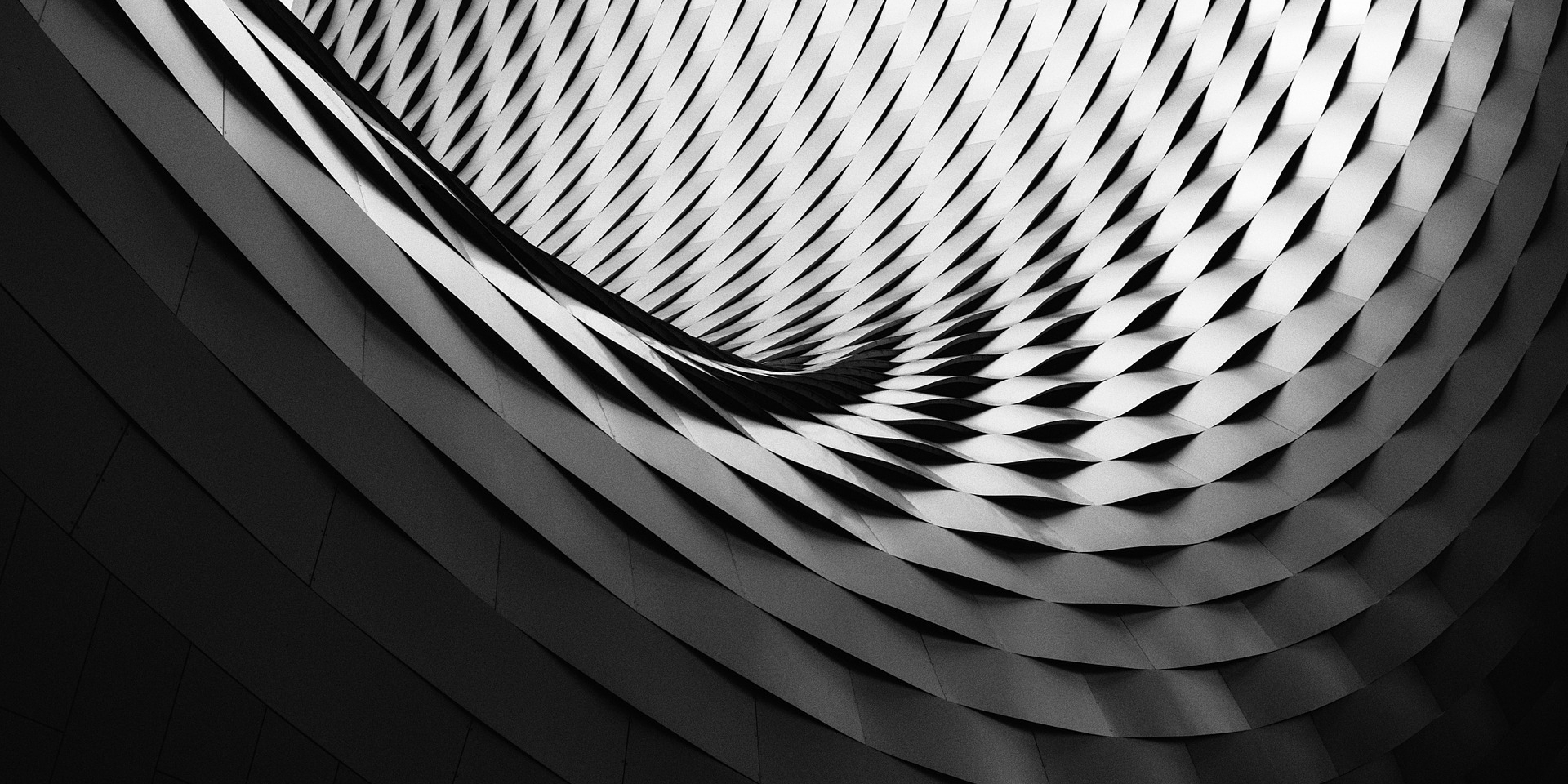Von Mandy Schünemann, Teilnehmerin am Workshop der taz Panter Stiftung
Von Mandy Schünemann, Teilnehmerin am Workshop der taz Panter Stiftung
Montag, 9.30 Uhr: Der Konferenzraum platzt aus allen Nähten, die Redakteurinnen und Redakteure der taz sind zur morgendlichen Sitzung gekommen. Kein Stuhl ist mehr frei; wer heute zu spät dran ist, muss stehen. So ergeht es auch meinem Kollegen Volker aus dem taz Panter Workshop; wir sind die einzigen beiden, die noch übrig geblieben sind. Mit 18 weiteren Nachwuchsjournalisten haben wir in den vergangenen vier Tagen beraten, geschrieben und produziert. Herausgekommen sind vier Spezial-Seiten zum Thema „Underground“, zu finden in der aktuellen Ausgabe der taz. Unser Werk ist damit vollbracht. Jetzt wollten Volker und ich nur noch eines wissen: Was sagt die taz selbst dazu?
Viel erwartet haben wir nicht, schließlich steht vor allem mit der dreifachen Katastrophe in Japan ein viel wichtigeres Thema an. Trotzdem hat man uns eine Minute Aufmerksamkeit geschenkt, sogar gleich zu Beginn: ein kurzes Lob, eine kleine Kritik. Anscheinend war doch nicht ganz verständlich, was die Damen und Herren im Keller der Spezial-Seite 1 von sich gegeben haben. Sonst war aber alles in Ordnung. Da frage ich mich: Ach ja? Gestern klang das noch anders. Da hat uns Elke Schmitter, Mitglied im Kuratorium der taz Panter Stiftung, ein „Feedback“, nein, besser gesagt: eine Blattkritik vom Feinsten gegeben. Und die fiel hart aus. Und war zerschmetternd.
Sicher, auch Frau Schmitter hat von vornherein betont: Sie schenkt uns Ihre Anerkennung für das, was wir geleistet haben. In kurzer Zeit vier Seiten zu einem bestimmten Thema fertig zu stellen, das sei nicht so leicht. Sie erinnere sich noch an die Zeiten, als sie während der Berlinale im Redaktionsbüro saß und Artikel in den Computer eingehämmert hat, die ihr via Telefon angesagt wurden. Wenig Zeit, viel Druck. So schaue das nunmal aus.

Es sind Kleinigkeiten, die einem jetzt, wo alles vorbei ist, auffallen. Eine Chefredaktion hätte für mehr Organisation der vielen Ideen sorgen können, eine Schlussredaktion hätte auch noch kleine Mängel aus dem einen oder anderen fertigen Artikel entfernen können. Ob das wirklich so gekommen wäre, weiß ich nicht. Schließlich muss man bedenken, dass ein Workshop-Teilnehmer, der von einem anderen kritisiert wird, diese Kritik vielleicht auch nicht ganz ernst nimmt – egal wie konstruktiv sie ist. Die Schuld für solche Kleinigkeiten weise ich aber weder den Teilnehmern noch den Organisatoren des Workshops selbst zu. Es ist eben nicht so leicht, wenn man 20 Jugendliche zusammenwirft, die völlig verschieden sind und die sich zum ersten Mal treffen. Da können auch die tazler nicht wissen, was ihnen bevor steht. Und die Jugendlichen wissen es noch weniger.
Trotzdem sind uns ja die vier Seiten gelungen. Und wir sind auch alle stolz drauf. Nur ist da die Blattkritik von Elke Schmitter, die noch hart im Nacken sitzt. Sie wusste nicht, wie der Workshop organisiert ist; sie wusste nicht, inwieweit wir vorher das Thema „Underground“ kannten; sie wusste auch nicht, dass manche von uns bislang noch nichts mit Journalismus am Hut hatten. Sie hat die Messlatte so hoch angesetzt, wie sie es auch bei jeder anderen Zeitung tun würde. Das wird uns aber nicht gerecht.
Ich kann gar nicht mehr wiedergeben, was Frau Schmitter alles kritisiert hat. Einige Aussagen in der Glosse seien unverständlich; das Editorial bringe nicht auf den Punkt, was denn nun „Underground“ eigentlich ist; fast alle Überschriften enthielten nur noch mehr Schlagwörter des Themas (= langweilig); Artikel und Interviews seien zu fromm geschrieben und geführt worden; vor allem aber: Keiner habe seine Meinung gesagt, keiner habe den „alten Säcken“ mal erklärt, wie das heute mit dem „Underground“ so aussieht. Tja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe weder im Untergrund gelebt, noch habe ich je im Leben was damit zu tun gehabt. Meine ersten Gedanken darum drehten sich, als ich die Zusage zum Workshop bekam. Und vielen ging es nicht anders.
Es ist schön und gut, mal zu erfahren, wie hart eine Blattkritik ausfallen kann. Ich habe nur die Sorge, dass das einige Teilnehmer jetzt so richtig verschreckt, die zum ersten Mal recherchiert, geschrieben und publiziert haben. Deshalb hier meine klare Ansage: Liebe Workshop-Kollegen, lasst euch bloß nicht entmutigen. Kritik gehört zum journalistischen Geschäft. Aber wir haben alle das absolut Beste rausgeholt – und dass unter solch deprimierenden Umständen, unter denen wir gearbeitet haben (wie auch, dass wir am Wochenende recherchieren mussten – zu einer Zeit, zu der keiner mehr erreichbar scheint). Die vier Spezial-Seiten in der heutigen taz-Ausgabe sind ein kleines Meisterwerk. Ich bin jedenfalls stolz darauf!