
Ich habe einen dreijährigen Sohn, der glaubt, dass alle Menschen bei der taz arbeiten, und der gerade so etwas wie einen verfrühten Ödipuskonflikt mit der taz austrägt, weil er sie seit Neuestem immer mit dem Adjektiv »böse« verbindet. Man könnte also sagen, er spiegelt mir, dass auch die taz ein Objekt meiner Liebe ist.
Das muss dann wohl so sein, und nicht nur für mich scheint sie das zu sein – oder wie anders könnte man erklären, dass hier talentierte Leute für viel weniger Geld viel mehr Arbeit leisten als die Kollegen in anderen Zeitungen, und wie anders könnte man erklären, dass es mittlerweile mehr als 12.000 Menschen gibt, die in dieses Projekt investieren?
Liebe, das ist ein großes Wort, und ich wäre ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen, dieses Wort in Bezug auf einen Arbeitsplatz oder eine Genossenschaft zu denken. Doch dann traf ich im letzten Jahr den britischen Theoretiker Terry Eagleton zum Interview, und wir sprachen über einen neuen Ansatz in der politischen Philosophie, der seit einigen Jahren immer wieder in den Schriften linker Denkerinnen und Denker auftaucht: Wir sprachen über die sogenannte »Politik der Liebe«. Mittlerweile ist das Thema auch bei der „Zeit“ angekommen und sie titelte letztens »Philosophen entdecken das Gefühl«.
Jedenfalls fragte ich Terry Eagleton, was um Himmels willen eine »Politik der Liebe« sein könnte, ob die, die davon sprachen, denn nun alle von einem spekulativen und pathetischen Tick befallen seien? Politik und Liebe, sind das nicht zwei ganz verschiedene Dinge, gehören die nicht völlig unterschiedlichen sozialen Sphären an? Und sollte man das Reden über die Liebe nicht lieber den Dichtern oder Psychoanalytikern überlassen? Er antwortete, es gebe eine konkrete Organisationsform, die das beschreibe. Nämlich die Genossenschaft.
Und er sagte, ich will ihn kurz zitieren: »Was bedeutet es, wenn das Erfüllen der Aufgabe, die einer hat, zugleich auch zum Vorteil des anderen ist, das ist ja wohl der Grundgedanke der Genossenschaft, wie ihn auch Karl Marx entwickelt hat. Die wechselseitige Erfüllung ist die Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft. Ein freies Bündnis von Genossen, die sich selbst regieren, das ist meiner Meinung nach politische Liebe. Und sie ist das Gegenteil von personengebundener Liebe.«
Ich dachte: Wow! Das ist zwar auch ziemlich pathetisch ausgedrückt, aber etwas ist doch vielleicht dran an diesem Gedanken. Ein freies Bündnis von Genossen, die sich selbst regieren – was da wie ein utopischer Entwurf klingt, ist das nicht ein kleines bisschen das, was wir hier in der taz-Genossenschaft leben? Oder besser: Ist das nicht zumindest der Kerngedanke, der das alles hier im Innersten zusammenhält? Gerade im Zuge der Krise erlebt die Genossenschaftsidee, wie sie im 19. Jahrhundert in der aufkommenden Arbeiterbewegung entstand und viel diskutiert wurde, eine gewisse Renaissance, wenn es um Alternativen zum bestehenden kapitalistischen Wirtschaften geht. Aber ganz so frei von Widersprüchen ist auch die Genossenschaftsidee nicht. Formulierte beispielsweise Karl Marx noch programmatisch für die »Internationale Arbeiterassoziation«, dass sie die Genossenschaftsbewegung als eine der möglichen Triebkräfte zur Überwindung der Klassengesellschaft anerkenne, so können wir gegenwärtig von keinem Geringeren als Philipp Rösler hören: »Die Genossenschaft ist Vorbild der sozialen Marktwirtschaft, sie ist die gelebte soziale Marktwirtschaft.«
Nun ist aus Rösler freilich noch kein Linker geworden. Sein Statement beschreibt einfach die schlichte Tatsache, dass Genossenschaften mittlerweile auch als ganz normale Unternehmen agieren. Aber, und das ist interessant, auch in der globalisierungskritischen Linken erhält die Idee eine Aktualisierung unter dem Begriff der »Commons«: Damit sind solidarische, unabhängige Ökonomien jenseits von Markt und Staat gemeint, in denen es um eine nachhaltige Nutzung von Gemeingütern – unseren natürlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen – geht. Womit wir wieder bei einem äußerst taz-affinen Thema wären. So gesehen hat das taz-Modell vielleicht gerade schon wieder so etwas wie Avantgardecharakter.
Dem publizistischen Projekt taz hat das Genossenschaftsmodell Überleben, Unabhängigkeit und Beweglichkeit ermöglicht. Es hat den allgemeinen Konkurrenzdruck verringert und auch vielen Menschen, die hier arbeiten, die Lohnarbeit erträglicher gemacht. Trotz der nötigen Selbstausbeutung, die nicht zu leugnen ist. Das kann natürlich nur funktionieren, solange die taz das Projekt von allen Mitarbeitenden ist. Avantgardecharakter hat die taz noch in einer anderen Hinsicht, nämlich in der, wie die freie Kreativität der Einzelnen konstituierend für das Ganze ist. Ein Aspekt, der immer wieder vorgebracht wird, wenn es um die Neugestaltung von Arbeit im gegenwärtigen Wissenskapitalismus geht.

Mehr Freiheit in der Arbeitsorganisation allein reicht eben nicht aus, wenn die gemeinsame Kreativität am Ende wieder von Einzelnen angeeignet wird. Die, die in die taz investieren, sind nicht an finanziellen Gewinnen interessiert, sondern an einer politischen Rendite. Und die ist nur zu haben, wenn die Kreativität der vielen nicht beschnitten wird. Das hat Konsequenzen für die – wie man das im Managerdeutsch nennt – Unternehmenskultur: Durchregieren – das geht in der taz nicht. Auch die jungen Leute, die zu uns kommen, sind fasziniert von dem Gedanken, dass es hier tatsächlich Spielräume gibt. Und das alles hat ja durchaus seine Außenwirkung – das schlägt sich nieder im Produkt, aber auch in der dazugehörigen Erzählung, die das Projekt hat. Und diese Erzählung ist nicht einfach eine aus den siebziger Jahren, sondern sie gehört in unsere Gegenwart, was meine Ausführung von vorhin, über die Idee der Commons, zeigen sollte. Die taz ist nicht das Eingenerationenprojekt, als das sie viele diskursiv entsorgen.
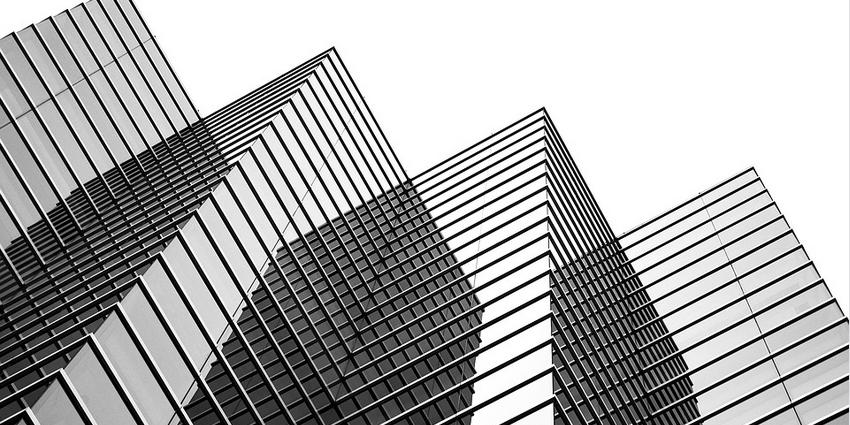



Souls in the Waves
Good Early morning, I just stopped in to go to your web site and imagined I’d say I appreciated myself.