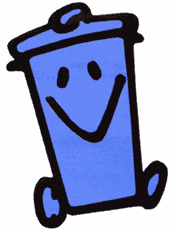 Schon wieder wurde ein Ermordeter in einer blauen Tonne aufgefunden,
Schon wieder wurde ein Ermordeter in einer blauen Tonne aufgefunden,
nachdem man ihm beide Beine abgesägt hatte. Die „grausige Tat“
ereignete sich im Essener Nobelviertel Bredeney. BILD berichtete (am
6.Juli). Das ist nun schon der achte deutsche Tote in diesem Jahr, der
in einer blauen Tonne endete. Europaweit (und rechnet man Russland, die
Ukraine, Georgien, Tschetschenien und Lettland dazu) waren es sogar
schon 72. Über den letzten Fall – in Essen – titelte die Bild-Zeitung:
„War es der Hausmeister?“ Denn die Polizei hatte als Tatverdächtigen den
„Hausmeister Tim H. (31)“ verhaftet, weil der angeblich die blaue Tonne
mit der Leiche bei einem Bekannten untergestellt hatte. Dieser war aber
irgendwann „wegen des Gestanks“ mißtrauisch geworden – und hatte sie
geöffnet. Nun darf man jedoch auch wegen der Tatverdächtigen mißtrauisch
sein, denn bei mehr als der Hälfte aller Blaue-Tonnen-Morde in Europa
hatte die jeweilige Polizei zunächst einen „Hausmeister“ der Tat
verdächtigt, wovon die überwiegende Mehrzahl früher oder später aber
ihre Unschuld beweisen konnte – und wieder freigelassen werden mußte.
Zurück blieben bei den Betroffenen Ärger, Unmut, ja Verbitterung und
sogar anhaltende Depressionen bzw. Schuldgefühle.
Während in den klassischen englischen und amerikanischen Krimis
meistens der Gärtner der Mörder ist (und die Leiche nicht selten im
Swimmingpool gefunden wird), scheint die europäische Öffentlichkeit eher
den Hausmeister als Täter zu favorisieren – und als Leichenversteck
zunehmend blaue Tonnen. Man könnte in diesem Zusammenhang von einer
schwarzen Romantik sprechen, bei der die berühmte blaue Blume sich zur
berüchtigten Tonne wandelte. Darüberhinaus hat sich aber noch etwas
geändert: Im sozialistischen Osten saßen die Hausmeister, Heizer und
Gärtner meist auf heißbegehrten „Schonplätzen“ – bei vollem
Grundlohnausgleich, im Westen werden sie dagegen eher als Deklassierte,
Verlierer – Gnadenbrötler also – begriffen. Während dort ihr Schonjob
den Kollegenneid erregte, sind sie es hier selbst, die angeblich von
Sozialneid zerfressen werden. So soll auch der „Hausmeister Tim H. (31)“
von seinem Opfer, einen Apotheker, der einen „Smart Roadster,
Sonderanfertigung (Wert über 30.000 Euro)“ fuhr, zunächst die
Geheimnummer der Kreditkarte erpreßt haben, mit der ein „Komplize (29)“
dann 2500 Euro abhob.
Nun bin ich als Hilfshausmeister nur gleichsam am Rande von dieser
Dämonisierung des Hausmeisters betroffen. Dennoch gilt es, solidarisch
zu sein, denn über die Hälfte aller europäischen Polizeien unterscheidet
hierbei gar nicht – zwischen Hausmeister und Aushilfshausmeister. Auch
der Essener Tim H. (31) war genaugenommen nur Aushilfshausmeister, wie
ein Anruf bei der für ihn nun zuständigen Staatsanwaltschaft ergab.
Ähnliches gilt für den Kiewer W. Timoschenko, der gleich fünf blaue
Tonnen mit mehreren von ihm angeblich ermordeten Mietern des Hauses, in
dem er als Hilfsheizer untergekommen war, füllte.
In der taz haben wir in jedem Stockwerk eine blaue Tonne stehen, dazu
noch eine im Archiv gegenüber und zwei als Ersatz im Keller. Das macht
summasummarum neun blaue Tonnen, die mit alten Zeitungen (den so
genannten Leichen im Keller der taz) gefüllt werden – sollen! Womit
schon gesagt ist, dass sie manchmal auch mit anderem gefüllt werden.
Deswegen hat der Hausmeister über jeder Tonne, die neben der
Fahrstuhltür aufgestellt werden, ein Schild angebracht: „In diese blaue
Tonne wirklich nur tageszeitungen“. Letzte Klarheit hat aber auch das
nicht gebracht, denn es ist nach wie vor unklar, ob der Hausmeister
wirklich nur tazzen meint – oder schlicht alles, was auf Zeitungspapier
gedruckt wurde. Selbst ich als Hilfshausmeister hatte bisher keine
Skrupel, gelegentlich auch mal einen Tagesspiegel oder eine
Nordsee-Zeitung in einer der blauen Tonnen zu entsorgen. Wenn sie voll
sind, muß der Hausmeister bzw. Hilfshausmeister sie abholen und auf dem
Hof abstellen – bis die angerufene Firma WIKO kommt, die sie gegen die
gleiche Anzahl leerer blauer Tonnen austauscht. Diese müssen dann wieder
auf den Stockwerken verteilt werden. So eine
Blaue-Tonnen-Austauschaktion kann also unter Umständen schon mal den
taz-Fahrstuhl für mehrere Stunden blockieren, was jedesmal zu kleineren
Protesten in der Belegschaft führt – dergestellt, dass einzelne
besonders Ungeduldige laut in den Fahrstuhlschacht schimpfen, wobei sie
jedoch nie persönlich werden, sondern höchstens schreien: „Welches
Arschloch hält da schon wieder den Fahrstuhl so lange an?“ Das geht nun
schon seit 1995 so!
Da gründeten arbeitslose Lehrer eine Recyclingsfirma nach der anderen –
besonders im Osten, wo diese „Umwelt-GmbHs“ bald sogar kostenlos mit
ABM-Kräften überschüttet wurden, sogar für ihre Sekretärinnen kassierten
sie „Wiedereingliederungsbeihilfen“, und bei der Einstellung von
„Schwervermittelbaren“ noch üppigere Zuschüsse. Die Westberliner und vor
allem Kreuzberger (Alternativen) lagen bei diesem Recyclingstrend
natürlich sofort ganz weit vorne, nur die Friesen (Ost-, Mitte- und
Nord-) waren wieder mal schneller. Wie übrigens auch bei den
Windkraftanlagen. Nicht umsonst ist der friesische Diplomlandwirt Peter
Ahmels Vorsitzender des deutschen Verbandes der WKA-Betreiber. Das
Startsignal gab allerdings der hessische Umweltminister Joschka Fischer,
als er behauptete: „Die Mehrkomponentenwertstofftonne ist eine völlige
Sackgasse!“
Seit dieser Zeit etwa gibt es in den besseren Wohngegenden immer mehr
farbige Tonnen – auch die allwöchentlich anfallenden rund 10 Zentner
taz-Leichen werden seitdem in Blaue Tonnen gestopft und von einer
Recyclingsfirma namens Wiko-GmbH abgeholt. Diese verfrachtete sie
anfänglich weiter an einen Papiergroßhändler und der verkaufte sie an
eine Papierfabrik, die daraus wieder neue Zeitungen machte. Neuerdings
entstehen daraus jedoch vor allem „Isoflocken“, mit denen man Eigenheime
isoliert. Dazu werden die tazzen erst einmal zerschnipselt, dann
gewässert, gesalzen und getrocknet. So oder so spart das Verfahren
kostbaren deutschen Wald, ganz zu schweigen von den Lohnnebenkosten, die
sonst für all die finnischen, schwedischen und österreichischen
Holzfäller-Brigaden in unseren einheimischen Forsten anfallen würden.
Zwar fallen dabei tausende von LKW-Kilometern an, aber es ist trotzdem
ein gute Sache – ökologisch-holistisch gesehen. Wenn wir an die
australischen Aborigines denken, denen es nicht darauf ankommt, so viel
wie möglich aus der Erde bzw. der Natur heraus zu holen, sondern darum,
sie möglichst genau so wie sie ist zu erhalten, dann liegt der
Herstellung von neuen tazzen aus in den Kreislauf wieder eingespeisten
alten tazzen eine Art Uraborigines-Gedanke zugrunde, wie er im übrigen
vielen nomadischen Völkern eigen ist. Man spricht dabei hier und heute
von Nachhaltigkeit.
Eine zeitlang wurde in der taz und nicht nur dort sogar laut vom
„papierlosen Büro“ geschwärmt. Dahinter stand der jobnomadische Gedanke,
dass die Vernetzung der Computer zusammen mit der allgemeinen Gewöhnung
an bloß noch virtuell existierende Texte (Daten) unweigerlich zu einer
Eindämmung der Papierflut führen würde, die täglich in Form von
Einladungen, Prospekten, Konzepten, Rechnungen, Faxen und Manuskripten
vom Hausmeister in die Postfächer der einzelnen Abteilungen verteilt
wird, aber auch von den Mitarbeitern fleißig selbst produziert wird,
indem sie alles gegoogelte und gemailte erst einmal ausdrucken – wozu
die neuen blitzschnellen Laserdrucker geradezu einladen. Oft genug
reicht es den Leuten schon bewußtseinsmäßig aus, bloß das Rattern des
Druckers hinter sich zu hören, um sich dem nächsten Gegenstand ihres
Interesses zuzuwenden, so dass sich in der Druckerablage oder daneben
die ausgedruckten Seiten stapeln, die niemand mehr haben oder lesen
will. Irgendwann landen sie wohlmöglich in einer der blauen Tonnen. Die
Superdrucker haben inzwischen sowohl die Fax- als auch Kopiergeräte auf
den Etagen fast ersetzt. Und der täglich Abfallpapieranfall ist damit
noch mehr gestiegen – so dass seine heimliche Einschleusung in den
Sekundärrohstoff-Kreislauf der alt-neuen tazzen einer
Sekundärrationalisierung gleich kommt. Und genauso vergeblich ist sie
denn auch, immerhin arbeiten die Blitz-Drucker aber schon mal mit
„ungebleichtem Umweltpapier“.

Wenn ich für das Auswechseln der Blauen Tonnen in der taz verantwortlich
bin, dann halte ich immer einige volle Tonnen zurück. Ihr Inhalt wird
extra abgeholt – von Toku, dem Freund meiner kenianischen Nachbarin
Adisha. Sie hat ein Hüftleiden und kann nicht arbeiten, aber einmal im
Jahr schickt sie einen vollen Übersee-Container nach Hause, den sie mit
allerlei kaputter Elektronik und Möbelteilen aufgefüllt hat. Ständig ist
sie auf der Suche nach brauchbaren Sachen, die nichts oder nur wenig
kosten – und die sie zunächst in ihrem Keller und in ihrer Wohnung
lagert. Seit 2002 gehören dazu auch einige Zentner Alt-tazzen, zuletzt –
2005 – waren es schon fast zehn Zentner. Die Zeitungen dienen ihr zum
einen als Füllmasse, um die Gegenstände im Container zu schützen – und
zum anderen für ihre Freundinnen daheim, die durchweg als Marktfrauen
arbeiten und die tazzen zum Einwickeln ihrer Ware brauchen. Ich stell
mir das sehr schön vor, wie Adisha, die mit dem Erlös aus dem Container
ihren jährlichen Heimataufenthalt finanziert, die ganzen Zeitungen an
ihre Freundinnen verteilt und schon bald darauf tausende von
KenianerInnen mit einer taz unterm Arm durch die Stadt laufen. Einige
werden später von Ziegen gefressen, manchmal versucht auch jemand, eine
Überschrift zu lesen. Zuletzt wird damit aber der Herd angezündet – und
das wars dann. Indem sich dergestalt die tazzen in Kenia in blauen Dunst
auflösen, sind sie wirklich virtuell geworden. So viel zu den Blauen Tonnen.
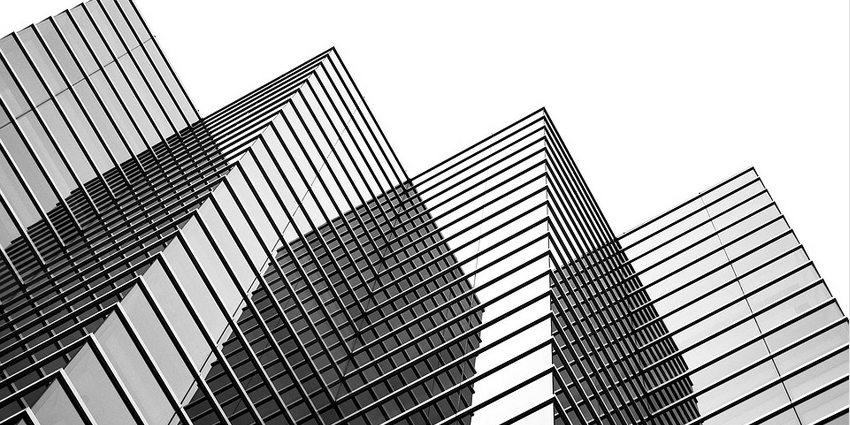



tja….wer den Spott hat, hat nicht den Schaden!
Ehrlich gesagt, find ich es nicht lustig!
Ein Menschenleben wurde genomme und in eine blaue Tonne gesteckt!