Hausmeister halten sich – im Gegensatz zu Aushilfshausmeistern – gerne Bienen. Auf der derzeit blühenden taz-Dachterrasse lebt eine Hummel – die für den Garten dort verantwortlichen nennen sie Emma. Auch Wladimir Kaminer, der gerade ein Buch über seinen Pankower Schrebergarten schreibt, kommt immer wieder auf Hummeln zu sprechen, die ihm freier als die (staatenbildenden) Bienen zu sein scheinen. Seine Tochter Nicole verfaßte daraufhin sogar einen Hummelrap. Neulich fand auf der Dachterrasse mal wieder eine taz-Abschiedsparty statt, ich glaube, es war wegen Silke aus dem Vertrieb, die für ein Jahr nach Holland geht, um dort ihr Kapitänspatent zu machen, es kann aber auch wegen Petra gewesen sein, der Chefredaktionsassistentin, die demnächst ihren Pilotenschein macht. Auf alle Fälle meinte eine mir unbekannte Frau auf der Dachterrassen-Party, dass diese Location sehr gut zum Aufstellen ihrer Bienenkörbe geeignet sei. Ich gab zu bedenken, dass dort wegen des beschissenen Öko-Hochhauses der US-Wohnungsbaugesellschaft GSW nebendran immer ein starker Wind wehe. Sie erwiderte jedoch, dass das ihren Bienen nichts ausmachen würde. Dennoch meldete sie sich nie wieder bei der taz. Dafür erfuhr ich jedoch, dass es in der besonders grünen Stadt Berlin von Imkern und Imkerinnen nur so wimmeln würde. Darüberhinaus gibt es hier auch noch, und das schon lange, eine starke Bienenforschung.
An der FU ist es das Institut für Tierphysiologie und Angewandte Zoologie unter der Leitung des Neurobiologen Professor Randolf Menzel. Dort ist auch ein Imkermeister beschäftigt. Wenn die angehenden oder schon angegangenen Wissenschaftler ihn allzusehr mit Fachfragen bedrängen, sagt er – etwas spöttisch: „Ihr seid doch die Bienenenforscher.“
Diese Bemerkung deutet auf einen alten Konflikt zwischen Kopf- und Handarbeiter hin, der spätestens in der Renaissance seinen Anfang nahm – als aus dem Handwerkerstand das neue besitzlose Proletariat erwuchs, dessen Kraft nur noch als Kollektiv existierte. Aber vereinzelt auch die ersten Künstler und Wissenschaftler daraus hervorgingen, die vom Verkauf ihres (infolge der Waffenproduktion und des Festungsbaus sich stürmisch entwickelnden naturwissenschaftlich-technischen) Wissens lebten – und zwar nicht selten an Handwerker, die sie damit mehr und mehr zu bloßen Ausführern machten, weswegen man bald stets, wenn sie sich dagegen auflehnten, einen (gebildeten) Anführer dahinter vermutete.
Gestört wurde daneben auch die Beziehung zwischen denen, die mit Pflanzen umgehen – arbeiten (Bauern, Kleingärtner, Kräutersammler, z.B.) und denen, die sie erforschen: den Botanikern. Diese Trennung von Theorie und Praxis, von Experten und Laien, Berufenen (Profis) und Amateuren (von Amator – jemand, der liebt ohne Gegenliebe zu verlangen), – das war am Anfang der Disziplin noch anders. Einer der ersten systematischen Naturforscher, Aristoteles, schöpfte noch ausgiebig aus dem Wissen der Bauern, Winzer, Fischer, Jäger, Imker und Viehzüchter. Gleiches gilt dann wieder für die frühen deutschen Forscher – die Äbtissin Hildegard von Bingen und Paracelsus z.B., die das Wissen von Kräuter- und Heilkundigen sammelten. Umgekehrt verfaßte aber auch noch der Straßburger Fischer Leonhard Baldner 1966 ein Vogel- und Fischbuch, in dem laut Adolf Portmann erstmalig die Paarung von Libellen geschildert wurde. Aber die Trennung war nicht aufzuhalten. Bis dahin, dass die brandenburgische Regierung 2005 es allen Landbewohnern in toto verbot, Kräuer- und Blätter zu sammeln, um sie verarbeitet oder unverarbeitet weiter zu verkaufen: Dies sei nur Botanikern und Pharmazeuten – mithin der Chemieindustrie! – erlaubt. Diese Pflanzen und Pflanzenteile waren bis dahin das letzte in der so genannten Natur gewesen, das man noch als „Gemeinbesitz“ bezeichnen und nutzen durfte.
Im Pariser Jardin des Plantes tat sich daneben bereits Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Spaltung auf – in der Wissenschaft selbst, die sich in der Funktion eines Professors, der dozierte, und eines „demonstrateurs“, der zeigte, institutionalisierte: als Vertreter einer deduktiv-spekulativen und einer empirisch-induktiven Methode. Ihr Streit wurde bisweilen offen ausgetragen: Während z.B. der Professor Bourdelin seine Vorlesung mit den Worten beendete: „…Wie Ihnen der Herr Demonstrateur durch seine Experimente sogleich beweisen wird“, begann der Demonstrateur Rouelle, er wurde später Mitbegründer der Chemie in Frankreich, mit den Worten: „… Alles, was der Herr Professor gesagt hat, ist absurd und falsch, wie ich Ihnen sogleich beweisen werde.“
Gegenüber den Laien oder Facharbeitern und ihrer Praxis ist das Verhältnis der Wissenschaftler und Theoretiker nicht selten von Ignoranz geprägt. Selbst wenn es beide schließlich in einer Person betrifft. So berichtete z.B. der gelernte Melker und spätere Diplomagraringenieur Hanns-Peter Hartmann: „Ich studierte dann an der Hochschule für LPG in Meißen. Meine Abschlußarbeit hieß ‚Vorschläge zur Erweiterung und rationelleren Nutzung moderner Milchproduktionsanlagen‘. Für die Note 1 oder 2 mußte man eine noch nicht ins Deutsche übersetzte sowjetische Arbeit als Quelle benutzen. Ich fand eine von Admin und Savzan aus dem russischen Versuchsbetrieb Kutusowska, in der es u.a. darum ging, den Färsen zwei mal täglich die Euter zu massieren: das würde die Milchleistung später um ca. 1 Liter täglich erhöhen. Als Praktiker nahm ich diese Empfehlung jedoch selbst nicht ernst: Wer hätte dafür Zeit gehabt, allen Färsen die Euter zu massieren und wieviel das gekostet hätte – dieses zwei mal tägliche Als-Ob-Melken?! Außerdem standen die meisten Färsen in den sogenannten Chrustschowschen Offenställen, in denen sie frei herumliefen: Da wär man gar nicht so ohne weiteres an die rangekommen.“
Daneben treten die Experten und Profis insgesamt gegenüber den Laien auch manchmal allzu pädagogisch auf – und werden unverschämt, wie sich z.B. dem Werbezettel der „Pilzberatung“ des Botanischen Gartens an der FU entnehmen läßt: „Stolz präsentieren die Sammler ihre Funde, und neugierig sind sie, was der Nachbar im Korb trägt. Mit ihren Kenntnissen wollen sie imponieren oder einfach dazulernen. Selten kommt noch einer mit der Bitte, nur Eßbares aus einem wüsten Sammelsalat auszusortieren…Pilzberatung muß zur Entzauberung beitragen.“
Vielleicht hat diese Einstellung sogar die Facharbeiter im Botanischen Garten nach und nach demotiviert: Im „Führer“ steht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Wiederbeginn normaler wissenschaftlicher Grundlagenforschung, die Zeiten vorüber waren, in denen die Gärtner mehr oder weniger selbständig Um- und Neupflanzungen vornehmen konnten. Wie ist das zu verstehen? fragte ich vor einiger Zeit den Wissenschaftler Dr. Zepernick, der im Botanischen Museum des Gartens arbeitet, wo auch unser großes Vorbild, der Weddinger Antifaschist Oskar Huth, während des Krieges als Botanischer Zeichner untergekommen war. Dr. Zepernick meinte: „Diese Entwicklung begann eigentlich schon nach dem Ersten Weltkrieg. Ich weiß nicht warum, aber es ist früher so gewesen, dass die Gärtner teilweise auch noch wissenschaftlich gearbeitet haben. Es gibt z.B. verschiedene Werke, die von einem Gärtner herausgegeben worden sind und vom Obergärtner bzw. vom Gartendirektor. Ob die Gärtner keine Lust mehr haben, oder ob sie von den Wissenschaftlern übern Mund gefahren worden sind … Aber es ist eigentlich schade. Unser gegenwärtiger oberster Gärtner, der ist von Hause aus genaugenommen Techniker, der kümmert sich z.B. um Wegebau und dergleichen. Darüber hält er auch Lehrveranstaltungen ab an der Fachhochschule für Gartenbau. Dass der keine Pflanzen beschreibt, ist verständlich. Aber es sind ja noch eine Reihe von Gärtnermeistern da. Darunter kommen dann die Reviergärtner, dann die Gärtner und dann die Gartenarbeiter – das sind insgesamt etwa 200 Leute. Von den Wissenschaftlern hält manchmal jemand einen Vortrag, da kommen dann daneben auch noch Studenten hin. Sehr gute Vorträge macht übrigens Herr Ern, der ist Pflanzengeograph und Ornithologe und beschäftigt sich schon seit langem mit dem Gebiet der Save, das ist ein Fluß in Jugoslawien. Aber ansonsten ist das alles nicht so doll, also ich meine: es kommt nicht so oft vor.“ Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Botaniker hier das Gespräch mit den Gärtnern abgetrennt und in Form einer Belehrung institutionalisiert, wobei dieses „Geschäft“ nun von beiden Seiten immer lustloser betrieben wird. Auf der anderen Seite hatte auch der neue Direktor den früher regelmäßig stattfindenden „Jour Fixe“ mit seinen Wissenschaftlern, an einem runden Tisch mit Kaffee und Gebäck, gerade abgeschafft – was Dr.Zepernick sehr bedauerte.
Im Starnberger Institut für Verhaltensforschung – zu Zeiten von Konrad Lorenz und seines Nachfolgers – nahm auch der Tierpfleger noch regelmäßig an den Gesprächsrunden der Wissenschaftler teil. Auch hier scheint dann aber eine Trennung erfolgt zu sein. Vermutlich hing die Zusammenarbeit an den Personen, wie man so sagt. Dass die Hand- und Kopfarbeiter sich generell immer weiter voneinander entfernen, hängt aber nicht zuletzt auch mit den Wissenschaftskonjunkturen zusammen, denen die Forschungs- und ihre Finanzierungsfragen folgen (müssen). Sowie auch mit den für die Experimente entwickelten und immer teurer werdenden Hightech-Geräten in den Labors. Damit bewegen sich die Forscher längst „unterhalb einer Sichtbarkeitsgrenze“, bei der ihnen die anderen schon allein aus Kostengründen nicht mehr folgen können. In den Labors hat man es vor allem mit immer mehr Daten zu tun, die interpretiert werden müssen.
Laut dem „Pressedienst Wissenschaft“ und anderer Internetseiten wollten die Berliner Bienenforscher von Professor Menzel zuletzt herausbekommen, wie die Bienen Informationen aus beiden Hirnhälften miteinander verarbeiten, wobei es primär um ihre Orientierung anhand von Düften ging: „Bienen können dreidimensional riechen“, entnahm ich einem Zwischenbericht. In einem anderen Projekt wurde eine Methode entwickelt, „mit der man selektiv die Ausgangssignale des Antennallobus messen kann.“ Bei diesem „Integrationszentrum der Duftwahrnehmung“ von Insekten, wie es auch genannt wird, „können Input- und Output-Signale … miteinander verglichen werden, was Aufschluß gibt, welchen Beitrag die verschiedendsten Hirnzellenarten der Biene im Antennallobus bei der Duftverarbeitung leisten.“ Der Biologietheoretiker an der FU Werner Backhaus beschäftigt sich mit den „Gegenfarbenneuronen“, die vor einiger Zeit auch bei Bienen entdeckt wurden. Es geht ihm dabei um die Frage, ob auch Bienen Elementarfarben sehen, aus denen ihre Farbeindrücke bestehen: „Sehen sie also wirklich Farben oder funktionieren sie eher wie Roboter, bei denen ein bestimmter Reiz nur eine Vielzahl komplizierter elektrischer Impulse auslöst, deren Gesamtheit am Ende eine Reaktion zur Folge hat?“ heißt es dazu in einem Beitrag von Thomas Fester.
Wie ich feststellen konnte, interessieren diese und ähnliche materialistisch-reduktionistische Fragestellungen, die auf Veröffentlichung in „Science“ oder „Nature“ hoffen können, zwar auch die Imker, aber gleichsam nur am Rande – flüchtig. So schwärmte z.B. die Kreuzberger Imkerin Rita Besser mir gegenüber von einer ganz anderen Dreidimensionalität bei den Fühlern der Bienen: „Sie können damit nicht nur riechen, sondern auch hören und tasten.“
Im übrigen machen die Handarbeiter ihre Erfahrungen manchmal fast unbeabsichtigt. So wie ein Kollege des Schriftstellers Bohumil Hrabal in der Altpapiersammelstelle von Prag, der ständig mit den von der Regierung verbotenen sowie aussortierten Büchern zu tun hatte – und dabei „gegen seinen Willen,“ wie er sagte, „gebildet wurde“. Einige Handarbeiter (oder Praktiker) sind anscheinend sogar völlig immun gegen das Wissen, das im Laufe der Zeit für ihre Branche oder Passion angehäuft wurde – z.B. die Jäger. Der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger bemerkt – in einem Kapitel über Kaninchen in seinem Buch über die Tierwelt der Alpen: „Das Freileben dieser interessanten Nager ist erst in den letzten Jahren erforscht worden. Auch hier hat es sich gezeigt, dass das Jagen im Grunde wenig Gelegenheit zum Beobachten bietet, die Kaninchenjagd schon gar keine. Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung.“ Während der leidenschaftliche Jäger und Angler Paul Parin als Psychoanalytiker, aber auch Naturforscher behauptete, die Jagd habe zumindestens für seinen Vater eine soziale Funktion gehabt, die seiner ganzen Familie zugute kam, schreibt Leo Trotzki, der zwar auf dem Land aufwuchs, aber sich nie sonderlich für „die Natur“ interessierte – in seiner Autobiographie: „Das Verlockende der Jagd besteht darin, daß sie auf das Bewußtsein wie das Senfpflaster auf eine kranke Stelle wirkt…“ Er ging sogar während seiner kasachischen Verbannung auf die Jagd und im daran sich anschließenden Istanbuler Exil bat er sogleich seine Deutschübersetzerin, ihm von Berlin aus eine besonders reißfeste Angelschnur aus England zu besorgen. Bei Trotzki dienten die Tierbeobachtungen implizit, bei Parin explizit der eigenen Triebabfuhr bzw. -entspannung, die im geglückten Schuß bzw. Fang sich entlädt. Genau umgekehrt war es lange Zeit bei den Naturforschern, die erst ganz am Schluß ihr Beobachtungsobjekt erlegten – und dann zerlegten. In der modernen Molekularbiologie steht die Umwandlung ihrer „Modellorganismen“ in bloße Biomasse dagegen oft am Beginn der Forschung – wenn z.B. für einen Versuch zentnerweise Rattenlebern herausgeschnitten werden, um sie hernach zellfrei zu zentrifugieren.
Um die sich immer mehr auftuenden Kluft zwischen Praktikern und Theoretikern, Laien und Experten, Amateuren und Professionellen zu überbrücken, ist der Wissenschaftsjournalismus angetreten – bis hin zum „Discovery Channel“ und den „Hobby-Zeitschriften“, wie etwa die deutschen „Reptilia, „Draco“ und „Koralle“, in der grob gesagt Arbeiter genauso wie Akademiker ihr gesammeltes Wissen über Reptilien, Amphibien, Insekten, Korallen etc. veröffentlichen, daneben auch noch in Hochglanz-Monographien. Darin ist wirklich „kein einziges Merkmal, das nicht gleichzeitig real, sozial und narrativ wäre“, wie es Bruno Latour in bezug auf die Werke der Ethnologen sagt, die – egal, wo man sie hinschickt, „immer mit einem einzigen Bericht“ zurückkommen. „Den Mut, in der Fremde zu vereinheitlichen, haben sie jedoch nur, weil sie bei sich zu Hause sauber trennen.“ In diesem Fall ist es die Abtrennung des Hobbys vom Beruf, wobei sich unter den Reptilienfreunden aber auch viele finden, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und umgekehrt. Im Editorial der Zeitschrift „Koralle“ wünscht sich der Chefredakteur eine engere Zusammenarbeit zwischen Aquarianern und Wissenschaftlern: „Dadurch bekäme das Hobby Meeresaquaristik eine noch wichtigere Funktion, denn kein Wissenschaftler der Welt kann das leisten, was Tausende engagierter Aquarianer als ‚Freizeitbiologen‘ in unzähligen Stunden an Beobachtung einbringen, mit einem Miniatur-Korallenriff in ihrem Wohnzimmer.“ Sein Vorschlag läuft auf eine gemeinsame Arbeitsgruppe hinaus, dabei leistet die Zeitschrift bereits so etwas Ähnliches – und das auf hervorragende Weise, wobei es allerdings merkwürdig oder eben noch typisch warenförmig ist, dass die alte Trennung zwischen Laien und Experten ausgerechnet im Konsumenten aufgehoben wird.
Daneben gibt es zwischen Wissenschaftlern und Praktikern aber auch eine kalte Verachtung. Auf einer Verkaufsveranstaltung einer Pharmafirma über ein neues Mittel gegen Bienenkrankheiten entwickelte sich eine kurze Diskussion zwischen dem wissenschaftlichen Referenten und einem Imker. Dieser hatte über seine Erfolge mit einem bestimmten „Kräutermix“ und die dafür selbst konstruierte Technik zu ihrer Anwendung berichtet – welche das zuvor angepriesene neue, aber teure Mittel entbehrlich machen würden. Der Referent im weißen Kittel tat dies mit einer Handbewegung ab: „Ja, ich weiß,“ sagte er lächelnd, „was da in den Imkereien manchmal so zusammengebraut- und gebastelt wird.“ Alles lachte mitwisserisch – und der Imker – in grauem Kittel – schlich wütend und beschämt aus dem Saal.
Umgekehrt erzählte die Weddinger Imkerin Ramona Mai, der 2002/2003 fast die Hälfte ihrer Bienenvölker einging, dass sie die Stöcke in der Nähe von Mais- und Rapsfeldern aufgestellt hätte, deren Saatgut mit einem starken Gift gebeizt worden war. Nachdem sich ihr Mann mit dem dabei verwendeten Pflanzenschutzmittel näher befaßt und darüber auch mit französischen Imkern korrespondiert hatte, besaß sie genug Beweise für ihren Anfangsverdacht, „dass diese Mittel für Bienen schädlich sind“. Auf den Einwand, dass das Bieneninstitut Hohen Neudorf, wo sie zu DDR-Zeiten noch ihre Ausbildung als „Tierwirtin mit der Spezialisierung Imkerei“ absolviert hatte, einen solchen Zusammenhang zwischen der Saatbeize und dem Bienensterben für nicht eindeutig belegt halte, antwortete Ramona Mai: „Sehen Sie, die Institute müssen von irgendwas leben. Die Forschung über Schädlinge, vor allem die Varroa-Milbe, ist eine wichtige Geldquelle. Gerade Hohen Neuendorf kriegt Millionen dafür, dass sie die Milbe erforschen. Wenn die jetzt plötzlich kein Problem mehr wäre – was ist denn dann mit dem Institut?“
Dies legt nahe, dass die Forscher nicht dafür bezahlt werden, dass sie die Vergiftung durch Saatgut-Beize nachweisen, sondern eher die Bienen resistent dagegen zu machen versuchen. Die Vergiftung ihrer Völker stellte sich der Weddinger Imkerin so dar: „Die Bienen sind auf dem Feld, verlieren die Orientierung und finden nicht mehr zurück. Am Stock stellt man nur fest: Die Völker werden schwächer, entwickeln sich nicht, brüten wie verrückt und haben trotzdem keine Bienen oder die Bienen kommen nicht mehr zurück. Im Sommer füttern sie die Brut mit verseuchten Rapspollen, und die Jungbienen sind vergiftet und schwach, wenn sie auf die Welt kommen. Als wir mit unseren Stöcken im Oderbruch noch in die Sonnenblume wanderten, war es besonders schlimm. Dort sind Mais- und Sonnenblumenfelder gebeizt.“
Meine eigenen Recherchen ergaben später: Es handelte sich dabei wahrscheinlich um die Präparate Imidacloprid bzw. Fipronil in den Pestiziden „Gaucho“ von Bayer und „Regent“ von BASF. Beide wurden auf Druck der Nationalen Union der Französischen Imker (UNAF) Anfang 2004 in Frankreich verboten, später auch in Deutschland. Die BASF protestierte gegen das Verkaufsverbot ihres Produkts: Bei „sachgerechter Anwendung“ (das genaue Gegenteil von „Zusammenbrauen und -basteln“) bestehe „kein Risiko für Bienen“, meinte der Konzern in einer Presseerklärung. Bereits 2005 – ein Jahr nach dem Verbot – hatten die Imker jedoch „wieder Bienenvölker wie vor der Gaucho-Ära,“ teilte der UNAF-Präsident Henri Clément der „Le Monde“ mit. Um zu beweisen, dass diese Pestizige für „Verhaltensstörungen bei den Bienen und für das Bienensterben“, das 30-50% der Völker dahinraffte, verantwortlich waren, hatten sich die französischen Imker mit Bauern sowie Chemielaboranten zusammengetan – in einer Art „Kompetenzteam“. Letzere sind in der Branchenorganisation der Basisgewerkschaft SUD aktiv, die sich nicht nur um Lohn- und Arbeitsplatzprobleme, sondern auch um Produktfragen kümmert – u.a. deren Umweltverträglichkeit betreffend. In den Forschungs- und Entwicklungslabors der Industrie bzw. der Universitäten sind die Chemielaboranten so etwas wie die Handarbeiter der Laborleiter und -wissenschaftler: Sie werden von ihnen zwar mehr als die Doktoranden gehätschelt, bekommen jedoch im Falle eines mißlungenen Experiments als erstes deren arbeitgeberlichen Zorn zu spüren. Wenn dagegen alles gut läuft, sind die Forscher sofort verschwunden, um auf irgendwelchen Konferenzen darüber zu referieren, wie der französische Wissenschaftsforscher Bruno Latour meint. Nur wenigen Einrichtungen gelingt es, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit in ihren Arbeitskollektiven zu überwinden.
Berühmt war dafür einmal das Wiener Vivarium, dessen Amphibienpfleger Albert Weiser das Herz und die Seele des Instituts war. Aber auch der dortige (lamarckistisch-inspirierte) Forscher Paul Kammerer galt als ein begnadeter Amphibienzüchter, dessen wissenschaftliche Abhandlungen jedesmal lange und für die Biologen irritierende Ausführungen über die Haltung und Pflege seiner Versuchstiere enthielten. Ein derartiger „Geist“ der gegenseitigen Annäherung wurde ansonsten vor allem in den sowjetischen Forschungs- und Entwicklungslabors gepflegt. Noch 1996 traf ich am Baikalsee auf ein Kollektiv von Atomphysikern, die dort im See mittels Photomultipliern Neutrinos „angelten“ – und dabei z.B. einige Wissenschaftler abgestellt hatten, die sich in Irkutsk um Verpflegung, Transport, Bettwäsche und dergleichen zu kümmern hatten – jedoch weiterhin als Autor der wissenschaftlichen Publikationen des Forschungskollektivs in Erscheinung traten. Was die beteiligten ostdeutschen Atomphysiker, die gerade erst vom Westen übernommen worden waren, schon ziemlich „irre“ fanden. Am Baikal war diese Arbeitsteilung noch so neu, dass sie noch nicht vollständig vollzogen war – und zudem bloß den Finanzproblemen der postsowjetischen Forschung geschuldet, von denen man hoffte, dass sie nur vorübergehend seien. An sich ist die Arbeitsteilung in der Sowjetunion sogar noch weitergehender als im Westen gewesen, sie wurde jedoch mit den Kollektiv- und Brigade-Systemen gleichsam überklammert. Zudem verpflichtete der „wissenschaftliche Sozialismus“ und vor allem die Ideologie von den Arbeitern als der herrschenden Klasse mindestens zu einer gewissen Kollegialität zwischen Kopf- und Handlangern, wobei letztere oftmals mehr verdienten als erstere. Dieses Prinzip wurde nach der Wende sofort abgeschafft: Mindestens die ostdeutschen Atomphysiker verdienen heute fünf mal so viel wie deutsche Arbeiter; im Vergleich zu den vor Ort rekrutierten „Hilfskräften“ ihres Baikalprojekts sogar mehr als hundert mal so viel.
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Westberliner alternative „tageszeitung“, die 1978 einen „Einheitslohn“ für Kopf- und Handarbeiter beschloß und zudem „Setzerbemerkungen“ in den Texten zuließ. Beim Westberliner Tagesspiegel, wurden dagegen die Redakteure in den Sechziger- und Siebzigerjahren bei ihrer Einstellung regelrecht darauf verpflichtet, sich im Falle eines Streiks der Drucker und Setzer nicht mit ihnen zu solidarisieren. In der DDR hat man nach neuen Formen der Kooperation zwischen ihnen gesucht: Für Westler war es immer wieder spannend mitzuerleben, wie sich dies von Fall zu Fall gestaltete – wenn z.B. einige Reisekader aus dem Osten mit ihrem Chauffeur hier in einem Hotel abstiegen: Was für merkwürdige Eiertänze die Funktionäre um den Arbeiter aufführten – an der Bar und im Frühstücksraum. Im Maße die Fahrer und andere Dienstleister selbständiger und selbstbewußter wurden, änderte sich dieses Verhältnis auch im Westen. Inzwischen gibt es schon ganze Forschungsberichte z.B. über den seltsamen Umgang von Westberliner Akademikern mit ihren polnischen Putzfrauen – auch von polnischer Seite.
Die Berliner Imkerin Ramona Mai bekam bereits mit zehn Jahren ihre ersten Völker zur Pflege: von ihrem Vater, und durfte – „ganz wichtig“ – den Gewinn aus dem Honigverkauf behalten. „Das war zu DDR-Zeiten eine lukrative Sache“. Nach der Wende gaben dagegen viele Imker auf: Es lohnte sich nicht mehr. In Ramona Mais Familie werden schon seit fünf Generationen Bienen gezüchtet. „Ich saß bereits mit drei Jahren bei meinem Vater und seinen Stöcken, nur in meinem Spielhöschen. Meine Mutter war immer völlig aufgelöst, aber das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen.“ Nach ihrer Ausbildung als Imkerin studierte sie jedoch erst einmal „Saat- und Pflanzgut“ und wurde Agraringenieurin. Danach arbeitete sie als Buchhalterin in einem Büro. Nach der Wende schulte sie sich zur Steuerfachgehilfin um. Erst als sie sich dann neu verheiratete – und ihr aus Frankreich stammender Mann einen Käsehandel eröffnete, machte auch sie sich selbständig: als Imkerin. Mit ihren derzeit 25 bis 30 Völkern ist es immer noch ein Nebenerwerb für sie: „Erst ab 100 Völker gilt man als Berufsimker“. Wie diese verrät sie dem Interviewer (*) jedoch ebenfalls nicht, wieviel Honig sie im Jahr produziert: „Das erzähle ich noch nicht einmal meinen Imkerkollegen. Bei den Anglern ist es genau andersherum: Die Fische werden immer größer, bei uns Imkern werden die Honigmengen immer kleiner. Schon in den Büchern geht dieses Tiefstapeln los: Glaubt man den Angaben, braucht man mit Bienen gar nicht erst anzufangen, weil es sich nicht lohnt. Wegen der Verschwiegenheit der Imker kommt man übrigens auch beim Thema Völkerverluste nicht zu Potte. Niemand gibt gerne zu, dass ihm Völker wegsterben.“
Die Kreuzberger Imkerin Rita Besser erzählte mir dagegen gerne, wieviel Honig ihre zwei Bienenvölker produzieren, die für ein kleines Halbliterglas 2,5 Millionen Blüten anfliegen müssen: „Etwa 30 Kilogramm ernte ich im Jahr, wobei ich den Bienen einige Kilo, drei oder vier Waben, lasse sowie den ganzen Pollen – für den Winter. Das ist bestimmt gesünder für sie, als wenn ich ihnen stattdessen Zucker hinstellen würde, wie es üblich ist. Den meisten Honig verbrauche ich selber, ich backe auch damit, den Rest verkaufe ich – hier im Haus, damit die Mieter auch was von meinen Bienen haben.“ Rita Besser hat seit zehn Jahren Bienen. Einmal, als sie im Urlaub war, verlor sie einen Schwarm, ein andern Mal schwärmte die Königin aus und es war keine neue mehr im Stock: „Sie war wohl auf ihrem Hochzeitsflug verschütt gegangen. Man kann den Arbeiterinnen auch einige Eier in die Königinnenzellen legen, aus denen sie sich dann mit Gelee Royal-Fütterung eine neue groß ziehen, das geht aber nur mit höchstens drei Tage alten Eiern und ich hatte es zu spät bemerkt. Im Neukölln kaufte ich mir dann bei einem Imker eine neue Königin, der züchtet die. Man hängt sie erst eingesperrt in einem kleinen Gitterkäfig in den Stock. Der hat zwei Öffnungen, die mit Honigteig verstopft sind, den die Bienen wegfressen müssen, damit die Königin raus kann. Es geht dabei darum, dass die Bienen sich erst einmal an die neue Königin gewöhnen müssen, sonst würden sie sie totstechen.“ Im übrigen passiert Rita Besser das mit dem Urlaub zur falschen Zeit nicht noch einmal: „Ich weiß jetzt, wenn die anfangen, Waiselzellen zu bauen, für neue Königinnen, dann schwärmen sie 14 Tage später. Und das kann man ein bißchen steuern: Entweder indem man die Waiselzellen abbricht oder indem man eine neue Zarge mit neuen Waben oben drauf stellt – dann haben sie erst mal wieder Platz für neue Trachten.“
Rita Besser kam über eine Heilpraktikerinnen-Ausbildung, bei der sie sich auf Pflanzenheilkunde spezialisierte, zur Imkerei: „Mein Lehrer hatte mehrere Völker und an den Bienen fand ich so toll, dass es absolute Sonnentiere sind, ihr ganzer Tagesablauf wird vom Licht bestimmt – und dass sie vollkommen auf Blumen bzw. Blüten orientiert sind.“ Als ein Freund von ihr nach Honduras auswanderte, kaufte sie ihm seine zwei Völker ab, die sie auf dem Dach ihres Mietshauses aufstellte. Im Neuköllner Imkerverein, dessen Mitglied sie dann wurde, lernte man sie an, und zwar dessen Vorsitzende Erika Geiseler, die ihre Völker im Knüllwald stehen hat, wo sie ein Bienenmuseum leitet. Davor betreute sie die Bienen in der „Ökolaube“ des Britzer Gartens – zuletzt auf ABM-Basis. Sie schreibt außerdem für das „Deutsche Bienen-Journal“, das sich „Forum für Wissenschaft und Praxis“ nennt. Einmal drehte sie auch einen kurzen Film über Bienen – zur Aufklärung in Schulen. Diesen Film hat Rita Besser später den Kindern in ihrem Mietshaus vorgeführt, um ihnen die Angst vor den Insekten zu nehmen, „die schon mal den Himmel über den Hinterhof verdunkeln können, wenn sie schwärmen. Ein Schwarm landete mal am Fabrikschornstein gleich nebenan. Wenn im Herbst die Blütenstetigkeit der Bienen nachläßt, dann fliegen sie auch den wilden Wein an der Hausmauer an: der summt dann ein paar Tage lang richtig.“
Ein andern Mal bemerkte sie eine seltsame Verhaltensänderung bei ihren Bienen: „Sie wurden immer aggressiver, im Winter ist mir dann ein Volk eingegangen.“ Die Ursache dafür sieht sie darin, dass eines Tages ein Mobilfunk-Sendemast auf dem Dach des Nachbarhauses errichtet wurde. Ihr Mann der eine Ausbildung als Baubiologe macht, beschäftigte sich näher damit. Er meint: „Ihre Fühler wirken wie Antennen, das macht die Bienen verrückt. Die Stöcke standen ja nur 10 Meter Fluglinie entfernt von dem Mast – das war zu nahe. Die können von den elektromagnetischen Wellen sterben“. Obwohl die Industrie das abstreitet, gibt eine Broschüre des Kreuzberger Stadtteilausschusses mit neuen Forschungsergebnissen über diesen Elektrosmog ihm das recht, sie heißt: „Informationen zu Mobilfunk und UMTS“. Die Autoren berufen sich u.a. auf den neuseeländischen Wissenschaftler Neil Cherry, der meint, dass die Strahlung die elektrischen Vorgänge im Körper – auch von Menschen, durcheinander bringen: „Die Handys werden innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fallzahl vieler neurologischer Krankheiten sowie der Gehirntumore ansteigen lassen.“
Rita Besser entschärfte das Problem für die Bienen kurzerhand, indem sie ihre Völker in den Hinterhof stellte, wo die Strahlung nicht mehr so stark ankommt: „Die Feldstärke eines elektromagnetischen Feldes im freien Raum nimmt mit dem Quadrat des Abstands zur Sendeantenne zu,“ heißt es dazu in der e.e. Broschüre. „Auch die Hauswände haben eine abschwächende Funktion“, meint Rita Besser, „ich mußte jedoch erst mal ausprobieren, was die Mieter dazu sagen.“ Sie schenkte ihnen Honig und kaufte einige Bienen-Bücher für die Kinder. Niemand hat sich beschwert.“ Dennoch pachtete sie dann einen Schrebergarten in Treptow und stellte ihre zwei Stöcke dort auf. Seitdem lebt sie sozusagen getrennt von ihren Völkern – ähnlich wie Ramona Mai, deren Stöcke bei Oranienburg stehen: „Wir haben dort einen tollen Standort gefunden. Es ist alles da, was wir brauchen: Frühlingsblüte, Raps, Robinien und Linde. Je nach Tracht kann man alle zwei, bis drei Wochen den Honig ernten, dann ist die Kiste voll. Natürlich versuchen wir, nach einer Blütephase zu leeren, damit wir reinen Sortenhonig bekommen. Bienen sind sehr blütenstet. Wenn’s eine Blüte reichlich gibt, fliegen sie die auch bevorzugt an. Deshalb bestäuben sie auch so gut. Stellt man seine Stöcke zum Beispiel auf eine Obstbaumwiese und alles blüht, dann fliegen sie von Apfelblüte zu Apfelblüte.“ Die Baumbesitzer haben auch was davon: „ihre Früchte werden dadurch größer als durch Windbestäubung“, wie Rita Besser, aber auch die Obstbauern im Alten Land bei Hamburg wissen.
Während Ramona Mai behauptet, dass die meisten Imker ältere Männer über 60 sind, bekommt man bei den Erzählungen von Rita Besser den Eindruck, dass fast nur jüngere Frauen sich für Bienen interessieren: In ihrem Schrebergarten, in ihrer Straße am Görlitzer Park, in der Manteuffelstraße, in der Waldemarstraße – überall leben Imkerinnen in Kreuzberg, obwohl gerade dieser Bezirk die wenigsten Grünflächen hat. Die Bienenhalter dort kennen sich und helfen sich mit Geräten (z.B. einer Honigschleuder) aus. Und die Feuerwehr verschenkt hier gerne von ihr eingefangene Schwärme – an „Starter“. Es gibt allein drei Kinderbauernhöfe in diesem Bezirk, in dem die „alternative Scene“ immer noch gut vertreten ist – und sich seit den Siebzigerjahren besonders um die Sanierung der Altbausubstanz sorgt, wobei fast alle Hinterhöfe üppig – also bienenfreundlich – begrünt wurden. Zudem hat man dann auch noch aus dem riesigen Gelände des zerstörten Görlitzer Bahnhofs einen Park gemacht. Das reduzierte jedoch erst einmal die seit dem Krieg dort entstandene Artenvielfalt. Inzwischen sind die neuangepflanzte Bäume und Sträucher aber alle gut angewachsen, an den Straßen stehen außerdem überall Linden und Kastanien. Diese werden auch von Rita Bessers Bienen gerne angeflogen, „sie beginnen jedoch mit den Weiden und Robinien im Park und zuletzt fliegen sie die Balkonblumen an. Jetzt in unserer Treptower ‚Kolonie Vogelsang‘ haben sie mehr Frühlingsblumen als blühende Bäume, aber Obstbäume gibt es dort auch. Meine Nachbarin fand den Honig früher besser – wegen des Geschmacks der Lindenblüten vor allem. Nun gibt es jedoch keine eindeutige Zuordnung zu einer Blütenart mehr bei meinem Honig. Am Besten schmeckt uns der frische erste Honig, der im Mai geerntet wird, wir machen da jedesmal ein kleines Fest draus.“
Ramona Mai erzählt: „Die erste Tracht – also das erste reichliche Nahrungsangebot – ist die Obstblüte, dann folgt der Raps. Das eigentliche Bienenjahr beginnt erst im Juli. Ab dann bereiten sich die Völker auf den Winter vor und produzieren Winterbienen. Eine Sommerbiene lebt nur sechs Wochen, aber die Tiere, die die kalte Zeit überstehen müssen, schaffen vier Monate. Gleichzeitig produziert das Volk Honig als Vorrat, das ist Blütennektar, den die Biene in ihrer Honigblase transportiert und in Waben eindickt.“ Um zu verdeutlichen, was die Bienen ihr außer Honig noch geben, wählt sie „ein Beispiel: Anfang des Jahres war ich stark erkältet, fühlte mich total mies. Dann, zum Saisonstart, konnte ich endlich wieder an die Bienen. Der herrliche Geruch! Bei den Bienenvölkern riecht es ganz intensiv nach Propolis. Diesen Kittharz, der antibakteriell ist, sammeln die Tiere an Knospen von Kastanien oder Pappeln und dichten damit die Ritzen in ihrem Stock ab. Der Geruch hat mir wahnsinnig gut getan, die Erkältung war schnell weg.“
Rita Besser meint, dass die Bienen eines Stockes den Geruch der Königin annehmen, und dass diese auch den Charakter ihres ganzen Volkes bestimmt: „ist sie aggressiv, sind die Bienen es auch.“ Wegen der „extremen Riechfähigkeit“ der Bienen nehme sie zur Geruchsbeseitigung, z.B. von Waben, bevor sie diese in einem anderen Stock verwendet, Thymiantee, „weil die aus dem Nachbarstock sonst denken, das sind ihre Waben und darüber herfallen. Der Thymian überdeckt den Geruch und wird gleichzeitig von ihnen gemocht. Der neue Rahmen wird trocken gemacht – und damit sauber – er ist dann erst für die Eier der Königin bereit, und gleichzeitig ist der Tee eine brauchbare Flüssigkeit für die Arbeiterinnen zum Trinken. Ansonsten lege ich in heißen Sommern einen nassen Schwamm in die Nähe der Stöcke. Jetzt in Treptow haben wir im Garten einen kleinen Teich. Ab und zu fällt da mal eine Biene rein. Ich rette sie dann immer, damit sie die anderen Bienen warnt, am Wasser aufzupassen. Sie sind nämlich lernfähig. Das sieht man z.B. an den Pollenfallen: Damit der Imker in den Besitz der Pollen kommt, verkleinert er das Einflugloch so, dass sie nach ihren morgendlichen Pollenflügen diesen beim Durchschlüpfen in das enge Loch von den Beinen abstreifen. So ist es gedacht, aber die Bienen lernen schnell, wie sie, wenn sie ganz vorsichtig erst das eine Bein und dann das andere mit hineinnehmen, den Pollen nicht verlieren. Sie brauchen den für die Brutaufzucht.“
Rita Besser arbeitet mit Rauch, wobei sie den Rat des Imkers im Botanischen Garten beherzigt, der ihr sagte, sie solle Rainfarn zum Verbrennen nehmen, dessen Rauch sei am Besten. „Das Interessante an der Räucherei ist: Erst denken die Bienen, es brennt – und werden nervös, dann fressen sie sich aber schnell mit Honig voll – auf Vorrat, und werden so träge, dass sie nicht mehr so schnell stechen. Wenn ich aber zu lange am Stock rumarbeite, dann werden sie doch mit der Zeit wieder unruhig.“
Da sie sich aber die Bienen „primär wegen ihrer Begeisterung für diese Tiere“ angeschafft hat, sitzt sie am Liebsten einfach vor den Stöcken und beobachtet die Fluglöcher – „da ist viel zu lernen; ich habe auch ein Buch, das heißt ‚Am Flugloch‘. Wenn z.B. die Bienen keine Pollen mehr bringen, dann kann es sein, dass die Königin gestorben ist. Oder die Drohnenschlacht, die muß auch erfolgen: Wenn die Bienen im Herbst die Drohnen noch immer nicht aus dem Stock geschmissen haben, dann heißt das höchstwahrscheilich auch, dass die Königin tot ist. Und dann sieht man das mit den Wespen – wie sie deren Angriffe abwehren. Wenn die Wespen es schaffen, den Stock zu plündern, dann ist das Volk zu schwach – und kommt wahrscheinlich sowieso nicht über den Winter. Aber man kann ihnen helfen, indem man im Herbst das Flugloch verkleinert, das erschwert den Wespen ihre Angriffe: Ein kleines Loch können die Bienen besser verteidigen. Einen Varroamilben-Befall kann man auch sehen – ein deutliches Anzeichen sind verkrüppelte Flügel. Unser Verein hat im übrigen einen staatlich bezuschußten Ausgleichsfond für Verluste durch Varroabefall. Im Mitgliedsbeitrag ist außerdem eine Haftpflichtversicherung enthalten – die ist aber eher dafür, falls mal ein Passant gestochen wird und umfällt.
Ramona Mai behauptet: „Für viele Imker ist Entspannung die Hauptsache, Honig nur das Nebenprodukt. Sie halten sich Bienen, weil sie die Tiere lieben, so wie andere sich Kaninchen halten. Der Honig ist Abfall und wird so behandelt: Er wird erwärmt, in Gurkengläser abgefüllt, ohne Etikett, überhaupt nicht liebevoll. Manche erhitzen ihn sogar über 40 Grad, der Zucker karamellisiert und der Honig sieht dunkel aus. So wird aus jedem Honig ein Waldhonig. Der Kunde findet das toll, kauft aber letztlich wertlose Pampe. Wir stehen mit unserer Imkerei ‚Maiblume‘ auf Wochenmärkten, unser Hauptverkauf ist Samstags der Kollwitzplatz im Bezirk Prenzlauer Berg. Aber der Absatz bricht ein, die Leute geben eben nicht mehr so viel für Lebensmittel aus. Deshalb probieren wir jetzt etwas Neues aus, im Naturschutzgebiet Schorfheide. Mein Mann hat in Büchern ein 150 Jahre altes System der Bienenhaltung entdeckt. Bienen in freier Wildbahn leben ja in hohlen Bäumen und kleiden sie von oben nach unten mit Waben aus. Das kann man mit Holzkästen nachbauen. Unten schiebt man ab und zu ein leeres Fach drunter, oben nimmt man die mit Honig gefüllten Fächer ab. Die Bienen sind völlig sich selbst überlassen. Mit diesem Honig wollen wir in die Bio-Läden – auch als Rückversicherung für den Fall, dass die anderen Völker wegen der Beizmittel auch sterben.“ Als „hohe Kunst des Imkerns“ bezeichnet sie die Trennung der Honigsorten. Zwar sind die Bienen blütenstet, aber wenn sie „zum Beispiel zu Robinienhonig, der eigentlich flüssig ist,nur ein bißchen Raps sammeln, der sehr schnell auskristallisiert, dann wird der Honig fest.“ Hier muß man dann versuchen, „ordentlich zu trennen“.
Rita Besser hat bereits Erfahrungen mit diversen Bienenkrankheiten gesammelt: „Einmal war die Amtstierärztin schon bei mir – wegen ‚Faulbrut‘, das ist eine übertragbare Krankheit: die Brut verfault dabei in den Zellen. Sie war 2003 in Neukölln ausgebrochen. Meine zwei Völker waren aber zum Glück gesund, sonst hätte man sie vernichten müssen. Dann die Varroa – aus Amerika: Damit haben heute alle Imker zu tun, das sind kleine Milben, die saugen die Bienen aus, schon die Larven. Im Spätsommer muß man dagegen einen ‚Nassenheider Verdunster‘ in die Stöcke stellen, der funktioniert mit Ameisensäure: Die Dämpfe betäuben die Milben, sie fallen von den Bienen ab – in eine Schale, die mit Vaseline eingestrichen ist, damit sie kleben bleiben. Im Winter 2004/05 sind viele Bienen daran gestorben, bei mir jedoch kaum welche. Aus Afrika kommt der kleine Beutenkäfer, der ist neu: Dessen Larven zerfressen die Bienenzellen und minimieren dadurch die Brut. Den habe ich aber noch nicht gehabt. Eher harmlos ist dagegen die Wachsmotte: Die stiehlt sich in den Stock zu den leeren Zellen, wo die Larven ausgeschlüpft sind und frißt die Häutchen, mit denen die Zellen von den Bienen ausgekleidet wurden. Diese Motten hatte ich schon mal: Dann muß man die befallenen Waben einschmelzen. Den Bienen tut die Motte nichts, es ist nur lebensmittelhygienisch – für uns also – unangenehm.“
In Spanien, dass hinsichtlich der Bienenzucht führend in Europa ist (es gibt dort 26.000 Imker, davon 6000 hauptberufliche), sind seit 2004 fast 40% der Völker eingegangen. Im Frühjahr 2005 demonstrierten 3000 Imker vor dem Landwirtschaftsministerium, wo man ihnen die Finanzierung zweier Imkereizentren zur Untersuchung des Bienensterbens versprach. Die Imker sind davon überzeugt, dass fipronil- und imidaclopridhaltige Pflanzenschutzmittel die Ursache dafür sind. Bereits 1999 waren in der Nähe von Valencia 14 Millionen Bienen an einem Insektizid der Firma Reva eingegangen. Bisher sind das noch alles „reine Hypothesen“, meinte der angesehene Zoologe der Universität Cordoba Francisco Puerta. Er geht davon aus, dass die Ursachenforschung für das neuerliche Bienensterben mindestens drei Jahre dauern wird. Die Imker, denen der Billighonig aus China schon das Geschäft schmälert, bangen, ob bis dahin von ihren 2,5 Millionen Bienstöcken überhaupt noch welche übrig bleiben. Das gilt auch für die Bauern, denen die Bienen z.B. den Ertrag eines Sonnenblumenfeldes um 65% steigern können.
In Deutschland beteiligten sich zur gleichen Zeit etliche Imker an Aktionen gegen Freilandversuche mit genetisch behandeltem Saatgut, vor allem Mais – in dem sie ebenfalls eine Bedrohung für ihre Bienenvölker bzw. deren Honigproduktion sehen. Die Initiativen namens „Gendreck-weg“ veranstalten u.a. Aktionscamps und so genannte Feldbefreiungen. Einer der Hauptinitiatoren in Süddeutschland ist der Tübinger Imker Michael Grolm. Zusammen mit dem Imkermeister Jürgen Binder kündigte er 2005 an, Genmaispflanzen von einem Feld in der Nähe von Strausberg in Brandenburg herauszureißen. An ihrer „Feldbefreiungs-Aktion“ beteiligten sich etwa 300 Gentechnik-Gegner, woraufhin die Staatsanwaltschaft Tübingen den beiden Initiatoren vorwarf, öffentlich zu Straftaten aufgerufen zu haben. Für Michael Grolm ist das eine glatte Tatsachenverdrehung: „Politik und Konzerne setzen uns und unsere Landwirtschaft dramatischen Risiken aus. Straftäter sind doch nicht die, die dagegen aktiv werden.“ Zu seinem Gerichtsprozeß erschien er mit einem Bienenvolk: „Wir haben viele stichhaltige Argumente gegen die Agro-Gentechnik!“, sagte er, „sie krabbeln hier im Bienenstock und fliegen draußen auch die manipulierten Pflanzen an. Genmaispollen verunreinigen meinen Honig. Darüber hinaus gefährdet Gentechnik die Existenz von Millionen von Bauern in aller Welt, die Gesundheit der Konsumenten und die Zukunft unserer Ernährung.“ Die Genkritiker nahmen den Prozeß zum Anlaß, um weitere Aktionen anzukündigen: im Juli 2006 wollen sie u.a. ein Genmaisfeld bei Zehdenick nördlich von Berlin „befreien“. Zu den Risiken der Agro-Gentechnik, auch und gerade in bezug auf die Honigproduktion, sollte vor Gericht ein „Sachverständiger“ gehört werden, die Vorsitzende verzichtete jedoch auf dessen Befragung, mit der Begründung, dass sie die Richtigkeit der Argumentation der Angeklagten nicht bezweifeln würde. Desungeachtet verurteilte sie die beiden Imker dann zu Geldstrafen, diese kündigten daraufhin an, in Berufung zu gehen. Michael Grolm erklärte: „Wenn ich erneut verurteilt werde, werde ich für diese Sache auch ins Gefängnis gehen. Es steht zu viel auf dem Spiel!“ Eine wissenschaftliche Studie aus Bayern, die die „unabhängige bauernstimme“ im Juli 2006 vorstellte, kommt zu dem Schluß, dass die Bienen auch jetzt schon die Felder mit Genmais anfliegen – bis zu 5 Prozent der von ihnen gesammelten Blütenpollen stammte von gentechnisch veränderten Maispflanzen. Als tierisches Produkt ist solch ein „versuchter Honig jedoch nicht kennzeichnungspflichtig.
Der wunderbare Insektenforscher Maurice Maeterlinck war nicht nur (um 1900) einer der ersten, der sich nach langer Zeit bemühte, die Wissenschaft und das Leben wieder prospektiv eng zu führen, er forderte auch dazu auf, in der Stadt Bienen zu züchten – zu eigenem und deren Nutzen und Frommen. Er ließ sich dazu einen speziellen Bienenstock bauen: „Einen Beobachtungskasten“ – d.h. „ein Bienenstock mit Glaswänden und schwarzen Vorhängen oder Läden. Die besten sind die, welche nur eine einzige Wabe enthalten, sodass man sie von beiden Seiten beobachten kann. Diese Kästen lassen sich ohne weiteres und ohne jede Gefahr in einem Wohn- oder Arbeitszimmer aufstellen, vorausgesetzt, dass sie einen Ausgang nach draussen haben. Die Bienen meines Beobachtungskastens, den ich in Paris in meinem Arbeitszimmer habe, tragen selbst in der Steinwüste der Großstadt genug ein, um zu leben und fortzukommen.“ Bei genauer und andauernder Beobachtung – nicht nur eines Volkes, sondern einzelner Bienen, die dazu mit Nummern markiert werden, kommen überraschende Ergebnisse heraus: So fanden die Bienenforscher Roesch und Lindauer u.a. heraus, dass es mit dem sprichwörtlichen Fleiß der Bienen nicht allzu weit her ist: „Die Biene 107 z.B., die vom ersten Lebenstag an fortlaufend beobachtet wurde, hat in den 20 Tagen ihres Innendienstes, bis zum ersten Trachtflug, von 139 Beobachtungsstunden nur 50 Stunden gearbeitet und 89 Stunden müßig verbracht. Von diesen 89 Stunden saß sie 39 1/2 still, und 49 1/2 ging sie langsam und ungezwungen auf den Waben umher, wobei sie bald eine Zelle flüchtig inspizierte, bald mit einer Nachbarin kurz Kontakt aufnahm.“ Solche und ähnliche Beobachtungen legen nahe, langsam aber sicher von der Erforschung der Arten weg zu kommen und sich den Individuen zuzuwenden, denn selbst diese staatenbildenden Insekten haben sich laut Karl von Frisch „bei aller erblichen Gebundenheit einen Grad von individueller Freiheit bewahrt“. Michel Foucault meinte einmal: „Unterhalb der Schafsarten kann man nur noch die Schafe zählen“. Die biologische Forschung treibt heute jedoch in die entgegengesetzte Richtung – indem sie partout und dumpf-materialistisch alle Lebensvorgänge in Chemie und Physik auflösen möchte.
(*) Das Interview mit Ramona Mai führte Ulrich Schulte (siehe taz v. 2.5.05), die Interviews mit Rita Besser, Hanns-Peter Hartmann und Dr. Zepernick führte Helmut Höge.
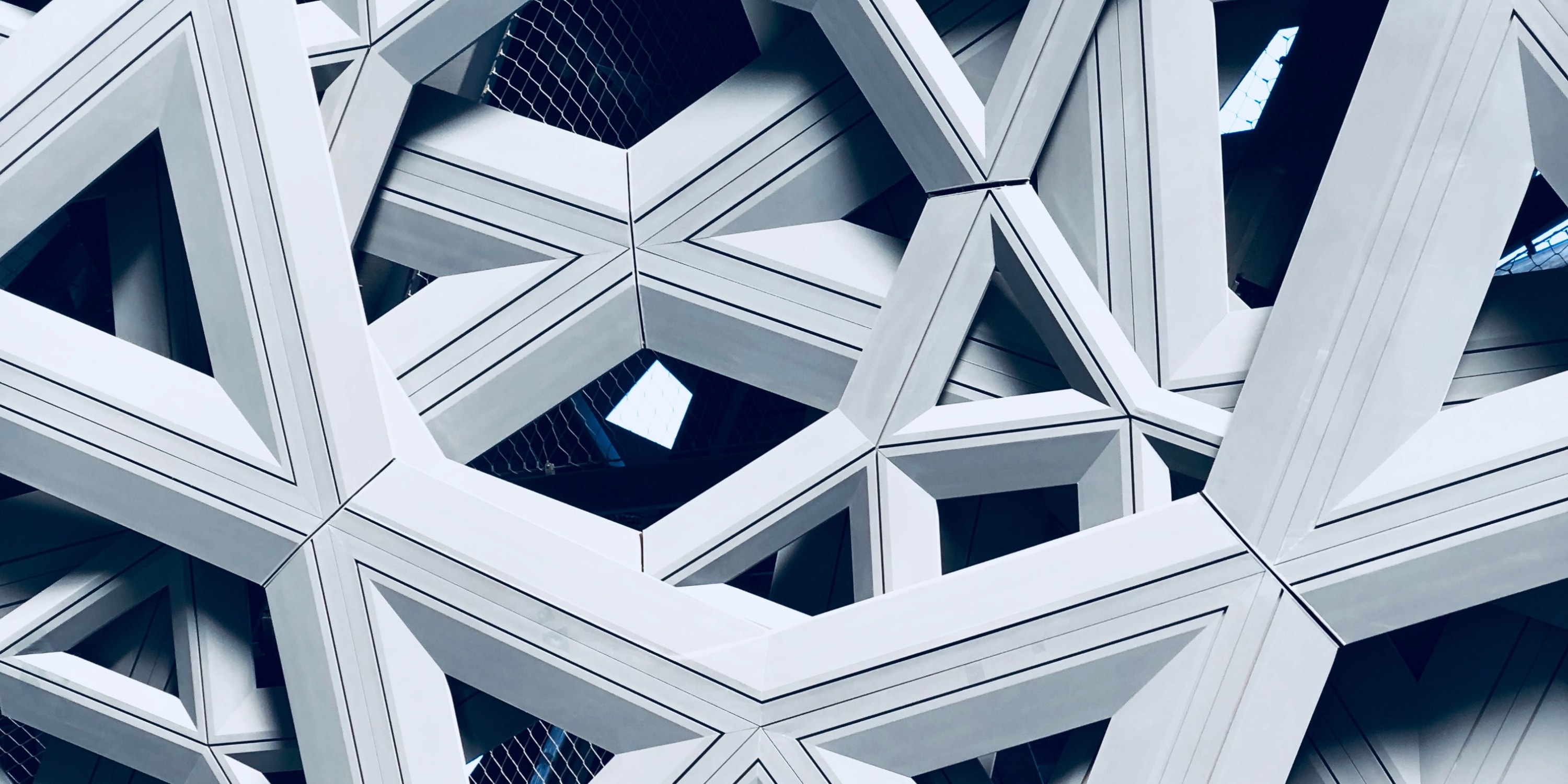



Nun hat sich auch die taz des Themas „Honig aus Berlin“ angenommen. Sybille Mühlke schreibt:
Auf dem Kreuzberger Dach stehen drei große Kästen in der Sonne. Tritt man näher, hört man es summen, ein leichter Wachsgeruch liegt in der Luft – es sind Bienenstöcke. Sabine Wagner ist Stadtimkerin, seit fünf Jahren hält sie Bienenvölker oben auf dem „Heilehaus“ in der Waldemarstraße. Bienen in der Großstadt? Das ist weniger exotisch, als es scheint. In Berlin wird fleißig geimkert – auf Dächern, in Parks, auf Brachflächen und sogar am Rand von Friedhöfen. 560 Berliner Imker zählt der Deutsche Imkerbund, dazu kommen noch die Individualisten ohne Vereinsmitgliedschaft.
Bei Sabine Wagner ist die erste Honigernte des Jahres gerade vorbei. Auf dem Dachboden des Heilehauses stapeln sich Gläser mit hellem, mildem Akazienhonig. Wohin damit? „Wir verkaufen unseren Honig unten im Café und haben keine Probleme, ihn loszuwerden“, sagt sie. Andernorts ist das schwieriger – für Imker und Honigliebhaber. Schließlich hat nicht jeder einen Imker in der Nachbarschaft, um sich mit hochwertigem Honig einzudecken. Und im konventionellen Lebensmittelhandel gibt es selten deutschen Honig und erst recht keinen Honig aus Berlin. Im Durchschnitt haben Berliner Imker fünf Bienenvölker, die rund 150 bis 200 Gläser Honig im Jahr produzieren. Das ist zu wenig, um mit einer Lebensmittelhandelskette zu kooperieren. Vertriebsstrukturen für kleinere Imker? Märkte oder ein Schild am Gartenzaun. Schon mancher Imker hat Imkerhut und Smoker entnervt an den Nagel gehängt, weil es so schwierig ist, den Honig zu akzeptablen Preisen loszuschlagen.
Das kann sich jetzt ändern. Die Berlinerin Annette Müller ist Honigenthusiastin. Und sie vermisste Möglichkeiten, an lokal produzierten Honig heranzukommen. Deshalb gründete sie Ende letzten Jahres „Berliner Honig“ als Vertriebsgemeinschaft und Label für Honig aus Berlin. Via Internet bringt sie Honigproduzenten und Honigliebhaber zusammen: Man kann den Berliner Honig online bestellen oder nachschlagen, wo es Verkaufsstellen in der Nachbarschaft gibt.
Die Vorteile für die Imker: Bei „Berliner Honig“ wird fair gehandelt, sie erhalten vernünftige Preise. Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt Heike Helfenstein aus dem bayerischen Oberhaching. Auf ihrer „Heimathonig“-Website kann man Imkerhonige aus ganz Deutschland – nach Region und Qualität sortiert – bestellen und Imkeradressen suchen. „Heimathonig“ sieht sich vor allem als Marketingplattform für Imker und soll später einmal kostenpflichtig werden.
Das Konzept scheint zu funktionieren, die Vertriebslücke zwischen Imkern und Honigfans schließt sich: Einige der „Berliner Honig“-Imker haben sich gerade zusätzliche Bienenvölker angeschafft, weil sie wissen, dass sie den Honig jetzt gut verkaufen; „Heimathonig“ hat in kurzer Zeit etwa 100 Imker gewinnen können.