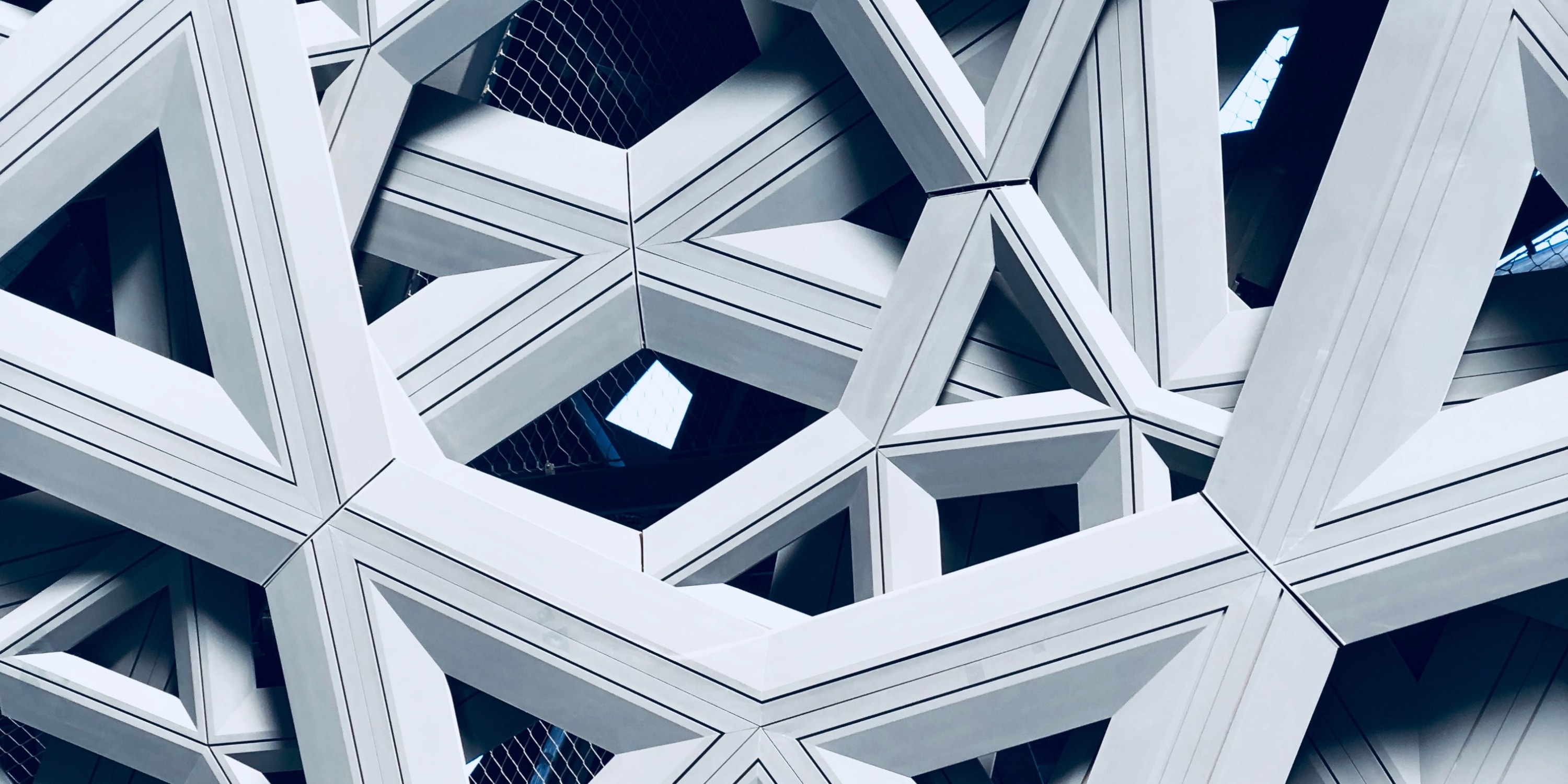Jetzt habe ich die Post vom Finanzamt noch immer nicht geöffnet, obwohl ich es „gleich „nach meinem Urlaub“ machen wollte. Meine Freundin Dorothee meinte einmal, als sich bei mir die ungeöffneten Behörden- und Hausverwalterbriefe mal wieder stapelten, das sei bloße Feigheit. Nein! verteidigte ich mich, aber als Selbständiger bin ich auf selbstinduzierten Schwung angewiesen und den darf ich mir zu bestimmten Zeiten nicht durch die Post versauen lassen. Weil Dorothee noch selbständiger ist als ich, kuckte sie nur skeptisch. Deswegen zitierte ich den während der Übernahme der Narva-Lichtproduktion mit dem Flugzeug abgestürzten Erfinder der nahezu unsterblichen Glühbirne Dieter Binninger. Nach einem TV-Streitgespräch mit Osram-Managern über die Lebensdauer, das zu seinen Gunsten ausgegangen war, hatte der Konzern ihm das Warenzeichen „Vilux“ für seine 150.000 Stunden brennenden Glühbirnen verboten, weil der Name angeblich ihrer „Bilux“-Birne zu nahe kam. Binninger klärte mich auf: „Die wollten mir bloß einen Tritt in den Hintern verpassen. So macht man die kleinen Leute fertig. Wenn Sie so einen Brief von der Osram-Rechtsabteilung morgens kriegen, dann ist doch erst mal der Tag gelaufen, das können Sie sich doch vorstellen…“ Ja, das konnte ich. Wie ich ebenso auch mit all den zigtausend Arbeitslosen mitfühlen kann, die sich von ihrer Abfindung und einem Bankkredit irgendwo eine Eigentumswohnung haben aufschwatzen lassen, die sie nicht vermietet geschweige denn wieder verkauft kriegen und nun vor einem Berg Schulden stehen: Bei jedem Brief von ihrer Bank oder Hausverwaltung bekommen sie Panikattacken. Ähnlich geht es auch vielen jungen Leuten, wenn sie Post von ihrer Handyfirma bekommen. Aber manche männliche Briefaufschlitzhemmung versteh ich nicht. So hat mein Freund Fikret, als er arbeitslos wurde, aber weiter seinen roten Mercedes fuhr, zwei Jahre lang alle Rechnungen, Mahnungen, Knöllchen, Warnungen ungeöffnet in einer riesigen Plastiktüte gesammelt. Was er dann gemacht hat,weiß ich nicht, jetzt scheint es ihm aber wieder einigermaßen gut zu gehen, denn er hat gleich neben der Polizeiwache in der Friedrichstraße ein Musikcafé eröffnet. Noch unverständlicher war mir die Geschichte von Hella: Mitte der Achtzigerjahre verliebte sie sich im Urlaub in einen Mexikaner, genauer gesagt in einen Tarahumara, dem sie regelmäßig Briefe schrieb. Irgendwann lud sie ihn zu sich ein, schickte ihm Geld für den Flug usw. Und er kam auch tatsächlich: In seinem Koffer hatte er ihre gesammelten Briefe mit – und alle waren ungeöffnet. Selbst für Hella war es ein Rätsel, wie das geschehen konnte, d.h. wie er es ohne sie zu lesen hierhergeschafft hatte. Wenn die Springerzeitungen mal wieder über einen Fall von besonders grauenhafter männlicher Verwahrlosung berichten, erwähnen sie bei der Beschreibung der Wohnung des Betreffenden stets, dass dort Berge von ungeöffneten Briefen herumlagen. Die Ironie will es, dass es als saisonaler Aushilfshausmeister zu meinen Pflichten gehört, täglich die Post zu sortieren. Wenn ich einen Briefumschlag keiner Abteilung zuordnen kann, muß ich ihn öffnen. Fast den ganzen Sommer über ist so der Brieföffner mein Haupthandwerkszeug. Inzwischen kenne ich schon mehrere männliche Selbständige, die Brieföffner regelrecht sammeln bzw. sich immer mal wieder gerne mit so einem Ding selbst beschenken – wahrscheinlich um ihre Brieföffnungsprobleme wenigstens technisch zu „lösen“. Immer häufiger werden solche Öffner auch über „ebay“ ersteigert: Dabei kann man sich dann gleich auch noch das Gefühl verschaffen, am Computer zu arbeiten. Eine Google-Blitzrecherche ergab kürzlich, dass es 217 Krimis gibt, in denen mindestens eine Person mit einem Brieföffner getötet wird: Auch das ganz im Sinne einer Problemlösung – nie als Lustmord oder aus Fahrlässigkeit. Umgekehrt zögern seit dem 11.9. immer mehr Leute, zum Brieföffner zu greifen, weil sie befürchten, es könnte eine Briefbombe oder ein mit Anthrax gefüllter Umschlag unter ihrer Post sein. Das ist aber keine Lösung.
Noch einmal zurück zum Finanzamtsbrief – dahinter verbirgt sich ein Alltagsproblem, das sich uns zunächst als „In-die-Quittungen-gehen-müssen“ aufdrängt. Der Dichter Majakowski hat immer wieder den „byt“ thematisiert, was man mehr schlecht als recht mit „Alltag“ übersetzen könnte. An ihm arbeitete der Dichter sich ab, an ihm verzweifelte er. Der Alltag ist es, der unser Leben gleichsam „automatisiert“, d.h. er macht, dass wir die Dinge um uns herum nicht mehr erkennen, sondern höchstens routiniert zur Kenntnis nehmen: den Salzstreuer z.B.. Und das Verfahren der Dichtung besteht darin, sie erneut wahr zu nehmen.
„Die Kunst kennt verschiedene Arten, die Dinge dem Wahrnehmungsautomatismus zu entziehen“, z.B. indem sie sie „verfremdet“ darstellt. Dies ist eine der zentralen Thesen der sogenannten russischen Formalen Schule – von Schklowski, Brik, Jakobson, Eichenbaum und Tynjanow, die Fritz Mierau „Morphologen“ nennt: Formlogiker, denn für sie ist „der Inhalt (die Seele) eines literarischen Werkes gleich der Summe seiner stilistischen Verfahren“. Natürlich ging es ihnen dabei, wie auch Majakowski, um eine permanente Aufsprengung des Alltags – nicht wie Isaac Babel um den „Neuen“ Alltag, sondern um seine Abschaffung. Mir wird dagegen mindestens einmal im Jahr genau das Gegenteil abverlangt: beim Abfassen meiner Steuererklärung, d.h. wenn ich für Tage „in die Quittungen“ gehen muß: Das ist jedesmal der Moment, wo der Staat, „das kälteste aller kalten Ungeheuer“ (Nietzsche), mich an die Kandarre nimmt – um aus mir einen Staatsbürger zu machen.
Jede Taxi-Quittung wird zu einem stummen Vorwurf: Von wo nach wo bin ich da – am 1.11.04 für 14 Euro – bloß gefahren? Hätte ich nicht ebensogut die BVG nehmen können? Nein, es war schon 1 Uhr nachts durch. Und außerdem brauche ich doch jede Menge absetzbare „Ausgaben“. Aber wird das Finanzamt diese auch als solche anerkennen? „Stadtfahrt“ reicht nicht mehr, wie auch Buchkauf-Quittungen mit der Aufschrift „Sachbuch“ nicht. Aber soll ich etwa nachträglich die Strecke bzw. den Buchtitel eintragen? Den Staat lassen meine Unsicherheiten kalt. Und am 12.5.04 die Zeche in Höhe von 42 Euro im Café Slavia in Friedenau: Für wen habe ich da bloß mitgezahlt und warum überhaupt? Unter „Bewirtete Personen“ schreibe ich – nach einigem Grübeln: Dr.Peter Berz, unter „Anlaß der Bewirtung“: Gespräch über rasierte Mösen. Nein, das geht nicht! Stattdessen schreibe ich: Informationsgespräch über die russische Formale Schule. Peter ist Russlandfan – und lebt sogar mit einer Moskauerin zusammen – was er aber nicht als „Sonderausgabe“ absetzen kann. Im Gegensatz zu Wladimir Kaminer z.B., der mit einer ganzen „Russen-WG“ im selben Haus wohnt. Deren unalltägliches Verhalten verarbeitet er gerade literarisch zu einem Buch über „Russische Nachbarn“. Zuvor hatte er bereits in einem anderen die „Helden des Alltags“ thematisiert. Mit dieser Erhöhung wollte er den Alltag wenigstens punktuell transformieren. 1926 gab jedoch Ossip Brik im Zusammenhang mit dem Erfolg des Romans „Zement“ von Gladkow bereits zu bedenken, dass das Verknüpfen von „Heroismus und Alltag“ einem starken staatlichen Wunsch nachkommt. Im Falle von Kaminer kam die Kritik von ganz anderer Seite: Seine Tante in Kreuzberg verbot ihm, noch einmal was über sie zu veröffentlichen. Was ich aber sagen wollte: Die sich über Stunden hinziehenden Gespräche mit seiner „Russen-WG“ im Haus bzw. die Unkosten, die ihm dabei entstehen, kann er natürlich steuerlich absetzen, indem er die Mitbewohner beispielsweise in sein Lieblingslokal „Canta Maggio“ einlädt und bewirtet: 18.10., 140 Euro, Gespräch über die Zeugen Jehovas, die einmal zu dritt die Russen-WG in der Gleimstraße besuchten – und sie nie wieder verließen. Aber sie leben noch.
Bei mir stellt sich neben solchen oder ähnlichen Bewirtungsproblemen auch noch die Frage: Kann/darf man das im Nachhinein so auf die Quittungen schreiben – und unterschreiben auch noch? Oder ist mit der „Unterschrift“ hier der eigentliche Wirt, also der Restaurantbesitzer, gemeint? Ich kann aber doch nicht wegen jeder Quittung jetzt durch die Stadt düsen – mit einem Taxi wohlmöglich noch. Und wenn sie mir nicht anerkannt werden – diese selbstunterschriebenen Quittungen, dann habe ich sie alle umsonst ausgefüllt und mich an die jeweiligen in dem und dem Restaurant geführten Gespräche zu erinnern versucht, die ich notfalls sogar alle mit mindestens einem Kolumnentext hinterfüttern könnte, um so ihre „Authentizität“ noch alltagsrealistischer zu gestalten. Damit wäre ich mir selbst fast sicher, dass sie so und nicht anders stattgefunden haben. Aber gerade dieses „fast“ ist ein Faß ohne Boden: In schwachen Augenblicken zweifel ich sogar an meinen Kontoauszügen: Spiegeln sie wirklich meine Einnahmen und Überweisungen vollständig wider? Wie oft habe ich im Nachhinein feststellen müssen, dass ich dicke steuerabzugsfähige Anschaffungen glatt übersehen habe, aber ebenso auch fette Honorare. So oder so verstößt man damit gegen jede Steuermoral (es gibt eine von unten und eine von oben). Die Zweifel rühren aber vor allem daher, dass ich mir „in den Quittungen“ permanent Verstellung vorwerfen muß: Wem mache ich da was vor – und was überhaupt? Wer bin ich? Die Verwandlung zum Staatsbürger in situ. Eigentlich müßte ich denen doch mein Leben erklären (können) – und nicht umgekehrt – die von mir kalkulatorische Rechenschaft fordern. Im Endeffekt und bei Überschreitung sämtlicher Abgabetermine läuft es meist auf eine nüchterne protestantische Bilanz der plausibelsten Gewinne und Verluste hinaus. Indem ich jedoch gezwungen bin, dabei das veranschlagte Jahr noch einmal geistig Revue passieren zu lassen, werd ich plötzlich ganz nachdenklich – und bei so mancher hohen Ausgabe (einer Blitzreise z.B.) geradezu melancholisch. Solche Märsche durch die Quittungen haben durchaus etwas Therapeutisches. Fast wird daraus der Abschluß eines Lebensabschnitts in Form einer Rechnung, die man moralisch und möglichst wasserdicht aufgemacht hat – gezwungenermaßen! Dabei wird neuerdings die Form immer aufwendiger: Manche Steuerklärungen von künstlerisch Selbständigen sehen schon fast so aus wie die Jahresabschlußberichte von „Global Playern“. Andererseits mehren sich auch die Freiberufler, die überhaupt keine Steuererklärung mehr machen – und sich irgendwie veranschlagen oder ausrangieren lassen. Diese Anarchisten, ihrem Selbstverständnis nach, werfen mir Kapitulation, wenn nicht gar Kollaboration vor.
Am Flottesten geht es bei mir voran, wenn die einzelnen Posten so weit geklärt und sortiert sind, dass sie nur noch zusammenaddiert werden müssen. Dazu leihe ich mir eine Rechenmaschine, die das Ergebnis ausdruckt. Und dieser Ausdruck, der an die Seite mit der per Hand notierten Summe der entsprechenden Ein- oder Ausgaben (z.B. für Büromaterial) getackert wird, der bekommt schon allein durch seinen Inhalt (Zahlen) etwas schwer Seriöses. Um das zu unterstreichen, wird der ganze Vorgang abschließend noch in eine Klarsichthülle gesteckt und dann abgeheftet. Umgekehrt soll der SPD-Vorständler Hans-Jochen Vogel jeden „Vorgang“ schon quasi vorab in Klarsichtfolien getütet haben. Neulich fand ich auch in einer Jahresetat-Aufstellung der Bundeswehr den Posten „Klarsichtfolien“: Er belief sich auf 480.000 Euro. Diese Folien kann ich steuerlich absetzen – unter „Büromaterialien“, ein Posten, der bei mir seltsamerweise immer der kleinste ist.
Ein Freund von mir brauchte einmal dringend „Ausgaben“ für seine Steuererklärung. Meine ebenfalls selbständig gewesene Mutter war dazu früher immer zu den Studenten meines Vaters gegangen und hatte sich einfach eine Summe in Höhe ihres „Freibetrags“ von ihnen quittieren lassen. Heute hadern aber die Studenten selbst mit ihrem ihnen längst zu niedrigen Freibetrag. Mein Freund war dazumal Musiker. Er kaufte sich erst einmal einen Quittungsblock, um damit den Kauf eines teuren Instruments zu dokumentieren. Anschließend fehlte unten drunter bloß noch ein Firmenstempel. Diesen ließ er sich extra anfertigen. Beides, den Quittungsblock und den Firmenstempel, setzte er später von der Steuer ab. Wodurch dieser ganze fiktive Vorgang sozusagen alltagsrealistisch abgesegnet wurde. Und tatsächlich hat nichts so eine (staats)pädagogische Wirkung wie die Finanzpolitik, wenn und insofern sie in den mikrosozialen Bereich vordringt – und das tut sie mehr und mehr. Dazu führte einmal der inzwischen pensionierte Westberliner Steuerberater Wolffram – nostalgisch gestimmt – aus: „Man kann sagen, daß gut 90% der Prozesse, die ich geführt habe, auch gewonnen wurden. Heute ist es genau umgekehrt: von zehn Prozessen verliert man neun. Durch die Änderung der Gesetzgebung verlaufen die Prozesse derart einseitig, daß ich schon seit einiger Zeit gar nicht mehr versuche, sie überhaupt zu führen. Es kostet nur viel Zeit, Schreibarbeit und Geld – und führt zu nichts mehr. Es verärgert bloß die Mandanten. Ich hatte meine Aufgabe immer auch darin gesehen, sie gegen die Willkür des Staates zu verteidigen und in Schutz zu nehmen. Heute rate ich Ihnen eher vom Prozessieren ab….Die unteren Gerichte entscheiden nur profiskalisch und reichen dann die Entscheidungen weiter an die höheren Gerichte. Die wiederum sichern sich dadurch ab, daß sie bestimmte Fälle gar nicht mehr annehmen oder nicht mehr öffentlich machen, was damit überhaupt geschieht.
Daß sie bei Gesetzesänderungen einfach Entscheidungen ohne Begründung fällen können, ist furchtbar. Z.B. kann der Bundesfinanzhof, das höchste Steuergericht, Entscheidungen treffen, ohne die Beteiligten anhören zu müssen. Und dann haben sie die Streitgrenzen wesentlich erhöht: weil die früher niedriger lagen, konnte man viel mehr Fälle bis vor den Bundesfinanzhof bringen.
Es gibt ja immer Dinge, die man aus prinzipiellen Erwägungen angreift – weil man sich sagt ‚Das ist ungerecht von den Finanzämtern, wenn das so und so ausgelegt oder gehandhabt wird!‘ Sie haben meinetwegen irgendeine Praxis und da geht es um Privatanteile bei den Kraftfahrzeugkosten. Früher hat man gesagt, die Privatfahrten kommen vor – in gewissem Umfang. Dann haben die Prüfer immer mehr Privatnutzungen von Kraftwagen festgestellt. Dazu gingen sie z.B. während eines Fußballspiel zum Olympiastadion und haben sich auf dem Parkplatz dort die KFZ-Kennzeichen notiert. Dabei haben sie festgestellt, daß viele davon Firmenfahrzeuge waren, die somit nicht allein beruflich genutzt wurden. Nach und nach hat man dann also die Privatanteile immer weiter hochgeschraubt, so daß nun seit 1996, als die letzte Entwicklung erfolgte, ein Fahrtenbuch geführt werden muß, in das jeder Kilometer eingetragen werden muß, wozu aber niemand Zeit hat. Da kommt also das absurde Ergebnis zustande, daß die Kosten von Firmenautos sich überhaupt nicht mehr steuerlich auswirken, nur durch die Pauschalsätze, die zugestanden wurden, und Autos sich also nur noch privat rechnen. Man überlegt also heute, wie man es machen kann, daß man die Autos gar nicht mehr betrieblich anschafft, sondern nur noch mietet oder daß man auf Taxis ausweicht. Bis da auch wieder ein Riegel vorgeschoben wird. Das ist also ein ständiger Kampf, der dazu noch mit unfairen Mitteln geführt wird – von der Finanzverwaltung her. Bedingt durch die Notwendigkeiten vielleicht, aber es macht keinen Spaß mehr. Man zwingt die Leute zu Nachweisen, die eigentlich nicht in ihrem Bereich liegen, denn die Finanzverwaltung müßte eigentlich ihrerseits nachweisen, daß das nicht stimmt, was dort angegeben wird. Und so war früher auch die Rechtssprechung.“
Wegen dieser zunehmend ungemütlicheren Finanzrechtssprechung begreifen sich heute viele junge Steuerberater, vor allem im Osten, wo man den Beruf zu DDR-Zeiten abgeschafft hatte, eher als Finanzmanager – und sagen deswegen zu ihrem Mandanten gerne: „Sie zahlen zu viel Steuern!“ Woraufhin der sie bloß ungläubig anstarrt. „Sie sollten Ihr Geld anlegen!“ Aber wie und wo? Schließlich raten sie ihm zu einer Eigentumswohnung, die z.B. gerade in einem Block auf einer grünen Wiese bei Kassel entsteht. Ihr Erwerb muß mit einem zusätzlichen Bankkredit finanziert werden… Und schon ist der Mandant seine Steuerlast los, aber auch sein kleines Vermögen. Und wenn sich diese Wohnung als unvermietbar erweist, dann kriegt er fortan bei jedem Brief von seiner Bank auch noch Panikattacken. Über 450.000 Leuten in der BRD geht das inzwischen so.
Obwohl ich eher zu wenig als zu viel Steuern zahle, riet mir einmal so ein Steuerberater – in Mitte: „Nehmen sie doch einfach ein paar Studenten, die für Sie in die Quittungen gehen“. Der Mann wollte hoch hinaus – aber nicht mit mir! Ich möchte eher immer weniger zum Leben brauchen, als mehr zu verdienen – während ich in Wahrheit jedoch immer weniger verdiene und mehr zum Leben brauche. Das habe ich auch schon meinem Finanzamt geschrieben. Aber denen geht es ja genauso.
Meine derzeitige „Abgaben-Rückstands-Tilgungsrate“ bei ihnen beläuft sich auf 75 Euro monatlich. Anläßlich einer Recherche über den ominösen Blumenladen-Boom in Mitte rief ich vor einiger Zeit mal beim Auswärtigen Amt in der Französischen Straße an – und bekam auch einen freundlichen Unterstaatssekretär an den Apparat. Er nahm sich einige Tage Zeit, um mir den Jahresetat des AA für Blumenschmuck heraus zu suchen: Es war gar nicht so einfach, „denn viele dieser Posten verstecken sich in Gesamtabrechnungen – von Bewirtungen auf Empfängen z.B.,“ erklärte mir der AA-Mitarbeiter. Schließlich nannte er eine Summe, die so hoch war, dass ich allein für die Blumen, die das AA in einem Jahr verbraucht, fast 1000 Jahre lang die o.e. Tilgungsrate zahlen müßte. Da ich das allein nicht schaffe, muß ich mir die Summe mit vielen anderen Steuerzahlern – noch zu unseren Lebzeiten – teilen. „Der Minister und seine nächsten Mitarbeiter bekommen täglich frische Schnittblumen auf ihre Schreibtische,“ verriet mir der AA-Mitarbeiter noch, der selber nebenbeibemerkt Topfpflanzen bevorzugt. Wie mochte das erst im Umweltministerium sein? Ich kam mir plötzlich ganz mutlos vor. So geht es mir nicht selten, wenn die Finanzpolitik ins Spiel kommt. Einmal habe ich aus lauter Verzweiflung sogar eine Mitarbeit an einer Ausstellung in der NGBK (zum Thema Arbeit) aufgekündigt, weil deren Finanzierung durch Lottogelder eine derart ausgeklügelte Rechnungslegung verlangte, sowie auch eine Ausschreibung noch der kleinsten Anschaffung bzw. Handreichung (Dienstleistung), dass ich bald kaum noch einen „Spielraum“ sah. Nicht zufällig sah man in der Kreuzberger NGBK dann auch den Weggang ihres Oberbuchhalters als den größten Verlust an – er arbeitet jetzt für die Konkurrenz in Mitte: die „Kunstwerke“.
Es ist immer noch vom Alltag die Rede, der jede Kunst und Bewegung schluckt. D.h. am Anfang – bei den ersten Steuererklärungen – handelt es sich dabei noch um zwei völlige verschiedene Personen: Der Steuerzahler und der Mensch sozusagen. Aber dann – mit der letzten Steuererklärung – sind beide identisch geworden – versöhnt: Und das ist dann das Ende! Bei meiner ersten Steuererklärung, Anfang der Achtzigerjahre, als der Partisanentheoretiker und FDP-Politiker Schroers die Künstlersozialversicherung gründete (in Wilhelmshaven – an Stelle des imperialistischen Marinestandorts dort), bin ich noch ausfallend geworden: gegenüber einem Sachbearbeiter beim Finanzamt, weil der die Kunst partout nicht von der Gewerbesteuer befreien wollte. Er gab den Fall dann an einen Kollegen ab, der das bereinigte: zu holen gab es so oder so nichts – bei mir, der ich damals auf dem Land wohnte, wo man schon mangels Kaufreizen viel bescheidener lebt. Zurück zu den Quittungen: Ich geniere mich jedesmal, überhaupt eine zu verlangen, denn richtig ist das nicht. Wenn mich jemand fragt, ob ich es mit oder ohne Quittung haben will, sag ich meistens – schon aus Höflichkeit: ohne.
Aber so geht es auch nicht – auf Dauer, ebensowenig mit meinen 1997 ausgehandelten Abgabe-Rückstands-Tilgungsraten, wie ich gehofft hatte, denn gerade schrieb mir das Finanzamt in einem Drohbrief: „Sollten Sie meiner Aufforderung [die aufgelaufenen Steuerschulden in Höhe von 17.512,76 Euro zzgl. 46,38 Euro Vollstreckungskosten bis zum 10.11.05 zu bezahlen] nicht nachkommen, sehe ich mich gezwungen, wegen Ihres steuerlich unzuverlässigen Verhaltens, das die Wirtschaftsordnung erheblich stört…“ Ich schrieb daraufhin zurück: „‚Erheblich‘ finde ich jetzt übertrieben…“