„Das Ich ist nicht nur hassenswert, es hat nicht einmal Platz zwischen Uns und dem Nichts,“ behauptet der Ethnologe Claude Lévy-Strauss. Wenden wir uns deswegen gleich Escherichia coli zu – zumal „wir selbst nichts anderes sind als eine Kolonie eng assoziierter Bakterien,“ wie einige Mikrobiologen meinen herausgefunden zu haben.
Obwohl wir heute über das Kolibakterium mehr wissen als über jedes andere Lebewesen auf der Welt, ist vieles an ihm noch unerforscht oder strittig. Noch weniger weiß ich über meine eigenen Kolibakterien im Darm. Dabei befinden sich dort zehn mal mehr Bakterien als mein Organismus Zellen hat, wobei diese auch wiederum aus mehreren kooperierenden Mikroorganismen entstanden sind. Allein die Gesamtzahl der Organismen, die frei in meiner Mundhöhle leben, ist größer als die Gesamtheit der Erdbevölkerung. Obwohl erst 0,5 % aller geschätzten 2 bis 3 Milliarden Arten von Mikroorganismen entdeckt und klassifiziert worden sind, weiß man immerhin schon, dass meine Darmflora aus ca. 500 verschiedenen Bakterienarten besteht. An und in meinem Körper befinden sich insgesamt ca. 2 Kilogramm Bakterien. Auch meine Scheiße besteht zu einem großen Teil aus ihnen (100 Milliarden Individuen in einem einzigen Gramm). Andersherum schafft es E.coli mit seiner extremen Säureresistenz nahezu problemlos, durch meinen Magen wieder zurück in den Dickdarm zu gelangen. Dort werden die Bakterien für die Synthese von Stoffen benötigt, die ich selbst nicht produzieren kann (u.a. Vitamine) – und E.coli ist dabei das wichtigste und auch am häufigsten vorkommende Bakterium. Außerdem ist es das erste gewesen, das nach meiner Geburt den vorher sterilen Darm besiedelte – und es wird wahrscheinlich auch das letzte dort sein, nach meinem Tod, wenn die Darmmikroorganismen mich auffressen, weil meine Schleimhäute, die mich zu Lebzeiten davor schützten, sich zersetzen.
Der mittels Geißeln sich fortbewegende Einzeller mit einer Länge von 2-4 Mikron und einem Durchmesser von 1 Mikron gehört zur Familie der Enterobakteriaceen, zu der auch die Durchfall bewirkenden Salmonellen sowie die Shigellen (Ruhrerreger) zählen. Mathematisch gesehen besteht E.coli aus einer halben Million Funktionseinheiten und ist im Gegensatz zu mir nicht nur als Individuum unsterblich, sondern auch als Spezies ubiquitär, d.h. es kann überall leben – in den Wolken genauso wie im Wasser und in der Erde, aber am Liebsten im Darm von Menschen und Tieren. Dort findet es eine ähnliche Umwelt (Ursuppe) wie seine Vorfahren, die Archaebakterien – vor rund 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde. Mit ihnen begann das, was wir Leben nennen. Mit einigem Recht kann man deswegen sagen: Mit den Bakterien fing nicht nur mein (extratrauterines) Leben an, sondern das Leben überhaupt. Außerdem verdanken wir ihnen einen Großteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre sowie auch der geologischen Formationen. Ja, es gibt Lebensforscher, die der Meinung sind, dass die Bakterien uns – vor allem Pflanzen, Tiere und Pilze – nur geschaffen haben, um immer und fast überall ein ausreichendes Nährmedium zur Verfügung zu haben. Nur in seltenen Fällen artet das in vernachlässigbaren Kommensalismus, in unangenehmen Opportunismus oder gar in einen uns schädigenden Parasitismus aus, die Regel ist symbiotisch, d.h. wir haben auch gehörig was davon – um nicht zu sagen, dass wir von ihnen abhängig sind, denn sie können gut und gerne auch ohne uns leben, wir aber nicht ohne sie. Und wenn wir ihnen trotzdem zu Leibe rücken, dann wissen sie sich ebenfalls zu helfen: Bei Antibiotika-Einnahme schaffen es z.B. einige E.coli-Bakterien in meinem Darm, resistent dagegen zu werden, bevor etwa das Schimmelpilzprodukt Penicillin sie alle vernichtet – und damit auch mich. In meiner Blase gelingt es ihnen, sich so lange in Immunzellen zu verstecken, bis die Antibiotikatherapie beendet ist. Außerdem können sie ihren Stoffwechsel bei Bedarf umstellen: Wenn Sauerstoff da ist, atmen sie, wenn nicht, nehmen sie mit anderen Verbindungen vorlieb, mit Nitrat z.B. (als „terminalen Elektronenakzeptor“).
An der Universität Wisconsin gelang es vor einiger Zeit, das „Nummer-Eins-Labor-Arbeitspferd E.coli“ durch zu sequentieren. 15 Jahre dauerte das, aber nun weiß man: Sein „Chromosom“ ist 4,6 Mio Basenpaare lang und enthält 4288 Gene, von denen 40% „komplette Rätsel“ sind, wie die Zeitschrift „Science“ schreibt. Seltsamerweise erkrankten in Wisconsin kurz nach seiner Sequenzierung mehrere Menschen an „potentiell tödlichen E.coli Bakterien“, die angeblich von „kontaminiertem Fleisch aus einer Verarbeitungsanlage“ stammten, zuvor waren dort bereits etliche Schüler erkrankt und sechs Leute sogar gestorben, wobei man eine „E.coli 0157:H7-Infektion“ dafür verantwortlich machte. Eine ähnlich Ursache vermutete man auch bei einer tödlichen Rindererkrankung – ebenfalls in Wisconsin. Hat sich das Bakterium dort etwa für seine „Durchsequentierung“ gerächt? Kürzlich starb dort auch noch eine junge Frau am Bakterium „Clostridium difficile“, das ebenfalls in unserem Darm lebt, mit E.coli aber weder verwandt noch verschwägert ist. Die äußerst keimkritischen US-Ärzte hatten ihren Durchfall mit Antibiotika behandelt, woraufhin sich das Bakterium, um sich zu schützen, in seine Sporenform zurückzog, vorher aber noch zwei giftige Substanzen – Enterotoxin und Zytotoxin – absonderte, an denen die Frau starb: „In den USA ist der Keim auf den Vormarsch,“ hieß es dazu kürzlich in den hiesigen Zeitungen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Zürcher Historiker Philip Sarasin eine Studie über die eine Woche nach dem Attentat vom 11.9.2001 in Amerika brieflich verschickten Sporen von Anthrax-Bakterien, an denen fünf Menschen starben. Was die ganze Nation in eine Paranoia stürzte, die auch vor der Politik nicht Halt machte – wenn die Anthrax-Briefe nicht sowieso aus einem der Regierungslabors kamen, was Sarasins Buch „Bioterror als Phantasma“ nahelegt. Im deutschen Fernsehen warb neulich eine Firma für ihren neuen Staubsauger – mit dem Argument, er könne sogar alle Keime und Bakterien unter dem Sofa vernichten. Mit dem Vogelgrippe-Virus hat uns die amerikanische Paranoia scheinbar vollends eingeholt. Ein Virus ist nebenbeibemerkt kein Lebewesen, er besteht nur aus ein paar proteinumhüllten Genen – und braucht, um lebensbedrohlich zu werden, Bakterien oder Körperzellen, in die er eindringt und in denen er sich vermehrt – bis sie platzen. E.coli kann etliche Virenarten abwehren. Bei ungünstig werdenden äußeren Lebensbedingungen bildet es im Gegensatz zu vielen anderen Bakterien keine Sporen, um sich derart eingekapselt notfalls jahrelang treiben zu lassen – bis bessere Zeiten oder Orte kommen, aber es ist auch so äußerst widerstandsfähig und kann in eine Art Schlafzustand fallen. Einige Bakterienarten können selbst in kochendheißen Quellen, in Säurebädern und sogar in gefrorenem Zustand überleben – man nennt sie deswegen auch Extremophile. Kürzlich fand man in tiefen losen Gesteinsschichten bei Irkutsk 500 Millionen Jahre alte – lebende – Bakterien, die sich statistisch nur alle paar tausend Jahre teilten. Die meisten Bakterien kommen in der Natur in Form von Biofilmen vor, wo sie sich unter günstigen Umständen so schnell teilen können, dass aus einer einzigen Bakterie innerhalb eines Tages 10 hoch 21 werden, nach einer Woche würden deren Nachkommen schon den ganzen Planeten mit einer dicken Schicht bedecken.
Das heißt: wenn sie stets genug Nahrung vorfänden und nicht selbst gefressen werden würden. Bakterien sind selbst wiederum die Nahrungsgrundlage von anderen Mikroorganismen, vor allem der Protoctisten, die sich von ihnen dadurch unterscheiden, dass nicht nur die Zelle, sondern auch ihr Zellkern von einer Membran umhüllt ist, außerdem gibt es bereits Mehrzeller unter ihnen. Bei den Bakterien schwimmen die Cromosomen, d.h. die Träger der Gene, noch frei im Cytoplasma ihres Zellinneren. Daneben fand man dort auch noch Gene von Archaebakterien: Diese wurden irgendwann einmal einverleibt – jedoch nicht verdaut, sondern in den Organismus integriert: als Organellen, d.h. Orgänchen. Die selben Arten gibt es daneben auch noch als freilebende Bakterien. Man kann sogar feststellen, in welcher Reihenfolge sie von ihrer Wirtsbakterie einst „eingefangen“ wurden. Dennoch spricht man hierbei von „Mutualismus“ – auf Gegenseitigkeit beruhend. Das letzte Stück individuelle Freiheit wird dann aufgegeben, wenn sich alle ehemals selbständigen Bestandteile eines Organismus eine gemeinsame Erbinformation teilen. Die ersten, die derart „verschluckt“, „versklavt“ oder „verstaatlicht“ ihre Autonomie verloren und dafür Nahrungssicherheit oder allgemein Risikominimierung eintauschten – weswegen man dabei das Wort „Symbiose“ verwendet – waren die Cyanobakterien, deren Chloroplasten das Sonnenlicht durch Photosynthese in nutzbare chemische Energie und Nährstoffe umwandeln – daneben die Mitochondrien, die in der Lage sind, mithilfe des Sauerstoffs der Luft aus Nährstoffmolekülen chemische Energie zu produzieren. Aus ersteren entwickelten sich über die Protoctisten (mit membranumhülltem Zellkern) und weiteren intrazellulären Symbiosen sowie Zellkoloniebildungen mit -spezialisierungen die Pflanzen, aus letzteren die Pilze und die Tiere. Diese drei jüngsten Stämme des Lebens vermehren sich jedoch nicht mehr durch Zellteilung, sondern im Gegenteil durch Verschmelzung – einer männlichen Samenzelle mit einer weiblichen Eizelle, aus denen dann ein neuer Organismus entsteht (in China nennt man diesen Moment – der beginnenden Embryoentwicklung – Geburt).
Meine E.coli-Bakterien sind demgegenüber ungeschlechtlich. Zudem ist Sexualität und Fortpflanzung bei ihnen getrennt. Mit ihrer Sexualität ist die Berührung oder Kommunikation zweier Individuen gemeint, bei der Gen-Geschenke übergeben werden. Dies geschieht durch direkten Körperkontakt oder mittels elastischer Proteinfäden, so genannter Sexual-Pili, die gleichsam aus der Distanz von einem Bakterium zum anderen hinüberwachsen; die Gene können aber auch – über eine noch größere Distanz – durch einen Virus als Bote von einem zum anderen transportiert werden. Die bakterielle Fortpflanzung hat damit nichts zu tun. Diese geschieht durch Teilung jedes einzelnen Individuums, wobei sich seine Chromosomen sowie auch die integrierten Organellen im Zellplasma ebenfalls teilen müssen. Auf diese Weise ist das Bakterium unsterblich – und sozusagen direkt vor 3,5 Milliarden Jahren aus den ersten Urzellen entstanden. Der Bruch im „Gedächtnis“ tritt erst mit der Verbindung von Sexualität und Fortpflanzung ein. Ich erinnere nur an den Seufzer des Dichters Peter Rühmkorf: „Ach könnte man doch angelesene Eigenschaften vererben!“ Und diese Verbindung – „Verschmelzungssex“ von der Zellbiologin Lynn Margulis genannt – wird erst möglich und vielleicht auch notwendig – mit fortschreitender Endosymbiose der Bakterien.
Statt von Sexualität spricht man bei ihnen von Konjugation, unterscheidet jedoch weiterhin zwischen Gen-Spendern und -Empfängern, obwohl letztere ebenfalls spenden können. Und nicht nur das. Wenn man unter einer Art alle Individuen versteht, die sich untereinander fortpflanzen können – alle Menschen z.B., im Gegensatz etwa zu den indischen und den afrikanischen Elefanten, die sich allzuweit voneinander entfremdet haben – dann gehören alle Bakterienarten genaugenommen zu einer einzigen Art – mit zigtausend Formen und Fähigkeiten, denn sie können alle untereinander Gene austauschen. Insofern stimmt es nicht, was der französische Genetiker und Nobelpreisträger Jacques Monod einst behauptete: „Was für E.coli wahr ist, muß auch für den Elefanten wahr sein.“
Einmal kam es darüber zu einem Streit zwischen ihm und dem Nobelpreisträger Francois Jacob – beide erforschten das Leben am Beispiel von Bakterien. Ihr Streit resultierte daraus, dass für Jacob E.coli plötzlich nicht mehr genug Individualität besaß, um sich ernsthaft weiter mit ihm zu beschäftigen. In seinem Buch „Die Maus, die Fliege und der Mensch“ schrieb er: „Der Bakteriologe Alfred Hershey hatte zwar einmal scherzhaft angemerkt, dass für den Biologen das Glück darin besteht, ein sehr kompliziertes Experiment auszutüfteln und es Tag für Tag zu wiederholen, wobei er jedes Mal nur ein Detail abwandelt. Doch ich wollte eine Veränderung. Seit fünfzehn Jahren ließ ich nun schon ausgesuchte Bakterienpaare im Takt kopulieren. Diese Art von Übung hatte mir viel Befriedigung verschafft. Doch glaubte ich ihre Freuden ausgekostet zu haben. Ich hatte nichts dagegen, eine Art Guru der Sexualität zu werden, aber nicht der Bakteriensexualität. Auch fingen die Bakterien an, mir ein wenig unsichtbar, ein wenig farblos zu erscheinen. Ich wollte etwas Sichtbares, mit Hormonen, Leidenschaften, mit einer Seele. Ich wollte Tiere, denen man ins Auge blicken, die man individuell erkennen, ja benennen konnte. Und die fähig waren, einem auch selbst in die Augen zu blicken.“ Francois Jacob dachte dabei an weiße Mäuse, um die herum er ein ganzes Institut zu gründen beabsichtigte, während Jacques Monod bei den Kolibakterien bleiben wollte.
In seinem grundlegenden Werk „Die Logik des Lebenden“ war Jacob sich noch sicher gewesen: „In einem Lebewesen ist alles auf Fortpflanzung hin angelegt“ (programmiert!). Und sich gefragt: „Von welch anderem Schicksal könnten eine Bakterie, eine Amöbe, ein Farn träumen, als zwei Bakterien, zwei Amöben, mehrere Farne zu werden?“ Ein Bakterium „träumt“ davon, da war sich Francois Jacob sicher, zwei zu werden. Zu den ersten Deutern dieses vermeintlichen Bakterientraums gehörte dann Jacobs Kollege am Collège de France Michel Foucault. In einer Rezension des Buches schrieb er 1970: Nun wissen wir, „dass die komplexeren Organisationsformen (mit der Sexualität, dem Tode, ihrem Begleiter, den Zeichen und der Sprache, ihren fernen Effekten) nichts anderes sind als Umwege, um immer wieder die Reproduktion zu sichern.“ Das kam schon fast Heinz Sielmann nahe, der ungefähr zur selben Zeit angesichts eines in der Sonne tanzenden Mückenschwarm meinte: „Sie haben nur ein Interesse: sich zu vermehren!“ Wobei er dies im Brustton der Überzeugung sagte und zu begrüßen schien. Für Foucault resultierte daraus eher eine „biologische und zelluläre Enttäuschung“, die er jedoch ebenfalls freudig begrüßte, weil sie uns „lehrt, „dass das Diskontinuierliche uns nicht nur begrenzt, sondern zugleich durchdringt: sie lehrt uns, dass die Würfel uns regieren“. Immer wieder ist Foucault später auf diesen „Würfelwurf“ zurückgekommen, der ihm anscheinend ganz wunderbar in den Kram paßte. Bei Jacob fand er ihn, als die Genetik gerade zum Sprung über die Leitwissenschafts-Planke ansetzte, in dessen biologischer „Geschichtsschreibung“, die „uns zeigt, wie und warum man das Leben, die Zeit, das Individuum, den Zufall ganz anders denken muß“ – und zwar von „hier“ aus: in „unseren Zellen“.
Wenn wir also nun unser Leben neu überdenken – nach dem vorläufigen Siegeszug des molekularbiologischen Denkens, dann müssen wir den Blick umdrehen – d.h. ihn durch unseren lichtlosen Schädel in unser Innerstes versenken: bis in das Gedärm…Und dort stoßen wir dann auf die Einzeller – u.a. Kolibakterien – die, wie erwähnt, nur davon träumen, sich zu verdoppeln. Angesichts dessen stellt sich laut Michel Foucault die Frage: „So lange man es zu tun hat mit einem, relativ gesehen, so einfachen Organismus wie einem Bakterium, kann man dann wirklich von einem Individuum sprechen?“ Präziser gefragt: „Kann man sagen, dass es einen Anfang hat, da es schließlich nur die Hälfte einer früheren Zelle ist, die ihrerseits die Hälfte einer anderen Zelle war und so weiter bis in die fernste Vergangenheit des ältesten Bakteriums der Welt?“ Oder – in die andere Zeitrichtung gefragt: „Kann man sagen, dass es stirbt, wenn es sich teilt, zwei Bakterien Platz macht, die unabhängig bestrebt sind, sich alsbald ihrerseits zu teilen?“ Seit Francois Jacob wissen wir, was ein Bakterium ist: „eine Reproduktionsmaschine, die ihren Reproduktionsmechanismus reproduziert, ein Erbmaterial, das sich um seiner selbst willen ins Unendliche vermehrt, reine Wiederholung vor der Singularität des Individuums. Im Verlauf der Evolution war das Lebende eine Verdopplungsmaschine, bevor es ein individueller Organismus wurde.“ Darüberhinaus wissen wir jetzt auch, was das „Auftreten eines Individuums“ evolutionär zur Voraussetzung hat: „das Prinzip der geschlechtlichen Fortpflanzung“. Der daraus entspringende individuelle Lustgewinn hat aber seinen Preis: „die Geburt und den Tod der Individuen“ – sie sind „die Lösung, die die Evolution wählte, um die geschlechtliche Fortpflanzung zu begleiten. Der Tod, sagt Francois Jacob, ist ‚eine im genetischen Programm ex ovo vorgeschriebene Notwendigkeit‘.“
Für die Bakterie gilt das noch nicht: Unser großer Traum von Unsterblichkeit ist mithin für E.coli fast ein Dauerzustand, denn sie teilt sich alle zwanzig Minuten – bei günstigen Lebensbedingungen: z.B. im Labor in einer Nährlösung aus Mineralsalzen und einer organischen Verbindung, die aus einer Kohlenstoffquelle und als Energieträger dienendem Zucker bestehen kann, aber auch aus einer Fleischbrühe. Dieser Einzeller ist wie wir ein Allesfresser. Und weil er sich so schnell reproduziert, für Vererbungsexperimente, d.h. für Kernversuche, wie geschaffen. Auf elektronenmikroskopischen Photographien sieht E.coli sack- bzw. stäbchenförmig aus, wobei diese Form durch seine Zellwand bestimmt wird, die mit einer zweischichtigen Membran ausgekleidet ist. Jacob erklärt dazu: „Die für den Durchgang gewisser Substanzen undurchlässige Membran verhindert, dass aus der Zelle Moleküle entweichen, die sie selber produziert. Hingegen läßt sie gewisse anorganische Salze ohne Hindernisse zirkulieren. Außerdem kann die Bakterienzelle mit Hilfe einer Art von in die Membran eingebauten Pumpen bestimmte Verbindungen absorbieren und konzentrieren – wie gewisse Zucker, die sie im Milieu findet und die für ihren Metabolismus notwendig sind,“ d.h. sie wandelt die ursprünglich in der Glukose vorhandene Ordnung in chemische Energie um. „Ansonsten scheint der Sack nur einige Tausend kleiner Partikel von homogener Größe und kugelartiger Gestalt zu enthalten: dort werden die Proteine synthetisiert. Beim Öffnen des Sacks findet der Chemiker einige Tausend verschiedener Molekülarten.“
Obwohl noch nicht alle Winkel von E.coli erforscht sind, macht es alles in allem einen primitiven Eindruck, meint Jacob, fügt jedoch hinzu: Man darf „Einfachheit“ nicht mit „archaischem Alter verwechseln und die Bakterienzelle als lebendes Fossil, das heißt als unseren gemeinsamen Vorfahren betrachten, denn jedes Lebewesen, Bakterium oder Säugetier, ist das Ergebnis einer Evolution von Milliarden Jahren.“ Wenn wir E.coli durchs Mikroskop betrachten, liegt dahinter eine zwei Milliarden Jahre oder noch längere Geschichte, „die für das Verstehen des Systems ebenso notwendig ist, wie die Kenntnis seiner Struktur“. Kann es demnach sein, dass E.coli manchmal auch von einem früheren oder anderen Leben träumt, von einer noch einfacheren Teilung vielleicht? Und dies um so mehr, als einige Arten sich nicht nur vegetativ, sondern – wie wir auch – geschlechtlich vermehren und sogar in toto miteinander verschmelzen, d.h. fusionieren können (noch ein Traum – auch von uns!) . Und wenn wir die Individualität erst mit dem Gebrauch von Geschlechtswerkzeugen beginnen lassen, also mit der Paarung zwecks Gentransfer, muß man dann nicht zwangsläufig E.coli – trotz seiner „starren Zellwand“ noch als von seinem Milieu, der Umwelt (die z.B. aus dem Darminhalt oder der Nährlösung in einer Petrischale bestehen kann) ungetrennt begreifen? Die Bakterien sind in der Lage, so wie unsere Körperzellen auch, untereinander zu kommunizieren und sich u.a. über ihr kollektives Wachstum, d.h. über die Verlangsamung oder Beschleunigung ihrer Teilung (nach einer Organverletzung beispielsweise) in Sekundenschnelle zu verständigen – die Biologen nennen diese Fähigkeit oder Erscheinung „quorum sensing“ – wörtlich: ein Sinn, mittels dessen sie untereinander Beschlußfähigkeit herstellen, man könnte hierbei auch von einer Vollversammlung sprechen. Wie dieser Sinn funktioniert, darüber gehen die Meinungen noch auseinander. Eine ist die von dem russischen Biologen Alexander Gurwitsch in den Zwanzigerjahren aufgestellte morphogenetische Feld-Hypothese, auf der die heute so genannte „Biophotonentheorie“ basiert. Danach koordinieren die Zellen in einem Organismus ihre Teilung mittels „schwacher Lichtstrahlen“. Wenn eine Zelle stirbt, erlischt buchstäblich ein kleines Licht, was heute mit Photomultipliern meßbar ist (siehe dazu „Kommentar 1“). Dieser Forschungsansatz wird derzeit u.a. von dem deutschen Physiker Fritz-Albert Popp weiter verfolgt. Auf einem Kongreß in Berlin 2005 erklärte der italienische Mikrobiologe Marcello Buiatti die zwischenzelluläre Kommunikation dagegen mit „Signalmolekülen“ – wie Proteine oder gelöste Gase. Alle Zellen sind in ein „dynamisches Beziehungsgeflecht“ eingebunden, „sie agieren und reagieren ständig miteinander.“ Kommunikation sei das, „was das Leben ausmacht, was uns von toter Materie unterscheidet“. Die möglichen Träume der frei lebenden Einzeller bleiben dabei gewissermaßen außen vor. Aber wenn sie mit ihrer Umwelt eins und ungetrennt sind, träumt dann nicht eventuell der ganze Inhalt des Darms oder der Petrischale, in der etliche Milliarden Kolibakterien schwimmen (weswegen man ihre Lebensäußerungen häufig nur statistisch erfassen kann)?
Man könnte noch weiter gehen: E.coli ist Teil der Darmflora, ein für unser Verdauungssystem notwendiger „Symbiont“, der jedoch in einigen Varietäten auch zu einem „Parasiten“ werden kann – zumindest wird er von vielen Ärzten sowie der Reinigungsmittelindustrie als ein solcher begriffen und bekämpft. Nun weiß man aber spätestens seit Michel Serres, daß „die besten Wirte manchmal auch die besten Parasiten sind“. Für Serres stellte sich dabei die Frage, ob nicht jede Forschung eine „Parasitologie“ ist und ob die parasitären Verhältnisse nur „der pathologische Auswuchs irgendeines Gebietes sind oder ganz einfach das System selbst“? Letzteres könnte bedeuten, dass E.coli unsere Träume sozusagen mitträumt oder sogar -trägt, mindestens darin vorkommt: und sich z.B. schon freut, wenn wir uns nach einigen Tagen Magermilchdiät entschlossen haben, eine deftige Fleischbrühe zu essen. Was wir uns mit unserem Appetit erklären würden. Er könnte uns jedoch auch aufgezwungen sein – in dem Moment, wo man z.B. von einem „unerklärlichen Heißhunger“ spricht. Umgekehrt weiß ich von meiner (inneren) Bakterienkultur z.B., dass sie es nicht mag, wenn ich ihr auf nüchternem Magen nach einem langen Arbeitstag gleich mit Rotwein komme, obwohl auch für sie genug Nährstoffe darin enthalten sind. Er scheint aber bisweilen einen „Filmriß“ bei ihr zu bewirken. Wer wehrt sich hier gegen wen? Der Ernährungsforscher Udo Pollmer meint, „das menschliche Gehirn ist evolutionsbiologisch eine Ausstülpung des Darms…Als die ersten organisierten Zellhaufen bemerkten, dass sie besser gedeihen, wenn sie sich andere Zellhaufen einverleiben, brauchten sie ein Nachrichtensystem im Verdauungskanal, das der Eintrittspforte den Wunsch nach Nachschub meldete. Und diese benötigte alsbald einen Sensor, der genießbare Zellen von Kieselsteinen unterschied. Aus diesem Grund sind die meisten Sinnesorgane nahe beim Mund angebracht – und deren Informationen müssen verarbeitet werden. Seither ist unser Gehirn ein Außenposten des Darms. Und deshalb obsiegt letztlich der Appetit über den Verstand.“ Pollmer spricht in diesem Zusammenhang von einem „Darm-Hirn, ENS: Enteric Nervous System“, das den Appetit regelt oder anregt. Nehmen wir an, das u.a. E.coli dahinter steckt, dann sind wir am Ende vielleicht bloß Statisten in einem Biofilm…
Umgekehrt, bei der Realisierung unserer sie ganz eindeutig benutzenden Wissenschaftsträume, spielt das Bakterium aber auch mit – geradezu virtuos. Es ist darüber schier von einem Objekt der Forschung zu einem Subjekt geworden: Indem das kostspielige und umfangreiche Labor, das es zur Bakterienerforschung braucht, nunmehr E.coli selbst geworden ist. Der Berliner Wissenschaftstechnikhistoriker Hans-Jörg Rheinberger sagt es so: Die Molekularbiologen konstruieren „nicht länger Reagenzglasbedingungen, unter denen die Moleküle des Organismus und ihre Reaktionsfolgen den Status wissenschaftlicher Objekte annehmen. Genau andersherum: Der Molekulartechnologe konstruiert informationstragende Moleküle, die nicht länger bereits im Organismus existieren müssen, und um sie zu reproduzieren, zu exprimieren und zu analysieren benützt er das Milieu der Zelle als deren angemessene technische Einbettung. Der Organismus selbst wird damit in ein Labor verwandelt. Worum es von nun an geht, ist nicht länger die extrazelluläre Repräsentation intrazellulärer Strukturen und Prozesse, sondern die intrazelluläre Repräsentation eines extrazellulären Projekts, mit einem Wort: die Um-Schreibung des Lebens.“
Praktisch heißt das z.B., dass in die Bakterie fremdes Genmaterial injiziert wird, damit sie dann lauter vielversprechende neue Stoffe synthetisiert – d.h. produziert. Das fing schon 1982 mit dem von E.coli-Stämmen „künstlich hergestellten“ Insulin an – und hört noch lange nicht bei den neugezüchteten Bakterienstämmen auf, die giftige Abfälle, Gemische, Öle und Schlämme in ungiftige Biomasse verwandeln. In England gelang es einer Forschergruppe unter der Leitung von Georges Vassaux E.coli-Bakterien gentechnisch so zu verändern, dass sie, genauer gesagt ein von ihnen produziertes Enzym, in die Tumorzellen von Mäusen eindringt, um dort die Zelle so vorzubereiten, dass Mittel zur Krebsbekämpfung gezielter wirken, berichtete „Nature“. Und in Kalifornien gelang es dem Gentechniker Pak Chung Wong und seinen Laborkollegen E.coli so zu manipulieren, dass es bei seiner Teilung ein Lied mitvererbt: Sie kodierten den Text des Liedes „It’s a small world“ in DNA-Sequenzen, die sie in das Erbgut der Bakterien einschleusten. Jeder Buchstabe wurde über eine spezifische Abfolge von DNA-Basen kodiert, wobei spezielle Sequenzen am Anfang und Ende des Liedtextes es verhinderten, dass die kodierte Information von E.coli als virales Erbgut identifiziert und zerstört wurde.
E.coli läßt also viel mit sich machen, es stirbt auch keinen „gewöhnlichen Tod“, wie Jacob betont, aber es kann dennoch „vergänglich“ werden: Und zwar paradoxerweise durch eine „von Wachstum und Vermehrung verursachte Verdünnung“ – ein Art statistisches Fading-Away. Und genauso ist dann auch manchmal mein abendlicher Stuhlgang. Umgekehrt soll „eine harte und träge Verdauung“ laut Nietzsche für „die deutsche Tiefgründigkeit“ verantwortlich sein. Diese kann man gar nicht gefährlich genug einschätzen, insofern aus der trägen Verdauung leicht eine Verstopfung werden kann. Der russische Zoologe und spätere Nobelpreisträger Elie Metchnikow stellte um 1900 die These auf, dass unser rasches Altern alles andere als „normal“ ist. Er machte dafür eine Art „Selbstvergiftung“ durch die Produkte bakterieller Zersetzung im Darm verantwortlich. Die Säugetiere, so meinte Metchnikow, scheiden ihren Kot nicht im Laufen aus. Wenn sie es jedoch beim Stillstehen oder wie wir im Hocken tun, setzen sie sich zahllosen Gefahren aus. Um nun die bestmögliche Zeit für die Kotentleerung finden zu können, brauchen Säugetiere geräumige Därme, in denen sie ihren Kot speichern können. In dem von ihnen geschaffenen „Lagerhaus“ gedeihen aber leider die Bakterien besonders gut. Und ihre schädlichen Körpersäfte bewirken wiederum bei uns eine Neigung zu Verstopfung, was sich bis zu einer „chronischen und kumulativen Toxämie pathologischer Senilität“ ausweiten kann. Darüberhinaus werden dann unsere derart vergifteten Zellen leicht Opfer von anderen so genannten phagozytischen Zellen. Der englische Gerontologe P.B.Medawar wandte demgegenüber 1969 ein: „Fischer, die normalerweise nur in Abständen von zehn Tagen Stuhlgang haben, sind nicht die kraftlosen Wracks, die wir in ihnen nach Metchnikows Theorie erwarten müßten. Der Dickdarm ist auch kein bloßer ‚Abfalleimer‘. Pflanzenfresser erhalten einen Teil ihrer Nahrung dank den Zellulose aufspaltenden Bakterien in ihrem Innern – ein harter Schlag für Metschnikows Theorie,“ so Medawar“. Noch weiter geht der bereits erwähnte Ernährungswissenschaftler Pollmer, wenn er den Lebensmittelberatern vorwirft, ihre Diätvorschriften würden angewandt nur zu „schlechtem Gewissen“ führen und den Hang zur Magersucht bestärken: „Die offiziellen Ratschläge empfehlen meist eine Kost, die kalorien-, zucker- und fettarm ist, dafür viele Ballaststoffe und Vitamine, sowie hochwertiges Eiweiß enthält. Es gibt ein Produkt, dass diesen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht wird: Es ist exakt das, was wir jeden Morgen in der Kloschüssel hinterlassen.“
Eine wahre Herkulesarbeit leisten die Bakterien im Darm der Termiten, wo sie das Holz bis dahin aufspalten, das die Termiten es verdauen können, wobei die Mikroorganismen komplizierte Umwandlungsprozesse arbeitsteilig angehen. Die ihrerseits staatenbildende Insekten müssen ihre Nachkommen rechtzeitig mit ihrem bakterienreichen Kot füttern – sonst sind sie später nicht lebensfähig. Ähnliches gilt für die Koalabären, die sich ausschließlich von hochgiftigen Eukalyptusblättern ernähren – deren Verdauung sie äußerst träge macht: ihre Kinder bekommen ebenfalls Kot zu fressen, damit sich die zur Aufnahme der Nährstoffe dieser Blätter notwendigen komplizierten Bakterienkooperationen in ihrem Darm etablieren, noch bevor sie gänzlich entwöhnt werden. Den jungen Bibern fehlen sie in dieser Phase oft noch, so dass sie die Baumrinde nicht verdauen können: Bis zu 50% des Bibernachwuchses stirbt an diesem Bakterienmangel. Auch bei Menschenbabys tritt das Problem gelegentlich auf. Gegen solche Bakterienschwächen im Darm gibt es heute eine Art Joghurt, der quasi in konzentrierter Form diese Mikroorganismen enthält. Die Theorie von Metschnikow, der als Nachfolger von Louis Pasteur die Bakterien bloß als mehr oder weniger gefährliche Krankheitserreger begriff, wurde von Medawar zuletzt noch mit einem weiteren Argument abgetan: Etliche Säugetiere halten ihren Kot gar nicht zurück – sie scheiden ihn notfalls auch im Laufen aus – Kühe z.B..
Bei diesen vor allem Gras fressenden Wiederkäuern entdeckte man ein anderes mikrobielles Verdauungsphänomen: Wenn man die Kolibakterien schon fast als Teil unseres Dickdarms bezeichnen kann – und das auch tut, dann gilt dies noch mehr für Kühe: ihre Verdauungsorgane, speziell der Pansen, sind derart voll mit celluloseabbauenden Bakterien, dass man laut Lynn Margulis sagen kann: „Sie sind die Kuh.“ Das Methan, das diese Bakterien bei ihrer Verarbeitung der Gräser im Pansen freisetzen, kann der Körper nicht absorbieren, er gibt es deswegen durch Furzen und vor allem Rülpsen frei – und das in solchen Mengen, dass man inzwischen die Kühe dieser Welt fast für den gesamten Methananteil in der Atmosphäre (etwa 14%) verantwortlich macht. Agrobiologen wollen diesen Anteil jetzt mit einer Bakterienart aus Känguruhmägen reduzieren: Die ebenfalls pflanzenfressenden Känguruhs produzieren wegen dieser speziellen Bakterien in ihren Vormägen kein Methan. Als erstes Agrarland will Dänemark damit das Klima verbessern. Allein die dänischen Kühe geben pro Jahr 140.000 Tonnen Methangas in die Atmosphäre ab. Auf der Erde leben gegenwärtig etwa 1,48 Milliarden Rinder, dagegen 6,2 Milliarden Menschen. Aber unser Lebensgewicht beträgt insgesamt nur 0,3 Milliarden Tonnen, während das der Rinder vier Mal so hoch ist – und dementsprechend fällt auch ihr Energieverbrauch aus: sie benötigen zig Millionen Hektar Weidefläche. Der Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf, der das und noch viel mehr ausgerechnet hat, will damit sagen, dass die Rinder es darwinistisch gesprochen zur erfolgreichsten Säugetierart gebracht haben – indem sie sich als „Haustier“ dem Mensch andienten – man könnte sie als unsere „Number-One-Exosymbionten“ bezeichnen.
Im Gegensatz zu ihrer Verdauung ist bei unseren Darmbakterien die Furzgasproduktion zu gering, um das globale Klima groß zu beeinflussen, höchstens das Mikroklima eines Zimmers. Aber mit einem nachträglichen Kontrollblick in die Kloschüssel könnte der Mensch vielleicht die jeweilige Befindlichkeit seiner Kolibakterien „entschlüsseln“. D.h. sofern man noch einen der einst von den Nazis durchgesetzten „Flachspüler“ besitzt – und keinen Tiefspüler: wie alle anderen zivilisierten Völker. Der korsische Naßzellenforscher Guillaume Paoli spricht deswegen bei dieser Form der Entsorgungs-Zwischenlagerung von einem „deutschen Sonderweg zum Gully“, der nur langsam – infolge der Amerikanisierung – verschwindet. Die technologische Zukunft besteht hierbei aus einer durch Annäherung an das Becken über einen photolektrischen Mechanismus ausgelösten Wasserspülung, bzw. beim Aufstehen von dem selben: „Das ist eine ’neue Aussage‘ und die Gewißheit, dass es keine Ohnmacht gibt, außer durch Depression,“ meinte dazu der Philosoph J.F.Lyotard, dem diese neumodischen Becken, die er das erste Mal auf der Toilette des Fachbereichs Informatik der Universität Aarhus benutzte, sogleich Beweis dafür waren, „dass es keine primitiven Gesellschaften gibt“. Und in der Tat hat sich auch unter den Biologen langsam die Erkenntnis durchgesetzt, dass es keine Höherentwicklung von einfachen zu immer komplizierten Organismen gibt. E.coli ist auch schon verdammt verwickelt – und je mehr man darüber forscht, desto mehr Rätsel gibt es auf.
Mit der Zeit ist dabei in der gentechnisch ausgerichteten Molekularbiologie die darwinistische Begrifflichkeit – Mutation, Selektion, Konkurrenz etc. – mehr und mehr einer larmarckistischen gewichen: Koevolution, Kooperation, Kollektivität, Koloniebildung und Mutualismus (d.h. „lockere Symbiose“ – so nannte schon der Anarchist Proudhon seine Utopie). Etwas zurückhaltender ausgedrückt: Während die einen Forscher fortfahren, mit Darwin den idealtypischen American Way of Life“ auf die Natur projizieren, sehen die anderen ihre anarcho-kommunitären Lebensprinzipien durch die Ergebnisse der neueren Molekularbiologie bestätigt – die im übrigen bereits von Kropotkin um 1900 vorausgesagt wurden. Für ihn war das nur eine Frage des Fortschritts in der Mikroskopietechnik. Es ist aber auch eine der Versuchsanordnung, des Blicks, der dazu führte, dass das, was z.B. für Justus von Liebig noch eine „chemische Reaktion“ war, für Louis Pasteur schon zur Aktivität eines „lebenden Organismus“ wurde. In Summa kam dabei heraus, dass nun, da der Sozialismus in der Kultur verschwindet, sich langsam die Gewißheit verdichtet, dass er quasi in unserer Natur angelegt ist. Genau umgekehrt wie zu Zeiten der Großen Depression im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts – als die Bauern überall Genossenschaften gründeten und die Arbeiter sich organisierten, aber auch das imperialistisch gewordene Kapital symbiotisch wurde – mit friedlichen und feindlichen Übernahmen, Trusts, Kartellen und Absprachen. Während seine (darwinistisch inspirierten) Ideologen gleichzeitig den Kampf – Jeder gegen Jeden – als natürlich ansahen und damit zudem den aufkommenden Rassismus wissenschaftlich machten.
Auch einige neuere Experimente knüpfen nun explizit wieder Lamarck an: So wuchsen z.B. die Cilien an Wimperntierchen, die man abgetrennt und an anderer Stelle des Einzellers eingepflanzt hatte wieder an – und diese Veränderung wurde sogar über viele Generationen hinweg vererbt: „Was [u.a. der US-Genetiker] Tracy Sonneborn und seine französische Kollegin Jannine Beisson entdeckten, schien diametral dem Dogma gegenüberzustehen, wonach erworbene Eigenschaften nicht vererbt werden können,“ schreibt Lynn Margulis über deren Wimperntierchen-Experimente. „Damit hatte man ein Laborbeispiel“ für das, was bis dahin immer „als lamarckistisch abgetan wurde“. Weiter heißt es bei ihr: „Nachdem man erkannt hatte, wie wichtig die Symbiose in der Evolution war, mußten wir die früheren, zellkernzentrierten Ansichten von der Evolution als einen blutigen Kampf der Tiere revidieren.“ Die von Margulis daraus entwickelte „serielle Endosymbiontentheorie“ ist inzwischen nicht nur offizieller Lehrstoff, sondern auch feministisch zu reinem Kropotkin fortgeschritten. Damit sind vor allem dessen Studien über „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ gemeint, in der er einen wunderbaren Bogen spannte von den Brutgenossenschaften der Vögel bis zu den mittelalterlichen Zünften und den modernen Arbeitergewerkschaften. Margulis selbst bleibt in der Biologie und wirbt seit einigen Jahren für die so genannte „Gaia-Hypothese“, wonach die ganze Erde einschließlich ihrer Atmosphäre wenn schon nicht ein einziger Organismus ist, dann zumindest „im biologischen Sinne einen Körper hat, der durch komplizierte physiologische Vorgänge am Leben erhalten wird“. An anderer Stelle heißt es: „Außerdem ist Gaia ein sehr altes Phänomen. Ihr weltweites System besteht aus Billionen wimmelnder, fressender, sich paarender, Abfälle ausscheidender Wesen. Die zähe alte Gaia ist durch die Menschen keineswegs bedroht. Das Leben auf der Erde hatte schon mindestens drei Milliarden Jahre überstanden, bevor ein lebhafter Menschenaffe, der sich nach einem relativ haarlosen Partner sehnte, überhaupt vom Menschsein zu träumen begann.“
Diese Wendung in der Lebensforschung, die langsam aber sicher den Darwinismus und das Intelligent Design als die zwei Seiten einer sektiererischen Komplementärideologie erscheinen läßt, geht ebenfalls auf russische Wissenschaftler zurück. Die „Gaia-Hypothese“ auf den Begründer der Biospährentheorie Wladimir Iwanowitsch Wernadsky, der bis zu seinem Tod 1945 Mitglied der Akademie der Wissenschaften der UDSSR war; und die „serielle Endosymbiontentheorie“ auf die Botaniker Konstantin Mereschkowski, Andrej Famintsyn und Boris Kozo-Polyansky, deren erste Symbiose-Forschungen (u.a. an Flechten, die aus nichts anderem als Algen und Pilzen bestehen und sich zusammengetan haben, um in Extremklimata überleben zu können) bereits um 1900 veröffentlicht wurden. – Zur selben Zeit, da Pjotr Kropotkin im englischen Exil sein Buch „Mutual Aid“ herausgab. Mereschkowski ging 1917 ins Exil – in die Schweiz.
Der geistige Kern dieser Theorien entstand schon bedeutend früher in Russland – er wurde mitunter als „Lamarxismus“ bezeichnet und kennzeichnete für lange Zeit das Ideengebäude der russischen Intelligenzija. Ich möchte behaupten: bis heute. Auch wenn die Intellektuellen dann von den Bolschewiki als „klassenfremde Elemente“ teils liquidiert und verbannt, teils als Staatsbedienstete korrumpiert wurden – und nach Auflösung der Sowjetunion dort eine nachholende Beschäftigung mit der anglo-amerikanischen Mikrobiologie einsetzte, die sich derzeit jedoch wie oben angedeutet mehr und mehr der früheren russischen Forschung annähert – fast gegen ihren Willen, möchte man meinen. Um diesen langen russischen „Sonderweg“ in der Biologie, der noch gar nicht richtig erfaßt wurde, zu verstehen, muß man auf die besonderen gesellschaftlichen Hintergründe seiner Entstehung eingehen .
Wiewohl man gemeinhin die Herausbildung der Intelligenz als „klagende Klasse“ mit Emile Zola anheben läßt, erreichte sie etwa zur gleichen Zeit im „rückständigen Rußland“, wo sie am konsequentesten die Partei der „Erniedrigten und Beleidigten“ (Dostojewski) ergriff, ihre stärkste moralische Kraft. Nirgendwo sonst auch wurde sie derart verfolgt, wobei – beginnend mit den Dekabristen – Zigtausende nach Sibirien verbannt wurden, emigrierten oder starben. Allein mit den Grabsteinen der „dahingeopferten“ revolutionären Jüdinnen hätte man den langen Weg von Paris nach St. Petersburg säumen können, meinte die marxistische Frauenforscherin Fannina W. Halle 1932. Was sich trotzdem aus diesem Typus in Rußland an Studentenprotest, Frauenbewegung, Kommunen und Terrorismus entwickelte, nahm die westeuropäische 68er-Bewegung und ihren weiteren Verlauf – 100 Jahre vorher bereits – vorweg.
Aus dem Kreis der berühmten „Männer und Frauen der Sechzigerjahre“ die „ins Volk“ gegangen waren, um vor allem auf dem Land die Bauern zu agitieren, bildete sich die Redaktionsgruppe der illegalen Zeitung „Zemlja i Volja“ (Land und Freiheit), in der zunächst noch die unterschiedlichsten revolutionären Ideen koexistierten. Auf einem Treffen in Woronesh kam es 1879 jedoch zu einer Spaltung: Während die einen, um Nikolai Alexandrowitsch Morosow, für den politischen Mord votierten, lehnten die anderen, um Georgi Plechanow und Vera Sassulitsch, Attentate strikt ab. Obgleich letztere 1878 selbst ein kühnes Attentat verübt hatte, indem sie den Stadtkommandanten von St. Petersburg niederschoß, weil der einen ihrer Genossen im Untersuchungsgefängnis wegen mangelnder Ehrerbietigkeit ihm gegenüber auspeitschen ließ – ungeachtet der Gerichtsreform von 1863, mit der Körperstrafen weitgehend verboten worden waren. In einem aufsehenerregenden Gerichtsprozeß (dessen Plädoyers Dostojewski später in seinen Roman „Die Brüder Karamasow“ einarbeitete) wurde Vera Sassulitsch freigesprochen. Das Urteil hob man zwar wenig später wieder auf, aber ihr gelang rechtzeitig die Flucht ins Ausland. Die Tat und der Freispruch machten sie in ganz Europa berühmt, man nannte Vera Sassulitsch „die Mutter des Terrors“, während sie selbst sich im Exil mehr und mehr von jeglichem „Attentismus“ abwandte. Ab 1900 gab sie mit Lenin zusammen die Zeitschrift „Iskra“ (Der Funken) heraus.
Die Militanten von Woronesh hatte ihren Zusammenschluß „Narodnaja Volja“ (Volkswille) genannt, die Gemäßigten für sich den Namen „Cernyi Peredel“ gewählt – schwarze Umverteilung, womit eine gerechte Verteilung des schwarzen, d.h. bewirtschaftbaren Bodens an die Bauern gemeint war. Dabei wollten sie an der altherbebrachten Form der bäuerlichen Selbstbestimmung, der Dorfgemeinschaft (Obschtschina), anknüpfen, die den Gemeinschaftsbesitz an Boden verwaltete. Zunächst studierte diese Gruppe um Plechanow in ihrem Exil jedoch vor allem die Schriften von Marx und Engels, die sie teilweise ins Russische übersetzten. 1881 schrieb Vera Sassulitsch einen Brief an Karl Marx: „Verehrter Bürger!
Sie wissen, daß sich Ihr Werk ‚Das Kapital‘ in Rußland großer Beliebtheit erfreut. Trotz der Konfiszierung der Ausgabe werden die wenigen verbliebenen Exemplare von einer Masse mehr oder weniger gebildeter Leute in unserem Land wieder und wieder gelesen; bedeutende Menschen befassen sich damit. Aber was sie vielleicht nicht wissen, ist, welche Rolle ‚Das Kapital‘ in unseren Diskussionen über die Agrarreform in Rußland und über die ländliche Kommune spielt. Sie wissen besser als jeder andere, wie dringlich diese Frage in Rußland ist. Sie wissen, was Tscherynschewski darüber dachte. Unsere fortschrittliche Literatur wie die [einst von Nekrassow redigierte Zeitschrift] ‚Vaterländische Notizen‘ zum Beispiel, entwickelt seine Ideen weiter fort. Aber diese Frage ist meiner Ansicht nach eine Frage von Leben und Tod…Eines von beidem: Entweder ist diese Landbevölkerung, einmal von den unmäßigen Forderungen des Fiskus, den Zahlungen an die Großgrundbesitzer und von der willkürlichen Verwaltung befreit, fähig, sich in sozialistischer Richtung weiterzuentwickeln, d.h. ihre Produktion und die Verteilung der Güter auf kollektivistischer Basis zu organisieren. In diesem Fall muß der sozialistische Revolutionär all seine Kräfte der Befreiung der Landbevölkerung und ihrer Entwicklung zur Verfügung stellen. Wenn hingegen die ländliche Kommune zum Untergang bestimmt ist, bleibt den Sozialisten nur noch übrig, sich mehr oder weniger gut begründeten Rechnungen hinzugeben, um herauszufinden, in wie vielen Jahrzehnten das Land des russischen Bauern aus seinen Händen in die der Bourgeoisie übergeht…Sie werden dann einzig unter den Arbeitern in den Städten Propaganda machen müssen, die ständig von der Menge der Bauern überschwemmt sein werden…“
Marx gab sich große Mühe bei der Beantwortung des Briefes von Vera Sassulitsch – er lernte sogar Russisch, um dabei einige Originalquellen heranziehen zu können. Schließlich schrieb er ihr – auf Französisch:
In Westeuropa sei die „Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln“, die „Expropriation der Ackerbauern“ ausgehend von England mit „historischer Unvermeidlichkeit“ vollzogen worden, aber in Russland könnte „die Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Russlands“ sein. Nur „müsste man zuerst die zerstörenden Einflüsse, die von allen Seiten auf sie einstürmen, beseitigen“. Der Ackerbaugemeinde wohnt laut Marx ein Dualismus inne, der „sie mit großer Lebenskraft erfüllen kann, denn einerseits festigen das Gemeineigentum und alle sich daraus ergebenden sozialen Beziehungen ihre Grundlage, während gleichzeitig das private Haus, die parzellenweise Bewirtschaftung des Ackerlandes und die private Aneignung der Früchte eine Entwicklung der Persönlichkeit gestatten, die mit den Bedingungen der Urgemeinschaft unvereinbar ist. Aber es ist nicht weniger offensichtlich, dass der gleiche Dualismus mit der Zeit zu einer Quelle der Zersetzung werden kann.“ Neben dem Privateigentum „in Gestalt eines Hauses mit seinem Hof“ könnte sich insbesondere „die parzellierte Arbeit als Quelle der privaten Aneignung“ zersetzend auswirken: „Sie läßt der Akkumulation beweglicher Güter Raum“ und „dieses bewegliche, von der Gemeinde unkontrollierbare Eigentum, Gegenstand individuellen Tausches, wobei List und Zufall leichtes Spiel haben, wird auf die ganze ländliche Ökonomie einen immer größeren Druck ausüben. Das ist das zersetzende Element der ursprünglichen ökonomischen und sozialen Gleichheit. Es führt heterogene Elemente ein, die im Schoße der Gemeinde Interessenkonflikte und Leidenschaften schüren, die geeignet sind, zunächst das Gemeineigentum an Ackerland, dann das an Wäldern, Weiden, Brachland etc. anzugreifen, die, einmal in Gemeindeanhängsel des Privateigentums umgewandelt, ihm schließlich zufallen werden.“
Noch vor Vera Sassulitsch hatte auch die Terroristenfraktion der Narodniki, die ebenfalls gemäß ihrer Statuts für den Erhalt der Obschtschina war, Marx, der sie einmal als „Alchimisten der Revolution“ bezeichnet hatte, einen Brief geschrieben. Darin wurde jedoch nur der baldige Besuch eines ihrer Genossen, Lew N. Hartmann, bei ihm in London angekündigt. Juri Trifonow erwähnt dies in seinem Roman über die Gruppe um Morosow: „Die Zeit der Ungeduld“. Der Gutsbesitzersohn Morosow bekam im übrigen nach der Revolution als verdienter Genosse von den Bolschewiki den Gutshof seiner Väter – in Borok – zurück, um daraus eine limnologische Forschungsstation zu machen, die später zur weltweit größten dieser Art wurde – und noch heute existiert. Ihr wissenschaftlicher Leiter war lange Zeit Boris Kusin, der u.a. Ossip Mandelstam zum Lamarckismus „bekehrte“.
Die noch quasi urkommunistisch organisierte Obschtschina auf Basis einer weitgehenden Subsistenzwirtschaft zersetzte sich nicht nur langsam von innen, sondern man versuchte auch – und das bis in die jüngste Zeit – sie immer wieder von oben zu zerschlagen, d.h. von der Zentralmacht aus, weil ihr dieser der Prozeß der inneren Auflösung der Dorfgemeinschaften nicht schnell genug voranschritt. Das geschah einmal mit der Landreform von 1861, nach der die von der Leibeigenschaft „befreiten“ Bauern sich zugleich bei den Gutsbesitzern verschulden und damit verdingen mußten. Dann unter dem Druck der Revolution von 1905/07 mit den Stolypinschen Agrarreformen, die den sozialen Differenzierungsprozeß beschleunigen sollten und es jedem Gemeindemitglied ermöglichten, seinen Landanteil zu verkaufen und wegzuziehen. Schließlich ab 1928 mit der Verstaatlichung des gesamten Landes und der Kollektivierung der armen und Mittelbauern bei gleichzeitiger Liquidierung der als ausbeuterisch klassifizierten Kulaken. Aus der Obschtschina wurden dabei Kolchosen und Sowchosen und aus freien Bauern befehlsempfangende Landarbeiter, denen man ab 1932 sogar den Paß abnahm, ohne den sie ihr Dorf nicht verlassen durften. Unter Chruschtschow faßte man 1956 die Dörfer und Produktionskollektive zu „territorialen Wirtschaftseinheiten“ zusammen. 1970 erfolgte unter Breschnew ihre „Reorganisation“. Und 1986 wurde aus dem alten Wort für „Dorfplatz“ – MIR – eine Weltraumstation. Zur selben Zeit bedauerte nebenbeibemerkt der bayrische Filmemacher Herbert Achternbusch: „Da wo früher Pasing und Starnberg waren, ist nun Welt! – die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“
Zuletzt nach 1990 wurden in Russland insbesondere die wenig produktiven Kolchosen und Sowchosen aufgelöst oder sie zerfielen langsam, andere wurden von ihren Leitungskadern aber auch von reichen Städtern privatisiert, d.h. in GmbHs, Aktiengesellschaften oder ähnliches umgewandelt bzw. zerschlagen. Gleichzeitig entstanden jedoch an vielen Orten auf dem postsowjetischen Territorium auch wieder neue, selbstorganisierte Obschtschinas, nicht selten in Form von Sippenverbänden und Gemeinschaften der einst nach Osten verbannten Kulaken; daneben gab es auch wieder Genossenschaften, Artel, Kommunen. Der Geist der alten Dorfgemeinschaft erfaßte sogar Datschensiedlungen. Die kollektive Wirtschaftsweise und die Obschtschina-Idee sind also auch heute noch nicht tot. Sie hatte, wie bereits Trotzki bemerkte, u.a. in den städtischen Fabriken überlebt, wo einzelne Kollektive sich aus ehemaligen Dorfgemeinschaften zusammensetzten, ähnliches galt sogar für die Arbeitslager, Gefängnisse und die neugebauten Hochhäuser am Stadtrand, in denen man bisweilen „Dorfälteste“ wählte. Überhaupt hat noch jede russische Revolte und Revolution die Obschtschina gestärkt.
Im Jahre 1905 befanden sich 9,5 Millionen Bauernhaushalte in Dorfgemeinschaften, daneben gab es 2,8 Mio Einzelhöfe. Deren Zahl verdoppelte sich in der Folgezeit – bis 1917 sämtliche „Reformbemühungen“ von oben „nahezu zunichte gemacht wurden“, wie der antikommunistische US-Historiker Robert Conquest in seinem Buch über die Kollektivierung „Ernte des Todes“ schreibt. Denn Millionen von Kleinbauern nahmen unter der bolschewistischen Parole „Das Land denen, die es bearbeiten“ den Großgrundbesitzern das Land weg „und schlossen sich verstärkt in Dorfgemeinschaften zusammen“, daneben entstanden eine Unzahl von Kommunen, Artel (Genossenschafen) und „befreite Gebiete“. 1927 bewirtschafteten die Dorfgemeinschaften 95 Prozent des Gutsbesitzes, nur 3,5 Prozent waren noch „eigenständige Höfe vom Stolypin-Typus“.
Auf die in Vera Sassulitschs Brief aus dem Jahr 1881 enthaltene Frage, warum ein revolutionärer Kampf für den Erhalt der russischen Dorfgemeinschaft sinnvoll sein könnte, schrieb Marx: „Ich antworte: Weil in Russland, dank eines einzigartigen Zusammentreffens von Umständen, die noch in nationalem Maßstab vorhandene Dorfgemeinde sich nach und nach von ihren primitiven Wesenszügen befreien und sich unmittelbar als Element der kollektiven Produktion in nationalem Maßstab entwickeln kann.“
Unter Alphabetisierung, Aufklärung und politische Agitation auf dem Land verstand man auch und vor allem die Vermittlung agrarwissenschaftlicher Kenntnisse und Techniken. Dabei bildete das Studium der Schriften von Lamarck und Darwin sozusagen die Grundlage. Letzterer hatte sich nach 1859 immer mehr an die teleologische Evolutionstheorie von Lamarck angenähert, wobei dieser Aspekt in der russischen Rezeption von vorneherein betont worden war. So griff Darwin z.B. bei seiner „Erklärung der Evolution des Menschen und seines Verhaltens“ auf die lamarckistische „Hypothese der Vererbung erworbener Eigenschaften“ zurück, erst recht dann in seiner 1871 erschienenen Schrift „Die Abstammung des Menschen durch natürliche Zuchtwahl“, in der es heißt: „Das höchste Element der menschlichen Natur“ wurde und wird „entweder direkt oder indirekt durch die Folgen von Gewohnheit, Geisteskräften, Belehrung, Religion etc. vorangetrieben, viel mehr als durch die natürliche Auslese“. Dieser „Lamarckismus“ half ihm, wie der Biologiehistoriker Torsten Rüting sagt, „sicher zu stellen, dass der Fortschritt unweigerlich, kontinuierlich und auf einen Zweck gerichtet voranschreitet“ – am Ende also die Tugend triumphiert!
Das mußte auch und gerade der Arbeiterbewegung gefallen: Wenn nicht einmal in der Natur die Dinge mehr ewig und unveränderlich waren, dann erst recht nicht in der Gesellschaft – sie stellten Darwin gewissermaßen vom Kopf auf die Füße. So bestand etwa Moses Hess darauf, „daß auch die selbständige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft den Naturgesetzen der Entwicklung unterworfen ist“. Die Theoretiker der Arbeiterbewegung „trafen sich in diesem Punkt mit jenen bürgerlichen Autoren, die den bestehenden feudalen Strukturen kritisch gegenüberstanden und in der Evolutionstheorie eine weltanschauliche Waffe für ihren Kampf um die Modernisierung und Demokratisierung sahen,“ schreiben Kurt Bayertz und Wolfgang Krohn in einem Aufsatz über Friedrich Engels Schrift „Dialektik der Natur“, weiter heißt es bei ihnen: „…wenngleich jedoch auch für Engels kein Zweifel daran besteht, daß die menschliche Geschichte nur die Fortsetzung der Naturgeschichte ist, so wendet er sich doch energisch gegen die von zahlreichen Theoretikern unternommenenen Versuche, die Mechanismen der organischen Evolution (‚Kampf ums Dasein‘) unmittelbar auf die Gesellschaft zu übertragen, da diese der Spezifik menschlichen Handelns nicht gerecht wird. Die menschliche Gesellschaft unterscheidet sich von der Naturgeschichte dadurch, daß die Menschen ihre Geschichte selbst, mit Bewußtsein, machen…“
Dennoch ist der Unterschied zwischen (Darwinscher) Naturgeschichte und menschlicher Kulturgeschichte für Engels kein absoluter, weil „die unkontrollierten Kräfte“ auch in der menschlichen Geschichte noch immer „weit mächtiger sind als die planmäßig in Bewegung gesetzten…Darwin wußte nicht, welch bittere Satire er auf die Menschen und besonders auf seine Landsleute schrieb, als er nachwies, daß die freie Konkurrenz, der Kampf ums Dasein, den die Ökonomen als höchste geschichtliche Errungenschaft feiern, der Normalzustand des Tierreichs ist.“ Für Engels, ebenso wie auch für August Bebel, hebt deswegen nur eine bewußte, planmäßige Produktion den Menschen aus der Tierwelt heraus: Erst der Sozialismus wird diesem „Kampf“ ein Ende bereiten – und die Menschheit in eine neue Phase eintreten, in der kein Ressourcenmangel mehr herrscht – und ein „neuer Mensch“ auf den Plan getreten ist. – Dessen Anfänge sich natürlich gemäß der 3. Marxschen Feuerbachthese noch selbst „umerziehen“ müssen. Dazu wußte z.B. die Terroristin Vera Figner, die bis zu ihrer Verhaftung im Vorstand der „Narodnaja Wolja“ aktiv war, aus eigener 20jähriger Gefängnis-Erfahrung mitzuteilen: „Ich glaube, es ist unmöglich, in langjähriger absoluter Einzelhaft psychisch intakt zu bleiben, nicht wahnsinnig zu werden. Doch daß man nach einem langjährigen Aufenthalt in einer Gemeinschafts-Zelle seine Seele noch intakt bewahrt, scheint mir einzig und allein mit Hilfe einer großen Selbstdisziplin und Umerziehung möglich…“ Es Vera Figner gleich tuend, nahmen derart viele Russinnen im ausgehenden 19. Jahrhundert ein solches „Projekt“ in Angriff, „dass die Frau in Rußland überhaupt zur Seele der Revolution“ wurde, wie eine ihrer Historikerinnen, Fannina Halle, schrieb. Dem lebenslänglich verbannten Dichter Tschernyschewski kommt dabei der Verdienst zu, mit seinem Roman „Was tun?“, den er 1863 in der Peter-Pauls-Festung verfaßte, eine Antwort darauf gegeben zu haben, wie sich die Frauenfrage aus der Theorie in die Praxis umsetzen ließe. „Wir lasen sein Buch mit gebeugten Knien“, erinnerte sich ein ebenfalls nach Sibirien Verbannter, der sich davon mit etlichen anderen zum Terrorismus hatte inspirieren lassen. In Tschernyschewskis Werk „Was tun?“, geht es darum, dass eine Frau aus dem Familienleben ausbricht, um wirtschaftlich unabhängig zu sein und einen sozialen Wirkungskreis zu haben. Dazu gründet sie einen „auf kaufmännischer Grundlage aufgebauten kommunistischen Artel – als erste Zelle eines zukünftigen sozialistischen Staatsorganismus“. Nach Erscheinen des Buches, das einen „Sturm“ auslöste, befürchteten Eltern und Ehemänner, dass ihnen die Töchter bzw. Ehefrauen weglaufen würden – was tatsächlich hier und da auch geschah, so entstanden an vielen Orten „Arbeitsgenossenschaften“. In der Hauptstadt lebten die Frauen in sogenannten Petersburger Kommunen – zusammen mit Studenten. Hier begannen sie mit der Agitation unter Fabrikarbeitern, wobei einige der Frauen bald, „mit falschen Bauernpässen“ versehen, anfingen, in Textilfabriken zu arbeiten.
Über die damalige Rezeption der Darwinschen Theorie in Russland schreibt der Biologiehistoriker Torsten Rütting: „Während Darwins ‚Origin of Species‘ in der schwerfälligen Übersetzung des Botanikprofessors Sergej Raschinskij mit ihren detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen nur eine kleine Schicht von Gelehrten ansprach“, wurde vor allem eine umfangreiche Interpretation seiner Schriften von Dimitrij Pissarew berühmt, die „unverkennbar den Stempel der radikalen Bewegung“ trug. Der junge Publizist und Narodnikisympathisant schrieb sie während einer mehrmonatigen Festungshaft, wo er in einer Einzelzelle direkt neben Tschernischewski saß, wie Wladimir Nabokov in seiner Biographie über diesen hervorhob. Pissarew veröffentlichte seine Darwin-Interpretation 1864 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Russkoje Slovo“ (Das russische Wort). Laut Torsten Rüters machte er darin jedoch erst recht einen „lamarckistischen Darwinismus in Russland populär“, denn er verfehlte das „essentiell Neue an Darwins Idee – das Ineinandergreifen von Variabilität und Selektion“, indem er die „Zweckmäßigkeit in der Organismenwelt als durch bewußte Zielstrebigkeit und Willensanstrengung erwirkte Umweltanpassung der Organismen“ erklärte. „Seine Ausführungen waren konzipiert als ideologische Waffe in den Auseinandersetzungen der 1860er-Jahre um die Erneuerung der russischen Gesellschaft…“ Und diese Kämpfe reichten bald immer tiefer. So berichtet Maxim Gorkij aus der Zeit seines Wanderlebens in „Meine Universitäten“, wie sie in den ärmlichsten Kellerwohnungen Tschernyschewskis und Pissarews Texte studierten, an den Wänden hingen Bildnisse von Herzen, Darwin und Garibaldi, und ein Tolstoianer fragte sie nach seinen Ausführungen polternd: „Seid ihr also für Christus oder für Darwin?“ In den deutschen Arbeiterbüchereien hatte zur selben Zeit ein Buch mit dem Titel „Moses oder Darwin“ die größte Ausleihquote, wie Eric Hobsbawm in seiner Geschichte des „Imperialen Zeitalters“ erwähnt. Gorkij wurde dann von einem ehemals Verbannten mit weiteren „naturwissenschaftlichen Büchern“ versorgt, wobei der ihm riet: „Sie müssen lernen, aber so, daß das Buch Ihnen die Menschen nicht verdeckt.“
Für die gesamte russische Literatur dieser Epoche war es laut Rosa Luxemburg kennzeichnend gewesen, „daß sie aus Opposition zum herrschenden Regime, aus Kampfgeist geboren wurde“. Ein Jahr bevor Nikolai Tschernyschewski seine Erzählung „Was tun?“ veröffentlichte, erschien im „Russki westnik“ (Russische Nachrichten) Iwan Turgenjews Roman „Väter und Söhne. Er skizzierte darin als erster den „Neuen Menschen“ – den Revolutionär als „Beweger“, wie er bald geradezu massenhaft in Erscheinung treten sollte. Die Handlung spielt Ende der Fünfzigerjahre und die Hauptfigur darin, der Medizinstudent Basarow, gehört noch zur Rasnotschinzengeneration, d.h. zu jener revolutionären Bewegung, die nicht mehr wie die Dekabristen zuvor von Adligen angeführt wurde, sondern von Leuten „unterschiedlichen Ranges“, Kleinbürgern also. Turgenjew nennt sie „Nihilisten“ – und meint damit „Revolutionäre“. Sie scharrten sich in jenen Jahren vor der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 um die Zeitschrift „Russkoje slowo“ und „betrachteten die Aneignung und Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse als einzigen Weg zum Fortschritt Russlands“, wie Klaus Dornbacher im Nachwort zur DDR-Ausgabe von Turgenjews „Väter und Söhne“ schreibt. Weiter heißt es dort: Tschernyschewskis Roman sei dazu sowohl „eine Art Fortsetzung als auch eine indirekte Polemik“. So decken sich Basarows Ansichten über „den bestimmenden Einfluß des sozialen Milieus und der Erziehung auf die Entwicklung des Menschen“ fast wörtlich mit den von Dobroljubow und Tschernyschewski propagierten Ideen. Letztere standen damals an der Spitze des Kampfes für den Sturz des Zarismus durch eine Bauernrevolution und die entschädigungslose Aufteilung des Gutsbesitzes. In Turgenjews Roman diskutieren die „Alten“ und die „Neuen Menschen“ bereits die Frage, ob die „Gemeindeselbstverwaltung“ erhaltenswert sei. Basarow zeichnet sich durch eine unsentimentale, vulgärmaterialistische Haltung gegenüber dem „Leben“ aus. Seine Bemerkungen über das Sezieren von Fröschen, um mehr über das Innere der Menschen zu erfahren, mußten übrigens die russischen Schüler mindestens bis zum Ende der Sowjetunion noch auswendig lernen – und sogar auch in Kleingruppen experimentell nachvollziehen: „Das war besonders eklig!“, so Wladimir Kaminers Kommentar dazu 2006.
Auch Tschernyschewski bediente sich bereits in seinem Buch laut Torsten Rütting eines „neurologischen Vokabulars“, um einerseits die Sexualität und die Beziehungen zwischen den Geschlechtern neu zu verhandeln und andererseits diese mit den damals aktuellen Debatten um die Neuordnung der Gesellschaft zu verbinden. Dergestalt nimmt er die lamarckistischen Naturwissenschaften in den Dienst der Zukunft des Neuen Menschen, der kontrolliert und rational ein moralisches und sinnvolles Leben führt. „Viele der russischen Intellektuellen verwarfen in Übereinstimmung mit Marx und Engels, aber auch unabhängig von ihnen, die Idee von der Höherentwicklung durch Konkurrenzkampf, die Darwin von dem englischen Nationalökonom Thomas Malthus übernommen hatte“. Malthus glaubte, bewiesen zu haben, dass das rapide Bevölkerungswachstum verbunden mit einem ständig zunehmenden Mangel an Nahrung quasi automatisch eine natürliche Auslese der Besten gewährleiste. Während jedoch Marx und Engels davon ausgingen, dass Darwin Malthus überwunden habe, indem er dessen Gesetz auch in der Tier- und Pflanzenwelt für gültig erklärte, hielt man in Russland das ganze Prinzip der Konkurrenz eher für ein englisches Insel-Phänomen, dass in den unterbesiedelten russischen Weiten keine Gültigkeit habe. In dieser Einschätzung war sich noch der revolutionäre Narodnik Michailowski mit dem mächtigen ultrakonservativen Oberprokuror Pobjedonoszew einig: Beide taten diesen Aspekt des Darwinismus als eine „händlerische Faustregel“ ab, die „unsere [russische] Seele nicht annehmen“ könne. Auch der Geograph und Anarchist Pjotr Kropotkin war dieser Meinung und bemühte sich, demgegenüber die „Sittlichung“ der biologischen Gesetze – ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen in Sibirien – heraus zu arbeiten – der konservativen Soziobiologie also eine fortschrittliche (russische) Biosoziologie entgegen zu stellen. Ebenso abgelehnt wurden in Russland dann auch die Experimente von August Weismann zur Widerlegung der Vererbung erworbener Eigenschaften und zur Konstanz des Keimplasmas, die u.a. die Theorie des Neo-Darwinismus begründeten, der in seiner molekularbiologischen Fassung dann von einem – „unbewegten Beweger“ ausging und -geht, wie Max Delbrück das später aristotelisch gestimmt nannte.
Die russische Debatte mußte sich nach der Revolution von 1917 noch zuspitzen, denn nun ging es ja um die planmäßige Gestaltung der gesamten Produktion – und auch die Schaffung des Neuen Menschen konnte jetzt im großen Stil in Angriff genommen werden. Zunächst bekamen dabei anscheinend die Neodarwinisten Oberwasser, indem sie die Eugenik als praktisches Projekt ins Spiel brachten – sie versprachen sozusagen eine flächendeckende Verbesserung des Menschenmaterials. 1920 gründeten sich gleich mehrere „Russische Eugenische Gesellschaften“, und die Akademie der Wissenschaften gab einige Jahre lang eine Zeitschrift mit „Eugenik-Nachrichten“ heraus. Es ging den russischen Eugenikern darum, „das menschliche Wesen zu verbessern“, den „höchsten Typ“ aus der Gattung Mensch herauszumendeln. Weil sie dabei auf das nicht zuletzt finanzielle Wohlwollen der Kommunisten angewiesen waren, sahen sie in ihrer Eugenik auch ein „biosoziales Problem“. So gingen einige z.B. davon aus, dass mit dem Sozialismus die Familie und die Ehe als kleinste Zellen der Gesellschaft absterben werden – und schlugen, um einem daraus ihrer Meinung nach resultierenden Bevölkerungsrückgang zu begegnen – die künstliche Besamung vor, aus Samenbanken mit dem Erbgut der „höchsten Typen“ natürlich. Noch 1935 legte z.B. der amerikanische Drosophilaforscher und spätere Nobelpreisträger Hermann Joseph Muller Stalin einen großen eugenischen Plan vor, den er „Aus dem Dunkel der Nacht“ betitelte: „Viele zukünftige Mütter, befreit vom religiösen Aberglauben, werden stolz sein, ihr Keimplasma mit dem eines Lenin oder Darwin zu mischen, um der Gesellschaft mit einem Kind von ihren biologischen Eigenschaften zu diesen…Echte Eugenik kann nur ein Produkt des Sozialismus sein“. Gegen diese makropolitischen Pläne protestierten nicht nur die Frauenverbände, auch in den Zeitungen wurde gegen solche oder ähnliche Mixturen aus Soziologie und Biologie zur Massenproduktion des Neuen Menschen polemisiert, zumal nachdem ab 1933 das faschistische Deutschland die Rassenverbesserung qua Biopolitik auf seine Fahnen geschrieben hatte und die Eugenik damit für die sozialistische Sowjetunion quasi „verbrannt“ war, wobei das Ziel jedoch nicht in Frage gestellt wurde, das man aber eher durch Pädagogik, Kollektivierung, Arbeit auf den Großbaustellen des Sozialismus, mit Taylorismus, Arbeitswissenschaft und – bis zum Sturz Trotzkis – mit Psychoanalyse erreichen wollte. Immer wieder kam es dabei zu neuen Kampagnen und Komsomolprojekten. Nicht die unwichtigsten waren sicher die Selbstversuche, bei denen Einzelne analog zu den einst „berühmten Männern und Frauen der Sechzigerjahre“ sich selbst zu neuen Menschen erzogen – und gleichzeitig in einem Tagebuch darüber Rechenschaft ablegten. Unmerklich weitete sich dieser eher mikropolitisch zu nennende Ansatz – von oben kontrolliert und gefiltert, indem nun auch eine „Neue Natur“ in den Blick geriet: Alles war machbar und ließ sich bewegen. Auch die Pflanzen und Tiere waren lernfähig, man konnte sie erziehen – verbessern. Ein neues Vokabular entstand (dafür) – schließlich eine ganze „proletarische Biologie“….
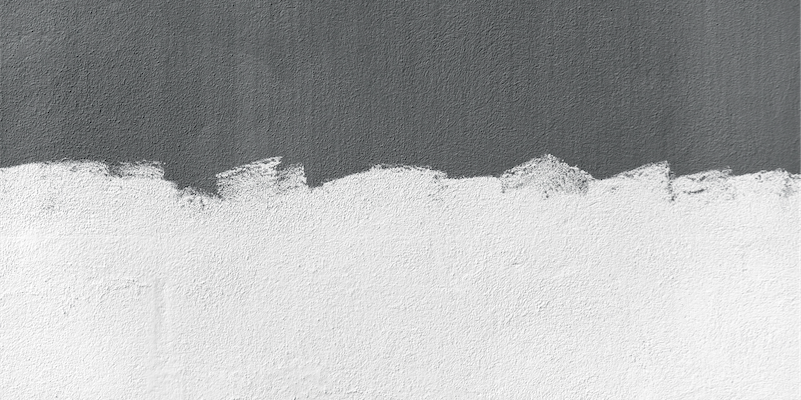



Bei so viel nachgewiesener Nützlichkeit von Bakterien wollte die NASA nicht nachstehen. Die taz meldete am 3.12.:
WASHINGTON dpa/afp | Die Pressekonferenz der Nasa am Donnerstag war mit Spannung erwartet worden. Hatte die US-Raumfahrbehörde etwa außerirdisches Leben entdeckt? Das zumindest meinten einige aus der Vorankündigung heraus zu lesen. Dort hieß es, man habe eine „astrobiologische Entdeckung, die Auswirkungen auf die Suche nach Beweisen für außerirdisches Leben haben wird“. Doch bereits vor der Pressekonferenz nahm die Nasa etwas den Wind heraus: Das was gefunden sei, sei komplett irdisch.
Nun ist es gerade dieser Umstand, die den Fund noch bedeutender macht. In den Sedimenten des kalifornischen Salzsees Mono Lake sind Forscher auf ein Bakterium gestoßen, das das für andere Lebensformen giftige Arsen fressen kann. Mehr noch: Es baut das Metall sogar anstelle von Phosphor in den Körper ein – auch im Erbgut.
„Es handelt sich um irdisches Leben, aber nicht um Leben, wie wir es bisher kennen“, sagte die Nasa-Astrobiologin Mary Yoytek in Washington. Phosphor gehört mit Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff zu den sechs Elementen, die essenziell für das Leben sind – zumindest in seiner bislang bekannten Form.
Das Team um Felisa Wolfe-Simon vom Astrobiologie-Institut der Nasa wollte herausfinden, ob das Leben auch mit anderen Stoffen funktionieren kann. Die Forscher konzentrierten sich in ihrer Studie auf Arsen, weil das Element Phosphor chemisch sehr ähnlich ist.
Genau diese Ähnlichkeit ist auch der Grund dafür, dass Arsen für die meisten Lebewesen hochgiftig ist: Der Stoffwechsel kann die beiden Elemente in ihrer biologisch aktiven Form nicht auseinanderhalten. Wird jedoch Arsen anstelle von Phosphor aufgenommen, funktionieren zentrale biochemische Vorgänge nicht mehr.
Die Forscher züchteten im Labor Bakterien aus dem Sediment des unwirtlichen Mono Lakes, das stark arsenhaltig ist. Dabei erhöhten sie allmählich die Arsen-Konzentration des Wachstumsmediums. Phosphor gaben sie dem Nährboden hingegen nicht zu.
Am Ende verblieb eine Bakterienart, die unter diesen Bedingungen überleben und sogar wachsen konnte. Die Forscher identifizierten sie als den Stamm GFAJ-1 aus der Familie der Halomonadaceae. Das Team wies nach, dass die Bakterien tatsächlich Arsen in ihrem Stoffwechsel verwendeten und damit den fehlenden Phosphor ersetzten.
„Wir haben die Tür einen Spalt weit geöffnet und sehen, was auch andernorts im Universum möglich ist. Und das ist entscheidend“, sagte Felisa Wolfe-Simon. „Diese Untersuchung erinnert uns daran, dass das Leben, wie wir es kennen, viel flexibler sein kann als wir normalerweise annehmen oder uns vorstellen können“, hieß es in einer Mitteilung der Arizona State University.
Und weiter: „Wenn etwas hier auf der Erde so etwas Unerwartetes tun kann – was kann das Leben dann noch, was wir noch nicht gesehen haben?“
Am 22.12. berichtete indes die Süddeutsche Zeitung:
„Im Moment wird ein Haufen Mist publiziert“, warnen manche Wissenschaftler. Deshalb wächst die Bedeutung von Blogs, die die Arbeit der Forscher kritisch begutachten.
Rosie Redfield lässt nicht locker. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte Anfang Dezember gerade die Geschichte von Bakterien in die Welt gesetzt, die angeblich von Arsen leben können und die Chancen für außerirdisches Leben erhöhen, da begann die wackere Mikrobiologin von der University of British Columbia auch schon, die Bakterien-Aliens auf ihrer Webseite auseinanderzunehmen.
Die Arbeit sei eine „schändliche Analyse“, giftet Redfield. „Ich weiß nicht, ob die Autoren einfach schlechte Wissenschaftler sind oder ob sie gewissenlos die ,Es gibt Leben im Weltall‘-Agenda der Nasa erfüllen.“
Die zähe Frau mit pink gefärbten Haaren belässt es nicht bei Beschimpfungen. Sie führt auch harte wissenschaftliche Argumente an; zusammengenommen sind ihre Ausführungen inzwischen länger als die Publikation, die sie so kritisiert. Und Redfield ist vielleicht die aggressivste, aber längst nicht die einzige Kritikerin.
Im Netz tobt ein Kampf über Wohl und Wehe einer Entdeckung, die gerade erst durch eine Publikation in Science geadelt wurde. Das ist immerhin eines der prestigeträchtigsten Fachmagazine einer Wissenschaftswelt, in der die Publikationsliste über den Fortgang von Forscherkarrieren entscheidet. Noch hält die Entdeckerin der Arsen-Bakterien den Science-Schutzschild vor ihre Arbeit. Sie finde es unangemessen, Wissenschaft in Blogs zu diskutieren, sagt Felisa Wolfe-Simon, die sich selbst Eisenlisa nennt (weil Fe das chemische Zeichen für Eisen ist). Jeder sei eingeladen, seine Kritik an Science zu schicken, damit sie darauf reagieren könne.
Doch diese Haltung geht an der Realität vorbei. Wissenschaft wird längst nicht mehr nur vor dem Abdruck von Koryphäen im Auftrag der Fachzeitschriften begutachtet. Weblogs entwickeln sich unaufhaltsam zu einem Wissenschaftskorrektiv, wie es die klassische Wissenschaft lange vermisst hat. (…)