– Und zwar in Form der „größten Schülerzeitung der Welt“ (alte taz-Eigenwerbung). Gemeint ist damit, dass es hier keinen Profitdruck gibt, dafür jedoch die ständige Gefahr, dass das „Projekt“ vom „Fading-Away“ ergriffen wird, weil der anfängliche kollektiv-politische Schwung nachläßt, zermürbt wird, abstirbt usw.. Gemeinhin geht man davon aus, dass die DDR an ihren diktatorischen Zwängen zugrunde ging. Weit gefehlt. Nach der Wende – in der ostdeutschen Betriebsräteinitiative (1) – kamen wir mit der Zeit zu einer genau entgegengesetzten Einschätzung. Dieser Frage ging ich noch einmal nach, als sich später die Gelegenheit zu einer relativ gründlichen Recherche bei Opel in Eisenach ergab:
„Ist es wahr, daß die DDR nicht an zu viel Unfreiheit, sondern eher an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrundeging? fragte ich den Betriebsratsvorsitzenden des Eisenacher Opel-Werks als erstes. Dem 44jährigen Harald Lieske fiel dazu sofort seine eigene Instandsetzungs-Abteilung im früheren Automobil-Werk Eisenach ein, in der bis zu zehn Leute beschäftigt waren, aber nur für drei Arbeit da war. Heute gehe die Tendenz bei der nach produktivsten japanischen Fertigungsmethoden funktionierenden Opel-Fabrik eher in die entgegengesetzte Richtung: Die sechs- bis sieben-köpfigen „Teams“, mit ihren von außen bestimmten „Team-Sprechern“, die nebenbei noch als Springer fungieren, sollen durch die Selbstorganisation ihrer Arbeitspensa nebst ständiger Verbesserungsvorschläge kontinuierlich die Schnelligkeit (Produktivität) steigern – bei mindestens gleichbleibender Qualität.
Schon beim letzten Ukas aus der Zürcher Opel-Zentrale, die Werksferien 1998 von drei auf zwei Wochen zu verkürzen, befürchtete der 15köpfige Betriebsrat (vier davon Freigestellte), daß die Arbeits-Teams dafür zu klein seien. Jeder hat sechs Wochen Urlaub im Jahr, dazu kommt noch eine gewisse Anzahl Krankentage. Der eigentlich für die Organisation und den Papierkram zuständige Team-Leiter müßte dann manchmal für zwei Leute einspringen. Die Eisenacher Geschäftsleitung darf andererseits nicht einfach mehr Leute einstellen und versucht stattdessen den Krankenstand zu senken. Auch bei den Überstunden reagiert sie ähnlich und versucht – nun schon im vierten Jahr – Sonderschichten beim Betriebsrat durchzusetzen, der deswegen jetzt die Einigungsstelle anrief. Das stärkste betriebliche Disziplinierungsinstrument ist jedoch die Selbstorganisation der Teams selbst. Zwar zieht jeder mal einen mit, der an einem Tag verkatert ist, zu Hause Probleme hatte oder ganz einfach mal einen schlechten Tag erwischte. Aber jemand, der dauernd zu spät kommt oder dessen Einsatzfreudigkeit kontinuierlich nachläßt – und so die Team-Leistung drückt, wird von seinen Kollegen rausgedrängt. „Da können wir dann auch nichts mehr machen,“ meint der Betriebsrat.
Im derzeitigen Streit über die anstehende Betriebsferienverkürzung informierte er am 4.September die Belegschaft mit einem Flugblatt: „Auch wenn Vorgesetzte auffordern, bei der Urlaubsplanung im Team bereits von zweiwöchigen Betriebsferien auszugehen, entbehrt das nach wie vor jeder rechtlichen Grundlage. Wir empfehlen allerdings, eine solche Planung dennoch vorzunehmen, weil nur so die Probleme eines verkürzten Urlaubs sichtbar gemacht werden können“. Im übrigen hätte die Geschäftsleitung ihr „Verhandlungsangebot“ mit 40 Neueinstellungen verbessert, diese Zahl sei jedoch noch nicht ausreichend.
Mancher ältere Opel-Mitarbeiter, der schon beim AWE dabei war (nicht selten damals in höherer Position), äußert sich zu solchen oder anderen Betriebs-„Kämpfen“, die anscheinend nie aufhören: „Der Grundkonflikt ist geblieben!“ Gewiß, die Kollektive heißen jetzt Teams und die Neuerungen Verbesserungen. Außerdem gibt es noch jede Menge neuer Amerikanismen (ein ernstes Gespräch ist jetzt ein Audit) und sogar einige Japanismen (zum Beispiel Andon: das Lichtsignal an der Anzeigentafel über den Fließstrecken – mit den Ist-, Soll- und Tendenz-Zahlen, das gelb oder rot blinkt, wenn jemand an der Notleine zieht, weil er nicht mehr weiter weiß.
In der DDR versuchte man 1950 und dann noch einmal 1960 Produktivität und Produkt-Qualität über die „Brigadebewegung“ und den sogenannten „Engagierten“ zu steigern. Nach einem Kontrollkommissions-Audit wurden an den Arbeitsplätzen Tafeln mit der Anzeige „Ich bin Selbstkontrolleur“ angebracht. Umgekehrt schlossen etliche „Engagierten“-Brigaden bzw. die von ihnen (!) gewählten Brigadiere eigene Verträge mit der Werksleitung ab, in denen die Norm-Vorgaben von oben für einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben wurden, und nur „auf der Grundlage der freiwilligen Erhöhung durch die Brigade“, also von unten (!), verändert werden durften: und zwar durch die Entwicklung neuer Arbeitsmethoden, die den Zeitaufwand verringerten. Die „daraus sich ergebenden überflüssigen Arbeitskräfte“ sollten der Werksleitung „zum anderweitigen Einsatz“ überstellt werden. Mit diesen Selbstverpflichtungs-Verträgen wurden die Rechte der Meister und Abteilungsleiter empfindlich beschnitten.
Auf der anderen Seite wurde die Werksleitung damit verpflichtet, „für das erforderliche Material“ und seine rechtzeitige Beschaffung sowie seinen Transport an die Arbeitsplätze zu sorgen. Dieses Mitbestimmungsmodell weitete sich 1951 derart aus, daß man daran dachte (z.B. in der Staatswerft Rothensee), die einzelnen Brigadiere zu sogenannten „Komplexbrigaden“ zusammenzufassen, die wiederum einen Brigadier wählten, dessen Funktion „administrativer Natur“ war. Im Endeffekt lief dies alles auf eine Doppelherrschaft in den Betrieben hinaus, wobei gewerkschaftlicherseits auch immer mit einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität infolge größerer Rechte der Arbeiter argumentiert wurde: Die Brigademitglieder „gingen mit einem ganz neuen Elan an die Aufgaben heran“, was die Leistung der gesamten Brigade verbesserte, wobei die „besten Arbeiter“ auch noch die anderen zur Qualitätsarbeit anspornten. Im Elektromotorenwerk Wernigerode wurden gar Brigade-„Leistungsübersichten“ ausgehängt, und Minuspunkte für Arbeitsfehler verteilt, die sich „jedoch von Monat zu Monat“ verringerten. Noch bis zum Ende der DDR wehrten sich einzelne Brigaden gegen Lohnabzüge bei verminderten Leistungen aufgrund von Versorgungsmängeln, für die sie nichts konnten: sei es, weil die stetige Materialzufuhr nicht klappte, das gelieferte Rohmaterial schlecht oder ihre Maschinen und Werkzeuge verschlissen waren. Bei Narva wurden z.B. Fließstrecken, die in Japan einschichtig liefen, ständig dreischichtig eingesetzt.
Mitte 1951 wurde die „Einführung der wirtschaftlichen Buchführung“ für alle Betriebe obligatorisch, die Werkmeister und Abteilungsleiter erhielten dadurch wieder größere Vollmachten, sie schlugen nun der Werksleitung die von ihnen „entsprechend dem technologischen Prozeß“ zu Brigadieren ernannten zur Bestätigung vor. Es wurde ein „Tag des Meisters“ kreiert. Der Brigadeforscher Jörg Roesler meint, daß man damit die zuvor erkämpften „Selbstgestaltungsfreiräume“ so weitgehend reduzierte, „daß im Prinzip das alte Verhältnis Meister-Kolonnenführer wiederhergestellt wurde, wenn auch die Brigade dem Namen nach erhalten blieb“.
Die zweite „Brigadebewegung“ dann – sollte zwar wie „von unten“ aussehen, wurde jedoch 1959 zunächst von oben, durch den FDGB, initiiert – und bekämpfte zum Beispiel über die Selbstorganisation „Arbeitsbummelei“ und „Trinkerei“, beförderte daneben aber auch – über „Brigadenachmittage“ etwa – das soziale Miteinander. In den Leuna-Werken wurde ein „Tag der Verpflichtungskontrolle“ eingeführt. Schon bald war dort aber auch von „Selbstnormung“ die Rede. Anderswo wollte man das Material selbständig anfordern – ohne Zustimmung durch den Meister, die ihre Verfügungsgewalt über die Brigaden nach und nach wieder verloren. Im Fahrzeugwerk „Sachsenring“ Zwickau verlangten die Arbeiter sogar die Mitbestimmung bei der Prämien-Verteilung für die Werksleitung. „Den Brigaden größere Rechte“ hieß ein wichtiger Artikel in der „Tribüne“, verfaßt vom Aktivisten Rudi Rubbel.
Mit den darauffolgenden Angriffen gegen seine Positionen beschäftigten sich sogar einige Westgewerkschaften in ihrer Presse. Sein Forderungskatalog sah u.a. vor, daß die Brigaden „selbständig Rationalisierungskredite zur Modernisierung der Arbeitsmittel“ aufnehmen konnten. Walter Ulbricht bremste diese Bewegung Anfang Juni 1960 aus: Das sei „Syndikalismus“ und rieche nach „jugoslawischer Selbstverwaltung“, die DDR brauche jedoch „keine neuen Strukturveränderungen“.
Rudi Rubbel wurde nach einer öffentlichen „Selbstkritik“ zunächst die Koordinierung der Neuererbewegung beim FDGB anvertraut, dann machte man ihn zum Leiter des neuen Kombinats Narva. Auch als Werksdirektor blieb er populär. Die Brigadebewegung verkam jedoch zu medial inszenierten Wettbewerbs-Hebeln a la „Jeder liefert jedem Qualität“. Mit der Wende wurde dieser ganze „Gütezeichen Q-Klimbim“, wie man ihn bei Narva nannte, sofort leichtherzig abgeschafft. Nachdem man die älteren und unqualifizierten Mitarbeiter in den Betrieben entlassen hatte, produzierten die so auf wenige Bestarbeiter reduzierten Brigaden kurzzeitig nach der Wende Spitzenleistungen, dafür brachen aber nach und nach die inzwischen geöffneten Märkte für ihre Produkte weg und die Treuhand legte daraufhin einen Betrieb nach dem anderen still.
Das Opel-Werk ist eine Neugründung – auf der sogenannten „grünen Wiese“. Im Prinzip stellen sich den kapitalistischen Managern und ihren Arbeiter-Teams aber heute noch die selben Probleme wie zu Zeiten der sozialistischen Brigadebewegung: Man braucht engagierte Mitarbeiter, die sich mit dem Betrieb identifizieren, aber einerseits gibt es einen ständigen demotivierenden Druck von oben – zur Produktivitätssteigerung und andererseits läßt sich die Arbeitsbegeisterung nicht immer wieder – wie Salzheringe – einpökeln. Einige Jahre nach seiner Inbetriebnahme 1992 war das Opel-Werk Eisenach mit 72 Fahrzeugen je Arbeiter im Jahr „die produktivste Autofabrik Europas“, aber seit kurzem belegt diesen Platz eine japanische Autofabrik in England. Auch bei der Anzahl der Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiter lag Eisenach lange Zeit vorne.
Für den Betriebsratsvorsitzenden Harald Lieske stellt sich der „Druck“ folgendermaßen dar: „Fünf Sekunden braucht der Mitarbeiter zwischendurch, um wieder er selbst zu sein – und genau die wird hier gesucht. Jede Zeitverschwendung wird immer wieder aufgestöbert, um neue Operationen unterzubringen. Es ist aber nirgends mehr Luft. Höchstens noch bei einem günstigen Optionen-Mix“. Mit diesem Halbamerikanismus werden intern die Kundenwünsche bezeichnet, von denen einige mehr Arbeit machen als andere: der Einbau geteilter Rückenlehnen hinten oder ein Schiebedach beispielsweise. Bei der Zeit-Planung ging man von dreißig Prozent derart ungünstiger Optionen aus, jetzt sind es jedoch mitunter schon über sechzig Prozent: „Das ist dann nicht mehr zu schaffen. Damit fährt man unweigerlich über den Takt hinaus und muß das Band anhalten“. Lieske klagt, daß „die meisten Mitarbeiter noch zu wenig Selbstbewußtsein haben, um sich dagegen zu wehren“.
Die erste Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle Eisenach, Renate Hemsteg von Fintel beklagt sich dagegen über den Opel-Betriebsrat, der sich zu wenig für seine Leute einsetze: „Die Mitarbeiter, die die Arbeitsintensität nicht mehr packen, kommen alle zu uns, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sie fühlen sich vom Betriebsrat im Stich gelassen. Opel zahlt keinen richtigen Leistungslohn, d.h. Leistungssteigerungen werden nicht entlohnt, obwohl der Betrieb immer produktiver, die Arbeit also immer anstrengender wird. Schlimm ist auch das gewaltsame Runterdrücken der Krankheitsquote – mittels Rückkehrgesprächen und sogar Kontrollbesuchen zu Hause. Das führt dazu, daß die sich zur Arbeit schleppen, auch wenn sie krank sind. Die Team-Mitglieder erziehen sich gegenseitig, um nicht der Anwesenheitsprämie verlustig zu gehen. Es kann nicht sein, daß einer, wenn er älter wird und nicht mehr so kann, dann von seinem Team rausgedrückt wird“.
Die IG-Metallbevollmächtigte, die sich selbst als eher zu entgegenkommend und tolerant bezeichnet, kommt aus dem Westen. Sie gehörte zu den ersten fünfzehn Funktionären, die nach der Wende „eine neue Struktur im Osten aufbauen“ sollten. Als sie noch einmal alle mit ihrem damaligen Vorsitzenden Steinkühler zusammensaßen und ihn fragten, was sie drüben tun sollten, sagte er: „Fangt einfach mal an!“ Die fünfzigjährige Renate Hemsteg wagte den Neuanfang, baute die Verwaltungsstelle auf und hat sich inzwischen auch in Eisenach eingelebt, mitunter ist ihr das alles sogar schon wieder zu viel Routine dort. „Die Talsohle ist jedoch hier noch nicht durchschnitten,“ meint sie über den derzeitigen Stand der Reindustrialisierung „ihres“ Kreises. Zur Zeit befinden sich sechs größere Betriebe in Gesamtvollstreckung, und zum Jahresende käme eventuell noch ein siebter hinzu. Zu den stabilen Neuansiedlungen rechnet sie das Scheibenwischermotoren-Werk von Bosch (mit 1000 Beschäftigten, demnächst würden dort noch dreihundert weitere eingestellt), eine BMW-Werkzeugmaschinen-Fabrik (mit 220 Beschäftigten), den Opel-Autositze-Hersteller Lear Corporation, der demnächst ebenfalls expandiert (jetzt sind dort 250 Leute beschäftigt), das FER-Werk für Fahrzeug-Elektrik in Ruhla, wo 500 Mitarbeiter u.a. Signalhörner herstellen, ferner das auf dem Opel-Gelände angesiedelte Preßwerk Benteler, das jedoch für VW produziert (mit 480 Beschäftigten). Auch die Getriebeteile-Fabrik Mitec (280 Mitarbeiter) sowie die Umform- und Fügetechnik GmbH, die 200 Leute beschäftigt, produzieren nicht für Opel: „Es wird hier generell kritisiert, daß Opel so gut wie keine Kooperationen mit einheimischen Firmen eingeht, und auch, daß sie bisher nur 10 Lehrlinge jährlich ausbilden“, sagt Renate Hemsteg.
Sie registriert jedoch ein langsames Umdenken, was im Endeffekt auf die Montage eines völlig neuen – eventuell ökologischen – Autos in Eisenach, sogar mit größerer Fertigungstiefe als bisher, hinauslaufen könnte. Bis jetzt werden noch 80% aller Teile aus Spanien angeliefert – „just in time“. Nachdem es in verschiedenen Opel-Werken immer wieder zu Material-Engpässen und Qualitäts-Problemen gekommen sei und die Betriebsräte daraufhin als Co-Manager dem General-Motors-Vorstand vorgerechnet hätten, daß viele der von anderen Herstellern bezogenen Teile (jetzt wieder) billiger und besser im eigenen Werk produziert werden könnten, würde man neuerdings geradezu ein „Insourcing“ verfolgen. Ähnliches wird übrigens auch aus dem Wolfsburger VW-Werk berichtet. Im Opel-Werk Eisenach wurde gerade die Lackiererei auf weitere Farbtöne erweitert. Und ab 1998 soll dort neben dem Corsa auch noch der Astra montiert werden, die Bänder und Schweißroboter werden bereits installiert. Dafür will man hundertdreißig neue Leute einstellen: „Sie müssen zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig Jahre jung sein, dazu Facharbeiter und arbeitslos. Schwerbehinderte werden nicht eingestellt, die produziert Opel Eisenach inzwischen selbst – siebenundzwanzig bis jetzt,“ bemerkt die IG-Metall-Funktionärin bitter. Geplant ist außerdem ein eigenes Preßwerk, sowie die Ansiedlung der Firma Irmscher, die sich auf das „Aufmotzen von Motoren“ spezialisiert hat. Dreihundert Leute will diese Firma zunächst beschäftigen.
Auf der im Oktober zu Ende gegangenen Internationalen Automobilausstellung verkündete zudem der US-Auto-Zulieferer Turbodyne seine Absicht, 100 Millionen DM in Eisenach zu investieren. Bei der noch immer vom Mitgliederrückgang gebeutelten IG Metall-Verwaltungsstelle ist man darüber natürlich froh, dennoch bedauert die Erste Bevollmächtigte, daß damit langsam aber sich wieder alles im Kreis Eisenach vom Automobil abhängt, von einer Branche mithin, „in der die Schwankungen besonders groß sind“. Damit diese nicht immer wieder voll nach unten in den Betrieben durchschlagen, brauchen die Arbeiter starke Interessensvertretungen. Der Organisationsgrad der in Eisenach in der Metallbranche Beschäftigten steigt auch bereits. Bei Opel gibt es außerdem inzwischen 120 Vertrauensleute, ferner sind die ersten zwei Lehrlings-Jahrgänge „sehr engagiert“. Aus diesen Reihen werden wohl Anfang nächstes Jahres einige neue Betriebsräte gewählt werden. Renate Hemsteg meint, daß sie den Problemen der Arbeiter näher stehen als die jetzigen Interessensverter: in der Mehrheit alte AWE-Leute, die dann bei Opel anfangs schnell Karriere gemacht hätten, und nun im Betriebsrat sitzen „und einen Schmusekurs fahren“. So hätten sie z.B. eine neue „Entgeldverordnung“ abgeschlossen, in der die Produktivität nicht genügend berücksichtigt worden sei, was bei den höheren Lohngruppen eine Differenz von bis zu 1000 DM gegenüber dem Werk in Rüsselsheim ergäbe. So etwas zu vereinbaren sei jedoch sowieso Aufgabe der Tarifpartner und deswegen werde die Gewerkschaft diese Entgeldverordnung nicht mittragen.
Als die Arbeitgeber 1995 den Tarifvertrag kündigten und es daraufhin zu Warnstreiks kam, stand Renate Hemsteg selbst unter Druck ihrer Organisation, die darauf drang, daß das Opel-Werk sich den Protesten anschloß. Auf einer Betriebsversammlung wurde die Geschäftsführung zwar heftig ausgepfiffen, aber zu einem Warnstreik reichte es zunächst nicht. Dafür demonstrierten die Arbeiter ihren Unmut, indem sie die grauweißen Einheits-Uniformen auszogen und „etwas Buntes“ überstreiften: Die Geschäftsführung war entsetzt. Als dann jedoch die Beschäftigten trotz Androhung rechtlicher Schritte sogar für eine Stunde rausgingen, gesellte sich die Leitung wieder locker zu ihnen. Später holte die Gewerkschaft sie alle mit Bussen zu einer Nachmittags-Demonstration in Erfurt aus dem Werk: „Dort haben sie dann eine richtige Show abgezogen: Opel marschiert ein – die Opelaner! Inzwischen wissen sie, daß sie die ersten sind, die auf die Straße gehen müssen bei Tarifkonflikten“.
Im Großraumbüro bei Opel, das sich der Betriebsrat u.a. mit der Geschäftsleitung teilt, hängt ein etwas rätselhaftes „Danke Schön“-Plakat aus Saragossa – „für die Streikbewältigung bei Opel-Eisenach“. Die Stimmung in der Belegschaft wird von Betriebsrat und Geschäftsleitung alle zwei Jahre mittels einer freiwilligen Fragebogenaktion ausgelotet, an der letzten – im vergangenen Jahr – beteiligten sich 851 der 1900 Beschäftigten. Die Frankfurter Rundschau registrierte darin einen wachsenden „Unmut“: über die Hälfte der Befragten seien mit ihrer Arbeit nicht zufrieden, 60% fühlten sich nicht leistungsgerecht entlohnt und mit den zweihundertdreißig Teamsprechern seien gar 88% unzufrieden. Das Manager-Magazin hatte zuvor bereits die 1994 durchgeführte Umfrage ähnlich interpretiert, wobei es sich auf den Betriebsrat berief. Damals reagierte der Vorsitzende Harald Lieske noch mit einem Leserbrief: „Ihre einseitige Bewertung der Gruppenarbeit wird möglicherweise so manchem Wettbewerber die Einführung dieses wichtigen Instruments nach Eisenacher Muster verleiden“. Natürlich habe er als Betriebsrat auch Kritik geübt. „Aber unsere Kritik ist keine Systembeschreibung. Und hier irrt der MM-Autor Gottschall. Indem er gut 90% des Positiven unter den Tisch fallen läßt und sich statt dessen auf zudem noch in falsche Zusammenhänge gestellte Zitate des Betriebsrates stützt, entwirft er ein Bild von Opel Eisenach, das die Realität völlig verzerrt“.
Mir erzählte Harald Lieske jetzt, daß viele inzwischen sogar stolz seien, bei Opel zu arbeiten: „Die Fluktuation ist fast Null; die meisten haben sich reingefunden und können damit leben“. Die Teams feiern inzwischen Geburtstage zusammen und es falle ihnen zunehmend schwer, ihre Arbeitsgruppe zu verlassen, was vielleicht damit zusammenhäge, daß man früher hier „eine Kultur der Nähe“ gepflegt habe. In einigen Kneipen treffe ich später auf Arbeiter, die sogar nach Feierabend noch ein T-Shirt mit Opel-Logo tragen. Außerdem gibt es bereits – in Stettfeld – eine „Opel-Ghetto“ genannte Siedlung von Opelanern. Die Geschäftsleitung fördert den Eigenheimerwerb mit Baukrediten bis zu dreißigtausend DM. Dafür dringt sie aber auch darauf, daß die Mitarbeiter sich endlich von ihren Privat-PKWs der Marken Wartburg, Trabant, VW oder Ford trennen und auf Opel umsteigen. Als sich neulich ein Techniker ohne groß nachzudenken mit seiner Frau zusammen einen Toyota anschaffte, kam es bereits zu einem „richtigen kleinen Aufstand: Aber die Leute haben hier eben nicht so viel Geld“. In Eisenach verdienen gerade mal die Nachtschichtler mit Zuschlägen so viel wie die normalen Wechselschichtler in Rüsselsheim. Wenn es auch etliche gäbe, die laut der letzten Umfrage „nicht so zufrieden“ seien, dann liegt das nach Meinung von Lieske „wahrscheinlich an ihrer Überqualifikation“. So habe zum Beispiel eine 42jährige Ingenieurin immer noch „Probleme am Band“ und für einen 54jährigen Diplomingenieur sei die Beschäftigung im Lager geradezu „entwürdigend“. Im übrigen müsse es der Betriebsrat hinnehmen, daß die Prozesse immer wieder optimiert werden, das passiere ja auch bei der Konkurrenz. Seine Aufgabe sei es vor allem, dabei individuelle Benachteiligungen auszugleichen. So sorge zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung dafür, daß keiner durch Verbesserungs-Vorschläge arbeitslos werde. Derjenige oder diejenige (etwa 10% der Beschäftigten sind Frauen) bekomme in dem Falle eine andere – sogar bessere – Arbeit zugewiesen.
Lieske hält die „Autonomie“ der Teams für größer als die der früheren DDR-Brigaden. Bei General Motors gäbe es sogar Überlegungen, ihnen eine eigene Budgetverantwortung (für Werkzeug und Schrottersatz) zuzubilligen, dafür existiere bereits eine eigene Software: „Psychologisch würde dadurch das Gefühl der Autonomie noch verstärkt!“ So wie die Gewerkschaftsfunktionärin über die seit der Wende sukzessive zurückgegangene Bereitschaft zum Straßenprotest klagt, berichtet der Betriebsratsvorsitzende vom nachlassenden Interesse der Belegschaft an den Betriebsversammlungen, die vier mal im Jahr stattfinden, jeweils an einem Samstag, und deren Teilnahme vom Konzern mit 55 Euro belohnt wird. Zur letzten Versammlung, auf der der Betriebsrat wie immer einen Rechenschaftsbericht abgab und die Belegschaft hernach Kritik üben sollte, erschienen nur 900 Beschäftigte, wovon über dreihundert nur noch hinten standen und auf das Ende der Veranstaltung warteten, Wortmeldungen gab es so gut wie keine mehr. Dies führte zu der paradoxen Situation, daß die Geschäftsleitung hernach einen Brief an alle Beschäftigten verschickte, in dem sie sie aufforderte, sich zukünftig mehr an den Betriebsversammlungen zu beteiligen und ordentlich Kritik zu üben. Anscheinend läßt sich solch Versammlungsverhalten bereits als nachlassendes Engagement für die Firma deuten.
Ihre vielgelobte innere Organisation – die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht gar von einem „ästhetischen Gesamtkunstwerk“, in dem die „Menschen am Band einer Ballettgruppe gleichen“ – ist bereits Vorbild für die neuen Opel-Werke in Argentinien und Polen geworden. In Gliwice (Gleiwitz) ist der Elan noch taufrisch: Rafal, ein erst vor kurzem dort eingestellter Mitarbeiter der Logistik-Abteilung berichtete: „Vor einiger Zeit erwähnte der Chef ganz beiläufig, daß wir früher anfangen könnten. Am nächsten Tag war die ganze Abteilung eine halbe Stunde vor Dienstbeginn da – so groß ist hier der Enthusiasmus“. Aber so wie die westdeutschen Opelaner sich nur wenig Gutes von den ostdeutschen erhoffen, hält sich auch die Begeisterung der Eisenacher über die neuen polnischen Opel-Kollegen in Grenzen: Als unlängst – just zur selben Zeit, da die ersten Mitarbeiter aus Gliwice zur Schulung in Thüringen anrückten – neue verschärfte Personen- und sogar Fahrzeugkontrollen am Werkstor angekündigt wurden (ein General-Motors-Audit hatte zuvor die Notwendigkeit dafür festgestellt), meinten viele, das geschähe nicht aus Mißtrauen ihnen gegenüber, sondern nur vorübergehend – wegen der vielen Polen im Werk.
—————————————————————————————————————————-
(1) Näheres über die kurze aber stürmische Entwicklung der ostdeutschen Betriebsräteinitiative:
Aus der Geschichte der italienischen Partisanenbewegung des Zweiten Weltkriegs weiß man, daß der Widerstand gegen die Deutschen fast immer in den Bergbaugebieten begann: Die Avantgarde im Partisanenkampf, das waren – auch anderswo – die Bergarbeiter. Ähnliches galt ab 1990 auch für die Sowjetunion. In Ostdeutschland waren die Bergarbeiter dagegen die letzten, die sich dem proletarischen Widerstand gegen die Okkupanten, in diesem Fall die Treuhandanstalt, anschlossen. Dafür kämpften sie dann jedoch äußerst ausdauernd.
Nachdem die Treuhand ihre Privatisierungsarbeit begonnen hatte, waren die frischgewählten Betriebsräte in der Ex-DDR vor allem damit beschäftigt, die immer wieder neu von oben verfügten Entlassungsquoten „sozial verträglich abzufedern“, d.h. neu zu selektieren. Dabei konnten sie es höchstens schaffen, daß dieser oder jener Mitarbeiter nicht – dafür aber ein anderer entlassen wurde, der dann in der Regel in einer Beschäftigungsgesellschaft landete.
Der Widerstand der Betriebsräte gegen diese von der Treuhand verfügten und von ihr sogenannten „Großflugtage“ begann im Berliner Glühlampenwerk Narva, wo man – nachdem von 5000 Leuten 4000 entlassen worden waren, befürchtete, bald überhaupt nicht mehr produzieren zu können.
Der Widerstand begann jedoch zunächst woanders. Bereits im September 1989 trafen sich fünf DDR-Oppositionelle in Ostberlin und diskutierten über die Frage: »Was wird aus den Betrieben und Gewerkschaften?« Schon bald überschlugen sich die Ereignisse. Die Bürgerbewegten gewannen an Boden, die Wirtschaftsprobleme gerieten dabei immer mehr an den Rand. Eine Gruppe – um Renate Hürtgen und ihre Tochter Stefanie -, inzwischen auf zwölf Leute angewachsen, gründete eilig eine „Initiative für unabhängige Gewerkschaften“. In Vorbereitung der Kundgebung am 4. November auf dem Alexanderplatz verfaßten sie einen Redetext, in dem sie – „basisorientlert“ – dazu aufriefen, unabhängige Gruppen in den Betrieben zu bilden. Damit wandten sie sich über das Maxim-Gorki-Theater an den Arbeitsausschuß zur Vorbereitung des 4. November, der jedoch seine Rednerliste schon voll hatte und überdies nicht am Thema interessiert war. Ein paar Tage später schlichen sie sich – „selbstbewußt genug, um nicht aufgehalten zu werden“ – in das Theater-Cafe, in dem die Redner saßen, darunter auch Heiner Müller und Stefan Heym. Einem von beiden wollten sie den Aufruf geben.
Sie entschieden sich für den bereits deutlich weniger als Stefan Heym von den „Ereignissen“ enthusiasmierten Heiner Müller, der den Text dann auch gleich las und sich sofort bereiterklärte, ihn an Stelle seiner eigenen Rede am 4. November vorzutragen. Eine Passage, die sich kritisch mit der Gewerkschaft beschäftigte („Was hat der FDGB in 40 Jahren für uns entschieden?“) kürzte er. Wichtiger für Müller war der im Aufruf thematisierte grundsätzlichere „Zusammenhang zwischen Arbeitern und Intellektuellen“, der nicht zuletzt aufgrund von Privilegien für die letzteren völlig zerstört worden sei, den es jedoch unbedingt (wieder)herzustellen gelte. Die Rede fiel aus dem Rahmen der allgemeinen Aufbruchsstimmung auf dem Alexanderplatz. Es gab Buhrufe und nur vereinzelt Beifall, als er sagte, die nächsten Jahre werden kein Zuckerschlecken sein, und man brauche jetzt dringend selbstgeschaffene Interessensvertretungen. In einem ND-Artikel wurde Heiner Müllers Rede anschließend als einzige abfällig beurteilt. Er bekam hernach etliche böse Briefe. In einem Artikel in der Gewerkschaftszeitung „Tribüne“ verteidigte er sich später: Die nicht von ihm stammende Rede sei wichtig und richtig gewesen, der FDGB brauche eine wirkliche Konkurrenz. Seine Rede hatte als einzige den Wirtschaftsbereich thematisiert. Wenn er den Aufruf der Initiative für eine unabhängige Gewerkschaft nicht vorgetragen hätte, hätte er irgendetwas aus seinem „Fratzer“ genommen.
Im Berliner Glühlampenwerk Narva ging es dann dergestalt weiter, daß der parteilose Einrichter in der Abteilung Allgebrauchslampe, Michael Müller, Stefan Heym einlud, vor der Belegschaft eine Rede zu halten. Auch der legte ihnen dann die Notwendigkeit einer innerbetrieblichen Interessensvertretung dar, die eine Reorganisation und damit Rettung de Betriebes mitzutragen hätte. Bei der anschließenden Wahl eines Betriebsrates wurde Michael Müller zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Und das blieb er auch- bis zum Schluß, d.h. zuletzt war er Liquidator der letzten Reste der Narva-Umqualifizierungsgesellschaft „Priamos“ (Jetzt ist er Hausmeister des zu computerisierten Büros umgebauten und in „Oberbaum-City“ umbenannten Narva-Komplexes).
Als erstes mußte der neugewählte zwölfköpfige Betriebsrat jedoch gegen die komplette Stillegung des Werkes angehen – zusammen mit der Betriebsleitung. In der Treuhand hatte die von Siemensmanagern dominierte Betriebsbewertungsgruppe Narva auf ihre Abwicklungsliste gesetzt. Nach Protesten stufte der Treuhandchef Detlef Rohwedder den Berliner Renommierbetrieb wieder als „sanierungsfähig“ ein. Nach seinem Tod wurde in der Treuhand jedoch erneut eine „reine Immobilienlösung“ für Narva gesucht – und gefunden: in Form dreier übelst beleumdeter Westberliner Investoren, die sich jedoch derart in Lügen und Tricks verwickelten, daß der Betriebsrat nahezu die gesamte Berliner Presse gegen sie mobilisieren konnte. Zusätzlich gab ich im Auftrag des Betriebsrates die zuvor eingestellte Narva-Betriebszeitung „Lichtquelle“ wieder heraus, um die Belegschaft über den Stand der Auseinandersetzungen zu informieren. Der Verkauf an die drei Immobilienspekulanten wurde schließlich von der Treuhand wieder rückgängig gemacht. Unterdes war aus dem Narva-Betriebsrat und einigen mit ihm solidarischen Betriebsräten aus anderen Großbetrieben eine „Berliner Betriebsräteinitiative“ entstanden, die sich bald mit einer ähnlichen Gruppe in Rostock zur „ostdeutschen Betriebsräteinitiative“ verband. Für letztere stellte ich in unregelmäßigen Abständen das Info „Ostwind“ zusammen, das einige Male der taz beigelegt wurde. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit der Treuhand versammelte unser „Arbeitsausschuß“ allwöchentlich 40 Betriebsräte aus allen möglichen DDR-Großbetrieben und diskutierte Widerstandsformen gegen die flächendeckende Abwicklung der ostdeutschen Industrie. Wiewohl die meisten Westgewerkschaften diese „basisorientierte Initiative“ bekämpften, tagte sie doch stets in Räumen des DGB. Publizistisch begleitet wurde sie primär vom „Neuen Deutschland“. Und den weitaus klügsten Artikel über die Hintergründe des Arbeitskampfes der Bischofferöder Kali-Bergarbeiter veröffentlichte dann Gregor Gysi – im „N.D.“
Um der PDS dieses Feld nicht allein zu überlassen, gründete auch Walter Momper noch schnell eine Betriebsräteinitiative, die im SPD-Haus tagte. Sie war jedoch nur eine Verdopplung der ersten Initiative – und auf Berlin beschränkt. Hier holte sich dann u.a. Rolf Hochhuth Informationen für sein Wendestück „Wessis in Weimar“, während meine Darstellung der Kämpfe des Berliner Glühlampenwerks gegen Treuhandanstalt, Siemens und das Elektrokartell IEA in Pully bei Lausanne u.a. von Günter Grass in seinen Wenderoman „Ein weites Feld“ eingearbeitet wurde.
Nach 1993 rekrutierte die PDS etliche Betriebsräte und Aktivisten aus der Initiative als Bundestags-Abgeordnete: Gerhard Jütemann vom Kaliwerk Bischofferode, Hanns-Peter Hartmann vom Batteriewerk BAE/Belfa in Oberschöneweide (als Nachrücker für Stefan Heym), ferner Pastor Willibald Jacob von der Gossner-Mission und den Westberliner Vorsitzenden der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Manfred Müller.
Das Logo und die Losung auf zwei Transparenten der Betriebsräteinitiative malte uns der Chefdekorateur der DDR-Staatsoper. Der Kontakt zu ihm kam über Konstanze Lindemann zustande: Die Berliner Vorsitzende der IG Medien versuchte später – Anfang 1994 – auch die Reste der Initiative im Rahmen ihrer Gewerkschaft noch eine Zeitlang zusammenzuhalten. Zuvor beteiligte sie sich aktiv am Arbeitskampf der Bischofferöder, weswegen diese umgekehrt der Betriebsräteinitiative Ende 1993 14 000 DM aus ihrem Solldaritätsfonds zukommen ließen. Und später noch einmal 400 DM, um den Bürgermeister von Guernica nach Berlin zu einer IG Medien-Ausstellung über den spanischen Bürgerkrieg einladen zu können. Im Hintergrund half auch immer wieder die »Stiftung Menschenwürde und Arbeitsplatz«, die der ehemalige BMW-Betriebsrat Bernd Vollmer mit einer Erbschaft ins Leben gerufen hatte. Dazu gehört noch der FU-Politologe Bodo Zeuner. Zuerst finanzierte ihre Stiftung einen Betriebsrätekongreß und zuletzt ein Buch über DDR-„Industriepfarrer“, das Willibald Jacob initliert hatte.
Ein „Motor“ der ostdeutschen Betriebsräteinitiative war der maoistische Münchner Historiker Martin Clemens, der mit einer ganz wunderbaren japanischen Gynäkologin verheiratet ist, die unsere Ausschußsitzungen stets mit kleinen handgeschnitzten Gemüse- und Obst-Stücken sowie Reisbällchen versorgte, beim Belfa-Hungerstreik leistete sie medizinischen Beistand. Mit Überschreiten des Höhepunkts der Betriebsräte-Mobilisierung gegen die Treuhand-Polltik gerieten Martin Clemens‘ Aktivitäten jedoch zunehmend zur Revolutionsmechanik, d.h. sie wurden derart unpersönlich, daß die Betriebsräte ihn sowie ein paar andere „intellektuelle Sympathisanten“ schließlich ausschlossen.
Zusammen mit der o.e. „Initiative für unabhängige Gewerkschaften“, die sich inzwischen mit einigen Grünen zu einer „Initiative kritischer GewerkschafterInnen“ umformiert hatte, gründeten diese daraufhin eine zweite Betriebsräteinitiative im Weddinger DGB-Jugendhaus, wo sie dann ihrerseits Jakob Moneta und mich, die wir von der ersten Initiative dorthingeschickt worden waren, ausschlossen. Jakob Moneta meinte, mich auf dem Flur anschließend trösten zu müssen: „Nimm es nicht so schwer, ich bin schon aus meinem Kibbuz, aus der IG Metall und aus der SPD ausgeschlossen worden!« Mittlerweile ist der alte trotzkistische Diamantenschleifer auch aus dem PDS-Vorstand wieder so gut wie ausgetreten. Die Betriebsräteinitiative führte etliche Demonstrationen (u. a. eine nach Bonn) durch, sowie drei große Konferenzen (sie wurden von Martin Clemens alle fein säuberlich, mit Pressespiegel usw., dokumentiert).
Auf der 2. Konferenz 1992, die im ehemaligen WF-Kulturhaus in Oberschöneweide stattfand, das inzwischen ein kurdisches Kulturzentrum geworden war, sprach Jakob Moneta über das bisher Erreichte, wobei er von einer Gewerkschaftstags-Rede des IGMetall-Vorsitzenden Steinkühler ausging, in der dieser die ostdeutsche Betriebsräteinititive kritisiert hatte: „Nachdem Steinkühler uns erst einmal eine ganze Reihe von Komplimenten gemacht hatte, meinte er, daß er es durchaus versteht, wie unsere Lage ist, daß er versteht, daß man sich wehrt und sich zusammenschließt, aber er meinte, das könne man doch alles auch unter dem Dach der Gewerkschaft tun. Unter dem Dach der IG Metall. Da liegt meiner Ansicht nach der Hauptfehler, zu glauben, daß man in einer einzelnen Gewerkschaft das leisten kann, was wir eben im Ansatz geleistet haben. Daß wir praktisch Schluß gemacht haben damit, daß jeder Betrieb und jede Branche für sich allein stirbt, und daß wir stattdessen versuchen, gemeinsam dagegen anzukämpfen. Nun möchte ich aber doch noch einmal zurückkommen auf die Frage, was ist dabei bisher herausgekommen? Darauf haben wir keine klare Antwort gegeben. Ich meine, das Entscheidende dabei war das gewachsene Selbstbewußtsein der Menschen, die selber für ihre Sache einstehen. Das ist nicht nur Theorie. Ich will aus dem Bericht, den der Spiegel gebracht hat, von unserer Bonn-Fahrt und dem Besuch bei der CDU, folgendes vortragen: Dort gab es ja den Herrn Grünewald, den Staatssekretär in Waigels Finanzministerium, der begann die Treuhand zu verteidigen. Er sagte: ‚Wo gehobelt wird, da fallen Späne‘, und behauptete schließlich, daß kein einziger Betrieb in der ehemaligen DDR plattgemacht worden sei, solange Aussicht auf Sanierung bestanden hat. Und da brach ein Tumult los. Es war eine CDU-Betriebsrätin, die ins Saalmikrophon rief. Ich bin nicht bereit, mir weiter diese Unverschämtheiten anzuhören! Daraufhin erhielt sie donnernden Applaus. Ein anderer, der sich ebenfalls als CDU-Betriebsrat vorstellte, sagte: ‚Herr Staatssekretär, ich möchte Sie herzlich bitten, uns nicht weiter zu provozieren!‘ Und ein dritter sagte: ‚Die Revolution vom Herbst 89 ist unblutig verlaufen, das kann jetzt noch anders werden‘.“
Das Selbstbewußtsein der bis Ende 89 zumeist „unpolitische“ Arbeiter bzw. Ingenieure gewesenen Betriebsräte in der „Initiative“ speiste sich vor allem aus ihrer gewählten Funktion – als verantwortungsbewußte Sprecher ihrer Belegschaft, aber auch als die eigentlich und einzig legitimierten Geschäftsführer ihrer Betriebe. Sprachmächtigkeit gewannen sie bei ihren vielen öffentlichen Auftritten, sowie aus dem Erfahrungsaustausch auf den wöchentlich stattfindenden Initiativ-Diskussionen, denen Schilderungen über den Stand der Dinge in den Betrieben (meist die Privatisierung und die Sozialauswahl beim Arbeitsplatzabbau betreffend) vorausgingen. Oft wurden dazu Gewerkschafter und Arbeitsrechtler eingeladen, die z. B.. über ein regionales Wirtschaftskonzept (in und um Finsterwalde etwa) oder über die „Durchgriffshaftung bei Konzernen“ referierten, aber auch konkrete Informationen beschafften: z. B. über den für Treuhand und IG Metall zugleich tätig gewordenen schwäbischen Anwalt Jörg Stein, der fast alle in Ostdeutschland an den Treuhand-„Großflugtagen“ Entlassenen in seinen Beschäftigungsgesellschaften „zwischenparkte“: allein in Sachsen über 20 000.
Später übernahm Jörg Stein auch noch den größten Teil der Bremer Vulkan-Belegschaft in eine extra dafür erworbene Parkraumbewirtschaftungs-Firma „MyPegasus“. Sein Job-Beschaffungsprogramm funktionierte nach Art eines „Piloten-Spiels“.
Der für viele Betriebsräte neue Einstieg in wirtschaftliche Details und Probleme unter dem Gesichtspunkt ihrer Mitbeeinflussung gewann jedoch – bedingt durch die notwendige ständige Abwehr von Treuhand-„Initiativen“ in ihren Betrieben – keine Systematik. Das verhinderten nicht zuletzt auch die permanent auf „Kampf-Aktionen“ drängenden intellektuellen Sympathisanten, für die ein Betrieb bzw. eine Belegschaft erst dann interessant wurde, wenn sie sich so gut wie im Ausstand befand. Martin Clemens entfaltete in solchen Fällen stets eine derart beeindruckend-umsichtige Aktivität, daß ihn z.B. die Belegschaft des Batterewerks Belfa mehrmals darum bat, Durchhaltereden in der Kantine zu halten, als sie einen Hungerstreik gegen Ihre endgültige Treuhand-Abwicklung organisierte. Auch wir anderen aus der Betriebsräteinitiative unterstützten Belfa: beim Transparente-Malen und -Aufhängen und bei ihrer Pressearbeit etwa, aber nur Martin Clemens‘ zündende Worte („Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren!“ etwa) verwischten den Gegensatz von „wir“ (die Unterstützer) und „ihr“ (die im Betrieb Beschäftigten, die im Falle einer Niederlage ihre Entlassung riskierten).
Die Initiative machte danach einfach weiter – und unterstützte z.B. die nächste Belegschaft „in ihrem Kampf“. Das war dann in Bischofferode, wo die Kalil-Kumpel ebenfalls einen Hungerstreik begonnen hatten, nachdem der Kali-Kartellexperte der Bremer Universität Peter Arnold ein Flugblatt über die bevorstehende Schließung ihrer Grube und die Markt-Gründe dafür am Werkstor verteilt hatte. Dort waren dann große Teile der Betriebsräteinitiative so engagiert, daß es schon fast einen regelrechten PKW-Shuttle von Berlin aus gab. Einige beteiligten sich sogar am Hungerstreik: Pfarrer Harald Meslin von der Gossner-Mission und Klaus Wolfram vom Basisdruck-Verlag beispielsweise. Der in der Zwischenzeit entlassene Belfa-Betriebsratsvorsitzende Hanns-Peter Hartmann hielt auf dem Bischofferöder „Aktionstag“ eine Rede, in der er einige Lehren aus „seinem“ Hungerstreik zog, der nach einer Spaltung seiner Belegschaft nur noch halb gewonnen werden konnte. Durch Martin Clemens‘ Engagement im Kaliwerk und sein Einwirken auf den Betriebsrat kam es zu einem Konflikt dort. Der später zurückgetretene Betriebsratsvorsitzende Heiner Brodhun hängte am 27. August 1993 eine Erklärung an das Schwarze Brett, in der er seine zuvor öffentlich geäußerte Distanzierung von „Hobbyterroristen“ noch einmal präzisierte: „Gemeint waren damit Leute, die unseren Arbeitskampf für ihre parteipolitischen Zweck mißbrauchen wollen: Rechtsextreme haben versucht, Bischofferode zu ihrem Tummelplatz zu machen, Marxisten-Leninisten haben ihren privaten Krieg gegen die PDS geführt, und als mir ein Vertreter der ostdeutschen Betriebsratsinitiative in einer Sitzung ‚Verrat an den Kollegen‘ vorgeworfen hatte, da ist mir der Geduldsfaden gerissen“.
In einem ZDF-Interview hatte Heiner Brodhun dazu bereits ausgeführt: „… Eindeutig wurde hier versucht, innerhalb des Betriebsrates einen Keil reinzutreiben.
ZDF: Kann es sein, daß diese Leute aus irgendeinem Kartell kommen?
Brodhun: Das bezweifle ich.
ZDF: In welchem Niemandsland sind diese Leute denn vorzufinden?
Brodhun: Niemandsland insoweit, wie ich auch gesagt habe, die woanders eine Revolution verloren haben und hier versuchen, diese fortzuführen.
ZDF: Wo haben sie denn eine Revolution verloren?
Brodhun: Oder ihre Revolution nicht gewonnen haben, zum Beispiel in anderen Betrieben, wo sie aufgetreten sind und nicht zum Ziel gekommen sind. Denn, bevor man solche Äußerungen macht, erkundigt man sich. Und das habe ich auch getan“.
(Anmerkung von Martin Clemens: Mit den „anderen Betrieben“ meint Heiner Brodhun wohl Belfa.)
Durch Vermittlung von Konstanze Lindemann und dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden der Deutschen Seereederei, Eberhard Wagner, gelang es dann, den Bischofferöder Betriebsrat wieder mit der Berliner Initiative zu versöhnen, nachdem auch der „Sprecherrat“ (der Hungerstreikenden), von dem der Verratsvorwurf zuerst gekommen war, den Betriebsratsvorsitzenden dazu gedrängt hatte, seine halbe „Kapitulationserklärung“ gegenüber der Geschäftsleitung zurückzunehmen. Heiner Brodhun verfaßte dann sogar zusammen mit Martin Clemens einen gemeinsamen Text: „Nach einem offenen und freundschaftlichen Gespräch teilen wir mit, daß die Vorwürfe (Hobbyterrorist u.dgl.) vom Tisch sind. Die Sache ist vorbei. jetzt gilt es nach vorne zu schauen, damit der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze in Bischofferode und anderswo gewonnen wird“.
Damit aber genau das nicht passierte, bekamen z. B. gleich im Anschluß an die Bischofferöder Arbeitskämpfe etliche West-„68er“, die Anstellungen in ostdeutschen Universitäten gefunden hatten, üppige „Drittmittel“ aus Westdeutschland für ihre „Transformationsforschung“, in der sie „ohne Hemmungen“ sogar konkrete Handlungsanleitungen für die Politik – in Form von „Aufruhrpräventions-Konzepten bei Betriebsschließungen“ – lieferten. Dies berichtete uns der Leipziger Philosoph Peer Pasternak, der seine Doktorarbeit über diese „Transformationsforscher“ schrieb, auf einer Veranstaltung des Berliner ABM-Netzwerks Wissenschaft.
Auch weite Teile der Westpresse, bis hin zur taz, hatten nur Verachtung für die dumpf-proletarischen Giftdünger-Produzenten im Eichsfeld übrig. Gleichzeitig pilgerten jedoch immer mehr Bergarbeiter von Rhein und Ruhr, arbeitslos oder krankgeschrieben, mit Solidaritätsspenden nach Bischofferode. Ein Teil davon wurde wie bereits erwähnt später an die Berliner Betriebsräteinitiative weitergeleitet – zur Unterstützung ihrer Ostwind-Redaktion. Und bis heute fühlen einige von uns sich mit den Aktivisten aus Bischofferode freundschaftlich verbunden, und verbringen z.B. ihren Urlaub im Eichsfeld, der sich dort locker mit Recherchen und Gesprächen über den Stand der Dinge verknüpfen läßt. Auch zu anderen Betrieben bzw. Betriebsräten, von denen jetzt viele Geschäftsführer sogenannter Beschäftigungsgesellschaften geworden sind, ist der Faden nie ganz gerissen: erwähnt seien Orwo, Otis, das Werk für Fernsehelektronik, das Frankfurter Halbleiterwerk, die DSR, Gerhard Lux vom AEG-Werk Marienfelde und Ulrike Ahl vom Narva-Sozialkombinat »Brücke«.
In Bischofferode ist vor allem die Pastorin Christine Haas noch aktiv: Mit einigen Eichsfelder Bürgerinitiativen zusammen versucht sie, die Umwidmung stillgelegter Kalischächte in gefährliche Sondermüll-Deponien zu verhindern. Brodhuns Nachfolger Gerd Jütemann wurde dann zwar PDS-Abgeordneter in Bonn gewor-den, er hält sich aber nach wie vor – über den Bischofferöder Tauben- und den Angelverein etwa – auf dem laufenden, z.B. was die einst von der Landesregierung versprochenen Ersatz-Arbeitsplätze betrifft. Mit seinem Nachfolger Walter Ertmer zusammen erwarb er überdies vor einiger Zeit die Poliklinik des Kaliwerks, die zum neuen Domizil der jetzt bereits fast betriebsratslosen und mehrheitlich schon arbeitslosen Kalikumpel umgebaut wird.
Martin Clemens‘ bisweilen allzu kompromißloses – kaltes – Überengagement korrespondierte merkwürdigerweise mit der allzu distanzierten Analytik eines FU-Soziologen: Martin Jander, die Ende September 1993 ebenfalls zu seinem Ausschluß aus der Betriebsräteinitiative – als teilnehmender Beobachter – führte: In der westdeutschen Gewerkschafts-Oppositionszeitung „links“ hatte er einen längeren Artikel über die bisherige Arbeit der Initiative veröffentlicht, in dem es u. a. hieß: „Erkennbar hohe Spenden für die Initiative stammen von der PDS und anderen Parteien. Außerdem wird mit abnehmender Bedeutung der Initiative die mediale Präsentation fast ausschließlich vom Neuen Deutschland gewährleistet“. Sie werde dadurch immer mehr in eine Teilgruppe der „Komitees für Gerechtigkeit“ verwandelt. Dem versuche einzig der Bündnis 90/Grüne-Sprecher Eberhard Wagner gegenzusteuern, der ihren Arbeitsausschuß stärken und das Instrument Initiative wieder zu einer Initiative von Betriebsräten machen will. „Wie eine eigene Zeitung dann finanziert werden soll, wer in ihr schreibt, wer das Sekretariat führt etc., das alles hat die Dritte Betriebsrätekonferenz offengelassen. Diese Fragen werden damit wohl nicht-öffentlich zwischen PDS und Bündnis 90/Grüne entschieden.“
In der Arbeiterbewegung kreist man anscheinend unausweichlich – wenn abstrakte Gesellschaftsanalyse politisch-konkret „zugespitzt“ werden soll oder umgekehrt – um „Verschwörung“ und „Verrat“ … Meiner etwas genaueren Erinnerung nach hatte die Initiative eigentlich nie Geld. Mehrere Ostwind-Ausgaben, die jeweils für ca. 3000 DM bei der taz gedruckt und ihr an einem Tag beigelegt wurden, finanzierten wir über einige Treuhand-Großbetriebe – indem die betreffenden Betriebsräte kurzerhand Anzeigen über „lhre“ Marketing-Abtellungen besorgten. Das für mich merkwürdigste Geld-Problem entstand einmal bei der Anmietung der Kongreßhalle am Alex (für 4000 DM): Als es darum ging, wer aus der Initiative am nächsten Tag den Mietvertrag dafür unterschreiben sollte, breitete sich peinliches Schweigen unter den etwa zwanzig anwesenden Betriebsräten aus. Ohne dem näher auf den Grund zu gehen, erklärte ich mich rasch zu der albernen Unterschrift bereit – mit der Bemerkung: „Ihr werdet mich ja wohl nicht hängenlassen!“ Wovon ich überzeugt war – und bin.
Der FU-Soziologe Martin Jander schreibt weiter: Der aktionistische Anti-Treuhand-Protest der Initiative transportiere undemokratische und antihumanitäre Parolen: „So hing z.B. auf dem Kongreß ein riesiges Transparent an der Wand: ‚Wer von der Treuhand nicht reden will, der soll von Rostock schweigen!‘ Keiner der Anwesenden protestierte gegen diese glatte Rechtfertigung des Pogroms in Rostock. Verzweifelte ‚Avantgarden‘ ohne Massen und hilflose Betriebsräte scheuen sich offenbar nicht, mit Pogromen zu drohen.“
Das Transparent wurde von mir für eine Demonstration der Betriebsräteinitiative gegen die Treuhand-Polltik bereits im Dezember 1992 angefertigt, und keiner aus der Initiative sah etwas Verwerfliches in diesem abgewandelten Horkheimer-Zitat, das original in etwa „Wer vom Kapitalismus nicht reden will, der soll vom Faschismus schweigen“ lautete. Mit der gedanklichen Herstellung eines Zusammenhangs von Treuhandpolltik und Rostocker Vietnamesen-Verfolgungen wollten wir auf die wirtschaftlichen Hintergründe ausländerfeindlicher Aktionen in Ostdeutschland hinweisen – was mir inzwischen geradezu ein Gemeinplatz zu sein scheint. Dennoch votierte ich dann gegen Martin Janders Ausschluß: Soll doch jeder schreiben, was er will!
Eher schon war mir an einem Ausschluß des meiner Meinung nach immer abstrakter werdenden Antikapitalismus und Aktionismus der „intellektuellen Sympathisanten“ in der Betriebsräteinitiative insgesamt gelegen. Obwohl und weil ich genaugenommen dazugehörte und deswegen auch zuvor schon selbst einmal unseren „Ausschluß“, der dann jedoch abgelehnt wurde, beantragt hatte, weil mir an einer der „permanenten Mobilisierung“ eher entgegengesetzten Anstrengugg gelegen war: Daß die Betriebsräteinitiative sich mehr und mehr in markt- und betriebswirtschaftliche Details, die sich mit fortschreitender Privatisierung diversifizierten, vertiefte. Und auch z. B. über die Ausgründungsmöglichkeiten und Chancen ihrer „ABM-Truppenteile“ diskutierte. Der eher induktive Journalismus gestattet dabei anscheinend eher einen „organischen Kontakt“ (Gramsci) als z.B. ein deduktiver Maoismus. Mir schien jedenfalls, daß mein journalistischer Wunsch, darüber kontinuierlich mehr zu erfahren, mit dem Interesse vieler Betriebsräte korrespondierte, etwa die konkreten Bedeutungen und Machtverhältnisse hinter den immer schneller aufeinanderfolgenden wolkigen Treuhand-„Philosophemen“ zu erfassen, mit denen sie fast täglich konfrontiert wurden. Das ging nicht selten bis hin zu regelrechten Erpressungsversuchen und groben Unverschämtheiten: Wenn etwa ein Treuhand-Manager in seinem Büro – die Füße auf dem Tisch – eine Betriebsräte-Abordnung empfing und sagte: „Das kennt ihr wohl noch nicht – diesen neuen amerikanischen Stil“. Ein andermal äußerte ein Privatisierungsdirektor in Anwesenheit zweier Betriebsräte den Wunsch: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen!“ Die Empörung über solche und noch ganz andere Zumutungen war zwar den Initiativ-Diskussionen förderlich, aber nicht wenigen Betriebsräten geriet ihr Interesse an einem tiefergehenden Erfahrungsaustausch in der Initiative angesichts der ständig dort eingebrachten „politischen Notwendigkeiten“ zu einem quasi privatwirtschaftlichen – und deswegen blieben sie mit der Zeit einfach still und leise weg. Der erste war Michael Müller von Narva.
Auf dem personell fast identischen SPD-Betriebsräteforum, dessen Diskussionen von Walter Momper straff geführt wurden und wo ebenfalls Experten (aus Treuhand und Wirtschaftsverwaltung z. B.) Rede und Antwort standen, war das Dilemma etwas anders gelagert: Man bemühte sich dort, die Probleme auf einen „vernünftigen Weg“, meist die institutionellen „SPD-und Gewerkschafts-Schienen“, zu bringen. Wobei man, der damalige Wirtschaftssenator Meisner vorneweg, von diesem Räderwerk derart überzeugt war, daß mit seinem immer offensichtlicher werdenden Leerlauf fast alle Westberliner SPD-„Hoffnungsträger“ schließlich das Handtuch warfen – und in die „freie Wirtschaft“ wechselten. Man nennt das neuerdings die „Politikfalle“. Sie bewirkte übrigens – in völliger Umkehrung der landläufigen Meinung -, daß das Interesse ausländischer Konzerne an ostdeutschen Betrieben weitaus ernsthafter und umfassender war als das der westdeutschen, die damit primär nur ein Konkurrenz-Unternehmen im Osten ausschalten wollten, wobei die Treuhand ihnen meist noch zuarbeitete. Viele Ostbelegschaften erhofften sich dummerweise auch von den Brüder- und Schwester-Unternehmen mehr als von den „Ausländern“.
Auf der letzten SPD-Betriebsrätesitzung im September 1996 meinte ein Referatsleiter aus dem Wirtschaftssenat: „Für die Berliner Wirtschaft ist es jetzt schon 5 nach 12, das sieht selbst der an sich grundoptimistische Finanzsenator Pieroth inzwischen so“. An Hiobsbotschaften von Betriebsräten hatte es jedoch auch dort nie gefehlt. Auf einer taz-Veranstaltung hatte Otto Schily einmal – als Mitglied des Treuhand-Untersuchungsausschusses im Bundestag – gemeint: „Die besten Informationen bekamen wir immer von den Betriebsräten“. Aber auch der „reine Immobiliendeal“ bei Narva und die gänzliche „Abwicklung“ von Belfa konnten durch genaue – veröffentlichte – Informationen verhindert werden, indem sich die Treuhand dadurch mehr und mehr in Widersprüche verwickelte. Das setzte ein konzentriertes Zusammenwirken vieler (bis hin zu den potentiellen Investoren) voraus. In der „Lichtquelle“ (der eingestellten und dann vom Betriebsrat wieder neu herausgegebenen Narva-Betriebszeitung) konnte ich einmal sämtliche Investoren-Konzepte zum Vergleich veröffentlichen. Michael Müller von Narva setzte in diesen „Kämpfen“ eher auf Presse und Politiker, während Hanns-Peter Hartmann von Belfa sich dabei mehr auf die Aktionsbereitschaft seiner Belegschaft verließ, mit der er heute noch gerne zusammen feiert. Michael Müller schätzt dagegen eher einsame Wanderungen im Böhmerwald und meditatives Angeln an sorbischen Seen. Wie auch immer, in der Treuhand nahm man jedenfalls die Betriebsräte zunehmend ernster. Die in einigen Treuhand-Gremien sitzenden westdeutschen Gewerkschaftsvertreter – allen voran die Funktionäre von IG Chemie/Bergbau/Energie – haben unserer kritisch-paranoischen Einschätzung nach die ostdeutschen Belegschafts-Interessen dagegen tendenziell „verraten“, was im Falle ihres allzu schwungvollen „Doppelagenten“ Jörg Stein beinahe justitiabel geriet. An diesem Punkt recherchierten wir auch am genauesten, nachdem sowohl Treuhand als auch IG Metall ihn gegenüber der allzu selbstbewußt auftretenden Belfa-Belegschaft in Position gebracht hatten.
Ebenso end- wie ergebnislos schleppten sich daneben die „Sondierungs-Gespräche“ zwischen Betriebsräteinitiative und Gewerkschaftsvertretern hin. Nach einer Diskussion mit dem DGB z.B. – über eine Unterstützung der geplanten „Protestfahrt“ der Initiative nach Bonn – hielt deren Protokollant aus der Düsseldorfer „Abteilung Vorsitzender“ in einer Gesprächsnotiz fest: „Sofern allerdings die Betriebs- und Personalräte während der (Bonner) Veranstaltung als Betriebs- und Personalräte auftreten und nicht als Mitglieder einer neben dem DGB existierenden Initiative, wäre eine Beteiligung eines DGB-Repräsentanten vorstellbar“. Martin Clemens bezeichnete die Gewerkschaften in einem Ostwind-Flugblatt Ende 1993, in dem es um das erst verbalradikale aber dann allzu verhandlungskompromißlerische Verhalten eines IG-Metall-Sekretärs bei den anstehenden Entlassungen von Osram-Mitarbeitern ging, als „Heuchler“. Er hatte darüber zuvor nicht mit den Betriebsräten in der Initiative gesprochen – und damit endgültig die unbestimmte Grenze von Unterstützer-Eigeninitativen in der Gruppe überschritten. Zuvor hatte er bereits die Ostwind-Redaktion mehr oder weniger an sich gebracht, was Konstanze Lindemann am 1. Dezember 1993 zu einer Klarstellung in Form eines „Vorschlags zur weiteren Arbeit“ veranlaßte: „Zur Zeit hat keine Person das Recht, im Namen der ostdeutschen Betriebsräteinitiative oder im Namen des Ostwinds aufzutreten, Stellungnahmen abzugeben und/oder Aktivitäten zu ergreifen … Die 13 900 DM, die von Martin Clemens und zwei anderen im Namen der Initiative und der Ostwind-Redaktion in Bischofferode beantragt wurden, werden zurücküberwiesen… Begründung: Es ist zur Zeit völlig unklar, wer die ostdeutsche Betriebsräteinitiative noch ist. Es ist ebenfalls unklar bzw. zufällig, wer der Arbeitsausschuß ist. Große Teile der Mitglieder der Initiative sind seit längerem weggeblieben. Die Ursachen dafür sind niemals zum Thema gemacht worden“.
Zwei Wochen später zogen neun Betriebsräte, die von Anfang an dabei gewesen waren, auf einer „Pressekonferenz“ im Westberliner DGB-Haus schon die Notbremse: „Eines der wichtigsten Ziele der Initiative war es, die Unterstützung des DGB und der Einzelgewerkschaften bei den Betriebsrätekonferenzen und -Aktionen zu erreichen. Dies ist mit Ausnahme der IG Medien und HBV und bis auf Ansätze beim DGB leider nie gelungen … Wir brauchen jedoch weiterhin die Vernetzung untereinander, den Erfahrungsaustausch, die gegenseitige Unterstützung, den gemeinsamen Druck auf die Gewerkschaften. Nach wie vor gilt unser Motto: Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!“ Auch einige der anwesenden „intellektuellen Sympathisanten“ verteilten eine „Presseerklärung: Die Betriebsräte, die heute hinter dem Rücken der Mehrheit des Arbeitsausschusses in spalterischer Absicht ihren Austritt aus der Initiative erklären, sprechen nur für sich. Die Initiative bestand von Anfang an nicht nur aus Betriebsräten. In ihr arbeiteten ehemalige Betriebsräte, Gewerkschafterlnnen und KollegInnen, Beschäftigte und Erwerbslose unterstützend und gleichberechtigt mit. An dieser demokratischen Arbeitsweise halten wir auch in Zukunft fest… Martin Clemens“.
„Machbare Ziele oder Weltrevolution?“ titelte Judith Dellheim anschließend in einem letzten ND-Artikel über die Betriebsräteinitiative. Und das war’s dann auch schon fast gewesen.
Wie mühsam es streckenweise war, sei hier am Beispiel der Organisierung einer „Protestfahrt nach Bonn“ gezeigt. Dazu mußten 1500 Einladungen an ostdeutsche Betriebsräte verschickt werden: der DGB hatte uns angeboten, sie über die Westberliner DGB-Poststelle rauszuschicken. An einem Donnerstag rückten zwei Leute des Arbeitsausschusses der Betriebsräteinitiative mit 1500 Briefen in der DGB-Poststelle an. Wie mit diversen DGB-Landesvorsitzenden zuvor besprochen, sollten die Einladungen über die Frankiermaschine des DGB rausgehen. Die Poststelle des DGB wird vom Kollegen Hans geleitet. Es stellte sich schnell heraus, daß dieses Büro im Erdgeschoß die wichtigste Schaltstelle der Gewerkschaft war. Als erstes klärte Hans die Kollegen darüber auf, daß er eine direkte Anordnung „von oben“ brauche, sonst könne er gar nichts frankieren: „Die versprechen zwar immer viel, aber ich muß das dann hier unten jedesmal ausbaden“. Dieses Problem ließ sich telephonisch noch relativ schnell erledigen – Hans stellte dafür seinen Apparat zur Verfügung. Dann mußten die beiden Leute von der Betriebsräte-Inititative aber erfahren, daß Hans „für heute“ schon abgerechnet hatte (es war gerade Mittag durch) und folglich die Briefe erst am nächsten Tag frankiert werden konnten: „Sonst bin ich sofort dran, wenn morgen zufällig der Revisor vorbeikommt!“
Das wollte natürlich niemand – Hans in Schwierigkeiten bringen -, und also würde man am Freitagvormittag wiederkommen und an diesem Tag nur schon mal die Briefe mit seinem „Drucksache“-Stempel soweit vorbereiten. Bevor Hans den Stempel rüberreichte, schaute er auf seinen Kalender: „Was? Die Fahrt nach Bonn soll am 9. September sein, heute haben wir doch schon den 27. August, das kommt doch alles gar nicht mehr an. Drucksachen dürfen acht Tage bei der Post liegenbleiben. Da ist nischt mehr zu machen!“ Man klärte ihn nun seinerseits darüber auf, daß die Briefe ja nur in die neuen Bundesländer und nach Berlin gingen, was hieße, daß sie alle vom Postamt am Nordbahnhof bearbeitet würden. Und dort säße in der Abteilung für Massensendungen die Frau Schuschke, der würde man zwanzig Mark geben für die Kaffeekasse, und dann könnte man es noch schaffen. Das sei alles schon soweit vororganisiert. Der Tip war von einem freiberuflichen Betriebsratsschulungsleiter aus Pankow gekommen, der seine Einladungen immer dort abgab und mitunter schon drei Tage später die ersten Rückantworten bekam. Hans gab sich aber nicht gleich geschlagen: „Auch die Briefträger können Drucksachen erst einmal liegenlassen, wenn sie zu viel auszutragen haben … Das ist einfach nicht mehr bis zum 9. zu schaffen. Ich seh‘ da schwarz!“
Während dieses Gesprächs kamen immer wieder Funktionäre und Sekretäre aus den oberen Etagen des DGB in die Poststelle und gaben schüchtern einige Briefe, mit und ohne Einschreiben, ab. Der eine oder andere blieb auch schon mal kurz dort und lächelte den beiden Leuten von der Betriebsräte-Inititative mit ihren sieben Kartons voller unfrankierter Briefe aufmunternd zu. Hans gab derweil hinten im Raum dem Aushilfshausmeister Anweisung, daß und wie er am nächsten Tag die Sendung zu bearbeiten hätte, da er, Hans, erst kurz vor Mittag kommen könnte, bis dahin aber alles erledigt sein müsse, da er am Freitagmittag gleich in Urlaub fahren wolle. Als das geregelt war, nahm Hans erst einmal ein Kuvert aus den Kartons und wog es: „Knapp an der Kippe, geht grad noch für sechzig Pfennig raus“, sagte er. „Seid ihr ganz sicher, daß nirgends ein Blatt mehr drin ist?“ Die beiden waren kurz davor, es ihm schriftlich zu bestätigen. Aber da hatte Hans schon ein neues Problem aufgetan: „Ihr habt die Briefe nicht nach Berlin und woandershin sortiert, das muß getrennt werden“. Man versprach ihm, das beim Drucksachen Abstempeln nachzuholen. Hans entschuldigte sich daraufhin erst einmal: „Ich arbeite ja Tag und Nacht für die Kollegen, aber mal muß ich auch ’ne Pause einlegen, ich geh‘ jetzt kurz was essen“. Als er wiederkam, nach etwa zwanzig Minuten, war die Sendung schon fast zur Gänze durchgestempelt und die Berliner Briefe in einem Kasten aussortiert. Hans war jedoch beim Essen was Neues eingefallen: „Ihr müßt die Briefe morgen ins Postamt Berlin 30 bringen. Alle Briefe, die über diese Frankiermaschine laufen, dürfen nur dort abgegeben werden, nicht einmal beim Postamt Zoo, das steht sogar im Vertrag mit der Post drin, das haben die sich schriftlich geben lassen“. Ermattet versprachen die beiden ihm das sofort und ohne Widerrede, ja, sie schrieben sich sogar die Adresse des Postamts 30 auf.
Am nächsten Tag waren sie erst einmal noch damit beschäftigt, weitere achtzig Briefe – Einladungen an die diversen Einzelgewerkschaften – fertig zu machen. Um 11 Uhr sollten sie die fertig frankierten Briefe in der DGB-Poststelle abholen. Vorsichtshalber telephonierten sie aber noch einmal mit Hans, bevor sie losfuhren – und erfuhren, daß die ganze Sendung noch nicht bearbeitet worden sei, weil alle Nichtberliner Briefe über die entsprechenden Landesverbände rausgehen müßten, über die Berliner Zentrale könnten sie nicht abgerechnet werden, nicht einmal die nach Brandenburg (obwohl es sich dabei um ein und denselben Landesverband handelte). Außerdem müßten sämtliche Briefe statt mit sechzig Pfennig mit achtzig Pfennig freigemacht werden, weil ein Drucksachenkuvert für sechzig Pfennig nur ein Blatt enthalten dürfe, nicht drei – das sei dann eine Briefdrucksache, und die koste achtzig Pfennig. Er könne jetzt zwar die die rund 150 Berliner Einladungen freimachen, mit achtzig Pfennig, dafür habe er vom Vorstand grünes Licht bekommen, aber die wären dann alle falsch abgestempelt – nämlich mit „Drucksache“ statt „Briefdrucksache“. Und dann käme noch hinzu, daß dies alles ganz schnell gehen müsse, denn die Poststelle schließe heute bereits um 12 Uhr: „Spätestens um Viertel nach 12 bin ich hier raus, und dann läuft da gar nichts mehr!“ Man fuhr trotzdem sofort los zur DGB-Poststelle, um wenigstens die Berliner Einladungen noch übers Postamt am Nordbahnhof, bei Frau Schuschke, rausschicken zu können. Unterwegs kauften die beiden Mitarbeiter der Betriebsräte-Inititative noch schnell für 1400 Mark 80-Pfennig-Briefmarken. Als sie im DGB-Hochhaus an der Keithstraße ankamen, waren die 150 von oben genehmigten Briefe bereits frankiert und in einem quasi offiziellen grauen Plastikbehälter der Bundespost einsortiert worden, den Hans ihnen großzügig als Geschenk mitgab. Im Hinausgehen verriet er ihnen noch, daß die Regelung der Trennung von ost- und westdeutschen beziehungsweise Ost- und Westberliner Sendungen, wobei die ersteren alle über das Postamt am Nordbahnhof gingen, nur noch bis Montag gelte, ab dann würden alle in jedem Postamt „normal“ bearbeitet werden: „egal wohin“. Die beiden bedankten sich für diesen Hinweis und fuhren vom DGB-Hochhaus in Westberlin zum DGB-Gewerkschaftshaus in der Ostberliner Wallstraße, wo sie im Saal 0205 die restlichen rund 1600 Briefe per Hand frankierten. Dazu gelang es ihnen, sich von den Sekretärinnen der Kreisstelle des DGB-Nord, im Stockwerk darunter, einen brandneuen roten Briefmarkenbefeuchtungsschwamm in einer grünen Gummischale auszuleihen – allerdings nur bis 14 Uhr, weil die Sekretärinnen dann Feierabend machen wollten. Aber auch das schafften sie noch beinahe rechtzeitig. Leider waren die Büros dann jedoch schon abgeschlossen, so daß sie den Briefmarkenbefeuchtungsschwamm im Kaffeeküchenraum nebenan deponierten – in der Hoffnung, daß die Sekretärinnen ihn dort am Montag gleich als erstes entdecken würden.
Sodann ging es in rasendem Tempo zu Frau Schuschke – zum Postamt am Nordbahnhof. Eigentlich hatte einer der beiden Helfer der Betriebsräteinititative vorgehabt, sie am Abend zuvor bereits aufzusuchen, um alle Modalitäten der Briefsendung mit ihr zu besprechen, er war aber vor verschlossene Türen geraten, mit einem Schild: „Pause zwischen 16 Uhr 30 und 17 Uhr“. Da er aus terminlichen Gründen nicht warten konnte, war er unverrichteter Dinge wieder abgezogen, wobei er sich aber insgeheim damit beruhigt hatte, daß man ja notfalls am nächsten Tag den Kaffeekassen-Solldarbeitrag auch auf dreißig Mark erhöhen könnte: Soviel sollte ihnen die geglückte Zustellung der Einladungen und damit das Gelingen einer massiven Protestpräsenz ostdeutscher Betriebsräte in Bonn eigentlich wert sein.
Als sie um 14.30 Uhr beim Postamt am Nordbahnhof ankamen, eröffnete ihnen die Mitarbeiterin von Frau Schuschke als erstes, daß sie sich die Arbeit mit den Briefmarken hätten sparen können: Ab hundert Briefe würde sie das mit einer posteigenen Frankiermaschine selbst erledigen, das wäre ein Service für Großkunden. Mit den rund 150 vom DGB frankierten Berliner Einladungen gab es weiter keine Probleme, auch wenn der eine Helfer der Betriebsräte-Inititiative voller Schrecken mit anhören mußte, wie sein Kollege, im übermächtigen Wunsch, diesmal auf Nummer Sicher zu gehen, das Problem geradezu herbeiredete. Da er aber gleichzeitig die zwanzig Mark für die Kaffeekasse gezückt hatte, ging dann doch alles glatt. Während noch die Mitarbeiterin von Frau Schuschke die ganze Sendung aus den Pappkartons in einen größeren Container umstapelte, wobei sie den praktischen Plastikbehälter mit Tragegriff vom DGB, in dem sich die Berliner Briefe befanden, einfach einbehielt, diskutierten die beiden mit Frau Schuschke noch einmal kurz die weiteren möglichen Probleme von Massensendungen: Das mit dem falschen Stempel – „Drucksache“ statt „Briefdrucksache“ – konnte sie bestätigen, meinte aber, wie zur Beruhigung, es würde schon irgendwie „durchflutschen“. Von der am Montag bevorstehenden Aufhebung der Trennung in Ost und West bei der Briefsortierung hatte sie noch nichts gehört: „Da wissen Sie mehr als ich!“ Ganz entschieden bestritt sie jedoch die Gefahr einer achttätigen Verschleppung von Drucksachen-Massensendungen auf Postämtern: „Das geht sofort raus, das schaffen Sie noch dicke vor dem 9. … Welchen Tag haben wir heute? Den 28. … Und der August hat sogar 31 Tage. Machen Sie sich da man keine Sorgen“.
Der Zufall wollte es jedoch, daß just in diesem Moment ein stämmiger Arbeiter aus der Sortierabtellung ankam, um die letzten vollen Container von der Stelle für Massensendungen abzuholen. Als er den mit den Einladungen der BetriebsräteInitiative sah, sagte er zur Mitarbeiterin von Frau Schuschke: „Ach, das sind ja alles nur Drucksachen, die können warten“. – Sprach’s und ging wieder über den Hof in die Sortierabtellung zurück. Frau Schuschke hob daraufhin noch einmal von vorne an: „Sie brauchen sich wirklich keine Gedanken machen, das kommt alles rechtzeitig an. Ehrlich …“ Aber doch schon etwas kleinlauter und dabei verlegen lächelnd. Sie ist übrigens Mitglied in der Postgewerkschaft. Von Hans muß angenommen werden, daß er in der ÖTV organisiert ist.
Auf der Fahrt nach Hause kamen die beiden Mitarbeiter der Betriebsräte-Inititiative – in gelöster Stimmung – überein, daß man, statt wochen- und monatelang mit den Führungsspitzen der Gewerkschaften zu korrespondieren und zu verhandeln, besser daran getan hätte, den „sofortigen Schulterschluß“ mit diesen beiden einfachen Mitgliedern an der Basis zu suchen … ja, die ostdeutschen Betriebs- und Personalräte-Inititiativen hatten in organisationssoziologischer Hinsicht noch viel zu lernen, soviel stand fest.
Ein paar Tage später versprach ihnen ein DGB-Vorstandsmitglied immerhin, die Kosten für die Briefmarken zu ersetzen. Und diverse IG-Metall-Landesverbände übernahmen die Kosten für die mit Bussen aus allen Landestellen nach Bonn anreisenden Betriebsräte. Zwei Tage vor Fahrtbeginn kam auch noch ein Brief vom IG-Metall-Vorstand in Frankfurt am Main: Man distanzierte sich darin aufs entschiedenste vom Einladungsbrief der Betriebsräte-Initiativen, in dem es geheißen hatte, daß die IG Metall die „Protestfahrt nach Bonn“ unterstütze. Dem war also nicht so! In der Familienforschung nennt man so etwas einen Double-Bind – eine besonders heimtückische Infantilisierungsstrategie.
Und diese „Strategie“ griff dann auch, d.h. es breitete sich zunehmend Mut- und Lustlosigkeit unter den Aktivisten aus. Nach der Spaltung am Ende zerfielen alle Gesprächskreise. Meines Wissens brauchte es fast anderthalb Jahre, bis Einzelne oder kleinere Gruppen von Betriebsräten und „Unterstützer“ wieder punktuell zusammenarbeiteten und sogar noch länger, um dann – wie im Falle der Berliner SPD-Veranstaltung Ende 96 – wieder gemeinsam etwas zu organisieren. Inzwischen ist die ehemalige DDR fast flächendeckend zu einer ABM geworden. 1995 fand bei Orwo laut Betriebsrat Hartmut Sonnenschein „eine größere Demonstration als am 17. Juni 1953“ statt, wobei es um eine bloße Verlängerung der dequalifizierenden „Sanierungs-ABM“ d.h. Abriß-Maßnahmen (gemäß 249h AfG) ging.
Noch deprimierender als für die Aktivisten der Betriebsräteinitiative, zu denen auch der mittlerweile geschiedene und zwischen Ironie und Zynismus ausbalancierende Hartmut Sonnenschein gehörte, war ab 1994 die Situation für die Bischofferöder Kalikumpel. Christine Haas erzählt: „Es ist aber auch eine schwierige Zeit. Während der Auseinandersetzungen, so anstrengend sie waren, ging es fast allen gut. Es kam dabei so etwas wie eine Ganzheitlichkeit zum Tragen. Danach fiel wieder alles auseinander. Und viele wurden krank, vier starben sogar.“
Wie nahezu überall in Ostdeutschland sind auch hier inzwischen die jüngeren, noch beweglicheren Arbeitslosen fast alle nach Westdeutschland abgewandert. Die evangelische Pastorin, die zwei ABM-Kräfte in ihrem Garten beschäftigt, geriet bereits – mit ihrer vehementen Ablehnung der Pläne einer Gießener Firma, oberhalb der Kaligrube am Ohmberg den Kalkstein abzubauen, wobei 15 Kalikumpel Arbeit gefunden hätten – in Konflikt mit den Bischofferöder Betriebsräten. Ihre Meinungsverschiedenheit schaukelte sich jedoch nicht gleich derart hoch wie die in der Berliner Initiative. Christine Haas trifft sich auch weiterhin regelmäßig z.B. mit dem Betriebsrat Werner Kunze, der hofft, beim eventuellen Verfüllen der Bischofferöder Grube mit Salzlauge weiterbeschäftigt zu werden. Kunze bekam gleich nach der Niederlage ein Magenleiden, zugleich bekam er aber auch sein 1972 enteignetes Land zurück und schaffte sich daraufhin ein Pferd sowie eine Kuh an, die dann ein Kalb bekam. Seitdem, so sagt er, gehe es ihm wieder etwas besser. Christine Haas bedauert, daß so viele Kalikumpel ihr nach dem Arbeitskampf sagten: „Ich kämpfe nicht mehr!“ Aber auch, daß jetzt überhaupt so viel „rückwärtsgewandtes Zeug“ im Eichsfeld passiert: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge, sogar Fahnenweihen: „Zum Glück hat man so etwas noch nicht an mich herangetragen.“
Man muß hinzufügen: All dieses Rückwärtsgewandte geschieht diesmal nicht nur ohne, sondern geradezu gegen das Kapital. Insofern unterscheidet sich der neue Nationalismus bis hin zum Neonazismus wesentlich vom alten Faschismus. Nicht nur empfinden die multinationalen und multikulturellen Konzerne jede nationalstaatliche Identifizierung als geschäftsschädigend, auch ein Handelsblatt-Redakteur machte neulich schon gegenüber einem exlinken Spiegel-Feuilettonchef eine fortschrittlichere – antinationalistische – „Meinung“ geltend.
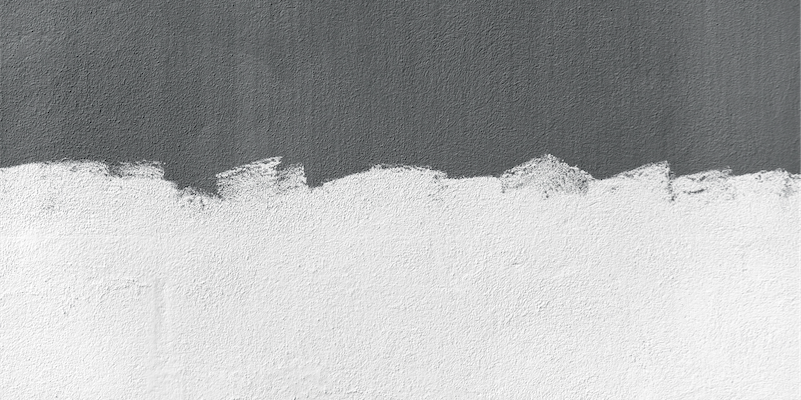



Wie gut, dass die Turbodyne – Luftnummer, ein Werk für 100 Mio. Dollar in Eisenach zu bauen, nicht verwiklicht wurde. Wahrscheinlich wären eine Unzahl örtlicher Handwerksbetriebe mit in den Untergang gerissen worden.
http://turbodyne-blog.blogspot.com/