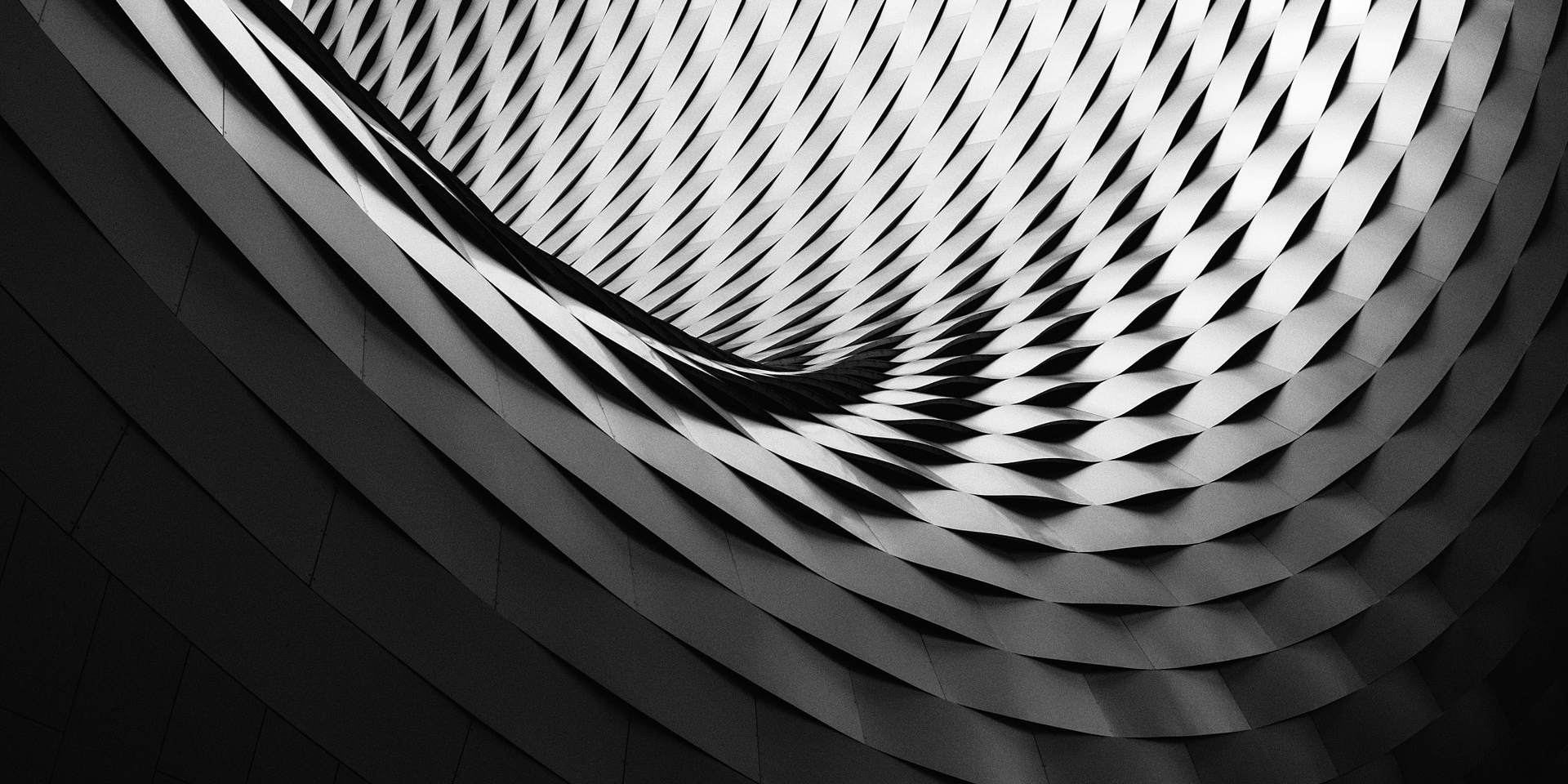„Es geht tatsächlich darum, von der Gegenwart eine dichte, ausdauernde Wahrnehmung zu haben, die es uns erlaubt herauszufinden, wo die Linien der Schwäche und wo die starken Punkte sind, womit sich die verschiedenen Mächte verknüpft haben, wo sie sich eingepflanzt haben; anders ausgedrückt: eine topographische und geologische Aufnahme der Schlacht machen…“ (Michel Foucault)
Wer weiß noch, dass der Potsdamer Platz bis1989/90 auf der Westseite eingekreist war von lauter postfaschistischen Schäferhund-Abrichteplätzen? Sie waren alle physisch und psychisch ausgerichtet auf den Führerbunker, wo Hitlers Schäferhund „Blondie“ 1945 eines qualvollen Todes starb. Dann kam aber die Wende und Daimler-Benz sowie Sony bekamen das zentrale Gelände zum Schnäppchenpreis zugeschanzt – gratis dazu aber auch den daraufliegenden Fluch. Das ganze Klein-New-York, das sie dann auf dem Potsdamer Platz hochzogen, geriet dann auch völlig verbummfiedelt: Die dorthin gezogene Berlinale ist seitdem von Arsch, das exklusive Spielcasino mußte bereits auf 1-Euro-Einsätze zurückrudern, eine Disco nach der anderen macht dort pleite und die großen „Show-Events“ sind entsetzlich anzusehende Flops. Am Liebsten würden sich auch Sony und Mercedes-Benz von diesem Ort des Schreckens zurückziehen, wo immer mehr Bürofluchten leer stehen und die Wohnungsmieten schon fast niedriger sind als in Neukölln. Die ganzen Kneipen sind bloß verschieden ausstaffierte Betonlöcher und die Bedienung darin nur zu bedauern.
Schon allein wie dieses Dreckviertel hochgezogen wurde – mit Sklavenarbeit – ließ nichts Gutes erwarten: „Nie würde ich in eines der Kinos am Potsdamer Platz gehen, meinte Zygmunt, einer der polnischen 2+4-Kontingent-Bausklaven, die die Gebäude dort für 3 Euro die Stunde errichteten, „wir mußten dort derart pfuschen, dass bestimmt irgendwann die Decken runterkommen!“
Dieser ganze verlogene Mist fing schon mit dem Grundstückskauf der Daimler-Benz-Tochter Debis an: 1. behaupteten die Stuttgarter, dass sie sich schon vor der Maueröffnung dort „engagierten“ – der SPD wurde jedoch in Wahrheit erst Anfang 1990 ihr Kaufinteresse signalisiert. 2. war der Kaufpreis dann so niedrig (1.505 Mark pro qm), dass Daimler-Benz später – von der EU dazu verdonnert – 34 Millionen Mark nachzahlen musste: Die Gutachter waren bei der Preisermittlung noch 1990 (!) von einem „Grundstück am Rande der westlichen City“ ausgegangen. 3. kostete die Daimler-Benz-Ansiedlung die finanzschwache Stadt dann: 25 Millionen für die Bodenreinigung, 12,5 Millionen für Ingenieurhonorare, 6 Millionen für einen Park genannten Grünstreifen und 300 Millionen wegen der Änderung der Stellplatzverordnung zu Gunsten von Daimler-Benz. Hinzu kommt noch der laut den Grünen „moralische Verlust wegen der Ansiedlung des größten deutschen Rüstungskonzerns ausgerechnet auf dem politisch sensiblen Potsdamer-Platz-Gelände“. So wurde Daimler-Benz im Oktober 1999 in einer ganzseitigen Anzeige in der New York Times mit der Formulierung „Design – Leistung – Zwangsarbeit“ als eine besonders schweinöse Firma angegriffen, die während des Nationalsozialismus 460.000 Zwangsarbeiter beschäftigte.
Für sein Buch „Berlin, Berlin – der Umzug in die Hauptstadt“ interviewte der Hauptstadtbüro-Leiter des Spiegels Michael Sontheimer den gefeuerten Sicherheitsingenieur der Debis-Großbaustelle Potsdamer Platz. Dieser, Jürgen Rubarth, meinte 1999: „Bei der Eröffnung floss der Sekt in Strömen. Oben wird gefeiert, unten schuften die Sklaven. Es ist traurig, aber wahr: Wir bauen unsere Hauptstadt mit Sklaven.“ Bereits 1996 schrieb ich anlässlich der Einweihung eines Beratungscontainers der IG Bau an der „größten Baustelle Europas“ einen Artikel über die schrecklichen Arbeitsbedingungen dort für die Mitgliederzeitung der IG Bau. Anschließend machte ich daraus auch noch einen taz-Artikel mit dem Titel „Das größte Arbeitslager Europas“. Nicht nur bekam ich dafür von der adligen Debis-Pressesprecherin ein Baustellenverbot. Zu allem Überfluss distanzierte sich auch noch die IG Bau schriftlich von mir.
Gegenüber Michael Sontheimer begründete Debis mein Potsdamer-Platz-Verbot später damit, dass ich „von hinten bis vorne falsch recherchiert“ hätte. Bei einem weiteren Potsdamer-Platz-Auftrag bat ich dann Dorothee Wenner, den Auftrag zu übernehmen. 1997 veröffentlichte sie ihre Recherche – unter Pseudonym (!) – in der Woche. An einer Stelle schrieb sie: “ ,Gestern kam ein polnischer Arbeiter mit einer klaffenden Wunde am Arm zu mir. Der hätte eigentlich sofort zum Arzt gemusst‘, berichtet Michael, Sanitäter auf dem Debis-Gelände. ,Ich habe ihn notdürftig behandelt, dann ging er mit dem Verband wieder zur Arbeit.‘ “ Nachdem ihr Artikel über die „rücksichtslose Ausbeutung“ der zumeist polnischen Arbeiter erschienen war, schob Die Woche eine Art Klarstellung nach, in der die Zeitung berichtete, dass die Johanniter-Unfallhilfe, die für Debis die Sanitätsstation betreibt, sofort alle Helfer und Sanitäter mit Namen Michael vom Dienstplan strich: „In einem Brief an Die Woche poltert indes nicht der Bauherr, sondern der Johanniter-Landesvorstand“ – die Darstellung träfe so nicht zu. Anscheinend hatte die über den Artikel erboste Debis die Sanitäter ebenso wie zuvor die IG Bau gezwungen, sich schriftlich in dieser Form zu äußern. So wie sie laut Auskunft eines Magazinverwalters dort angeblich auch die Polizei überredete, vor Beginn jeder Razzia gegen Schwarzarbeit die Poliere zu informieren, damit diese „ihre“ Schwarzarbeiter rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.
Nach Beendigung der Bauarbeiten berichteten Dorothee und ich noch einmal über den Potsdamer Platz, diesmal über das dortige Einkaufs- und Freizeitcenter, das nun durch Glastüren von jedem betreten werden konnte, wo Debis jedoch eine Art Hausordnung mit Verhaltensregeln für die Besucher angebracht hat. In dem taz-Artikel zitierten wir unter anderem einen indischen Freund namens Tipu, einen angehenden Ingenieur, der gerade bei Debis einen Aushilfsjob hatte. Er sollte der Entwicklung eines individuellen Verkehrsleitsystems zuarbeiten. Nach einigen Monaten hörte er jedoch frustriert wieder auf, „weil er sich dort zu sehr ausgebeutet fühlte: Seine Freundin sollte er sich abschminken und stattdessen ein Handy zulegen, um immer erreichbar zu sein“.
Tipu hatte aber noch für einen Monat Gehalt zu bekommen: „Schreiben Sie eine Rechnung!“, sagte ihm sein Debis-Chef, der Direktor für Mobility Services, Rummel. Das tat Tipu: 1.400 Mark für 80 Stunden. Sodann erschien im September unser taz-Artikel. Wenig später kam das Geld – jedoch nur 700 Mark. Tipu rief Rummel an. Der schrie ihn an und wies auf den Artikel hin: „Mehr Geld kriegen Sie nicht!“ „Was habe ich damit zu tun?“, fragte Tipu, „Sie können doch nicht einfach meine Rechnung ändern.“ Wieso nicht?! „Ich bestimme hier die Spielregeln“, erwiderte Rummel. Bei DaimlerChrysler überlegt man sich bereits, ob man Debis nicht besser abstoßen sollte. Abstoßend genug ist sie allemal!
Beizeiten bereits gab es eine Ausstellung samt Katalog über den Bereich Tiergarten, insbesondere über das dem Potsdamer Platz benachbarte „Kulturforum“. Einer der Autoren, der chilenische Philosoph Claudio Lange schrieb darin:
„Über das Tiergartenviertel zu arbeiten, vom Penner- zum Kultur-Strich-Forum, erzeugt Angst, Karrierismus, Korruption. Man ist im Zentralen Bereich. Seine Tabula rasa bietet die seltene Möglichkeit, den Schnitt durch Moderne und Postmoderne zu untersuchen. Wie der Fisch in die Zeitung, kommt das Fotomaterial in Schuhkartons.“
Was steht im Rest des Katalogs? Einiges an beispielhafter Oral-History, wie man heute blödsinnigerweise die Mitschnitte von Gesprächen mit „Zeitzeugen“, meistens den Opfern, nennt, ein paar schöne Fundstücke: zum Beispiel im Interview mit Raffael Rheinsberg der Hinweis auf „Piko“, einen Maler, der mit seinem Esel früher in der norwegischen und in der japanischen Botschaft lebte, zuletzt in den Ruinen der albanischen. Und ein Gespräch mit Dörthe Crass, Mutter von Johannes Grützke und ehemalige „Trümmerfrau“ im Tiergarten. Sie erwähnt unter anderem, daß die Ruine der spanischen Botschaft lange Zeit ihre Baubude war (während seiner Arbeit an der „Spanischen Botschaft“ hat spanische Künstler Francesco Torres sich oft gefragt, wer dort seit 1945 die verlassenen Hallen wohl alles benutzt haben mag; in seiner Installation taucht diese Frage an einer Stelle als saubere Kopie einer „Wandschmiererei“ auf).
Olav Münzberg meinte damals in der Einleitung zu dem „Tiergarten-Projekt“: „Um Trauerarbeit kommt keiner herum“. Heute würde ich sagen – speziell auf den Potsdamer Platz bezogen: „Um Abrißarbeit kommt keiner herum!“
Um einen Mieter dort wäre es allerdings schade: Dirk. Er paßt da hin wie die Faust aufs Auge. Sein Lieblingswort ist „Kommunikation“. Mitte der Neunziger eröffnete er einen Swingerclub in Karlshorst. Sein Werbespruch dafür lautete: „Wir haben Verständnis für Toleranz!“ Der Club ging bald pleite. 2003 wagte er eine neue Geschäftsgründung: eine Internet-Kontaktbörse. Auf der Startseite warb er mit Nackphotos von Frauen, die man allerdings kaum erkennen konnte, dafür wurde man in Großschrift aufgefordert: „Klicke hier für realen Sex mit echten Leuten“.