Es gibt wohl kam eine Region in Deutschland, die besser erforscht ist als dieser einst von der Kindersendung “Mischmasch” ermittelte “Mittelpunkt der BRD”, der im Osten an das Fulda Gap grenzt, im Südosten an Peter Engstlers einmal jährlich auf der Jungviehweide stattfindenden Rhönputsch und im Südwesten an Gelnhausen, der malerischen Kleinstadt mit den meisten Geschenkboutiquen Deutschlands.
Der Vogelsberg ist also nicht, wie Illies Junior und der Weltredaktor meinen, terra incognita, im Gegenteil: Hier kann so gut wie niemand die Tinte halten, wenn der Nordwestwing um die holzverschalten Häuser heult. Mathias Horx siedelte hier, in Bobenhausen II, einst seine ersten utopischen Romane an, östlich davon nahm laut Jörg Schröder die äußerst schriftsatzproduktive westdeutsche Friedensbewegung ihren Anfang, Micky Remann bedichtete dieses Mittelgebirge in seiner “Kammlagenkritik” ebenso wie Albert Sellner , dessen Langpoem Eingang in das bereits erwähnte Rotbuch “Vogelsberg” der Agentur Standard Text fand. Auf der anderen Seite des Hoherodskopfs schrieb derweil der Dichter Peter Mosler an einer Chronik seines Dorfes – für die Jubiläumsbroschüre der freiwilligen Feuerwehr. Überhaupt hat sich dort spätestens seit den Siebzigerjahren noch in jedem Dorf mindestens ein Chronist gefunden, über die einstigen jüdischen Gemeinden gibt es sogar eine dreibändige Geschichte. Dennoch ist Florian Illies’ jüngstes Vogelsberg-Projekt zu loben, holt es doch die jungen Leute von der Straße bzw. vom Bildschirm und vors Buch – wie z.B. den Blogger Falko:
“Ja, jetzt lese ich auch ich mal Illies
“Generation Golf” ging mir am Arsch vorbei. Ich habe es nie gelesen, denn was ich davon hörte und auszugsweise las, gefiel mir nicht – schlicht, weil es mich nicht interessierte.
Wenig später nahmen die gerade geschlichteten Parteien sich aber doch Rechtsanwälte, die dann – auf dünnem Schriftsatzpapier – noch einmal alles neu und anders auflisteten und gegeneinander aufrechneten: die Waschmaschine gegen die Geschirrspülmaschine, die Flex gegen die Handkreissäge, den Toaster gegen den Küchenquirl, ja, sogar das Klopapier gegen die Zahncreme. Seitenlang. Aber auch die Rechtsanwälte schafften es nicht, das Chaos zu ordnen. Als es dann zum Prozeß kam, weigerte sich der Richter, ein Urteil in dieser für ihn völlig obskuren Angelegenheit zu fällen, er verlangte kategorisch von den streitenden Parteien, sich hier und jetzt im Gerichtssaal zu einigen. Das geschah dann auch. Jörn beanspruchte ca. ein Drittel des Hofwertes – er hatte Geld und Arbeitskraft investiert. Die andere Partei – Paula, Werner und Lothar – behaupteten später zwar, übervorteilt worden zu sein, aber immerhin konnten sie die schon beantragte Zwangsversteigerung abwenden und im Haus wohnen bleiben. Die Schafwirtschaft wurde als alleinige Angelegenheit von Jörn dargestellt, und also musste er erst einmal alle Maschinen übernehmen – zu dem Preis, für den man sie angeschafft hatte plus der inzwischen angefallenen Reparaturkosten. (Beispielsweise hatten sie sich einen kleinen Traktor gekauft – für 2400 Mark, an dem waren für insgesamt 5000 Mark Reparaturen angefallen: Weil sie vergessen hatten, Frostschutzmittel aufzufüllen, war ihnen als erstes gleich nach der Anschaffung der Motor verreckt. Für die Übernahme des Traktors wurden Jörn also 7400 Mark berechnet. Dann zogen Gaby und Jörn zusammen mit Michaela und Willi auf einen anderen Hof bei Ilbeshausen. Bei seinem Auszug aus dem Palmenhof hatte Jörn noch versucht, seine ganzen Freunde aus der Umgebung zu einer Art von Protestversammlung (“Demo”) zu mobilisieren. Es kamen aber kaum welche. Auch die Nachbarwohngemeinschaft, die er zuvor schon vergeblich gebeten hatte, vor Gericht für ihn auszusagen, hielt sich zurück. Sie wollte es sich nicht völlig mit den anderen verderben. Überdies überlegten sie sich gerade, ob sie nicht ihren Hof landwirtschaftlich nutzen sollten.
Nächtelang saßen sie zusammen und diskutierten darüber, und immer öfter kamen Paul und Lothar zu ihnen rüber und setzten sich dazu. Man überlegte, ob man vielleicht sogar zusammen … Gemeinsam wollte man beispielsweise eine alte Dreschmaschine kaufen – so etwas sei besser als die neumodischen Mähdrescher, darüber war man sich einig, das Feld würde dabei sauberer werden und das Getreide gründlicher ausgedroschen. Das bestätigten ihnen auch alle umliegenden Bauern. Was sie verschwiegen, wonach sie aber auch nicht gefragt wurden, war, dass die Ernte damit statt drei Tage drei Wochen dauert – wenn man es gut kann. Werner hielt es nicht mehr länger aus, dass Paula mal mit ihm, mal mit Lothar ins Bett ging, und verlegte seinen Studienplatz von Kassel ins weiter entfernte Wien. Währenddessen hatten Lothar und Paula von ihren ziemlich wohlhabenden Eltern Geld aufgetrieben für die Anschaffung von landwirtschaftlichem Gerät. Statt mit den Nachbarn zusammen kauften sie sich dann aber alleine welche. Den Nachbarn boten sie an, zur Erntezeit mit ihren Getreidegarben einfach auf den Palmenhof zu kommen, damit man sie dort dresche, das sei einfacher als mit dem schweren Gerät zu ihnen rüberzufahren. Lothar hatte überall in Nordhessen alte Mähbinder aufgetrieben; zwei, die mit Pferd, und einen, der mit Traktor zu bedienen war, kaufte er, wobei er einen davon gleich an die Nachbarwohngemeinschaft weiterverkaufte. Diese probierten ihn bei ihrer ersten Ernte auch aus – und fuhren damit zwei Morgen Getreide platt. Vorher hatten sie das Gerät noch umständlich repariert, es hatte ein Stück Plane gefehlt, das sie sich in Frankfurt besorgt und dann mit Nieten und Leisten hergerichtet hatten – für weitere 100 Mark. Insgesamt banden sie ca. 20 Garben Hafer damit, dann stellten sie den Mähbinder in einer dunklen Ecke ihrer Scheune ab – für immer. Wenig später vermittelte ihnen Lothar ein weiteres Gerät: eine kleine Dreschmaschine (er selbst hatte sich gerade eine große gekauft). Diese kleine, die sie mit ihrer VW-Pritsche nach Hause transportierten, wurde aber nie in Betrieb genommen, irgendjemand zerhackte sie dann im nächsten Winter zu Feuerholz. Die alternative Landwirtschaft ist zwar umweltfreundlicher, aber auch arbeitsintensiver. Die vom Palmenhof suchten per Zeitungsannonce in der Berliner Tageszeitung weitere “Mitbewohner”.
Es meldete sich eine Berlinerin. Sie war zwar wunderschön, hockte aber die meiste Zeit auf ihrem Zimmer und dachte anscheinend nach. Ein paar Wochen später zog sie wieder aus. Man annoncierte neu. Es meldeten sich zwei weitere Leute aus Berlin: Lutz und Ev – er war mal Lehrer gewesen, sie Sozialpädagogin und verheiratet mit einem Arzt. Nachdem sie bei der für sie zuständigen Behörde in Gelnhausen Sozialhilfe beantragt hatten, erschien im Gelnhäuser Tageblatt ein Artikel über die beiden.[3]
Lutz und Ev hatten überhaupt keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht. Aber es lagen 15.000 Mark auf ihrem Konto, die sie in den Palmenhof investierten. Man pachtete Land von einer Landkommune – ein paar Dörfer weiter -, die gerade ihre Landwirtschaftsversuche wieder eingestellt hatte. Dann wurden VW-Bus-Ladungen mit jungen Gemüsepflanzen eingekauft – von Paulas Ex-Ehemann in Stuttgart, die zwar teurer waren als beim Großhändler nebenan, aber dafür “biologisch-dynamisch”. Auf einen Morgen pflanzte man Zucchinis, Kohl und Salat, auf zwei weitere Morgen 12.000 Mohrrüben und Zwiebeln. Die Landkommune, die ihnen den einen Morgen überlassen hatte, wurde von Lothar und Paula wiederholt ermahnt, sich nicht einfach vom Acker zu bedienen, man wolle vom Gemüseanbau leben und brauche jede Pflanze. Die Pflanzen gediehen alle prächtig. Da die Leute vom Palmenhof zu sehr mit Unkrauthacken, Begießen und Ernten beschäftigt waren, musste zwangsläufig der Absatz der reifen Früchte vernachlässigt werden. Es gab ein paar Dörfer weiter eine gerade im Entstehen begriffene alternative Absatzgenossenschaft, aber auch die bekamen das Problem des Verkaufs nie in den Griff. Wenigstens nahmen sie ab und an ein paar Kisten Gemüse vom Palmenhof mit auf den Wächtersbacher Wochenmarkt. Tausende von Salatköpfen schossen plötzlich aus und Tonnen von überreifen Zucchinis stapelten sich am Feldrand. Die Wohngemeinschaft, eben noch ermahnt, sich ja nicht selbst auf dem Feld zu bedienen, wurde nun angefleht, die Zucchinis doch bitte an ihre beiden Pferde zu verfüttern. Desgleichen ein Künstler in Herchenhain, der kurz zuvor auf Landwirtschaft umgestellt hatte und der auch sofort mit Traktor und Anhänger anrollte und sich die Zucchinis auflud, um sie an seine Schweine zu verfüttern. Nach einigen Tagen konnten selbst die keine Zucchinis mehr sehen. Etwas anders sah es auf dem Karotten- und Zwiebel- Feld aus – die Zwiebeln machten ihnen Kummer, sie wurden nicht größer als sie als Stecklinge gewesen waren, die 12.000 Karotten dagegen steckten im Boden wie Beton, von Quecken umschlungen und durchbohrt. Einzig die Sonnenblumen, die sie als Windschutz an den Rand der zwei Äcker gepflanzt hatten, ließen sich mit einigem Gewinn in Frankfurt verkaufen.
Von dem Geld von Ev und Lutz kaufte man sich für 10.000 Mark einen Traktor und für den Rest sieben preisgekrönte ostfriesische Milchschafe, die aber in dem Jahr nicht mehr gemolken wurden. Paula versuchte es einmal – sechs Monate nach der Geburt der Lämmer, aber die Tiere bekamen sofort alle Euterentzündungen davon und mußten kostspielig mit homöopathischen Mitteln wieder kuriert werden. “Im zweiten Jahr hatte ich für sie eine Absatzmöglichkeit aufgetan, da wollte ein Magenkranker denen regelmäßig Schafsmilch abkaufen, für drei Mark den Liter, das war der Paula aber zu wenig; hab ich ihr gesagt, dass das immer noch besser sei als gar nichts, der Lothar konnte nämlich keinen Käse machen, bei dem landete die ganze Milch immer im Abfluß”, erzählte eine Nachbarin. Der Traktor wurde auf Paulas Namen angemeldet, den Kraftfahrzeug-Brief vergaß Lothar merkwürdigerweise dann bei seiner Ex-Freundin in Frankfurt. Ähnlich wie Jörn zuvor besuchte bald auch Lutz immer öfter die Nachbarn. Ev war hochschwanger und lag meistens in ihrem Zimmer im Bett. Beide wollten nur noch die Geburt ihres Kindes abwarten und dann sofort ausziehen. Die Nachbarn rieten Lutz, sich unverzüglich in Lothars Zimmer auf die Suche nach dem Kfz-Brief zu begeben, das verstand er aber nicht ganz. Jetzt fingen Paula und Lothar erneut mit ihrer verbissenen Aufrechnerei an, die dann später wieder in die dünnen Schriftsätze von Rechtsanwälten ausartete. Weder wollten sie die Milchschafe und den Traktor rausrücken, noch den Gegenwert in Geld dafür. Sie stellten Lutz und Ev etliche Monate Miete in Rechnung sowie 300 Mark “Unkosten-Pauschale Landwirtschaft” im Monat. An einem Tag schien eine Einigung in Sicht: Mittags sollten Lutz und Ev 5000 Mark zurückbekommen und dafür unterschreiben, dass sie keine weiteren Forderungen mehr hätten, abends war dann aber nur noch von 3000 Mark die Rede. Sie wollten Lutz plötzlich die Mitarbeit am Bau des Fundaments eines Unterstell- und Holzschuppens nicht mehr vergüten. Diesen Schuppen hatten sie mitten auf den Hofplatz gebaut, er verschandelte alles und verunmöglichte überdies das Rangieren mit größerem Gerät auf dem Hof. Christian hatte einen Güterwaggon Kalk bestellt, das war zwar viel zu viel für ihre paar Hektar Land, aber es war natürlich billiger, als den Kalk zentnerweise einzukaufen. Der Dünger musste vom Güterbahnhof in Lauterbach abgeholt werden. Dazu lieh Lothar sich einen riesigen Anhänger vom Speckenmüller in Salz. Und dann ging es darum, diesen mit 20 Tonnen Kalk völlig überladenen Anhänger rückwärts in den mit dem Schuppen verbauten Hof zu rangieren. Stundenlang versuchte Lothar es, dann nacheinander alle Nachbarn, andere standen drumherum und dirigierten. Schließlich standen Paula und Lothar allein auf der Straße und beschimpften sich. Der Holzzaun war kaputt, beim Hoftor war eine Ecke abgebrochen. Es ging trotzdem nicht.
Nachdem sie dann später einen Teil des Kalks auf ihre diversen Äcker und Wiesen gebracht hatten, gab es wieder Ärger. Und zwar mit dem Acker, der der Landkommune ein paar Dörfer weiter gehörte. Die hatten ihnen gesagt, sie wollten das Land wieder selber bestellen, das hatte Lothar aber überhört; da er den Acker nun mal gekalkt hatte, wollte er ihn auch ein paar Jahre behalten. Im Herbst rückte er an – pflügte und grubberte und war gerade dabei, Ackerbohnen einzusäen, als es zum Streit kam – am Feldrand. Lothar tobte und drohte: “Das zahl ich dir zurück!” Und zum “Rechtsanwalt” und zum “Fürsten” wollte er gehen. Ein paar Tage später fand bei den Nachbarn in Udenhain ein Fest statt, zu dem Lothar, den sie ausdrücklich nicht eingeladen hatten, auch erschien. Petra sagte ihm, sie wolle ihn im Haus nicht sehen, er solle wieder verschwinden. Er ging aber nicht, blieb einfach sitzen und unterhielt sich angeregt weiter.
Petra war insbesondere wegen des Eiergeldes wütend auf ihn. Die vom Palmenhof hatten regelmäßig Eier bei ihr geholt. Dann waren sie eines Tages angekommen und hatten zu ihr gemeint, sie hätte für 65 Mark auf dem Palmenhof telefoniert, die müsse sie jetzt endlich mal bezahlen. Petra hatte entgegnet: sie hätten für 67 Mark Eier und Milch von ihr bekommen, das könne man verrechnen, also bekäme sie noch zwei Mark vom Palmenhof. Damit war Paula aber nicht einverstanden, sie wollte das Telefongeld sofort und in bar; mit den Eiern und der Milch, das ginge sie nichts an; sie hätte allen in ihrem Haus und auch ihren Gästen untersagt, drüben Eier und Milch zu kaufen, deswegen wolle sie jetzt auch nicht die Rechnung dafür bezahlen. Eine Weile lang war Lothar morgens immer zu Petra rübergegangen und hatte sich einfach die Eier aus ihrem Hühnerstall rausgenommen. Sie hatte das aber jedesmal mitbekommen, war aus dem Bett gesprungen und hatte die Eier nachgezählt, die er in der Hand trug. Zwar hatte sie Lothar zu Anfang gebeten, die Anzahl der Eier doch immer selber aufzuschreiben, aber das war nie geschehen. Paula und Lothar hatten ihr statt dessen geraten, sie solle doch mal versuchen, großherziger zu sein: “Das vergeß ich nie. Unser Auto kaputt, die beiden Kinder krank und mußten zum Arzt. Und Lothar musste uns natürlich dafür seinen Wagen leihen. Tat er auch. Und wir auch brav getankt. Alles klar. Sogar voller getankt als er war und auch noch einen Reifen gekauft für ihn. Abends wollten Paula und Lothar nach Frankfurt und ich mit ihnen mitfahren. Die haben mich abgeholt und wir sind los. Nach zehn Kilometern meinen die beiden: Hast du noch Geld dabei, wir müssen noch tanken. Ich sage: Ich habe doch heute morgen erst für 40 Mark getankt, damit kommen wir doch locker nach Frankfurt und wieder zurück. Die sofort: Nein, wir brauchen Geld, wir müssen tanken, wir fahren noch mal zurück, du mußt dir das Geld holen. Okay. Ich steige aus, finde nach langem Suchen im Haus auch fünf Mark und wir fahren erneut los.
Für diese 4,95 Mark genau haben sie dann auf der Rückfahrt auch wirklich getankt. Dabei haben sie dann an der Tankstelle zu mir gesagt: ‘Du darfst das nicht alles so eng sehen, sei doch mal ein bißchen großherziger!’ Dazu muß man noch wissen, dass die sich immer unsere Pritsche ausgeliehen haben, die mußten doch permanent irgendetwas transportieren. Einmal hatten wir auf unserer zehn Kilometer entfernten Wiese Heu zu liegen. Lothar kommt an und leiht sich – wie immer ‘mal eben kurz’ – die Pritsche. Wir sitzen zu Hause und warten, dass er zurückkommt damit. Sind im Druck, weil das Heu wenigstens noch auf Reihen gemacht werden muß. Irgendwann geht mal jemand zum Palmenhof rüber um zu fragen, wo der Lothar mit der Pritsche bloß abbleibt. Und da steht der Wagen auf dem Hof bei denen. Lothar! Was ist denn los? Ja, das Auto ist kaputt, kann man nicht mehr mit fahren. Was? Hättest du nicht wenigstens bei uns Bescheid sagen können? Wir warten seit Stunden auf dich. Ja, wieso, die Pritsche ist doch eh kaputt, kannst doch eh nicht mehr mit fahren. Wir haben das Auto dann rübergeschoben und nachgeschaut. War eine Schraube am Vergaser los, die haben wir festgedreht und sind dann zur Wiese gefahren, war schon fast dunkel.”
“Zu dem ‘großherzig’ fällt mir noch die Geschichte mit dem Stroh ein: Die Winters hatten dem Palmenhof und uns das Stroh auf einem ihrer Äcker gegeben. Als es soweit war, riefen sie beim Palmenhof an und die fuhren sofort mit der Ballenpresse los, ohne uns einen Ton zu sagen. Als wir dann ankamen, hatten sie sich schon 200 Ballen geschnappt, wir bekamen gerade noch 40 ab. Im Spätherbst wollten die Winters dann 100 Mark für das ganze Stroh haben. Lothar zahlte ihnen 50 Mark und sagte, die andere Hälfte würden sie von uns bekommen. Als ich ihn deswegen zur Rede stellte, meinte er, ich solle doch nicht so kleinlich sein.”
Nachdem Lothar sich seinen Herzenswunsch, einen Traktor für 10.000 Mark – 60 PS mit Allrad-Antrieb und Frontlader – erfüllt hatte, kaufte Paula sich für 10.000 Mark einen 18 Zentner schweren Schwarzwälder Ackergaul. (Sie hatten gerade von der Bochumer Anthroposophen-Bank einen 30.000 Mark-Kredit ausgezahlt bekommen.) Zunächst musste Paula mehrmals nach Ulm zum Züchter fahren, um sich mit dem ausgebildeten Pferd – eine tragende Stute – vertraut zu machen. Dann wurde es mit einem Pkw-Anhänger abgeholt. Vorher hatte Lothar wochenlang an einem Pferdestall gebaut. Vielleicht wäre das Pferd arbeitswillig gewesen, nur leider ließ es sich keine Eisen vom Schmied ansetzen. Dr. Laube wurde geholt. Er gab dem Pferd vier Beruhigungsspritzen. Dann war es so betäubt, dass es nicht mehr alleine stehen konnte. Der Tierarzt weigerte sich, ihm noch eine Spritze zu geben, die wäre eventuell tödlich gewesen. Wenn mal wieder der Schmied aus Frankfurt angesagt war, sah man den Tierarzt schon morgens schweißgebadet aus dem Pferdestall wanken und Bier trinken. Was sehr ungewöhnlich ist. Aber er schaffte es trotzdem nicht. Bis heute hat die Stute noch keine Eisen unter den Hufen. Mittlerweile ist ihr Fohlen schon fast ausgewachsen.
“Wir kaufen uns einen nagelneuen – noch originalverpackten – Kompressor. Packen den hier im Haus aus. Gucken uns den eine Woche lang verliebt an. Der Lothar kommt vorbei, sieht das Ding und meint, er brauche es mal kurz. Wir geben ihm den Kompressor auch. Und er spritzt sofort die ganzen Fassaden der Hofgebäude damit. – Siebenmal! Der Kompressor hatte danach den selben Farbton wie der Hof : Blutundbodenrot – und mindestens 300 Betriebsstunden drauf. Na gut. Wir haben nichts gesagt. Aber du hättest mal hören sollen, was passierte, wenn man sich was von denen geliehen hat. Ich leih mir deren Grubber, häng ihn an den Traktor und fahr los. An unserem Haus stoß ich mit der Krümelwalze an das Hoftor. Das Ding verzogen. Ich habe das aber gar nicht richtig mitbekommen, hab dann auf dem Acker gegrubbert. Der Krümler drehte sich auch noch, und dann habe ich den Grubber wieder auf den Palmenhof zurückgebracht. Dabei festgestellt, dass er leicht verzogen war, hinten. Na gut, habe ich ihn zum Schmied gebracht und richten lassen – 20 Mark. War alles wieder okay. Am nächsten Tag brauchte Uwe den Grubber auch, und wir haben uns das Ding noch mal geliehen. Kam die Paula mit raus und meinte: ‘In Ordnung, du kannst das Ding haben, du fährst ja auch nicht so wild wie der Bernd’. Uwe heizt los mit dem Grubber durchs Dorf und haut mit der Krümelwalze beim Herbert ans Brückengeländer. Rumms. Wieder alles verzogen. Oh, war ihm das peinlich. Zuerst wollte er zum Schmied fahren und sich beschweren, ist ja immer noch verzogen, das Ding. Dann ist er aber doch aufs Feld gefahren, musste ja gegrubbert werden. Dann zurück zum Palmenhof mit dem Ding, den Lothar rausgeholt, der sofort: ‘Fahr bloß schnell zum Schmied damit, bevor die Paula das sieht’. Er hat den Grubber auch gleich zum Schmied gefahren. Der hat nur noch geschmunzelt, weil der hat den nach jedem Gebrauch reparieren müssen. Uwe hat ihn dann auch gleich bezahlt und zurückgebracht. Ein paar Tage später kommt Lothar rüber und meint, der Grubber ist jetzt abgenutzt, die Holzlager halten nicht mehr so lange, 80 Mark wolle er für die Abnutzung von uns haben. Haben wir gesagt: ‘Ja, ja, ist okay’. Als wir aber dann mal wieder beim Schmied waren, haben wir nachgefragt: Holzlager, hat er gesagt, das ist so eine Holzscheibe mit einem Loch drin, 2,50 Mark das Stück, die halten zehn bis 15 Jahre.”
In der Steinauer Kneipe “Bundschuh” trafen wir ein paar Leute aus Hellstein, die uns erzählten: “Wir hatten in der gemauerten Miste auf dem Hof von unseren zwei Pferden einen Riesenhaufen Mist liegen, den Paule und Lothar haben wollten – geschenkt natürlich. Und irgendwann rückte Lothar mit seinem Traktor und einem riesigen geliehenen Miststreuer an. Wochenlang vorher hatte es Stein und Bein gefroren, aber als Lothar kam, war es schon seit Tagen am Regnen. Unsere Miste hat 100 Jahre lang wunderbar gehalten. Als Lothar mit dem Ausmisten fertig war, war sie hinüber. Außerdem war der ganze Hof ein einziger Matschhaufen, mit Schotter und Mist vermischt. Für 1000 Mark mußten wir neuen Schotter anfahren lassen, die Wiese hinter der Miste hatte er zu Klump gefahren und die Drainage ist seitdem auch kaputt. Wir haben dann die Miste zugeschüttet. Während er seinen Miststreuer vollud, mußten wir ihn auch noch alle Augenblicke mit Unimog und Traktor wieder rausziehen, weil er sich mit seinem Allrad-Traktor in die Miste eingewühlt hatte. Wir haben die früher – per Hand – immer in drei Tagen ungefähr leer gemacht, und der Hof sah anschließend genauso sauber wie vorher aus, Lothar brauchte mit seinem dicken Traktor vier Tage dazu und alles war im Arsch. Und dann haben wir uns noch einen Monat lang im Haus untereinander deswegen gestritten.”
“Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Da kam er nämlich hier an und wollte sich von uns den Bagger für den letzten Rest Mist ausleihen. Den Bagger hatten wir uns vom Imhoff geliehen, um einen kleinen Teich hinterm Haus auszubaggern. Da war ein Druckschlauch dran kaputt gewesen und wir haben gesagt, wir machen einen neuen drauf – für 80 Mark und dafür können wir dann unseren Teich damit ausheben. Gut. Halb hatten wir die Grube auch schon fertig, da kam Lothar an, brauchte schnell mal eben den Bagger, weil bei euch alles zu matschig geworden war. Ich sag, ‘da mußt du erst den Imhoff fragen’. Was macht Lothar? Er fährt in unseren Garten, hängt den Bagger an seinen Traktor und prescht damit beim Imhoff vorbei, ich muß mal eben schnell damit auf den Acker, habe da was zu misten, dann fährt er weiter zum Palmenhof und hängt vorne an den Frontlader den großen Miststreuer. So ist er dann den Wald hochgeheizt, der Wald war abgeschlossen, er schnell die Schlösser geknackt und dann durch den Wald zu euch, der konnte natürlich nicht mit den zwei Geräten vorne und hinten dran auf der Straße fahren. Zwei Tage hat der Bagger bei euch gestanden, just am nächsten Tag war auch noch Karfreitag, und er ist den ganzen Tag mit dem Mist durchs Dorf gefahren und hat dabei die zu Ostern frisch gewaschenen Autos alle mit Mist bespritzt. Da war vielleicht was los. Am nächsten Tag kam sofort der Imhoff rüber, stinksauer, und hat den Bagger abgeholt: ‘Ihr kriegt den Bagger nicht mehr, ich leihe euch nie wieder was, das habe ich ja noch nie erlebt, sowas!’ Ich dann noch mal zu ihm rüber: Da können wir doch nichts für, was haben wir mit dem Palmenhof zu tun …’Das ist mir egal’, meinte der Imhoff, ‘der Bagger bleibt jetzt hier. Punktum’. Und wir mußten den Teich dann quasi mit der Hand auslöffeln, und hatten 80 Mark fürn halben Teich bezahlt. Später hat der Förster dann noch Ärger gemacht wegen der aufgebrochenen Schlösser an den Schranken und weil der Lothar mehrmals durch den Forst gefahren ist. Da gingen dann wieder die Schriftsätze der Anwälte hin und her.”
Nachdem Lutz und Ev ausgezogen waren, wollten zwei neue Leute auf dem Palmenhof einziehen: André und Laura. Die beiden hatten schon irgendetwas von den Problemen dort läuten hören und erkundigten sich erst einmal vorsichtig bei den Nachbarn. Die erzählten ihnen auch alles, was sie wußten. Trotzdem zogen die beiden dann drüben ein. Kurz darauf hatte Laura ein kleines Techtelmechtel mit Lothar, dann verliebte sie sich in Werner. Die beiden heirateten sofort und André zog aus. Laura rauchte von einem Tag zum anderen kein “Gras” mehr und fing stattdessen an zu joggen. Werner gab sein Studium in Wien auf und verkaufte seinen Bauwagen, den er dem neuen Besitzer mit einem Spezialtransporter der Bundesbahn nach Hamburg schickte. Laura und Werner wollten nach Andalusien auswandern. Dazu beabsichtigte Werner, sich seinen Hausanteil auszahlen zu lassen von Paula und Lothar. Zwar hatten die mittlerweile einen zweiten 30.000 Mark-Kredit von den Anthroposohen in Bochum bekommen, aber das Geld war schon wieder ausgegeben worden, u.a. hatte Lothar sich einen Peugeot davon gekauft. Werner ging nun einfach zum Peugeot-Händler und kaufte sich auf Paulas Namen für 22.000 Mark ebenfalls einen Peugeot, einen neuen. Jetzt beanspruchte er nur noch 40.000 Mark. Sie einigten sich darauf, dass Laura und Werner auf dem Palmenhof bleiben und sich dort eine eigene Wohnung ausbauen sollten, inklusive eigener Küche. Die beiden fingen auch sofort mit den Umbau- Arbeiten an. Alle Türen, Fenster und Fußböden wurden abgelaugt und repariert, Wände ausgerissen und neue hochgezogen, usw.. Als sie damit fertig waren, zogen sie aus, zu einem Freund nach Niedermoos, dem sie dann das Haus abkauften. Laura und Werner hatten extra kirchlich geheiratet, das Haus war das Hochzeitsgeschenk der reichen Eltern von Laura. Schon anfangs – bei den Nachbarn – hatte Laura immer von ihren reichen Eltern erzählt und dass sie adlig sei und dass sie sich für sie bei den Büdinger Fürsten verwenden könne, damit man irgendwie an dessen Seehof bei Wächtersbach “rankäme”.
Während Werner und Laura noch auf dem Palmenhof mit Umbauen beschäftigt waren, annoncierten Lothar und Paula nach neuen Leuten, die bereit waren, mit ihnen gemeinsam zu leben und landwirtschaftlich zu arbeiten. Es meldeten sich auch zwei: Winfried und Christa. Die beiden besaßen bereits eine eigene kleine Landwirtschaft in Südost-Bayern. Jetzt rückten sie mit ihren Kühen, Pferden, Landwirtschaftsgeräten und allem Drum und Dran an. Die Geräte transportierten sie mit einem Lastwagen. Für die Tiere hatte man sich einen Pkw-Anhänger geliehen und für 100 Mark eine Anhänger-Kupplung an Werners Peugeot anbauen lassen. Damit fuhren sie dreimal nach Bayern, um alle Tiere zu holen. Später verlangte Werner noch 500 Mark von Winfried für die Anhänger-Kupplung. Die beiden hatten sich ziemlich schnell zerstritten. Ihre Lebensstile waren sehr unterschiedlich: Laura und Werner aßen und tranken gerne gut und teuer, Bündener Rauchfleisch und Sekt zum Frühstück; während Winfried und Christa rohen Dinkel aus Holzschalen bevorzugten.
Nach einiger Zeit richteten die beiden sich eine eigene Küche in der Durchfahrt zwischen dem Haus und der Scheune ein, mit einem Holz-Küchenherd; sie sahen nicht ein, dass sie sich an den hohen Stromrechnungen im Haus beteiligen sollten, hervorgerufen durch Geschirrspüler, Durchlauferhitzer und Infrarot-Grillherd etc.. In der Durchfahrt stellten sie dann auch noch eine Zinkwanne auf, in der sie badeten. Einmal hatte Winfried zwei Tage lang mit seinen Pferden einen Acker geeggt, auf den Dinkel und Roggen ausgesät werden sollten, dann kam Paula und guckte sich alles an und es gefiel ihr nicht. Sie nahm den Traktor und eggte damit in zwei Stunden alles noch einmal über. Die beiden stritten sich immer öfter wegen ihrer Pferde. Wenn Winfried seine beiden einspannen wollte – zur Arbeit, meinte Paula zu ihm, für sie seien die Pferde nur ein Hobby. Um so verwunderter war man dann, als man hörte, dass Lothar und Paula einen Lehrer im Nachbardorf verklagt hatten, weil der von einem Bauern eine Wiese für die zwei Ponys seiner Tochter gekauft hatte. Die vom Palmenhof argumentierten, er hätte kein Recht zum Landkauf, sie als Landwirte hätten das Vorkaufsrecht.
Christa und Winfried waren gerade dabei, sich in ihrer Durchfahrtsküche einen Karottensalat zuzubereiten, da kam Paula dazu, sah das und schrie sie an, was ihnen denn einfiele, einfach die Karotten aus dem Keller zu nehmen, die seien nicht zum Essen, die wären für ihr Pferd. Daraufhin drehte Christa durch: “Ihr Idioten, ich zünde euch noch mal den ganzen Hof an!” Das hörte Lothar im Stall, lief auf den Hof und rief: “Du willst uns unsere Existenz vernichten!” Hin und her.
Im Oktober-Café in Wächtersbach erzählte uns Petra: “Ich habe mal zum Lothar gesagt: irgendwann schmeißt die Paula dich auch noch raus, dann hat sie ihr Haus fertig renoviert, und du kannst nichts machen, du hast ja nichts in der Hand. Ein paar Tage später passierte prompt so etwas Ähnliches: Paula hatte sich mit Lothar gezankt, daraufhin lief sie nach oben und warf seine ganzen Klamotten aus dem Fenster, unten rannte Lothar auf dem Hof hin und her und brabbelte vor sich hin: ‘Was mach ich jetzt?’ ‘ Was mach ich jetzt bloß?’ Irgendwie hat er es dann geschafft, sich wieder mit Paula zu vertragen und dann konnte er seine Klamotten wieder nach oben tragen. Ich hatte ihm geraten, ihr ein paar aufs Maul zu hauen. Der hat alles für sie gemacht – gekocht, eingekauft, die Landwirtschaft, und wenn der mit Putzen dran war, dann musste der auch putzen, während Paula – umgekehrt – an ihrem Tag seelenruhig im Bett blieb, die hat nur ihren Gaul gefüttert und ihn jeden Tag auf die Weide gebracht, und wenn mal eine andere Frau zu Besuch kam, die ist ja jedes Jahr regelmäßig zur Frauen- Sommerakademie nach Berlin gefahren, dann hat sie sich auch schon mal auf den Traktor gesetzt, um der zu imponieren. – Ich konnte sie noch weniger als Lothar ausstehen. Der hat immer versucht, mit mir anzubändeln, aber mich hat es zu sehr gestört, dass er einem nicht mal in die Augen gucken konnte.”
Eine Zeitlang hatten sie einen jungen Praktikanten auf dem Hof. Den haben sie dann immer zu den Nachbarn rübergeschickt, wenn sie mal wieder mit denen zerstritten waren, damit er sich das Auto für sie leihe. “So läuft das nicht, haben wir dem gesagt. Da war der dann auch noch sauer auf uns.” “Dann kam ihr Versuch, eine Berner-Sennhund-Zucht aufzubauen. Da hatten sie erst einmal den riesigen Baldi, der alles und jeden anfiel. Dann brachte Laura noch ihren Hund Emily mit, und die durfte nie mit dem Baldi zusammenkommen, wenn sie heiß war. Beide Hunde wurden angebunden. Und zwar so, dass sie sich gerade mal eben mit der Schnauze berühren konnten. Das macht den Baldi derartig wahnsinnig, dass er kurz darauf den Werner in den Arm biß – bis auf den Knochen durch. Als Winfried und Christa einzogen, brachten sie auch noch einen Hund mit – Merlin, und der durfte dann auch wieder dem Baldi nicht zu nahe kommen. Dabei wurde Werner noch einmal gebissen. Schließlich ließen sie ihre Hundezucht-Idee wieder fallen.”
“Als nächstes versuchten sie es mit Hühnern. Sie hatten sich einen Stall und einen Hühner-Auslauf gebaut und auch schon alles ausgerechnet – 50 Pfennig pro Ei in den Frankfurter Reformhäusern und dies und das, aber dann haben die Vögel erst mal überhaupt keine Eier gelegt, und dann bekamen sie alle Tuberkulose und mußten vergast werden. Und sie durften auf dem Palmenhof jahrelang keine Hühner mehr halten. Einen gesunden Hahn hatten sie aber noch übrigbehalten, den wollte Lothar an Klaus und Heidi in Radmühl verkaufen – für 50 Mark. Klaus hat zu ihm gesagt, dafür nimmt er den Hahn bestimmt nicht. Daraufhin ist Lothar zu Heidi in den Garten gegangen und hat ihr gesagt, er habe mit Klaus geredet und sie solle ihm die 50 Mark für den Hahn geben, was sie auch getan hat, obwohl sie sich dabei gedacht hat, jetzt ist ihr Mann völlig durchgeknallt – so viel Geld für so einen bescheuerten Hahn auszugeben. Und dann hat der Hahn noch nicht einmal ihre Hühner besprungen, aber jeden hat er angefallen, der in den Stall gegangen ist. Man musste immer erst den Hahn treten – und so lange wie der halb betäubt hin und her torkelte, konnte man schnell die Hühner füttern oder die Eier einsammeln.”
Auf dem Palmenhof versuchten sie es dann mit Gänsen, aber die holte fast alle der Fuchs. Die letzten drei verkauften sie an Georg in Völzberg. “Danach stiegen sie ins Kartoffel-Geschäft ein. Einen Acker wollten sie erst mal legen. Aber sie haben sich gleich eine große Kartoffel- Legemaschine dafür angeschafft. Gut. Uns haben sie damit dann auch gleich noch die Kartoffeln gelegt. Aber dabei hat Lothar die Maschine zu hoch eingestellt, so dass wir jede einzelne Kartoffel auf unserem Acker dann noch einmal mit der Hand einbuddeln mußten. Bei ihren Kartoffeln hat er es richtig gemacht. Aber wenn der Winfried später nicht zweimal mit dem Pferd durch die Reihen gegangen wäre, mit dem Unkrauthacker, hätten sie trotzdem keine geerntet, weil das Feld völlig verunkrautet wäre. 320 Zentner wollten sie ernten, das hatten sie sich ausgerechnet, die Hälfte haben sie dann geerntet, und selbst die sind sie kaum losgeworden. Schließlich fanden sie einen Biogemüse-Händler im Taunus, der ihnen die 160 Zentner abnahm. Aber der zahlte ihnen dann keinen Pfennig dafür, weil die Hälfte vergammelt war. Statt dessen verlangte er, sie sollten das Zeug wieder abholen. Daraufhin verklagte Paula ihn. Darüber gehen jetzt immer noch die Schriftsätze der Anwälte hin und her. Nach der Pleite mit der Legemaschine haben wir auf den Einsatz ihres Vollernters, den hatten sie sich natürlich auch gleich gekauft, dankend verzichtet und es mit unserem alten Roder selbst gemacht, ging auch genauso schnell, weil die für ihren Vollernter immer mindestens fünf Leute als Bedienungspersonal brauchten und außerdem laufend irgend etwas nicht funktionierte an dem Ding.”
“Was für ein Wahnsinn. Was ist da für ein Geld reingeflossen. Und sie haben nach wie vor nur die sieben Milchschafe, die nicht gemolken werden und das Pferd mit Fohlen, mit dem man weder arbeiten noch reiten kann.” “Immerhin bekommen sie für jedes Schaf im Jahr 30 Mark Mutterschaf-Prämie von der Landesanstalt für Tierzucht …” “Bei der letzten Versteigerung wollten sie ein Jungschaf verkaufen. Paula hatte dabei die tolle Idee, Ingo mitzunehmen, der sollte durch Mitbieten den Preis hochtreiben. Und das machte der auch ganz prima. Zu prima – denn der hat sogar noch den Höchstbietenden überboten, und damit hatte Paula für 650 Mark ihr eigenes Schaf sich wieder zurückersteigert, und musste dafür noch 75 Mark Auktionsgebühr bezahlen.”
Nach und nach übernehmen Lothar und Paula eine Wiese nach der anderen von Jörn, nachdem der sie bei der Gemeinde abgegeben hatte, und zwar ohne dass das – wie sonst üblich – über eine Versteigerung ging. Man wunderte sich schon im Dorf, wieso die sich derart gut mit dem Birsteiner Bürgermeister verstanden. Nur an die allseits begehrte Selzer-Wiese kamen sie nicht ran, Jörn hatte irgendwas läuten gehört und gab sie einfach nicht ab, obwohl er sie auch nicht brauchte, da er zu weit weg wohnte und dann sowieso seine Schäferei aufgab. “Ich habe mal zufällig mit angehört, wie Lothar mit dem Bürgermeister darüber redete: ‘Das geht nicht mehr so weiter, wir brauchen die Wiese, jetzt sehen Sie endlich mal zu, dass da was passiert, ich schicke Ihnen morgen gleich die Papiere zu, und dann muß das eigentlich klappen.’ Der Bürgermeister brauchte den Lothar – als einen ehemaligen Journalisten, mit seinen ganzen Medien-Kontakten. Vor einiger Zeit wollte der Clausener, der in Sotzbach eine Firma besitzt, die feinmechanische Geräte baut, sich einen Privatflugplatz bauen. Dagegen ist dann eine Bürgerinitiative entstanden. Und obwohl der Birsteiner CDU-Bürgermeister und Freund von Clausener sich für den Bau des Flugplatzes eingesetzt hat, hatte die Landesregierung ihn nicht genehmigt. Damit war die Sache aber noch nicht erledigt. Der Clausener drohte plötzlich damit, seinen Betrieb zu verlegen, wenn er seine Landebahn nicht bekäme – er müsse konkurrenzfähig bleiben, gegen die Japaner, er bräuchte ein schnelleres Kunden-Betreuungssystem und Ähnliches. Er machte also Druck. Einer der ersten, die sich daraufhin für den Flugplatzausbau aussprachen, war der Speckenmüller. Sein Sohn arbeitet beim Clausener in der Firma und spielt außerdem im Fußball-Verein von Salz Linienrichter, und diesen Verein hat der Clausener ein paar Mal mit kleineren Geldspenden unterstützt. Deswegen haben die sogar eine Straße in Salz nach ihm benannt – Clausener- Straße. Auf den Schildern steht unter seinem Namen: “Sotzbacher Wohltäter”. Nach dem Speckenmüller wurden auch Lothar und Paula für den Clausener-Flugplatz aktiv. Sie besaßen gewisse organisatorische Fähigkeiten. Lothar war mal bei den Trotzkisten gewesen und Paula – wie ihre ehemaligen Mitbewohner auch – hatte als Sozialarbeiterin in dem linken Frankfurter Heimprojekt “Zingelswiese” gearbeitet. Die beiden gründeten nun die Ortsgruppe Birstein des Bundes für Umwelt- und Naturschutz, wobei die Hauptaktivitäten der Ortsgruppe darin bestanden, sich für die Genehmigung des Clausenerschen Flugplatzes einzusetzen. Der Speckenmüller, der sonst überall erhaltenswerte Feuchtbiotope wittert, hatte angesichts des zukünftigen Flugplatz-Standortes argumentiert, es handele sich hierbei nur um einige schlechte saure Wiesen, um die es nicht weiter schade sei. Lothar und Paula mit ihrer Birsteiner Ortsgruppe für Umwelt- und Naturschutz argumentierten nun wesentlicher: Im Zusammenhang mit den Frankfurter Wasserentnahme-Plänen sei im Flächennutzungsplan das Gebiet des Vogelsbergs nur noch als Naherholungsgebiet und Truppenübungsplatz ausgewiesen. Weder sei also beabsichtigt, die Landwirtschaft hier zu erhalten bzw. zu fördern, noch die wenige hier ansässige Industrie. Wenn man nun für den Bau des Flugplatzes eintrete, dann deshalb, um etwas für die Erhaltung der hiesigen Arbeitsplätze zu tun und um damit die für diese Region schädliche Wasserwirtschaftspolitik der hessischen Regierung zu durchkreuzen. “Darüber ließe sich ja reden. Nur was für ein Interesse hatten Lothar und Paula, sich derart für diesen Hobby-Flieger Clausener einzusetzen, und das noch mitten in der Heuernte!?”
“Ganz einfach. Sie haben vom Clausener immer wieder dessen Lastwagen sich ausleihen dürfen und außerdem hat er ihnen zinslos einen 8000 Mark-Kredit gegeben.” Bernd, der ebenfalls in Udenhain wohnt, erzählte uns: “Uwe hatte sich neulich ohne zu fragen einfach den Miststreuer vom Palmenhof geholt, und Lothar war ausgeflippt, worauf wir ihnen im Gegenzug einen Acker gekündigt hatten. Jetzt waren Paula und Lothar wieder dran: Sie kündigten uns den Miststreuer, den wir uns ein halbes Jahr vorher gemeinsam angeschafft hatten – für 2600 Mark, jeder hatte 1300 Mark dazugegeben. Wir hatten sogar einen schriftlichen Vertrag darüber aufgesetzt, wobei ich ihnen noch die Priorität beim Heumachen eingeräumt hatte. Dann kam erst mal, dass sie plötzlich auch bei den Kartoffeln Priorität beanspruchten. Und sowieso sollten wie sie immer fragen, wenn wir den Miststreuer brauchten, während sie ihn jederzeit ungefragt nehmen konnten. Per Bote kam dann schriftlich von ihnen die Kündigung, fristlos, nach Paragraph sowieso. Ich habe das Schreiben einfach ignoriert. Als wir den Miststreuer dann wieder mal brauchten, kam es zu einer richtigen kleinen Schlägerei deswegen, zwischen mir und Lothar, wobei Lothar den kürzeren zog, oder jedenfalls bekamen wir den Miststreuer noch einmal in unseren Besitz. Lothar hatte mir zwar mit Polizei und Bürgermeister gedroht, als ich ihm aber sagte – bei dem wirken nämlich nur so verbale Schläge unter die Gürtellinie: ‘Sei du bloß ruhig, du läßt dich doch nur von der Paula bumsen, weil sie die Kohle hat’, da war er erst mal sprachlos. Ein paar Tage später hat er mir dann ein Angebot geschickt: Er wollte mir meinen Anteil am Miststreuer auszahlen – 1300 Mark, abzüglich 500 Mark Abnutzungsgebühr, also 800 Mark wollte er mir wiedergeben. Wir hatten das Ding aber nur ein paar Mal benutzt. Damit war ich natürlich nicht einverstanden.”
“Lothar und Winfried hatten im Sommer auf einem kleinen Feld ‘Gras’ angebaut. Paula hatte Angst vor der Polizei bekommen und konnte deswegen keine Nacht mehr ruhig schlafen. Sie überredete Lothar schließlich, das ganze Zeugs zu vernichten. Woraufhin Winfried natürlich stinksauer war, den hatte man überhaupt nicht gefragt. Der Mangel an ‘Kiff’ wurde aber dann einige Zeit später dadurch behoben, dass Lothar das Hanffeld von Gustl aberntete. Der hatte sich ein Feld am Waldrand angelegt gehabt und war dann bei uns ausgezogen. Ich hatte die Pflanzen ab und zu mal begossen. Plötzlich waren sie verschwunden. Lothar sah daraufhin verdächtig oft ‘bekifft’ aus, und Winfried bestätigte mir schließlich meinen Verdacht. Ich stellte Lothar zur Rede und er sagte: ‘Wieso?! Das war doch aufgebebenes Eigentum. Und das gehört mir.'”
“Zu uns kommt Lothar jetzt ab und zu und will ‘Gras’ kaufen. Ich sag: Gut, machen wir es doch so – ein Gramm ‘Gras’ gegen einen Ballen ‘Heu’. Das kommt ungefähr hin. Den Preis findet der Lothar auch in Ordnung, aber so läßt er sich darauf nicht ein. Es läuft nur so, dass er mir das Geld gibt und ich gehe dann zu Paula, gebe ihr das Geld, und sie gibt mir dafür das Heu. Völlig idiotisch, aber anders machen die das nicht.”
“Beim letzten großen Herbst-Manöver hatte Werner alles mit kleinen Protest- Plakaten vollgeklebt. Am nächsten Tag rückte die Kripo an und durchsuchte den ganzen Palmenhof. Sie fanden aber nichts, fünf Minuten vorher war Werner mit seinem Peugeot weggefahren und da war alles ihn belastende Material drin gewesen. Eine Woche später haben sie auf dem Palmenhof wegen des Polizei-Überfalls eine Pressekonferenz organisiert und das halbe Dorf dazu eingeladen. Da kamen auch ziemlich viele, wollte ja jeder wissen: ‘Haben die vom Palmenhof nun die Plakate geklebt oder nicht?’ Darüber sagten sie auf der Pressekonferenz aber keinen Ton, sie haben nur stundenlang über die Militarisierung der Region, über Raketenstationierung und dergleichen abgeprobt. Die Leute aus dem Dorf waren alle ziemlich enttäuscht.”
“Einmal haben sie richtigen Ärger mit dem Dorf gehabt. Da hatten sie von der Gemeinde einen Acker gepachtet, und die ganzen Steine, die sie runtergesucht hatten, an den Feldrand abgelegt, da gab es schon mal Ärger deswegen, aber dann haben sie auch noch zwischen die Steine eine Hecke gepflanzt. Die Gemeinde hatte es nach Jahrzehnten endlich geschafft, die Hecken überall auszureißen, so dass man mit den immer größer werdenden Maschinen überall durchkam, und nun pflanzten die da auf Gemeindeland wieder neue Hecken. Daraufhin wollte ihnen der Ortsvorsteher den Acker wieder abnehmen. Aber das hat er nicht geschafft, bei Lothars guten Kontakten zum Bürgermeister, und dann erschien in der Frankfurter Rundschau auch noch ein halbseitiger Artikel über diese Hecken-Affäre, von Lothar organisiert, mit einem Foto von ihm, wie er mitten auf seinem Steinhaufen zwischen der Hecke steht – stolz wie ein Spanier.”
Paula bekam beim Arbeitsamt Gelnhausen eine Umschulung auf Landwirtschaftsgehilfin genehmigt und begann für 1000 Mark im Monat pro forma eine Lehre bei einem Landwirt in Ulmbach; sie hatte mit dem Lehrherrn verabredet, dass der die Berichtshefte für die Berufsschule unterschreibt, ansonsten hatte sie mit dessen Landwirtschaft nichts zu tun. Winfried und Christa hielten sich bald wie ihre Vorgänger mehr bei den Nachbarn auf als auf dem Palmenhof. Sie fuhren mehrmals nach Bayern, um sich dort nach einem neuen Hof umzuschauen. Petra musste derweil ihre Tiere versorgen, obwohl sie auf dem Palmenhof eigentlich Hausverbot bekommen hatte. Schließlich fanden Christa und Winfried einen neuen Hof nahe der tschechischen Grenze. Überstürzt unterschrieben sie einen Pachtvertrag und zogen dorthin – nur ihre Tiere und ihr Bettzeug nahmen sie mit. Bei ihrem Einzug auf den Palmenhof hatten sie 7000 Mark eingebracht, die nach und nach für den Ausbau von Ställen für ihre mitgebrachten Tiere verbraucht worden waren, dann – der letzte Rest – für Saatgut und Zusatzfutter. Bei ihrem Auszug verlangten Paula und Lothar rückwirkend für ein Jahr von den beiden monatlich je 600 Mark (300 Mark für Miete und 300 Mark Unkostenbeteiligung an der Landwirtschaft) – also 1200 Mark monatlich. Bisher ist darüber noch keine Einigung zustande gekommen, da Winfried und Christa in Bayern erst einmal mit anderen Dingen beschäftigt waren, sie hatten z.B. alle Heu-, Stroh- und Hafervorräte für ihre Tiere auf dem Palmenhof zurückgelassen und mußten sich für den Winter neue besorgen. Einige Wochen nach ihrem Auszug gingen Lothar und Paula zu den Nachbarn rüber und fragten sie, ob sie das ganze Zeugs von den beiden bei sich einlagern könnten, sie bräuchten den Platz, weil in den nächsten Tagen neue Leute bei ihnen einziehen würden: eine Familie mit Kind und eine Psychologin – als Wochenendgäste diesmal nur. Dafür arbeiteten aber drei junge Praktikanten jetzt auf dem Hof. Die Nachbarn weigerten sich, noch einmal irgendetwas vom Palmenhof bei sich zu deponieren.
Eine Weile lang wurde es im “Bundschuh” zu einer stehenden Redewendung, jeden zu fragen: “Was gibt’s Neues auf dem Palmenhof?” Die Nachbarn in Udenhain hatten ihren Hof samt vier Hektar Land nur gepachtet gehabt, als sie ihn zu kaufen beabsichtigten, erfuhren sie vom Besitzer, dass Lothar und Paula ihn für 300.000 Mark zu kaufen beabsichtigten. Die beiden wollten den Hof in eine alternative Molkerei umwandeln (obwohl es mehrere leerstehende Molkereigebäude in der Umgebung bereits gibt). Das Geld dafür hatten sie anscheinend wieder von der Anthroposophen-Bank bewilligt bekommen. Die Nachbarn, die sich inzwischen nach einem neuen – billigeren – Hof umschauten, verlangten 20.000 Mark Ablösung für die vier Hektar Land, das sie drei Jahre lang nichtchemisch gedüngt hatten (nach weiteren zwei Jahren konnte man es als “Demeter-Land” registrieren lassen). Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, drohten sie Lothar und Paula damit, dass sie vor ihrem Auszug Kunstdünger auf die vier Hektar streuen würden. Lothar und Paula hatten sich indes auch noch gerichtlich mit dem Birsteiner Fürsten angelegt, der im Nachbardorf einige Morgen Wiese gekauft hatte, als Vollerwerbslandwirte hätten sie das Vorkaufsrecht, meinten die beiden vom Palmenhof.
Wir hatten uns zu Anfang überlegt, ob man nicht alle Leute davor warnen sollte, dort einzuziehen; dann kamen wir aber überein, dass es sicher spannender sei, dieses Experiment weiter zu verfolgen, ohne irgendwie zu intervenieren. Anhand des bisher vorliegenden Materials läßt sich aber jetzt schon sagen: Das Vogelsberger Nebelgras ist wegen seiner zum Teil üblen Nebenwirkungen für den menschlichen Genuß nicht geeignet!
Anmerkungen:
[1] In Schotten befindet sich am Haus des Seilermeisters Sohst noch ein Schild mit der Aufschrift: “Die kleinen Diebe hängt man auf, die großen läßt man laufen. Wär umgekehrt der Welten Lauf, tät ich mehr Strick’ verkaufen.”
[2] … “Bei uns im Dorf ist alles Flachland”, erklärt mir einer der Bauern, “hier kann man alles sehen.” Hier ist alles Flachland, bei uns im Vogelsberger Mittelgebirge, ich musste lachen über diese vertrackte Wahrheit: Man kann alles sehen. Morgens um sechs kann man sehen, wie das Dorf zerrissen wird, die Nebenerwerbler fahren zur Arbeit in die Stadt, um nein kann man sehen, wie sich die Frauen abrackern auf dem Hof, und abends um sieben kann man in der Wirtschaft begreifen, dass man in eine chauvinistische Männergesellschaft geraten ist, ein erbarmungsloser Chauvinismus, er richtet sich nicht nur gegen Frauen als Wut, auch gegen Männer als Spott. Man kann aber auch sehen: Der Nachbar ist krank, und zur Heuernte werden Hände gebraucht. Dann kommt immer jemand zur Hilfe, und ich denke: Ist es nicht diese Ethik des Dorfes, die in der Stadt gebraucht wird, eine Ethik der Kooperation und Hilfsbereitschaft? Ohne Nachbarschaftshilfe kann freilich in einem 115-Seelen-Dorf keiner leben. Es kann immer sein, dass jemand die Schreibmaschine in meinem Haus benötigt, oder ich die Messerschleifmaschine vom Beckerhof. Das Dorf ist klein. Es ist überschaubar: Drei Straßen, und doch leisten sich die Bauern den Luxus, den nördlichen Teil “Vorderdorf”, den südlichen “Hinterdorf” zu nennen. “Überschaubarkeit” ist ein Ideologem in der urbanen, anonymen Massengesellschaft geworden. Aber Übeschaubarkeit ist immer auch: soziale Kontrolle. Es gibt keine richtigen Todfeinschaften mehr im Dorf, solche, die über Generationen vererbt werden, aber heimliche Bosheiten, Gemeinheiten, Hintenrumgerede. Höchstens unter den Landkommunen. Wie sie die alte Architektur wieder beleben, so auch das alte Herkommen. Eine Landkommune, zwei Dörfer weiter, hat sich zerstritten, und was jetzt beginnt, ist schlimmer als eine Ehescheidung. Sie reden nicht mehr miteinander, und ohne einen Vermittler gäbe es gar keine Kommunikation untereinander, aber eine Kommunikation braucht es doch, und sei es nur, um den Zugewinn aufzuteilen. Später, als eine Gruppe ausgezogen ist, wird sie von der anderen Gruppe noch immer unerbittlich verfolgt; es ist wie in einer zerrütteten Ehe – wenn man sich schon nicht lieben kann, ein Lebtag lang, soll man sich wenigstens hassen, bis in den Tod. Kleinlich, gehässig, boshaft – und das soll die Alternative zum normalen Leben sein? Es ist bäuerliche Kleineigentümermentalität, ein Kampf, ausgetragen bis zum Letzten. Stumm, reglos und entsetzt sehe ich mir das an – das soll das neue Leben sein, in Harmonie mit der Natur …? Das Gesetz für jeden Stadtflüchtling heißt: Paß dich an, aber versuche nicht, in diesen Teig von Homogenität zu kriechen. Ich selbst habe mir angewöhnt, meinen Freunden auf dem Dorf zu erklären: “Wir wollen einen Teil der Dorfgemeinschaft sein, aber wir sind anders als ihr, und wir wollen auch anders bleiben.” (…)
[3] “Guten Tag, liebe GT-Leser! Landrat Rüger nennt sie Aussteiger. Darunter versteht der Mann aus dem Linsengerichter Eselspfad jene Zeitgenossen, die ihren Job ohne ersichtlichen Grund an den Nagel hängen und meinen, im sozialen Netz dieser Gesellschaftsordnung ist gut ruhen. Besonders getroffen hat es anscheinend Hans Rüger, dass unter diesen Mitmenschen auch Beamte sind. Ein Beispiel: Die Frau eines Berliner Arztes, Beamtin auf Lebenszeit, von ihrem Mann getrennt, aber auch von der Arbeit. Besagte Dame hätte sich im Main-Kinzig-Kreis niedergelassen und kassiert jetzt fleißig vom Sozialamt. Da gibt es dann noch, so Rügerm die “rüstigen Dreißigjährigen”, die in Vogelsberg und Spessart in Bauernhäusern unterschlüpfen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und kräftig auf Kosten der Allgemeinheit abkassieren. Der Landrat nennt solche Volksgenossen Parasiten und klagt, dass immer mehr auf diese Unart und Weise ihr Leben fristen wollten. Zehn Prozent der Sozialhilfeempfänger gehören zu diesen Typen. Wenn der Sozialetat des Kreises seit 1976 von 20 Millionen auf 36 Millionen Mark emporgeschnellt sei, dann sei dies der “Verdienst” der “Aussteiger”. Warum diese Leute aussteigen, meint der Landrat erkannt zu haben. Trotz eines Lebens auf der faulen Haut hätten sie am Monatsende mit Sozialhilfe und ähnlichen Zahlungen aus der öffentlichen Hand genauso viel Geld im Säckel wie einst, als sie noch eine Lohnsteuerkarte ihr eigen nannten. Nicht selten seien gar staatliche Leistungen höher als die Nettoarbeitsentgelte. Wenn gar noch nebenbei etwas schwarzgearbeitet würde, könnten die Aussteiger nur noch über die Zeitgenossen lachen, die täglich in ihrem Beruf schuften. Hans Rüger aber ist froh darüber, dass die Beamten in seiner Umgebung allesamt moralisch gefestigte Persönlichkeiten sind, die zwar schon das eine oder andere Mal dem Kreishauschef verrechnen, wie gut’s ihnen gehen könnte, wenn sie den Kram in der Verwaltung des Großkreises hinwerfen und sich fürs Nichtstun belohnen lassen würden. Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, warum der Kreis den Parasiten die Mäuler stopft. Rüger weiß die Antwort. Früher wären die Fürsorgezahlungen von den Gemeinden gekommen. Da kannte man seine Pappenheimer. Heute komme der Antragsteller zur anonymen Kreisverwaltung, seine persönlichen Verhältnisse sind nicht bekannt, der Sachbearbeiter erfährt nur die “Notlage” und wird dann – wagt er es, genauer nachzufragen – auch noch belehrt, dass er keine Moralpredigten zu halten, sondern zu zahlen habe. Kaum einmal kann diesen Menschen nachgewiesen werden, dass sie lügen. Sehr bedauerlich, denn wirkliche Aussteiger und Alternative werden mit den Betrügern gar zu schnell in einen Topf geworfen, befürchtet Euer Fritz
P.S.: Vielleicht hat Florian Illies in seiner Vogelsberger Selbstfindung “Vorortgespräch” Ähnliches herausgeschält wie wir hier aus dem dortigen Kollektiv – denn gegenüber der FAZ meinte er: “Ich versuche im Buch insofern ehrlich zu sein, als ich mir auch romantische Sehnsuchtsbeschreibungen durchgehen lasse. Zwar kann man nicht einfach in einen provinziellen Zusammenhang zurückkehren, weil man da gar nicht glücklich werden würde. Aber wenn man diese bisweilen lästige Wahrheit kurzfristig ausblendet, findet man die „Entschleunigung” auf dem Land tatsächlich schön. Das ist für mich der spannendste Moment, wenn eine Empfindung zwischen Rationalität und Irrationalität oszilliert.”
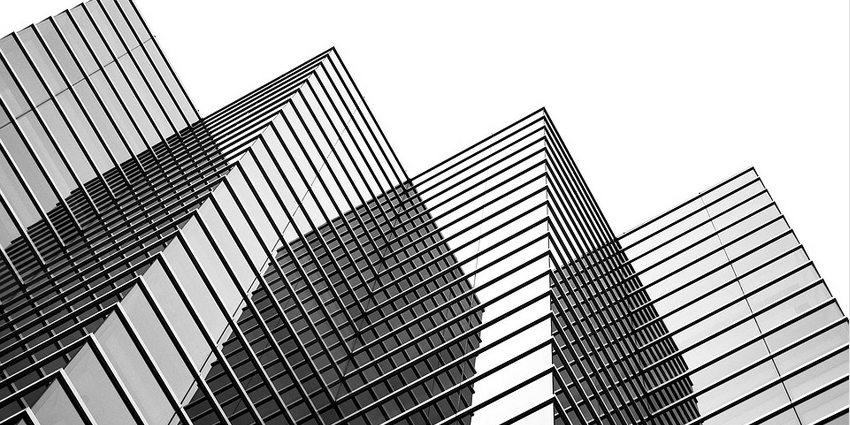



Helmut Höge (Berlin)
Jetzt habe ich endlich das Buch über Schlitz an der Schlitz von Florian Illies “Ortsgespräch” gelesen – und zwar im Zusammenhang einer Rhön-Recherche. Leider gehört Schlitz wohl doch zum Vogelsbergkreis” (VB), wenn man dem Autor glauben darf, und befindet sich somit außerhalb meiner derzeitigen “Gebietskulisse”, wie man das Biosphärenreservat mit der Dachmarke “Rhön” nun nennt, aber dennoch muß ich sagen, dass mir das Schlitzbuch von Illies außerordentlich gut gefallen hat. Fast wurde ich neidisch, denn es ist wohl doch ein Unterschied, ob man zwecks Recherche in einer “Gebietskulisse” einfällt oder ob man eine bestimmte Region sozusagen mit der Muttermilch bereits aufgenommen hat. Nicht dass ich das nicht schon vorher gewußt hätte, aber Illies hat es mir auf unaufdringlichste Weise noch einmal vorgeführt.