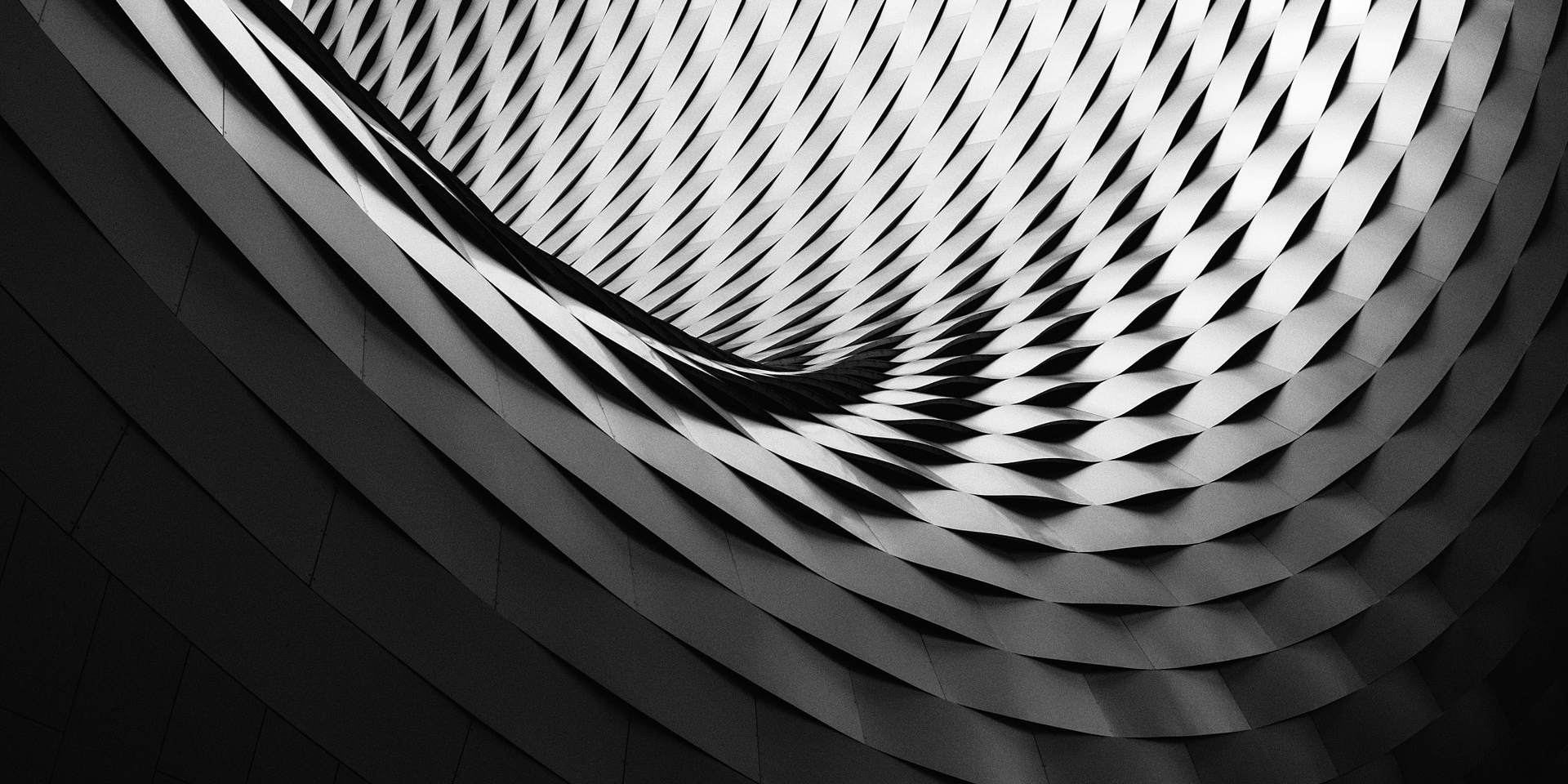Im Vogelsberg wimmelt es nicht nur von Schriftstellern, sondern auch von Künstlern. Im Folgenden erzählen drei, wie sie sich von Auftrag zu Auftrag durch die Region arbeiten:
L.: Ein Auftrag, auf den ich lange hingearbeitet habe, war die Bemalung der Trennwand in der Radmühler Diskothek vom Eier-Schleich. Als ich das erste Mal hinkam, war das da grad so auf der Kippe: dort haben sie noch Foxtrott getanzt und in Frankfurt fingen sie just damit wieder an; so wie man anderswo keine Tramper mehr mitnimmt und in Oberhessen noch nicht. Mit der Zeit bin ich dann mit den drei Töchtern vom Eier-Schleich ins Gespräch gekommen, die machten die drei Theken in der Disko und versuchten ansonsten, alle möglichen Moden und Trends dort reinzuziehen, den Schuppen also modern durchzustylen, aber der Vater behielt zäh die Oberhand, so dass sie sich immer nur punktuell oder in irgendwelchen Ecken, laufend werden neue angebaut, verwirklichen konnten, was das Ganze immer panoptikumsartiger werden ließ. Irgendwann war ich für die drei Frauen mit meiner blondgefärbten Stoppelfrisur und weil ich Kunst machte, nicht nur der Mann, der im Trend lag, sondern der auch immer die guten Ideen hatte und dafür gaben sie mir jedesmal, wenn ich hinkam, einen aus. Manchmal haben wir dann noch bis morgens um Fünf da gesessen und ich habe mitgeholfen, sauber zu machen. Das ist auch ein Erlebnis, am Mittwoch, wenn es Cola/Weinbrand für eine Mark gibt – in Plastikbechern, dann müssen morgens bergeweise diese Becher zusammengekehrt werden – mit einem speziellen kleinen Kehrtrecker wird das gemacht. Die besuchten natürlich laufend andere Diskos, um auf neue Ideen zu kommen und immer wieder sprachen sie davon: „Ja, jetzt wird alles umgebaut und renoviert. Alles ganz weiß. Der ganze Krempel kommt raus!“ Mit dem Krempel meinten sie all die Dreschflegel, Schiffe in Flaschen, Wappen aus Plastik, Kanonen, Spinnräder, Starposter, Gipsgrotten, Western-Panoramen und falschen Yucca- Palmen.
Aber sie hatten nichts zu sagen. Bestenfalls erlaubte der Vater ihnen, noch mehr dazuzukaufen. Z.B. die größte Laseranlage Europas, die aber wegen der getäfelten Wände und den ganzen Ecken und Winkeln überhaupt nicht zur Wirkung kam. Dann wieder sprachen sie davon, sie hätten jetzt den Architekten der Klein-Stammheim-Disko in Frankfurt engagiert – alles wird vergittert und gekachelt. Und zwischendurch erzählten sie mir auch immer noch ihre persönlichen Deals: „Haste schon gehört, die Ilse heiratet demnächst. Die hat auf Ibiza einen Bildhauer kennengelernt.“ Da dachte ich noch: Was für ein Flip, fährst in Urlaub und verheiratest dich gleich. Dann habe ich aber erfahren, der ist aus Ladenhausen, also quasi grad um die Ecke, und mit dem war sie früher schon mal fünf Jahre zusammen, und das ist ein ganz langweiliger Steinmetz, Verfasser von Grabinschriften und das macht der auch nur noch ganz selten, weil die meisten Grabsteine mittlerweile synthetisch hergestellt werden. Jetzt arbeitet er auch in der Diskothek. Jeder, der beim Eier-Schleich zur Familie gehört, arbeitet auch in seiner Disko und bekommt dafür 1.500 Mark Taschengeld im Monat und hat ansonsten alles andere umsonst.
Eines Abends haute mich Anette an, ob ich nicht einen Aufkleber für sie entwerfen könnte. Hab ich gesagt: „Für 500 Mark gerne“. „Bist du verrückt“, hat sie sofort gekontert, „dafür können wir schon 2000 Stück drucken lassen“. Das haben sie dann auch gemacht – mit so einem grünen griechisch-römischen Motiv drauf. Der Eier-Schleich heißt so, weil er noch einer Eier-Großhandel hat, ein Eiergeschäft, das er von fünf Uhr morgens bis zehn Uhr morgens betreibt, wo er schon mal einen Tausender täglich mit verdient … Also der Eier- Schleicht beschäftigt schon seit Jahren einen Architekten für alle Um- und Anbauten. Eines Tages zitierte er diesen Architekten wieder mal zu sich, um ihm stolz seine neueste Erwerbung für die Diskothek vorzuführen: eine echte Ritterrüstung – und die sollte am Ende der Theke aufgestellt werden. Nun war es aber von der Theke bis zur abgehängten Decke nur 1 Meter 60 und die Ritterrüstung war 1 Meter 90 hoch, so dass der Helm über der Decke gar nicht mehr sichtbar war. Der Architekt traute sich nicht, dem Schleich zu sagen, dass das Monstrum total daneben war, der fand das aber völlig in Ordnung. Nur eines bereitete ihm Kopfschmerzen: da die Leute die Rüstung ewig anfaßten, musste die immer geputzt werden, sonst fing sie an zu rosten. Später haben sie sie dann an einer Wand befestigt, mit einer Plexiglas-Schutzscheibe davor.
Im Sommer hatten sie mal wieder angebaut – eine zweite Tanzfläche, mit Marmor und Spiegeln und einem schmiedeeisernen Gitter drumrum, und dann kamen sie auf die Idee, quer durch die Disko eine in der Decke versenkbare Trennwand einzubauen, die heruntergelassen werden konnte, wenn es mal nicht so voll war und man mit dem halben Raum auskam. Diese Trennwand wollten sie bemalen lassen – Sonnenuntergänge sollten da drauf. Anette sagte mir, ich solle doch mal den Architekten anrufen, vielleicht könnte ich das ja übernehmen, was ich denn dafür haben wolle? Hab ich gesagt, so ungefähr 100 Mark für den Quadratmeter. Das fand sie natürlich wieder viel zu viel, das wären ja bei 100 Quadratmetern 10.000 Mark. Rechnen konnte sie blitzschnell. Aber die Nummer vom Architekten hat sie mir trotzdem gegeben und der war dann ganz froh, dass er jemanden hatte, der das übernehmen wollte. Und 100 Mark für den Quadratmeter hat er mir dann auch gezahlt, er waren aber nur 30 Quadratmeter.
Der Schleich war ganz enttäuscht, als ich ihm sagte, ich spritze das Bild (eine ganze Diskoszene mit einer Sky-Line im Hintergrund), er wollte es lieber mit Pinsel gemalt haben, weil er mal im Fernsehen gesehen hatte, wie irgendwelche schwarzen Jugendlichen mit Farbspray-Dosen eine New Yorker U- Bahn völlig versaut hatten. Während der Arbeit an dem Disko-Panorama bin ich öfter zum Essen in den Dreschflegel nach Birstein gefahren. Einmal hat sich der Wirt dort zu mir an den Tisch gesetzt und mir einen Stapel Polaroids gezeigt von Trucks und Truckern.
Er war gerade dabei, das „1. Internationale Trucker-Festival in Birstein“ – „mit Tom Astor und bekannten Country-Stars“ – zu veranstalten und dafür brauchte er noch ein großes Hinweisschild. Das habe ich dann zwischendurch auch noch schnell gemalt – Dispersion auf Span, ausgesägt, ein großer roter Truck. An sich freute sich ganz Birstein über dieses Trucker-Festival, aber als man erfuhr, dass im Bierzelt ein Damen-Schlamm-Catchen stattfinden sollte, distanzierten sich nach und nach alle Schirmherren davon, zuerst der Bürgermeister, nachdem sogar der evangelische und der katholische Pfarrer von der Kanzler herab dagegen gewettert hatten. Er gingen einige einstweilige Verfügungen hin und her und tagelang wurde in Birstein über nichts anderes mehr geredet als über dieses Schlamm-Catchen, das dann nur ca. ein Dutzend Leute wirklich sehen konnten, weil mehr nicht um das in einer Ecke des Bierzeltes aufgestellte Kinder-Planschbecken paßten, das mit Haferschleim gefüllt war. Draußen hing ein Transparent mit der Aufschrift: „Wer Country-Music spielen will, muß eine Menge Mist gerochen haben. (Hank Williams)“. Während des Festivals bekam der Dreschflegel-Wirt als Veranstalter noch einmal Ärger mit der Polizei, weil mein Bild zu nahe an der Straße stand und so realistisch wirkte, dass es aussah, als würde ein Truck von rechts auf die Hauptstraße donnern, mehrere vorbeifahrende Pkws waren kreischend auf die Bremse getreten. Dieser von mir gemalte Truck, für den ich übrigens 400 Mark bekommen hatte und eine Diashow im Bierzelt über Trucks und Armeelastwagen, das waren die einzigen Trucks auf dem Festival, ansonsten gab es nur noch einen Paraphernalien-Stand und Lévi’s „Frisch-Fisch“.
M.: Manchmal bekommt man Aufträge, die einen verbittern, bei der Kunstkritikerin Hilpolt zum Beispiel. Die kauft die Arbeiten der Kollegen und schreibt über sie, aber mich holt sie, damit ich ihr das Landhaus renoviere, da muß ich ihr die Wände neu anstreichen, damit die Arbeiten der Kollegen besser zur Geltung kommen. Dabei liegt meine einzige Gestaltungsmöglichkeit dann darin, dass ich bestimmen kann, wo der Nagel hinkommt, an dem die Bilder aufgehängt werden. Sie eine Frau, die ist natürlich als Kunstkritikerin über das Auge so hoch benetzt, im ästhetischen Bereich, das die mir genau sagt, wie ich das Grau der Wandfarbe abzumischen habe: „Ja kein Rot reinmachen, das sieht man!“
L.: Ich bekam dann als nächstes einen Backhaus-Auftrag in Volkhartshain. In den Wochen davor hatten Manu und ich kaum was anderes gemacht, als im Vogelsberg rumzufahren, von einer Kerb zur nächsten, von einem Dorffest zum anderen. Dabei waren wir irgendwann in Volkhartshain gelandet. Es war schon ziemlich spät und nur noch der harte Kern der letzten Trinker hing an der Theke im Zelt. Schließlich sackte auch Manu weg und übrig blieben der Ortsvorsteher Walther und ich. Da diese Kerbs immer öder wurden, machte ich ihm den Vorschlag, doch mal ein Straßenfest zu organisieren, auf der Volkhartshainer Hauptstraße. Und er: „Ja? Was? Was ist das denn?“ Und ich ihm sofort die ganze Hippie-Schose erklärt – mit Non-Profit und jeder macht das, wozu er Lust hat, jeder Haushalt steuert irgendwas zu dem Fest bei oder läßt es sein, usw.. Walther ist in der CDU, aber das hat ihm restlos eingeleuchtet. Er sagte: „Ja, das machen wir! Aber jetzt haben wir erst mal das Problem, wir machen ja bei der Ortsverschönerung mit, ‚Unser Dorf soll schöner werden‘, da kommt dann ein Gremium, das sich aus Vertretern der regionalen Interessenverbände zusammensetzt und es gibt da einen jährlichen Wettbewerb, kurz und gut, die Kommission kommt am 28. Juli nach Volkshartshain und bis dahin muß alles topfit sein, d.h. wir haben noch eine Menge zu tun, u.a. muß auch noch das Backhaus renoviert werden…“ Er schaute lange in sein Bierglas und sagte dann: „Wenn du uns ein Bild an das Backhaus malst, dann machen wir ein Straßenfest. Alles Non-Profit!“
Besoffen wir ich damals war, hat mir das auch sofort eingeleuchtet und ich habe zugesagt. Das hat sich dann langsam im Dorf rumgesprochen – „Was? Der malt ein Bild? Der kann doch gar nicht malen!“ Einige waren schwer am Unken, viele konnten mich auch überhaupt nicht leiden in Volkshartshain. Erst einmal wurde das Backhaus neu verputzt, die Bänke gestrichen, Blumentöpfe hin und her gerückt, Zäune lackiert, Hecken gestutzt … Das meiste muß ja in Eigeninitiative geleistet werden, seit der Zusammenlegung zu Großgemeinden. Früher hatten die einzelnen Gemeinden eigenes Geld dafür zur Verfügung. Jetzt gehört Volkhartshain zu Grebenhain und die haben sich gerade für fünf Millionen ein neues Feuerwehr-Gerätehaus hingestellt, d.h. dass für Volkhartshain fünf Jahre lang kein Pfennig mehr da ist. Gerade dass man aus irgendeinem Sonderfond noch das Geld für die Farbe des öffentlichen Gebäudes Backhaus bekommen konnte.
Ich sollte mein Bild bis zum 25. Fertig haben. Vorher habe ich den Weißbindern noch ein paar kleine Anweisungen gegeben und die haben mich immer gefragt, was ich denn da raufmale. Ich hatte mir vom ehemaligen Seemann, der im Haus des Bademeisters wohnt, ein paar Dutzend Kunstpostkarten geliehen und mich für eine Bauern-Idylle entschieden: Drei dickärschige Ährenleserinnen. Dann kam aber der Iduna- Versicherungsfritze an und wollte unbedingt ein Stilleben drauf haben – irgendso einen Bierhumpen neben einem vertrockneten Hering und einem Kanten Brot. Ein anderer wollte was ganz Modernes und der Krankenpfleger Thomas, völlig bescheuert, ein jamaikanisches Panorama. Er ist ein absoluter Reggae- Fan und Kiff-Kopf.
Ein paar Abende lang standen wir vor dem Backhaus und das halbe Dorf diskutierte biertrinkenderweise über das Motiv. Die Bauern sind morgens vom Backhaus weg nach Hause gleich in den Kuhstall zum Melken gegangen. Ich wiederholte permanent – wie der alte Cato: Das muß irgendwas mit Backen zu tun haben. Ich mal euch da einen Landschaft drauf, mit einem Getreidefeld und drei Ährenleserinnen. „Ja, und wie machst du denn das?“ Und ich: „Öhöhö …“ „Ja, wann fängst du denn an?“ „Wenn es dunkel ist!“ Das hat sie schon mal sehr geschockt. Man war ziemlich gespannt. „Laßt euch überraschen. Wenn es dunkel ist, kann ich fünfmal schneller arbeiten.“ „Ja, brauchst du noch irgendwas?“ Hab ich gesagt: „Ich benötige kurz einen Traktor mit Frontlader, ein Gerüst und vielleicht noch zwei Leute, die mir kurz helfen,“ Ich hatte mir schon mal angerissen, wie groß das Bild in etwa werden sollte und bin dann weggefahren, um ein Episkop zu holen. Als ich zurückkam, war es bereits dunkel und der Traktor stand bereit. Das Episkop habe ich auf den Frontlader gestellt und es damit auf die richtige Höhe gebracht. Der alte Opa Knieriehm ist auf das Gestänge vom Frontlader geklettert und hat das Episkop festgehalten. Dann habe ich die Postkarte drunter gelegt und das Licht angeschaltet. „Das ist es! Das Bild ist fertig!“, habe ich gemeint. Die haben immer noch nicht durchgeblickt. „Du willst uns verarschen, du Schwein!“ Ich bin dann auf das Gerüst und habe die Umrisse mit einem Kohlestift nachgezeichnet. Das hat fünf Minuten gedauert. Ich habe ihnen dann erzählt, so würde man das heute meistens machen, ich hätte mich auch hinstellen können und das Ding mühsam in drei Stunden abzeichnen können. Das fanden sie schon mal sehr einleuchtend und modern. Und morgen würde ich dann mit dem Malen anfangen. Ja, wann ich denn anfangen wollte? „So zwischen drei und halb vier Nachmittags“, hab ich gesagt. Am nächsten Tag waren sie wieder alle da, ich habe mich aufs Gerüst gesetzt und als erstes angefangen, den Himmel zu malen, irgendwie so mit dickem Pinsel und Farbe und damit rumgestrichen, unten waren sie immer noch am Unken: „Ob das was wird?!“ „Ob der überhaupt malen kann?“ Dann habe ich in diesen Himmel reingezogen, so ein bißchen mit Farben, das weiteste von der Landschaft, was sich im Himmel teilweise bereits auflöst, und dann mit wenigen schnellen Strichen, zack, zack, zack, Berge am Horizont, und dann fing ich an, auch so ganz wenig: Da ein Haus, Heinrichs Haus, und noch eins, Walthers Haus, jetzt der Kirchturm, zack, die alte Schule, das Dorfgemeinschaftshaus, zack, zack, in zwei Minuten hatte ich das ganze Dorf gemalt, in der Ferne, nur mit so ein paar Pinselstrichen, während unten die letzten Skeptiker verstummten und alles begeistert war. Dann bin ich erst mal wieder runter und habe mit denen ein Bier getrunken, und dann war es auch schon wieder Abend. Bis zum Morgengrauen haben wir noch da gestanden und geredet. Am nächsten Nachmittag ging es weiter. Diesmal war fast das ganze Dorf am Zugucken und dann auch am Rummachen. Walther fing an, sein Garagentor zu streichen, Oma Müth strich ihre Fenster, die Postfrau pflanzte Blumen ein und eine andere alte Frau schrubbte die Gasse. Auf einmal war das reinste Dorfverschönerungsfieber ausgebrochen. Ein Typ war dabei, der war früher mal Ortsvorsteher gewesen, der konnte mich nicht ausstehen, der hatte früher nie auch nur ein Wort mit mir gewechselt. Ich hatte mal einen Hund, Troll, so einer, bei dem man nicht wußte, wo vorne oder hinten ist, der ist immer hoch ins Dorf gelaufen und da hat ihm dieser Typ mal mit einer Kartoffelhacke ins Bein gehauen und der Hund hatte danach noch monatelang ein Riesenloch im Bein. Der hatte zwar behauptet, er wäre es nicht gewesen, aber Rudi hatte es gesehen und mir erzählt. Auf jeden Fall, er hatte Geburtstag und stand da mit zwei anderen rum, und ich war am Malen, eine von den drei Frauen, mit einem dicken Pinsel, da ein paar Flecken und da ein paar Flecken. Die da unten kommentierten es: „Das wird doch nichts!“ „Was gibt das denn?“ Es dauerte keine fünf Minuten, da hatte ich die ganzen verstreuten Flecken zusammengebracht und es war halt ein Kleid mit Licht und Schatten und Falten und die Frau war so gut wie fertig. Sie hatten aber wohl nur mitgekriegt, wie ich irgendwelche Flecken verteilt hatte und das war für sie einfach Zauberei. Sie waren baff. Ich wußte, dass der Typ an dem Tag Geburtstag hatte und da habe ich zu ihm gesagt: „Ich steh hier auf dem Gerüst, hol mir doch mal einen schönen starken Kaffee mit zwei Stück Zucker und viel Milch und ein Stück Kuchen, möglichst mit Schlagsahne.“ Und er sofort: „Ja, ja, bring ich dir“, und ist losgeflitzt und hat mir Kaffee und Kuchen gebracht. Der war so überrascht worden von diesen Fleckenspielereien, dass er auch die nächsten zwei Tage noch immer unter dem Gerüst rumrannte und mir laufend anbot, Kaffee und Kuchen zu holen. Er hatte irgendwie mitbekommen, ich brauch viel Kaffee, um wach zu bleiben. Ich habe jeden Tag höchstens drei Stunden gearbeitet, insgesamt vielleicht zwölf, es extra hinausgezögert.
Als das Bild fertig war, hat der von der Iduna einen Pressefuzzi geholt (einen, dem er mal günstig eine Lebensversicherung verkauft hatte) und der Journalist hat dann auch ein Foto gemacht und dann stand wieder was über Volkhartshain in der Presse und dass da ein Künstler das Backhaus gemalt hat. Dann kam diese „Unser Dorf soll schöner werden“-Kommission und die Kommission hat Volkhartshain gelobt, die waren voll des Lobes und deswegen gab es später noch einen Artikel übers Dorf in der Kreiszeitung. Wenn ich in die CDU eingetreten wäre, die hätten mich vielleicht sogar zum 1. Vorsitzenden des Tischtennis- Vereins gemacht, das war das Hauptkulturträger im Dorf, vier Tage hatte ich jedenfalls die besten Karten in Volkshartshain.
M.: Ich bekam mal einen Anruf von der katholischen Gemeinde in Gelnhausen. Die hatten irgendwas von mir erfahren und dass ich auch fotografieren würde, jetzt hätten sie eventuell einen Auftrag für mich, ich solle mal vorbeischauen. Ein Kirchenauftrag, das ist ja toll, hab ich gedacht und bin gleich hingefahren. Wenn man mal einen Fuß in der Kirche hat, das zieht bestimmt noch weitere Aufträge nach sich. Kurz und gut, es ging darum, dass die ihre bunten bleiverglasten Kirchenfenster, aus dem 18. Jahrhundert oder so, fotografiert haben wollten. Wunderbar. Zuerst musste aber mal eine Firma mit einem Spezialgerät kommen und die großen Schutzvorrichtungen vor den Fenstern, aus Plexiglas, abbauen, weil die störende Lichtreflexe warfen. Dann habe ich meine geliehene Hasselblad aufgebaut, alles fotografiert und die Fotos entwickelt und vergrößert, die Firma baute die Plexiglas-Vorrichtungen wieder an und ich setzte mich zu Hause hin und schrieb eine überzeugende Rechnung – über 3000 Mark. Eine Woche später schickte mir die Kirchengemeinde eine Spendenquittung in Höhe von 3000 Mark. Das wars. Und dann waren die auch noch katholisch und ich bin protestantisch. Seitdem bin ich auf Kirchenaufträge nicht mehr so scharf.
N.: Zwischendurch bekommt man auch immer wieder mal Arbeiten, wo nichts passiert, völlig langweilige Geschichten. Einmal sollte ich fürs Hanauer Heimatmuseum irgend so ein didaktisches Ding anfertigen, für eine neue Ausstellung: eine Ständepyramide: Hämmernde Gesellen, eggende Bauern und so was, von winzigen Vorlagen mit Tuschefedern abgezeichnet und koloriert. Da hatte ich mir gedacht, es ist Sommer und draußen eh zu warm, da kann ich gemütlich hier im Haus sitzen, aber ich zeichne ja so gut wie nie und außerdem kann ich Fitzelkram nicht ausstehen. 300 Markt sollte ich dafür bekommen und dann habe ich angefangen. Alle drei Minuten bekam ich einen Krampf in der Hand, musste die Feder beiseite legen und mir fünf Minuten die Hand massieren, irgendwelche Salben draufschmieren. Vier Tage habe ich gebraucht. Und dann dauerte es ewig, bis das Museum mit dem Geld rüberkam und dann wollte auch noch der Typ, der mir den Auftrag verschafft hatte, einen Fünfziger Provision haben.
M.: Manchmal geht das von einem Auftrag zum nächsten über Empfehlungen. Einmal kam z.B. auf diese Weise ein älteres Pärchen bei uns auf den Hof gefahren – im VW-Bus, der Typ mit Bart und freiem Oberkörper, kurze weiße Hose. Die sagen beide sehr kurios aus. Ja, und was sie denn gemalt haben wollten? Ja, rehe wollten sie, ans Haus. Ach, um Gottes Willen, hab ich gesagt, auf Rehe zu malen habe ich einfach keine Lust. Und das fanden die fürchterlich arrogant und sind wieder abgezogen. Ich wollte sowieso erst einmal in Urlaub fahren. Wieder zurück brauchte ich natürlich wieder Geld und bin dann irgendwann zu denen hingefahren. Ich hätte denen auch Rehe gemalt, aber es gelang mir, ihnen eine Gainsborough-Kopie aufzuschwatzen: Eine südenglische Heuernte, eine wirklich tolle Idylle. Ich hab dann auch so ein bißchen was von denen mitbekommen. Sie war ihrem Mann abgehauen und er seiner Frau, weil, was weiß ich, die sich alle irgendwie gegenseitig vergiften wollten. Der Typ war schon zweimal am Gehirntumor operiert worden, hat immer rumerzählt, von irgendwelchen Frauen, dass er da wie ein Stier wird, und ich saß ihm gegenüber und habe mir gedacht, auweia, der wird ja schon zum Stier, wenn er nur davon erzählt. Und die Frau immer dazwischen zu mir: „Willst du hier noch was vom Kuchen und noch eine Tasse Kaffee, und wenn du anfängst, ich bin ja dann nicht da, ich leg dir hier den Schlüssel hin und stell dir was zum Essen auf den Tisch.“ Als ich den ersten Tag kam, meinte sie, sie müßte um zwei Uhr arbeiten, hätte mir aber zwei Rippchen fertiggemacht, die im Kühlschrank lägen. Ein paar Stunden später kam der Sohn – von seinem Spanienurlaub zurück, mit seiner Freundin, die er Mäuschen nannte. Er war so ein stämmiger 19jähriger Dachdecker. Wir haben uns eine Weile unterhalten, dann hat er mir seinen Body-Building- Trainingsraum im Keller gezeigt, wo wir ein bißchen Hanteln gestemmt haben. Er hatte noch ein paar Tage Urlaub und am nächsten Tag kam er wieder an. Ich stand auf dem Gerüst. Da fragte er mich, ob wir uns nicht zusammen Videos angucken wollten, er hätte sich gerade ein paar neue Pornos geholt. Haben wir uns also erst mal im Wohnzimmer einen Porno reingezogen. Er hatte die ganze Zeit die Fernbedienung in der Hand und wenn jemand ins Zimmer kam, schaltete er schnell um, durfte niemand mitkriegen, dass wir uns am hellichten Tag Pornos anschauten. Aber meistens war es seine Freundin, die da so leicht indigniert durchs Wohnzimmer schlicht und dabei irgendwelche Bemerkungen fallen ließ – was wir uns für einen Scheiß anguckten, er hat sie jedesmal zurück angemacht: „Mach dich doch raus, wenn du keine Pornos sehen willst“. Das waren vielleicht dumpfe Dinger, noch drei Nummern bescheuerter als die Pornos in der „Heißen Hütte“ in Büdingen. Am nächsten Tag kam er zu mir und meinte: „Du mußt mir unbedingt ein Bild für mein Zimmer malen. Er wollte so einen Typen so ähnlich wie Supermann gemalt haben, unheimlich groß und stark, und der sollte so aussehen wie er, und dann um ihn herum so ein paar Mickerlinge, die so aussehen sollten wie seine Freunde. Und das wollte er riesig-groß haben und was das denn kosten würde? Hab ich gesagt: „Naja, 1500 Mark ungefähr“. Und das fand er auch in Ordnung. Er hätte nur im Augenblick gerade nicht so viel. Ach ja, und dann sollte da noch eine scharfe Frau drauf, die ihm zu Füßen liegt.
L.: Mein wichtigster Auftraggeber, quasi ein Dauerauftrag, war Peter, der seit einem Jahr in Ober-Seemen eine Kfz-Werkstatt hat. Seine Frau war mal in einem Volkshochschulkurs von Manu, von daher kenne ich sie, und als Peter die Werkstatt eröffnete, habe ich ab und zu beim ihm getankt. Einmal meinte er, er bräuchte irgendeine Werbung für seine Werkstatt: „Du kannst doch malen, mal mir doch mal ein Bild auf die Garangentür, die ist so vergammelt, da muß Farbe rauf.“ Er hat dann so rumgesponnen, was man da alles raufmalen könnte: einen Rennwagen, einen Geschlechtsakt, Trucks mit irgendwelchen Tussis, die mir prallen Ärschen an der Straße stehen … Irgend so was in der Art sollte ich machen, aber Geld gäbe es keins, er würde mir dafür meinen Benz reparieren. Ich habe dann einen Scirocco von hinten gemalt und daneben eine dralle blonde Tankwartin, mit aufgerissenem Mund, die zwischen den Beinen einen Tankschlauch hält und damit irgendwelchen Sprit in das Auto schüttet. Auf dem Original war sie barbusig, und jetzt musste man irendwie, man konnte ja da im Dorf nicht, die musste halt was anhaben, ich habe ihr dann irgend so ein Hemdchen gemalt, ein nasses T-Shirt, mit dem sie noch nackter aussah. Irgendwo stand dann noch groß „Quick-Wash“ drüber. Als ich anfing, habe ich die Tür erst einmal weiß grundiert und dann die Umrisse der Zeichnung mit brauner Dispersionsfarbe einfach nachgezogen, mit einem spitzen, weichen Pinsel. Die Nachbarin, die Frau von einem Bauunternehmer, fand diese Zeichnung ganz toll, als ich dann aber mit den knallbunten Farben und der Spritzpistole anfing, das auszumalen, fand sie das alles zu obszön, das ginge nicht, sie müßte da jeden Tag dran vorbeigehen. Peter hat zu ihr nur „ja, ja“ gesagt. Das Bild ist jedenfalls immer noch auf der Garagentür. Ich wußte von Peter vorher nur, dass er so ein schräger Fuzzi war, der alle möglichen linken Dinger dreht, und jetzt musste er also was an meinem Benz machen, aber da war nichts dran zu machen, war alles okay, er hat nur ab und zu mal unter die Motorhaube geguckt.
In dem Sommer bin ich fast täglich an den Gederner See gefahren zum Tretbootfahren. Und da musste ich immer bei Peter vorbei. Irgendwann habe ich zu ihm mal gemeint: „Du brauchst unbedingt eine Espresso-Maschine und die stellst du draußen hin, unter einen Sonnenschirm, und dann einen Tisch und ein paar Stühle dazu, das muß gemütlich sein, dann kommen die Leute auch zu dir. Tanken, das muß wie Urlaub sein“, hab ich gemeint, aber Peter mochte keinen Espresso. Bis er irgendwann mal bei seiner Schwägerin zum Essen eingeladen war und da gab es anschließend einen Espresso. Beim nächsten Metro-Einkauf hat er sich dann gleich so eine Maschine angeschafft, für 120 Mark. Und ich hockte ab da jeden Tag bei ihm unterm Sonnenschirm und habe einen Espresso getrunken, für eine Mark. Und dann habe ich ihm ein Schild gemalt, für seine Motoröle, ein Sonderangebotsschild, und dann noch eins für seine Spraydosen, und dafür bekam ich zwei Reifen von ihm oder einen Ölwechsel, also solche Geschichten. Ein Jahr ungefähr lief das so.
Die einzig größere Sache war die Bemalung der Überdachung für die Zapfsäulen, eine anstrengende Überkopfmalerei. Ich hab aus der Überdachung eine Sixtinische Kapelle gemacht – mit der Erschaffung Adams, dem dabei ein Zapfhahn in die Hand gedrückt wird. Am Anfang hatten wir ausgemacht, ich brauche nur das Material zu bezahlen und ansonsten rechnen wir einfach seine Arbeitszeit gegen meine auf. Dann war aber plötzlich der Benz alle nasenlang kaputt und er reparierte ihn, was zur Folge hatte, dass er sich laufend neue Malaufträge für mich einfallen lassen musste. Also Kunst, keine Anstreicher- Arbeiten. Das sah dann z.B. so aus, dass er die Suzuki-Vertretung haben wollte und sich einen Suzuki-Jeep kaufte, obwohl er keine müde Mark in der Tasche hatte, und ich musste ihm dann hinten auf das Blech, das den Ersatzreifen hält, ein Bild malen – einen Adler. Ein paar Tage später kam dann schon der nächste Suzuki-Jeep-Besitzer und wollte ebenfalls ein Bild auf den Ersatzreifen gemalt haben – einen Mustang, für 200 Mark, was wieder soundsoviele Ölwechsel, kleinere Reparaturen, etc. bedeutete.
Als ich noch an diesem Mustang rumpinselte kam Toni, der Pizzeria-Besitzer aus Gedern zum Tanken vorbei. „Ach, wußte gar nicht, du prima Maler, mal mir ein Bild in Pizzeria“. „Klar, mach ich, Toni“, hab ich gesagt. Und bin dann ein paar Tage später zu ihm hin. Bei Tortellini und Thunfischsalat haben wir das Motiv diskutiert. Es musste irgendwas Sardisches sein. Ich sollte ihm eine Pizza und Wein und so was vor einer Landschaft malen und hatte schließlich die Idee mit dem „Abendmahl“, wo alle Jünger um eine Riesenpizza sitzen, knallbunt und jeder versucht sich da ein Stück rauszuziehen, ein Riesengewurschel mit Pizza und Käse. Toni war absolut begeistert. Zuvor musste Roberto aber noch die Wand neu verputzen und der war gegen das Motiv: „Das ist Gotteslästerung“, hat er gesagt, „das kann man nicht machen. Es kommt niemand mehr in deine Pizzeria, Toni“, usw.. Das hat Toni derart verunsichert, dass er plötzlich was anderes drauf gemalt haben wollte. Eine sardische Idylle habe ich ihm dann liefern müssen – mit seinem Großvater in der Mitte. „Das war großer Bandit“, meinte Toni, „Partisan, verstehst du?!“.
Bei Peter ging es dann im Spätherbst so weiter, dass ihm ein Prospekt von Glasurit in die Hände fiel und da wollte er bei denen sofort einen Kursus in Auto-Bemalung machen, um Air-Brush-Bilder auf Karosserien malen zu können. Ich hab ihm gesagt, das könnte ich auch, hab mir von ihm eine Schrott-Motorhaube geben lassen und eine Wassernixe mit Brandung draufgesprüht. Peter war begeistert. Und gleich am nächsten Tag sollte ich seinen Passat und einen Scirocco bemalen. Er hat die Karosserie-Teile jeweils geschliffen und grundiert und anschließend noch fünf Klarlack- Schichten drübergelegt. Wir haben die üblichen Ralley-Idioten-Motive genommen – so Mischungen aus Schwermetall-Fantasy und oberhessischen Playboy-Imitationen. Peter kümmerte sich um weitere Aufträge. Einer wollte ein Bild auf seinen Motorrad-Tank gemalt haben, ein anderer, der Besitzer vom Windsor-Club in Büdingen, irgendwelche Streifen an seinen Bentley. Das Geschäft lief gut an, das muß man sagen.
Als dann in der „Bild am Sonntag“ auch noch ein Artikel über solche Karosserie-Bemalungen mit Air-Brush erschien, haben wir uns hingesetzt und für die Kreiszeitung ebenfalls einen Werbeartikel verfaßt, der wurde aber nie abgeschickt. Ich bekam es von der ganzen Farbsprüherei auf die Lunge und hörte mit dem Rauchen auf, und Peter ging das Geld aus, die Werkstatt lief schlecht, er vergraulte mehr Kunden als neue hinzukamen mit seiner chaotischen Art. Und in dieser Situation wurden wir beide unausstehlich. Einmal kam er mit einem Busunternehmer, der auf seine zwölf Busse hinten irgendwelche Bilder – Palmen mit Sonnenuntergängen – gesprüht haben wollte, aber ich habe gleich den Preis so hoch angesetzt, dass der Typ sich wieder verzog. An sich war diese Auto- Design-Idee nicht schlecht, gerade für Peter nicht, der sich damit neue Kunden für seine Werkstatt ranlockte, die auch immer was zu gucken hatten, aber auf die Dauer war das für mich nichts, nicht nur wegen der Glasurit- Schichten – Giftklasse 5Fx – auf den Bronchien.
M.: Schon seit längerem wollte ich mal eine Anzeige in die Zeitung setzen, dass ich Häuser bemale. Als mir dann das Geld ausging, habe ich das auch gemacht. Und dann kamen ein paar Anrufe. Eine Frau, die war ganz hartnäckig. Die meisten haben nur einmal angerufen und es dann wieder vergessen. Ich habe die Frau dann auch zurückgerufen. Sie hätte ein kleines Fertighaus, das wäre halt nicht so schön und deswegen sollte da ein Bild drauf. „Historische Figuren“, meinte der Mann. Erst wußte er von nichts, weil seine Frau das mit mir ausgemacht hatte. „Wie auf einem Fachwerkhaus, so historische Figuren“. Die gibt es überhaupt nicht, aber er meinte, man würde die überall finden. Seine Frau hat mir die Ohren vollgesabbelt: „Ja, sie hätten ein Neckermann-Fertighäuschen, so langweilig, und sie wollte was Gotisches um die Fenster. Hab ich erst mal gedacht: Oh, verdammte Scheiße, was gibt das wieder für ein Ding? An ein Neckermann-Haus auch noch. Und dann fiel mir ein früherer Auftraggeber ein, bei dem hatte ich mal ein Buch gesehen: „Fassadenmalerei“ – ein dickes, schönes Buch mit wahnsinnig vielen Abbildungen, das habe ich mir am nächsten Tag ausgeliehen und bin damit zu meinen neuen Auftraggebern hingefahren. Das Haus war von vorne ganz zugewachsen – mit so Zierbäumen: Wacholder, Lebensbäume, Zwergpinien und Krüppelkiefern. Verdammte Scheiße, wo soll ich denn da noch was hinmalen? Die Frau, mit gefärbten Haaren, machte mir gleich auf, sah aus wie sechzig, später hat sie mir erzählt, sie sei über siebzig, total behängt mit Klunkern. Im Flur hing ein Riesen-Barock-Spiegel, Stuck um die Türrahmen, alles in hellblau, das ganze Wohnzimmer so Neubarock aus dem Neckermann- Katalog, da sollte ich mich hinsetzen. Mehrere Zimmer gingen ineinander über, mit Bögen dazwischen und alles vollgestopft von oben bis unten, die Wände waren voll mit Barockbildern, überall Schnörkel: Da ging ein Engel von der Decke und da eine Rosette aus Plastik mit Holzlasur. Sie guckte sich das Buch an und rastete völlig aus. „Das ist ja so wahnsinnig schön. Und das ist ja noch viel schöner. Und das erst.“ Und zwischendurch immer wieder: „Das ist ja so toll, dass sie das Buch mitgebracht haben.“ „Sie hätten das Buch nicht mitbringen dürfen, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr …“ „Sie mit Ihrem künstlerischen Verständnis, Sie müssen das entscheiden …“ Und dann rief sie ihren Mann und der musste sich dann auch noch mal die ganzen 250 Seiten angucken. Ich hab denen erzählt, dass all diese abgebildeten Säulen, Balkone, Fenster, Putten, Türen und Bögen gemalt seien – bloße Fassadenmalerei. Und dann fing die Frau an: „Ach, ich wollte ja schon immer in einer Villa wohnen mit Säulen. Vielleicht sollten wir Säulen auf die Fassade malen?“ Es waren beides Rentner, sie aus Berlin, er vom Bodensee. Er schnipselte immer in seinem Garten rum, ein kleiner Garten an sich, aber mindestens 200 Bäume drauf, alles diese Zierbäume, ein richtiger Mini-Urwald, man musste sich da durchquetschen, zu einem kleinen freien Platz, wo eine griechische Statue aus Gips stand, vor einem Springbrunnen und flankiert von riesigen Blumentöpfen. Die Frau erzählte mir die ganze Zeit von ihrer Terrasse, wo ich auch irgendwann was malen sollte. Aber erst mal ging es darum, sie hatten gerade Heizöl gekauft und ich kam ganz ungelegen, sollte nur was ganz Kleines malen, nur was um die Tür, und später um alle Fenster rum, und er wollte immer noch Sankt Georg mit dem Drachen vorne neben die Eingangstür haben, und zwei dorische Säulen. Das Buch hatte ihre Phantasie wahnsinnig angeregt. Da sie den Vorschlag gemacht hatten, aus finanziellen Gründen, alles nach und nach zu malen, hab ich schon gedacht, das gibt wieder einen Dauerauftrag. Ich habe dann gesagt, dass sie sich in Ruhe entscheiden sollen, ich lasse ihnen das Buch da. In der Zeitung hatte ich geschrieben: zwischen 400 und 800 Mark würden die Malereien kosten; zu ihrer Beruhigung habe ich dann hinzugefügt, dass solche Fenster-Ummalungen billiger seien. Und so etwas sollte ich ihnen dann auch machen: Oberbayrische Lüftelmalerei um die Fenster. Für 700 Mark insgesamt. Später kam dann noch ein kleines Barockbild dazu: Ein junge Frau im Reifrock, die unter einem dürren Baum sitzt und ein Schäfchen streichelt. Auch auf die Außenfassade, an einer Stelle, wo von der Symmetrie her ein Fenster fehlte.
N.: Kaum war ich mit dem einen Auftrag fertig, rief ein Herr Grönewoldt aus Nieder-Seemen an, der ein Bild gemalt haben wollte. Ach nein, das war anders, der kam hierher und wollte eine Gans kaufen, wir haben aber keine Gänse mehr, und da hat er mitgekriegt, dass wir malen. So war das. Und dann kam er noch mal – mit einer Gipsrosette, die man an die Decke klebt, und in deren Mitte ein Kronleuchter hängt, mit so einem Ding kam er an, um unsere Fähigkeiten erst mal zu testen. Diese Rosette wollte er sehr delikat und zart pastell bemalt haben. Das habe ich auch gemacht. Für einen Fuffi. Er war auch ganz zufrieden damit, nur einige Rosen waren ihm noch ein bißchen zu glühend. Na gut. Das war also erledigt. Irgendwann hat er dann angerufen und gefragt, ob ich mal vorbeikommen könnte. Vorher hatte er schon von einem Bild geredet. Hab ich gedacht, er will halt jetzt so einen Schinken gemalt haben. So war es aber nicht. Erst einmal musste ich eine Führung durch sein Haus mit ihm machen. An der Decke im Wohnzimmer hing noch so eine Gipsrosette, in der Mitte ein wahnsinnig häßlicher Leuchter. Hat er gemeint, die Rosette wollte er auch so ein bißchen in Pastellfarben haben, er hätte auch eine Leiter da, ich könnte gleich anfangen. Das kleine runde Feld, wo die Lampe raushing, habe ich himmelblau gemacht. Er ist die ganze Zeit wie ein Distelfink um die Leiter rumgesprungen und hat immer gemeint: „Toll, dieses Blau, einfach toll!“ Und zwischendurch hat er sich immer wieder als ausgezeichneter Gastgeber profiliert, indem er laufend in meiner Reichweite Kristallgläser mit einem ausgezeichneten Wein deponierte. Seine Frau kam dann auch noch dazu, aber ihr war das alles nicht so ganz geheuer. Sie ging arbeiten und er war schon Rentner. „Ach, du immer mit deinem Kram“, sagte sie ein paar Mal, sie wollte das eigentlich alles gar nicht. Ihr war das auch peinlich, dass ihr Mann so einen pingeligen oder ungewöhnlichen Geschmack hatte. Auf jeden Fall hat sie mich dann zu irgendwelchen Resten von Hasenpfeffer eingeladen, und dazu gab es Elsässer Wein. Ich wurde immer betrunkener.
Am Nachmittag gab es dann in der Küche noch Kaffee und Kuchen. Der Auftrag zog sich hin, das mit der kleinen Rosette, weil er mir ständig irgendwas anderes noch zeigen wollte oder wir ins Reden bzw. Essen und Trinken kamen. Sieben Stunden war ich insgesamt beschäftigt, wieder für einen Fuffi. Er hat mich mehr als Gesprächspartner bezahlt. „Komm doch mal wieder vorbei, das war prima!“ meinte er als ich ging. Im Keller besaß er einen Hobby-Raum, eine fast vollständig eingerichtete Schreinerei. „Wenn ihr irgendwas gemacht haben wollt, kommt einfach vorbei“. Eigentlich wollte er ja ein Bild gemalt haben: Verhärmte Flüchtlinge, die über die deutsche Scholle gen Westen wanken. Auf einer Auktion hatte er mal von einem norwegischen Maler ein Bild gekauft – ein Gabenfeld bei Vollmond. Ein sehr schönes kleines Bild. Das hing in seinem Wohnzimmer, in dem die Decke und die Türen aus Kirschholz waren, in der Mitte stand ein Eichentisch. Um sein Grundstück hatte er sich so eine geschwungene Mauer im spanisch-maurischen Stil gebaut, ibizamäßig, und innen also dieser Schwarzwaldstil. Es war auch ein Fertighaus. Und nun war ihm dieses Bild von dem Norweger nicht mehr groß genug. Die riesigen Malereien in unserem Atelier müssen ihn inspiriert haben. Ich gab ihm einen Stapel Kunstpostkarten, weil ich dachte; Mach ich ihm halt eine Kopie von irgendwas. Als er dann anrief und sagte, ich solle vorbeikommen, dachte ich natürlich, er hat sich was ausgesucht, war aber nicht. Er wußte noch nicht so richtig. Haben wir also zusammengesessen und Wein getrunken. Das ging ein paar Mal so. Irgendwann hatte er aber doch was gefunden – er gleich mit dem Zollstock an der Wand über der Wohnzimmercouch: 2 Meter 20 mal 1 Meter 20, in einem Zimmer von höchstens 20 Quadratmetern, und ich guck mir die Postkarte an, da war das so etwas Ähnliches wie von Käthe Kollwitz. Also irgend so eine Elends-Vision. Wenn ich die dem gemalt hätte, nach drei Wochen hätte er nur noch geheult und nach weiteren drei Wochen wäre er in seinen Hobbykeller gewankt und hätte Selbstmord begangen, auf seiner Kreissäge oder was weiß ich. Er hat gemeint, ja, er wäre doch auch mal geflüchtet. Und sowieso hatte er mir schon erzählt, dass er depressiv wäre, deswegen würde er so viel schaffen.
Ich habe ihm dann das Bild ausgeredet. Irgendwann rief er wieder an, jetzt hätte er was gefunden. Ich habe gleich gedacht: Oh scheiße, wieder ein Nachmittag weg, bin aber runtergefahren. Da hat er mir in einem Buch auf einer Seite, unten winzig klein in der Ecke, eine Federzeichnung von Wilhelm Busch gezeigt, die er unbedingt haben wollte, so eine schnelle Zeichnung mit 15 Federstrichen: Ein Spießbürger im Sessel mit dickem Bauch und Zigarre im Maul, der von einem dünnen spitzgesichtigen Wanderburschen mit Felleisen schräg angeschaut wird. Auf handbemalten Zielscheiben, die den Ehrenschützen vorbehalten sind, sollte ich das malen, eine hatte er schon fertig grundiert in seinem Bastelkeller liegen. In einer halben Stunde habe ich ihm das Ding da raufgeklatscht, mit Acrylfarben von seiner Frau, die manchmal nach Zahlen Katzenbilder ausmalte. Als er es dann abholte, wußte ich erst gar nicht, wieviel ich dafür nehmen sollte, bloß weg das Ding, wir haben noch dagestanden und über die Schwierigkeiten bei der Festlegung der Kosten solcher Arbeiten geredet. Fünfzig Mark habe ich dann wieder genommen, ich wollte ihn nur los sein …
L.: Man sollte man darüber nachdenken, ob Kunst, ich meine jetzt vor allem Bilder, die man an die Wand hängt, ob man die nicht auf Krankenschein bekommen kann, dass ich also als Maler über die Krankenkassen abrechne. Die Bilder, die haben ja auch eine Langzeit-Wirkung, mehrere Jahre meistens, so lange eben, wie jemand sie in seinem Zimmer hängen hat, und dabei laufen jede Menge Auseinandersetzungen und Identifikationen damit. So ein Krankenkassen-Kunstmodell wäre jedenfalls weitaus besser als das holländische Modell, wo der Staat den Künstlern quasi ein Gehalt zahlt und dafür Bilder bekommt, die er in irgendwelchen Speicherräumen, kulturellen Zehntscheinen, abbunkert, wo sie vor sich hingammeln. Sowas ist Mist. Wenn der Künstler für irgendwelchen vergrätzten Bürokraten arbeitet statt sich mit hochmotivierten privaten Auftraggebern zu arrangieren, die dann ja wirklich auch mit dem Bild leben wollen oder müssen. In Volkhartshain da war quasi eine Woche das ganze Dorf an der Malerei beteiligt, und die Bezahlung, die war dann ja das Straßenfest, das sie dann vier Wochen später auch wirklich gemacht haben, ein tolles Fest im übrigen, da gab es zum Beispiel zwei Familien, die wohnten seit 15 Jahren im Dorf und hatten seit 15 Jahren noch mit niemandem dort geredet, die hingen auf dem Fest bis morgens um Fünf da rum und haben mit fast allen getanzt und geredet.
N.: Dabei fällt mir noch was ein, dieses Krankenkassen-Modell noch mal: Im Grunde gibt es das ja schon. Vor einigen Jahren habe ich mal in ei ner psychosomatischen Klinik als Beschäftigungstherapeut gearbeitet – Maltherapie, das ist ja schon fast so etwas, auch wenn das in diese ganze Prinzhorn-Muff-Richtung geht. Und danach habe ich in Schotten und Lauterbach Volkshochschulkurse im Malen gegeben, das ist auch so etwas Ähnliches. In der psychosomatischen Klinik hatte ich mit magersüchtigen und fettsüchtigen Frauen zu tun und statt Mallehrer war ich dann sehr schnell deren Entertainer, d.h. ich musste für die als Discjockey Platten auflegen, nach denen sie getanzt haben.
L.: Mein letzter Auftrag, der fädelte sich quasi am Faschingssamstag ein. Da hat ein bisher Unbekannter kurz vor Mitternacht in Volkhartshain drei Frauen umgebracht – Großmutter, Mutter und zwölfjährige Tochter. Ein fürchterliches Blutbad angerichtet, mit einem schweren Gegenstand und einem Messer. Der Täter muß barfuß gewesen sein. Man fand einen blutigen Fußabdruck. Die Polizei quartierte sich wochenlang im Dorfgemeinschaftshaus ein. Sie fingen an, alle Leute aus dem Dorf zu verhören. Zuerst den Schäfer, der nachts um ein Uhr auf der Straße gesehen worden war, er hatte seinen Sohn, einen Bäckerlehrling, zur Arbeit gefahren. Der Täter hatte die Schuhgröße 44, deswegen schieden die meisten als unverdächtig aus, ich auch. Vor einem Jahr hatte die Familie das Haus der Oma väterlicherseits verkauft, weil die allein nicht mehr drin wohnen konnte. Die Oma hatte mit ihren 88 Jahren deswegen Selbstmord gemacht, im Dorfweiher, der nur einen Meter tief ist. Ein halbes Jahr später starb ihr Sohn an einem Herzinfarkt. Seine Frau verkaufte das Vieh und die landwirtschaftlichen Geräte, erst vor einigen Wochen den Traktor für 18.000 Mark. Das Geld war nicht auf die Bank gezahlt worden, im Gegenteil, sie hatte sogar noch was abgehoben. Die Polizei vermutete deswegen einen Raubüberfall, und der konnte nur von jemandem verübt worden sein, der von dem Geld wußte. Irgendjemand aus dem Dorf, aus dem Umfeld des Käufers oder jemand aus der Verwandtschaft. Das Haus war vom Täter völlig auf den Kopf gestellt worden. Als man nach einer Woche noch niemanden verhaften konnte, wurde die Atmosphäre im Dorf immer gespannter. Jeder verdächtigte jden, ja, viele fühlten sich selbst verdächtig, einige kauften sich Gewehre, andere schlossen nachts ihre Türen ab. Der Ortsvorsteher berief in seinem zum Partyraum umgebauten ehemaligen Schweinestall eine Dorfversammlung ein. Er fungierte als Mittelsmann zwischen der Polizei im Dorfgemeinschaftshaus und den verwirrten Leuten drumrum. Die Polizei ließ Hubschrauber über dem Dorf kreisen, sie durchsuchte mit Leitern alle Dachrinnen. Als ich an der Tankstelle in Büdingen mal den Tankwart fragte, was es Neues über den Mord in Volkhartshain gäbe, schrieb der sich gleich meine Nummer auf, meldete sie der Polizei und die setzten sich sofort auf meine Fährte. Ich war gerade auf dem Weg nach Frankfurt, wo ich einen neuen Auftrag hatte, ich sollte für eine Kaffeerösterei ein Firmenschild malen, für 400 Mark. Die Polizei ließ mich nach kurzer Zeit wieder laufen. Aber ein paar Tage später tauchten sie in unserem Atelier auf und wir kamen ganz nett ins Gespräch dabei. Ich bot mich ihnen als Phantomzeichner an – und tatsächlich bekam ich auch den Job: sie zahlten mir hundert Mark für eine Zeichnung. Bis jetzt hat man zwar noch niemanden verhaftet, aber mein Honorar ist nicht vom Erfolg abhängig. Ich habe diese Phantomköpfe mit schwarzer Feder gezeichnet. Es war ziemlich schwierig. Die Kripo-Beamten kamen mir laufend mit ganz ungewöhnlichen Einwänden. Fast war es das Gegenteil von dem, was ich sonst so gemacht hatte: Eine möglichst genaue Kopie von einem verschwundenen Original anzufertigen, das vielleicht nie existiert hat. Der Täter, den die Polizei dann später – ohne Phantomzeichnung – verhaftete, war es dann auch gar nicht: seinen Anwälten gelang es, ihn wieder freizubekommen. Mittlerweile hat man es aufgegeben, nach dem echten zu suchen, und der falsche wurde trotzdem bestraft: er saß lange in U-Haft, seine Verlobte trennte sich von ihm, er verlor seine Arbeit, und als er rauskam, traute er sich nicht mehr in sein Heimatdorf zurück. Die Bevölkerung hier mißtraut nämlich immer noch der Intelligenz, mit der seine linken Anwälte aus Frankfurt ihn freibekamen. Für sie gilt eher sein „Geständnis“, das die beiden Polizisten, einer aus Alsfeld, der andere vom BKA, aus ihm rauspreßten – mit „persönlichkeitsverletzenden Polizeipraktiken“, wie es einer der Gutachter ausdrückte.