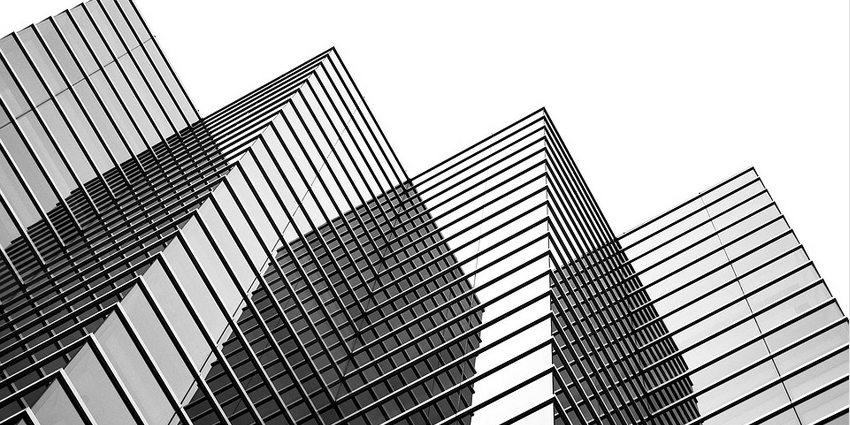Nicht nur Individuen, auch ganze Gemeinwesen (Dörfer) können „verlieren“ (scheitern), aber anscheinend auch „gewinnen“ – vom „Survival of the Fittest“ zu reden, wäre hierbei jedoch übertrieben.
Soeben erschien ein „Roman“ über den aktuellen Niedergang eines polnischen Dorfes: „Tartak“ (Das Sägewerk). Es geht darin um einzeln vorgestellte Handlungsträger in einem Kolchosendorf mit einer Kolchosensiedlung, aber seit der Wende ohne Kolchose, dafür jedoch mit einem neuen Sägewerk, das der Privatbesitzer (Businessman) am Ende anzündet, damit es nicht seinen Gläubigern in die Hände fällt.
Der Autor des Buches Daniel Odija wurde 1974 in Slupsk geboren, wo er heute noch als Schriftsteller und Fernsehjournalist lebt. Man könnte ihn zu den neuen skeptischen oder pessimistischen „Naturalisten“ zählen. Sein Roman könnte denn auch bereits das Drehbuch zum Dokumentarfilm aus dem Jahr 1997 von Ewa Borzecka „Arizona“ sein, in dem sich bereits einige identische Szenen finden.
Er handelt ebenfalls von einer Gruppe langzeitarbeitsloser Bauern aus einem Staatsbetrieb, der aufgelöst wurde (bis 1989 wurde 20% der Gesamtfläche von solchen „Kolchosen“ bewirtschaftet), das Gutsgebäude kaufte ein Städter. In den Mittelpunkt ihrer Dokumentation stellte die junge Regisseurin Ewa Borzecka den einzigen Lebensmittelhändler des Dorfes. Er fährt einen Mercedes und verkauft den Fertigen zwar in der Not kein Brot mehr, versorgt sie jedoch ohne Ende mit dem Billigwein „Arizona“. Dafür darf er die Sozialhilfe seiner Stammkunden bei der Behörde direkt kassieren. Borzeckas Dokumentationen des Elends – neben „Arizona“ ist das noch ein Film über Warschauer Obdachlose, die in der Kanalisation hausen sowie einer über ledige Mütter, die sich durch Beischlafdiebstähle ernähren – bezeichnete die polnische Kritik als „Pornographie“. Es gibt sogar einen „Gegenfilm“ dazu: die Komödie „Geld ist nicht alles“ (Pieniadze to nie wszystko). Statt sich zu besaufen entführen hier die arbeitslosen Bauern einen Yuppie, statt eines Lösegelds hilft er ihnen, die Kolchose für die Marktwirtschaft fit zu machen.
Odijas Roman „Das Sägewerk“ kreist gewissermaßen um den Sägewerksbesitzer Mysliwski, der seinem mißratenen Sohn zuletzt auch noch seinen Mercedes überläßt – und sich ganz dem Alkohol widmet oder ergibt. Ich habe in dieser Dorferzählung, wenn sie die Wirtschaftstopographie thematisiert, den Ort „Osno“ im Libuser Land wiedererkannt. Und in dem Politiker, der bei seinem Wahlkampf ins Dorf kommt, den Bauernführer Lepper. Die Halbprostituierte Mariola erinnerte mich an die „zwei Schwestern“ in der biographischen und sehr viel genaueren, aber auch dickeren Dorfchronik „Der helle Horizont“ des berühmten polnischen Autors Wieslaw Mysliwski. Dass Odijas Hauptfigur ebenfalls Mysliwski heißt, ist vielleicht nicht zufällig.
Mehr als diese ganzen Anspielungen oder Anleihen interessierte mich jedoch bald ein Vergleich dieses neopolnischen Romans aus dem Jahr 2003/06 mit dem 1927/1929 erschienenen russischen Roman der Sowjetschriftstellerin Anna Karawajewa, der ebenfalls „Das Sägewerk“ heißt. Er wurde damals auf Deutsch im „Bücherkreis“-Verlag des sozialdemokratischen „Vorwärts“ veröffentlicht und behandelt genau im Gegensatz zu Odijas „Sägewerk“ den Aufbau eines modernen neuen Dorfes – mit Elektrizität, industriellen Arbeitsplätzen, Wohlstand und Frauenemanzipation. Hier wie dort kommt es dabei zu Toten und Verwundeten und einigen Alkoholismen, aber unter den Kommunisten geht es voran: ein Dorfsowjet wird gewählt und das Proletariat aus der Stadt bringt eine neue Kultur mit aufs Land usw..
Auch hierbei kommt es zu einer Verbrennung des Sägewerks – im Suff, aber der Täter realisiert hier sozusagen im letzten Moment noch, dass er Volkseigentum vernichten würde – und alarmiert die „Feuerwehr“. „Wann werdet ihr endlich begreifen, daß ihr jetzt selber die Herren seid?“ hieß es zuvor. Ein etwas später auf Deutsch erschienener und noch agitatorischer angelegter Kolchosenroman aus der Sowjetunion – von Sergej Tretjakow – hieß schon im Titel „Feld-Herren“.
Sowohl in dem Roman von Karawajewa als auch in dem von Odija regnet es viel. Manchmal sitzen die Menschen auch bloß so da, als ob es ihnen auf den Kopf regnen würde. Und hier wie dort geht es um den Aufstieg und Untergang eines gewitzten Kulaken. Was jedoch 1929 eine Befreiung war und Fortschritt bedeutete, auch im Zusammenhang der Schaffung neuer weniger entwürdigenderer Arbeitsplätze sowie auch eines Genossenschaftsladens – statt des wie auch schon wieder bei Ewa Borsecka skrupellosen Einzelhändlers, ist 2003 der Verlust eines Unternehmers, einer letzten Wirtschaftseinheit mit Arbeitsplätzen. Zurück blieben „die Leute – als habe man sie „allein ihrem Schicksal überlassen. Nie hatte man ihnen beigebracht, mit sich selber etwas anzufangen. Immer hatte ihnen jemand gesagt, was sie tun sollten. Jetzt sagte ihnen keiner mehr etwas. Sie mußten es sich selber sagen.“ (Odija)
Aber das ist rein rhetorisch – denn so weit geht der Autor nicht in seinem polnischen Dorfroman. In der Wüste Gobi bei den mongolischen Viehzüchterinnen habe ich dagegen kürzlich „in echt“ mitbekommen, dass und wie sie wieder Kollektive bildeten, um handlungsfähiger zu werden. Auch sie sagten, dass es so aussähe wie die früheren Kollektive – zu Sowjetzeiten, Die Kolchosen wurden 1990 in der Mongolei alle aufgelöst (jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh), aber im Unterschied zu damals würden sie nun in ihren heutigen Kollektiven selbst bestimmen, was sie wie zu tun gedächten und was nicht. Und das teilten sie uns so selbstbewußt und entschieden mit, dass der „Trip“ durch die Gobi mir zu einem einzigen Aufbauroman geriet.
Anna Karawajewa, geboren 1893 in Perm, war zunächst Lehrerin und Philologin, und schrieb dann ab den Zwanzigerjahren eine ganze Reihe von Aufbauromanen. Mindestens einer – „Die Fabrik im Wald“ wurde von der Trotzki-Übersetzerin Alexandra Ramm ins Deutsche übertragen. Wenn ich nicht irre, emigrierte die Karawajewa 1968 nach Frankreich. Vom wem ihr Hauptwerk „Das Sägewerk“ übersetzt wurde, habe ich komischerweise nicht rausbekommen. An einer Stelle heißt es darin – über die renitenten Dörfler:
„Und dann dieser Instinkt der Selbsterhaltung…Dieser wilde Durst, zu atmen, zu schreien, sich zu bewegen, die Sonnenwärme zu spüren, seinen tierischen Zusammenhang mit der Natur zu fühlen…Welch furchtbare Kraft das ist!…Furchtbar – wann? Wenn die Sicherheit fehlt, daß diese süße Gewohnheit nicht plötzlich unterbrochen wird. Diese Sicherheit muß man ihnen geben, unbedingt. Dann wird der Instinkt wieder seinen richtigen Platz einnehmen, dann kriegt jeder halbwegs gute Zug im Menschen wieder sein Gesicht…“ Dies sagt der Tschekist Ognew – am Vorabend der Zwangskollektivierung, die 1928/29 anlief:
„Wir sind übergegangen von einer Politik, die Ausbeutertendenzen des Kulaken zu beschränken, zu einer Politik, den Kulaken als Klasse zu liquidieren“, verkündete Stalin. Gegenüber Churchill erwähnte er später die Zahl „10 Millionen“, die davon betroffen gewesen seien – also enteignet, erschossen oder verbannt wurden. „Es war [damals] leicht, einen Menschen ins Gefängnis zu bringen,“ schreibt Wassili Grossmann 1955 in seiner Erzählung „Alles fließt“, die erst 1989 veröffentlicht werden durfte, aber dann sofort vergriffen war, auch in der DDR im Jahr darauf. „Du schreibst eine Denunziation; du brauchtest sie nicht einmal zu unterschreiben. Alles, was du sagen mußtest, war, daß er Leute bezahlt hatte, um für ihn als Tagelöhner zu arbeiten, oder daß er drei Kühe besessen hatte.“ Die Leute betrachteten die so genannten Kulaken „als Vieh…; sie hätten keine Seelen, sie würden stinken…; sie seien Volksfeinde und beuteten die Arbeit anderer aus…Und es gab für sie keine Gnade“, selbst die Kulaken-Kinder waren geringer als eine Laus, schreibt Grossmann.
Der Stalin-Preisträger Michail Scholochow verfaßte bereits 1932 einen Roman über diese heroische Zeit der Kollektivierung: „Neuland unterm Pflug“, dessen erster Teil 1955 veröffentlicht wurde. Er spielt wie auch schon sein Kosaken-Epos „Der Stille Don“ in der Steppe am Don – in einem Bezirk, wo die Kollektivierung erst 14,8 Prozent der kosakischen Bauern erfaßt hat und deswegen die Entkulakisierung forciert werden muß. Der Dorfaktivist Andrej Rasmjotnow bekommt dabei irgendwann Skrupel – er sagt: „Ich halte nichts mehr von diesem Kulaken-Brechen.“ Der zum Parteiaufgebot der 25.000 gehörende Proletarier Dawydow, fragt ihn, was er damit meine. „Ich wurde nicht dafür ausgebildet, gegen Kinder zu kämpfen…Was bin ich, ein Henker? Oder ist mein Herz aus Stein?“ Dawydow kann ihn nur mit Mühe wieder auf Parteilinie bringen: „Gewiß, wir jagen die Kulaken fort, schicken sie nach Solowki. Krepieren werden sie aber ganz gewiß nicht…Und haben wir erst einmal unseren Aufbau vollendet, dann werden diese Kinder keine Kulakenkinder mehr sein. Die Arbeiterklasse wird sie inzwischen umerzogen haben.“ In dem Roman verschwören sich die Kulaken, aber auch der eine oder andere Kolchosmitarbeiter, mit den letzten Resten der untergetauchten weißen Offiziere – und scheuen selbst vor Morden nicht zurück. Dawydow versucht derweil die Masse der Dörfler mitsamt ihrem Eigentum in einer Kollektivwirtschaft zusammen zu fassen. Aber ihr Engagement und ihre Arbeitskraft sind sehr unterschiedlich und einigen bricht es schier das Herz, ihr Pferd oder ihre Kuh zu vergesellschaften, d.h. sie in einen Stall der Kolchose zu bringen, wo sie u.U. nicht so gut behandelt und gefüttert werden.
Sergej Tretjakow erwähnt in seinem 1968 veröffentlichten Roman „Das Ableben“, der die Geschichte des Kirchdorfes Poshary von 1917 bis in die Chruschtschow-Zeit erzählt, ein Erlebnis des „gescheiterten Bauernführers“ Iwan. [3] Er will einem Kutscherjungen, der gerade mit Pferd und Wagen von der Molkerei gekommen ist, beim Abladen helfen. „Das Pferd war groß, schmutzig, unter dem enthaarten Fell stachen die Rippen hervor, traurig ließ es den Kopf hängen. Als Iwan hinzutrat hob es plötzlich den Kopf, sah ihn mit feuchtem Blick an und begann leise und wehmütig zu wiehern. Er hatte es nicht erkannt, aber das Pferd hatte ihn erkannt…Einer seiner beiden ‚grauen Schwäne‘ [wie er sie früher immer genannt hat] – die Hufe beschädigt, die Fesseln geschwollen, der Bauch schmutzverkrustet, und der feuchte Blick, voller Wehmut und Trauer um das frühere Leben, um die warme Box und die liebevolle Hand des Herrn, die ihm Zuckerstückchen zwischen die samtigen Lippen gesteckt hatte. Er hatte seine Pferde geliebt, war stolz auf sie gewesen…Nie warf er einen Blick in den Pferdestall der Kolchose; wenn er seine Grauen irgendwo unterwegs sah, wandte er sich ab, zu schmerzlich war ihm der Anblick. Und nun stand er einem seiner Pferde Auge in Auge gegenüber, und das Tier hatte ihn zuerst erkannt.“
Anders sieht es in den Kollektivlandwirtschaften aus, die aus Nichtbauern bestehen, z.B. in der Gorki-Kolonie für kriminell gewordene Jugendliche von A.S. Makarenko, wo jedes neu angeschaffte Nutztier eine große Errungenschaft ist und dementsprechend von allen liebevoll behandelt wird. Allerdings bildet hier die Landwirtschaft nur die ökonomische Basis für die Kolonie, sie ist nicht deren Zweck, der darin besteht, die Kinder zu Neuen Menschen zu erziehen. Aber auch dabei werden „die Kulaken von Tag zu Tag zahlreicher,“ sorgt sich einer der Jugendlichen. Und Makarenko schreibt: „Anfangs [ab 1920] waren wir geneigt, nur die Landwirtschaft als wirtschaftliche Betätigung zu betrachten, und unterwarfen uns blind der alten These, die da behauptet, daß die Natur veredle. Diese These war in den Adelsnestern entwickelt worden, in denen die Natur in erster Linie als ein sehr schöner und gepflegter Ort für Spaziergänge und Turgenjewsche Erlebnisse aufgefaßt wurde…Die Natur aber, die den Gorki-Kolonisten veredeln sollte, schaute ihn mit den Augen der ungepflügten Erde an, des Unkrauts, das ausgerodet werden mußte, des Mistes, der gesammelt, aufs Feld gefahren und dann ausgestreut werden mußte, eines zerbrochenen Fuhrwerks, eines Pferdefußes, der geheilt werden mußte. Was konnte es da schon für eine Veredelung geben!“ Ähnlich ist es dann mit den Gewerken, d.h. mit den Kinderkolonien, „die ihre Motivationsbilanz auf das Handwerk aufbauten“. Makarenko beobachtete dabei stets ein und das selbe Ergebnis: dass die Jugendlichen als angehende Schuster, Tischler, Maurer etc. immer mehr „Elemente des Kleinbürgerlichen“ annahmen. Und diese stehen der Entwicklung eines revolutionären Kollektivs entgegen, wie er es anläßlich des Umzugs der Gorki-Kolonie in eine größere in der Nähe von Charkow sogar an sich selbst bemerkte – nachdem sie ihr knappes Hab und Gut zusammengepackt hatten und dabei eine Menge sauer erworbenes bzw. organisiertes „Eigentum“ zurück ließen: „All diese ungestrichenen Tische und Bänke allerkleinbürgerlichster Art, diese unzähligen Hocker, alten Räder, zerlesenen Bücher, dieser ganze Bodensatz knausriger Seßhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit war eine Beleidigung für unseren heldenhaften Zug…und doch tat es einem leid, diese Dinge fortzuwerfen.“
Oft genug wurde auch bei anderen Kolchosen der widerstreitende Individualegoismus der Bauern bloß durch einen vereinigten neuen Kollektivegoismus ersetzt: Was scheren uns die Nachbar-Kolchosen und -Dörfer, ob sie dort falsch wirtschaften und hungern, Hauptsache unser eigener Betrieb blüht, wächst und gedeiht. Um diese Denkweise auszurotten wurden die Kolchosen zu immer größeren Einheiten zusammengefaßt, bis aus ihnen riesige Agrarkombinate wurden. In der hitzigen Anfangszeit kollektivierte man hier und da sogar das Geflügel. Scholochow schildert einen erfolgreichen Aufstand der Bäuerinnen gegen diesen revolutionären Rigorismus, den Stalin selbst – Anfang 1930 – in seinem berühmten Artikel „Vor Erfolgen von Schwindel befallen“ kritisierte.
Der heute als der sowjetischste Schriftsteller von allen geltende Andrej Platonow (1899 bis 1951), begab sich nach Erscheinen dieses Artikels – im Auftrag der Zeitschrift „Krasnaja now“ (Rote Neuigkeit) – sofort in sein Heimatgebiet Woronesh, wo er sich zuvor als Ingenieur an der Melioration und Elektrifizierung der Dörfer beteiligt hatte, um diese von Stalin proklamierte Wende in der Kollektivierungspolitik von unten mit zu bekommen. Seine währenddessen entstandene „Armeleutechronik ‚Zu Nutz und Frommen'“ wurde zwar 1931 gedruckt, aber nachdem Stalin eigenhändig „Ubljudok“ (Schweinehund) auf die Ausgabe geschrieben hatte, mußte der Chefredakteur Alexander Fadejew sich von ihr distanzieren. Er bezeichnete sie als „Kulakenchronik“ und den Autor als „Kulakenagent“, der „das wirkliche Bild des Kolchosaufbaus und -kampfes verfälscht“ und „die kommunistischen Leiter und Kader der Kolchosbewegung verleumdet“ habe.
Der Erzähler in Platonows „Chronik“ ist eine „dämmernde Seele“, „zerquält von der Sorge um das Gemeinwohl“, der unruhig von einem Kollektiv zum anderen über Land wandert. In all seinen Büchern sind die Leute unterwegs, in der „Chronik“ ist es Platonow selbst, ein „Pilger durchs Kolchosland“ – der das Dorf verstand, wie Viktor Schklowski bereits 1926 feststellte, indem er aktiv an seiner Entwicklung teilnahm, denn „wertvolle Beobachtungen entspringen nur dem Gefühl emsiger Mitarbeit“. Diese Überzeugung teilte Platonow mit Sergej Tretjakow, der sich ebenfalls auf Viktor Schklowski berief, als er meinte, „der Schriftsteller muß in Arbeitskontakt mit der Wirklichkeit treten“.
1930 stellte Tretjakow sich dem nordkaukasischen Kombinat „Herausforderung“, einer Vereinigung von 16 Kolchosen unweit von Beslan, für Bildungsarbeit zur Verfügung. Anschließend veröffentlichte er das Buch „Feld-Herren“ darüber, das bereits im Jahr darauf auf Deutsch herauskam und hier fast zu einem Bestseller wurde. Es ist jedoch mehr von bolschewistischem Enthusiasmus als von wirklicher Kenntnis des Dorfes und der Landwirtschaft getragen – dazu absolut staatstragend. Der eher anarchistisch inspirierte Platonow ließ dagegen bereits 1928 in seinem Essay „Tsche-tsche-O“ seinen Helden sagen: „Die Kollektive in den Dörfern brauchen wir jetzt mehr als den Dnjeprostroi…Und schon bereitet der Übereifer Sorgen…verschiedene Organe versuchen, beim Kolchosaufbau mitzumischen – alle wollen leiten, hinweisen, abstimmen…“, so zitiert ihn die Platonow-Expertin der DDR Lola Debüser, die darauf hinweist, dass der Autor die Tragik und letztlich das Scheitern der Kollektivierung vor allem im „staatlich-bürokratischen und repressiven Mechanismus“ von oben sah, der den „Garten der Revolution“ mit seinen „kaum erblühten Pflanzen“ zerstampfte.
Das Ringen mit dieser „mechanischen Kraft des Sieges“ thematisierte Platonow auch in seinen zwei Romanen aus dem „Jahr des großen Umschwungs“ 1929: „Tschewengur“ und „Die Baugrube“. In diesem läßt er einen Kulaken sagen: „…ihr macht also aus der ganzen Republik einen Kolchos, und die ganze Republik wird zu einer Einzelwirtschaft…Paßt bloß auf: Heute beseitigt ihr mich, und morgen werdet ihr selber beseitigt. Zu guter Letzt kommt bloß noch euer oberster Mensch im Sozialismus an.“ Daneben ging es Platonow auch um die durch die Mechanik der Macht (wieder) forcierte Trennung von Kopf- und Handarbeit, mit der die ganzheitlichen Maßstäbe und die bewußte Teilnahme des Einzelnen am Aufbau des Sozialismus zerstört werden. „Der Mensch war [durch die siegreiche Revolution] – so empfand Platonow das zumindestens – aus dem System der sozialen Determiniertheit ‚herausgefallen‘, alles schien möglich und leicht realisierbar,“ schreibt der russische Platonowforscher L. Schubin. Aber diese Möglichkeiten wurden nach und nach von der „Mechanik der Macht“ zurückgedrängt. „Die Technik entscheidet alles,“ verkündete Stalin 1934 und meinte damit nicht nur die Industrialisierung der Landwirtschaft – vom Traktor bis hin zu agronomischen Verfahren, sondern auch die administrativ umgesetzten neuen Erkenntnisse der Wissenschaft – vor allem der „proletarischen Biologie“.
Der französische Marxist Charles Bettelheim merkte dazu 1971 an: „Wer hier handelt, das ist die Technik, und es ist der Bauer, auf dessen Rücken gehandelt wird“. In seinen Samisdat-„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“ kam Boris Jampolski 1975 zu einer ähnlichen Einschätzung: „Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer‘, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten‘, so ist das reine Phantasie.“ Für diese Autorin ist Literatur „staatliches Schönschreiben“, könnte man dazu mit Platonow auch sagen. In seinem Roman „Tschewengur“ läßt er einen seiner Helden zu der Erkenntnis kommen: „Hier liegen keine Mechanismen, hier leben Menschen, die kann man nicht in Gang setzen, solange sie nicht selbst ihr Leben einrichten. Früher habe ich gedacht, die Revolution ist wie eine Lokomotive. Jetzt aber sehe ich: Nein, jeder Mensch muß seine eigene Dampfmaschine des Lebens besitzen…damit mehr Kraft da ist. Sonst kommt man nicht vom Fleck.“
Auf dem Plenum der KPdSU zur Agrarpolitik am 15. März 1989 formulierte es zuletzt Michail Gorbatschow rückblickend so: „…die Führung des Landes ging [Ende der Zwanzigerjahre] nicht den Weg der Suche nach ökonomischen Methoden, um die Probleme und Widersprüche zu lösen, sondern einen anderen, direkt entgegengesetzten Weg – den Weg des Abbaus der NEP,…der administrativen Kommandomethoden…Die natürliche Unzufriedenheit der Bauern wurde als eine Art Sabotage gedeutet. Und damit wurde die Notwendigkeit repressiver Maßnahmen gerechtfertigt…Im Agrarsektor lebten die Methoden außerökonomischen Zwangs aus den Zeiten des Kriegskommunismus wieder auf“. Hierzulande kennen wir dagegen den „ökonomischen Zwang im Agrarsektor“ nur allzu gut: „Wer nicht wachsen will muß weichen“, sagen die Bauern dazu, d.h. von der EU wird permanent eine Politik der Liquidierung der Dorfärmsten als Klasse betrieben – zugunsten der Kulaken.
In Platonows „Armeleutechronik“ sucht der unstete Wanderer demgegenüber einen humanistischen (Aus-)Weg. Im Kolchos „Kulakenfrei“ trifft er auf den Vorsitzenden Senka Kutschum, der eine interessante Kollektivierungspolitik betreibt: Und im Kolchos des Vorsitzenden Kondrow geht die Kollektivierung so erfolgreich und ohne Überspitzungen voran, , „weil er selbständig denkt und andere zum Mitdenken auffordert, auch weil er sich gegen unqualifizierte Direktiven von oben wehrt. Kondrow ist glücklich, als Stalins Artikel seinen vernünftigen Weg bestätigt. Platonows Erzähler stellt fest: ‚…es gab Orte, die frei blieben von schwindelerregenden Fehlern…Doch leider waren solche Orte nicht allzu zahlreich‘.“
Stattdessen gab es viele Aktivisten, die nur allzu bereit waren, jede Maßnahme der Administration zu exekutieren. In „Die Baugrube“ hat Platonow solch einen porträtiert: „Auch dem Aktivisten war der gelbliche Abendhimmel, diese Begräbnisbeleuchtung, aufgefallen, und er beschloß, gleich morgen früh das Kolchosvolk zu einem Sternmarsch zu formieren, der in die umliegenden Dörfer führen sollte, die sich noch immer ans Einzelbauerntum klammerten…Der Aktivist befand sich noch auf dem Orghof, die vorige Nacht hatte nichts erbracht, keine einzige Direktive war von oben herab auf den Kolchos geflattert, und so mußte er notgedrungen den Gedanken im eigenen Kopf freien Lauf lassen. Doch sie brachten Unterlassungsängste mit sich. Braute sich nicht doch Wohlstand auf den Einzelgehöften zusammen? War ihm in dieser Beziehung etwas entgangen? Andererseits war nichts gefährlicher als Übereifer – deshalb hatte er nur den Pferdebestand vergesellschaftet und grämte sich nun über die vereinsamten Kühe, Schafe und Hühner, denn in der Hand des spontanen Einzelbauern konnte schließlich auch der Ziegenbock zum Hebel des Kapitalismus werden.“
Platonow spielt hier ironisch sowohl auf die Parteirechten um Bucharin an, die für eine eher sanfte Kollektivierung plädiert hatten, als auch auf die Linken, die Stalin mit den Trotzkisten aus der Partei ausgeschlossen hatte. Letztere befürworteten eine noch radikalere Lösung der Bauernfrage. Später wandte sich Stalin auch gegen die Bucharinisten.
In der Kolchose von Gremjatschi Log, deren Entwicklung Scholochow beschreibt, wird der Aktivist Makar Nagulnow wegen seines Kampfes für die „hundertprozentige Kollektivierung“ plötzlich des „Trotzkismus“ verdächtigt. Er verteidigt sich: „Ich bin nicht Trotzki wegen mit den Hühnern nach links geraten. Ich wollte nur so schnell wie möglich den Eigentumsmenschen, den Kleinbürger matt setzen“. Er muß sich jedoch sagen lassen, dass solche linksradikalen „Verzerrungen“ , ja sogar „ungebührliche Drohungen gegen Bauern“ bei der Kollektivierung laut Stalins Artikel „Vor Erfolgen vom Schwindel befallen“ nur dem Feind nützen – also dem „rechten Opportunismus“. Es wurde daraufhin beschlossen, dass die Kollektivbauern ihr Kleinvieh und sogar eine Kuh zurück bekommen. Stalin legte sogar genau fest, wieviel Morgen Land jeder in Zukunft privat bewirtschaften durfte. Damit gerieten viele Kolchosen erneut in Schwierigkeiten, denn die Bauern arbeiteten bald lieber auf ihrem kleinen Privathof denn in der großen Kollektivwirtschaft – als Befehlsempfänger.
(Es fehlt hier noch die Einarbeitung einer neuen Studie – über die Kollektivierung und den bäuerlichen Widerstand dagegen in Weißrussland von Diana Siebert – das kommt noch)