Das einst von Rathenau auf der grünen Wiese geschaffene Industrieviertel Oberschöneweide, das dann von den Kommunisten nach dem Krieg noch ausgebaut wurde, ist eines der markantesten Beispiele für die Umwandlung der Industriegesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft – spätestens seit der Wende.
Dort wurde und wird seitdem die von den Kommunisten bloß listig „versteckte Arbeitslosigkeit“ ans Licht gezerrt: Zuerst riss man 1990 die Gebäude des VEB Berliner Metall- und Halbzeugwerke (BMHW) ab – und errichtete auf dem Gelände einen Supermarkt. Dann wurde das Institut für Nachrichtentechnik (INT) nebenan erst von der deutschen Alcatel-Tochter „Standard Elektrik Lorenz“ erworben – und 1992 abgewickelt. Das Gebäude erwarb ein Immobilienhändler, der dort u.a. eine Spielhalle einquartierte. Das gegenüberliegende Transformatorenwerk (TRO) wurde gleichzeitig von der Daimler-Tochterfirma AEG (wieder) übernommen, die 46 Millionen Mark an Fördermitteln investierte. Dann erwarb aber die Alcatel-Tochterfirma GEC Alsthom Teile der AEG – und diese musste dafür ihr TRO-Werk stilllegen. Die Uferimmobilie übernahm ein ehemaliger Manager von Ruhnke-Optik – und machte daraus ein Kunstzentrum, das ein „touristischer Anziehungspunkt“ erst Ranges werden sollte – laut Quartiersmanagerin Heidemarie Mettel.
Ähnlich verlief die „Privatisierung“ des riesigen Kabelwerks Oberspree (KWO) nebendran, das mit großem Trara und im Beisein der Queen von der British Callendar Company (BICC) gekauft wurde – dann aber ebenso wie die Berliner Kabelwerke von Siemens und Alcatel dicht machte. In die Rathenauvilla auf dem Gelände zog die Berliner Landesentwicklungsgesellschaft (BLEG): Aus einem Teil der denkmalgeschützten Gebäude machte sie ein „Handwerks- und Gewerbezentrum“. Zudem war sogar ein Yachthafen geplant. Inzwischen wurde die BLEG jedoch ebenfalls abgewickelt.
Vorher steckte sie aber noch einige Anwohner mit ihrem Optimismus an: So ließ sich zum Beispiel der Wirt der Schichtarbeiterkneipe „Sporti“ zur Fortbildung nach Las Vegas schicken, als er zurückkam, hatte seine Frau bereits Konkurs angemeldet. Ähnlich ging es dem Wilhelminenstraßen-Entwickler Manfred, der erst mit einem Thaibordell, dann mit einem potenzstärkenden Gelee-Royale-Mittel aus China scheiterte – und schließlich an einer Kartoffel erstickte.
Rathenaus dort errichtetes Autowerk NAG krönte der Architekt Peter Behrens einst mit einem Turm am Spreeknie, in dem sich zuletzt ein Technik-Museum befand. Jetzt steht der Turm jedoch leer. Aus der NAG-Fabrik wurde zu DDR-Zeiten das Werk für Fernsehelektronik (WF), das 1992 von Samsung übernommen wurde. Die Koreaner beschäftigten zunächst deutlich mehr als die 1.000 Mitarbeiter, die sie zunächst übernahmen. Der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Kippel meinte: „Wer es schafft, bei Samsung reinzukommen, der verlässt den Betrieb als Rentner.“ Die Koreaner wollten 1995 auch noch den sächsischen Öko-Kühlschrankhersteller Foron übernehmen, aber die Siemens AG schrieb ihnen: Sie würden das als „unfreundlichen Akt“ ansehen – prompt zog Samsung seine Offerte zurück.
Vis à vis übernahm die BLEG 1993 ein Grundstück und errichtete dort ein „Technologie- und Gründerzentrum Spreeknie“ (TGS), in das einige outgesourcte WF-Gewerke und eine Qualifizierungsgesellschaft einzogen. Daneben befindet sich die Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik (BAE), ihr Gründer Quandt ließ dort ebenfalls seine Villa errichten. Nach der Wende wollte seine westdeutsche Firma Varta wieder bei der BAE einsteigen, sie kam jedoch nicht über Absichtserklärungen hinaus, stattdessen privatisierten leitende Angestellte die BAE, wobei sie sich jedoch von ihrem Betriebsteil Gerätebatterien (Belfa) trennten.
Die Belfa erwarben zwei Münchner, die eine Private-Label-Stategie verfolgten, mit der sie 2001 Pleite gingen. Dann meldete auch das Industriebatteriewerk BAE Konkurs an, weil die Bleipreise aufgrund der starken chinesischen Nachfrage von 400 auf 700 Euro pro Tonne stiegen. Aus dem BAE-Verwaltungsgebäude machte derweil ein Köpenicker Sozialhilfeverein ein „WAS-Haus“ („Wohnen – Arbeit -Sucht“). Aus dem BAE-Kulturhaus wurde ein „kurdisches Kulturzentrum“, das jedoch schnell Pleite ging – seitdem steht das riesige Gebäude leer. Alle Hoffnungen, auch der Kneipenwirte, richteten sich dann auf das KWO-Gebäude, in das die Fachhochschule für Wirtschaft und Technik (FHTW) einziehen sollte. Diese wollte jedoch lieber in Karlshorst bleiben – und zögerte den Umzug immer wieder hinaus.
Zu DDR-Zeiten arbeiteten in Oberschöneweide 36.000 Menschen, jetzt sind 80 Prozent der Bewohner Sozialhilfeempfänger, wie eine Studie der Supermarktkette „Kaiser’s“ ergab. Die dortige Filialleiterin schaffte bereits den „langen Donnerstag“ ab.
Die dort wohnenden nannten ihren Stadtteil zu DDR-Zeiten „Oberschweineöde“. Diese Verballhornung des Köpenicker Stadtteils Oberschöneweide hatte es dem Autor Karsten Otte besonders angetan in der B.Z.-Serie „Mein Kiez-Tagebuch“. Sein Text geriet ähnlich schweinös wie die Kreuzberg-Berichte der FAZ und der Neukölln- Report des Spiegel, den das Montagsmagazin dann sogar noch mit einem üblen Wedding-Artikel toppte. In Oberschöneweide debattierte einmal der dortige Unternehmerstammtisch den B.Z.-Artikel über ihren „Problembezirk“: „Alles erstunken und erlogen!“ so das Resümee.
Im einzelnen. „Die gesamte Tendenz des Autors lautete: ,Dort lebt nur Abschaum‘ – das ist menschenverachtend! So weit, daß unter einem Foto von einem Krüppel, das noch nicht einmal im Kiez aufgenommen wurde, steht: ,Aufbruch-Stimmung in Oberschöneweide‘.“ Über das Stammpublikum des neben dem Wilhelminenhofstraßen-Puff gelegenen Nachtcafés „Hollywood“ schreibt der Autor: „Die Gäste sehen (dort) zwar auch nicht besser aus als die der ,Stumpfen Ecke‘, doch der Barkeeper grinst verheißungsvoll seine Kunden an…“ Im „Hollywood“ gibt es überhaupt keinen „Barkeeper“, dort arbeiten ausschließlich „Blondinen“.
Über die pleitegegangene Kneipe „Sportlerklause“ weiß der Westjournalist: Dort „verkehrten früher die Vorarbeiter!“ Solche gab es in der DDR überhaupt nicht, und sowieso war die „Sportlerklause“ eher eine Schläger- und Kleinkriminellen-Kneipe. Diese „Knastis“ sollen dagegen laut B.Z. im „sagenumwobenen Haus der tausend Biere“ gezecht haben. Eine Kneipe dieses Namens hat es im biersortenarmen Osten Berlins nie gegeben. Die Kneipe selbst gibt es dagegen noch immer – sie war nie „sagenumwoben“: Zu DDR- Zeiten hieß sie „Zur Wuhlheide“, nach der Wende „Haus der hundert Biere“ und jetzt „Kolbico“.
Die wenigen noch lebenden „Werktätigen“ Oberschöneweides – angeblich Nachwende-„Nachbarn“ des Autors – gingen stets in die „Stumpfe Ecke“, „um dort die Reste ihres Menschseins mit Wodka endgültig zu liquidieren“. Hierzu merkte der Oberschöneweider Unternehmerstammtisch an: „Dort hat noch niemand Wodka getrunken, den gibt es in der Stumpfen Ecke schon seit 1961 nicht mehr!“
Als die Queen das von den Engländern übernommene Kabelwerk besuchte, standen laut B.Z. extra „die Bewohner der angrenzenden Westbezirke“ Spalier in der Wilhelminenhofstraße, „um fleißig mit der britischen Fahne zu winken“ – damit die Queen auf keine Osteinheimischen stoße: „finstere Gestalten“ allesamt! Wahr ist zwar, daß die britische Kabelfirma, die das Werk schändlicherweise nur übernahm, um Fördergelder zu kassieren und dann die Produktion einzustellen, sich nicht entblödete, einige Jubel-Westler an den Straßenrand zu stellen. Aber weder sie noch die Anwohner bekamen etwas von der Queen mit, da diese auf der Spree mit einem Schiff ans Werk fuhr.
Auch daß der Autor meint, es gäbe in Oberschöneweide Tote, die so lange in ihren Wohnungen lägen, daß die Maden sie bereits verlassen und in die Nachbarwohnungen zu noch lebenden Oberschweineödern gezogen seien, hält der am Unternehmerstammtisch anwesende Ex-MdB H.P. Hartmann für mindestens so übertrieben, wie daß der „ehemalige Arbeiterbezirk eine ,postgrufte Atmosphäre'“ ausstrahle, die „nach Feierabend einem ,atomar verseuchten Gebiet'“ gleiche.
Besonders erbost hat den im Problembezirk aufgewachsenen Hartmann der Satz: „Landete der gewöhnliche Oberschöneweider doch mal im Ehebett statt in der Gosse, ging es der Frau, dem Kind und der Wohnungseinrichtung an den Kragen.“
Ansonsten scheint sich die bürgerliche Öffentlichkeit aber bereits mit dem Verschwinden ihrer industriellen Basis abgefunden zu haben. Als in Oberschöneweide auch noch das Kabelwerk Oberspree (KWO) dichtmachte, titelte die BZ geradezu triumphalistisch: „Ich bin der Letzte!“ Gemeint war damit der Kabelmechaniker Harald Schrapers (47), der nach 30-jähriger Tätigkeit im KWO „ohne Abfindung“ aus der versteckten in die offene Arbeitslosigkeit entlassen wurde. Zuvor waren bereits die Kabelfabriken von Siemens, Pirelli, Kaiser und Alcatel in Westberlin stillgelegt worden.
Zu Hochzeiten arbeiteten über 36.000 Kabelwerker allein in der „Elektropolis“ Berlin. Das KWO gehörte zur AEG und wurde 1897 gegründet. Zu DDR-Zeiten arbeiteten dort 16.000 Menschen. Bereits bei seiner Privatisierung 1993 durch den britischen Konzern BICC unkten Kabelkartellkritiker, dass diese Übernahme eine schleichende Abwicklung werde. 1997 stieg die niederländische Draka Holding dort mit ein, 1999 übernahm das US-Unternehmen General Bicc das Werk, und zuletzt wickelte es die Wilms-Gruppe ab, die nicht Mitglied im Arbeitgeberverband ist. Jeder dieser „Betriebsübergänge“ ging mit einer neuen Entlassungswelle einher.
Nach Abwicklung des KWO bleiben nun in Berlin nur noch drei kleine Restbetriebe – von Baika, Draka und Wilms – übrig, in denen Glasfaserkabel und Litzen gefertigt, Draht und Kunststoff aufbereitet oder Kabelstränge konfektioniert werden – mit insgesamt etwa 240 Mitarbeitern. Anders als beim Kabelwerk von Alcatel in Neukölln gab es in den vergangenen 13 kapitalistischen Jahren beim KWO keinen einzigen Arbeitskampf gegen die Entlassungswellen. „Alles ging seinen ordentlichen Gang“, wie der Pressesprecher der KWO-Geschäftsführung sich ausdrückte. Nur im Herbst 1994 füllten sich die leeren Fabrikhallen noch einmal kurz mit Lärm und Menschen – das war, als der Regisseur Thomas Heise dort Heiner Müllers Revolutionsdrama „Zement“ aufführte.
Im KWO war man bereits zu DDR-Zeiten markwirtschaftlich orientiert, deswegen meinte man, dort besonders gut für den kommenden Kapitalismus gerüstet zu sein. Dies war jedoch rein betriebswirtschaftlich gedacht – ohne die Politik des internationalen Kabelkartells ICDC ins Kalkül zu ziehen, das zuletzt 1997 vom Bundeskartellamt wegen Preisabsprachen mit einer Geldbuße in Höhe von 280 Millionen Mark bedacht wurde.
Der ehemalige KWO-Bereichsökonom Reinfried Musch, der nun freiberuflicher Controller u. a. bei der taz ist, meint: „Da ist jetzt auch eine Menge Experiment und Innovation mit untergegangen.“ Seine Arbeit hatte u. a. darin bestanden, „wettbewerbsnahe Arbeitsbedingungen“ herzustellen:
1. „Aufgrund unseres speziellen Brigadeprinzips – mit begrenzter Budgethoheit – hatten wir nur 20 Prozent der üblichen Überstunden, d. h., wir waren in der Lage, flexibel alle möglichen Fertigungs- und Sortimentswünsche sofort zu erfüllen.“ Im Sozialismus wurde ansonsten meist mit Überstunden gearbeitet.
2. „Ein weiterer Engpass, das waren meistens die Maschinen-Verfügbarkeit, Ausfallzeiten, Reparaturen etc., spielte kaum noch eine Rolle. Bei uns waren die Instandhalter der Produktionsbrigade assoziiert, d. h., sie kamen auf Bedarf. Das hat die Stillstände weitgehend abgebaut. Und im Übrigen waren die Kabelwerker daran interessiert, dass die Maschinen liefen, denn sie verdienten ihr Geld nicht mit Überstunden, sondern im Leistungslohn.“ Dieser bestand aus einem technologisch kalkulierten Grundlohn, wobei es Lohngruppen – gegliedert nach Qualifikation und Leistung – gab plus Leistungszuschlägen, die sich aus Normübererfüllung und Schichtzuschlägen zusammensetzten.
Hinzu kam nun noch die Innovation von Musch: ein Überstundenabbauzuschlag. „Die Grundregel dabei lautete: 50 Prozent der Einsparungen für die Kabelwerker und 50 Prozent für das Werk.“ In summa: „Wir waren auf die Marktwirtschaft gut vorbereitet.“ Genützt hat es ihnen jedoch nichts!
Inzwischen wurde das Fernsehwerk von Samsung stillgelegt, nachdem man dort die Umstellung auf die Produktion von Plasmafernsehern „versäumt“ hatte. Und in das Kabelwerk KWO zog die Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW), die dafür ihren alten Standort – Karlshorst – schnöde der Verödung ausliefert. An ihrem neuen Standort hat man dazu auch noch ein „Kurzfilmfestival“ angesiedelt, das am kommenden Wochenende beginnt. U.a. zeigt dort eine Steglitzer Schülerin einen „Spot“ über die Einsamkeit von schönen Mädchen in Berlin. Ihre plötzlich arbeitslos gewordene Mutter läßt sich derweil vom ehemaligen KWO-Bereichsökonom Rheinfried Musch bei der Existenzgründung „Café“ beraten. Meine Aufgabe ist dabei, jeden Vormittag zwei bis drei Cafés mit ihr zu besuchen – und dabei unaufdringlich herauszufinden, ob und wenn ja in welcher Hinsicht sie für ihr „Projekt“ vorbildlich sein könnten.
Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Batteriewerks ist inzwischen aus Oberschöneweide weggezogen nach Polen. Er war nach seiner Entlassung erst PDS-Abgeordneter im Bundestag und dann arbeitslos geworden. Zwischen 1999 und 2003 bekam er überraschend schnell drei mal eine ABM-Stelle als Projektleiter einer Handwerksbrigade, die Altenwohnungen in Oberschöneweide renovierte. Dabei arbeitete er auch wieder mit einiger seiner ehemaligen Belfa-Kollegen zusammen. Nach zwei Knieoperationen wurde er jedoch als invalid und nicht mehr vermittelbar bis zur Rente eingestuft.
Währenddessen hatte seine Freundin Ewa, die ebenfalls früher bei Belfa gearbeitet hatte, mit ihm zusammen einen kleinen Hof im Lubusker Städtchen Grosno erworben. Dort halten sie inzwischen auch einige Nutztiere und müssen deswegen ständig zwischen Berlin und Polen hin und her pendeln. Der gelernte Agraringenieur Hartmann fühlte sich in den letzten Jahren immer niedergeschlagener, die frische Luft im Lubusker Land ließ ihn aber langsam wieder aufleben.
Ähnlich wie ihm ging es nebenbei bemerkt auch einem der Bischofferöder Kalikumpel, wie mir die dortige Pastorin erzählte: Nach dem langen, vergeblichen Hungerstreik, der vier Aktivisten das Leben kostete, war auch er krank geworden, dann hatte er aber sein Land zurückbekommen und sich eine Kuh angeschafft. Als sie kalbte, gewann auch er mit der Zeit seinen Lebensmut wieder.
Hartmann lud mich zu sich auf seinen Hof nach Grosno ein, dazu musste ich in Küstrin umsteigen. Als ich bei ihm ankam, mistete er gerade den Stall aus. Ich erfuhr, dass es auch schon zu Verlusten gekommen sei – u. a. hätte ein Marderhund alle Hühner gerissen. Ich berichtete ihm von einem neuen polnischen Dokumentarfilm über ein Hilfsprogramm für Arbeitslose in Ostpolen, das „Ziegen statt Sozialhilfe“ heißt.
Hartmann meinte, dass das bei vielen Leuten durchaus funktionieren könne. In seiner Nachbarschaft würden bereits etliche arbeitslose Deutsche leben, die sich so über Wasser hielten: Die Fabrikarbeit habe eben keine Zukunft mehr in Deutschland. „Und mich – als Landwirt – zieht es sowieso aus der Stadt. Die Arbeit in der Batteriefabrik sollte eigentlich nur vorübergehend sein. Ich fing 1979 in einer neuen Abteilung an einer Fließpresse an. Meine Brigade bestand zu 60 Prozent aus Vorbestraften. Zusammen mit einem Kumpel habe ich es dann geschafft, dass unsere Brigade durch Neuerungsvorschläge und Kampf schließlich die bestverdienende des ganzen Betriebes wurde. Das hat mich dort gehalten – und auch noch die Arbeit im Betriebsrat ab 1989. Aber jetzt sind das doch alles nur noch traurige Rückzugsgefechte – in den letzten Fabriken, mindestens in Berlin.“
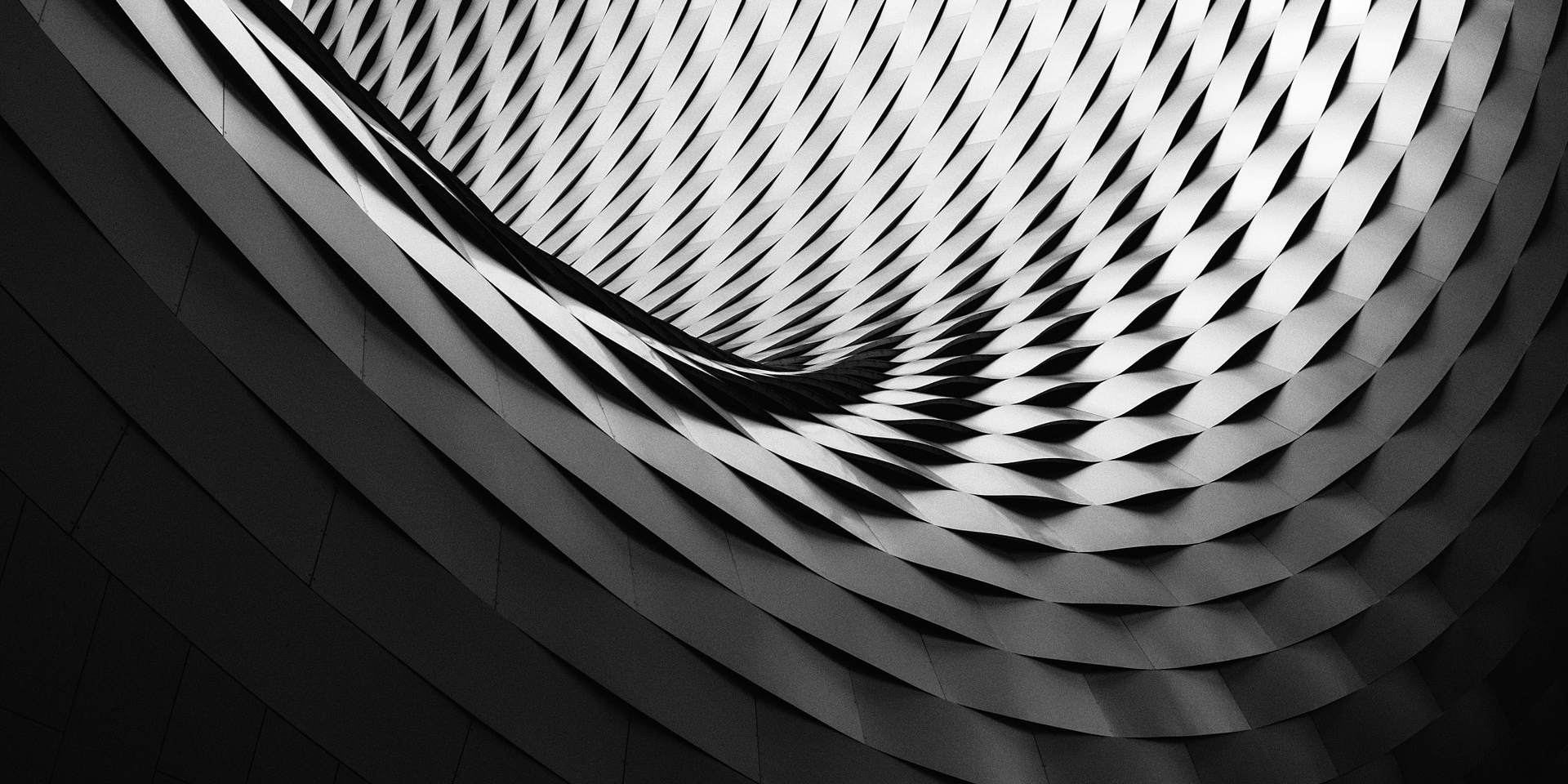



Sehr geehrter Herr Höge,was Sie in Ihrem Artikel über Schöneweide schreiben, entspricht total meiner momentanen Gefühlslage.Was da derzeit mit dem Zieselbau geschieht, ein Skandal, nach soviel Protesten. Aber so ist das, wenn es um die „Kohle“ geht.Nicht alle aktuellen Prozesse sind mir bekannt, aber schon der Abriss der Spreehallen, die zu dumm, nicht unter Denkmalschutz standen, ist ein Trauerspiel.Und die unrühmliche Rolle der Verantwortlichen der FHTW zeigt wieder einmal, dass die mit dem Namen des Architekten Ziesel und seinem revolutionären Bauwerk nicht umgehen können.Aber eigentlich wollte ich Ihnen noch erzählen, dass ich mit vier anderen Frauen das Thema Schöneweide wieder einmal( es ist sicher schon das 1000.)künstlerisch bearbeitet habe.D. h. gemalt.Je mehr man sich in die Materie vertieft,umso wütender kann man darüber werden, wie hilflos man zusehen muß, wie Eines nach dem Anderen verschwindet. Bis 2001 arbeitete ich im hieseigen Kulturamt und eine meiner Aufgaben bestand darin, leere Werkhallen mit Kultur zu füllen.Dass das nicht funktioniert, ist bekannt, dennoch blieben mir die von Ihnen so treffend beschriebenen Machenschaften nicht verborgen.Ach, es wird Sie nicht interessieren, vielleicht aber unsere Ausstellung in der Mediathek am Schüßlerplatz in der Köpenicker Altstadt-
Vernissage am 18.4.07 um 19.30Uhr. Zu sehen bis 29.5.07.Öffnungszeiten: Mo/Do/Fr 10-18Uhr,Di 10-19 Uhr.
Mit freundlichem Gruß
Sabine Libera