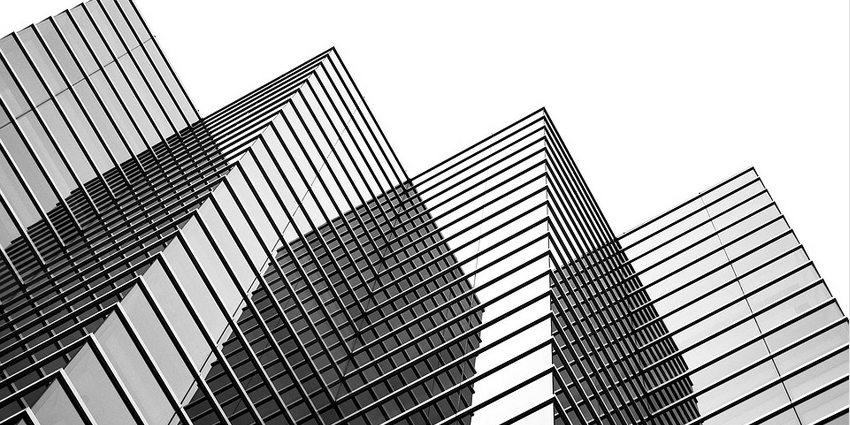Um diese Jahreszeit enden viele Demos auf dem Weihnachtsmarkt. Die Verkaufsbuden auf dem Alexanderplatz haben sich zu einer Art Permanent-Weihnachtsmarkt entwickelt. So ähnlich wie zu DDR-Zeiten das „Mecklenburgische Dorf“ in Köpenick, wo man immer mal wieder in den Genuß von Sonderkontingenten gelangte – z.B. an Wildschwein- und Rehbraten, geschossen von den Hobbyjägern in der Nomenklatura. Noch immer wird der Dauer-Weihnachtsmarkt auf dem Alex von einer besonderen Sorte Mensch besucht: von der proletarisch-sozialistischen Kleinfamilie Ostberlins. Materialistisch bis ins Mark! Das heißt durch Handarbeit im Stück- oder Akkordlohn sein Leben verausgabend und deswegen genau darauf achtend, dass man nicht beschissen wird – also geschult, für sein sauer verdientes Geld einen „optimalen Gegenwert“ zu bekommen. Alles andere interessiert nicht. Besonders wenn der oder die Betreffenden gerade von einer Demo gegen Sozialabbau oder Arbeitslosigkeit kommen – und immer noch ein bißchen in brass sind.
Mißmutig und mißtrauisch wandeln diese Menschen dann zwischen den Buden, wo man sie von allen Seiten nur bescheißen will. Besonders die ausländisch aussehenden und sprechenden Ausländer. Z.B. mit überteuertem Glühwein, der nicht mal richtig heiß ist und zudem kaum noch Alkohol beinhaltet. Am Brunnenrand treffe ich – wie schon öfter – Jan. Er ist mit Klaus befreundet, der dort einen Imbißstand hat. Sein Bier kauft Jan aber trotzdem nicht bei ihm, sondern im nächsten Supermarkt, wo es 40 Cent billiger ist. Und seine Zigaretten kauft er beim Vietnamesen, wobei er ebenfalls Geld spart.
Auch die Kneipen sucht er einzig danach aus, wie teuer dort die Getränke und die Bockwürste mit Kartoffelsalat sind. Als sein Bräunungsstudio „Palm Beach“ die Preise erhöhte, kaufte er sich eine eigene Solarliege – für 1400 DM, die nun sein Wohnzimmer verschandelt. „Dafür habe ich damit schon im nächsten Herbst das Geld wieder eingespielt“. Solche Rechnungen macht er ständig auf. Auch und erst recht im Urlaub – den kostbarsten Wochen des Jahres. Im Grunde ist sein ganzes Leben ein einziges Rechenexempel.
Das fängt schon morgens im Betrieb – an seiner Verpackungsmaschine – an. Oder noch früher: wenn er in seinen Opel steigt und an der Tankanzeige sieht, dass nach Schichtende mal wieder eine Fahrt nach Polen – zum Benzinkauf – nötig wäre, und er sich überlegt, was er sonst noch alles dort braucht. Z.B. einen Besuch im Polenpuff – für 25 Euro. Er ist nämlich geschieden: „Das war nichts für mich – ich verdiente das Geld und die Olle gab es aus. Dabei hat sie ständig überteuert eingekauft und nichts richtig auf die Reihe gekriegt“. Jan will damit sagen, dass er auch in seiner Ehe genau kalkuliert hat und dabei irgendwann den Eindruck gewann, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmte.
Es war jedoch seine Frau, Edith, die ihn irgendwann verließ. Seitdem sagt er sich: „Loch ist Loch“ – und geht z.B. lieber in ein Neuköllner Billigbordell, wo „die Weiber hässlich wie die Nacht“ sind, als dass er bei einer „aufgebrezelten Nutte“ 20 Euro mehr ausgibt. Noch lieber besorgt er sich auf dem Treptower Trödelmarkt gebrauchte Pornovideos für 5 Euro: „Da spar ich noch am meisten!“ Dafür legte er sich dann aber einen „Super-Videorecorder“ und einen neuen Großfernseher zu – für über 2000 Euro: „Das ist eine Anschaffung, die sich lohnt!“
Wenn ich Jan auf dem Alex treffe, revanchier ich mich für seine Rechenexempel, indem ich ihm einen überteuerten Glühwein nach dem anderen ausgebe. Er hält mich deswegen für bekloppt. Höchstens in seiner Stammkneipe in Hohenschönhausen würde er mir einen Glühwein spendieren: „Dort kostet das Zeug immer noch einen Euro – und schmeckt wirklich lecker, das hier ist doch der reinste Beschiß!“ Dass ich den klaglos hinnehme, ist für ihn typisch, denn als Journalist gehöre ich seiner Meinung nach auch zur Meute der Betrüger – und eine Krähe hackt eben der anderen kein Auge aus. „Kopflanger“ nennt er uns. Umgekehrt halte ich ihn – als Handlanger – für das Musterbeispiel eines – von Gewerkschaft, Staat und Kapital – um sein Leben Betrogenen. Wobei wir beide eine Art friedliche Koexistenz – für die Dauer der Glühweinperiode – vorexerzieren. In angetrunkenem Zustand muß er manchmal richtig an sich halten, um mich nicht wüst zu beschimpfen und für alle Übel dieser Welt verantwortlich zu machen. Mir geht es gelegentlich ebenso.
Seit neuestem hat er eine Freundin – aus Kuba, ebenso wie sein Freund Klaus, der sich eine immer fröhliche Braut aus Bulgarien angelacht hat. Seit diesem Doppelglück beginnt jedes ihrer Gespräche damit, dass sie sagen: „Du weißt ich bin nicht ausländerfeindlich, ich lebe selber mit einer Ausländerin zusammen, aber diese Ausländergangs und die ganze Ausländerkriminalität, das ist schrecklich, das darf nicht so weitergehen. Insbesonder die Ausländer mohammedanischen Glaubens würden sie lieber heute als morgen alle abgeschoben sehen. Das ist ihre Hauptidee geworden. Komischerweise erst, seitdem sie mit einer Ausländerin liiert sind. Das verschaffte ihnen sozusagen den Status einer unparteiischen – objektiven – Urteilsinstanz. Dabei sind sie nicht mal ungebildet. Sie lesen viel – leider nur technische und naturwissenschaftliche Fachliteratur, ansonsten blättern sie durch Springerzeitungen, auch mal den stern, und kucken täglich Fernsehen. Man kann ihnen einfach nicht mit den Mechanismen der Wirtschaft inn lokaler und globaler Hinsicht kommen. Davon verstehen sie nichts und wollen sie nichts verstehen – sie sehen ja, was los ist, wie sie sagen. Damit meinen sie wahrscheinlich Fernsehen. Auch dass die Kriminalitätsrate absolut zurückgegangen ist, seit Jahren schon, ficht sie nicht an. Überhaupt sind sie unfähig, sich wenigstens ihren Schwachsinnsmedien gewachsen zu sein – sie nehmen alles, was dort weggedruckt bzw. -gesendet wird für bare Münze.
Nun sitz ich aber als Autor – Aushilfshausmeister inmitten von Journalisten, Redakteuren – umgeben von der Medienredaktion auch noch – und weiß von daher bestens, das immerhin schon seit über 40 Jahren, was für einen Stuss sich die Redakteure morgens, mittags oder abends so ausdenken, wenn sie zusammensitzen und Heftplanung bzw. Themenkonferenzen oder auch Brainstorming betreiben. Nicht zuletzt deswegen habe ich vor einigen Jahren beschlossen, das Telefon abzuschaffen: Weil ich nicht immer wieder entsetzt nein sagen wollte und konnte – bei einem unmöglichen Themenvorschlag. Da reagier ich schon fast wie Jan und Klaus: Ich seh doch, was da oder da passiert und wichtig zu sein scheint – d.h. im wirklichen Leben (draußen sozusagen). Umgekehrt interessiert sich meistens kein Schwein in den Redaktionen für das, was ich als eine wichtige Geschichte ihnen anbieten möchte. Bis 1994 waren das meistens Sauereien im Zusammenhang mit Treuhand-Privatisierungen bzw. -Betriebsschließungen. In der Zeit sagte man mir, als ich mal wieder mit so einem Artikelvorschlag kam: „Ach, wenn Sie wüßten, Herr Höge, aber hier im Haus kann man das Wort Treuhand nicht mehr hören!“ Stattdessen sollte ich dann eine Reportage über den „Kitkat-Club“ schreiben. Ich versuchte es mit einem Text über den Nichtbesuch dieses Etablissements.
Viel später bin ich dann tatsächlich mal – zu Weihnachten – da gewesen. Ramona – eine Prostituierte aus dem „Café Psst“, die übrigens seltsamerweise niemals fickt – hatte mich mitgenommen. Ohne sie wäre ich auch gar nicht reingelassen worden. Die Kleiderordnung, genauer gesagt: Unordnung ist da sehr streng. Aber davon wollte ich gar nicht erzählen. Stattdessen von Ramona selbst, die mir dann nämlich ein Interview gewährte, das es in sich hatte, d.h. dass es selbst Jan und Klaus nachdenklich gestimmt hätte – so voller Wirklichkeit und Wirtschaft zugleich steckte es:
Ramona K. (geboren 1973 in Thüringen) wollte nach Abschluß der 10. Klasse eigentlich Außenhandelskauffrau werden, aber der Außenhandelsbetrieb für Elektrotechnik am Alexanderplatz, bei dem sie bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hatte, ging im Sommer 1990 zu Recht davon aus, dass er nicht mehr lange existieren würde. Deswegen reichte er ihren Namen und ihre Anschrift einfach an die Sparkasse weiter, die sich schräg gegenüber befand. Von dort schrieb man ihr, dass sie vorbeikommen solle, um den Lehrvertrag zu unterschreiben. Und das tat sie dann auch: „Obwohl ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was ich da zu tun hatte. Aber wir haben doch immer gelernt, dass Arbeitslosigkeit das Schlimmste sei“.
Am 1.September fing sie in der Filiale am Alexanderplatz an. „Und da bin ich dann jeden Tag – neun Jahre lang – hingegangen. Zum Schluß war ich allerdings immer öfter krank geschrieben – über jeden Schnupfen habe ich mich gefreut. Es war eine total inhaltsleere Tätigkeit – nur Zeit absitzen, und auf die Uhr kucken und schier verzweifeln, weil die Minuten nicht verstreichen“.
Nach einigen Monaten wurde Ramona in eine Marzahner Filiale versetzt: „Die war noch halb ostisch: es gab nur Giro-, Sparkonten und Ratenkredite“. Zuerst lernte sie dort Auszüge einsortieren und dann Scheckhefte abstempeln. Die Kunden mußte sie an ihre Kolleginnen verweisen, da sie noch zu wenig vom Geschäft verstand. Aber ihre Kolleginnen wußten selber nicht richtig Bescheid – mit der über sie gekommenen kapitalistischen Wirtschaftsweise und der ganzen neuen Produktpalette der Sparkasse, denn im selben Jahr fusionierten die Westberliner mit den Ostberliner Sparkassen – zur Landesbank Berlin, die damit die Begrenzungen des öffentlich-rechtlichen Regionalprinzips der Sparkassenorganisation abstreifte. Außerdem wollte man auch über die Immobilienfinanzierungsgeschäfte hinausgehen und selbst in das Bauträgergeschäft samt Immobilienfonds einsteigen. In der Marzahner Filiale war 1990/91 schwer was los: „Da standen schon morgens um 8 über 100 Leute vor der Tür und warteten darauf, dass wir um 9 aufmachten“.
Zwei mal in der Woche mußte Ramona zur Berufsschule – die bald ebenfalls in den Westen verlegt wurde. Das traf dann auch für Ramona selbst zu, die in eine Kufürstendamm-Filiale versetzt wurde. Dort sortierte sie weiter Kontoauszüge ein. Außerdem fing sie an, sich durch die „Arbeitsanweisungen“, mit denen alle Bankvorgänge bis ins Kleinste geregelt werden, zu lesen: 14 dicke Aktenordner. „Und dann habe ich auch meine ersten Sparverträge – Termingelder, Kontoeröffnungen usw. – verkauft“. Ihre Gruppenleiterin im Servicebereich verbrachte ihre Tage damit, die Termingeldvorgänge zu verwalten: „Ich durfte ihr helfen – indem ich z.B. die Bestätigungsschreiben in Briefumschläge steckte. Weil ich ja noch Auszubildende war, las sie mir die diesbezügliche Arbeitsanweisung in voller Länge vor“.
Ramona hatte sich wunders was gedacht, was sie alles kennen mußte, um den Kunden etwas verkaufen zu können: „Im Prinzip waren es aber immer nur fünf Produkte: Sparkonten, Girokonten, Bausparverträge, Versicherungen und Investmentfonds“. Ihre Sicherheit stieg im Maße sie merkte, dass man gar keine große Ahnung darüber haben mußte. „Stattdessen haben wir manchmal über eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob jemand nun eine EC-Karte kriegt oder nicht“. Einmal kam ein Kunde zu ihr, der sein Konto auflösen wollte. Solche Leute sollte sie immer nach den Gründen fragen. Er sagte: „Sie kennen doch sicher die Sparkassenwerbung, in der ein Discjockey eine Platte auflegt? Darunter steht: ‚Würden Sie ihm etwa Ihre Kreditkarte geben? Wir schon!‘ Dieser Typ, das bin ich. Nur dass die Sparkasse mir nie eine Kreditkarte geben wollte. Deswegen wechsel ich jetzt die Bank“.
Immer wieder bekamen die Angestellten Post von der Personalabteilung: Absender war mal die Sparkasse, mal die Landesbank, mal die Bankgesellschaft Berlin. Ramona weiß bis heute nicht, wer ihr Arbeitgeber war. „Das Problem war auch, dass die Sparkassen eigentlich einen öffentlichen Auftrag hatten und haben: den kleinen Mann zum Sparen zu ermuntern und sein Geld zu verwalten. Indem man aber die Sparkasse mit allen möglichen Kreditinstituten unter einer Holding zusammengepackt und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hatte, waren wir irgendwann auch dazu da, Aktien unserer eigenen Firma anzubieten. Durch diese Fusionen wurde alles immer gewinnorientierter. Girokonten waren nur noch Peanuts. Ich bekam Anschisse, wenn ich einen Kunden, der ein Girokonto eröffnen wollte, eine halbe Stunde lang beraten – und ihm dabei nicht mindestens ein Sparbuch verkauft hatte“.
Mit den Investmentfonds, von denen es hunderte gibt, war es folgendermaßen: „Wenn man einmal begriffen hatte, wie die aufgebaut sind und funktionieren, dann hat jeder von uns seine drei oder vier Favoriten im Dauerangebot gehabt, wobei man jedem Kunden das selbe erzählt hat. Man muß sich das so vorstellen, dass jeder Banker drei Platten im Kopf gehabt hat – über Giro- bzw. Sparkonten sowoe über Kredite und Investmentfonds, die er täglich mehrmals abgespult hat“.
Zwar versprach die Sparkasse immer mehr Dienst am Kunden, gleichzeitig wurden jedoch über die Einführung von Bankautomaten, Telefonbanking und Internetbanking – und mittels aggressiver Werbung – die Kunden geradezu genötigt, ihre Bankgeschäfte selbst bzw. zu Hause zu erledigen. Das hatte zur Folge, dass bald niemand mehr in die Filialen kam, „dem wir unsere individuelle Vermögensberatung angedeihen lassen konnten“.
Dagegen wurde jedoch ein tolles Mittel entwickelt: Die Angestellten bekamen Computerlisten aus der Zentrale mit den Daten von hunderten von Kunden – denen sie dann in der einen Woche telefonisch z.B. Bausparverträge verkaufen sollten. In der nächsten Woche war es ein anderes, angeblich wieder besonders auf die jeweiligen Kunden zugeschnittenes Produkt – z.B. Lebensversicherungen. „Mir war das peinlich und unangenehm, diese armen Menschen noch nach Feierabend zu Hause zu belästigen. Deswegen habe ich irgendwann die Listen einfach so ausgefüllt: ‚Kunde will nicht‘ oder ‚Kunde hat schon‘. Irgendwann hatte ich aber so gut wie gar keine realen Kunden mehr – und hatte nichts zu tun“.
Das war schon so in der Sparkassen-Filiale am Rüdesheimer Platz, wohin man Ramona inzwischen versetzt hatte. Sie bewarb sich deswegen für die neue Filiale am Potsdamer Platz in den dortigen „Arcaden“. „Aber da habe ich mich erst recht gelangweilt“. Es gab da die neue Funktion eines Empfangsmanagers: der hatte ein kleines Sitzpult – mit Schildchen und Laptop, auf dem Computerspiele liefen. Er mußte aber die ganze Zeit auf die piepsenden Automaten im Vorraum blicken. Hauptsächlich kamen Touristen rein, die nur mal kucken wollten. Weil die Öffnungszeiten länger als die Arbeitszeit waren, mußten die „Banker“ reihum den Empfangsmanager ablösen: „Das war der entwürdigendste Job, den wir da hatten. Man hatte nichts zu tun und wurde wie ein Affe im Zoo angegafft. Ich habe tatsächlich befürchtet, dass man mir da irgendwann ein Banane zustecken würde und mir deswegen ein Schild „Füttern verboten“ gekauft, das ich ans Stehpult gehängt habe. Mein Chef fand das jedoch nicht so lustig“.
Ramona arbeitete ansonsten im Servicebereich und dort hatten die Mitarbeiter Stehpulte. Wenn wirklich mal ein richtiger Kunde auftauchte, dann stürzten sofort drei oder vier Kollegen in der Hoffnung auf einen Gesprächspartner zu ihm hin. Meistens wurden sie jedoch enttäuscht, weil der Betreffende nur eine Überweisung abgeben wollte. „Meine verantwortungsvolle Aufgabe als Bankkauffrau bestand dann darin, mit diesem gelben Zettel vier Meter nach rechts zu laufen und ihn in den Hauspostkasten zu werfen, um anschließend die vier Meter zurück zu laufen und am Stehpult auf die nächste Überweisung zu warten. Nichts zu tun zu haben am Arbeitsplatz – das ist die Hölle. Viel schlimmer als Arbeitslosigkeit! Das Gehirn schläft ein, man kämpft mit der Müdigkeit und die Zeit steht still. Den ganzen Tag wartet man auf Feierabend. Ich habe in den neun Jahren Sparkasse echt an Wortschatz eingebüßt und vor allem an Lebensfreude“.
Ramona versuchte dagegen an zu gehen, indem sie die wenigen einfachen und doofen Tätigkeiten so gründlich und zeitaufwendig wie möglich erledigte. Einmal sortierte sie aus lauter Verzweiflung tagelang „irgendwelche Listen“ nach ihrem Datum. Das war zwar vorschriftsmäßig, aber völlig unwichtig. „Als ich damit fertig war, bin ich zum Friseur gegangen. Meiner Kollegin habe ich gesagt: ‚Ob ich hier dumm rumsitze oder 50 Meter weiter – das ist doch gehupft wie gesprungen‘.“
Zuletzt am Potsdamer Platz hatte sie gleitende Arbeitszeit, deswegen kam sie immer später. Ein Jahr lang sogar täglich eine Stunde, so daß sie schließlich ein „irres Defizit“ auf ihrem Zeitkonto hatte. Man konnte zwar theoretisch die Unterstunden abends abbauen, indem man länger blieb, aber da es ja nichts zu tun gab, gingen alle immer pünktlich nach Hause. Zunächst hatte es immer nur einen „langen Freitag“ – bis 18 Uhr – gegeben. Um sich diese Qual zu versüßen, feierte die Belegschaft oft anschließend noch ein bißchen. Gegen 22 Uhr wurde es plötzlich ruhig: die Klimaanlage hatte sich ausgeschaltet. „Da merkte man erst mal, in was für einem Lärm wir täglich arbeiten mußten: ein subtiles Dauerrauschen, das jede Gehirntätigkeit lähmte“. Dazu kam noch der Großraumbüro-Geruch: eine stinkige Mischung aus dem Kohlendioyxd-Ausstoß der Leute, ihren Parfüms und Aftershaves, Schweiß und Staub. Außerdem herrschte ein ständiger Sauerstoffmangel, denn man durfte die Fenster nicht öffnen wegen der Klimaanlage und die konnte man wiederum nicht selber einstellen. Im Sommer war sie auf ganz kalt gestellt, um die Kunden mit einer „angenehmen Kühle“ reinzulocken. Aber die Mitarbeiter an ihren Stehpulten mußten sich Strickjacken überziehen und froren trotzdem die ganze Zeit.
Einmal in der Woche fand eine Filialmitarbeiter-„Besprechung“ statt, die Ramona fatal an ihre alten Pionierversammlungen erinnerte: „Es wurde da alles besprochen, was jeder schon wußte. Beispielsweise wurden wir darüber belehrt, dass wir ab morgen alle ganz freundlich zu sein hatten – sowohl untereinander als auch zu den Kunden, weil wir nämlich jetzt ein modernes Dienstleistungsunternehmen seien. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man so etwas extra besprechen muß, jeder weiß doch, dass das Leben angenehmer ist, wenn man seinen Mitmenschen freundlich gegenübertritt – ob nun im Bus oder in einer Bank“.
Die Freundlichkeitsschulung mündete in eine regelrechte „Kampagne“ – mit internen Flyern und Infos, in denen die neuen „Leitlinien des Unternehmens Sparkasse“ den Mitarbeitern noch einmal verklickert wurden. Und das half auch: „Am nächsten Tag bemühte sich jeder, besonders freundlich zu sein – ‚Wie gehts?‘ ‚Wie stehts?‘ ‚Kann ich Ihnen irgendwie helfen?‘ Das ist aber schnell wieder eingeschlafen. Es war auch überzogen, wir sind doch vorher schon alle ganz freundlich miteinander umgegangen. Bis hin zu meinem letzten Chef, dem es z.B. fürchterlich leid tat, als er mich wegen meines ständigen Zuspätkommens zur Abmahnung bei der Personalabteilung melden mußte. Fast mußte ich ihn anschließend noch trösten“.
Ramona bekam eine Vorladung, wo man ihre Arbeitseinstellung besprechen wollte. Davon ausgehend, dass die Sparkasse sie nun endlich rausschmeißen würde – und ihr somit eine Abfindung zustehe, bemühte sie außerdem noch einen Vertreter des Personalrates dorthin. Die vier hochbezahlten Damen und Herren erklärten Ramona jedoch nur – mit erhobenem Zeigefinger, dass sie mit ihrem Verhalten den Betriebsablauf störe und dass sich das ändern müsse. Und nun möge sie wieder zurück in ihre Filiale fahren und weiter arbeiten.
„Dieser Gedanke erschreckte mich so, dass ich spontan selber kündigte. Man machte mir daraufhin einen sehr wohlwollenden Auflösungsvertrag – und zwei Tage später war ich endlich frei! Ein ganzes Jahr brauchte ich – in Arbeitslosigkeit – um nach diesen neun Sparkassenjahren wieder einigermaßen zu mir zu kommen, d.h. um die ganze Fremdbestimmtheit los zu werden. Dann immatrikulierte ich mich an einer Schule für Erwachsenenbildung. Hier traf ich einige andere ‚Banker‘, denen die Arbeit ebenfalls zu blöd geworden war. Um meine Ausbildung zu finanzieren, arbeite ich jetzt im Rotlichtmilieu. Dort prostituiere ich mich jedoch weit weniger als in der Sparkasse.“