1954, neun Jahre nach den Atombombenabwürfen auf die japanischen Hafenstädte Hiroshima und Nagasaki und bereits kurz nach dem Test einer 750 mal stärkeren Bombe auf dem Bikini-Atoll, wodurch ein japanisches Fischerboot in der Nähe mit radioaktivem Fallout überschüttet wird, an dem sechs Fischer sterben und tausende von Japaner erkranken, weil sie den verseuchten Fang essen, kommt ein Film in die japanischen Kinos, der dieser neuen hochtechnologischen Bedrohung mit archaischen Mitteln und Bildern gewissermaßen entgegentritt.
Er begründet ein ganzes Genre, das ebenso wie die atomare Bedrohung bis heute existiert – und für das Japan inzwischen berühmt ist: den Monsterfilm, in dem Schauspieler in Monsterkostümen agieren (Suitmation statt Animation). Das erste Ungeheuer – „Godzilla“, eine Art Riesensaurier – wurde durch Atomversuche im Pazifik geweckt und schwimmt nun auf Tokio zu, um sich zu rächen. Als erstes fallen ihm zwei Kriegsschiffe zum Opfer. Das Untier ist etwa 500 Millionen Jahre alt, seine Fußstapfen sind radioaktiv verseucht und es kann Feuer speien. Die Japaner wehren sich mit allen Mitteln.
Bei ihnen heißt das aufrecht gehende Ungeheuer Gojira, eine Kombination aus Gorilla und Kujira – Wal auf japanisch. In den darauffolgenden Filmen gesellen sich neben Godzilla noch jede Menge andere Monster, um mit ihm zusammen gen Tokio zu ziehen, aber auch, um gegen ihn zu kämpfen oder um selbst die Stadt zu bedrohen, wobei in diesem Fall Godzilla umgekehrt den Japanern (und damit der ganzen Welt) zu Hilfe kommt. Dabei gerät das Urmonster zwangsläufig immer harmloser – bis es zu einem wahren Kinderfreund wird. Als Spielzeug erobert es ab den Siebzigerjahren die Kinderzimmer (wo es dann mit Space-Hightech zu „Transformern“ mutiert).
Die japanischen Monster kommen fast alle aus dem Meer – nach getaner Tat zieht es sie auch wieder dorthin zurück und sei es nur zum Sterben. Es gibt unter ihnen (mutierte) Riesen-Echsen, -Krabben, -Seesterne, -Seedrachen, -Tintenfische und andere rieseneierlegende Meeresungeheuer. Meistens sind es deswegen Fischer, die die Katastrophe als erstes mitkriegen: Plötzlich brodelt die See und eine Klaue oder Schere taucht auf, die dann nicht selten den Kutter in die Tiefe zieht. Über Godzilla wissen die auf einer entfernten Insel als Fischer lebenden Eingeborenen noch zu berichten: Er lebte von Fischen – bis die Menschen ihm alle wegfingen. Da kam er eines Tages wütend an Land. Früher hat man ihn noch mit einem Mädchenopfer besänftigt.
Das moderne Japan vertraut dagegen nun auf die Technik und seine Heimatschutzarmee. Dieser „Glaube“ schafft (sich) jedoch bald neue Probleme: Umweltschutzkatastrophen, die wiederum neue Monster (aus giftigen Abfällen, Smog etc.) hervorbringen. Gleichzeitig – mit der beginnenden Weltaumfahrt der Russen und Amerikaner – stürzen sich auch noch jede Menge Monster aus dem All auf das arme Tokio, ja selbst simple Naturkatstrophen – wie ausbrechende Vulkane und Tsunamis – gebieren plötzlich Ungeheuer.
Es ist gesagt worden, dass sich der sowjetische „Kosmos“-Begriff vom amerikanischen „Outer Space“ dadurch unterscheidet, dass ersterer mit der irdischen Lebenswelt „harmonisch“ verbunden ist, während der US-Weltraum so etwas wie eine „new frontier“ darstellt. Die Monster in den japanischen Filmen, so sie mehr als einmal darin vorkommen, durchlaufen beide Vorstellungen. Gleiches gilt auch für die aus den Weltmeeren plötzlich auftauchenden Kreaturen. In seiner „Logik des Imaginären“ hat der Kulturforscher Roger Caillois am Beispiel des Riesenkraken den Unterschied zwischen dem westlichen Festland- und dem japanischen Inseldenken herausgearbeitet: Während dieser auf dem Meeresgrund lebende Kopffüßer bei uns mit dem Dunklen und Unheimlichen des Meeres selbst gleichgesetzt wird, gilt der Krake in Japan eher als lüstern und trunken. Besonders junge Perlentaucherinnen haben es ihm angetan. Tatsächlich ging 2001 eine junge Biologin (im Taucheranzug) ein Liebesverhältnis mit einem Riesenkraken ein – allerdings nur zu Versuchszwecken. In diesem Jahr sind die japanischen Taucher vor allem mit Riesenquallen beschäftigt – vielleicht resultiert auch daraus bald ein neuer Monsterfilm.
„In den frühen Jahren drückten die Monster Ängste der Gesellschaft wie etwa die vor der nuklearen Vernichtung aus,“ meint J.D.Lees, der Herausgeber des kanadischen Monstermagazins „G-Fan“. Aber schon 1972 rufen die Menschen am Strand in einem G-Film dem wegschwimmendem Monster zu: „Komm bald wieder, Godzilla,“ und (wesentlich leiser): „Es muss ja nicht so bald sein.“ Die Monster entwickeln mit der Zeit Charakter. Der sechsmalige Godzilla-Darsteller Kenpachiro Satsuma wünschte sich 1995 in einem Interview mit dem „G-Fan“-Magazin, dass seine Darstellung auf immer „subtilere Emotionen“ abzielt: „Es gab da diese Schlußsequenz in ‚Godzilla vs. Space Godzilla‘, wo ich als Godzilla kurz innehalte, bevor ich im Meer verschwinde. Das sind solche Momente, die ich meine.“ Kenshou Yamashita, der Regisseur dieses Monsterfilms, der just zum Zeitpunkt des Erdbebens von Kobe anlief, erwähnt, dass seine Produktionsfirma Toho „den Opfern dort Spaß oder Trost geben wollte, indem sie die Eintrittsgelder herabsetzte und den Menschen dadurch ermöglichte, ins Kino zu gehen.“ Dies brachte der Special-Effects-Direktor Koichi Kawakita auf die Kurzformel: „Not lehrt Monster!“. Die gigantischen fiktiven Lebewesen würden jedoch „den Wurzeln der japanischen Kultur entstammen.“ Er dachte dabei an die „acht Millionen Götter“ in seiner Heimat, aber auch an die ganzen Naturkatastrophen, wie Erdbeben und Taifune: Diese „Erfahrung generiert ins uns vielleicht einen Zerstörungswunsch, der in den Monstern verkörpert wird.“ In „Godzilla 2000“ gibt es schon „eine Art Godzilla-Greenpeace-Organisation“ in Tokio, wo das Monster den Angriff eines „Wabbel-Alien“ abwehrt.
Die wirkliche Umweltschutzorganisation kritisiert dagegen seitdem, dass Japan bis heute „hartnäckig das Walfangverbot ignoriert“ und sogar im Antarktis-Schutzgebiet „eigenmächtig seine Fangquoten erhöht“. Überhaupt gibt es kaum ein Volk auf der Erde, das in bezug auf seine Lebensmittel so sehr vom Meer abhängig ist wie die Japaner. Deswegen müssen die meisten Monster auch notgedrungen von daher kommen – sie sind als Rache des Ozeans ein endlos reanimiertes schlechtes Gewissen. Helmut Höge
Alle Zitate stammen aus dem soeben im Martin Schmitz Verlag erschienenen Werk „Japan – Die Monsterinsel“ von Jörg Buttgereit; der Berliner Horrorfilm-Regisseur behandelt darin alle Monsterfilme vom ersten (1954) bis zum zuletzt (2006) gedrehten – aufs Innigste.
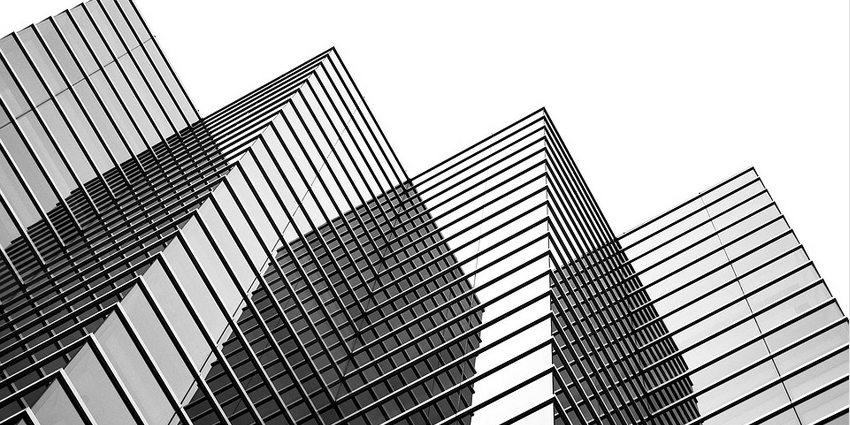



Näheres zu den „Transformern“:
„Transformer“ sind als Kampfmaschinen konstruierte Riesensaurier und Flugechsen, deren zerebrale Steuerzentralen mit hochmodernster Hardware bestückt sind. Diese biomechanischen Ungeheuer überbrücken mit ihrem Einsatz ältestes, noch ins menschliche Gedächtnis lappendes Erdmittelalter-Verhalten und nächste technologische Zukunftsvisionen.
Meist bevölkern sie die Planeten unserer bzw. fremder Galaxien in amerikanischen Science-Fiction -Filmen, in denen sie seit 1964 mit Röntgenlaser-Waffen in Schach gehalten werden (die real erst 1984 im „National Laboratory“, Livermore, vom SDI-Forscher Hagelstein erfunden wurden).
Als Plastikspielzeug (designed von „New Era Communications Ltd.“) lassen sich die computerisierten Urechsen mit wenigen Handgriffen zu schweren Transportfahrzeugen und Arbeitsrobotern umrüsten (deswegen ihr Gattungsname „Transformer“). Ihr Artenreichtum in der einen und anderen Form entspricht genau dem ihrer Fantasy-Film-Vorbilder, deren Copyright sie zu detailgenauer Nachahmung zwingt. Neben dem bloßen Nachspielen filmischer Handlungsabläufe (aus „Starwars“ I. und II. z.B.) kann man mit den Transformern auch noch eine Art High-Tech-„Brunnen-Schere -Stein-Knucksen“ spielen, wobei die Waffenüberlegenheit sich jeweils nach den Möglichkeiten der günstigsten Umwandlungsform (zwischen den Polen reine Saurieraggressivität und Nuklearenergiewaffe) richtet. Außerdem ist es in den Kampfpausen der Kinderzimmerkriege möglich, das ins Mechanische transsubstantiierte Gerät eher wieder zu reparieren als das an Lebendiges erinnernde.
Die meisten Kinder (eine Schultaschenfirma nennt sie die „Scout -Generation“) halten sich dabei an die Spielregeln. Die gelten für die Wirklichkeit allerdings nicht mehr. Hier wird auch dem Biologischen permanent mechanisch wieder auf die Sprünge geholfen. Bei den Humanoiden zwar noch nicht durch Eingriff in die Erbsubstanz oder durch Einbau von Bio-Chips, aber dafür mittels Verbesserung und Ausweitung der Prothetik (das Spektrum reicht von Lidschlag-Sensor und Kunstherz über Silicon-Brüste und Hart-PVC-gestützte bzw. aufblasbare Penisse bis zu immunschwächebremsende Präservative).Dazu gibt es gerade eine Ausstellung im Medizinhistorischen Museum der Charité.
In einer ökologischen Perspektive, die noch ganz andere Bio -Systeme als organismisch begreift, würden auch Katalysatoren, Filter-, Kläranlagen und „Betreten Verboten“ -Schilder noch zur Prothetik gehören. Die im Dienste oder für die „Gesellschaft“ (i.O. deutsch) entstandenen Schäden werden gesellschaftlich, d.h. technisch-wissenschaftlich, behoben: eine permanente Krückenbildung. Man ahnt, daß die „Transformer“ bereits mitten unter uns leben.
Der Dinosaurier mit High-Tech-Cockpit (oder der „Scout Walker“ aus „Return of the Jedi“) ist nur eine nette Versinnbildlichung der naiven Theorien unserer Gehirnforscher, Genetiker und Computer-Ingenieure (inklusive Raketenbauer) – die künstlerische Dünnsäureverklappung der großen naturwissenschaftlich-technischen Trusts, wenn man so will.
Ähnliches hat man auch über die Bilder H.R. Gigers gesagt, der (sich) seit 20 Jahren die erotischen Phantasmen der Biomechanik ausmalt, genauer gesagt: mit Airbrush postert. Verschiedene Berliner Künstler haben es deswegen dem Avantgarde-Galeristen Petersen auch seinerzeit übel genommen, daß er eine Giger-Ausstellung eröffnete – auch noch mit satanistischen Raumschiffdesign-Möbeln (für 150.000 Mark) ausgestattet, bis hin zur silbernen Gürtelschnalle in der Vitrine für den Oberpriester luciferischer Ritualmorde. Diese Ausstellungstat dankten dem Galeristen dafür die hiesigen Grufties, die mit eigenen Plakaten in ihren Kneipen für die Giger-Show Reklame machten. Auch unter den Satanisten der Stadt sprach sich die blasphemische Großbildnerei in der Goethestraße bald herum. Petersen ertrug all diese Schmähungen und Aufmerksamkeiten gelassen. Nur als auch noch ganze Schulklassen sich in der Galerie ansagten, wurde es ihm zu viel.
Die Kids kennen Giger vor allem als Ausstatter des Films „Alien“, wofür der 48jährige Schweizer 1981 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Die US-Zeitschrift ‚Cinefantastique‘ schreibt, daß seit Gigers Science-Fiction-Film „nichts mehr so ist wie vorher“, auf alle Fälle habe sein „biomechanoid look“ Schule gemacht – die Autoren zählen allein zwölf neuere US-Filme auf, in denen mehr oder weniger unverschämt Giger-Ideen kopiert wurden: „Hollywoods Great Giger-Rip -Off“.
Und „Sliming Technology“ nennen die amerikanischen Giger -Fans das, was „Alien“ zu einem „turning point in the look of science fiction“ gemacht hat: eine meist lurch- oder wurmförmige Biomasse, die sich mit humanoiden Mutanten, Maschinen, Waffen und Möbeln organismisch verbunden hat. Ventile und Aggregate, die mit Nervensträngen der Wirbelsäule und Blutgefäßen verlötet und verschweißt sind. Immer wieder tauchen dazwischen Pin-Up-Model-Körper auf – in Priesterinnen-Funktionen (bisweilen ähneln ihre Gesichter Gigers Freundin Li Tobler, die 1975 Selbstmord beging, sie ähnelte wiederum der Sängerin Debbie Harry, über die Giger 1982 einen Dokumentarfilm drehte). Trotz – oder wegen? ihrer gelegentlichen biomechanischen Eleganz sind die Menschen, vor allem Hunde und Männer auf Gigers Bilder von atomaren Katastrophen deformiert, zusammen mit Monstern in unterirdische Totenreiche abgetrieben, die Frauen auf Paarung, Penetration reduziert.
Timothy Leary meinte: „Gigers work disturbs us, spooks us, because of its enormous evolutionary time-span. It shows us, all too clearly, where we come from and where we are going.“ George Lucas sagte, daß vor allem die Japaner ganz wild auf Gigers „Images“ seien, die so ganz anders als der japanische Lieblingssaurier „Godzila“ Horrorschauer auslösen. Für den Regisseur William Malone, der aus Gigers „Necronomicon“-Panorama einen Sechs-Millionen-Dollar-Film – „The Mirror“ – machte, ist es „like Alice through the Looking Glass meets H.P. Lovecraft“.
Mir scheint, mit seiner polymorphen Schleim-Technologie ist Giger eine (von den Amis „surrealistisch“ genannte) „Fusion“ gelungen, d.h. eine Synthese aus Horror und Porno. „Alien war vor allem von ‚The Texas Chainsaw Massacre‘ beeinflußt,“ sagte Giger in einem Interview, und seine vielfach oral und genital penetrierten Körper-Details nannte er „Erotomechanics“ (als „Intrauterine Technologie fürs Jahr 2000“ bezeichnete sie H.A. Glaser, und sie ist seiner Meinung nach „mörderisch“). Gigers Porno spielt auf „der Intensivstation des Berner Inselspitals und auf einer NASA -Weltraumstation“.
Wenn man sich noch an die zukunftsoptimistischen bunten Werbefilme der großen Pharmazie-, Chemie- und Elektrokonzerne aus den sechziger Jahren erinnern kann (alles wird vollautomatisiert und -klimatisiert sein, statt Fußwege gibt es nur noch ‚Via Mobiles‘, unsere Füße und Beine bilden sich zurück… usw.), dann wird man vielleicht zustimmen: Gigers schwarz-weiße Aerographien sind pessimistische, postkatastrophische Werbefilme – für eine pubertierende ‚Scout-Generation‘.
Jes Petersen starb im April 2006, aber H.R. Giger lebt noch – umgekehrt wäre es mir lieber.