Der Schweizer Anthraxforscher Philip Sarasin hat gerade ein weiterführendes Buch – über “Bakteriologie und Moderne” herausgegeben, in dem sich etwa ein Dutzend Autoren, darunter der besonders interessante Bruno Latour, mit der “Biopolitik des Unsichtbaren” von 1870 bis in die Dreißigerjahre befassen.
Nicht nur für die Mikroorganismen, auch für die Mikroteilchen gilt, was Sarasin über ihre Erforschung durch die Wissenschaftler sagt: “Sie deuten Spuren im Lichte anderer Spuren, in der Hoffnung, dabei Differenzen ausmachen zu können, die nicht einfach wieder im Rauschen der Daten verschwinden, sondern die, als signifikante Differenz, sich als Hinweis auf etwas Neues stabilisieren lassen.” In Summa bewegt sich die heutige Gen- und Atomforschung, also die dominierende Naturwissenschaft, schnurstracks hin zu einer Kulturwissenschaft, wie bereits der Derrida-Übersetzer Hans-Jörg Rheinberger vermutete.
Bei der Spurensuche werden immer kompliziertere technische Geräte eingesetzt – je kleiner die Spur desto teurer die Erkennungstechnik. Am Beispiel der Detektoren zum Auffinden der allerkleinsten Teilchen – den nahezu masselosen Neutrinos – kam mir einmal der Verdacht: Wenn die elektronischen Geräte nur teuer genug sind, kriegt man immer irgendwas auf den Bildschirm, was sich interpretieren läßt. Diesen Verdacht hat Sarasins Buch erhärtet. An einer Stelle findet sich darin sogar der konkret auf die Neutrinoforschung bezogene Literaturhinweis: “Confronting Nature: The Sociology of Solar Neutrino Detection”, Dordrecht 1986, von Trevor Pinch.
Vor einigen Jahren bekam ich die Möglichkeit, mich einmal für einige Tage auf die Spur einer ganzen “Neutrino-Expedition” zu setzen:
Von Irkutsk aus ging die Fahrt mit einem Kleinbus über den zugefrorenen Baikal-See. Zuvor hatten wir die Robbenstation und das Baikal-Museum in Listwjanka besucht, mit denen das “Baikal-Projekt” der Atomphysiker – aus Berlin, Moskau und Irkutsk – kooperiert. Ich hatte mich zu Hause bereits etwas in ihre “Materie” eingearbeitet. Es gibt Neutrino-Forschungsstationen von den Amerikanern und Japanern, in der Antarktis und vor Hawaii, eine – von der EU finanziert – vor einer kleinen griechischen Insel im Mittelmeer, und eben die von deutschen und russischen Wissenschaftlern am und auf dem Baikalsee. Das ostdeutsche Institut für Hochenergiephysik übernahm nach der Wende DESY Hamburg, wo man u.a. in einem Teilchenbeschleuniger Neutrinos auf Protonen und Neutronen schießt, um aus der Ablenkung Aufschlüsse über ihr Inneres zu gewinnen.
Die Neutrinoforschung geht auf eine Idee des Physiker Wolfgang Pauli zurück. In den Dreißigerjahren postulierte er zur Lösung eines Problems in der Atomtheorie die Existenz von Neutrinos. Später meinte er: “Ich habe etwas Schreckliches getan: Ich habe ein Teilchen vorausgesagt, das nicht nachgewiesen werden kann”. Das “nahezu masselose Teilchen” (erst kürzlich gelang japanischen Forschern der Nachweis, daß es eine “kleine Masse” besitzt) wurde zwar inzwischen entdeckt – mit riesigen Apparaturen, Beschleunigern und Detektoren, die Milliarden kosten, aber noch immer gilt: “Neutrinophysik ist im wesentlichen die Kunst, viel aus der Beobachtung von nahezu gar nichts zu lernen”, wie es 1988 der Atomphysiker Haim Harari ausdrückte.
Mittlerweile hat man herausgefunden: Bei jeder Kernspaltung werden Neutrinos emittiert: In einem Reaktor z.B., oder im Innern der Sonne, bei der Explosion einer Super-Nova und natürlich auch beim sogenannten Big-Bang, dem Urknall, mit dem unser jetziges Universum entstanden sein soll – vor 10 bis 20 Milliarden Jahren. Seitdem dehnt es sich aus – laut Eddington zerstreut sich das “Supersystem der Galaxien so ähnlich wie sich eine Rauchwolke langsam auflöst”.
Die Forscher auf dem zugefrorenen Baikal-See haben es u.a. auf die Neutrinos aus dem Urknall abgesehen. Mit ihrem sich Jahr für Jahr vergrößernden Detektor steigt die Chance, “Neutrino-Punktquellen oder den diffusen Fluß von Aktiven Galaxien zu identifizieren”. Sie wollen also im Grunde wissen, was unsere Welt im Innersten zusammenhält.
Der erste Neutrinodetektor – in den Sechzigerjahren in Betrieb genommen – trug den Namen “Poltergeist”. Wenig später führten die Experimente bereits zu einer Revision der Darstellung: Es gibt Neutrinos und Antineutrinos und sie haben einen Spin. Genauer gesagt: das Neutrino ist linkshändig. Die amerikanische Neutrino- Biographin Christine Sutton schreibt, es ähnelt “den Vampiren der Gruselromane: es hat kein Spiegelbild”. Inzwischen unterscheidet man mehrere Arten:Tauon-Neutrinos, Elektron-Neutrinos, Myon-Neutrinos. Dazwischen können sie auch noch oszillieren und sich mischen. Zudem lassen sich bei den einzelnen Arten verschiedene “Flavours” und “Farben” bzw. “Antifarben” unterscheiden. Kurzum – so Christine Sutton: “Lewis Carroll hätte die Neutrinos bestimmt geliebt”.
Die Wissenschaftler am Baikal benutzen ein Neutrino-Teleskop, das Ende der Achtzigerjahre mit der Enstehung der Neutrino- Astronomie entwickelt wurde. 1987 brach der Stern Sanduleak, bekannt als SN1987A, nach einer Explosion in einer einzigen Sekunde zusammen, er existierte 10 hoch 7 Jahre. Mit seinem abrupten Ende begann die Neutrinoastronomie. Beim Baikal-Experiment geht es um den Nachweis kosmischer – hochenergetischer – Neutrinos. Wobei das Detektormedium Wasser, das zudem noch extrem sauber ist, störende Einflüsse wie Sonnenstrahlen wegfiltert. Die Detektoren werden dazu in etwa 1400 Meter Tiefe dreieinhalb Kilometer vom Ufer des Sees entfernt verankert.
Hochenergetische Myon-Neutrinos, die eine große Wassermenge durchqueren, haben eine zwar geringe, aber endlich große Chance, bei einer Wechselwirkung ein energiereiches Myon zu erzeugen. Da das Myon geladen ist, emittiert es bei seinem Flug durch das Wasser die sogenannte Tscherenkow- Strahlung. “Was, Sie kennen Tscherenkow nicht?” fragte mich ein junger russischer Atomphysiker bei einem nächtlichen Gespräch in einer der Expeditions- Unterkünfte erstaunt.
Das Tscherenkow-Licht läßt sich mit sogenannten Photomultipliern aufspüren. Über 100 dieser “optischen Module” (OM) hängt man im Winter von der Station auf dem Eis aus an Stahlarme und -seile wie ein gigantisches Mobilé -die Forscher sprechen von einem “Regenschirm” – ins Wasser. Die von einer druckfesten Glaskugel ummantelten optischen Module, mit einer Quasar-Röhre in ihrem Kern, sind über Kabel mit der Uferstation verbunden, wo ihre Signale von Computern registriert und ausgewertet werden. Für die Rechner sind die Deutschen verantwortlich. Die Forscher bezeichnen ihre Tätigkeit als “Angeln kosmischer Myonen und Neutrinos”.
Das große Problem ist dabei, echte Signale von falschen bzw. gefakten zu unterscheiden, z.B. können runterkommende Myonen hochkommende “faken”. Zudem müssen sich die hochenergetischen Neutrinos aus dem Weltraum klar gegen einen Hintergrund atmosphärischer Neutrinos abheben lassen. Dazu werden Ankunftzeiten und Stärke der Tscherenkow-Signale an verschiedenen Raumpunkten im Wasser gemessen. So läßt sich Richtung und Energie der Myonen rekonstruieren. Die Myonen behalten die Richtung der primären Neutrinos im wesentlichen bei. Der Baikal-Neutrinodetektor bestand zum Zeitpunkt unseres Besuchs aus zehn Drahtseilen, an denen jeweils 12 OM hingen. Die Module, die ein Betrieb in Nowosibirsk herstellt, werden im Winter überholt, in einer Dunkelkammer neu kallibriert und wieder in die Tiefe versenkt.
Als ich ankam, wurde gerade ein neues leistungsstarkes Glasfiberkabel durch den See gelegt. Die Atomphysiker arbeiteten dabei mit Spezialisten aus dem Institut für Schnee, Eis und Dauerfrostböden in Nishni Nowgorod zusammen, wo man eine Reihe von Spezialgeräten konstruiert hat – u.a.schwere Schlitten und Traktoren, die über ihre Zapfwellen Eissägen antreiben. Das Eis wird zwischen Februar und April bis zu 1 Meter 20 dick. Beim Verlegen des Kabels kamen mehrere Traktoren und ein umgebautes Amphibienfahrzeug der NVA zum Einsatz. Der Expeditionsleiter, aus dem Moskauer Institut für Kernphysik, Grigorij Wladimirowitsch Domogatzky, freute sich: “Auf jeder Zugmaschine sitzt ein Akademiker.” Die Expedition besteht aus etwa 40 Wissenschaftlern und 20 Arbeitern bzw. Fahrern sowie zwei Köchinnen. Letztere kommen alle aus der Umgebung. Weil die Kabel teuer waren, ließ Domogatzky diesmal nur Wissenschaftler ans Steuer.
Hinterher fragte ich ihn nach den Problemen, die mit derAuflösung der Sowjetunion und dem Geldmangel der Regierung auf die Expedition und ihre Teilnehmer zugekommen sind. Der ununterbrochen “Belomor” rauchende und von allen Teilnehmern hochgeachtete Professor, dessen Vater ein polnischer Maler war, meinte: “Das Hauptproblem sind immer die inneren Differenzen – und die haben wir nicht. Wir haben gute Ideen und sind ein gutes Team”. Das sagte er auf Englisch, sonst hätte er vielleicht von Brigade gesprochen. Nicht nur wegen der Finanzkrise,auch wegen des Statusverlustes trauern viele Wissenschaftler ein wenig der UDSSR nach. Die Irktutsker Gruppe, die hauptsächlich auf dem Eis arbeitet – und auch auf dem Eis in Containern wohnt, hat demonstrativ eine Lenin-Fahne sowie eine mit Hammer und Sichel über ihrem Camp gehißt. Während die ostdeutschen Atomphysiker aus Zeuthen mit der Wiedervereinigung einen großen Gehaltssprung machten, sind die russischen fast verarmt: Die jüngeren verdienen etwa 80 Dollar monatlich, und darin sind bereits Zuschüsse von der George-Soros-Foudation und der Volkswagenstiftung enthalten. Einer der Zeuthener, der schon mehrere Jahre dabei ist, möchte gerne auf die Antarktisstation der amerikanischen Neutrinoforscher überwechseln. Später gelang ihm das auch. Er war das sowjetische und postsowjetische Durchwuschteln leid. Während meines Aufenthalts meinten seine Kollegen, gelegentlich seinen Zynismus bremsen zu müssen, um sich nicht die gute Laune verderben zu lassen. Und die Stimmung war dort wirklich gut. Es wurde jedenfalls tagsüber hart gearbeitet und abends ausdauernd gefeiert.
Zum Camp gehören neben der Eisstation der Irkutsker noch das zum Computer- und Wartungszentrum ausgebaute Bahnwärterhaus “Kilometer 105” am Ufer sowie etwa 12 Holzhütten und mehrere Wohnwagen drumherum. Am “Kilometer 106” befindet sich in einem anderen Bahnwärterhaus die Kantine, die von den zwei Frauen versorgt wird, eine hat daneben auch noch einen kleinen wunderschönen Laden, wo es überraschenderweise alles gibt, was man braucht – und mehr.
Der ganze Komplex liegt an den Gleisen eines alten Transsib-Streckenabschnitts, der1913/14 nach den Versorgungsproblemen im russischen-japanischen Krieg von italienischen und serbischen Gastarbeitern gebaut wurde. Sie verbrauchten dafür über die Hälfte der damaligen russischen Sprengstoff- Vorräte. Vom See aus mit Blick auf diesen Abschnitt hat man den Eindruck, als befände man sich am Comer See: Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel, dahinter Berge und blauer Himmel. Noch bis zum Zusammenbruch der UDSSR standen an jedem Tunnel Soldaten auf Wache: Im Bürgerkrieg gelang es den Weißen, insbesondere den 60.000 Soldaten der tschechischen Legion, die Transsib-Strecke zu besetzen – das sollte nicht noch einmal passieren.
Heute werden die Gleise zwischen den Orten Port Baikal und Kultuk nur noch zwei mal täglich von einem kurzen Versorgungszug benutzt. Seit dem Bau der Angara- Stauwerke, die das Wasser des einzigen See-Abflusses ansteigen ließen, kam das Ufer den Gleisen zu nahe und die Wellen unterspülten stellenweise den Bahndamm, so daß man 1956 zwischen Irkutsk und Kultuk eine neue Strecke quer durch das Gebirge baute. Sie führt nicht mehr an der Angara entlang, das gesamte Gebiet entlang der alten Strecke mit etlichen kleinen Dörfern, in denen zumeist Bahnarbeiter wohnen, wurde dadurch quasi von seiner Lebensader abgeschnitten. An einer Stelle fand ich eine Schiene, die aus Colorado stammte: im Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke mit Hilfe der Alliierten noch einmal erneuert.
Beim Lokführer des täglichen Versorgungszuges bestellen dieKöchinnen die tägliche Brotration (etwa 40 Brote). Er liefert sie ihnen abends, wenn er auf der Rückfahrt wieder an der Kantine vorbeikommt. Ich helfe beim Ausladen. Dabei bekomme ich es gleich mit zwei ganz wesentlichen russischen Dingen zu tun: das Brot und die Eisenbahn. Auch den wie Rasputin aussehenden und auch so genannten Dorfirren lerne ich kennen, er ist gerade dabei, in der Abenddämmerung die Sauna für die Frauen anzuheizen. Die Männer, die an einem anderen Tag saunen, springen anschließend immer noch in ein Eisloch des Sees. Mir graut davor, aber am darauffolgenden sonnigen Morgen merke ich, daß die trockene Luft es sogar erlaubt, halbnackt zu einem kleinen Flüßchen zu laufen, um sich dort zu waschen, ohne daß man friert. Auch die sibrische Trinksitte, daß der Längengrad den Alkoholgehalt bestimmt – hier also gut 80% – ist weniger barbarisch als zunächst befürchtet, zumal wenn der Alkohol mit dem Saft sibirischer Beeren gestreckt wird und man dazu frischen Baikal-Fisch, gestreiften Speck, Knoblauch und das gute Brot ißt.
Einmal im Monat kommt ein Industriegüterzug, der die an der Strecke nach Port Baikal liegenden Siedlungen mit Waren des täglichen Bedarfs beliefert, und gelegentlich fährt auch noch ein Pullmann-Sonderzug für Reiche am Ufer entlang. Wir gehen jeden Tag mehrmals auf den Gleisen zwischen der Reparatur- und Computerstation und der Kantine hin und her. Die meisten Männer tragen Filzstiefel, Steppjacken und Pelzmützen. Ich hatte mir ebenfalls solche Kleidungsstücke zugelegt, außerdem hatte ich noch ein Taschenheizgerät auf chemischer Basis mit dabei. Aber tagsüber in der Sonne kam ich – beim Spazierengehen über den See – sogar in Schweiß, deswegen wollte ich meine Mütze nicht aufsetzen. Der Leiter des deutschen Teams Professor Christian Spiering, der ein bißchen den Tourguide für uns Journalisten machte und einen Ausflug organisiert hatte, befahl mir jedoch, sie zu tragen. Es war der erste echte Befehl, den ich in meinem Leben bekam. Und es war nicht ohne Witz, daß ich noch kurz vor der Sibirien-Reise bei Alexander Solschenizyn den ersten Befehl überhaupt, d.h. in diesem Fall der jungen Sowjetrepublik, gelesen hatte – und begeistert gewesen war.
Wir fuhren zunächst mit einem Lastwagen über den See am Ufer entlang in Richtung Westen: Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel…Hinter den Brücken erstreckte sich jedesmal ein kleines Tal, in dem ein oder zwei Bauernhäuser standen. Aus ihren Schorsteinen stieg Rauch zwischen den Bergen auf. In einem kleinen Dorf am “Kilometer 108” trafen wir einen alten Bauern. Christian Spiering verwickelte ihn in ein Gespräch über die jüngste Vergangenheit, aber er wollte nichts Schlechtes über irgendjemanden sagen: “Wie leicht kann es mal wieder anders rum kommen”. Das Versammlungshaus der Partei, die Rote Ecke, stand leer, das Ewige Licht – die Glühbirne über der Eingangstür – war erloschen. Oder hing dort gar kein Lämpchen und ich bilde mir das im Nachhinein nur ein? Der Bauer sprach von Bären und Wildschweinen, die gelegentlich nachts ins Dorf runter kämen. Und davon, daß viele Bewohner arbeitslos seien – die schlimmsten Wilddiebe würde man als Wildhüter im Nationalpark beschäftigen oder umgekehrt. Das kannte ich bereits als gängige Praxis der hessisch- fürstlichen Förstereien – im 19. Jahrhundert. Im übrigen wolle man den Tourismus mehr fördern, deswegen habe die Gebietsverwaltung bereits Kontakte zu deutschen Fernsehanstalten aufgenommen, um sie für den Baikal-See zu begeistern. Mit uns waren zwei ORB-Leute gekommen. Aber sie drehten einen Film über die Neutrino-Forschung – und das vor allem im Genfer Forschungszentrum CERN. Am Baikal-Unterwasserteleskop waren sie nur am Rande interessiert und an der Umgebung dort überhaupt nicht. Ähnlich war es dann mit einem Fernsehteam aus Moskau, das anscheinend einige um Forschungsgelder konkurrierende Wissenschaftler mobilisiert hatten, zusammen mit dem Irkutsker Schriftsteller Rasputin, für den der Baikal das Herz Russlands: Das Fernsehteam suchte nur nach einer See-Verschmutzung, die es dann – in Form einer kleinen Öllache auf dem Eis – auch fand, was den Expeditionsteilnehmern hernach zur Strafe einen dreimonatigen Lohnabzug einbrachte. So streng sind dort die Ökologie-Bräuche inzwischen. Auch die der Ökonomie: Der für die Organisation Verantwortliche im Team hat aus Gehaltsgründen bereits gekündigt und Domogatzky mußte einen der Irkutsker Atomphysiker dafür abstellen. Der Theoretiker kümmert sich nun um Bettwäsche, Benzin, Werkzeug, usw.. Andere Wissenschaftler fahren im Land herum und besuchen Fabriken, die ihnen spezielle Stecker, High-Voltage- Kabel, Testgeräte und ähnliches liefern können.
Ungefähr in Höhe von Kilometer 114 befand sich die Bahnstation Maritui, wo wir erneut ausstiegen. Aus allen Lautsprechern des Ortes dröhnte Musik, einige Männer saßen in der Sonne auf dem Dach eines Lagerhauses und beobachteten mißtrauisch unsere Gruppe. Der quasi handgeschnitzte Bahnhof war bis in das kleinste Detail renoviert und herausgeputzt, so als würden dort andauernd Kurgäste aussteigen, dabei befand sich dahinter genaugenommen nur ein funktionslos gewordener Güterumschlagplatz. Wir kehrten um, wobei wir ein Stück weit in den Sonnenuntergang auf den See rausfuhren, irgendwann türmten sich vor uns die hochgedrückten Eisschollen aber derart, daß wir nach links abschwenkten. Gradeaus wären wir nach einigen Stunden in die burjatische Hauptstadt Ulan- Ude gekommen, das Zellulose- Werke dort am Ufer konnte man bereits erkennen. Seit der Perestroika wird der Direktor immer wieder wegen seiner Dreckschleuder angegriffen. Das Werk hat aber seit einigen Jahren eine Kläranlage. Nun geht der Direktor mitunter mit Journalisten an die Seeeinleitung und entnimmt dort Wasserproben, die er vor ihren Augen trinkt. Die Journalisten halten das jedoch für einen Propaganda-Trick.
Auf dem Rückweg machen wir auf der Eisstation Halt. Dort hat man große Löcher ins Eis gesägt, mit Seilwinden am Rand werden die überholten Module runtergelassen. Einmal rutschte dabei eine der tonnenschweren Winden ins Wasser, sie hing nur noch an einem Seil. Eine ganze Woche arbeitete man Tag und Nacht daran, sie zu bergen. Dabei wurde ein zweites Loch ins Eis gesägt und zwischen beiden Löchern ein Drahtseil durchs Wasser gezogen. Dafür baute man zunächst einen ferngesteuerten Elektromotor um und ließ ihn ins Wasser, durch eine Styropur-Ummantelung wurde er von unten an die Eisdecke gedrückt. Statt Räder hatte er Sägeblätter, die ihn vorwärts bewegten – so zog er das Seil unter dem Eis von einem Loch zum anderen. Ein Glühlämpchen zeigte an, wo der Unterwasser-Eisläufer sich gerade befand. Anschließend wurde die Seilwinde auf dem selben Weg durch das zweite Loch hochgezogen.
Ein anderes Mal riß ein Teil der Aufhängung ab, einer der sogenannten Strings – mitsamt den Photomultipliern, die etwa 20.000 DM pro Stück kosten. Der Physiker Andrej Iwanowitsch Panfilov, verantwortlich für die Mechanik des Detektors, konstruierte daraufhin ein großes Blechsegel, gleichzeitig berechnete man die Wasserströmung, um herauszufinden, wo in etwa das Teil – 1500 Meter tief – auf dem Grund liegen konnte. Unterhalb des Segels hingen mehrere Haken am Seil. Durch das Herunterlassen ins Wasser versetzte sich das Segel in Kreisbewegungen, dadurch sollten sich die Haken um den verlorengegangenen String wickeln und dann könnte man ihn wieder hochziehen. Das war die Überlegung. Und sie funktionierte auch. Die Forscher waren anschließend derart stolz auf Panfilov, daß sie seine Berge- Konstruktion in einen ihrer Expeditionsberichte aufnahmen.
Professor Domogatzky erklärte mir: “Jeder unserer Schritte und Fehler bewegt sich auf unbekanntem Terrain, wir können dabei kaum auf die Erfahrungen der anderen Expeditionen zurückgreifen. Zudem wird die Situation immer schwieriger. Die 200 Millionen Rubel, die wir jetzt etwa pro Jahr bekommen, sind nur ein Drittel von dem, was wir eigentlich benötigen. Dabei haben wir schon beim Budget, das die Regierung für die Forschung auf dem Gebiet der Hochenergie-Physik bereitgestellt hat, die Priorität. Ich bin zu 100% mit dem Projekt beschäftigt, dazu gehört auch der Vorsitz im Neutrino- Rat der russischen Akademie der Wissenschaften. Wir wollen uns hier fest niederlassen – am Baikal, bisher sind wir eigentlich nur drei Monate im Jahr am See. Und das ist ein sehr spezieller Platz. Der Baikal ist das Herz jedes Russen, alles was dort passiert, macht sie nervös. Es ist außerdem eine ‘heiße Zone’ zwischen Atlantik und Pazifik – genau in der Mitte. Und wir bewegen uns hier auf einem absolut neuen wissenschaftlichen Gebiet mit unseren Forschungen: Sie sind schwer zu vermitteln. Insgesamt besteht unsere Gruppe aus 70 Wissenschaftlern, 30 sind zur Zeit woanders. Bisher haben wir erst 1/5 des Detektors installiert. Die Idee dazu geht auf Moishe Alexandrowitsch Markov zurück. Die Baikal- Bedingungen sind sehr günstig für das Projekt. Vor Hawaii ist die See zu rauh, in der Antarktis ist die Versorgung kompliziert und im Mittelmeer das Wasser wahrscheinlich zu verunreinigt. Außerdem sind wir hier ein starkes Team: in den letzten 14 Jahren haben nur drei Physiker das Projekt verlassen”.
Später erfahre ich noch, daß der Irkutsker Physiker Nikolai M. Budnev, wegen der anhaltenden Finanzmisere, die ihn mehrmals zwang, die Gehälter seiner Leute zu reduzieren, unlängst als Leiter der Eisstation zurücktrat und jetzt nur noch einfaches Expeditionsmitglied ist. 1987 hatte er noch gemeint: “In meiner Gruppe ist kein einziger Kommunist, darauf bin ich stolz!” Nun war er es, der die kommunistischen Fahnen über der Eisstation gehißt hatte.
Ein anderer sowjetischer Atomphysiker ist Jurij Orlow: Er war zwar nicht am Baikal-Experiment beteiligt, aber als Dissident sieben Jahre in sibirischer Verbannung, anschließend durfte er in den Westen ausreisen. In seinem 1992 auf Deutsch erschienenen Buch “Ein russisches Leben” dankt er ausdrücklich dem Leiter der Hamburger DESY-Laboratorien Volker Soergel für die Hilfe bei seiner Emigration. Andersherum schreibt der Leiter der Zeuthener Baikal-Gruppe Christian Spiering in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe des Buches “Arsamas 16” – über die dagebliebenen Wissenschaftler der geheimen Atomstadt in der Nähe von Nishni Nowgorod, wo Andrej Sacharow einst forschte und lebte: “In diesem Buch dominieren hochqualifizierte Spezialisten, fleißig und effizient, diszipliniert und loyal, verantwortungsbewußt im Rahmen eines streng umschriebenen Moralkodex – und mit einer letzten Endes begrenzten und mittlerweile verkrusteten Weltsicht”. Über die Neutrino-Forschung auf der Station “Baikal NT 200” bemerkt er – an anderer Stelle: “Die Voraussetzungen für ein langfristig angelegtes Großexperiment in Rußland erscheinen mittelfristig eher ungünstig”.
Spierings Status und der seiner Zeuthener Kollegen hat sich mit der Wende verändert: Früher haben sie als DDR-Forscher von den Sowjets “gelernt”, jetzt bringen sie als Deutsche “die Marktwirtschaft mit”. Dadurch verschieben sich langsam die Machtverhältnisse in der Expedition. Immer öfter müssen die Zeuthener sich bei Engpässen eigene Finanzhebel, wie man in Sibirien sagt, ausdenken. Der sportliche Nichtraucher Spiering wird dadurch mehr und mehr zu einer Art Projekt-Manager.
So wie wir hergekommen sind, verlassen wir den Baikal auch wieder nach ein paar Tagen: mit einem Kleinbus. Er bringt uns zum Hotel Angara in Irkutsk, wo wir noch einmal übernachten – bis zum Abflug. Aus Langeweile testen wir die zwei neuen Spielcasinos der Stadt. Bei unserem Eintritt simuliert das beschäftigungslose Personal vitalstes Spielgeschehen. Nachdem wir unsere Jetons verloren haben, fallen die Mitarbeiter jedoch augenblicklich wieder in ihre alte Warteposition zurück.
Vor dem Hotel warten – auf einer zugefrorenen Bucht der Angara – hunderte von Männer vor ihren Eislöchern darauf, dass ein Fisch anbeißt. Auch auf dem zentralen Marktplatz warten die Leute: Viele suchen Käufer für ihre Belegschaftsaktien, die ihnen die Betriebe, in denen sie arbeiteten, zur Abfindung mitgaben. Im Hotel sitzen Dutzende von Chinesen und warten auf Geschäftspartner. In der Einkaufsstraße stehen Photographen vor sibirischen Kulissen – Wald mit und ohne Dorfkirche – und warten auf Sibirientouristen. Im Friseursalon zitiert eine junge Frau, die Janna heißt, nachdem sie erfahren hat, dass ich aus Deutschland komme – Geinrich Geine: “Ich weiß nicht, warum ich so traurig bin”…Und ich Idiot behaupte sofort, das Loreleilied sei doch gar nicht von Heine. Erst im großen Buchladen am Lenin-Denkmal, wo wir es schwarz auf weiß finden, gestehe ich meinen Irrtum ein. Und wieder zurück in Berlin erfahre ich, dass das eine Spätfolge des Nationalsozialismus ist, denn damals wurde sein berühmtes Gedicht zwar weiterhin veröffentlicht, jedoch nun mit dem Hinweis “unbekannter Verfasser”.
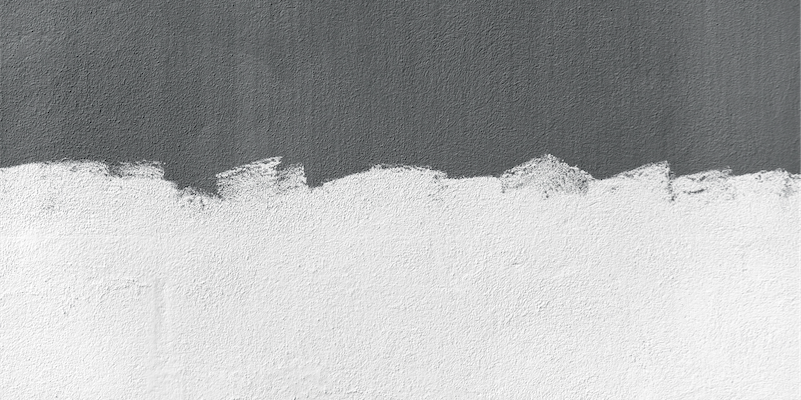



In der taz vom 20.12.2010 wurde Neues über die oben ebenfalls bereits kurz erwähnte Neutrinoforschung in der Antarktis berichtet:
Das in der Antarktis installierte ein Kubikkilometer große Neutrino-Teleskop ist fertig. Rund 5.000 optische Sensoren wurden im Eis versenkt.
Das größte Neutrino-Teleskop der Welt in der Antarktis ist fertig. Kernstück der 279 Millionen US-Dollar (gut 211 Millionen Euro) teuren Anlage am Südpol ist ein Eiswürfel mit einer Größe von einem Kubikkilometer, der mit Lichtsensoren durchsetzt ist. Sie fangen Spuren der Neutrinos aus dem Weltall auf, um Informationen über weit entfernte Galaxien zu erhalten, wie das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg mitteilte.
Die meisten dieser neutralen Elementarteilchen durchdringen die Erde, ohne mit einem einzigen Atom zu kollidieren. Weil sie kaum mit anderer Materie in Wechselwirkung treten, sind sie schwer nachweisbar.
IceCube besteht aus 86 Kabeln, an denen in Tiefen zwischen 1,45 und 2,45 Kilometern jeweils 60 Glaskugeln angebracht sind. Ein Viertel dieser insgesamt über 5.000 optischen Sensoren wurde durch deutsche Forschungsgruppen bereitgestellt.
Das Projekt wird von einem internationalen Konsortium unter Führung der National Science Foundation (NSF, USA) betrieben. Das IceCube-Team besteht aus 260 Wissenschaftlern von 36 Forschungsinstitutionen aus 8 Ländern.
Beteiligt ist auch die Universität Mainz. Der Südpol ist nach DESY-Angaben ein idealer Ort für das Projekt, weil er kristallklares Tiefeneis bietet und es mit der Amundsen- Scott-Station die notwendige Infrastruktur gibt. Neutrinos sind Elementarteilchen, die 1956 erstmals nachgewiesen wurden. Milliarden von ihnen prasseln den Angaben zufolge pro Sekunde auf jeden Quadratzentimeter der Erdoberfläche.