In der Wüste Gobi erfuhr ich von einer der dortigen, in Genossenschaften (Communities) organisierten Viehzüchterinnen, dass sie Mitglied in der „World Alliance of Mobile Indigenous Peoples“ seien. Eine Frau aus ihrer Gruppe würde sogar aktiv in der WAMIP mitarbeiten. Auf deren Webpage heißt es – auf Arabisch und Englisch: „The World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP) is a global alliance of nomadic peoples and communities practicing various forms of mobility as a livelihood strategy while conserving biological diversity and using natural resources in a sustainable way.“ Das Arabische erklärt sich nicht nur aus der relativen Politisierung der im arabischen Raum lebenden nomadischen Völker, sondern laut WAMIP-Webpage auch dadurch, dass diese Organisation mit der CEESP affiliiert ist – der „IUCN Commission on Environmental, Economic and Social Policy“ und diese wiederum ist ein „inter-disciplinary network of professionals whose mission is to act as a source of advice on the environmental, economic, social and cultural factors that affect natural resources and biological diversity and to provide guidance and support towards effective policies and practices in environmental conservation and sustainable development.“ Die IUCN, mit ihrer „Commission CEESP“ ist also ein Mission von Professionellen – also eine postkoloniale Projektfortsetzung der einst zumeist christlichen Missionare. Das erklärt jedoch nicht die arabische Ausrichtung – im Gegenteil. Die WAMIP der Nomaden ist aber nicht nur mit der CEESP-Commission der IUCN-Mission affiliiert, sondern „currently“ auch noch „hosted“ in der CENESTA – dem Centre for Sustainable Development“. Dieses Zentrum befindet sich im Iran (www.cenesta.org) und es unterstützt die Allianz – also die WAMIP – mit „secretariat support during its transition period.“ Die CENESTA-Webpage ist auf Arabisch, auf Englisch und in Farsi verfaßt. Es ist angeblich die erste NGO, die nach der iranischen Revolution 1979 entstand. Sie wurde von Wissenschaftlern und Bürgern gegründet, „who were concerned that development in Iran as well as other parts of the Third World needed its own patterns and models that should not be based on imitation of the West.“ Diese sozusagen nicht-westliche Ausrichtung der CENESTA ist verständlich, wie ebenso, dass eine solche NGO nicht unter dem verbrecherisch-westlich orientierten Schah-Regime möglich war, aber darauf folgt bei der CENESTA nun komischerweise eine zutiefst westliche (öko-logische) Zielvorstellung: „Sie kämpft nämlich seit über 20 Jahren für erneuerbare (alternative) Energien, für nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung, erstellt Umweltschutzgutachten und lehrt Umweltschutz, veranstaltet Konferenzen über Nomadismus und ressourcenschonende Viehzuchtmethoden usw.. Dabei stehen die CENESTA-Spezialisten mit „pastoral societies“ in Südwestasien, der Sahelzone und dem westlichen Iran in Kontakt. Aber auch sonst sind sie angeblich überall da präsent, wo sich weltweit Umweltschutzgruppen treffen und organisierte u.a. die Konferenz islamischer Länder über Solarenergie mit. Vor allem scheint die CENESTA jedoch sich im Iran selbst für die Belange der dort lebenden Nomaden einzusetzen – im Zusammenhang einer „National Strategy for Enviromental and Sustainable Development“. Dazu schreibt z.B. der Bonner Wirtschaftsgeograph Eckart Ehlers in seinem Forschungsbricht 1995/97 – über die Nomaden des iranischen Hochgebirges Zagros: 1. „Der iranische Staat war [war?!] aus machtpolitischen Erwägungen an einem Aussterben der nomadischen Kulturweise interessiert.“ 2. „Die Bedürfnisse des Marktes und nicht mehr die Limitierung der Ressourcen bestimmten das Wirtschaften im Zagros.“ Ehlers untersuchte dort mit Unterstützung der „Organisation für nomadische Angelegenheiten des Iran“ und dem „Ministerium für Wiederaufbau“ speziell die Weidegebiete und ihre Bewirtschaftung durch die Bamadi, einem Unterstamm der Bakhtiari. Dabei konnte er seine Forschungshypothese untermauern, dass „die über Jahrhunderte hinweg nachhaltig wirksame Form der nomadischen Landnutzung…durch Bevölkerungsdruck sowie Umwandlung von Weide- in Ackerflächen aus dem Gleichgewicht geraten ist.“
Ähnlich geht es auch den halbnomadisch lebenden Waldindios in Südamerika, Indonesien und auf den Philipinen – über deren anhaltende Verfolgung und Vertreibung die vom deutschen „Bund für Naturvölker“ herausgegebene Zeitschrift „Bumerang“ regelmäßig berichtet, wobei sie sich nicht zuletzt auf „Interviews mit Angehörigen indigener Völker“ stützt. Dazu gehören auch die Maori und die Aborigines, deren Lebensweisen schon lange unter dem Druck der weißen Einwanderer steht. Über letztere, die australischen Ureinwohner, berichtete zuletzt der Schriftsteller Bruce Chatwin in seinem Reisebericht „Traumpfade“, der zu wesentlichen Teilen aus den Fragmenten seines weltweit gesammelten „Nomadenbuchs“ besteht. Zu den „bedrohten Völkern“ gehören auch die Sahrauis in der Sahara, von denen die Mehrheit – 175.000 – bereits im Exil lebt, aber noch immer kämpft ihre von Lybien und Algerien unterstützte Guerillaorganisation „Frente Polisario“ gegen den marokkanischen Staat, der nicht zuletzt wegen riesiger Phosphatvorkommen am Territorium der Nomaden interessiert ist. Auch die Beduinen in Syrien, Jordanien, Israel und Ägypten versuchen sich gegen ihre Seßhaftmachung zu wehren. Hier schränken Grenzsicherungen und Bodenprivatisierungen ihre Viehzuchtmöglichkeiten immer mehr ein. „In der Negevwüste kam ihre Entwicklung vom Nomadismus zum Halbnomadismus bereits mit Ende der britischen Mandatszeit (1948) zum Abschluß“ – wie das Internetinfo „www.beduinen-online.de“ schreibt, aber ihre Einengung geht weiter: „In Israel sind ihnen heute nur noch 10 Prozent des Landes zugänglich… Zurzeit leben ca. 53.000 Menschen in den offiziell anerkannten ‚Wohnsiedlungen‘. 68.000 Beduinen verharren trotz ärmlichster Verhältnisse und Repressalien in 45 so genannten ’nicht-anerkannten‘ Siedlungen, die heute nicht mehr aus Ziegenhaar gewebten Zelten, sondern aus Zinkblech und Plastikplanen bestehen.“ Anders als im Iran sind die Beduinen „ihren“ Staaten auch als „Terroristen“ suspekt: Nach den letzten Bombenattentaten in Ägypten wurden über 2000 als Verdächtige verhaftet.
In Sibirien und Kanada werden die nomadischen Völker von Industrie- und Bergbauprojekten in die Enge gedrängt. Und in Alaska sowie auf der Tschukschen-Halbinsel bringt sie nun die Klimaerwärmung in Bedrängnis. Erwähnt seien ferner die Roma und Sinti in Europa, die insbesondere in den ehemaligen Ostblockländern seit 1990 von oben und von unten zugleich massiv diskriminiert werden und zudem fast alle ihre Arbeitsplätze verloren. Auch sie haben sich in diversen Organisationen und sogar Parteien organisiert, gleichzeitig jedoch auch ihre Gegner – die Neonazis. Es kam bereits zu lokalen Aufständen – mit mehreren Toten sowie zu einer anschwellenden Emigration: Allein aus der Slowakei flüchteten bisher über 10.000 Roma.
Die World Alliance of Mobile Indigenous Peoples – die WAMIP – hat dagegen eine Vision entwickelt: „Mobility is recognised and appreciated as a strategy for both sustainable livelihoods and conservation of biological diversity. Mobile indigenous peoples (MIPs) are in full solidarity among themselves and with other indigenous peoples. The rights of mobile indigenous peoples to natural resources (as per the relevant United Nations Draft Declaration) are fully respected….In such a world, mobile indigenous peoples will enjoy broad social recognition and respect.“ Die WAMIP hat dazu auch eine „Mission“ formuliert: “ The mission is to assist and empower mobile indigenous peoples throughout the world to maintain their mobile lifestyles in pursuit of livelihoods and cultural identity, to sustainably manage their common property resources and to obtain the full respect of their rights.“
Ein Weg dahin ist die Umwandlung von bedrohtem Land, das von nomadischen Völkern genutzt wird, in National- oder Schutzparks (Reservate). So wurde z.B. ein Drittel der gesamten Mongolei in Nationalparks umgewandelt – wie ein dort als Entwicklungshelfer eingesetzter deutscher Förster meint: „allerdings nur auf dem Papier.“ Auf dem 3. World Conservation Congress“ der WAMIP, der im November 2004 in Bangkok stattfand, gab es hierzu neben den quasi-offiziellen Resolutionen auch ein Votum aus Peru: „Peruvian forest peoples (in voluntary isolation) share the common objective with the state of protecting biological and cultural diversity, but think it is better to offer to the forest people official recognition of their rights to manage the land as they have been doing, and not place these lands within national parks.“ Daneben sprach sich der Kongreß für eine Unterstützung des Widerstands der Massai in Kenya aus, die dafür kämpfen, dass ihre Weideflächen, die ihnen einst durch englische Kolonialverträge genommen wurden, für ihre Rinderherden wieder zugänglich sind. Außerdem wurde noch auf die anhaltende Verfolgung der „sea gypsies“ (Seezigeuner) in Burma und Indonesien aufmerksam gemacht, deren „Existenz als Kultur und Volk“ besonders gefährdet ist. Während es über die burmesischen „Seezigeuner“ einige neuere Untersuchungen von französischen Ethnologen gibt sowie auch einen Dokumentarfilm, werden sie in Indonesien, wo man sie als Piraten und Verbrecher begreift, seit Auflösung der DDR von der indonesischen Marine mit NVA-Schiffen verfolgt und ihre Schiffe versenkt.
Im Januar 2005 fand in Äthiopien, auf der „pastoralist area“ der Turmi, ein weiteres „Globales Nomadentreffen“ statt – mit 120 Teilnehmern aus Amerika, Afrika, Europa und Asien. Eine mongolische Dolmetscherin erzählte mir 2006 – in der Wüste Gobi, dass sie nun schon zwei Mal in Äthiopien gewesen sei, aber leider noch nie in Mitteleuropa. Die Kongreßzeitung „Turmi Morning Herald“ schrieb über das Nomadentreffen – unter der Überschrift „Können Träume wahr werden?“
We all met to discuss and answer two questions: 1) What do we predict will be the reality in 10 years? 2) What is our vision or dream for the future?
Regional groups discussed these critical questions as part of the process of bringing this global gathering to a close. The first group to present were the South Omo, who spoke of hopes of a livestock market in Turmi centre and the hope that they will have the resources to organise themselves to make change in the next 10 years.
From the Afar and Somali groups of Kenya and Ethiopia we heard how if there is no change pastoralism will decline, poverty will increase and people will be forced to settle in villages. They hope that government efforts will include pastoralists in policy and decision making, and that the pastoralists themselves can continue to talk with each other. They also found hope in the fact that the world community and some representatives of governments and policy makers have come together here in Turmi. It is hoped that the policy makers will have listened and will make more effort to help pastoralists, so that pastoralists can in turn make more effort to help themselves.
Next we heard from the Bedouins, who spoke of an optimistic vision for the future within the framework of the Millennium Development Goals. They commented that unless there is a coordinated effort from governments, pastoralists and international organisations, this vision will surely fail. But there is hope for a better future if the three groups work together.
The West Africans then spoke of the risks ahead if there is no change in the next 10 years, which include further marginalisation of pastoralists, migration from rural to urban areas and the decreased availability of pasture land. They spoke of a vision of a better world for pastoralists supported by a representative international organisation that can recognise that pastoralists can live in harmony with their social and economic environments if adequately supported with basic services such as education and health care.
The Spanish speakers presented next, bringing together the voices of Chile, Peru, Argentina and Spain. They all agreed that if the situation does not change, things will only get worse. Their vision includes a hope that all of society will become aware of the ecological, social and economic importance of pastoralism, which can in turn lead to a great support and recognition of pastoralists at the government level. They also suggested that „a key thing is that pastoralists recover their pride in what they do and what they achieve“.
Finally Iran spoke powerfully about their positive vision for the future. Touching on issues of representation, coordination, universal education, communication and self-mobilisation, they then proposed specific next steps to come from this global gathering. These included a replication of this kind of gathering at the regional level, developing a more concrete plan to achieve these visions, a platform for follow-up communication (such as website hosted by WISP) and finally a commitment from all of us participating here in Turmi to share the results and ideas from this meeting.
They echoed the calls from the South Omo peoples and Spanish speakers for a statement that summarises the key issues arising from this gathering. We are all left thinking not about concrete solutions, but about ideas and possibilities for the future, and some possible strategies to turn these dreams into realities.
Ein Sprecher aus Westafrika drängte auf Taten: “ „Pastoralists are like a sick patient in need of medicine. If nothing is done to bring medicine or help to this person, the pastoralist is going to die.“ Einer der Teilnehmer der mongolischen Delegation, Sharaw Munkh-Orgi, war da optimistischer: „Because of this meeting over the next ten years the pastoralists‘ lives will improve. The world will now hear pastoralists‘ voices, and when they go home they will be able to affect the local government which will affect the regional government which will affect the national government which will affect international organisations. Herders will push their governments for this, and international organisations can help pastoralists‘ voices reach the decisions-makakers. We appreciate that herders from so many places are here and that they understand that their problems are similar.“ Ähnlich äußerten sich die Sprecher aus Tadjikistan, Mauretanien und Indien. Letzterer war insbesondere vom Widerstand der Nomaden in Mali beeindruckt. Darüberhinaus befaßten sich mehrere Beiträge mit der Rolle der Frauen bei den Nomaden und wie sich ihr Einfluß in den Stämmen und Sippen verstärken ließe.
Auf der WAMIP-Webpage findet sich neben solchen und ähnlichen Kongreßberichten auch ein Beitrag des US-Forstwissenschaftlers Don Bedunah und der in Ulaanbaatar stationierten neuseeländischen Entwicklungshelferin Sabine Schmidt – über „Pastoralism and Protected Area Management in Mongolia’s Gobi Gurvansaikhan National Park“. Dessen durchaus positive Entwicklung war jedoch bereits Thema meiner 2. Kolumne in der deutsch-mongolischen Zeitschrift „Super-Nomad“, wo ich sie aus der Sicht einiger dort lebender Viehzüchterinnen schilderte. Ganz anders sieht es dagegen im äthiopischen „Omo Nationalpark“ aus, wie die WAMIP-Dachorganisation CEESP meldete: „463 houses of the Guji-Oromo people in Nechasar National Park in southern Ethiopia were burned down by police and park authorities on November 25, 2004. Reportedly present also were representatives of the provincial government of the Southern Nations, Nationalities, and Peoples‘ Region (SNNPR).
The burning of the Guji-Oromo houses is the latest move in the effort to remove the Guji and Kore people from within the boundaries of the National Park so that it can be developed and managed by the Netherlands-based African Parks Foundation as a wildlife viewing park for well-heeled tourists. It is a condition of the African Parks Foundation contract that no people be present in the Park. Included in the development plans is a fence around part of the Park to keep local people out and wildlife in. (See the Refugees International bulletin „The Human Cost of Tourist Dollars.“)
Nechasar National Park features lush grasslands amidst rugged mountains and lakes. The Park has an area of 514 square kilometers (about 200 square miles) and was established in 1962. Prior to 2004, the park and its environs were inhabited or utilized by thousands of Kore/Amaro and Guji-Oromo households. The Kore are farmers who grew maize, sorghum, and teff in the eastern part of the Park. In 2004, 1,020 families were „voluntarily“ relocated from their lands bordering the Park to a place about 15 kilometers south. The Kore were promised land, a clinic, schools, wells, and food and about $17 per person in compensation for moving. However, the distribution of food and the provision of social services has fallen far short of that promised.
The Guji-Oromo are pastoralists who claim a legitimate presence in the area that dates back generations. They were previously expelled by the government from the Park in the 1980s but came back and re-established themselves in five villages. Facing expulsion again, the Guji-Oromo filed six appeals to the Federal and Regional governments to allow them to remain in the Park. However, the regional government then ordered the Guji-Oromo to visit and choose one of two resettlement sites.
It was during the visit of their leaders to the second site when their houses were burned without warning. Some of the houses were occupied at the time; others were temporarily abandoned as the Guji-Oromo typically migrate with their herds and return to their houses during the rainy season. Following this incident some of the Guji-Oromo were resettled near the Kore, but two groups of more that 5,000 people have relocated to two corners of the Park. No compensation has been paid for the property destroyed in the house burning. The government of Ethiopia’s official position seems to be that the Guji-Oromo were illegal settlers in the Park and thus have no rights to compensation unless they submit to resettlement. An electric fence to enclose much of the Park is proposed for construction after the remaining Guji-Oromo are expelled. The fence might also impact fisherman who depend upon access to two large lakes within the Park for their livelihoods. The eviction and resettlement of Kore and Guji-Oromo families puts them in extreme danger.
Ethiopia is one of the poorest, most densely populated, and food-insecure countries in the world. Already poor and struggling, the 10,000 or more Kore and Guji-Oromo who depended upon the resources in the Park for their livelihoods are now threatened. In Ethiopia, there is little margin for error in the precarious struggle for survival.
Moreover, the precedent of inadequate consultation with residents and users of Park lands, semi-voluntary or involuntary resettlement, and sudden destruction of homes and expulsion established in Nechasar may also be followed in nearby Mago and Omo National Parks, also proposed to be developed under the management of the African Parks Foundation. The African Parks Foundation claims that the development of the Nechasar and other parks will provide hundreds of jobs to local people and that grants will be provided to help local communities. However, those benefits are still on the horizon, perhaps the distant horizon.
Nechasar has the potential to be a magnificent park. The African Parks Foundation and the Ethiopian Federal and Regional Governments, however, should re-think their approach and ensure that the people of this region are consulted fully and that their present and future welfare is taken into consideration.“
2006 trafen sich verschiedene Nomadenorganisationen im Rahmen des „United Nations Development Programs“ (UNDP), darunter auch die WAMIP, an deren Adresse eine Klage des „Southern Mongolian Human Rights Information Center“ (SMHRIC) erging (die nebenbeibemerkt der der tibetischen Nomaden ähnelte):
„Ladies and gentlemen,
My name is Enhebatu Togochog, and I represent the five million indigenous Mongolian people of Inner Mongolia. I am honored to be here today to talk about what is currently happening in Inner Mongolia. As a typical Asian mobile indigenous people, the Mongols have lived in Inner Mongolia for thousands of years practicing their nomadic way of life. However, in 1947 the Chinese Communist Party took control of Inner Mongolia causing drastic changes in the region. After almost 60 years of Chinese rule, the Inner Mongols are being forced to abandon their traditional way of life and leave their ancestral land under a series of forced policies from the authorities:
The first is the forced eviction of Mongolian herders from their land under slogans of „recovering grassland ecosystem“ and „improving herders‘ living standard“. This policy was officially implemented in 2001 when the government of Inner Mongolia passed a set of legislations that directly targeted 650,000 herders during the first 5-year phase. Ultimately, the legislations will affect the entire herding and semi-herding population. Under these laws and regulations that were designed, passed and enforced by the government without consultation with the Mongol herder population, it is currently illegal for the Mongols to graze livestock in their own pastoral lands across the region. The authorities‘ justification for this policy is that the Mongolian herders‘ „backward, primitive, and low-productive“ traditional way of life is the root-cause of Inner Mongolian environmental degradation. Currently „over-grazing“ is a very popular term often used by the Chinese official news media. Ironically enough, there is no term in the Chinese authorities dictionary called „over-cultivation“, despite the fact that 12 million Chinese peasants (as opposed to only 2.5 million Mongol herders) are cultivating the already-weakened Inner Mongolian land every spring. The second is the forced urbanization of Mongolian evictees. In the name of „speeding up urbanization and industrialization of rural communities,“ thousands of evicted herders are being forced to resettle into overwhelmingly Chinese populated urban areas; including big cities like Huhhot and Shiliin-hot, and newly formed townships or the so-called „immigrant’s new villages“ („yi min xin cun“ in Chinese). Without the necessary skills and financial incomes to survive in urban areas, these herders are further marginalized in a Chinese dominated society. According to a communication from Huhhot City, recently the Chinese authorities have forcefully demolished a group of evicted herders‘ small businesses that were their only livelihood. In another case, more than 40 Mongolian herder’s households from Huveet-shar Banner of Shiliin-gol League were relocated to an abandoned factory building in the outskirts of Huhhot City. With no way to make a living, these herders asked for permission to return to their land but their requests were turned down by the authorities.
The third is the forced elimination of Mongolian language and education. As a continuing pattern of cultural assimilation, a policy was adopted by the Chinese authorities in Inner Mongolia with the goal of eliminating Mongolian language and Mongolian schools. The main justification of this policy by the authorities is that the Mongolian communities are „scattered across the vast land“ which makes it hard for the government to improve the quality of education in rural pastoral areas. Therefore, the Chinese authorities claim that the only way to overcome these difficulties is to „concentrate and redistribute“ Mongolian schools. According to complaints from rural Mongolian communities, under this policy almost all Mongolian elementary schools at the level of Gachaa (the second smallest administrative unit) are being eliminated, and most Mongolian middle schools at the Sum level (the third smallest administrative unit) are being merged into Chinese teaching schools. Mongolian students are therefore left with no choice but to learn Chinese. Dear friends, what I mentioned here is just the tip of the iceberg. There are a lot more human rights issues in Inner Mongolia waiting to be raised. If you are interested in exploring more, please visit our website at www.smhric.org.“
Moralische Unterstützung bekamen die in der von China beherrschten Inneren Mongolei lebenden Nomaden jetzt von einem chinesischen Hochschullehrer, den man während der Kulturrevolution in dorthin aufs Land geschickt hatte – und der nun ein Buch über die Lebensweise der Viehzüchter schrieb, das zu einem Bestseller in China geriet und demnächst auch auf Deutsch erscheinen wird. In der „Super-Nomad“ Nummer 3 wird es eine Rezension des Buches geben ( ich hänge sie hier an). Das Buch wurde unter den chinesischen Intellektuellen und dem neuen Prekariat dort zu einem Bestseller – und das, weil diese selbst sich zunehmend als „Neue Nomaden“ begreifen. Das tun auch die zur Flexibilisierung gezwungenen Massen in den Industrieländern, die sich damit auf der Höhe der Modernität wähnen. Entweder, indem sie sich – als Arbeitsemigranten – aufgemacht haben, um neue Jobs in anderen Ländern und Städten zu finden, oder, indem sie als Künstler, Wissenschaftler, Politiker oder Geschäftsleute bereits eine quasi transnationale auf jeden Fall jedoch sehr mobile Existenz führen. Beide Gruppenbilden dabei in ihrem Selbstverständnis so etwas wie eine Avantgarde in der europäischen und amerikanischen Seßhaftenkultur: „Die Fackel der Befreiung“ ist von den seßhaften Kulturen an „unbehauste, dezentrierte, exilische Energien“ weitergereicht worden, „deren Inkarnation der Migrant“ ist – meint z.B. der Exilpalästinenser Edward Said.
Für den Engländer Neal Ascherson sind es insbesondere die „Flüchtlinge, Gastarbeiter, Asylsucher und Obdachlosen“, die zu Subjekten der Geschichte geworden sind. Der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko zog daraus bereits den Schluß: „Der Künstler muß als nomadischer Sophist in einer migranten Polis aufzutreten lernen“ – auf ihren neuen Agoren, den Plätzen, Märkten, Parks und Bahnhofshallen der großen Städte. Ebenfalls an die urbane „intellektuelle Zirkulations“-Scene wandte sich Michel Foucault mit seinem Credo: „Glaube daran, dass das Produktive nicht seßhaft, sondern nomadisch ist!“ Die deutsche Kulturpolitikerin Adrienne Goehler nahm daraufhin kürzlich die sich immer mehr „verflüssigenden“ sozialen Umwelten in den Blick, um den nomadisierenden Künstler und Intellektuellen als produktive Antwort darauf zu begreifen. Da deren mobile Existenz bald für alle gelten soll, werde sich dabei aufs Ganze gesehen der „Sozialstaat zur Kulturgesellschaft“ wandeln, so Goehlers These, die der SPD-Theoretiker Peter Glotz bereits 1987 vorformulierte. Dieser positiven Sicht auf alle „Verflüssigungen“ – infolge der dritten industriellen Revolution – hält der exilierte polnische Soziologe Zygmunt Baumann das Elend der „Überflüssigen“ entgegen: also das Schicksal all derer, die weltweit eine neue Existenzweise suchen – und dabei jedoch nicht mehr wie noch vor 150 Jahren auf so genanntes „unterbesiedeltes Land“ auswandern können. Der US-Präsident Theodore Roosevelt stellte die seinerzeit schon fast abgeschlossene Ausrottung der büffeljagenden Indianer durch diese meist aus Europa kommenden armen Siedler und Pioniere noch als einen „gerechten Krieg“ dar: „Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für elende Wilde erhalten werden“. Nun haben wir es jedoch mit elenden – weil joblosen – Seßhaften weltweit zu tun (allein in China gibt es inzwischen 250 Millionen Wanderarbeiter bzw. Arbeitslose auf Wanderschaft). Der Slawist Karl Schlögel spricht in diesem Zusammenhang von einem „Planet der Nomaden“, wobei er jedoch noch schwankt, ob dies zu begrüßen oder zu beklagen ist. Dazu zitiert er den gleich mehrfach exilierten jüdischen Philosophen Vilém Flusser: „Wir dürfen also von einer gegenwärtig hereinbrechenden Katastrophe sprechen, die die Welt unbewohnbar macht, uns aus der Wohnung herausreisst und in Gefahren stürzt. Dasselbe lässt sich aber auch optimistischer sagen: Wir haben zehntausend Jahre lang gesessen, aber jetzt haben wir die Strafe abgesessen und werden ins Freie entlassen. Das ist die Katastrophe: dass wir jetzt frei sein müssen. Und das ist auch die Erklärung für das aufkommende Interesse am Nomadentum…“ Dieses neue Interesse äußert sich nun zwar nicht – wie noch in den Siebzigerjahren bei den westeuropäischen und amerikanischen Linken in einem gesteigerten Interesse an der Lebensweise der Zigeuner (was bis zu Wohnwagen und nomadischen Gewerken ging), aber immerhin in einem sich stetig ausweitenden Interesse am Nomadentum, insbesondere an dem der Mongolei: die Mongolei verstanden als beinahe letzte einigermaßen sichere Heimat traditionellen Nomadentums. Die Münchner Journalistin Gundula Englisch hat deren tradiertes Wissen, das sie vor allem vom tuwinischen Schriftsteller Galsan Tschinag übernahm, mit den neuen noch vereinzelten Erfahrungen der hier in Bewegung geratenen Profiteure der elektronischen Revolution verknüpft. Herausgekommen ist dabei 2001 eine Art Ratgeber für „Jobnomaden“, der in das „Szenario“ einer zukünftig allumfassenden Mobilität mündet, obwohl die Autorin zugeben muß, dass gerade die Mitteleuropäer einem „Wohnortwechsel selbst bei drohender Arbeitslosigkeit“ noch äußerst ablehnend gegenüber stehen (in der EX-DDR sind es über 70% der Bevölkerung). Dennoch sind die Auswanderungszahlen seit 2000 enorm gestiegen. Laut statistischem Bundesamt emigrierten seitdem etwa 150.000 Deutsche jedes Jahr, gleichzeitig reduzierten sich die Zuwanderungen drastisch, so dass die Bevölkerungszahl jährlich um rund 100.000 sank. Von Ralf Pickart, einem nach Kanada emgrierten Deutschen, gibt es inzwischen eine zornige Webpage mit gesammelten „Auswanderungsgeschichten“ (www.nixwiewegaus.de). Es sind jedoch meistens die Dableibenden, die sich als mehr oder weniger mobile „Projektemacher“ gerne „Neue Nomaden“ nennen. Im Fernsehen bezeichneten sich neulich einige Lufthansa-Stewardessen als „Nomaden der Lüfte“ und eine Gruppe von LKW-Fahrern als „Nomaden der Autobahn“. Im Internet bewirbt die Firma Regus ihr „Netzwerk für Nomaden“: Mit dem „Netzwerk“ sind ihre fertig eingerichteten Mietbüros und mit den „Nomaden“ gutverdienende Handelsvertreter gemeint. Dazu heißt es: „Das Nomadenleben von Außendienstmitarbeitern wäre weitaus produktiver, wenn diese an ihren zahllosen Destinationen immer flexiblen Zugriff auf professionelle Arbeitsräume hätten, wo sie gleichermaßen arbeiten und Kunden repräsentativ empfangen könnten. Diese Möglichkeit bietet ihnen nun Regus in seinen 750 Business Centern in 350 Städten und 60 Ländern weltweit.“
Außerdem gibt es auch noch „Daten-Nomaden“ – die sich angeblich nichts sehnlicher als ein „mobiles Breitband-Flat“ wünschen. Ansonsten existiert für „Berufsreisende“ bereits ein eigenes Internetportal – namens „Business Nomaden“. Sowie – unter dem Titel „Leben als Nomaden“ – schon fertig ausgearbeitete Designvorschläge „für flexibles und mobiles Wohnen“ von der Bauhaus-Universität Weimar. Dazu fällt mir eine Episode aus der Gründung der Westberliner Kommune I ein: Nachdem sie aus der zunächst von ihnen besetzten leeren Wohnung von Uwe Johnson in Friedenau rausgeworfen worden waren, bot sich ein solidarischer Architekt an, für die Gruppe ein Kommunehaus nach Maß zu entwerfen. Dies wurde jedoch abgelehnt – mit der Begründung: „Wir wollen nicht wohnen, sondern politisch aktiv sein.“ Wirtschaftlich aktiv will dagegen jetzt das „Nomaden-Web Headquarter“ sein, eine Gruppe junger dynamischer Leute, die sich auf ihrer Webpage mit Labtops in der Wüste photographieren ließen und bereits erste Erfolge bei der „Optimierung“ von MyM-Sites (nicht zuletzt mittels „SEO-Tools) sowie beim „Nachwachsen neuer Features“ über den „Beta-Test“ vermelden. Bei ihrer Geschäftemacherei berufen sie sich auf das „Nomaden-Denken“ von Gilles Deleuze, dem die Französischübersetzerin Michaela Ott vor einiger Zeit bereits ein ganzes Werk widmete: „Vom Mimen zum Nomaden“ betitelt. Die Autorin zitiert auch aus dem von Gilles Deleuze und Félix Guattari gemeinsam verfaßten Buch „Tausend Plateaus“: In der darin entworfenen „Nomadologie“ wurden jedoch die Migranten und postmodernen Projektemacher gerade nicht als „Nomaden“ begriffen – auch nicht als „neue“: Während die Nomaden den Raum beherrschen, nehmen die Seßhaften ihn in Besitz, sie zerstückeln und markieren ihn, um ihn aufzuteilen. Deleuze/Guattari reden in diesem Zusammenhang vom Gegensatz zwischen dem „Glatten und dem Gekerbten“. Zu den Einkerbungen der Seßhaften und ihrer Staaten gehören Grenzposten, Festungen, Stacheldraht, Mauern etc. Zwar hat auch der Nomade Punkte (Wasserstellen, Winterplätze, Versammlungspunkte), aber die Frage ist, was ein Prinzip des nomadischen Lebens ist und was nur eine Folge: „die Punkte sind den Wegen, die sie bestimmten, streng untergeordnet, im Gegensatz zu dem, was bei den Seßhaften vor sich geht“. Und auch noch bei den Migranten, die „prinzipiell von einem Punkt zum anderen gehen“ (es zumindestens versuchen)…
Während der Seßhafte „einen geschlossenen Raum unter den Menschen aufteilt, verteilt der Nomade die Menschen und Tiere in einem offenen Raum, der nicht definiert und nicht kommunizierend ist“. Anny Milovanoff schreibt in „La seconde peau du nomade“ (Die zweite Haut des Nomaden): „Der Nomade hält sich an die Vorstellung seines Weges und nicht an eine Darstellung des Raumes, den er durchquert. Er überläßt den Raum dem Raum.“
Schaf-Chinesen wollen von Wolf-Mongolen lernen (von Wei Wutai)
Demnächst veröffentlicht der Bertelsmann-Verlag den ersten chinesischen Bestseller auf Deutsch: „Wolf Totem“. Die chinesischen Kulturfunktionäre – und -beobachter sprechen von einem Marktwunder, weil sie sich nicht erklären können, wie ein solch langatmiger Roman bereits in wenigen Monaten über 500.000 Mal verkauft werden konnte: Er handelt ausschließlich von einem Tier, beinhaltet keine Sex- oder Liebesszenen und wurde zudem noch von einem bisher völlig unbekannten Autor geschrieben. Die Rede ist von Jiang Rong und seinem Buch „Wolf Totem“, in dem es um die Philosophie und Moral des „Wölfisch-Werdens“ geht. Sein Literatur- und Kunstverlag Yangtse inszenierte als Werbemaßnahme für das Buch einen heftigen Streit unter Kritikern, TV-Prominenten und erfolgreichen Geschäftsleuten – über den Hauptgedanken des Autors: „Für die heutigen Chinesen ist es notwendig, vom Geist des Wolfes zu lernen!“ Inzwischen findet man im Google unter den chinesischen Wörtern „Wolf Totem“ und „Jiang Rong“ 90.000 Eintragungen, was es bisher noch nie gab.
Die Hauptfigur des Romans ist Chen Zhen, ein junger Mann, der während der Kulturrevolution (1966-76) Peking verlassen hatte und sich im Autonomen Gebiet der Inneren Mongolei niederließ. Dort wurde er mit dem ihm bis dahin fremden „Ethos der Steppe“ konfrontiert. So etwas Ähnliches gab es schon einmal – jedoch unter anderem Vorzeichen: Bei dem von 1986 bis zur Niederschlagung der Demokratiebewegung zum Kulturminister ernannten Schriftsteller Wang Meng, den man 1958 als Rechtsabweichler zur Umerziehung aufs Land geschickt hatte, wobei er 16 Jahre im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang verbrachte – das ihm dabei zur zweiten Heimat wurde. Die uigurischen Bauern hatten ihn nicht nur sehr freundlich aufgenommen, insbesondere Abdul Rahman und seine Frau in der Kommune Bayandai, bei denen Wang Meng und seine Familie wohnte, sondern auch während der Kulturrevolution vor allen Demütigungen geschützt. Mehr noch: Die dortigen Kader verschafften ihm sogar eine Anstellung als Redakteur und Übersetzer in der uigurischen Vereinigung der Kulturschaffenden. Der Schriftsteller revanchierte sich später mit mehreren schönen Erzählungen über das menschenfreundliche Leben in der uigurischen Steppe.
Der Autor Jiang Rong nun bzw. sein Held Chen Zhen findet in der mongolischen Steppe heraus, dass die Wölfe dort in einer seltsamen Verbindung zu den Menschen stehen. Nur wenn man diese verstehe, so meint er, komme man auch der geheimnisvollen Region und ihren nomadischen Bewohnern auf die Spur. Die Steppe ist schon seit Urzeiten die Heimat der Wölfe, Chen bemüht sich um eine genaue Kenntnis ihres Lebensraumes, in dem man sie zuletzt fast ausrottete. „Im Buch gibt es Dutzende dramatischer Geschichten die von der Überlebensfähigkeit, Treue und Opferfähigkeit der Wölfe zeugen,“ schreibt die „China Daily“. Der Autor habe sich daneben gründlich mit der alten Nomadenkultur und ihrem Wolfs-Totemkult beschäftigt.
Die mongolischen Viehzüchter sehen im Wolf einen Adoptivsohn von Tengri, dem Himmel – der höchsten Macht im Kosmos. Die Tiere verkörpern für sie alle Fähigkeiten, die man für den harten Überlebenskampf in der Steppe brauche – auch der Mensch. In ihrer Gewitzheit, ihrem Mut und ihrer Geduld sind sie unschlagbar, ebenso aber auch in ihrer Aggressivität, Unbarmherzigkeit und Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig verletzten sie jedoch niemals die Spielregeln, d.h. sie töten nur, wenn sie hungrig sind, und zerstören nicht das natürliche Gleichgewicht in der Steppe, dazu sind sie jeder Zeit bereit, sich für ihr Rudel zu opfern. Wie Chen Zhen an einer Stelle sagt, „rufen sie Furcht, aber auch Respekt bei ihren Gegnern hervor“.
Viele Leser sind vor allem angetan von der traurigen Eloge auf das verschwundene einfache Leben in der Steppe und ihren edlen Bewohnern, den Wölfen, die seit unvordenklichen Zeiten schon die Mongolen spirituell beeinflusst haben. Laut Chen glauben die nomadisierenden Viehzüchter, dass das Raubtier notwendig ist, um das „Ökosystem der Steppe auszubalanzieren“. Den Viehzüchter Bilige läßt der Autor sagen: „Tengri schickte uns den Wolf, der dafür sorgt, dass die Grasflächen nicht überweidet werden“. Aber keiner, der sich an den (chinesischen) Ausrottungsaktionen gegen den Schädling Wolf beteiligte, habe auch nur geahnt, wie richtig diese „Warnung“ war, schreibt die China Daily, „denn als der Wolf verschwand, war die Verwüstung dieses Lebensraumes fast besiegelt“.
Immer wieder weist der Autor auf die parallelen Schicksale der Wolfsrudel und der mongolischen Viehzüchter hin – „den Nachkommen Dschingis Khans, ihres einstigen militärischen Führers, dessen Herrschaftsbereich bis heute an Größe von niemandem übertroffen wurde“. Diese Botschaft hören die von den Chinesen heute in eine geradezu verschwindende Minderheit gedrängten Mongolen wohl. Tengger, der Sänger der Musikgruppe „Canglang Yuedu“ (Wolf Band), bedankte sich öffentlich für die chinesische Wolfseloge: Das Buch habe mit seiner leise trauernden Klage tief verschüttete Erinnerungen wachgerufen.
Jiang Rongs Recherchen und Geschichten haben aber auch viele junge Chinesen begeistert: So meint z.B. der Computerspezialist Fu Jun, „wie der Autor die Wölfe beschreibt, aber auch die mongolischen Nomaden, das hat mich sehr berührt. Es sind harte Burschen, die bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Einige ihrer positiven Eigenschaften sind es wert, von uns übernommen zu werden, z.B. durch unsere Fußball-Mannschaften, damit sie ihre Gegner besiegen – statt besiegt zu werden.“
Jiang Rong meint, dass es die kleinbäuerliche chinesische Landwirtschaft war, die aus den Chinesen das gemacht habe, was er ein Schafs-Temperament nennt: „Sie sind unterwürfig, demütig und passiv, dazu verdammt, geschlagen und eingeschüchtert zu werden. Dem gegenüber haben die Mongolen der Steppe Selbstbewußtsein und großen Mut – so wie der Wolf!“ Dem Autor gerät seine Nomaden-Romantik immer wieder zu einer faden Wolfs-Predigt. Wahr ist daran jedoch, dass die Spezifik und Dauer der chinesischen Reisbauernkultur eine fast schon eingefleischte Kollektivität hervorgebracht hat. Die prosperierende Handels- und Industriegesellschaft verlangt nun aber eher individuelles Denken und Handeln von jedem – so wie es die nomadischen Viehzüchter scheinbar vorgelebt haben. Für den Literaturkritiker Zhang Qianyi aus Hongkong ist das eine „allzu simple „Geschichtsauffassung“. In der chinesischen Geschäftswelt, „wo sich heutzutage die heftigste Jagdleidenschaft austobt,“ wie die China Daily schreibt, stieß sie jedoch auf große Resonanz. Hier ist man der Meinung, dass der Wolf, so wie einst schon die mongolischen Viehzüchter von ihm lernten, nun auch Vorbild für den modernen Geschäftsmann sein sollte – mindestens im Hinblick auf seine Jagdtechniken: „Aus dem Buch von Jiang Rong erfahren wir, dass die Wölfe ausgezeichnete militärische Führer sind,“ sagt z.B. Zhang Ruimin, Geschäftsführer der Haier-Group, einer in Shandong ansässigen Elektrofirma, „sie gehen nie unvorbereitet in einen Kampf und sie wissen, wie man sich anschleicht, einen Hinterhalt legt, belagert und jemanden abfängt. Und stets wählen sie den richtigen Zeitpunkt zum Angriff. Sie warten geduldig und vergeuden keine Kraft. Erst wenn ihre Beute in die Enge getrieben ist, schlagen sie zu – überraschend und ohne große Verluste. Aber ihre am meisten zu lobende Eigenschaft ist, das sie immer und in jedem Fall als Team kämpfen.“
Seit der Veröffentlichung von „Wolf Totem“ im April 2004 sind in China bereits vier Ratgeberbücher erschienen, in denen es darum geht, wie man mit Hilfe von Wolfsstrategien beim Geschäftsmachen erfolgreich ist.
Unterdes hat der Autor Jiang Rong der Pekinger „Youth Daily“ in seinem ersten Interview gestanden, dass er in Wirklichkeit Jiang Mao heißt, er ist 58 Jahre alt und Wirtschaftsprofessor an der Pekinger Universität. Während der Kulturrevolution – ab 1967, lebte er elf Jahre in der mongolischen Steppe. Und sein Romanheld, Chen Zhen, das sei er selbst. 25 Jahre lang habe er für das Buch recherchiert, das er dann in sechs Jahren niederschrieb. Der Kritiker Meng Fanhua meinte begeistert, es sei eine gute „Fiktion“ und gleichzeitig eine „großartige anthropologische Monographie“. Andere, wie der Kolumnist Zhang Ruixi, bemängeln darin jedoch den Hang des Autors zum Pädagogisieren: „Das Buch wirkt stellenweise nicht wie eine Erzählung, sondern wie eine didaktisch aufbereitete Theorie“.
Solche mehren sich nun auch hier – in Deutschland, allerdings in kritischer Absicht. Erwähnt sei das soeben erschienene Buch „Raubtier-Kapitalismus – Globalisierung, psychosoziale Destabilisierung und territoriale Konflikte“ von Peter Jüngst, und ferner „Hirten & Wölfe“ – wie Geld- und Machteliten sich die Welt aneignen“ von Hans Jürgen Krysmanski. Man kann aus diesen zeitlichen Unterschieden in der Theoriebildung Chinas und Deutschlands nur den Cioranschen Schluß ziehen: „Die Stunde des Verbrechens schlägt nicht für alle Völker gleichzeitig – daraus erklärt sich die Kontinuität der Geschichte.“
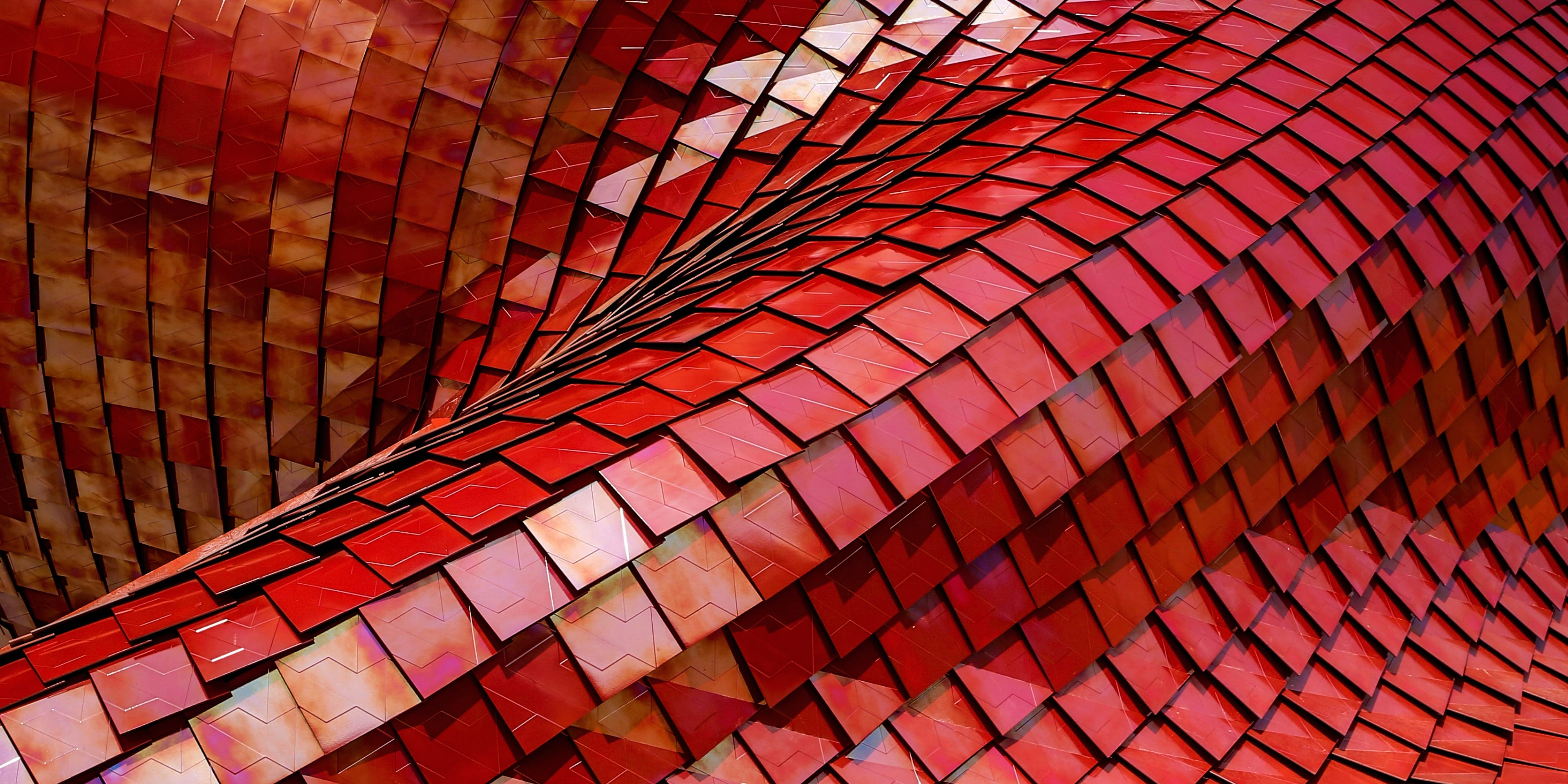



Nomaden der Moderne – von Ekaterina Beliaeva:
Draußen:
Wenn man im Köpenicker Abschiebeknast in der Grünauerstraße sitzt und eine Schar Wildgänse fliegt – aus Sibirien kommend – über das Gefängnis nach Südwesten – dann ist es hier besonders gemein. Zur einen Seite blicken die Gefangenen auf die Dahme, wo man am anderen Ufer Villen mit großen Gärten sieht, gelegentlich fährt ein Schiff auf dem Fluß vorbei. Gleich neben dem Knast ist ein Lidl-Supermarkt, auf der entgegengesetzten Seite eine Schrebergartenkolonie – deswegen heißt die Straßenbahnhaltestelle am Abschiebeknast Rosenweg. Die Briefkästen der Kleingärtner sind fast am Zaun des Gefängnisses angebracht. Ein Stück weiter befindet sich ein Badestrand.
Die etwa 5000 „Ausreisepflichtigen“, die jedes Jahr in Köpenick einsitzen, haben eine Stunde „Hofgang“ am Tag. Marion, die Berliner Freundin eines von dort abgeschobenen Sibiriers aus Barnaul erzählt: „Ich konnte Slava nur drei mal besuchen, dann war er plötzlich weg, aber viele sitzen dort bis zu 18 Monate, bis man sie in ihre Heimat deportiert. Aber ich muß sagen, dass Slava das geregelte Leben hinter Gittern körperlich ganz gut getan hat: Er hat nicht mehr gesoffen, regelmäßig gegessen, er mußte keine Angst mehr haben, dass sie ihn als Illegalen schnappen, das war ja bereits geschehen, und dann hat er dort auch viel geschlafen. Leider durfte ich ihm nichts Selbstgemachtes in den Knast mitbringen. Bei den Büchern haben sie den Umschlag abgenommen. Die fünf Zellengenossen von Slava hatten Handys und sie haben ihn gelegentlich telefonieren lassen, vor allen Dingen konnte ich ihn dadurch anrufen – bis irgendwann alle Telefonkarten von denen leer waren. Wenn man sie besuchen will, muß man am Gefängnistor klingeln und ihren Namen sowie ihre Gefangenennummer sagen. In keinem deutschen Amt habe ich bisher so eine Höflichkeit erlebt wie dort bei den Beamten in der Wache. Wie bei allen Behörden bekomm der Besucher eine Wartenummer. Am Wochenende ist die Warteschlange für die wenigen Gesprächskabinen sehr lang. Man kann sich in diesen Glaskästen nicht berühren, nur miteinander sprechen. Beim ersten Mal erwartete ich, Slava in einem gestreiften Sträflingsanzug dort sitzen zu sehen, die Häftlinge tragen aber ihre eigenen Klamotten“.
Es sitzen auch viele Frauen im Abschiebeknast, sie werden u.a. von der 1995 gegründeten Gruppe „Kiralina“ betreut, die ihnen z.B. Päckchen schickt – mit Kosmetika, Obst, Kaffee, Tabak etc. Am 2. November veranstaltete die „Initiative gegen Abschiebehaft“ eine Kundgebung vor dem Köpenicker Abschiebeknast. Es kamen etwa 100 Demonstranten, die erfahrenen Aktivisten unter ihnen waren warm gekleidet und hatten Thermosflaschen mit heißen Tee dabei. Einige trugen Transparente, auf denen sie gegen die Inhaftierung von Nichtkriminellen protestierten. Andere verteilten Flugblätter, in denen sie zu ihrem nächsten „Antirassistischen Einkauf“ (zusammen mit legalen Flüchtlingen in einem „Extra“-Supermarkt in der Schönhauser Allee) aufriefen. Mit einem Lautsprecherwagen wurden die Häftlinge im Gefängnis über die Kundgebung informiert – auf russisch, türkisch, hindi und arabisch. In den Reden ging es u.a. um die Klagen der Inhaftierten: Viele leiden unter Alpträume, Depressionen und Selbstmordgedanken, sie klagen über Willkür und Schikanen der Behörden. Jährlich treten etwa 400 Abschiebehäftlinge aus Protest gegen ihre Inhaftierung in einen Hungerstreik. Hinter mehreren Fenstern winkten die Gefangenen mit weißen Tüchern den Kundgebungsteilnehmern zu. Die Gefängnisleitung ließ daraufhin alle Oberlichter schließen. Die Demoveranstalter konterten mit sechs Trommlern, die zunächst den durchgefrorenen Demonstranten ordentlich einheizten. Die nichtmilitante Atmosphäre wirkte auch auf die Polizisten, die in ihren Mannschaftswagen in der Nähe saßen, entspannend: sie griff nicht ein. Nach etwa zwei Stunden entschwand die Mehrzahl der Protestierer in Richtung S-Bahnhof Spindlersfeld den Blicken der Gefangenen.
Drinnen:
Als wir am frühen Nachmittag aus dem Knast traten, flog wieder ein Schwarm Wildgänse über unsere Köpfe – diesmal in Richtung Osten. Sie flogen sehr hoch, also wohl nicht in Richtung Müggelsee, sondern raus aus der Stadt. Der Tag hatte damit begonnen, daß ich um 10 Uhr mit einer Aktivistin aus der „Initiative gegen Abschiebehaft“ am Bahnhof Hackescher Markt verabredet war, wir hatten vor, Sergej zu besuchen. Wie sollten wir uns erkennen? Ich trage einen langen schwarzen Mantel. Sie ebenso. Beide tragen wir Hosen, Rucksäcke und haben dunkle Haare. Und doch finden wir etwas: Sie ist an der Nase gepierct. Und einen schönen Namen hat sie auch: Anita Schaum. Ich muß an den Köpenicker Stolz, das Berliner Bürger Bräu: BBB, denken und daran, dass die Jungs im Gefängnis davon nur träumen können: Mit einem Bierchen in der Hand am Müggelseeufer im Sommer das Leben zu genießen. Wir fuhren mit der S-Bahn bis Grünau und von dort mit der Straßenbahn bis zum Rosenweg. Unterwegs erfahre ich über Sergej das Wenige, was Anita von ihm weiß und er ihr erzählt hat, was wir glauben müssen. Siebzehneinhalb ist er, ein Bürschchen, ein Waisenkind, geboren in einem Dorf in der Ukraine. Er kam ohne Papiere nach Deutschland, vier Monate später wurde er geschnappt und sitzt seit neun Monaten hinter Gittern. Eigentlich soll die Haftdauer ein halbes Jahr nicht überschreiten: Nur, bei seinem ersten Verhör gab Sergej eine falsche Heimatadresse an, deswegen wurden die ersten Monate als „selbstverschuldet“ nicht angerechnet. Anita nennt ihn „ein liebes Kerlchen“ , ich stelle mir ein kleines trauriges Waisenkind vor und schüttel bedauernd den Kopf. Wir wollen ihm was Leckeres mitbringen und gehen zum Lidl-Supermarkt neben dem Gefängnis, der von Menschen wie uns – d.h. Knastbesuchern – lebt. Am Mittwoch Vormittag sind nur wenige Kunden im Laden. Anita sucht ein paar Sachen aus: unter 2 Kilo muß es sein, fabrikverpackt und Glasflaschen sind nicht erlaubt. Eine große Tüte Chips landet als erstes im Einkaufswagen, gefolgt von Weihnachtsstollen, Schokolade und einer großen Colaflasche aus Plastik. Dazu noch ein rosafarbenes Gesichtswasser, weil wir keine Rasierwasser für ihn finden. Und weil Sergej ein Ukrainer ist, packe ich auch noch ein Stück Bauspeck in den Wagen, dazu fällt mir eine Anekdote ein:
Ein Ghanaese und ein Ukrainer sitzen im Zug, der eine ißt eine Ananas und der andere Speck. „Was ist das denn?“ fragt der Ukrainer. „Ananas!“ sagt der Ghanaese. „Darf ich mal kosten?“ „Na klar, und was ist das?“ „Speck!“ „Darf ich auch mal kosten?“ „Da gibts nichts zu kosten – Speck ist Speck!“
Wir klingeln an dem wenige Meter von einer Laubenpieperkolonie entfernten Wachhäuschen des Gefängnisses und werden hereingelassen. Im Raum steht ein Regal mir roten Körben, die alle Nummern haben. „Bitte in Korb 1 alles Mitgebrachte zur Kontrolle packen und die Pässe hier abgeben,bitte“. Danach gehen wir zu zweit in eine der Besucherkabinen, sie sieht aus wie eine große Telefonzelle, mit drei Holzstühlen auf unserer Seite, einem Stuhl auf der anderen Seite, dazwischen eine dicke Glasscheibe mit einer gelochten Metallplatte, durch die man sprechen muß. Bis Sergej gerufen wird, habe ich Zeit, um die Inschriften zu lesen, sie sind in unserer Kabine fast ausschließlich auf russisch. „Der Sklave, der nicht bestrebt ist auszubrechen, verdient die doppelte Sklaverei“, „Rußlandvaterland“, „Tschetschenien.Grosnij.Idris. Siedlung Mitschurino“, „Rostov-am-Don, Oktober 2001“. Anita meint, dass wir eigentlich zu einer ungünstigen Zeit kämen, weil die Leute in der Nacht wach sind und am Tage schlafen, damit die Zeit schneller vergeht. Ihre Worte wurden vom verschlafenen Sergej bestätigt, der mit der Lidl-Tüte eintrat, sich hinsetzte und erst einmal verschlafen die Augen rieb.
Über diese Einkaufstüten lachte einmal Aljoscha, ein russischer Programmierer mit Green-Card: Er sei stolz, nach den Einkaufen bei Lidl durch den Prenzlauer Berg zu gehen, weil jeder dann sähe, er habe die Lebensmittel nicht geklaut.
Da ist er also, unser Sergej. Über 1.90 groß, Anabolika-Muskeln, große Hände, kindliches Gesicht. Lässiger Strandbadlook: Kniehose, T-Shirt, Socken und Badelatschen. Wir sind geschminkt. Der junge Mann ist nicht schön. Er blickt dauernd gehetzt über die Schulter, reibt sich das Gesicht, blickt mich mistraurisch an. Anita meint später, Sergej habe auch ihr lange Zeit nicht getraut, sie hätte ja von der Polizei sein können. Die Ukrainischen Bauern sind Unbekannten gegenüber sowieso nicht besonders aufgeschlossen. Und der Speck – vielleicht will ich ihn damit kaufen? lese ich in seinen Augen. Anita und er besprechen erst einmal den Stand der Dinge, seines Verfahrens, dann reden sie über den Sozialarbeiter, den Pfarrer und was mit seinen Papieren ist. Bald sind es sechs Monate in der zweiten Halbzeit, dann müsste er freigelassen werden, Anita hofft – noch vor Weihnachten. Der Pfarrer hätte bereits eine Unterkunft für ihn. Sergej bleibt zurückhaltend: von Vorfreude hält er anscheinend nichts. Wird schon werden…
Er selbst erzählt: „Neulich haben sich drei Albaner mit Messern aufgeschlitzt. Erst der eine, sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht, von dort ist er…“ Sergej lächelt verschmitzt und macht eine Handbewegung…“abgehauen“. Er spricht deutsch, noch simpel, trotzdem sehr klar und nur manchmal fragt er mich auf Russisch nach einem Wort. Als der erste Albaner weg war, folgten ihm die anderen zwei. Die hat er auf der Toilette in ihrem Blut liegend vorgefunden und dann um Hilfe gerufen. Noch etwas hat sich ereignet: Er wurde beschuldigt, ein Feuerzeug geklaut zu haben, man filzte ihn und fand nichts, trotzdem hängt an ihm seitdem ein Diebstahl. Seine Augen lachen wieder: „Habe ich etwa dieses verdammte Ding aufgegessen?“. Danach mußte er die Zelle und das Stockwerk wechseln, er will zurück auf die sechste Etage, die Kumpels dort gefallen ihm am besten, aber der Sozialarbeiter will nicht – es scheint ihm nicht zu gefallen, dass Sergej irgendetwas will.
Sein grimmiges Gesicht ändert sich plötzlich und er wird wieder kindisch: „Ich habe mir ein persönliches Ziel gesetzt, in weitere drei Etagen verlegt zu werden“. Er zählt die Umzüge auf: beim ersten Mal war es wegen einer Renovierung, beim zweiten Mal wegen des Feuerzeugs, beim dritten Mal, „da haben wir den Indianer erzogen.“ Wir glauben falsch gehört zu haben und sind ganz Ohr. Also, nicht Indianer, sondern einen Inder, verstehen wir, nachdem Sergej den Mitgefangenen mit Zeichensprache beschrieben hat. Und warum? Der spuckte in der Kantine und viel zu laut sei er auch gewesen. Die Einzelheiten der Erziehungsmaßnahme wollen wir nicht wissen. Sergej erklärt nur: „Ich bin schon lange hier, es geht doch nicht ohne Action!“
Er hat uns das Interessanteste berichtet, jetzt darf ich die Fragen stellen. Was gibt es zum Essen? Zum Frühstück – dabei zeigt er mit seinen großen Fingern kleine Kästchen: Marmelade und Margarine, dazu Brötchen oder Weißbrot. Ich denke an diesen Bauernjungen, der das Feld bestellen muß und erst einmal ein vernünftiges Bauernfrühstück braucht. Und zu Mittag? Hier vergisst Sergej das Wort und zeigt, wie etwas eingewickelt wird. Teller, Tablett? Ah, eine Folie! „Eingewickelt in Folie eine Portion Kartoffeln und ein bisschen Fleisch, einen Joghurt, ein Stück Obst“. Er wiederholt es drei mal: „ein Stück Obst am Tag“. Zum Abend gibt es Brot, etwas Wurst und Schnittkäse. Anita fragt, ob das reicht. Zu spät, ich kann mich vor seiner Antwort nicht verstecken: Natürlich reicht es ihm überhaupt nicht. Wir besprechen, was ihm beim nächsten mal mitgebracht werden soll.
Und wieder Anita – sie meint es gut: „Na, Sergej, was ißt du am liebsten? Bananen, Apfelsinen, trinkst du gern Kaffee?“ Der Kerl wird ganz rot im Gesicht und sagt: “ Na alles, hör bitte auf!“ Und er erzählt, dass es auf jeder Etage eine Küche gibt und sogar Wasserkocher, zwei Pfannen und Geschirr. Nur, was soll er kochen, ja, und Eier dürften wir ihm sowieso nicht mitbringen. Wie siehts aus mit Taschengeld? Ganze 24 Euro bekommt jeder Häftling monatlich, der Laden ist eigentlich bloß ein Lagerraum in Keller, da geht immer einer aus der Zelle hin und bringt für die anderen was mit.
Was ist mit Spazierengehen und Fernsehen? Eine Stunde Hofgang am Tag, das ist alles. Ich bitte um genauere Beschreibung. Sergej zeichnet mit dem Finger drei zwanzig mal zwanzig Meter abgegrenzte „Zellen“ auf – Betonboden, hohe Holzwände, wenn eine Etage mit dem Hofgang fertig ist, kommt die nächste dran. Es gibt Fussball-und Volleyballnetze: „die Bälle verteilt die Kirche und die Pfarrer sind überhaupt in Ordnung „. Ein Fernseher steht in jeder Zelle. Wie viele Kanäle? „Ah, nicht so viele, 10 oder 15, ich hab sie nicht gezählt. Um zwei Uhr Nachts ist Sendeschluß, lesen dürfen wir auch nur bis zwei“. Nach den Telefoniermöglichkeiten frage ich ihn nicht: Sergej hält ein Funkgerät fest in der Hand. Aber wer soll ihn anrufen? Plötzlich wird er munter, als ich ihn nach der Medizinversorgung im Knast frage: Darüber will er sprechen – schlecht sei sie. Der Zahnarzt zum Beispiel, wenn der einem eine Füllung verpasst, dann macht er mal zu viel und ein andern Mal zu wenig rein – ihm ist das egal. Oder da war ein Georgier, der drei Wochen wegen eines schlechten Zahns Anträge gestellt hatte. Als er endlich zum Arzt durfte und zurück kam, erzählte er, dass der ihm zwei Zähne gezogen hatte, aber der entzündete sei drin geblieben. Anita und ich schütteln hilflos die Köpfe. Über sich berichtet Sergej: Seine Gastritis sei schlimmer geworden, aber der Doktor gibt ihm entweder die falschen Tropfen oder zu wenig. Und jetzt habe er auch noch überall Flecken auf dem Körper, die müssten doch irgendwie weg zu kriegen sein. Aber die Ärzte gäben sich keine Mühe: man klagt über ein Augenleiden, wird aber nach Spandau zum Lungenröntgen gefahren. Anita sieht das Positive: Ist doch schön, eine kleine Spazierfahrt. Nichts da, erwiedert Sergej, es gibt keine Fenster in dem Auto, dafür Metallsitze, er steht auf und zeigt uns, wie man nachher rumläuft. Der Wärter kommt, Sergej redet ihn merkwürdigerweise mit „Meister“ an – unsere Besuchszeit ist um, nach einer kurzen Verabschiedung wird er vom grünuniformierten Meister in seine Zelle zurückgeführt.
Wir sind draussen und die Straßenbahn in Richtung Grünau fährt uns vor der Nase weg, also beschließen wir, bis Adlershof zu Fuß zu gehen.
Unterwegs überlegen wir uns, eine Benefizparty für die Abschiebehäftlinge zu organisieren. Dabei soll uns Lena helfen, die in russischen Galerien und Clubs Büffets macht. Als wir uns später nach ihrem momentanen Verbleib erkundigen, erfahren wir, daß sie kürzlich bei einer Razzia in der „Garage“ festgenommen wurde und nun bereits im Abschiebeknast sitzt.