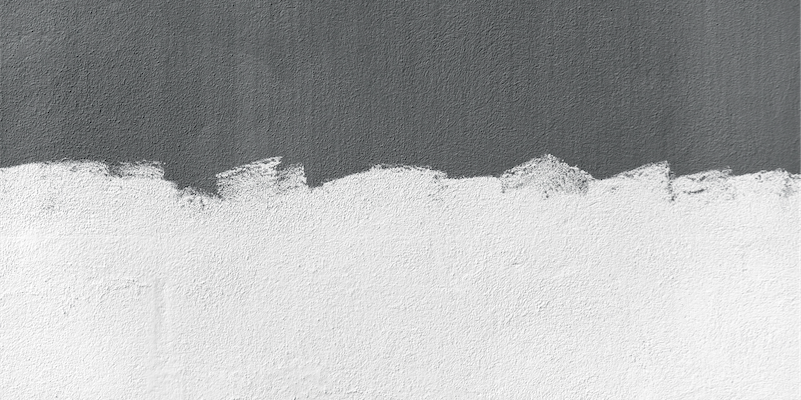Die Redaktion der Zeitschrift „Osteuropa“ hat gerade eine ebenso dicke wie wunderbare Ausgabe (6/07) über Warlam Schalamow, Kolyma, Gulag und Sibirien zusammengestellt. Ich war vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung der Moskauer Gruppe „Memorial“ zum ähnlichen Thema – nämlich über die Texte von Gulag-Häftlingen über ihre Lagererfahrungen:
„Es gibt nur etwa 4.000 Texte“
Die Gulag-Kanonen, das sind natürlich immer noch Jewgenia Ginsburg, Alexander Solschenizyn und Warlam Schalamow. Am 7. November, dem Tag der Oktoberrevolution, fand im Berliner Zentrum für Literaturforschung eine Diskussion über „Gulag und Gedächtnis“ statt. Das Moskauer Zentrum für Oral History hatte dazu die „Memorial“-Mitarbeiterin Irina Scherbakowa abgesandt, die jetzt auch mit einem Beitrag im oben erwähnten Osteuropa-Band vertreten ist.
Wiewohl es kaum ein Land auf der Welt ohne Gulag-Literatur gibt, weil die Arbeitslager wirklich international bemannt waren, konzentrierte die Referentin sich auf die sowjetische Gedächtnisliteratur. Was sich damit rechtfertigen lässt, dass diese Gulag-Memoiren das höchste Niveau haben – Dostojewski und Tschechow legten dafür schon im 19. Jahrhundert die Latte!
Die eigentliche Gulag-Literatur begann erst 1962 mit Alexander Solschenizyns „Iwan Denissowitsch“. Es waren zumeist Vertreter der Intelligenz, die daraufhin anfingen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Dabei ging es ihnen um ihre Rehabilitierung, wobei sie in Form einer Rechtfertigung die KGB-Anschuldigungen zurückwiesen. „Das war auch die ideologische Message von Chruschtschow damals – Lenin contra Stalin“, so Irina Scherbakowa. Die Partei blieb ungeschoren, auch die eigene Rolle – zum Beispiel bei der Kollektivierung der Landwirtschaft – wurde nicht thematisiert.
Nach der Durchsuchung der Wohnung Solschenizyns 1965 änderte sich das: Die Erinnerungsschreiber waren nun ohne Hoffnung auf Veröffentlichung – und ihre Selbstzensur ließ nach. Für die Darstellung des Gulag-Alltags waren die Siebzigerjahre „sehr fruchtbar“.
Ende der Achtzigerjahre überwog dann mit der Perestroika das „antikommunistische Pathos: Die Vergangenheit hatte plötzlich einen kommerziellen Wert. Außerdem ist man nun nicht mehr nur ein Opfer, das mit Glück überlebt hat, sondern von Widerstand ist die Rede. Man spricht jetzt viel von Lageraufständen. Und das wird von den Medien breit aufgegriffen – zwischen 1987 und 1992, dem Jahr des KPDSU-Verbots, das „ein Quasi-Verbot war“.
Danach sank das Medieninteresse an Gulag-Erinnerungen, es wurden jedoch weiterhin welche geschrieben, zumeist von jüngeren Leuten, die nach dem Krieg ins Lager gekommen waren: „Sie griffen oft tabuisierte Themen auf – die Sexualität zum Beispiel.“ Aber man darf sich von dieser Erinnerungsflut keine übertriebenen Vorstellungen machen: „Es gibt nur etwa 4.000 Texte insgesamt – von 17 Millionen Menschen, die irgendeine Gulag-Erfahrung hatten. Das ist ein kleines Gedächtnis, fast ausschließlich von der Intelligenz und von Adeligen“. Man sollte deswegen besser von „verlorenen Erinnerungen“ sprechen, zumal es von den Tätern nur dann Memoiren gibt, „wenn sie selbst Opfer wurden“.
Aufgrund der Homogenität der Schreiber-Gruppe entstand ein „Quasibild des Gulags: Viele waren am selben Ort und schrieben über dieselben Vorkommnisse.“ Seit 1992 gesellt sich dazu aber „das Gedächtnis der Archive: Jetzt können wir vergleichen – und es kommt dabei zu einem Rashomon-Effekt“. Es gibt Millionen von Akten, jede 100 bis 150 Seiten, allein in den Archiven der russischen Förderation. Man möchte sie jetzt von oben gerne wieder „sicherstellen – das System regeneriert sich“. Was zugleich bedeutet, die Gesellschaft „erkaltet“, das heißt, außer einigen speziellen Gruppen versucht man zu „vergessen“: Es gibt kaum Museen, geschweige denn ein „Memorial-Zentrum“. Bei den jungen Leuten kann man bereits von einer „Gedächtniskatastrophe“ sprechen.
Zum Schluss meinte Irina Scherbakowa noch, dass man auch nicht vergessen dürfe – in den Hungerjahren der Nachkriegszeit war die Versorgung in den Lagern mitunter besser als in der Verbannung und in der Freiheit: eine geradezu paradoxe Zwangsarbeitssituation! Kein Wunder, dass dann der Gulag langsam abgeschafft wurde. In einem Dokumentarfilm über ein ehemaliges Lager im Ural hat Eduard Schreiber kürzlich gezeigt, dass etliche alte Häftlinge und Wächter bis heute nicht daraus vertrieben werden konnten. Die dort einst inhaftierten Kriminellen begründen dies damit, dass nun draußen zu viele junge Gangster rumlaufen, denen sie nicht mehr gewachsen seien, ähnlich meinen die ehemaligen Wächter, sie fänden jetzt draußen keine Arbeit mehr.
Weitere Sibiriensia:
Das Lachen in Sibirien
Neulich gab es hier in Berlin eine Ausstellung über Sibirien – von einem Kreuzberger Photographen, der dort herumgereist war, sowie eine Ausstellung über die Mongolei, die von einem Wissenschaftler begleitet wurde, der daheim seine Doktorarbeit über mongolische Polizistenwitze geschrieben hatte. Seine Arbeit wird noch immer unter Verschluß gehalten.
Mein größter Wunsch ist es, einmal die näheren Gründe einiger Lacher in Sibirien zu erforschen. Ich weiß, es gibt derzeit weniger denn je in Sibirien zu lachen, wo gerade die halbe Bevölkerung auf dem Rückzug (nach Rußland) ist und die andere Hälfte, die Urbevölkerung, mehr denn je dem Suff verfällt, dennoch wird auch jetzt noch in Sibirien gelacht. Das weiß ich von einem Baikal-Ausflug im letzten Frühling.
Im hiesigen Fernsehen lief ein mehrteiliger polnischer Film: „Wildes Sibirien“, produziert von ZDF und arte. Ein wunderbares Werk, in dem jedoch nur ganz wenig gelacht wurde. Besonders traurig war der zweite Teil, in dem es um den russischen Lehrer Anatoli Grigorjewitsch Popow und seine sibirischen Kinder ging, die bereits im zarten Alter Saufgelage spielen. Ihr Schule befindet sich zweitausend Kilometer vom Nordpol entfernt in Ust-Avam auf der Halbinsel Taymyr, mitten in der Tundra, neun Monate im Jahr in Eis und Schnee.
Popow ist ein Lehrer, wie man ihn sich in seinen schönsten Träumen vorstellt: ein wunderbarer Mensch also. Wobei hinzugefügt werden muß, daß man komischerweise in Sibirien laufend auf ganz wunderbare Menschen stößt. Auch Popows Schulkinder, insbesondere die schon etwas älteren Mädchen, von denen viele Waisen sind, weil ihre Eltern im Suff erfroren, waren sehr beeindruckend.
Zufällig bearbeitete ich gerade eine Presseerklärung der Stiftung Werkschule, als der Film lief. Die Weddinger Werkschule, das war auch ein sehr schönes pädagogisches Projekt – für Heimkinder, an dem meine alten Freunde und Kampfgenossen Rüdiger und Ramba beteiligt waren.
Von den übriggebliebenen Geldern nebst zwei Häusern, die sie aufgrund ihrer sparsamen Wirtschaftsweise (das Kollektiv zahlte sich nur etwa 250 Mark Taschengeld im Monat aus) in die Stiftung einbringen konnten, wollen sie nun „Initiativen im Bereich von Erziehung, Bildung, Völkerverständigung, Jugend und Altenhilfe“ unterstützen.
Ich beantragte sofort, Popow und seine Schüler für einige Wochen oder Monate nach Berlin einzuladen. Von der für die Filmausstrahlung verantwortlichen Frau in der Redaktion Außenpolitik des ZDF erfuhr ich dann jedoch: „Alle Verbindungen nach Ust-Avam sind abgebrochen. Es haben sich schon zig Leute bei uns gemeldet, die Popow und den Kindern helfen wollten, viele wollten das eine oder andere Kind sogar adoptieren. Es gibt aber keinerlei Kontakte mehr nach dort. Der Flugverkehr ist gänzlich eingestellt worden, aus Benzinmangel. Auch gibt es kein Telefon. Es ist alles sehr traurig. Um den Film dort drehen zu können, mußten die Leute aus Warschau dem Dorf mehrere Kisten Wodka spenden. Ganz schrecklich! Und mehr kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Außer, daß die Serie ,Wildes Sibirien‘ bestimmt wiederholt wird.“
Erholung in „Neurosibirsk“
Am und auf dem Baikalsee in Sibirien arbeitet eine Gruppe Berliner Atomphysiker. Mit in einem riesigen Stahlnetz hängenden Photomultipliern „angeln“ sie im Wasser in 1.200 Meter Tiefe kosmische Neutrinos, nahezu masselose Teilchen, an denen sich die sogenannte Tscherenkow-Strahlung messen läßt. Das deutsch- russische Forschungsprojekt will so neue Erkenntnisse über den Ursprung des Universums gewinnen.
Dazu werden die Signale der Photomultiplier am Ufer des Baikalsees im ehemaligen Bahnwärterhaus „Kilometer 105“ an einer alten Transsib-Strecke mit Computern ausgewertet. Irkutsker Physiker betreiben im Winter die Eisstation auf dem See, Moskauer Akademiemitglieder sind für die Photomultiplier und Kabelverbindungen zum Ufer verantwortlich, die Berliner betreiben die Computerstation neben den Transsib-Gleisen. Für die Verpflegung der Expedition sind zwei Frauen aus dem nahen Weiler „Kilometer 106“ zuständig. Die Neutrino-Forschungsstation erreicht man von dem kleinen Ort Listvianka. Im Ort gibt es ein Baikal-Museum, eine Robbenstation und mehrere staatliche Sanatorien im stalinistisch-venezianischen Stil. U. a. trafen sich dort Breschnew mit Brandt und Gorbatschow mit Kohl.
Die Sanatoriumsgebäude wurden bisher vom Interhotel Irkutsk mitverwaltet. Jetzt will ein Schweizer Psychoanalytiker, Fritz Groß, dort groß ins Geschäft kommen: Der Erholungskomplex wird ins Enorme vergrößert und modernisiert – und zwar für Deutsche mit einem WKZwo-Sibirientrauma. Man sollte meinen, diese Ostfront-Strategen („Sibirien oder Sieg“) sind langsam am Aussterben – weit gefehlt: Immer mehr Deutsche zieht es nach Sibirien. Vor allem wollen sie dort Gulag-Reste und Öko-Katastrophen hautnah erleben! Nach Recherchen von Groß ist der „Antikommunismus immer schon eine negative Sibirien-Utopie“ gewesen, und „jetzt schraubt er sich vollends ins Absurde“. Groß meint damit nicht Ausstellungen wie im Karlshorster Museum („Auch die Russen hatten Opfer im Krieg zu beklagen“) oder im Gropius-Bau, „wo feigemutig der Totalitarismus illustriert wird“.
Der Genfer Psychoanalytiker macht sich Sorgen um uns, die Kotzbrocken-Kinder der Kalten Krieger: „Noch die ganzen achtziger Jahre über hat z. B. die FAZ den Bau der sibirischen Erdgastrasse gegeißelt, weil an der ,das Blut und die Tränen von Heeren sowjetischer Arbeitssklaven klebt‘. Nun stellt sich zweierlei heraus: 1. diese Arbeiter waren hochprivilegiert (,Einmal Trasse, nie mehr arm!‘), und 2. erst jetzt mit der Marktwirtschaft gibt es dort Sklavenarbeiter – Türken und Russen, Verbrechen, Prostitution und sogar, von Deutschen, faschistische Symbolik. Darüber berichtet keine einzige Zeitung, das Sibirientrauma der jungen Deutschen wird dadurch jedoch immer bedrückender.“ Als Beispiel zitiert Groß die jüngste Aufforderung des Wirtschaftsredakteurs der Woche, Peter Morner, noch mehr und weiter gen Osten zu investieren: „Bangemachen gilt nicht. Auf also nach Sibirien – ohne Zaudern, ohne Angst!“ Den dafür wie geschaffenen therapeutischen Ort am Baikalsee will Groß „Neurosibirsk“ nennen.
Und wenn alles gut geht, werden die Krankenkassen 43 Prozent der Kurkosten übernehmen. Merkwürdigerweise gibt es eine Reihe sowjetischer Schriftsteller, rechts von Solschenizyn, die genau dort eine neue russische Hauptstadt hinhaben wollen – aus volkstherapeutischen Gründen!
P.S.: Groß wurde inzwischen in Listvianka ausgebootet – von den Neuen Russen, die dort in den schick renovierten Hotelkomplexen jetzt einen auf Highlife machen.
Schwieriger Briefwechsel
Man müßte unbedingt mal was übers Finanzamt machen, wie die Profijournalisten zu sagen pflegen. Unlängst verlangte das gerade mit der Tiergartener Behörde zwangszusammengelegte Finanzamt Mitte die Adresse meiner Brieffreundin in Sibirien, Jannah aus Irkutsk, nebst einer Übersetzung ihrer Briefe, die ich ihr u.a. mit 100 Dollar beantwortete und deswegen von der Steuer abzusetzen beabsichtigte. In ihrem letzten Brief schrieb sie: Sie habe ihr „Sexbusiness“ an den Nagel gehängt, ihren kaputten Opel verkauft und wäre dann mit ihrer Freundin an den Baikalsee in die Sommerferien gefahren. Als sie wieder zurückkam – blank – hätte die Oma, mit der sie zusammen wohnt, ihr meinen Brief nebst dem Geld übergeben, was ihr gut in den Kram paßte. Trotzdem solle ich ihr in Zukunft kein Geld mehr schicken. Dafür aber noch einmal den letzten Brief, denn den habe sie ein paar Tage später zusammen mit einem Wörterbuch in ihren Rucksack gepackt und mitgenommen, als sie mit ihrer Freundin am Wochenende mit dem Zug an einen See gefahren sei. Dazu muß man wissen: 1. Im Baikalsee kann man, weil er zu tief und deswegen zu kalt ist, auch im Sommer nicht baden. 2. Weil es auch Irkutsker ohne Landhaus im Sommer ins Grüne zieht, fährt die Eisenbahn einfach am Wochenende mehrere Züge vor die Stadt, nahe an irgendwelche Seen und stellt sie dort ab. Die Fahrgäste können die Abteile als Datsche benutzen. Dort am See nun, so Jannah, hätten zwei Männer ihren Rucksack geklaut – mitsamt Brief und Wörterbuch. Während die beiden Mädchen schwammen. Bis dahin hatte sie gerade mal die ersten Zeilen übersetzt gehabt, deswegen müsse ich ihr nun noch einmal schreiben.
Soweit ihr letzter Brief. Die Sache ging aber noch weiter: Kaum hatte ihn mir die freundliche taz- Osteuropa-Redakteurin rohübersetzt, verlor ich den Brief aus meinem Jackett – und fand ihn nicht wieder. Damit hatten wir es mit zwei verschwundenen Briefen zu tun. Das Finanzamt begnügte sich dann zwar mit der deutschen Zusammenfassung eines alten Briefes von Jannah – und erachtete diesen „Deal“ als steuerabzugsfähig, aber desungeachtet sollte ich zum einen dennoch eine geradezu irre Steuerschuldsumme begleichen, und zum anderen war ich mir über die weitere „Bearbeitung“ des Briefwechsels nicht im Klaren: Eigentlich brauchte sie das „Honorar“ doch jetzt dringender als früher – mit regelmäßigem „Intergirl“- Einkommen.
Dann erfuhr ich auch noch, daß der alte Zausel-Direktor des „Mauer-Museums“ Hildebrandt jüngst eine junge Ukrainerin geheiratet hatte und daß der alte Rechts-Historiker Zitelmann neuerdings in der Hilton-Disco „Chip“ verkehre, wo viele Russinnen tanzen gehen: Eine hätte er jetzt sogar geehelicht. Ferner, daß die im russischen „Sex-Kino“ Potsdamer Straße nackttanzende Moskauerin mit blonder Perücke, Tanja, ein regelrechter Renner unter den bärtigen Schöneberger Linksintellektuellen geworden sei, während die beiden naturblonden St. Petersburgerinnen im „Sex-Kino“ Berliner Allee in Weißensee von der ostdeutschen Intelligenz so gut wie gar nicht angenommen würden.
Wenn also dieser neuerliche Vorstoß der vereinigten West- Truppen in die Weite des russischen Raumes voll im Trend lag, war es dann nicht hohe Zeit, entschieden gegenzusteuern? Und wenn ja, wie ließe sich das brieflich bewerkstelligen? Eine Bekannte schleppte mich ins Arsenal, in den Film „Das Zigarettenmädchen von Mosselprom“ – ein Film aus der NÖP-Zeit, der Neuen Ökonomischen Politik Mitte der zwanziger Jahre, wo es wieder Neureiche, Schieber, Dollars und Marktwirtschaft gab: „Also alles schon mal dagewesen.“ Ein wunderbarer Film, aber – wenig hilfreich!
Da lacht die Kommunistensau
Für Theodor W. Adorno begann „Sibirien“ bereits kurz hinter Frankfurt am Ende der Wetterau, wo langsam der Vogelsberg und dann die Rhön sich erheben. Eine arme Gegend mit geducktem Landvolk und heute immer mehr Neonazis. Aber erst ab der Zonengrenze wird es wirklich schlimm – kalt.
Der Ostelbier scheint jedoch langsam seinen Witz wiederzufinden! So meinte neulich ein arbeitsloser LPG-Feldarbeiter aus der Prignitz: „Ich habe einen Astra vor der Tür stehen, einen neuen Videorecorder, und unser Haus ist fertig renoviert – jetzt könnte langsam Honecker wiederkommen.“
Ein überall kolportierter Witz geht so: Ein Ostler sitzt allein auf einer Düne inmitten einer riesigen Wüste. Plötzlich kommt ein Westler auf ihn zu, begrüßt ihn freudig – und sagt: „Rutsch mal ein Stück!“
In vielen Ost-Betriebsratsbüros, nicht nur bei Orwo in Wolfen, hängt mittlerweile der fotokopierte Spruch: „Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Beim Wessi ist es andersrum!“ In Wolfen bezieht sich das insbesondere auf einige Treuhand-Manager, die dort jetzt anscheinend dabei sind, die mit öffentlichen Geldern (ABM) sanierten Industrieimmobilien nun privat zu verwerten – als eine Art Altersversorung für Privatisierungspioniere. Die lästigen Betriebsräte sollen dabei ausgeschaltet werden, die Kommune und das Land dürfen fürderhin nur noch in einem „Beirat“ zu Wort kommen.
Neulich berichtete ich über den Psychoanalytiker Fritz Groß, der aus den Sanatoriumsgebäuden im sibirischen Listvianka am Baikalsee, wo Willy Brandt mit Breschnew und Helmut Kohl mit Gorbatschow und Jelzin parlierte, ein Therapiezentrum für verwöhnte Westler – namens „Neurosibirsk“ – machen wollte (ich machte dann ein Buch daraus mit dem Titel!).
Der wackere Schweizer ist inzwischen aus dem Rennen, aber die Idee eines psychosozialen Erholungszentrums in Sibirien (Ort des Schreckens aller freiheitsliebenden Westbürger) gedeiht weiter: Bereits auf der 96er Tourismusmesse in Berlin wurden jede Menge ökologisch saubere Trekking-Tours und politisch korrekte Lager-Rundreisen nach Sibirien angeboten: von halbprivatisierten sibirischen Reisebüros und transbaikalischen Bergwacht- Brigaden mit Nebenerwerbs- Ambitionen.
In der Moskauer Zeitung Komsomolskaja Gaseta befand sich jetzt eine große Anzeige des neuen Reisebüros „Gulag-Travel“ – das unter anderem einen mehrwöchigen „romantischen Winterausflug“ nach Kolyma (in das Straflager bei Wladiwostok) anbietet, inklusive Originalverpflegung und -bewachung. (In der Juni-Ausgabe des Sklaven steht dazu bereits Näheres.)
Laut Spiegel – in persona: der Nichte von Justus Frantz – haben sich die Sklaven-Redakteure überhaupt dem West-Haß verpflichtet und sind damit in der elaborierten Prenzlauer-Berg-Szene zur Avantgarde im „German- Bashing“ geworden. Dem vorausgegangen war der Erste-Mai- Ärger mit den West-Autonomen, die ihre Randale komplett in den dortigen Kiez verlegt hatten, was laut Wolfram Kempe der „Sargnagel“ im Verhältnis von Ost- und West-Autonomen war: „Das nächste Mal kriegen sie nicht nur Prügel von den Bullen, wenn sie sich noch einmal in dieser Weise hier danebenbenehmen.“
An sich finden Kempe und Bert Papenfuß aber die „Aufmerksamkeit“, die diesem Ost- Haß jetzt durch den Spiegel-Artikel zuteil wurde, „schon wieder lustig“.
Gar nicht witzig finden hingegen die Kneipiers und Barbesitzer zwischen Oranienstraße und Kurfürstendamm den nach wie vor anhaltenden Trend der Vergnügungsverlagerung nach Osten – zwischen Oranienburger Straße und Kastanienallee. Dort hatte auch noch der „Prater“ wiedereröffnet, wobei die Sklaven-Redakteure an der Programmgestaltung beteiligt wurden. Auch ihre „Torpedokäfer“-Kneipe boomt derart, daß sie planen, das Haus obendrüber zu kaufen sowie eine zweite (Fisch-)Kneipe gegenüber zu eröffnen. Selbst solch eine wirtschaftliche Expansion findet der Ostler inzwischen „doch eigentlich ganz witzig“.
Sibirien als Genius loci
Die Folgen der nachgeholten – bolschewistischen – Modernisierung bedrohen erneut die russische Intelligenzija: „Dead again!“ wie sich die Moskauer Schriftstellerin Masha Gessen bereits im Titel ihres US-Buches über diese Spezies äußert. Als soziale Gruppe entstand sie in Rußland erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts und fand dann ihren wichtigsten Bezugspunkt im Leben und Werk von Puschkin, den sie bis heute nicht verloren hat. Ihr hoher moralischer Anspruch war ebenso persönlich wie stets aufs Ganze gerichtet. 1863 veröffentlichte Nikolai Tschernyschewski die Erzählung „Was tun?“. Der Philosoph und Dichter schrieb sie in der Peter- und-Paul-Festung, er wurde dann 19 Jahre nach Sibirien verbannt. In „Was tun?“ skizzierte er für die kommende Intelligenzija den „Neuen Menschen“ – den Revolutionär als „Beweger“. „Wir lasen es mit gebeugten Knien“, erinnerte sich ein ebenfalls nach Sibirien Verbannter, der sich davon mit vielen anderen zusammen zum Terrorismus inspirieren ließ. Die zweite Beantwortung der russischen Frage „Was tun?“ stammt aus dem Jahr 1902 von Lenin und befaßte sich mit dem bolschewistischen Parteiaufbau, der Avantgarde. Lenin entwickelte darin die Konzeption des Berufsrevolutionärs, den die objektiven Interessen der Arbeiterklasse bewegen. 1997 erschien auch noch ein drittes Werk mit dem Titel „Was tun?“: eine Beantwortung der „russischen Frage“ auf einem Kolloquium der Deutschen Bank mit Siemens, Daimler-Benz und entsprechenden „Verantwortlichen“ in Rußland. Der Titel ist Hilmar Koppers Referat entnommen, der darin ein Bewegungs-„Programm“ entwirft, „das Macht, Geist und Geld zusammenführt“. Es ist die Fortsetzung dessen, was Gorbatschow „umzusetzen“ versucht hatte, nämlich eines der Szenarien, die bereits unter seinem Vorgänger Andropow von verschiedenen ZK-„Braintrusts“ ausgearbeitet worden waren, um den Machterhalt der Parteielite in einer vom „Neuen Denken“ bestimmten sozialistischen „Transformationsperiode“ zu gewährleisten: „durch Umwandlung des Kollektivbesitzes der Nomenklatura in Privatbesitz ihrer einzelnen Mitglieder“ – so der ehemalige ZK-Mitarbeiter Jewgeni Nowikow 1994 in New York.
Wiewohl man die Herausbildung der Intelligenz als „klagende Klasse“ (Wolf Lepenies) mit Emile Zola anheben läßt, erreichte sie etwa zur gleichen Zeit im „rückständigen Rußland“, wo sie am konsequentesten die Partei der „Erniedrigten und Beleidigten“ (Dostojewski) ergriff, ihre stärkste moralische Kraft. Nirgendwo sonst auch wurde sie derart verfolgt, wobei – beginnend mit den Dekabristen – Zigtausende nach Sibirien verbannt wurden, starben oder emigrierten. Was sich aus diesem Typus in Rußland an Studentenprotest, Frauenbewegung, Kommunen und Terrorismus entwickelte, nahm die westeuropäische 68er Bewegung und ihren weiteren Verlauf – 100 Jahre vorher bereits – vorweg. Dennoch war auch für die sowjetische Dissidentenbewegung, besonders für ihre Sprecher Solschenizyn und Sacharow, 1968 ein entscheidendes Jahr: Solschenizyn beendete den „Archipel Gulag“ und begann sich öffentlich für „Regimegegner“ einzusetzen, für Sacharow wurde der Einmarsch der Roten Armee in Prag zum „Wendepunkt“. Beide knüpften wieder bei der alten russischen Intelligenzija an – und nahmen sich explizit Puschkin zum Vorbild.
Für die Literatur dieser Epoche war es laut Rosa Luxemburg kennzeichnend gewesen, „daß sie aus Opposition zum herrschenden Regime, aus Kampfgeist geboren wurde“. Die nachrevolutionäre Literatur hatte zwar auch den Staatsterror zu fürchten, sie ließ sich aber vor allem durch das kommunistische Glücksversprechen ihren Kampfgeist abkaufen. Maxim Gorki scheint hierbei eine Art Scharnier gebildet zu haben: Mit seiner Parteinahme für das Proleteriat und Subproletariat gehörte er noch zur alten Intelligenzija. Nach der Revolution emigrierte er, kehrte jedoch – aus Geld- und Ruhmgründen, wie Solschenizyn meint – wieder nach Rußland zurück: Als sowjetischer Staatsschriftsteller, der sich nicht scheute, sogar „der Sklavenarbeit Ruhm zu singen“, das heißt, die ersten Arbeitslager des KGB propagandistisch zu verklären. Damit verkehrte sich das Engagement russischer Schriftsteller vollends in sein Gegenteil. Der in einem sibirischen Arbeitslager gestorbene Dichter Ossip Mandelstam schrieb 1929: „Es ist so weit gekommen… Sämtliche Werke der Weltliteratur teile ich ein in genehmigte und solche, die ohne Genehmigung geschrieben wurden. Die ersteren sind schmutziges Zeug, die letzteren – abgestohlene Luft.“
In den Samisdat-„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“ meinte Boris Jampolski noch 1975: „Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer‘, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten‘, so ist das reine Phantasie.“
Während Tschernyschewskis „Was tun?“ ein Manifest der Intelligenzija war, wurde Lenins „Was tun?“ zu ihrem (eigenen) Nekrolog: „Zwischen 1936 und 1956 wurde die Intelligenzija in der Sowjetunion vernichtet“, resümiert Detlev Claussen. Michel Foucault unterschied 1977 den „universellen Intellektuellen“, dessen Ursprünge er bei Voltaire ansetzte und der vor allem von gebildeten Juristen verkörpert wurde, vom „spezifischen Intellektuellen“, der in seiner besonderen Stellung zur Macht, durch seine berufliche Tätigkeit selbst zum moralischen Widerstand gelangt.
Zum älteren Typus zählte Foucault auch noch Sartre, dessen Kriminalisierung De Gaulle einmal verhinderte mit der Bemerkung: „Einen Voltaire verhaftet man nicht!“ Sartre empfahl übrigens seiner Intelligenz, die Existenz sowjetischer Arbeitslager zu verschweigen: um die französischen Arbeiter nicht völlig hoffnungslos zu machen. Erst Foucault änderte dann Sartres Haltung zum „Gulag“. Das Scharnier zwischen beiden Intellektuellentypen war für Foucault der Atomphysiker Robert Oppenheimer. In der sowjetischen Dissidentenbewegung könnte man danach den „Vater der Neutronenbombe“ Sacharow als Repräsentanten der neuen „spezifischen“ und den Schriftsteller und Dichter Solschenizyn als Vertreter der (alten) „universellen Intellektuellen“ bezeichnen.
Das gilt auch für die Lagerliteratur-Verfasser Jewgenia Ginsburg und Warlam Schalamow. Solschenizyn, dem es stets darum ging, weniger zum Leben zu brauchen als mehr zu verdienen, schätzte außer den Samisdat- beziehungsweise Tamisdat-Werken dieser beiden vor allem die Sibirien-„Tagebuchblätter“ des sozialrevolutionären Terroristen Pjotr Jakubowitsch, der ihm wegen seiner „Kompromißlosigkeit“ nahestand. Sein „Archipel Gulag“, bei dem ihm 250 „Lagergenossen“ zuarbeiteten, werde für das Sowjetsystem einmal so „gefährlich wie eine Atombombe“ sein, schrieb er nach seiner Ausweisung 1975 in „Die Eiche und das Kalb“.
Vor kurzem führte der Petersburger Schriftsteller Daniil Granin Klage über das neuerliche Verschwinden der russischen Intelligenzija, die in den sechziger Jahren – vor allem „aus der Physik und später der Biologie“ – entstanden sei, als diese Spezialisten für die Macht wichtiger als die Beamten und sogar das Militär wurden. Für Granin ist die Intelligenzija ein „sozialer Begriff“, im Gegensatz zur westlichen „Intelligenz“, der ein „Persönlichkeitsbegriff“ sei, „fast ein Beruf“. Granin schrieb mehrere Romane über die „wissenschaftliche Sowjetintelligenz“, die sich mit der Industrialisierung und dem raschen Ausbau des Bildungswesens zu einer Art Mittelschicht entwickelte.
Der Sozialismus begünstigt „in seiner entwickelten Form“ – laut George Orwell – „sowieso eher die Mittelschicht als das Proletariat“. Aus Emigranteninterviews zog der US-Slawist Barber 1988 den Schluß, daß die „sowjetischen Arbeiter“ die offizielle Ideologie weit weniger verinnerlicht hätten als die „Intellektuellen“. Jetzt bildete sich seit 1992 im Zusammenhang mit der Reprivatisierung eine neue russische Mittelschicht heraus. Der ehemalige amerikanische Arbeitsminister Robert Reich nennt diesen – globalen – Mittelschichtstypus „Problemfinder“ beziehungsweise „-löser“. Dazu zählt er Werbetexter, Filmer, Pressesprecher und Journalisten, aber auch Broker, Gentechniker, Programmierer und so weiter. Diese dynamisch charakterlosen „Projektemacher“ neuen Typs bilden für ihn das glückliche Fünftel der neuen postsowjetischen Weltgesellschaft: die einzigen Gutverdiener. Die neue russische „Mittelschicht“ hat darin zwar weder Arbeitslager noch Psychiatrisierung zu befürchten, mit den ihr vorangegangenen aber noch dies gemeinsam, daß sie ständig von der Emigration versucht wird.
Granin beklagt den anhaltenden Massenexodus in den Westen. Wolf Lepenies „prognostizierte“ 1992 bereits, „daß in Europa zwei politische Kulturen aufeinanderstoßen“ werden – „auf seiten der armen Länder Intellektuelle mit hohem moralischem Kredit, aber ohne ausreichende Expertise, auf seiten der reichen Länder dagegen Fachleute mit hervorragender Expertise, die an moralischen Problemen nur mäßig interessiert sind“. Lepenies‘ karrieristische „Fachleute“ dürften mit den Reichschen „Problemlösern“ identisch sein, die Granin westliche Berufsintellektuelle nennt.
Wohingegen die „armen Intellektuellen“ nichts anderes als die sich immer wieder von Puschkins „ironischer Poesie“ (Jossif Brodsky) inspirieren lassende „Intelligenzija“ sind. Aus der Pierre Bourdieu neuerdings wieder eine „Front“ machen möchte! Ich vergaß zu erwähnen, daß schon Zola sich stark von Tschernyschewski beeinflussen ließ. Isaiah Berlin hielt dessen Intelligenzija gar für „den größten russischen Beitrag zum sozialen Wandel in der Welt“.
Der Westberliner Lepenies sorgte sich 1992 um die west-„europäischen Intellektuellen“. Im selben Jahr fürchtete der Ostberliner Volker Braun um die östliche „Intelligenzija“ – in einem Essay zur Neuherausgabe von Dostojewskis Puschkin-Rede, die dieser 1880 gehalten hatte: anläßlich der Einweihung des Puschkin-Denkmals, wo nicht zufällig ab 1980 auch die ersten Moskauer Protestdemonstrationen begannen. Volker Braun sah von Puschkins „Onegin“ über Trotzki bis zu Gorbatschow die „Verwirklichung“ ein und desselben „literarischen Typs“ am Werk, die für ihn gleichzeitig seine „Heraustreibung“ war. Vielleicht ist die politische oder wirtschaftliche Verbannung für die Intelligenzija am Ende wesentlich? Sibirien wäre demnach ihr Genius loci. Und Paris bloß so lala!
Sibirien-Bücher
Seitdem immer mehr Ostberliner ihr geistiges Eigentum zum Trödler tragen, haben sich die Westberliner Märkte für gebrauchte Bücher gründlich verändert – und zwar positiv: Neben all den bunten US- bzw. BRD-Bestsellern machen sich zunehmend russische Autoren in intelligent edierten DDR- Ausgaben breit. Nicht selten stehen noch Widmungen darin: „Beste Wünsche von Deiner Brigade“ oder „Gratulation zum bestandenen NVA-Offiziersexamen“.
Die Preise sind niedrig: An den Bücherständen in den Treptower Trödelhallen bekommt man drei gebundene „Klassiker“ für eine Mark. Westdeutsche Antiquare decken sich dort kistenweise ein. Das führt zu „Preiserholungen“ – von Ost nach West: Bei einem Buchhändler in Hannover z. B. kosten Ausgaben, die in den Berliner Antiquariaten für fünf bis zehn Mark verkauft werden, dreißig bis fünfzig Mark.
Rund zwanzig Läden bieten inzwischen ihre Bücher übers Internet an. Neulich schloß sich ihnen der Anarcho-Antiquar in der Oranienstraße 45 an. Früher waren viele Antiquare und Trödelhändler in Westberlin relativ unbedarft – die „Nachlässe“ dagegen noch ziemlich hochkarätig. So daß es während der Studentenbewegung etlichen Linken gelang, „wahre Schätze“ zu entdecken, die sie gegebenenfalls teuer wiederverkauften. Auch die alten Raubdrucker fanden noch in den Buchgrabbelkisten manchen Stoff. (Die jetzigen haben es eher auf „Reprints“ von Althusser und Negri abgesehen als auf russische Originale.)
Ansonsten wundert man sich immer wieder, wie schnell die linken Westbücher-Konjunkturen seit den 70ern im Ramsch enden. Manche sind sogar noch verschweißt. Dagegen behaupten sich die alten Russen in langen Wellen. Für ihre Fans ist der Untergang der Sowjetunion einschließlich DDR ein wahrer Segen. Die jetzigen Antiquare sind aber auf der Höhe ihres Angebots. Die im Prenzlauer Berg wirken alle irgendwie „überqualifiziert“ – das schlägt sich in ihren Preisen nieder. Auch im Westen stehen etliche Antiquare – aus der Studentenbewegung hervorgegangen – derart im Stoff und kennen zudem ihren Markt so gut, daß sie nur wenige, reiche Sammler mit Erstausgaben beliefern.
Trotzki hatte einmal in seiner Biographie kurz seine Flucht aus der zaristischen Verbannung erwähnt. Zur Macht gekommen und damit zum Bestsellerautor geworden, koppelte er seine „Flucht aus Sibirien“ schnell aus und machte daraus eine „Long Version“, die – mit einem avantgardistischen Cover von John Heartfield versehen – als Single-Text auf den deutschen Markt kam. Das zwanzigseitige Heft kostet heute 200 Euro. Mir würde eine Fotokopie reichen. Beim Büchertrödeln treffe ich immer öfter auf Gleichgesinnte – und man hilft sich untereinander: So besorgte mir der eine Vera Figner in Rostock und der andere Victor Serge in Stuttgart – für nahezu umsonst. Übrigens kann man die Aufgeblasenheit von Serge erst richtig ermessen, wenn man die „Erinnerungen“ von Figner gelesen hat. Dieses Sammelgebiet ist auch und vor allem ein Feld zur (moralischen) Sammlung – und das ist „ein weites Land“ (Gerd Ruge). Insofern man dabei auf immer neue Literaturhinweise stößt, wobei nicht selten der eine den anderen relativiert – entwertet gar.
Das Heldenepos des Stalinpreisträgers Ashajew z.B. – über eine Komsomol-Baustelle in Sibirien, „Fern von Moskau“, das derzeit zu Hunderten die Gebrauchtbücher-Regale verstopft – „entlarvt“ Solschenizyn in seinem „Ersten Kreis der Hölle“ als völlig verlogenen Roman über ein Zwangsarbeitslager in Sibirien, „vielleicht sogar von einem Sicherheitsoffizier geschrieben“. Auch Solschenizyns eigene „Entlarvung“ – als hochbezahlter US-Agent, mit eigenem Fahrstuhl in seiner Datsche – durch den MfS- Schreiber Harry Thürk: „Der Gaukler“ – findet man heute dutzendfach beim Trödler. Einer, aus dem Osten, verriet mir, als Thürks Buch erschien, hätten sich sogar diejenigen seiner Freunde, die in der Partei waren, deswegen geschämt.
Im Westen landete andererseits auch Solschenizyn reihenweise im Antiquariat – fast immer ungelesen. Und die meisten Bemerkungen über seine Bücher sind dementsprechend wenig kenntnisreich – er sei „religiös, rechts, chauvinistisch“ und zudem ein „schlechter Künstler“. Im Osten traute man sich erst nach der sogenannten Wende an die sowjetische „Lagerliteratur“ heran, zuvor wurden jedoch laufend üppig ausgestattete Lagerberichte aus der vorrevolutionären Zeit veröffentlicht. Im Westen war es eher umgekehrt.
Manches war sich aber auch vorher schon ähnlich geworden – so z.B. die Sibirienreiseberichte des westdeutschen DKP- Vorständlers Peter Schütt, „Ab nach Sibirien“, und des ostdeutschen Journalisten Landolf Scherzer, „Nahaufnahmen“. Beide Bücher enden merkwürdigerweise mit einem Gespräch zwischen dem Autor und einem Baikal-Fisch. Es wird damit auf die damals gerade vom „Fischfreund Breschnew“ (P. Schütt) verfügte ökologische Rettung des Baikal-Sees angespielt. Geholfen hat diese konzertierte Ost-West-Aufklärung indes wenig: Noch immer begründet der Westberliner Essayist Wolf- Jobst Siedler seine Aus-dem- Osten-nichts-Gutes-für-Berlin- Botschaften mit dem Hinweis auf den völlig verschmutzten Baikal-See. Dabei liegt eine Verwechslung mit dem Aral- See in Usbekistan vor. In einer ZDF-Seniorenquizsendung ließ Carolin Reiber sogar den Namen „Balalaika-See“ durchgehen – als Heimat des stets gutgelaunten Chors der Wodka-Kulaken?!
Der Held – ein Gutdenker
Wer eine Tragödie überlebt hat, ist nicht ihr Held gewesen. Deswegen haben auch alle Lagerberichte notgedrungen ein Happy-End, meinte der verfemte sowjetische Dichter Joseph Brodsky: Der Held überlebte – sonst gäbe es keinen Bericht darüber! Der Hamburger Hafenarbeiter Tönnies Hellmann – dessen Erzählung von den beiden Politikstudenten Friedrich Dönhoff und Jasper Barenberg aufgeschrieben wurde – gab seinem Rechenschaftsbericht den Titel „Ich war bestimmt kein Held!“
Schon die Eltern des 1912 geborenen Hellmann standen links. „Seit Anfang des Jahrhunderts hatte die Arbeiterschaft ein Hobby: Taubenzüchten!“ Der Adel bevorzugte dagegen Jagdfalken. Tönnies Hellmanns Vater besaß 70 Tauben. Sein Sohn bekam 1927 eine Lehrstelle auf der Blohm&Voss-Werft. „Durch meinen Freund Rolf Hagge kam ich zur kommunistischen Jugendgruppe in Eimsbüttel.“ (Hagge wurde später in der DDR Polizeipräsident von Rostock; weil er sich dann von seiner erst spät aus sibirischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten Frau trennte, kündigte Hellmann ihm die Freundschaft.)
Anfang der dreißiger Jahre wurde der Autor arbeitslos, er schloß sich einer „Jugend-Sturmabteilung“ des Rotfrontkämpferbundes an. Ende 1933 verhaftete ihn die Gestapo. Noch während der Haft heiratete er seine hochschwangere Freundin Mary. Nach seiner Entlassung war er erst einmal „vollkommen demoralisiert. Am Boden zerstört – seelisch und körperlich. Ich hätte das auch nicht länger durchgestanden.“ Sein Schwiegervater war inzwischen Mitglied einer illegalen KP- Gruppe geworden. Hellmann kam wegen eines Sportunfalls ins Krankenhaus. Mary verliebte sich in einen anderen Genossen. Er fing an zu saufen. Nachdem die Wehrmacht in die Sowjetunion eingefallen war, drängte man ihn, in einer Widerstandsgruppe mitzuarbeiten. „Da hatte ich erst mal Todesangst… Mary war mutiger als ich… Ich hatte damals einen starken Radioapparat.“ Hellmann sollte Verbindung zu einem russischen Frauenlager in Eidelstedt aufnehmen: „Hab‘ ich auch gemacht.“ 1943 wurde er eingezogen – „praktisch (als) Kanonenfutter“.
Auf dem Rückzug wurde er drei Tage nach der Kapitulation von tschechischen Partisanen gefangengenommen. Den Gefangenentransport, in dem er sich befand, schickte man zum Arbeitseinsatz nach Sibirien. „In meinem Herzen war noch immer die Begeisterung der Jugendideale vorhanden: Stalin, der große Meister und Vater – eine Überfigur.“ Hellmann kam in ein Baulager bei Kisel, im Nordural. In seiner Brigade versuchte er zunächst die Jungen zu überreden, mit dem Rauchen aufzuhören. Die andauernde Lebensmittelknappheit veränderte ihn: „Mensch, du wirst ja zu einem Tier!“
Weil er in der KP gewesen war, holte man ihn aus einer Zimmermannbrigade und machte ihn zum Leiter eines Antifaschistischen Agitations-Aktivs. Er durfte das Lager verlassen und Baustellen besuchen. Der Lagerkommandant in Kisel war ein deutscher Hauptmann, er „stand auf der Seite des NKWD und war ein Leuteschinder: „…gegen diesen Mann bin ich aufgestanden. Ich bin aufgestanden gegen das System, und das System hieß nun Stalinismus… Mit meiner politischen Arbeit bin ich bei den Gefangenen ansonsten natürlich gescheitert.“
Wie bei allen deutschen Lagerberichten aus Sibirien weiß Tönnies Hellmann eine Reihe von Geschichten zu erzählen, in denen seine (privilegierte) Stellung es ihm ermöglichte, Mitgefangenen das Überleben zu erleichtern. Den russischen Lager-Erinnerungen, für die kein geringerer als Dostojewski die Maßstäbe setzte, ist so etwas in der ersten Person fremd. In ihnen geht es primär um das andere Ende der sibirischen „Prüfungs“-Skala, die Hellmann mit seiner „Tier-Werdung“ nur streift. Solschenizyn, dem die infantilen Westeuropäer „weder an Weisheit noch an Standhaftigkeit etwas zu bieten“ haben, würde ihn deswegen als „Gutdenker“ bezeichnen. Dazu gehört auch, daß Hellmann, wenn er an „kritische Punkte“ kommt, ins Deduktive umschwenkt – und die allgemeine Gefechtslage erklärt. Hellmann sollte in die DDR entlasen werden: „,Nein‘, habe ich gesagt, ,ich will zurück nach Westdeutschland‘.“
Mit ihm kehrten 300 Heimkehrer nach Hamburg zurück. Nervlich fertig muß er ins Krankenhaus. Seine Frau läßt sich von ihm scheiden. Er ist „am Ende“ – und wird psychotherapeutisch behandelt. Später findet eine Anstellung als Fahrer. Bis zum KPD-Verbot 1956 sitzt er dann in der Landeskontrollkommission. Einmal verhindert er den Ausschluß eines „Verräters“, der bei der Gestapo ausgepackt hatte, mit der Begründung, die jüngeren Genossen könnten sich nicht vorstellen, „was es bedeutet, gefoltert zu werden“.
Als 1968 die Partei – als DKP – neu gegründet wird, soll auch er wieder mit dabeisein, inzwischen hatte sich die KP Frankreichs jedoch – nach Solschenizyns Büchern über die sowjetischen Arbeitslager – von der „Diktatur des Proletariats“ verabschiedet. Tönnies Hellmann lehnt diese Konzeption nun ebenfalls ab. Und überhaupt hatte er „die Schnauze voll von Parteien“. Er heiratete erneut: Cecilie, und ging in Rente. Gegen seine Herzrhythmusstörungen empfahl ein Arzt ihm lesen und schreiben. Er kaufte sich eine Schreibmaschine – bei Quelle und abonnierte Die Zeit. Darin stieß er eines Tages auf einen Text über Heinrich Böll, dem er einen langen Brief schrieb. Von Böll ermuntert schrieb Hellmann bald auch anderen Prominenten Briefe, u.a. Helmut Gollwitzer, dessen allzu kritische Darstellung des sowjetischen Kriegsgefangenenlagers 20 ihm mißfallen hatte: „Ich war entsetzt… Das war doch ein Offizierslager bei Moskau – mit erhöhter Verpflegung.“ Neben den Lagerliteraturen (von Margarete Buber- Neumann und Karlo Stajner z.B.) wurden dem Altkommunisten Hellmann vor allem die Klassiker wichtig: Goethe, Heine, Puschkin, Tolstoi… In der Zeit las er Artikel von Marion Gräfin Dönhoff. „Also allgemein war in den Arbeiterkreisen eine ablehnende Haltung gegenüber dem Adel. Die haben gelacht, wenn ich das Wort ,Gräfin‘ sagte“. Nachdem er ihr einen Brief geschrieben hatte, lud sie ihn in die Redaktion ein: „Im Pressehaus habe ich vorsichtshalber schon am Empfang gefragt: ,Wie muß ich denn die Gräfin ansprechen?'“ Die Gräfin beauftragte einen Kollegen mit der Abfassung eines Artikels über Hellmann. Als der erschienen war, entstand daraus erneut „ein gewaltiger Briefwechsel“. Wegen seines Antistalinismus war er für viele seiner ehemaligen Genossen inzwischen zum „Arbeiterverräter“ geworden.
Für Hellmann begann der Umdenkprozeß bereits in den siebziger Jahren: mit dem Sibirienlagerbericht von Jewgenia Ginsburg „Marschroute des Lebens“ und den Büchern von Lew Kopelew, der zusammen mit Solschenizyn in einem privilegierten Intellektuellen-Arbeitslager bei Moskau inhaftiert war.
In einem österreichischen Verlag erschien soeben ein umfangreicher Sammelband mit rund zwei Dutzend Berichten von Kriegsgefangenen über sowjetische Lager: „Von Workuta bis Astrachan“. Trotz der grauenhaften Zustände in diesen Arbeitslagern kann von einer systematischen Vernichtungswut der Russen nicht die Rede sein, glaubt man den Schilderungen.
Auffallend viele Autoren erinnern sich jedoch voller Zorn an die deutschen „Antifas“. Einer fragt: „Wo sind diese Leute heute eigentlich? Haben sie sich vor Scham in Erdlöcher verkrochen?“ Zu Hellmanns Entlastung sei abschließend erwähnt, daß er eigentlich statt des dünnen Rowohlt-Studentenbändchens ein 700seitiges Erinnerungswerk abliefern wollte.
Dieser Wald ist viel zu voll
Was für die Intelligenz auf der einen Seite – in Paris etwa – die Angst vor dem weißem Papier ist, wurde auf der anderen Seite zur faszinierenden „weißen Wand“ – Sibirien als riesige Projektionsfläche. Selbst „Hollywood heads for Siberia“, vermeldete jüngst ein Film-Fachblatt. Während die einen wahre Horror-Szenarien von dort mitbringen: voller Kälte, Entbehrungen, Gulag-Resten, Altkommunisten, Mafiabanden, Umweltkatastrophen und Genozide, preisen die anderen Mensch und Natur, Baikalsee, Behring-Robben und Bodenschätze in den höchsten Tönen. Der Publizist Lothar Baier bedichtet den äußersten sibirischen Norden als „Arktisches Arkadien“, die FAZ titelt: „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft“.
Im Schnittpunkt all dieser Wunsch-Wahrnehmungen: „Nowosibirsk“, der geographische Mittelpunkt der ehemaligen Sowjetunion! Dieser noch immer real existierende Ort befindet sich westlich des Flusses Jenissei zwischen dem Öl- und Gaszentrum Nischniwartowsk im Südwesten und der Hafenstadt Dudinka im Nordosten. Er liegt am Fluß Tas im Heiligen Hain des kleinen Volkes der Selkupen. Hier beginnt der Film der Nenzin Anastasia Lapsui und des Finnen Markku Lehmuskallio. „Uhri – die Opfergabe“ unterscheidet sich wesentlich von den meisten anderen „Sibiriensia“ – erst einmal dadurch, daß die beiden Filmemacher es augenscheinlich nicht eilig hatten, schnell wieder in ihr gemütliches Zuhause zurückzukehren. Sie haben sich ordentlich Zeit genommen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber (vor allem in Sibirien) nicht, zudem Lapsui auch nach diesem „film about a forest“ noch Wert auf die Feststellung legt, daß die Taiga – der Wald – für Tundra-Nenzen eigentlich beunruhigend und unheimlich ist.
Alle sibirischen Völker glauben an eine beseelte Natur, den Nenzen beispielsweise ist der Wald „zu voll“. Aber sogar die Taiga-Selkupen am Fluß Tas schützen ihren fest bebauten Sommerplatz mit einem Holzzaun vor Waldgeistern, sie wollen „raus“ aus Sibirien.
Das Reinfinden dauert – und ist darüber hinaus ein dem Auge verborgener Vorgang. Denkbar schwierig für den Filmer also. Auch wenn er, wie Markku Lehmuskallio, weiß: „Wenn ich einen Moment filme, fühle ich, daß ich etwas Unsichtbares festhalte.“ Diese Schußversuche (im Englischen kommt das Filmen – Shooting – aus der Jägersprache) bedeuten, da es sich gezielt um eine Ethnographie von Jägern handelt, daß die Bild- und Tonschützen, die FilmemacherInnen, sich der Erfahrung einer „generationenübergreifenden Kontinuität“ vergewissern.
Immer wieder schauen sie dem Jäger und Fallensteller ins Gesicht und gucken, wie er in den Wald guckt, reinhorcht. Und so wie die Selkupen sich an ihren heiligen Plätzen für all das bedanken, was der Wald ihnen „gab“ – Elche, Auerhühner, Bären, Zobel, Hechte und andere Fische, dazu Beeren sowie Feuerholz – so ist auch dieser Film in gewisser Weise das Abtragen einer Dankesschuld: eine Gegen-„Gabe“, dessen einzelne Teile „Platzwechsel“, „Zivilisation“, „Freizeit“, „Eine Tragödie“ usw. heißen. Sie werden von Liedern zusammengehalten. Eins – über das Hosenflicken – singt die Selkupen-Mutter, während sie eine Hose flickt. Es geht so: „Ich lebe mit meinen leisen Liedern/ Mit leisen Liedern flicke ich die zerrissene Hose meines Sohnes/ Mein Sohn, der einem Schwan ähnelt/ Zerreißt immer wieder seine Hose/ So schnell, daß ich keine Worte dafür finde…“
Wir verstehen, was sie singt, aber was das Lied wirklich bedeutet, das wissen nur die Selkupen selbst – meint Markku Lehmuskallio. Es muß noch viel getan werden, um alle sibirischen Geheimnisse – wenigstens der Selkupen in der Mitte – zu verraten!
Mafia als neue Mitte
Gleich der erste soeben auf deutsch erschienene Band der russischen Krimiautorin Alexandra Marinina, „Auf fremden Terrain“, befaßt sich mit der Mafia – in einer Kleinstadt, wo sie mit der mafiösen Kommunalverwaltung sowie mit einer Rehaklinik-Verwaltung kohabitiert bzw. kollidiert. Der Aufklärer ist eine dort kurende Moskauer Milizionärin namens „Anastasija“. Auch die Autorin war bis vor kurzem noch ein Oberstleutnant der Miliz. Ihre ersten literarischen Arbeiten veröffentlichte sie in der Hauszeitung des Innenministeriums. Inzwischen verkauften sich ihre bisher 20 Krimis über 13millionenmal. Die Bestsellerautorin lebt nunmehr von ihrem Schreiben, ebenso ihr Agent Natan Sablozkis, der zuvor – im Dienst – ihr Vorgesetzter war.
Der Berliner Argon-Verlag hätte jedoch besser nicht gleich derart mit der Wurst zur Speckseite geworfen – und mit Marininas Mafia-Fall begonnen, denn eigentlich sind ihre Täter gerade keine der hierzulande ebenso beliebten wie gefürchteten russischen „Mafia-Typen“, sondern einfache Menschen – Mörder wie du und ich quasi: WK-Zwo-Veteranen, für den Polizeidienst Untaugliche und frustrierte Ex-Generäle… Der Spiegel zählte sie gerade alle auf, und trug damit das Seinige zum Erfolg der Krimis von Marinina – nun auch in Deutschland – bei. Nötig hätten diese es nicht. Denn die Autorin, die ihrem Alter ego Anastasija erlaubt, sich nebenbei noch mit Englischübersetzungen ein Taschengeld zu verdienen, zieht auch bei ihren restlichen Romansträngen alle angloamerikanischen Register. Diese Westanpassung macht ihre Bücher hier eher überflüssig – im Gegensatz zur sonstigen russisch-sowjetischen und postsowjetischen Bullenprosa, die wahrscheinlich einmalig ist, auch und gerade in ihrer wüstesten Romantik.
Bereits mit Beginn der modernen russischen Literatur, d.h. seit Puschkin, gibt es eine große Sympathie der Intelligenz mit den Kriminellen, denen auch das Volk zu keiner Zeit sein Mitgefühl entzog. Dadurch kam es zu ihrer ebenso fatalen wie falschen „Romantisierung“ – wie Solschenizyn meint. Mit der Revolution wurde daraus – mindestens bis in die fünfziger Jahre – eine Art Staatsdoktrin: Für die Avantgarde des Proletariats waren die Kriminellen als Subproletariat „Klassennahe“, während die (revolutionäre) Intelligenz bald zu den Klassenfeinden zählte. Die Folge war, daß sich die mit den Bolschewiki sympathisierenden Schriftsteller, wollten sie nicht verfolgt und vernichtet werden, auf die Seite des Staates und seiner Sicherheitsorgane schlugen. Gleichzeitig schafften es viele der übelsten Verbrecher, umerzogen, als KGB-Lagerwächter und sogar -Offiziere Karriere zu machen. Während Zigtausende von politischen Gefangenen in den Gefängnissen und Lagern noch hinter den debilsten Totschlägern rangierten.
Die Organe verfolgten nicht nur die Dichter und ihre Leser bis in die geheimsten Rezitationen – und schufen sich dafür einen entsprechenden (wissenschaftlichen) Apparat, sie sonnten sich und ihren revolutionären Eifer auch immer wieder gerne im Lichte großer Literatur. Außerdem fühlten sie sich auch immer wieder herausgefordert, ihren Alltag selbst schriftstellerisch zu „bewältigen“. Heraus kamen dabei schreckliche Sammelbände – mit Titeln wie „Schild und Flamme“, „Blumen und Stahl“, oder Tschekisten-Memoiren à la „Ein Leben in Gefahr“ (von Tewekeljan). Bis heute gibt es aber auch aller Ehren werte Schriftsteller, die einmal Wächter in irgendeinem Lager waren. Der leider gerade (in der amerikanischen Emigration) gestorbene Sergej Dowlatow („Die Unsren“) beispielsweise.
Seit der Entlassung der letzten politischen Häftlinge und der Reduzierung von Arbeitsplätzen besinnt man sich in Rußland wieder mehr auf den Resozialisierungsgedanken – derart, daß inzwischen ab einem bestimmten Dienstgrad jeder in einer Vollzugsanstalt Beschäftigte nebenbei noch Sozialwissenschaften bzw. Philosophie studieren soll. Mit der Folge, daß es inzwischen wohl nirgendwo so viele schreibende Uniform- und Geheimnisträger gibt wie in Rußland.
Dies ist auch Ausdruck eines anderen Verhältnisses von privat und öffentlich. So fiel einem KGB- Überläufer (Spezialist für Computercodes), den man 1994 in einer Münchner CIA-Siedlung versteckte, vor allem auf, daß sich dort die Amerikaner so benahmen, als würden sie alle normale Angestellte einer stinknormalen Firma sein, die sich abends mäßig im Hofbräuhaus oder in Schwabing amüsierten und morgens müde ins Büro schleppten. In der Sowjetunion legen die Organe dagegen nach wie vor eher Wert auf Isolation: Die Welt wimmelt von Spionen – was zusammen mit dem Verrat dann auch ein breites Genre wurde. Derzeit durchaus induktiv selbstaufklärerisch: So veröffentlichte unlängst ein anderer „Überläufer“, der Bruder des Regisseurs Nikita Michailkow, in München unter Pseudonym heiße „KGB-Insiderstories“ – auf deutsch.
Zwar gab es in der Sowjetunion stets von oben durchorganisierte Massenverhaftungskampagnen – gegen Bummelei und Hooliganismus etwa -, aber die kleinen quasi Einzelfälle waren ansonsten das tägliche Brot der Miliz (der Polizei). Zu Anfang – im Bürgerkrieg – wurden allerdings aus Kriminellen immer wieder konterrevolutionäre Banden – und umgekehrt. Auch und gerade die wachsame Miliz blieb von diesem „Paradigmenwechsel“ nicht verschont. Sehr schön schildert dies der sibirische Journalist Pawel Nilin, dessen Bücher „Ohne Erbarmen“ und „Der Kriminalassistent“ in den fünfziger Jahren auf deutsch erschienen: „Sozialistischer Humanismus mit Action“, wie es in einem Literaturlexikon heißt.
Ab Mitte der zwanziger Jahre entstand aus solchen – die Probleme der revolutionären Moral behandelnden – Miliz-Romanen parallel zu der von oben wieder zugelassenen Marktwirtschaft (Neue Ökonomische Politik – NEP – genannt) für einige Zeit so etwas wie ein eigenes Krimigenre. Seine Helden waren Schieber, Spekulanten, Zuhälter bzw. die diesen neuerlichen „Augiusstall“ säubernden Fahndungsbrigaden: Abschreckungsliteratur. Den Anstoß hierzu gab anscheinend Nikolai Bucharin, der in der Prawda 1923 wiederholt einen „roten Pinkterton“ gefordert hatte. Die Philosophin Marietta Schaginjan veröffentlichte daraufhin eine Groschenheftserie „MessMend oder die Yankees in Leningrad“. Die Cover-Collagen gestaltete Alexander Rodtschenko. Fast zeitgleich wurde Schaginjans Krimi in der deutschen Roten Fahne nachgedruckt, deren Leser jedoch über die chaotisch-ironische Destruktion des beliebten US-Kolportage-Genres durch die sowjetische Autorin not amused waren. Von ähnlich phantastisch-groteskem Kaliber war dann der Kollektiv-Krimi „Die großen Brände“, an dem sich 25 Autoren (u.a. Babel, Grin, Fedin, A. Tolstoi, Soschtschenko und Kolzow) beteiligten.
Spätere Krimischreiber siedelten ihre Handlung immer wieder in dieser guten alten Verbrecherzeit an. Beispielsweise der Komsomol- Funktionär Nikolai Sisow in: „Was soll ich mit einer Million?“ Der Roman erschien hier 1976, er beschwört die NEP-Gestalten wie Schatten der Vergangenheit herauf. Ebenso der 1978 in der DDR – in der Reihe „Spannend erzählt“ – veröffentlichte Roman „Der Schuß“ des jüngst verstorbenen Anatoli Rybakow. Wenn es um das kontemporäre Verbrechen ging, neigte man jedoch – schon bald nach der NEP – dazu, das Problem von Schuld und Sühne wieder losgelöst von allem Fahndungsdruck zu diskutieren. In „Die Abrechnung“ von Wladimir Tendrjakow bekennen sich z.B. alle Zeugen gegenüber dem ermittelnden Milizoffizier als „schuldig“ – um anstelle des jugendlichen Mörders bestraft zu werden!
Solche gleichsam ins Philosophische abdriftende Romane trugen dazu bei, im Westen die Meinung zu verbreiten, im Osten seien echte Krimis verboten, weil man dort davon ausgehe, mit dem Kommunismus werde jedwedem Verbrechen der Boden entzogen. Solschenizyn rühmte jedoch gerade Tendrjakow – vor allem wegen seines Romans „Drei, Sieben, As“, weil der es – vielleicht als einziger russischer Schriftsteller – verstanden habe, „erstmals einen Unterweltler ohne Anhimmelung und Rührseligkeit zu zeichnen und dessen innere Widerwärtigkeit aufzudecken“.
Mit der Perestroika rächte sich aus der Sicht des Volkes das „Bündnis“ der Bolschewiki und insbesondere des KGB mit den Kriminellen. Die im Zuge der Privatisierung eingeleitete Zweite NEP schuf in den neunziger Jahren mit den Neuen Russen, dem Busineß und der Mafia die realen Bedingungen für eine neue Krimikonjunktur. Von den in dieser Zeit entstandenen „Thrillern“ wurden viele sofort zu Bestsellern. Noch immer zeugen zahlreiche Spezialzeitschriften und TV-Sendungen von dem großen Interesse der Russen an allem Kriminellen. Die neue, jetzt gerade mit der ökonomischen Krise wieder eingestellte Literaturzeitschrift Puschkin widmete ihre letzte Ausgabe diesem Thema.
An erster Stelle wird dort der Krimiautor Daniil Koretzky (48) erwähnt, ihm gelangen bereits sieben Bestseller. „Der schreibende Oberst“ (bei der Miliz) ist noch immer im Dienst: Seine Romanideen fallen ihm beim Marschieren auf dem Exerzierplatz ein, behauptet er. Seine Plots gelten als „dynamisch, lebensnah“ und beweisen überdies „große Materialkenntnis“. Von seinen Büchern – beginnend mit „Antikiller“ 1 und 2 – verkaufte er bisher über 2 Millionen Exemplare.
Koretzky sieht sich dennoch weniger als Schriftsteller denn als „Diener des Systems“. Den Schriftstellern wirft er vor, sie würden nicht verstehen, was derzeit wirklich vor sich geht – draußen im Land! Da er z.B. davon ausgeht, daß inzwischen die russischen Bezirksgerichte sämtlichst von der Mafia kontrolliert werden, fordert er, die Armee solle die Kriminalprozesse führen – mit maskierten Richtern. Den Vorwurf der Kritik, sein Roman über die Todesstrafe – „Vollstreckung“ – sei allzu „kafkaesk“, konterte Koretzky resolut: „Nein, so ist das Leben!“
Auch der zweite von Puschkin porträtierte prominente Krimi- Autor Sergej Alexejew (45) ist quasi vom Fach: Er war Untersuchungsführer bei der Kriminalpolizei. Nachdem man ihn wegen Alkoholismus entlassen hatte, wurde er Schriftsteller. Seinen 700-Seiten-Schmöker „Der Schatz von Walkirij“, der sofort 50.000mal verkauft wurde, bezeichnete die Kritik als „philosophisch-ethnographischen Action-Roman“. Der Autor, der angeblich große Ähnlichkeit mit seinem Protagonisten hat, schuf damit einen „Kulturmythos à la Castaneda“. Die riesige Resonanz auf diese „Romantik“ war bisher echter Literatur vorbehalten, klagte Puschkin. Es geht darin um die Zukunft Rußlands, die von einer unsterblichen neuen Komintern, die sich in Ural-Katakomben fit hält, gesichert werden soll.
Zu Alexejews Lesungen erscheinen immer wieder Fans, die sich persönlich für die Walkirij-Auserwählten halten bzw. bereits in besagtem „Untergrund“ leben. Der Autor ist inzwischen selbst von dieser Realität zweiter Ordnung derart überzeugt, daß
er neulich schon auf dem Moskauer Flughafen mit Waffen und Munition im Gepäck verhaftet wurde.
Ähnlich erging es auch dem Philosophen Anatoli Koroljow (50), der angesichts der boomenden Krimiliteratur seiner Zeitschrift Snamja (Das Banner) vorschlug, auch einmal einen „Thriller“ zu schreiben. Gesagt, getan. Nur lehnte die Redaktion dann überraschend sein Manuskript – mit dem Titel „Thriller“ – ab. Koroljow suchte sich einen neuen Verlag. Er fand zwei merkwürdige, aber seriöse Geschäftsleute – mit einem Verlag, in dem bisher nur ein Buch erschienen war: über eine Makarow-Pistole! Kurz vor der öffentlichen Präsentation seines Thrillers fragten sie den Autor, ob er etwas dagegen hätte, wenn die Party in KGB-Räumen stattfände. „Nein, im Gegenteil!“ meinte Kariljow, der nun gespannt ist, ob – und wenn ja, wie – sein Krimi sich immer mehr in die russische Realität rein verlängert.
Der in Berlin lebende Schriftsteller Wladimir Kaminer meint: „Eine revolutionäre neue Ordnung zu schaffen, das ist schon immer eine genuin künstlerische Tätigkeit gewesen, und daraus erklärt sich auch die enge Verbindung zwischen Bolschewiki und Künstlern, seit Dscherschinski.“ Zu dem käme noch hinzu, daß die Miliz, generell alle „Menschen in Uniform“, in der Sowjetunion stets im „Mittelpunkt der Gesellschaft“ standen. Diese Leerstelle hätte nun die Mafia besetzt, der deswegen alle Aufmerksamkeit gelte. Dies könnte u.a. auch den Krimi- Boom erklären.
Angst vor den Volksfeinden
In „Sieben Lieder aus der Tundra“ erzählen Anastasia Lapsui und der Finne Markku Lehmuskallio vom Leben der Nenzen in nördlicher Schneelandschaft
Die Nenzen, früher Samojeden genannt, sind ein im Nordwesten Russlands sesshaft gewordenes Nomadenvolk. Die Nenzin Anastasia Lapsui und der Finne Markku Lehmuskallio haben schon viele Filme über ihre arktische Heimat zusammen gedreht. Zuletzt lief in der Forum-Reihe: „Uhri – Das Opfer“ – ein Dokumentarfilm über die Selkupen, die in der sibirischen Taiga jagen. Für die Regisseurin, deren Volk in der nahezu baumlosen Tundra lebt, ist der Wald „beunruhigend und unheimlich“ – und vieles war ihr bei den Selkupen unverständlich.
In ihrem neuen Film nun – „Seitsemän Laulua Tundralta“, „Sieben Lieder aus der Tundra“ -, der halb Dokumentar- und halb Spielfilm ist, sind viele ihrer eigenen Erfahrungen und Erinnerungen eingeflossen. Sie schrieb auch das Drehbuch. Markku Lehmuskallio merkte dazu an: „Die Nenzen haben keine professionellen Schauspieler, nur einfache Leute – Nomaden, Jäger und Fischer. Sie stellten uns ihre Zelte, ihre Rentiere, Boote und vor allem sich selbst und ihre Zeit zur Verfü- gung … Die Rolle des obersten Landwirts wurde vom obersten Landwirt gespielt, die des Lehrers von einem Lehrer – alle spielten sich selbst.“
So erzählt der Film die Geschichte ihrer Familien, ihre eigene Geschichte. Anastasia Lapsui erinnert sich an die Geschichte einer Sandbank im Fluss, wo noch heute einige Erdhöhlen und die Überreste eines Hauses zu sehen sind: Dort arbeitete bis zum Ende der Stalinzeit eine Frauen-Fischerbrigade. Sie galten als „Feinde des Volkes“ und kamen aus allen Republiken. Ihr Lager grenzte an die Hütte der Familie Lapsui. Sie fischten unmittelbar nebeneinander, hatten aber keinen Kontakt: Die Nenzen hatten Angst vor den so genannten Volksfeinden. Ein blondes junges Mädchen kam jedoch regelmäßig zu ihrer Hütte und setzte sich neben die Eingangstür. Sie schaute den Nenzen bei der Arbeit zu und weinte leise.
Diese ebenso schöne wie traurige Geschichte kommt jedoch in den „Sieben Liedern aus der Tundra“ nicht vor, obwohl der Film bis zur Kollektivierung der Landwirtschaft zurückreicht. Die Gesichter der Beteiligten sind eindrucksvoll, noch mehr die kargen Schwarzweiß-Szenen in der Schneelandschaft, die sich stets bis an den Horizont erstreckt – und der man anscheinend nur mit einem bis zum Äußersten konzentrierten Minimalismus gewachsen ist.
Die Kehrseite davon ist, dass dadurch die Gesamtgeschichte etwas Holzschnittartiges bekommt – insbesondere dann, wenn die Großgeschichte in die Lebensgeschichten der Einzelnen hineinspielt, sie bestimmt. Im Falle der Nenzen ist das: die Kollektivierung der Landwirtschaft und der Vernichtung der Kulaken, der Große Vaterländische Krieg, den einige von ihnen als Soldaten an der Leningrader Front erlebten, die Planerfüllungs-Zwänge ihrer Kolchose, die Verkörperung der Macht vor Ort sowie die Alphabetisierungskampagne, die für die jungen Nenzen eine Trennung von ihren Eltern bedeutet, da man sie in Internaten konzentriert.
Durch das Komprimieren dieser komplexen Großereignisse auf kurze Szenen bekommt der Film in seinen inszenierten Passagen etwas dumpf Antikommunistisches – dieses Märchenhafte tut ihm nicht gut. Erst recht nicht, wenn man weiß, dass die Regisseurin an einige dieser Ereignisse eine viel schärfere Erinnerung hat.
Singsang in Sibirien
Der Obertongesang Tuwas als Hotspot der internationalen Ethnoszene: Einige Überlegungen zum Film „Genghis Blues“ von Roko und Adrian Belic
Irgendwo in Amerika – in einem etwas heruntergekommenen Wohnviertel – sitzt ein blinder Blues-Sänger inmitten seiner Geräte und Musikstücke. Eines Tages hört er ein sibirisches Lied – von einem Obertonsänger aus Tuwa – im Radio. Wo ist das überhaupt: Tuwa? Und was ist das für ein seltsamer Gesang? Der schwarze Bluessänger namens Paul Pena bemüht sich, all das herauszubekommen. Er lernt in der Folgezeit sogar ein bisschen Tuwanisch und außerdem den Obertongesang. Seine Sehnsucht nach Tuwa wird derweil immer größer. Seine Freunde machen sich schon über ihn lustig: Ach Paul, du mit deiner Tuwa-Macke!, sagen sie. Dennoch nennen sie sich bald alle zusammen „Friends of Tuwa“. Es sind nicht unbedingt Loser, aber Winner erst recht nicht. Und deswegen brauchen sie sehr, sehr lange, bis ihr „Tuwa-Projekt“ steht. Im Kern besteht es darin, dass sie allesamt – als ein Filmteam – nach Tuwa fliegen und Paul Pena dort ein paar Obertonlieder zum Besten gibt, inmitten von einheimischen Sängern, die ebenfalls alle diese Art Gesang beherrschen.
Während ihrer Expeditionsvorbereitung passiert jedoch Folgendes: Überall in der westlichen Welt entdecken Filmemacher, Musiker und Globetrotter Tuwa. Nach dem politisch aufgeladenen Nicaragua-Run, dem menschenrechtlich totgerittenen Tibet und dem bereits völlig verwimwenderten Kuba ist Tuwa plötzlich der neue Hotspot. Tuwa – wo es noch mehr Pferde als Menschen gibt und wo „Yahoo!“ noch nicht triumphiert hat beziehungsweise nicht mehr triumphiert, seitdem die Sowjetmacht kollabierte. Die deutschen Kamerateams der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kennen bereits jeden Winkel und jedes Tal in Tuwa. Bednarz, Ruge, Riefenstahl und Rimski-Korsakow – alle haben sie schon da gedreht. Da gibt es ferner den verrückten Ami, der sich dort auf die Suche nach dem Grab Dschingis Khans machte – aber nichts als Hanffelder bis an den Horizont fand (auch gut). Dann den Tuwa-Dichter aus Leipzig, der eine Gruppe in der Mongolei arbeitslos gewordener Tuwaner zurück in ihre und seine Heimat begleitete. Dann einen Berliner, der jedes Jahr mit der Videokamera durch Tuwa reist. Den alljährlichen Tuwa-Stand auf der Internationalen Tourismus-Börse. Die zwei Künstlerinnen, die als Trekker dort unterwegs waren. Die Tochter eines Steglitzer Immobilienhändlers, die auf Tuwas kleine Pferde steht, ihr Bruder, der die dortigen Kamele lieber mag und so weiter.
Kein Wunder, dass der „Genghis Blues“, so heißt der Film über die Tuwa-Expedition von Paul Pena, bei der Berlinale erst einmal abgelehnt wurde: Inzwischen haben sie dort bereits eine Art Tuwa-Aversion entwickelt. Zudem ist der Film weniger eine Tuwa- als eine Pena-Expediton. Immer wieder wird gezeigt, wie er in der Tuwa-Hauptstadt – dem Mittelpunkt Asiens – auf dem großen Oberton-Gesangsfestival auftritt. Und sogar einen Preis einheimst. Es ist ein erfrischend dilettantischer Film geworden, der sich nicht scheute, die schönsten Bilder gleich drei-, viermal zu verwenden. Nur der Werbetrailer, der derzeit in den Kinos läuft, ist etwas irreführend: Man sieht vor allem Tuwa-Männer in historischen Kostümen, die auf schnellen Pferden über die Grasebenen sausen. Im wirklichen Film kommt so etwas nur am Rande vor – wie im wirklichen Leben im Übrigen auch.
Dafür ist die Kamera immer dabei, wenn Pauls Tuwa-Freunde ihm ein Ständchen an einem Fluss singen oder wenn sie ihn zu zweit auf die Bühne oder von der Bühne weg begleiten; oder wenn er unterwegs einer Gruppe von Arbeitern ein Tuwa-Lied singt – und die sich darüber sehr freuen. Der Film – und sein Trailer – ist so amerikanisch wie Apple-Pie. Und wir als Antiamerikaner können uns an seiner Machart nicht satt sehen. Außerdem macht es Spaß sich vorzustellen, wie dieser blinde Amerikaner – mit dem guten Gehör eines Musikers und einem Blindenstock ausgerüstet, der wie ein Minensuchgerät aussieht – dieses fremde Land bereist, in sich aufnimmt.
Natürlich gibt es Tuwa inzwischen auch im Internet – zigmal, und in Amsterdam einen Musikladen, der alle möglichen Cassetten und CDs mit Musik aus Tuwa im Angebot hat. Ich bekam von dort neulich eine Aufnahme mit Knastliedern aus Tuwa, die ich für eine SWF-Sibirien-Reportage verwendete. Der Redakteur, der anfangs noch nie etwas von Tuwa gehört hatte, sagte – als ich ihm das fertige Band schickte: „Musste das wirklich sein? Inzwischen wird hier im Sender sogar schon von der Sportredaktion nur noch Tuwa-Musik verwendet!“ Ich tat empört, musste ihm aber insgeheim recht geben: Dieser Tuwa-Trend hat bereits etwas Enervierendes, zumal dort ein Tal wie das andere aussieht – und alle von Bergen umgeben sind. Von denen die Obertonsänger tagaus, tagein ihr Liedgut schmettern.
Aber in Kuba tun sie auch nichts anderes als permanent Musik zu machen, und in Tibet beten sie rund um die Uhr – dalailamisch. Man muss da ja auch gar nicht hinfahren, es reicht, sich diesen merkwürdigen Tuwa-Film im Kino anzuschauen – und sich dabei sein eigenes „Expeditionsprojekt“ auszumalen: Tuwa gehört zu Sibirien. Und Sibirien ist eine einzige riesige weiße Projektionsfläche.
„Ein Ethos wie bei Solschenizyn“
Wie will Kurt Germann (54) leben? Der ehemalige Landkommunarde lebt jetzt im russischen Sibirien – in einem Vorort von Jakutsk, wo in der Nähe auch ein Kreuzberger Künstler immer wieder mal als Lehrer tätig ist. Germann will dort Waren so produzieren, dass der Widerspruch zwischen den Zielen des Produzenten und denen des Konsumenten aufgelöst wird.
taz: Die Fluchtrichtung der Hiesigen verläuft meist nach Süden, bei Ihnen ist es anders . . .
Kurt Germann: Ich habe mal ein paar deutsche Genossen in Indonesien besucht, die Anfang der Achtzigerjahre mit einer auf Java selbst gebauten Dschunke namens „Tunix“ unterwegs waren. Nun waren sie in Jakarta geschäftlich tätig geworden und kultivierten einen halbkolonialen Lebensstil.
Das kann man heute auch im sibirischen Jakutsk, wo Sie heute leben.
Vor der Revolution gab es hier schon hunderte von Genossenschaften, Artels. Das kommt jetzt alles wieder. Der Vorteil der Kälte ist, dass die Leute enger zusammenarbeiten. Und dass sie wegen der monatelangen Dunkelheit viel lesen. Deswegen ist ihnen hier auch der Gedanke nicht fremd, dass man sein Brot anders als mit Warenproduktion verdienen kann.
Steht die Warenproduktion denn dem wirklichen Leben im Weg?
Die Frage zielt auf den Kern der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie, der nach Meinung vieler falsch ist.
Können Sie diesen Kern kurz zusammenfassen?
Es geht dabei um das kapitalistische Wertgesetz, dass die Unternehmen zwingt, ständig die „organische Zusammensetzung des Kapitals“ zu verändern. Das heißt: Sie stehen unter dem Zwang zur „Rationalisierung“ – um die Produktivität zu steigern. Da der Vernutzung der Menschen dabei Grenzen gesetzt sind, tritt an die Stelle des „absoluten Mehrwerts“ der so genannte „relative Mehrwert“ in den Vordergrund der abstrakten Gewinnproduktion. Marx nannte es die „steigende organische Zusammensetzung des Kapitals“.
Das heißt?
Er bezeichnete damit den Zwang zur Erhöhung des relativen Anteils von Sachkapital gegenüber der menschlichen Arbeitskraft. Dieser Prozess ist nicht schrankenlos: Die moderne, betriebswirtschaftliche, auf abstrakte Gewinnmaximierung ausgelegte Produktionsweise lässt sich nicht unendlich ausdehnen. Denn wenn der ökonomische „Wert“, der sich in der Form des Geldes „darstellt“, weder eine Naturtatsache noch ein vertracktes „Ding“ ist, sondern eine, nach Marx „fetischisierte“ gesellschaftliche Beziehungsform, dann ist es allein die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, durch die „Wert“ entsteht, während das Aggregat des Sachkapitals nur „Wert überträgt“ . . .
Womit also nicht allein die Arbeit wertschaffend ist – und letztlich die auf dem „Wert“, das heißt auf dem zum System gewordenen Geld beruhende Warenproduktion an sich selbst erstickt. Tut sie aber noch nicht . . .
Doch! Absolut immer mehr Produkte repräsentieren immer weniger ,Wert‘, und die Zusammenbrüche dieser Wirtschaftsweise sehen wir an allen Ecken und Enden, das heißt Peripherien. Darum geht es aber gar nicht.
Sondern?
Was wir in Sibirien versuchen, ist der Aufbau einer andersartigen Produktion. Bisher war es so, dass man als Produzent mit möglichst wenig Arbeit viele Produkte zu einem hohen Preis herstellen wollte bzw. musste, während man als Konsument an billigen und guten Waren interessiert war. Das galt auch für den Sozialismus, wo man ebenfalls Waren produzierte. Nur die Unternehmerfunktion war ja verstaatlicht. Während der Kapitalismus den Produzenten jetzt in Billiglohnländer abschiebt, hat der Sozialismus permanent den Konsumenten gedemütigt. Diesen Widerspruch wollen wir im Oblast Jakutsk praktisch lösen.
„Geh nach Sibirien, junger Mann, dort wachsen dir die Gürkchen ins Maul“, riet Gorki einem Arbeitslosen. Heute zieht die Arbeitslosenkarawane von Sibirien gen Westen.
Das ist nicht nur schlecht. Jetzt gehen all die, die sich für die Konsumentenseite entscheiden, die endlich anständig was verdienen und sich dann ebenso anständig was dafür kaufen wollen.
Der israelische Kibbuz zeigt, wie schnell eine alternative Produktion vom konsumistischen Umfeld aufgesogen wird – bis hin zur Beschäftigung von Fremdarbeitern, die nicht selten aus Russland kommen . . .
Dies ist nicht weniger ein Scheitern als der normale Geschäftsbankrott. Ich gebe hierbei zu bedenken, dass dieser auf Holländisch „schoonop“, Reinigung, heißt. In anderen Worten: Man ringt sich zu größerer Klarheit durch. Letztendlich braucht man eine andere Technologie, die mit dezentral nur unzulänglich umschrieben ist, für diese nachkapitalistische Gebrauchswertproduktion.
Das klingt nach Handwerksethos.
Ja, etwa so wie das Loblied, das Solschenizyn seinen „Iwan Denissowitsch“ im Gulag auf die „anständige Arbeit“ anstimmen lässt. Diesen Arbeitsethos gibt es aber schon länger in Sibirien – es kamen ja in der Vergangenheit nicht nur die Zwangsarbeiter hierher, sondern vor allem frei Siedelnde, was „auf dem Festland“ – in Russland nicht möglich war. Die, die man zuletzt mit Vergünstigungen anlockte, sind es jetzt auch, die wieder gehen – seitdem die Vergünstigungen nach und nach weggefallen sind.
Was ist mit denen, die blieben?
Die fangen an, sich hier zu engagieren – wenigstens in den Fabriken. Hier wird dauernd irgendwo gestreikt. Die Aktivisten der neuen autonomen Gewerkschaften sprechen von einer „Doppelherrschaft“, die sie aufrecht erhalten wollen, wenigstens gilt das für Ostsibirien. Auch da, in der Organisationsarbeit, geht es oft um reine oder kleine Gebrauchswerte. In Ostfriesland, wo ich herkomme, nennt man das Nachbarschaftshilfe.
Sibirien im deutschen Fernsehen
Sibirien ist ein riesiges Zeitreservoir, meinte Heiner Müller. Dies gilt vor allem für deutsche TV-Produktionen: Noch jeder Moskaukorrespondent hat zu Weihnachten eine mehrteilige Sendung über Sibirien produziert – inklusive Buch. Die Amis sind aber auch fasziniert von Sibirien – und die Hauptkunden der russischen Veranstalter für „Gulag Travel Tours“.
Sogar das französische Arbeitsamt finanzierte einem Arbeitslosen 2001 eine filmische Reise von Jakutsk nach Kolyma. Aus Deutschland düsen vor allem Künstler im Kulturauftrag durch Sibirien. Hier gilt es, den einstigen Horrorort systematisch umzudeuten zu einer positiven Utopie. Auf dem Höhepunkt der Kampagne erfand ein Künstler für eine Berliner Ausstellung sogar ein neues Sibirienvolk.
Den Höhepunkt aller Gruselgeschichten von dort bildete in den Sechzigerjahren die „Straßenfeger“-TV-Serie „So weit die Füße tragen“. Den Niedergang erlebte dieses Genre Anfang der Neunzigerjahre mit dem Roman „Siberian Light“, in dem ein Erdölingenieur mit Hilfe von Greenpeace und Internet einem US-Konzern auf die Spur kommt, der in den Gulag-Resten unverbesserliche US-Gefangene, vornehmlich Schwarze, unterbringt.
Tatsächlich gibt es bereits einige von Deutschen geleitete Reha-Camps in Sibirien, in denen Neonazis „umgeschult“ werden. Außerdem jede Menge deutscher Missionsstationen, in denen durch den Kommunismus wieder verheidnischten „Sibirjaken“ rechristianisiert werden.
Da es in einigen Teilen Sibiriens einen großen Arbeitskräftemangel gibt, hat der Gouverneur des Oblast Swerdlow in Berlin unlängst alle Russlanddeutschen, die hier keine Arbeit finden, aufgefordert, nach Sibirien zu ziehen – sie wären dort hochwillkommen. 56.000 haben sich angeblich bereits bei ihm gemeldet. Auch die EU wird eines Tages wohl darauf kommen, alle Arbeitslosen nach Sibirien zu expedieren – mit einer besonders geförderten „Weißen Ich-AG“ womöglich, die bei Bedarf in eine Festanstellung auf einer sibirischen EU-Großbaustelle umgewandelt werden kann.
Das ZDF strahlt heuer dazu zur besten Sendezeit und rechtzeitig zu Weihnachten eine Art „Big Brother in Sibirien“ aus. Dafür hat man zwei Ehepaare aus Bayern und aus Sachsen auf eine Insel im Baikalsee – mitten in ein Dorf – ausgesetzt. Sie müssen dort überleben, sind hierfür aber gut ausgerüstet worden: von einer Kuh über eine Axt bis zum Deutsch-Sibirischen Wörterbuch. Eines der Ehepaare hat neben der Selbstversorgung noch Jobs im Dorf angenommen: Er arbeitet als Schreiner und sie, die gelernte Krankenschwester, veranstaltet für Kinder Deutschkurse, den Erwachsenen bietet sie Massagen an.
Die beiden sind die Pioniere des neoliberalen Medienzeitalters. „Geh nach Sibirien, junger Mann, dort wachsen dir die Gürkchen ins Maul,“ riet Maxim Gorki bereits 1906 einem jungen Arbeitslosen – und veröffentlichte das Gespräch mit ihm anschließend. In Deutschland dagegen ließ Carolin Reiber in einer ZDF-Seniorenquizsendung noch den Namen „Balalaika-See“ durchgehen – als Heimat des stets gut gelaunten Chors der Wodka-Kulaken!?
Sibirien,mon amour
Das ZDF hat erneut von einigen hundert Ehepaaren zwei – aus Ost- und Westdeutschland – ausgewählt, um sie für mehrere Monate nach Sibirien zu schicken: als Pioniere einer neuen Ostlandbesiedlung. Bei der letzten wurden dort mithilfe der Wehrmacht überall deutsche Arbeitsämter eingerichtet, um für die hiesigen Betriebe Sklavenarbeiter einzufangen. Demnächst werden jedoch umgekehrt die deutschen Arbeitsämter ihre „Kunden“ nach Sibirien vermitteln, wo dringend Arbeitskräfte gebraucht werden: Die Idee geht auf Walther Rathenau und die KPD zurück.
Zuletzt veröffentlichte 2003 ein westsibirischer Gouverneur einen solchen „Aufruf“ in deutschen Zeitungen. Zur selben Zeit hatte das ZDF bereits zwei Ehepaare für sechs Monate – nahezu auf Selbstversorgungsbasis – in einem Dorf auf einer Insel im Baikal ausgesetzt, also im sonnigen Südsibirien. Nun geht es in der Permafrostregion Nordwestsibiriens weiter, auf der Halbinsel Jamal oberhalb der Ob-Mündung. Die dritte TV-Sibirien-Expedition 2005 wird ihre Protagonisten wahrscheinlich noch weiter ab nach Kamtschatka verfrachten.
Das ZDF hat jedoch bereits dazugelernt: Die beiden Ehepaare bleiben nur drei Monate auf Jamal, bekommen mehr Geld und sind sprachkundig. Es handelt sich dabei zum einen um die Familie Rabe aus Schleswig-Holstein: Er ist Arzt und sie Steuerberaterin, er hat drei und sie zwei Kinder aus erster Ehe. Während er als Russlandkenntnis nur seine Begeisterung für den Film „Dr. Schiwago“ mitbringt, hat sie einst als DDR-Ökonomin drei Jahre in Kiew studiert. Vom Sibirienabenteuer erhofft sie sich ein „Zusammenwachsen“ ihrer Ost-West-„Patchworkfamilie“. Das andere Ehepaar – Stute – stammt aus Sachsen-Anhalt und hat eine Tochter: Er ist Landwirt und sie Arbeitsamts-Sachbearbeiterin (!), beide verstehen etwas Russisch.
Da einige der Kinder im Dorf Jarssalei, in dem die zwei Familien untergebracht sind, auch zur Schule gehen müssen, hat das ZDF ihnen vorab einen Russischkurs verpasst. In Jarssalei kümmert sich überdies ein Nenze, Kyril, der eine Fleischvermarktungsfirma hat, um die beiden Familien. Er fährt mit ihnen der Abwechslung (und der Bilder) halber zu seinen Verwandten, die als Rentierzüchter in der Tundra leben.
Dort müssen die Deutschen in Zelten leben, auf die Jagd gehen und angeln. Ansonsten arbeitet der Arzt in der Klinik von Jarssalei und seine russischkundige Frau assistiert ihm, während der Landwirt auf der örtlichen Sowchose arbeitet und seine Frau in einer Kita. Die Sowchose zahlt so gute Löhne, dass im Sommer sogar Saisonarbeiter aus Moldawien und der Ukraine hier jobben.
Die beiden deutschen Ehepaare sind in wunderbaren alten Holzhäusern untergebracht, die jedoch allen modernen Komfort wie Zentralheizung, Spülklos und Bäder haben. Die Wohnungen gehören zwei Nenzen-Familien, die in dieser Zeit bei ihren Rentierherden in der Tundra leben. Jarssalei, das man per Schiff über den Ob oder per Hubschrauber von Workuta aus erreicht, ist ein reiches, schönes Dorf, in dem es alles gibt, was man braucht, und seine Schule mit Internat (für die Nomadenkinder) ist materiell weitaus besser als jede deutsche Schule ausgestattet – und pädagogisch sowieso. Außerdem scheint es das leidige Alkoholproblem wie sonst in den Nordmeerregionen nicht zu geben.
Den Nenzen sieht man an, dass sie sich, zumindest in der Vergangenheit, mit allen möglichen Russen vermählt haben. In der DDR wurden sie bekannt über das „Jamburg-Abkommen“, mit dem, nach dem Röhrenembargo des Westens, die Beteiligung der sozialistischen Bruderländer an einer Erdgastrasse vom Mittleren Ob bis nach Berlin geregelt wurde. Diese Trasse hat man dann bis zum „Jamal-Feld“ nach Norden verlängert: Wir kochen hier also alle mit nenzischem Gas!
Neuerdings ist das kleine sibirische Volk vor allem durch die Filme der Nenzin Anastasia Lapsui und des Finnen Markku Lehmuskallio bekannt geworden, die jedes Jahr eine neue Dokumentation auf der Berlinale präsentieren. Über die Burjaten, die am Baikalsee siedeln, unterrichtet uns das deutsche Fernsehen durch seine Moskaukorrespondenten, die sich im Sommer noch stets auf Sibirien-Tour begeben haben. Und Kamtschatka kennt man aus dem Haus der Kulturen der Welt.
Die ZDF-Jamal-Expedition endet im November, bisher sind zwei von vier Folgen abgedreht, die Serie wird wahrscheinlich wieder um Weihnachten ausgestrahlt werden: als schöne Bescherung und zur allgemeinen Belehrung!
Ein Bericht von Ekaterina Beliaeva, die kürzlich enttäuscht von Berlin wieder zurück nach Russland ging:
Ende des Jahres fand in Berlin ein „internationaler Kongress der russischsprachigen Presse“ statt, zu dem man den Gouverneur des westsibirischen Oblasts Swerdlowsk (Jekaterinburg) als Ehrengast geladen hatte. In seiner Rede forderte Eduard Rossel alle Russlanddeutschen, „die ja auch Deutschrussen, sind, also Söhne und Töchter von zwei großen Kulturen“, auf: Wenn sie hier nicht das gefunden hätten, wovon sie träumten, sollten sie nach Russland zurückkehren: „Bei uns gibt es genug Platz und Aufgaben für euch alle!“
Der Gouverneur versprach ihnen außerdem Unterstützung bei der Arbeitsfindung sowie beim Grundstückserwerb oder bei der Haus- und Wohnungssuche. Auch ihre Einbürgerung wolle man beschleunigen. Die meisten deutschen Spätaussiedler hatten zuletzt kasachische Pässe. Die Einladung des Gouverneurs sprach sich auch sofort in Kasachstan unter den dortigen Russlanddeutschen herum.
Seine Rede wurde in der Moskauer Regierungszeitung Rossijskaja Gazeta und hier in der Wochenzeitung Russkaja Germanija/Russkij Berlin nachgedruckt. Anfang des Jahres war aus dem Amt des Gouverneurs zu erfahren, dass bereits 54.000 Russlanddeutsche ihr Interesse an einem Neuanfang im Mittleren Ural bekundet hätten und ein spezielles Amt dafür eingerichtet worden sei.
Der Oblast Swerdlowsk, etwa so groß wie die BRD, hat nur fünf Millionen Einwohner, ist aber eine prosperierende Industrie- und Bergbauregion – fast ohne Arbeitslosigkeit. Deswegen gibt es dort laut Rossel vor allem einen „Kadermangel“. Obwohl die Russlanddeutschen sich in Kasachstan und Deutschland als „Menschen zweiter Klasse“ fühlen, wird bezweifelt, dass wirklich 54.000 ihr Interesse an Sibirien bekundet haben. Eher würden sie – zumindest die in Kasachstan lebenden Russlanddeutschen – nach Deutschland ziehen beziehungsweise weitere Verwandte von dort nachholen.
Dies wird ihnen jedoch von der deutschen Regierung zunehmend erschwert. So klagt zum Beispiel Alexander Fitz, ein in München lebender Journalist und Autor des Buches „Puteschestwije na semlu“ über die Geschichte der Russlanddeutschen: „Nicht nur werden die Sprachtests immer schwieriger und die Bearbeitung der Übersiedlungsanträge dauert immer länger, auch die deutschen Medien zeichnen vielfach noch ein negatives Bild von den Russlanddeutschen.“
Seit dem 13. März hat der Aussiedlerbeauftrage der rot-grünen Regierung, Jochen Welt, jedoch wieder einen kleinen Schritt auf die Spätaussiedler zu getan: Er spricht jetzt nicht mehr von ihren „nichtdeutschen Verwandten“, sondern von „Familienmitgliedern, die nicht verpflichtet sind, deutsche Sprachkenntnisse nachzuweisen“.
Nach Abdruck der Rede des Swerdlowsker Gouverneurs Rossel hatte die Redaktion der Ruskaja Germanija/Russkij Berlin viele Leserbriefe von Russlanddeutschen bekommen: sowohl aus Deutschland als auch aus dem ehemaligen asiatischen Sowjetrepubliken. Eine in Bernau lebende Familie schrieb, dass sie vor ihrer Spätaussiedlung als wissenschaftliche Mitarbeiter in der Ukraine gearbeitet hätten. Hier bekämen sie nun leider zu spüren, dass „ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Arbeitskraft“ niemand haben will. Deswegen sei das Angebot aus Jekaterinburg für sie attraktiv.
Zwei in Usbekistan lebende Ehepaare, deren Männer beide als Lokomotivführer beschäftigt sind, schrieben, sie seien zwar ohne Zweifel deutsch, hätten aber die Sprachprüfung nicht bestanden. Sie könnten deswegen nicht nach Deutschland emigrieren. Weil die Lebensbedingungen in Usbekistan aber immer schwieriger würden, überlegen sie nun, in den Ural zu ziehen. Auch ein Russlanddeutscher aus Neustadt begrüßte die „helfende Hand des russischen Gouverneurs in dieser schweren Zeit“ – zumal die deutschen Behörden für die überallhin versprengten Russlanddeutschen das Tor fast zugemacht hätten.
Es gibt aber auch viele kritische Stimmen, die die Rede des Gouverneurs Rossel für eine bloße PR-Aktion in seinem Wahlkampf halten. Oder für einen Dreh, um an Fördergelder – sowohl aus Berlin als auch aus Moskau – heranzukommen.
Die Russlanddeutschen sind auch deswegen skeptisch, weil sie nicht erst seit gestern als „Manövriermasse“ missbraucht werden: Einst als Siedler nach Russland eingeladen, wurden sie dort spätestens seit dem Ersten Weltkrieg in Schüben als fremde Gefahr immer weiter nach Osten verschoben und enteignet. Dabei kamen fast eine halbe Million Menschen allein zwischen 1941 und 1956 um.
Seit der Perestroika sind, umgekehrt, 1,5 Millionen Spätaussiedler aus der Sowjetunion nach Deutschland gezogen: allein aus Kasachstan 700.000, wohin gleichzeitig 30.000 Kasachen aus der Mongolei reemigrierten.
Der Botschafter Kasachstans in Deutschland, Wjatscheslaw Gisatow, bedauert den Aderlass an fleißigen Deutschen: „Wenn sie zurückkehren wollen, wird Kasachstan sie mit offenen Armen empfangen“, verspricht er. Jährlich kommen etwa 50.000 Ausgewanderte als Besucher zurück. Kasachstan fördert diese Verbindungen und will es ihnen erleichtern, Visa zu erhalten und Geschäfte anzubahnen. Sowohl der kasachische Botschafter als auch der westsibirische Gouverneur setzen auf den eurasischen Wirtschaftsraum. In ihm könnten die Russlanddeutschen die Funktion eines Transmissionsriemens zwischen West und Ost wahrnehmen.
Zuvörderst empfinden viele Russlanddeutsche diese Aufgabe aber oft noch als Zumutung. Sie sitzen auf den Umschulungsbänken, und man erwartet von ihnen, dass sie sich hier sofort integrieren. Dazu bräuchte es jedoch Arbeitsplätze, die es für sie am allerwenigsten gibt. Dennoch: Unter allen Ausländergruppen haben die Russlanddeutschen inzwischen die geringste Arbeitslosigkeit.
Mit den überraschenden Offerten aus Kasachstan und Sibirien beginnt vielleicht ein neues Kapitel in der Geschichte der Russlanddeutschen – jetzt nicht mehr als altschwäbische Siedler, sondern als neue eurasische Nomaden. „Wir brauchen die Russlanddeutschen, die schon immer ordentlich gewirtschaftet und sich durch soziale Stabilität sowie psychische Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet haben“, meint Eduard Rossel. Und Wjatscheslaw Gisatow ergänzt: „Wir sind ihnen dankbar für ihren Beitrag für die wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung Kasachstans“.
Die sibirischen Aluminiumkriege (von Wladimir Kaminer):
Vor 20 Jahren war der Schriftsteller Limonow in Russland sehr populär. Er war einer der ersten Russen seiner Generation, die Amerika in den Augen der Intellektuellen entlarvt hatten.
Der junge Limonow war Anfang der Siebzigerjahre aus der Sowjetunion, dem „Reich des Bösen“, ausgewandert und landete zusammen mit seiner schönen Frau auf Umwegen in New York. Dort wohnte der junge Dichter mehrere Jahre in einem Wohnheim, nackend kochte er seine Kohlsuppe auf dem Balkon, stritt sich mit Puertorikanern und anderen Minderheiten und schuftete mal als Möbelträger und mal als Tellerwäscher bei McDonald’s, um sich über Wasser zu halten. Irgendwann verließ ihn seine schöne Frau, seine einzigen Freunde waren ein paar Penner und Psychopathen, die genau wie er von der Stadt New York verschluckt worden waren.
In diesem amerikanischen Alptraum schrieb Limonow seinen ersten Roman: „Fuck off, Amerika“ – eine bittere Abrechnung mit dem Land der Träume. Der Held des Romans läuft durch die nächtlichen Straßen und schreit vor Einsamkeit und Frust: „Nimm mich, Amerika! Was soll ich noch tun, damit du mich endlich bemerkst? Ich bin es doch, Limonow!“ In jener Nacht wird er von einem großen schwarzen Mann in einem Sandkasten vergewaltigt.
In Amerika fand Limonow keinen Verleger für sein Manuskript. In Russland wurde es zu einem großen Erfolg. Besonders bei den russischen Jugendlichen kam Limonow gut an. Obwohl sie nie in Amerika gewesen waren, konnten sie sich mit dem Helden identifizieren. In kürzester Zeit wurde Limonow berühmt, sein Buch verkaufte sich gut. Dann kehrte er nach Russland zurück. Als neues Enfant terrible der russischen Literatur erntete er allgemeinen Respekt – und wusste nichts damit anzufangen.
Am besten gefiel Limonow die Rolle des einsamen Helden, des nach Anerkennung schreienden, ausgestoßenen Engels mit dämonischem Blick. Es gelang ihm aber immer weniger, diese Rolle auszufüllen. Die Zeiten der Kohlsuppen auf dem Balkon waren vorbei. Limonow wurde immer dicker. Frustriert ging er wieder auf Reisen und besuchte seinen ehemaligen Unterschlupf in New York. Von dort war er früher fast jede Nacht durch die gefährlichsten Abschnitte des Central Park gelaufen und hatte vor nichts Angst gehabt, weil er nichts zu verlieren hatte. Nur ein scharfes Messer steckte in seiner Hosentasche. Er wurde dort jedoch niemals angegriffen.
Nun, 29 Jahre später, unternahm er noch einmal einen Nachtspaziergang durch den Central Park. Er wollte es sich beweisen. An der Stelle des Messers befand sich nun eine Brieftasche. In Sekundenschnelle wurde Limonow von irgendwelchen dunklen Nachtgestalten zusammengeschlagen und ausgeraubt. Er kehrte daraufhin wieder nach Russland zurück und suchte sich dort neue Aufgaben.
Er ging in die Politik, gründete die National-Bolschewistische Partei und heiratete mehrmals. Mit seinen Anhängern, romantisch eingestellten jungen Männern, reiste er überall hin, wo es Krieg gab – nach Serbien, Mittelasien und in den Kaukasus. Gleichzeitig schrieb er weiter Texte und sogar Gedichte, obwohl er seinen Anhängern immer wieder zu verstehen gab, die Literatur interessiere ihn nur noch als Möglichkeit, um die Partei zu finanzieren.
Als Politiker zeigte sich der Schriftsteller Limonow ultraradikal. „Die Jungen und Rücksichtslosen erobern die Welt, unser Hass ist unsere beste Waffe im Kampf gegen die verlogene kapitalistische Gesellschaft!“, skandierte er auf Kundgebungen und Parteiversammlungen, die aber schlecht besucht waren. Die Erniedrigten und Beleidigten Russlands – die Bauern, Rentner und Bergarbeiter – trauten Limonow nicht. Bei den letzten Regionalwahlen bekam er 0,0015 Prozent der Stimmen. Er heiratete zum fünften Mal – seine neue Frau war dreißig Jahre jünger als er, der mittlerweile auf die sechzig zuging. Er wollte für immer der junge Eduard aus dem Buch „Fuck off, Amerika“ bleiben und ein heldenhaftes Leben führen, konnte aber seinem eigenen Werk immer weniger gerecht werden. Seine Odyssee endete jetzt erst einmal ziemlich dramatisch – im Knast.
Er wollte sein neues – das 27. – Buch über den Geschäftsmann Anatoli Bikow schreiben, den ehemaligen Generaldirektor des größten Aluminiumkombinats von Sibirien. In ihm sah Limonow die Zukunft Russlands. Der Schriftsteller fuhr nach Krasnojarsk, um über seinen Helden zu recherchieren. In dem wildkapitalistischen Giftnebel des russischen Geschäftslebens war Bikow zweifelsohne für viele ein heller Stern – eine echte sibirische Legende. Er fing spät an. Die spontane wirtschaftliche Privatisierung in Russland Anfang der Neunzigerjahre war schnell in einen Krieg ausgeartet: Auf der einen Seite waren es die ehemaligen Betriebsdirektoren, die ihre eigenen Fabriken privatisieren wollten und sich dafür selbst Kredite bewilligten, sowie auch die regionalen Parteibonzen und Polizeichefs, die alle Businessmen werden wollten. Auf der anderen Seite kamen die Kriminellen – „Blauhäute“ in Russland genannt wegen ihrer Ganzkörper-Tätowierungen. Die beiden Parteien verknäulten sich ineinander. Im sibirischen Krasnojarsk brach 1991/92 der erste Aluminiumkrieg aus – es ging um hunderte von Millionen Dollar, denn Aluminium war ein Exportartikel der Extraklasse.
Anatoli Bikow blieb damals zunächst noch außen vor. Er arbeitete als Sportlehrer in einer Schule seiner Heimatstadt Nasarowo, die eigentlich nur ein Kohlenschacht war – in der Nähe von Krasnojarsk. Dort kümmerte er sich um die Jugendlichen und organisierte einen Boxklub, damit sie nicht beschäftigungslos auf der Straße herumhingen. Viele seiner Freunde fuhren regelmäßig nach Krasnojarsk, um dort Geschäfte zu machen, er aber blieb Sportlehrer.
Einmal beklagten sich ein paar Kumpel bei ihm über all die Probleme, die ihnen in der großen Stadt zu schaffen machten – die Blauhäute wollten partout Schutzgelder aus ihnen rauspressen. Bikow versprach zu helfen. Er fuhr mit seinen Boxjungs nach Krasnojarsk, traf sich mit den Kriminellen und klärte sie darüber auf, dass sie keine Chance gegen seine durchtrainierte Truppe hätten. Danach mieden diese Bikows Freunde nach Möglichkeit. Wenig später erzählte schon jeder zweite Geschäftsmann in der Stadt stolz, er arbeite mit Bikow zusammen.
Bikow zog nach Krasnojarsk. Die Miliz und die Kriminellen mussten ihn notgedrungen in ihre Gesellschaft integrieren. Sie wählten ihn sogar zu ihrem Schiedsrichter. Doch mit dieser Rolle gab sich der ehemalige Sportlehrer bald nicht mehr zufrieden, nachdem er begriffen hatte, dass die Direktoren und Milizchefs genau wie die Blauhäute sich nur um ihre Gewinne sorgten. „Warum müssen es immer nur solche Leute sein, die in unserer Region das Sagen haben?“, dachte sich Bikow. Er baute seine Boxerschule in Krasnojarsk weiter aus und stieg selbst ins Aluminiumgeschäft ein.
Es begann ein zweiter Aluminiumkrieg: Diesmal schienen die sibirischen Kriminellen die Verlierer zu sein, einer nach dem anderen wurde ermordet: Den „Schnurrbart“ erwischte es vor seinem Haus, der „Schrille“ wurde mit seinem Mercedes in die Luft gesprengt, der „Gestreifte“ wurde im Bett erstochen. Innerhalb von einigen Monaten waren zwei Dutzend kriminelle Autoritäten weg vom Fenster. Nur einige ganz große, wie Pascha Lichtmusik, überlebten.
In der Stadt war man fest der Meinung, dies alles wäre allein Bikows Verdienst. Doch er selbst sagte dazu nichts. Aber schon bald hatte er genügend Aktien des Aluminiumkombinats in seinem Besitz, um Vorsitzender des Aufsichtsrates zu werden. Gleich anschließend verscheuchte er auch noch die amerikanischen Investoren, alles ehemalige Russen, die das Kombinat kaufen wollten. So wurde er zum Alleinherrscher von Krasnojarsk und zum Robin Hood Sibiriens.
Als Erstes baute Bikow in Krasnojarsk eine orthodoxe Kirche sowie eine Moschee und eine Synagoge, dann eröffnete er ein neues Waisenhaus, eine Schule für begabte Kinder, mehrere Sportvereine und fing an, den Arbeitern im Aluminiumkombinat anständige Löhne zu zahlen. Als Bikow dann noch in die Politik ging und seine Kandidatur für das russische Abgeordnetenhaus anmeldete, wunderte sich keiner mehr, dass er gleich auf Anhieb 75 Prozent der Stimmen bekam. Damit war er aber auch den politischen Machtinhabern in Sibirien nicht mehr geheuer. Als gemunkelt wurde, dass Bikow angeblich die letzte Blauhaut in der Stadt – Pascha Lichtmusik – umzulegen beabsichtige, stellten sie ihm eine Falle. Obwohl es keinerlei Beweise gab, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Bikow flüchtete nach Ungarn, dort wurde er verhaftet und nach Moskau ausgeliefert. Man steckte ihn in Untersuchungshaft.
Bis dahin hatte der Schriftsteller Limonow seine Geschichte in Sibirien genau recherchiert. Als das Buch gerade fertig war, wurde er verhaftet: wegen Aufrufs zum bewaffneten Widerstand. Außerdem sollte er in Sibirien versucht haben, Luft-Boden-Raketen von der chinesischen Volksarmee zu erwerben.
Wenig später saß er schon mit dem Geschäftsmann Bikow zusammen im selben Knast. Die beiden etwa gleichaltrigen Männer sahen sich regelmäßig bei ihren Spaziergängen im Hof und redeten miteinander, wie Moskauer Journalisten herausfanden. Pascha Lichtmusik lebte derweil draußen weiter munter vor sich hin und genoss das Zeugenschutzprogramm.
Am 8. Juli begann am Bezirksgericht Saratow der Prozess gegen Limonow und fünf Aktivisten seiner Partei. Und in Sibirien ist längst der dritte Aluminiumkrieg ausgebrochen.
Das muss sich ändern, sagte ich und versprach ihm, eine Geschichte über die Tschukschen in Berlin zu schreiben. Doch außer ihm habe ich bis jetzt noch keine Tschukschen getroffen, also musste ich Anton interviewen. Zwei Stunden lang haben wir miteinander geredet. Dabei stellte sich heraus, dass die Tschukschen in Berlin im großen und ganzen wie alle anderen Studenten hier leben: Mühsam verdienen sie sich ihr Bafög, wohnen in einer WG, und abends gehen sie in die eine oder andere Kneipe. Oft haben die jungen Tschukschen – Luoravetlanen – bei den Frauen Erfolg, aber noch öfter werden sie abgewiesen.
Doch es gibt etwas, was die Tschukschen von den anderen Berlinern unterscheidet: Einmal im Jahr fahren sie in ihr Heimatdorf zu ihrer Mutter in die Tundra. Dort verbringen sie normalerweise drei Wochen. Alle zwei hundert Luoravetlanen im Dorf sind untereinander verwandt. Wie in fast jedem Dorf glaubt eine Hälfte der Bewohner an Jesus Christus, die andere glaubt nur an die eigene Kraft. Außerdem gibt es einen, der glaubt, er wäre selbst Jesus Christus.
Die Luoravetlanen befinden sich schon seit einer Ewigkeit am Rande des Aussterbens und stehen deswegen unter der Kontrolle einer UNO-Kommission. Doch diese Kommision kann ihnen nicht ständig hinterher laufen und sie nachzählen, sie kommt einmal im Jahr und wundert sich dann, dass die Luoravetlanen schon wieder weniger geworden sind – obwohl die miesen Kommunisten auf Tschukotka längst ausgestorben sind.
Letztes Jahr ist die Luoravetlanen-Population erneut um sieben Seelen kleiner geworden. Die Polizei im Verwaltungszentrum Anadir hatte einen Hinweis bekommen, dass der berühmt-berüchtigte Serienmörder mit dem Spitznamen Schneemensch, der jeden Monat aus der Tiefe der Tundra auftauchte und jedesmal eine Frau mit einer Socke erdrosselte, ein Luoravetlane sei.
Der Stammesälteste wollte seinen verdächtigten Landsmann jedoch nicht der Staatsgewalt übergeben und drohte dem Polizeichef mit der UNO-Kommission. Von dieser Drohung ließ sich die Miliz aber nicht beeindrucken. Sie beschloss, das Haus des Verdächtigen zu stürmen. Seitdem gibt es auf der ganzen Welt nur noch 193 Luoravetlanen.
Nach diesem Drama beschlossen die Übriggebliebenen, sich von der Zivilisation erst einmal zurückzuziehen. Dazu tauschten sie mit der Lokalverwaltung ihr Gemeindeland gegen einen verlassene Raketenschacht der sowjetischen Armee – etwa zwanzig Kilometer vom Dorf entfernt, der schon immer ein Objekt ihrer Begierde gewesen war.
Die Atomraketen, die dort – vis a vis von Alaska – jahrzehntelang stationiert gewesen waren, damit die Sowjetunion Amerika auf dem kürzesten Weg erwischen konnte, wurden 1993 abgebaut. Eine gewisse Radioaktivität blieb jedoch erhalten. Deswegen ist es im Schacht das ganze Jahr über angenehm warm und trocken, man kann dort sogar im Winter Kartoffeln und Gurken anpflanzen. Der Raketenschacht ist ein riesiger unterirdischer Bunker mit vielen Wohnräumen – fast ein modernes Hochhaus, nur nach unten. Für die meisten Luoravetlanen war es ein lauschiges Plätzchen.
Nur Anton gefiel es dort nicht. Er ist in Berlin ein Großstadtmensch geworden und bekam unter der Erde Platzangst. Außerdem sei es sehr langweilig dort, er habe die ganze Zeit immer nur Gardner gelesen, erzählte Anton.
„Gardner? Earl Stanley Gardner? Den amerikanischen Krimiautor? Wie kam der denn in den Raketenschacht?“ fragte ich ihn ungläubig.
Im Schacht standen noch aus den alten Zeiten jede Menge Müllcontainer herum, erzählte mir Anton. Sie wurden nun von seinen Leuten langsam umfunktioniert.
Auf der Suche nach Lesbarem fand er dort eine ganze Auflage der Zeitung „Sowjetisches Sibirien“ aus dem Jahr 1983 mit einer Gardner-Geschichte als Fortsetzungsroman. Drei Wochen lang las er ununterbrochen Gardner. Immer wieder dieselbe Geschichte, aber jedesmal in einem neuen Exemplar.
„Zum Schluss ging sie mir ziemlich auf den Geist, dafür aber geht es jetzt meinen Leuten ganz gut. Die Uno-Kommission wird sich bestimmt freuen“, sagte Anton.
„Und was ist mit der Restradioaktivität?“ fragte ich ihn.
„So etwas spüren wir Luoravetlanen gar nicht“, meinte Anton und strahlte.
Sibirien und die Käsebrigade (von Wladimir Kaminer):
Jeden Tag nach dem Frühstück mache ich meinen Rundfunkempfänger an und lausche den Nachrichten aus meiner Heimat. Von besonderem Interesse ist für mich zurzeit, ob die sibirischen Bewohner, die vor zwei Monaten in einen Hungerstreik traten, noch am Leben sind. Sie hatten in Krasnojarsk aus Protest gegen die Kälte den Hungerstreik angekündigt, und danach habe ich nichts mehr von ihnen gehört.
Dieses Gebiet wird seit November vorigen Jahres nicht mehr mit Strom versorgt, weil die Regierung die Stromrechnungen nicht bezahlt hatte. Der Gouverneur, ein General, sagte daraufhin dem Frost und der Kälte den totalen Kampf an – und startete eine Kampagne für gesünderes Leben. Er selbst ging als gutes Beispiel voran, indem er jeden Tag öffentlich auf dem Eis joggte – bis der letzte Fernseher ausging.
Heute morgen gab es wieder mal was Neues über ihn. Ein bisschen Strom haben sie also doch noch, sonst würde ich die Stimme des Generals im Rundfunk gar nicht hören können.
„Ich werde persönlich dafür sorgen“, sagte der General, „dass die Wärme in unserem Gebiet in kürzester Zeit wiederhergestellt wird.“ Das hat er schön ausgedrückt. Mit „Wärme“ meint der General natürlich nicht die Stromversorgung, sondern den Sommer.
Er spielt ein Spiel, das man gar nicht verlieren kann. Ende April waren die Menschen in Sibirien schon immer gespannt – alles dreht sich nur noch um das eine: Kommt nun der Sommer oder nicht?
Sollte dies der Fall sein und der Sommer kommt wirklich, dann wird der General sagen: „Seht ihr, das war für mich nicht leicht gewesen, aber was tut man nicht alles für sein Volk.“
Wenn aber der Sommer dieses Jahr Sibirien meidet, wird der General sagen: „Die Kräfte der Natur sind stärker als die Gesetze der Wirtschaft und der Politik, wir müssen vor diesen Kräften den Hut ziehen.“
Er ist ein weitsichtiger Politiker. Der General hat + 4 Dioptrien. Doch eine Brille zu tragen kommt für den General nicht in Frage, und Kontaktlinsen halten in der sibirischen Kälte nicht lange. Deswegen hat er sich in seinen BMW + 4-Dioptrien-Glasscheiben einbauen lassen.
Ein Bekannter meines Vaters, ein Offizier, der einmal im Auto des Generals saß, erzählte: Für einen Menschen mit normaler Sehkraft ist das derart unerträglich, dass er schon nach zehn Minuten kotzen muss.
Ein Glück, dass ich nicht in Sibirien lebe! Bei uns in der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg ist das ganze Jahr über schönes Wetter angesagt, die extrem vielen Autos, die Tag und Nacht auf der Allee fahren, erhöhen die Außentemperatur um einiges, und die U-Bahnen bremsen den Wind ab.
An jeder Ecke werden Kuchen gebacken und verkauft, im Ostrowski sogar am Sonntag, und nachts kann man sich im Burger King schräg gegenüber von unserem Haus ernähren. Dieses Gefühl kennt man in Sibirien gar nicht: Plötzlich wachst du um drei Uhr nachts mit einem Hungergefühl auf und gehst einfach auf einen Snack rüber ins Schnellrestaurant.
Die ganze Brigade stand vor der Tür, als ich letzte Nacht dort aufkreuzte: „Guten Morgen, möchten Sie vielleicht ein paar Cheeseburger kaufen, ganz frisch – zum halben Preis? Oder fünf Stück für fünf Mark, was halten Sie davon?“
Ich wurde wegen solch ungewöhnlich hoher Aufmerksamkeit verlegen. Der King macht doch sonst nie Sonderangebote. Vielleicht halten sie mich für einen anderen. „Wieso?“, fragte ich, „was ist denn los?“
„Eine typische Geschichte für diese Gegend, eigentlich nichts Besonderes“, sagte die Chefin. „Die Produkte sind nämlich wirklich frisch. Vor einer halben Stunde riefen uns irgendwelche Jungs an und bestellten 100 Cheeseburger für eine Party. Kurz vor Ihnen kamen sie, um die Waren abzuholen, und wollten mit einem falschen 500-Mark-Schein zahlen, da habe ich sie wieder weggeschickt.“
„Na gut“, sagte ich. „Fünf Cheeseburger zum Mitnehmen, aber bitte ohne Käse, den mag ich nämlich nicht.“
„Den Käse machen wir Ihnen gerne weg“, freute sich die Brigade.
P.S.: Der General ist inzwischen tot – mit einem Hubschrauber abgestürzt, sein Finanzverantwortlicher hat sich nach Berlin abgeseilt, wo er eine Zeitung für Russlanddeutsche gründete und auch sonst in der russischen Scene der Stadt für einigen Wirbel sorgte.
Auch das Kapital überspringt nun den Ural
Nachdem der Gouverneur der Oblast Swerdlowsk, Eduard Rossel, von Berlin aus alle arbeitslosen Deutschen aufgefordert hatte, dem „großen Kadermangel“ in seinem mit Vollbeschäftigung gesegneten westsibirischen Gebiet abzuhelfen, veranstaltete nun am 25. Oktober auch noch der Gouverneur des Gebiets Nowosibirsk, Wiktor Tolokonski, eine Pressekonferenz im Haus der Russischen Kultur – um deutsche Investoren in seine Oblast zu locken.
Wie Rossel versprach auch er ihnen jede Menge Hilfeleistungen seitens seiner Administration: bessere Investitionsbedingungen – wie Steuervergünstigungen in Bezug auf den Ertrag, die Immobilien sowie den Grund und Boden, dazu ein zunehmend kapitalfreundlicheres Wirtschaftsrecht, eine im Vergleich zu Deutschland schlankere Bürokratie und noch schöner: „Bei uns ist es verboten, mit sozialen Forderungen an Investoren heranzutreten. Die einzige Forderung an sie lautet: Der Plan muss erfüllt werden!“ Dafür gibt die Gebietsadministration sogar jährlich 10 Millionen Euro für die Zahlung der Zinsen von Unternehmerkrediten aus.
Gouverneur Tolokonski hatte nicht nur jede Menge Werbebroschüren und CDs sowie ein Video auf Deutsch über seine Oblast dabei, er eröffnete am selben Tag auch noch zusammen mit der Commerzbank in der russischen Botschaft eine „Nowosibirsker Wirtschaftswoche“ – unter dem Motto „Sibirien – mit Zuversicht in die Zukunft sehen!“. Dies gelte insbesondere für sein Gebiet Nowosibirsk, das sich „äußerst dynamisch“ entwickle – einmal als „strategisches Gebiet“ mit Hightech-Rüstungsproduktion, dann mit seiner Verarbeitungs- und Lebensmittelindustrie und schließlich mit seinen Hochschulen und der Filiale der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Etliche deutsche Firmen haben sich bereits in Nowosibirsk angesiedelt: Gerade eröffnete z. B. der Fenster- und Türenhersteller Veka dort eine Fabrik, und darüber hinaus wird derzeit der Flughafen von deutschen Unternehmen ausgebaut. Außerdem will sich der Metro-Konzern in der sibirischen Hauptstadt niederlassen.
Nach 1990, während der Konversion der meisten Rüstungsbetriebe, die man nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion in diese Region evakuiert hatte, hatte die Gebietsverwaltung zunächst „zehn schwierige Jahre“ durchzustehen, in denen man händeringend neue Partner suchte. In diesen Nachwendejahren, rückblickend nun als „erste Etappe“ bezeichnet, wurden hauptsächlich Waren importiert – bis die Im- und Exporte in etwa gleichzogen.
In der „zweiten Etappe“ ging es dann um den Ausbau der Warenproduktion. Und nun geht es in der „dritten Etappe“ um Investitionen – „nicht nur Waren verkaufen, sondern Betriebe“ – und außerdem um Neugründungen.
Nowosibirsk weist derzeit die größte Zuwachsrate von allen Gebieten Russlands auf, dazu kommen viele Bodenschätze und eine produktive Landwirtschaft. In der Stadt und in einem Umkreis von 300 Kilometern leben 12 Millionen Menschen, von denen viele sehr gut ausgebildet sind. In summa: „Das Wichtigste, was wir den deutschen Investoren bieten können“, meinte Tolokonski, „ist Ruhe und Sicherheit für heute und morgen!“ Daneben gibt es für sie inzwischen aber auch ein Russisch-Deutsches Haus für Kultur sowie eine Russisch-Deutsche Universität und demnächst eine Wirtschaftswoche deutscher Unternehmen in Nowosibirsk.
Als „Helden“ taugen die Deutschen nicht, wie der Historiker Michael Stürmer einmal vor dem Unternehmerverband Gesamtmetall ausführte, wohl aber komme ihnen bei der wirtschaftlich-wissenschaftlichen (Wieder-)Eroberung des Ostens eine führende Rolle zu. Beim Nowosibirsker Gouverneur hörte sich das jetzt so an: „Die BRD ist gegenwärtig einer der Hauptpartner unseres Gebietes auf dem Weltmarkt. Die Administration des Gebietes Nowosibirsk misst dem Ausbau der russisch-deutschen Geschäftsbeziehungen deswegen eine besondere Bedeutung bei.“
Der edle Wilde und das Öl
„Art from Another World“ im Pfefferberg zeigt Werke des früheren Seemanns und heutigen Malers Michail Grey Wolf Guruev. Dabei geht es auch um sein Nordasiatisches Kulturzentrum in der Mongolei
Der Initiator des Nordasiatischen Kulturzentrums in der Mongolei, Michail Grey Wolf Guruev, arbeitet seit 9 Jahren an diesem Projekt und hat dafür bereits 95.000 Dollar zusammengekratzt. Er wurde 1940 als Sohn einer Ewenkin in Sibirien geboren und wuchs in der DDR auf, aus der er 1961 in den Westen floh. Seitdem hat er sich in vielen Ländern umgetan und dabei als Seemann, Koch und Musiker gejobbt. Bei den Navajos kam er mit indianischen Künstlern in Kontakt – und ist seitdem auch Maler und Bildhauer.
Einen Großteil seiner Arbeiten stellt nun die Berliner „Asia-Lounge“, eine Initiative abgewickelter Asiatistinnen der Humboldt-Universität, auf dem Pfefferberg aus. Gleichzeitig werden dort mehrere Dokumentarfilme über die indigenen Völker Nordasiens, der mongolische Film „Die Geschichte vom weinenden Kamel“ sowie ein TV-Film über Michail Grey Wolf Guruev selbst gezeigt. Daneben gibt es eine Reihe von Diskussionsveranstaltungen und Workshops – u. a. über die kleinen nordasiatischen Völker, über deren Spiritualität sowie über das Kultur- und Ausbildungszentrum; zuletzt einen Vortrag von Arved Fuchs. An einem Tag tritt außerdem die mongolische Musikgruppe Kukh Mongol auf. Das ganze Programm firmiert unter der Überschrift „Art from Another World“ – mit dem Zusatz: „Not an exhibition but a state of mind“. Michail Grey Wolf Guruev will damit sagen, dass er nicht wie ein westlicher Künstler darauf hofft, dass seine Objekte und Bilder möglichst viele rote Punkte aufgeklebt bekommen, er erwartet vielmehr, dass mit dieser Veranstaltung einige ihm besonders wichtige Punkte für das Publikum geklärt werden.
Zunächst einmal der Begriff „Nordasien“. Michail Grey Wolf Guruev dazu: „Ich bat zum Beispiel eine asiatische Stiftung um Unterstützung, verwies diese darauf, dass das geplante Kulturzentrum ja in Sibirien, d. h. in Russland, liege; also sollte ich mich an westliche Institutionen wenden. Tat ich selbiges in westlicher Richtung, wurde mir gesagt, dass mein Projekt ja für Asien gedacht sei“. Weil er sich dafür von der russischen Administration inzwischen weniger Hilfe verspricht als von der mongolischen, hat Michail Grey Wolf Guruev den Standort für das Nordasiatische Kulturzentrum 2002 vom burjatischen Baikalsee die Selenga hoch an das Ufer des mongolischen Sees Huvsgul verschoben.
Ähnlich wie mit dem Begriff „Nordasien“ verhält es sich auch mit dem Wissen über die sozialen und kulturellen Probleme der kleinen, meist nomadisch lebenden Völker dort, von denen viele hier nicht einmal namentlich bekannt sind. „Ihre Situation hat sich seit dem Ende der Sowjetunion noch mehr verschlechtert – unsere Leute sind fast alle arbeitslos, und es fehlt an Ausbildungsmöglichkeiten.“
Eher umgekehrt ist es mit ihrer Religion – dem Schamanismus, der hierzulande inzwischen fast zu einem Modethema geworden ist, sodass immer mehr Leute aus Nordasien sich als Schamanen ausgeben, obwohl sie eher Scharlatane sind. „Die Sowjetunion hat es ja verhindert, dass das Wissen der letzten alten Schamanen an junge weitergegeben wurde. Wir zeigen dazu einen Film des jakutischen Regisseurs Sakha über eine 108-jährige Ewenkin. Ein Schamane verlässt nie seinen Ort und ist außerdem nicht erkennbar. Dies bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass alle, die auf internationalen Schamanen-Konferenzen das Wort ergreifen, keine sind.“
Schließlich wird man auf dem Pfefferberg auch noch Näheres über Guruevs Kulturzentrum am Huvsgul-See erfahren und wie man es unterstützen kann. „Dort soll u. a. ein großes Denkmal für Tiere entstehen. Das Wichtigste für die indigenen Völker Nordasiens ist ihre Verbindung zur Natur, d. h. zur Flora und Fauna – von und mit denen sie leben.“ Dies führt zu einem weiteren Punkt: Was kann der Westen von ihnen lernen? „Neben ihrem Heilwissen ist es eben dies: ein anderes, unmittelbareres Verhältnis zur Natur – zur Umwelt.“
Aber gerade das wird ihnen zunehmend erschwert. Zwar gibt es mittlerweile im Westen eine ganze Reihe Initiativen und kleineren Organisationen, die sich mit der Situation der indigenen Völker Nordasiens befassen und diesbezüglich Aufklärungsarbeit leisten, aber die wahren Interessen hier richten sich auf die riesigen Erdöl-, Erdgas- und sonstigen Bodenschätze, die seit dem Ende der Sowjetunion vermehrt von internationalen Konsortien aufgesucht werden, wobei die Amerikaner, die Russen und die Chinesen sich geradezu ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Das bringt die nordasiatische Urbevölkerung aber noch mehr in Bedrängnis, indem es ihr nach und nach die Lebensgrundlage entzieht. Und dies gilt für nahezu die gesamte Region – vom Eismeer bis zur Mongolei und nach Tibet, vom Ural bis zu den Ainu auf Hokkaido. Einerseits gibt es hier also eine Verklärung der nordasiatischen Nomadenvölker als „edle Wilde“, andererseits sind sie akut vom technologischen Fortschritt bedroht, dem sie im Weg stehen.
Mit der Errichtung des Nordasiatischen Kulturzentrums soll beidem entgegengewirkt werden. Dazu brauchte es noch mehr Geld, das man vielleicht über den Verkauf einer Art Aktie akquirieren könnte. Damit ließe sich zum einen das Grundstück kaufen, zum anderen könnte man die bisher von Guruev angeschafften Einrichtungsgegenstände und Werkzeuge – 60 Tonnen in Containern, die bei Hamburg stehen – mit einer Art Karawane auf Lastwagen an den Huvsgul-See bringen.
P.S.: Michail Grey Wolf Guruev hat seine Container inzwischen in die Mongolei geschafft und ist schon schwer damit beschäftigt, sein Kulturzentrum dort am Huvsgul-See aufzubauen.
Die Trommel rühren
Einerseits hat sich die Kunst musikalisch und als Performance mehr und mehr dem Schamanismus zugewandt, andererseits haben die wieder auferstandenen neuen Schamanen vor allem von Kunst und Kommerz gelernt. Im Anschluss an das „Festival Traditioneller Musik/Urban und Aboriginal XIII: Polar“ schrieb der FR-Rezensent: Der Schamanismus konnte dank „hoher Wandlungsfähigkeit“ überleben.
Das ist ebenso wurzelkitschig gedacht wie seine „Warnung“ vor Kommerzialisierung – im Zusammenhang der perfekten Vortragskunst von Sainkho Namtschylak, einer am Moskauer Jazz geschulten Schamanensängerin aus Tuwa. Schon in den Sechzigerjahren machte man in Ungarn die Erfahrung, dass zur Sesshaftigkeit gezwungene Zigeuner keine Musik mehr machen. Sie war aber für den Tourismus notwendig, deswegen eröffnete man eine Musikschule – nach Noten.
So muss man sich auch die „Neugeburt“ des Schamanismus vorstellen: Im sibirischen Burjatien lehrte zum Beispiel die derzeit in Berlin ihre Doktorarbeit über russische Emigranten schreibende Ethnologin Tsypylma Dariewa ihre Landsleute an der Universität von Ulan-Ude „Schamanismus“.
Und am Wannsee ist ein Mongole in derselben Angelegenheit tätig. Den Wannseern sind seine „Schama-Sessions“ inzwischen derart wichtig, dass er davon leben kann.
Ende Oktober traten im Haus der Kulturen der Welt Schamanen aus Kamtschatka auf. Sie tanzten, sangen, stellten Jagd-Szenen dar und dialogisierten mit ihrer „Babuschka“ (Kamtschatka). Äußerst gelungen fand ich den „Möventanz“ – inklusive der Schreie – von drei Frauen. Er wurde von einem rührenden „Robbenpärchen“ flankiert. Auch das „Robbenspiel“ verdiente alle Achtung.
Am besten gefiel mir jedoch ihr aller Impressario, ein schnurrbärtiger Russe in grauem Sakko und blauer Krawatte, der am rechten Bühnenrand die Trommel schlug oder am linken die Aufführung mit seinem Akkordeon begleitete. Er war so dermaßen bei der Sache, dass ich mir sicher war, er hat nach der Wende – vielleicht als abgewickelter Kamtschatka-Anthropologe – das „Tanztheater“ aufgebaut, hat sich um Vorlagen für die – sehr schönen – Kostüme bemüht, bei der Regionalregierung das Geld für die Schneiderkosten rausgeleiert, Auftritte organisiert, sich um die Presse gekümmert … Und nun tritt seine zehnköpfige Truppe bereits im Ausland – in Berlin – auf.
Sie sind in einem guten Hotel untergebracht, es gibt einen Shuttle-Service zum Haus der Kulturen der Welt, es gibt Dolmetscher, Übungsräume, Lachen, Trinken, im Café Global beim netten Kurden Rumsitzen, es gibt die baumlange Pressesprecherin des Hauses, Anna Jacobi, die sich ebenfalls sehr bemüht …
Alles ist gut! Die Zukunft liegt wie ein satter Silberstreif am Horizont. Darauf trinken wir noch einen! Und – warum eigentlich nicht – noch einen.
All das sah ich in ihrem „Liebestanz: Morgendämmerung“ zum Beispiel aufscheinen. Und vor so viel Glück traten mir Tränen in die Augen. Neben mir im Zuschauergang saß eine schöne Frau im Rollstuhl: ihr ging es ebenso. Anschließend schlich ich mich aus der Kongresshalle ins Dunkle und begann – zuerst im Café Einstein dann im Dressler Unter den Linden und zuletzt im Torpedokäfer sowie im Luxus am Wasserturm – mich zügig zu betrinken. Wieder und wieder trank ich auf das Wohl des internationalen Schamanismus. Und mir selbst wurde immer wohler dabei zumute.
Allein, die Umstehenden konnten oder wollten mich nicht verstehen. Ich schwärmte von der Wodkazeremonie in den lamaistischen Klöstern Burjatiens und von den vielen Soju-Tents in Seoul und Pusan, die von den dortigen Nachtschwärmern mit schon fast religiöser Inbrunst aufgesucht werden … Ja, der Schamanismus ist eine feine Sache, braucht aber viel Überzeugungskraft.
Wahrheitssuche in Sibirien
Kürzlich zeigte Arte den Film „Auf den Hund gekommen“, Martin Otting hatte mir zuvor erzählt, dass es darin um den während der Lyssenko-Ära nach Sibirien ausgewichenen Genetiker Dimitrij Beljajew ging, der 1959 in Nowosibirsk anfing, Domestikationsversuche mit Silberfüchsen (Vulpes vulpes) durchzuführen. Man stößt immer wieder in der ehemaligen Sowjetunion auf seltsame antidarwinistisch inspirierte Forschungen über das Leben. Im vergangenen Sommer entdeckte der Kulturwissenschaftler Peter Berz im Stauseengebiet der oberen Wolga gleich ein ganzes lamarckistisches Nest von Fischforschern: auf der einst weltgrößten limnologischen Forschungsstation in Borok – vis à vis einer naturgeschützten „Darwin-Halbinsel“. Auch die russische Vogelforschungsstation in Rybatschij (früher Rossitten) auf der Kurischen Nehrung, die seit 1997 vom Königsberger Heinz-Sielmann finanziell unterstützt wird, sowie die Affenforschungsstation in Suchumi verdienen alle Achtung. Für letztere interessiert sich besonders die Aspekte-Reporterin Christine Daum, wobei es ihr Otto Julewitsch Schmidt angetan hat. Der Vater der sowjetischen Psychoanalyse, Polarforscher, „Tscheljuskin“-Expeditionsleiter, Kosmologe und Sowjetenzyklopädist wollte anfänglich – im revolutionären Überschwang – in Suchumi Affen mit Menschen kreuzen, um sie zu zu domestizieren. Die BILD machte daraus neulich ein Stalinsches Schauerdrama – bebildert mit Stills aus US-Affenplanetfilmen. Dabei sollten die in den frühen Zwanzigerjahren künstlich geschaffenen Menschen-Affen nur beim Aufbau des Sozialismus helfen. Erst seit 1975 ist wissenschaftlich erwiesen, dass es so nicht geht.
Erfolgreicher war dann Schmidts Ehefrau Vera – mit ihren „psychoanalytischen Kindergärten“, aus denen im Westen ab 1967 die antiautoritären Kinderläden hervorgingen. Im abchasischen Bürgerkrieg 1992 verschonten die Kämpfer auf allen Seiten zwar nicht die Menschen, aber dafür die Affen von Suchumi. In Nowosibirsk wollte Beljajew seinerzeit nachweisen, dass man die „soziale Intelligenz“ wie bei den Hunden, die als einzige Tiere selbst versteckte Hinweise des Menschen mit der Hand oder den Augen verstehen, herauszüchten kann: „Selektion auf Kommunikation“. Ich würde hierbei zwar nicht von „sozialer“, sondern von interartlicher Intelligenz sprechen, aber desungeachtet war Beljajew nach 35 Generationen und 45.000 Blaufüchsen am Ziel: die Füchse waren domestiziert!
Er hatte stets die zutraulichsten weiter gezüchtet. Dabei hatten diese sich – sozusagen im Nebeneffekt – auch wie die Hunde körperlich verändert: sie hatten Schlappohren, bellten, wedelten mit dem Schwanz zur Begrüßung und bekamen weiße Flecken (wie u.a. Hauskatzen und Kühe). Laut Martin Otting hatten sie „noch ein Merkmal, das bereits Konrad Lorenz bei domestizierten Tieren aufgefallen war, nämlich ’niedliche‘ Gesichter, runde, wie die Teddybären. So sehen alle Säugetiere aus, wenn sie klein sind. In der freien Natur streckt sich später der Schädel, er wird lang und spitz. Die zahmen Füchse blieben Rundköpfe! Damit war klar, dass auch die Hunde vor 10.000 Jahren nicht auf äußerliche Merkmale gezüchtet worden war. Diese stellten sich von selbst ein, wenn man auf Verhalten zielte. Beljajew erlebte seinen Erfolg aber nicht mehr; er starb in den 80er-Jahren.“ Nach dem Zerfall der Sowjetunion mußte sein Institut Mitarbeiter entlassen und die Fuchszucht verkleinern. Dann entdeckte es der Harvard-Wissenschaftler Brian Hare: „Er hat sich mit den übrig gebliebenen Kollegen aus Nowosibirsk zusammengetan und getestet, ob die Füchse auch können, was die Hunde können: den Hinweisen des Menschen folgen. Sie können es, obwohl sie nie darauf trainiert wurden (näheres siehe ‚Current Biology‘, 15, S. 226).“
Mit Wolf Dräger, einem in Sibirien tätigen Privatisierungsmanager der aus der THA hervorgegangenen TOB – „Treuhand-Osteuropa-Beratung“, hätte das Arte-Team nun klagen können: „Man kann hinkommen, wo man will, die Amis sind immer schon vor einem da!“ Das taten sie aber nicht, eher reagierten sie wie die deutschen Max-Planck-Institute, die ihre Forscher dazu anhalten, ihre Texte auf Englisch zu publizieren. In der Hoffnung, dass deren steile Thesen so schneller Eingang in die „Scientific Community“ finden – und damit ins Wahre treffen! Es gibt jedoch einige Philosophen, die davor aus erkenntnistheoretischen, besser gesagt: erkenntnispraktischen Gründen warnen: So wird das nie was! „Die Wissenschaft ist grobschlächtig – das Leben subtil,“ gab bereits Roland Barthes zu bedenken.
Sibirisches Gas
„Alles hat Einfluß aufs Öl- und Gasgeschäft!“ (T. Abelaine, ein Londoner Broker)
In Polen zählt anders als in Deutschland neben dem Brennstoff- und Strombereich auch die Wärmeerzeugung zur Energieversorgung. Die Anteile der verschiedenen Energieträger an der Versorgung des Landes sieht derzeit etwa so aus:
Steinkohle 58%, Braunkohle 13%, Öl 7%, Erdgas 10%, Andere (z.B. Wasserkraft) 2%
Während der Ölmarkt entstaatlicht und dereguliert wurde, gibt es im Bereich der Gasversorgung – wie in einigen anderen europäischen Ländern auch – nach wie vor ein Monopolunternehmen: die Polnische Öl und Gas Gesellschaft PGNiG. Die Gaspreise sind freigegeben, die Tarife müssen jedoch von der Energieregulierungsbehörde URE abgesegnet werden. Die Lieferungen erfolgen vornehmlich aus Russland, auf Basis langfristiger Lieferverträge. Um etwas unabhängiger von den russischen Lieferverträgen zu werden, will Polen sich am Bau eines baltischen Atomkraftwerks beteiligen, daneben gibt es Überlegungen für ein AKW in Westpommern nahe der deutschen Grenze. Außerdem hat man sich von weiteren Privatisierungen auf dem Energiesektor erst mal verabschiedet, man denkt sogar im Gegenteil an Wiederverstaatlichungen. So wurde z.B. die bereits eingeleitete Privatisierung des Steinkohlebergwerks KWK Bogdanka, des Verteilers Enea und des Kraftwerks Kozienice gestoppt.
Beim Import von Energieträgern ist Polen laut Premierminister Jaroslaw Kaczynski an der „Nutzung verschiedener Quellen interessiert, um die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu verringern“. Dies bezieht sich vor allem auf Russland, wie das deutsche Wirtschaftsministerium – wohl zu Recht – annimmt: „Ein Anlass für diese Vorsicht ist die geplante neue Erdgas-Pipeline von Russland nach Deutschland, die unter der Ostsee verlaufen soll. Polen befürchtet, es könne ohne die Rolle eines Transitlandes erpressbar werden. Der russische Lieferant könnte so Westeuropa direkt beliefern und die durch Polen laufenden Pipelines schließen, bis etwa höhere Preise gezahlt würden.“
Konkret ist in Polen vor allem daran gedacht, norwegisches Erdgas zu beziehen: Um dieses per Schiff nach Polen zu verfrachten, ist für etwa 400 Mio. US$ eine aufwändige Hafenanlage an der Ostsee geplant. Gleichzeitig erwägt Polen, sich am Bau einer neuen Pipeline von Norwegen nach Schweden zu beteiligen. Diese soll nach dem Wunsch Polens bis an seine Ostseeküste verlängert werden. Entsprechende Verträge hat die PGNiG mit der norwegischen Statoil auszuhandeln. Schweden ist ebenfalls gegen die Ostsee-Pipeline und wird eventuell die Erlaubnis, dafür nahe der Insel Gotland eine Plattform als Verdichterstation zu errichten, verweigern.
Als der russische Präsident Putin und Bundeskanzler Schröder 2005 zusammen mit den Vorstandschefs von Gazprom, E.ON und BASF die „Vereinbarung“ zum Bau der Gaspipeline von Wyborg nach Greifswald durch die Ostsee an Polen vorbei unterzeichneten, sprach Schröder von einem „historischenTag“. Mit der Vereinbarung sichere sich Deutschland seine Energieversorgung in direkter Partnerschaft mit Russland auf Jahrzehnte. Mit Blick auf die Bedenken einiger ost- und mitteleuropäischer Länder betonte Schröder, die Zusammenarbeit richte sich gegen niemanden und diene allein russischen und deutschen Interessen. „Ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.“
In Polen, das dabei ebenso wie einige ehemalige Sowjetrepubliken als Transitland gewissermaßen umspielt wird, sprach man erbost über den neuen „Pakt“, mit dem Polens Interessen wieder einmal empfindlich verletzt werden. Die Pipeline kostet mindestens 5 Milliarden Euro, die erste Trasse soll bis 2010 verlegt sein, eine zweite 2012. Sie werden eine Transportkapazität von 55 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr haben. Der Jahresverbrauch in Deutschland beläuft sich auf etwa 80 Milliarden Kubikmeter. Russland hatte der Ukraine in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen, sich aus der Landpipeline illegal Gas abgezapft zu haben, und Polen, dass es zu hohe Transitgebühren für die quer durch das Land führende Pipeline verlange.
Weil die USA wegen des Einmarsches der Roten Armee in Afghanistan 1982 ein sogenanntes „Röhrenembargo“ verhängten, übernahmen damals die sozialistischen Bruderländer verschiedene Bauabschnitte einer neuen Gaspipeline aus Sibirien in den Westen. Die DDR zeichnete im „Jamburg Abkommen“ (benannt nach den Gasfeldern auf der Jamal-Halbinsel) für drei „lineare Teile“ verantwortlich: In der Ukraine (an der Grenze zum Transitland CSSR), südlich von Moskau und im Oblast Perm (am mittleren Ural), wo sie dann auch noch einen Teil mit übernahmen, mit dem die Jugoslawen nicht zurecht kamen. Neben der Gaspipeline waren dort jeweils eine gewisse Infrastruktur (Fabriken und ganze Siedlungen) sowie alle 250 Kilometer Verdichterstationen zu errichten. Die Sowjetunion zahlte dafür mit Gas. Die Haupttrasse (bestehend aus 19 Leitungen) führte von Westsibirien durch Russland, die Ukraine und die Slowakei, sodann nach Tschechien und von dort in die DDR sowie in die BRD – wo in beiden Ländern Monopolisten das Gas weiter verteilten bzw. verkauften. In der BRD war es die Ruhrgas AG.
Nach der Wende gründete der aus mehreren Ministerien hervorgegangene russische Konzern Gazprom zusammen mit der BASF-Tochter Wintershall die Wingas AG sowie zwei Handelshäuser, um fortan ihrem größten deutschen Gasabnehmer, der Ruhrgas AG, Konkurrenz zu machen: 15% Marktanteile wollte man dem Monopolisten abjagen – mit günstigeren Gaspreisen. Für 4,5 Milliarden DM wurden daraufhin erst einmal neue Speicher und Pipelines kreuz und quer durch das wiedervereinigte Deutschland gebaut. Außerdem baute Gazprom mit westlichen Milliardenkrediten auch noch die „Yamal-Pipeline“ von Westsibirien nach Deutschland – durch Weißrussland und Polen, die dafür seitdem Transitgebühren kassieren.
Auf die Nachricht vom geplanten Bau der „Ostsee-Pipeline“ reagierte Polen mit dem Vorschlag einer „Amber-Pipeline“ – durch Lettland, Litauen und Polen, die weitaus billiger als die Unterwasser-Pipeline wäre und zudem weniger umweltgefährdend. Sie würde darüberhinaus – anders als die bestehende Yamal-Pipeline – das politisch unsichere Weißrussland aussparen.
Für Russland ist jedoch nicht Weißrussland, sondern eher Polen „politisch unsicher“, zudem will Moskau um jeden Preis unabhängig von Transitstaaten werden, erst recht, wenn sie ihnen, wie Polen, eher unfreundlich gesinnt sind.
Wie zur Bestätigung dessen wurden dann in Warschau zwei russische Diplomatenkinder verprügelt. Moskau forderte daraufhin eine offizielle Entschuldigung, sogar Putin schaltete sich ein, was in Polen als überzogen gewertet wurde. Seit dem Machtwechsel in der Ukraine verdächtigt man in Russland die polnische Regierung, Unruhen in den früheren Sowjetrepubliken zu schüren, ihr andauernder Streit mit Weissrussland scheint diesen Befürchtungen Recht zu geben. In Deutschland bemüht sich nun die neue CDU-Kanzlerin Angela Merkel, nachdem ihr Vorgänger Gerhard Schröder auch noch Aufsichtsratsvorsitzender des russisch-deutschen Gaspipeline-Konsortiums geworden war, wenigstens um verbale Beschwichtigung der polnischen Befürchtungen. Dazu teilte sie der vom deutschen Springerkonzern extra zur Verdummung polnischer Leser gegründeten Zeitung „Fakt“ mit: „Es geht bei diesem Projekt nicht nur um deutsche und russische Interessen; auch andere Länder in Europa – insbesondere auch Polen – sollen von der Ostsee-Pipeline profitieren können. Wir werden uns auch dafür einsetzen, dass die berechtigten ökologischen und seerechtlichen Interessen aller betroffenen Ostsee-Anrainer berücksichtigt werden.“
Der ganze deutsch-polnisch-russische Gaskrieg ist auf dieser Ebene reine Augenwischerei, der darüber hinwegtäuschen soll, dass nicht mehr die Politiker, sondern die multinationalen Konzerne die gesellschaftliche Entwicklung „steuern“, indem sie nach US-Vorbild jeglichem volkswirtschaftlichen Denken und Handeln den Boden entziehen. Nicht „Deutschland“ wird Polen auf dem Energiesektor entgegenkommen oder bedrängen, sondern „seine“ beiden Gas-Großkonzerne Ruhrgas (E.ON) und Wintershall (BASF), die sich abgesehen davon auch gegenseitig bekriegen, wobei es zunächst um „Durchleitungsrechte“ für die Ruhrgas-Pipelines ging: Es macht keinen Sinn, zu jedem Industriekunden eine weitere Pipeline zu verlegen. Zum Präzedenzfall wurde das von der übernommene DDR-Chemiekombinat Schwarzheide, daß die Wintershall AG über das ostdeutsche Leitungsnetz der „Verbundnetz Gas“ (VNG) mit eigenem Gas beliefern wollte. Wintershall besitzt 16% Anteile an der VNG. Deren Mehrheitsgesellschafter, die Ruhrgas AG, verweigerte jedoch den Transport des Gases durch das VNG-Netz – indem sie dafür laut BASF „Freudenhausgebühren“ verlangten.
Überhaupt gaben sich anfänglich die Kontrahenten – Ruhrgas und Wingas – äußerst kämpferisch: „Wer uns herausfordert, sollte wissen, daß wir unsere Position bis zum letzten Blutstropfen verteidigen werden“, sagten die einen und die anderen konterten: „Wir werden bis zu den Knien durch Blut waten müssen. Aber unser Blut wird es nicht sein“. Im Boxsport nennt man so etwas eine „Sensationspaarung“. Für die Ruhrgas AG, 1926 aus dem „Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat“ hervorgegangen, war dies bereits der dritte „Gaskrieg“. Der erste begann, als die „Essener“ verlauten ließen, daß sie nun – im Preiskampf gegen die regionalen Gaswerke – das gesamte Reichsgebiet mit dem Abfallprodukt Gas – aus ihren Kokereien und Hütten – beliefern wollten. Viele Städte mochten jedoch ihre Versorgung nicht einem Privatunternehmen anvertrauen. Der Durchbruch kam erst mit dem „Verräter“ Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister von Köln. 1962 war die Ruhrgas AG Monopolist bei der Produktion und Versorgung der Städte und Industrien mit Kokereigas. Da entdeckten Exxon und Shell in Holland ein riesiges Erdgasfeld – und die „Essener“ gerieten plötzlich selbst „in die Rolle eines vom Markt verdrängten Opfers“, wie der Firmenchronist Günter Karweina 1993 schrieb.
Der zweite Gaskrieg ging um den Erhalt wenigstens des „Liefermonopols“: „Vier Jahre blockt die Ruhrgas alle Ansätze der Öl- und Gasmultis zum Bau eigener Leitungen ab“, gleichzeitig wird das bundesdeutsche Gasnetz zu einer „Drehscheibe der europäischen Versorgung“ ausgebaut. Demarkations- und Konzessionsverträge mit kleineren inländischen Ferngasgesellschaften sowie den regionalen bzw. kommunalen Verteilern sorgen dafür, daß sich niemand preiszerstörerisch ins Gehege kommt.
Den dritten „Gaskrieg“ zettelte dann die BASF an: Weil ihr das von der Ruhrgas AG gelieferte Gas zu teuer wurde, wollten sie sich 1989 über eine eigene Pipeline von Ludwigshafen bis nach Emden mit billigem norwegischen Erdgas versorgen. Aus „Loyalität zur Ruhrgas AG“ weigerten sich die Norweger jedoch, dem Chemiekonzern Gas zu verkaufen. Noch 1996 schimpfte der Wintershall-Vorstandsvorsitzende Detharding während einer „Ölmesse“ in Oslo öffentlich: „Wenn die Ölgesellschaft sich derart vom deutschen Gasgiganten Ruhrgas ausnutzen läßt, sind Statoil und norwegisches Erdgas die Verlierer“.
Als die BASF verkündete, sie werde zukünftig zusammen mit dem Gazprom-Konzern russisches Export-Gas vermarkten, waren die „Essener“ über diese Nachricht zunächst derart schockiert, daß sie der noch am selben Tag die Gaslieferungen um 40% kürzten. Das zuständige Landgericht untersagte ihnen dann jedoch jegliche Lieferkürzung: „Ein krasses Beispiel dafür, wozu eine Monopolstellung verführen kann,“ kommentierte hernach ein BASF-Sprecher.
Ende 1996 meinte der Herausgeber eines Gas-Branchendienstes jedoch bereits – auf einer in Berlin tagenden Gas-Konferenz der Internationalen Energie-Agentur (IEA,Paris): „In einigen Jahren werden die beiden Kontrahenten bestimmt wieder friedlich an einem Tisch sitzen – und Geschäfte miteinander machen“. Und das machen sie nun – gegen Polen, es wird sie jedoch nicht daran hindern, sich bei Gelegenheit erneut untereinander zu bekriegen. Neuerdings ist auch noch der holländische Monopolist Gas-Unie an der Ostsee-Pipeline beteiligt (mit 9%). Und auch Polen hat seit kurzem eine neue Idee, um billig an nicht-russisches Gas heranzukommen: Premierminister Kaczinsky denkt dabei an die von US-Konzernen um Russland herum geplante Pipeline vom Kaspischen Meer in die Türkei. Für seine Einwilligung zur Stationierung von US-Raketen gegen „Schurkenstaaten“ auf polnischem Boden soll das Land an diese so genannte Baku-Tbilissi-Ceyhan-Pipeline angeschlossen werden, deren Bau bereits im September 2002 begann, die jedoch wohl nie in Betrieb gehen wird.
Die Transitländer verlangen für die Durchleitung Gebühren. Russland hat Polen immer wieder vorgeworfen, dass sie zu hoch seien. Da Polen jedoch gleichzeitig sein Gas hauptsächlich aus Russland bezieht, gab das deutsche Wirtschaftsministerium im Zusammenhang der polnischen Proteste gegen den Bau der Ostsee-Pipeline zu bedenken: „Polen befürchtet, es könne ohne die Rolle eines Transitlandes erpressbar werden. Der russische Lieferant könnte so Westeuropa direkt beliefern und die durch Polen laufenden Pipelines schließen, bis etwa höhere Preise gezahlt würden.“ Weil einige polnische Politiker den Vertrag zwischen Gazprom (51%), BASF und Eon (je 20%) sowie der holländischen Gasunie (9%) zum Bau der Ostsee-Pipeline unter dem Aufsichtsratsvorsitz von Gerhard Schröder als neuen „Hitler-Stalin-Pakt“ bezeichneten, bemühte sich zuletzt auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel um wenigstens verbale Beschwichtigung der polnischen Befürchtungen. Dazu teilte sie der zum deutschen Springerkonzern gehörenden polnischen Zeitung „Fakt“ mit: „Es geht bei diesem Projekt nicht nur um deutsche und russische Interessen; auch andere Länder in Europa – insbesondere auch Polen – sollen von der Ostsee-Pipeline profitieren können.“
Der Begriff „Hitler-Stalin-Pakt“ mag polemisch überzogen sein, aber eines ist sicher, dass Polen nicht von der neuen Pipeline „profitieren“ wird. Denn deswegen wird sie ja extra um das Land herum gebaut – und zwar mit weitem Abstand, so daß Polen nicht einmal gefragt werden muß. Matthias Warnig, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Nord Stram, erklärte dazu: Ein Mitspracherecht haben beim Bau der Pipeline nur die Länder, deren Außenwirtschaftszone dabei tangiert wird. Das gilt für Finnland, Schweden und Dänemark. „Diese Länder können Auflagen machen, eine Genehmigungspflicht gibt es aber nicht.“ Gar kein Mitspracherecht haben die Hauptkritiker der Pipeline: Polen, Litauen, Lettland und Estland. Ihre Außenwirtschaftszone wird nicht berührt. „Diese Staaten können aber Fragen stellen und sie werden informiert.“ Die Bundeskanzlerin hat dabei erst einmal mit einer Desinformation angefangen.