Eigentlich sollte dieser Blog ja Bemerkungen und Beobachtungen des taz-aushilfshausmeisters sammeln – so hatte es sich der taz-blogwart und die -geschäftsführung jedenfalls anfänglich gedacht. Aber 1. würde ich es mir dann der Reihe nach mit allen tazlern verderben, und zwar gerade mit solchen, von denen ich als freier Autor abhängig bin, und 2. würde das, schon um 1. möglichst zu vermeiden, über kurz oder lang in Korinthenkackerei ausarten, d.h. lauter Büro-Nichtigkeiten enthalten.
An sich wäre dagegen nichts zu sagen, aber dann müßte dies unbedingt mit Liebe und Sorgfalt geschehen – und dafür fehlt mir wiederum die Zeit bzw. das Geld. Deswegen wird dieser blog mehr mit dem gefüllt, was mir lieb und wert ist – außerhalb der taz und meistens ist das etwas, was die taz-redaktionen nicht wollen (an bewegungsmeldungen und -positionen z.B.) oder was sie nicht kennen bzw. übersehen – eine Bürgerinitiative, die sich in einem Dorf bei Berlin gegen eine Gastrasse wehrt z.B.. Darüber könnte man bei den taz-holzjournalisten wahrscheinlich höchstens einen 50-Zeiler unterbringen und das auch nur einmal. Allein der neulich hier im blog eingestellte „offene Brief“ der BI hat aber schon 500 Zeilen.
In den hier folgenden zwei Texten vermischen sich Interna und Externa, Vorab aber erst einmal die Meldung, dass in der taz gewählt wurde – und zwar der Betriebsrat. Etwa 200 Mitarbeiter durften dieses Gremium wählen, etwas mehr als die Hälfte tat es, woraufhin sich eine interne Debatte über die „beschämend niedrige Wahlbeteiligung“ entwickelte. Aber das kennt man ja aus dem Rest der Welt. Und mir ist es weder hier noch dort wichtig. 1. halte ich nichts von solchen „demokratischen Verfahren“ und habe auch noch nie in meinem Leben etwas oder jemanden gewählt, schon gar nicht irgendwelche Parteien – die für mich nichts mit Politik zu tun haben. Da, wo ich politisch verkehre bestimmt bzw. entscheidet man direkt: Du machst dies und der macht das, ich übernehme jenes. Fertig. 2. in der taz hat es sich durchgesetzt, dass man dort von a bis z die ganze bürgerliche Scheiße kopiert – von Geschäftsführung, Ressortleitung, Steuerberater, GmbH, Genossenschaft, Vertrieb, Callcenter, Promihonorare, Damen- und Herren-Toiletten, Rauchverbot, Chefredakteure, Putzfrauen-Brigaden, Praktikanten, Betriebsräte, Kommentare, Berichte von Parteitagen, Antikommunismus, Spießerkarrieren, Häuslebauereien, Pressekonferenzen, Professionalitäten und andere Sauereien, Riesterrenten statt Zyankali und was weiß ich noch alles. Ich möchte es eigentlich gar nicht so genau wissen. Diese ganzen Alternativbetriebe haben eben nur eine Halbwertzeit von 10 Jahren – und dann sind sie von dem übrigen (klein-) bürgerlichen Mist drumherum nicht mehr zu unterscheiden – wobei das „Bewußtsein“ noch eine Weile überhängen mag. Ich hätte demgegenüber z.B. statt „Journalisten“ und solche, die es werden wollen, nur Adlige eingestellt, am Besten solche, die Alkoholiker werden wollen – aber mich fragt ja keiner. Außerdem arbeiten in der taz viel zu viele Deutsche – auch das ist große Scheiße. Wer nicht mindestens einmal am Tag den Wunsch hat, mit einem Revolver in einer (deutsche) Menge zu schießen, der trägt selber seinen Wanst ständig in Schußhöhe – und kann keine Texte schreiben, die die Kacke des Seins umgraben.
Was konkret den taz-betriebsrat betrifft: auch der ist natürlich Bockmist, aber wer a – Geschäftsführung, Gehaltsspreizung, Chefredaktion sagt, muß natürlich auch b – betriebsrat, betriebsverfassungsgesetz, kündigungsschutz, erziehungsurlaub, kindergeld, kureigenbeteiligung, weihnachtsgeld, blaumachen etc. sagen und bald wohl auch telefonüberwachung, stechuhr, feste arbeitszeit usw.. Das ist eine regelrechte Elendsspirale, die sich immer weiter dreht, während gleichzeitig das „Kampfblatt“ gegen diesen ganzen bürgerlichen Dreck zu einem reinen Arbeitsplatz-Erhaltungs-Dingsbums verkommt. D.h. es wird und ist jetzt schon völlig unwichtig, was da drin steht täglich, Hauptsache es liest sich irgendwie wie ein halbwegs gepflegter Diskurs, eine halbwegs anerkannte Meinung in moderner Aufmachung (Layout), wobei auch die Ironie, auf die sowieso geschissen ist, nicht zu kurz kommen darf. Bei der taz kommt dann noch diese ganze bescheuerte Ökologie dazu, die zu nichts anderem taugt, als immer wieder die stockende Warenproduktion flott zu machen. Dabei ginge es gerade darum, den Tauschwert der Dinge endlich zu eliminieren – alles andere ist Augenwischerei: Scheißegal, ob z.B. Vattenfall Braunkohle oder Wind und Wasser oder Sonne oder was auch immer verstromt – es geht um die Stromproduktion als Warenproduktion, die abgeschafft gehört. Der schwedische königliche Staatskonzern hat dabei gegenüber der taz sogar immerhin noch den Vorsprung, dass er wenigstens noch Gebrauchswerte produziert, während die taz bald reiner Tauschwert ist – mit all den praktisch-solipsistisch-verblödenden Folgen, die das hat.
Zurück zum taz-betriebsrat: Wenn dort demnächst das neue Gremium auch wieder den Hausmeister Wolf als Vorsitzender wählt, der sich schon vor Jahr und Tag in das Betriebsverfassungsgesetz eingefuchst hat wie kein anderer, dann könnte es sein, dass er diesmal wegen der erneut gestiegenen Betriebsgröße „freigestellt“ wird, woran ihm sehr gelegen ist. Und das würde wiederum bedeuten, dass er nicht mehr als Hausmeister zur Verfügung stünde – und ich also nicht mehr als sein Aushilfshausmeister fungieren könnte, wenn er krank ist oder im Urlaub. Das hätte wiederum zur Folge, dass ich meine jährlichen taz-schulden nicht abarbeiten könnte – und also verarmen und daraufhin krank werden würde. „Ein Elend!“ (Victor Hugo) Aber das soll hier erst mal nicht weiter interessieren: „Das Ich ist nämlich nicht nur hassenswert, es hat nicht einmal Platz zwischen Uns und dem Nichts!“ (Claude Lévy-Strauss)
1. Das Einzige, was zählt ist der Augenblick, aber auch das Jahrhundert
Man glaubt es kaum, wie viele taz-Redakteure und -Autoren im Nebenberuf DJs sind – auch wenn das bei einigen schon Jahrzehnte her ist, bei anderen nur wenige Tage. Da ist erst mal der taz-Blogwart Mathias Broeckers: Schon Ende der Sechzigerjahre legte er im kirchlichen Jugendkeller von Limburg Platten auf. Und nicht nur das: Er installierte dort auch eine Lichtorgel bestehend aus sechs bunten Glühbirnen und ebenso vielen Schaltern, die er im Rhythmus der Rockmusik ein- und ausschaltete. Schon bald versuchte man im Rathaus, ihm den Club auszuknipsen. Die Begründung des Bürgermeisters dafür: „Die spritze sisch da des pure Hasch!“
Etwa zur selben Zeit arbeitete ich als Aushilfs-DJ in der Bremer Disco „Dschungel“, die so hieß, weil am Rande der Tanzfläche lauter Papppalmen standen. Einige Jahre später spielte Barbara Dribbusch in einer Rockband und stand auf Partys gelegentlich als DJane hinterm Mischpult. Vor etwa fünfzehn Jahren legte Meike Jansen „Noise“ und „Experimentelles“ auf. Erwähnt sei ferner Harald Fricke, der auch als DJ sehr ambitioniert war. Dann Daniel Bax, der gewissermaßen auf „Oriental“ spezialisiert ist, während der jetzige Musikredakteur Tobias Rapp mehr auf „Soul“ steht.
Kirsten Risselmann legte zuletzt Ultramodernes in der „Palomabar“ auf. Einen ähnlichen Musikgeschmack haben Gerrit Bartels und Arno Frank. Wohingegen Matthias Urbach neulich auf einer Party „Evergreens“ bevorzugte. Im taz-Café spielen die Empfangschefs Henry Budziarek und Stefanie Grimm täglich und eher notgedrungen „Dezentes“. Und am letzten Wochenende versammelte der Auslandsaushilfsredakteur Rüdiger Rossig nahezu sämtliche jungen Balkanexilanten in Tatiana Kourilskaias Kneipe „Schmitz‘ Katze“, weil seine „Jugo-Disco“ dort einheizte. Abgesehen von der Nationalhymne und dem Hit „Jugoslawia“ war das meiste, was er auflegte „No Identity“, wie er meinte. Die Aushilfsbarfrau und taz-Autorin Antonia Herrscher fand das jedoch gar nicht: „Das war doch reinster Ostblock-Rock und -Pop.“ Gegen Morgen kam es – weniger wegen der Musik, sondern eher wegen des selbst gebrannten Slibowitz und des Belgrader Biers, aber auch wegen der balkanischen Ehre – zu einer heftigen Schlägerei zwischen einem Mann und einer Frau. So etwas hatte es bis dahin bei einem taz-DJ noch nie gegeben, sieht man mal von Wladimir Kaminers „Russendisko“ ab, wo öfter solche oder ähnliche Entgleisungen stattfinden. Kaminer hat jedoch eine schnelle Eingreiftruppe dafür: den Türsteher und Schachmeister Thomas nebst einem Aushilfsrausschmeißer.
Nun gibt es aber auch einige tazler, die noch nie DJs waren. Anlässlich eines „Erntedankfestes“ sprachen sie neulich auf der Dachterrasse über ihre Gründe: 1. „Ich bin unmusikalisch.“ 2. „Man hat uns postfaschistischen Westdeutschen im Gegensatz zu den präkommunistischen Ostdeutschen jegliches Liedgut ausgetrieben.“ 3. „Norddeutsche singen nicht: „Frisia non cantat“ (Tacitus).“ 4. „Meine Mutter hat mich bereits mit Bob Dylan, Edith Piaf, Ray Charles und Pete Seeger gequält.“ 5. „Ich habe zu viele Jahre in Diskos verballert und mein Gehör ramponiert, jetzt stößt mich dieser ganze Party- und Clubscheiß ab.“ 6. „Seitdem die Rockmusik nicht mehr verboten ist und stattdessen aus allen Schuh- und Klamottenläden sowie Radiosendern und U-Bahnen dröhnt, interessiert sie mich nicht mehr.“ 7. „Sie ist längst nicht mehr Teil einer sozialen Bewegung.“ Ein Rolling-Stone-Musikredakteur meinte mal: „Das Ende der Rockkonzerte begann mit dem T-Shirt-, Poster- und sonstigem Fan-Klimbim-Verkauf. Ab da interessierten sich die Musiker nicht mehr dafür, wie die Leute während ihres Konzerts drauf waren, sondern wie viel sie von dem Zeug verkauft haben.“ 8. „Ich fand schon die Kolumnen von Jonas Überohr (Helmut Salzinger) in der Sound bisweilen hermeneutisch überanstrengt, die Musiktexte von Klaus Theweleit viel zu lang und die von Diedrich Diederichsen in der Spex geradezu gaga. Allen dreien ging es glaube ich darum, ,ihre‘ jeweiligen Bands irgendwie doch noch diskursmäßig rüber zu retten.“ 9. „Wenn Musik, dann höre ich inzwischen am liebsten klassische. Aber noch lieber ist mir die Stille – da will ich auch nichts über laute Musik lesen.“
2. „Das Liebsleben der Tiere macht froh und traurig zugleich“ (Michel Foucault)
Ich sage nur Knut. Tiere erfreuen sich einer immer noch steigerungsfähigen Beliebtheit – je mehr wir uns denaturieren. Der Song „Let’s do it like the animal on the discovery channel“ schaffte es in ebenso viele Hitparaden, wie es Länder gibt, in denen man diesen Natur- und Tiersender empfangen kann. Davon profitieren auch die Tiere und Pflanzen, die es mehr und mehr in die Stadt zieht. Die sich diesem Phänomen widmenden Biologen, wie der Berliner Riechelmann und der Münchner Reichholf, sprechen von einer regelrechten Landflucht: In den Städten gebe es bereits eine größere Artenvielfalt als auf dem Land. Dort ist man auch eher bereit, diese letzten „Wilden“ willkommen zu heißen, außerdem herrscht hier Waffenverbot. Und statt von verrohtem Landvolk ist zumindest Berlin voll von Kopfarbeitern, die Tiere erforschen bzw. besingen.
Erwähnt sei der ehemalige taz-Redakteur Wiglaf Droste, dessen beste Gedichte von unseren bepelzten und gefiederten Lieblingen handeln. Eine die Krähen schwer verunglimpfende Glosse stieß dagegen nicht nur beim taz-Biologen Riechelmann auf scharfe Kritik, sie brachte ihm darüber hinaus fast ein Schreibverbot hier im Haus ein. Auf einer Lesung aus dem neuen Buch „Morgens leicht, später laut“ im taz-Café erfuhren wir neulich, dass auch Detlef Kuhlbrodts Feuilletons immer dann am besten gefallen, wenn es dabei um Tiere – angefahrene Igel zum Beispiel – geht. Und in der Frankfurter taz-Redaktion saßen beziehungsweise sitzen gleich mehrere Mitarbeiter, die sich am liebsten mit Tieren (im Rhein-Main-Gebiet, aber nicht nur dort) befassen. Zuletzt verfasste dort Heide Platen einen Kommentar über den Bären Bruno sowie Porträts von Kormoranen, Kamelen und Eichhörnchen.
Auch die taz-Ökoredaktion ist immer mal wieder für eine Recherche über Tiere und Pflanzen gut, Ähnliches gilt für die Wissenschaftsredaktion. Und für den gelegentlichen taz-zwei-Kolumnisten Matthias Stührwoldt sowieso: Der schleswig-holsteinische Biobauer und frühere Abonnent des Kleinen Tierfreunds hat seine gesammelten Kolumnen gerade in einem neuen Buch, „Schubkarrenrennen: Frische Texte ab Hof“ veröffentlicht.
Ich habe mich als Betreuer der Kolumne „Agronauten“ in letzter Zeit vor allem über Bakterien und andere Mikroorganismen ausgelassen, bei denen man noch nicht zwischen Pflanzen, Pilzen und Tieren unterscheiden kann. Daneben bin ich aber noch für sechs große Topfpflanzen im taz-Konferenzsaal quasi zuständig. Zu den taz-Büropflanzen generell sei gesagt: Je mehr sich die Leute mit ihrem Arbeitsplatz perspektivisch identifizieren, desto mehr Pflanzen stellen sie um sich herum auf – zur Motivierung ihres eigenen Wurzelschlagens im „Projekt“.
In den meisten Redaktionen gibt es so gut wie keine Topfpflanzen, höchstens zum Geburtstag mal den ein oder anderen Blumenstrauß. Im Verlags- und Chefredaktions- sowie im EDV- und im Genossenschaftsbüro sieht es dagegen wie in einem Gewächshaus aus. Und während sich die Chefredakteurin die Pflanzenpflege mit ihren Assistentinnen teilt, haben die Büroleute noch die Pflege und das Mähen des Rasens auf der Dachterrasse übernommen. Dort sowie auf ihrem Balkon ziehen sie außerdem noch jede Menge Sonnenblumen, Erdbeeren, Bohnen, Schafsgarben, Disteln und Topinambur in Töpfen.
Einige der Büroleute haben darüber hinaus auch zu Hause noch einen Garten, sodass die Pflanzen manchmal hin- und herwandern – zumindest ihre Ableger. Überhaupt ist es ja bei Pflanzenliebhabern oft so, dass man die Nachzucht untereinander austauscht. Ich verschenke zum Beispiel gerne kleine Goethepflanzen. Dabei handelt es sich um ein indisches Dickblattgewächs, das nachts Kohlendioxid für seine Photosynthese aufnimmt und in jedem gezähnten Blattwinkel neue Pflänzchen ausbildet, die nach einiger Zeit abfallen. Goethe hat sie sehr gemocht, deswegen heißt sie auch so. Aus demselben Grund hat Rudolf Steiner sie dann als Heilpflanze – gegen „hysterische Erscheinungen“ – empfohlen.
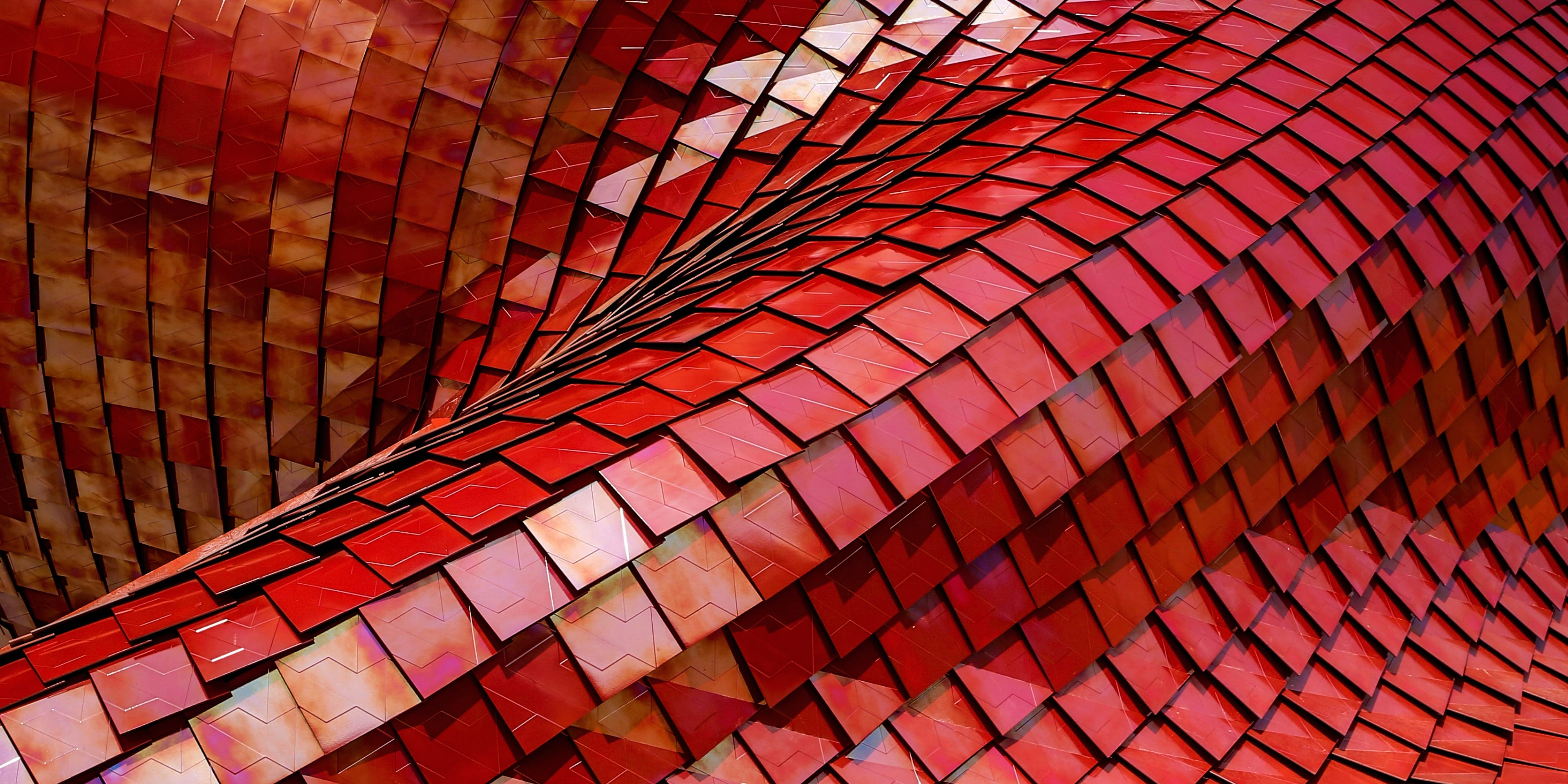



tacitus hat ja recht:hört euch nur die HALLUNER(helgoländer)KAARKFINKEN(domspazzen)an.oder:besser nicht….