Andauernd laufen irgendwelche Filmteams durch die taz. Dabei habe ich noch nie einen Beitrag von ihnen gesehen. Aber auch im Weichbild der Stadt sind laufend welche unterwegs, die sich dort noch wichtiger nehmen – und ganze Straßenzüge für ihre Dreharbeiten absperren.
Warum tut keiner was dagegen? Mit einer Filmkamera kann man anscheinend eine ganze Stadt in Schach halten! Wenn es früher darum ging, koste es was es wolle in die Medien zu kommen – muß man es in der jetzigen Mediengesellschaft geradezu krampfhaft vermeiden. Aber die meisten linken Gruppen und Künstler haben das noch nicht begriffen – und wenden sich immer zuerst an die Medien mit ihren „Projekten“. Ich bekomme mindestens 30 Mails pro Tag mit solchen Annoncements.
In der taz hat Stefan Heidenreich gerade geunkt, es könnte den Geisteswissenschaften bald genauso ergehen wie einst der Theologie – dass sie zu Orchideenfächern werden:
„Gesucht wird also nichts dringender als Köpfe, die Kultur verstehen, das Netz und die neuen Technologien kennen und das Wissen besitzen, um Ideen und Lösungen für künftige Aufgaben und Angebote zu finden. Das schließt die Fähigkeit ein, den Gang der Dinge kritisch betrachten zu können. Dass man in Deutschland in dieser Hinsicht bislang nicht sonderlich produktiv war, zeigt schon ein flüchtiger Blick auf die kulturell relevanten Neuerungen im Netz. Praktisch alle neuen Plattformen, von Google über Wikipedia bis zu YouTube, stammen aus Amerika. Hierzulande beschränkt man sich auf Nachahmerprodukte. Damit sind wir im Feld der digitalen Kultur auf das Niveau einer zweiten Welt gesunken. Kultur reicht zwar nach wie vor über die digitale Welt weit hinaus. Aber es macht einen nicht ganz unwesentlichen Unterschied, ob die neuen Kulturtechniken vor Ort entwickelt oder von außen importiert werden.“
Ich gebe zu bedenken, dass man auch schon beim Radio und beim Fernsehen sowie beim Hollywoodfilm ähnlich gedacht hat – und heute hört kein Schwein mehr Radio bzw. kuckt Fernsehen oder sieht sich irgendwelche Leinwandschinken an. Irgendwann in nächster Zukunft wird man auch des Internets und der Computer überhaupt überdrüssig werden – und reumütig wieder zum Pflug bzw. zur „Hacke“ (Deleuze/Guattari) zurückkehren.
Hier eine Auswahl der vergangenen und wiederkehrenden Berlinale-Rummel bzw. -Filme:
Shooting Stars
Mein Freund Max (54) ist voll arbeitslos, nimmt sich zur Berlinale aber immer frei. Er sitzt dann in den einschlägigen Lokalen und Lobbys herum, wo er von vielen Leuten huldvoll angelächelt und begrüßt wird: Sie halten ihn für einen berühmten Regisseur oder Filmbusinessman – zu Recht, denn er sieht genauso aus. „Jedes Jahr gibt es mehr Mädels, die ganz scharf auf mich sind“, meint er. „Wenn ich vorm Borchardt Autogramme gebe, schreibe ich ihnen jetzt immer meine Telefonnummer dazu.“
Max ist nicht der einzige Abstauber auf der Berlinale, die immer mehr zu einem Publikumsfestival wird. Die Leute sind jedoch mitnichten an den Filmen interessiert. Wenn man früher von einem Trend zum „hinteraktiven Medium“ sprach, womit gemeint war, dass hinter der Kamera mehr los ist als davor, dann muss man nun von einer „hinteraktiven Projektion“ sprechen, d. h., der wahre Film läuft vor den spotlighterhellten Kinos ab – und nicht in den dunklen Sälen.
Dazu hat die Berlinale-Verwaltung selbst wesentlich beigetragen, indem sie 1. ihre durchgehend blödsinnigen Wettbewerbsbeiträge im fünfstöckigen Musicalcenter am Potsdamer Platz präsentiert, wo sich zwar jeder als VIP vorkommt, wenn er da reingeht, aber dann nichts vom Film mitkriegt; und 2. wie verrückt die Springerstiefelpresse hofiert, die sich einen Dreck um die Filme schert, dafür aber jede Filmstartitte in Großformat feiert. Das macht insofern Sinn, als der Spielfilm generell am Ende ist – so wie vor ihm die Oper und das Musical. Es sind alles nur noch vage Versprechungen auf echte Pornografie: Sieht man am Ende, wie er ihn reinsteckt oder nicht? That’s the question!
Und weil man das in jeder Sexshopkabine haben kann, halten sich mehr und mehr Berlinale-Besucher gleich an den Glamour drum herum: „Die Sucht nach dem Chichi zeigt sich immer nackter“, so sagt es der Paris-Bar-Besitzer Michel Würthle, der diesem Trend freilich auch nur noch dumpf nachhechelt. Dahinter steckt aber doch ein echtes menschliches Rühren, ja, eine Widerständigkeit gar.
Bekanntlich waren die 68er wesentlich filmorientiert: Wie die taz gerade anlässlich der Premiere von Bernardo Bertoluccis „Träumer“ schrieb, war damals das Kino „der politischste Ort“. Zu erinnern sei an „Viva Maria“, „Die Schlacht um Algier“, „Sacco und Vanzetti“, sowie an Godards, Pasolinis und Antonionis Filme … Noch 1975 gingen meine Freundin und ich in Paris jeden Abend zusammen mit anderen Pärchen ins Kino – grauenhaft! Denn eigentlich verstanden wir uns als absolut agoraphil. Alles Einbildung!
In meiner WG in der Mommsen wohnte sogar mal ein Germanist, der zunehmend agoraphob wurde. Am Ende kam er nur noch aus seinem Zimmer, wenn wir anderen schliefen. Zur FU ging er schon lange nicht mehr, dafür besuchte er nachts immer irgendwelche Spätvorstellungen. Folgerichtig nahm er irgendwann einen Job im Arsenal an.
Wenn ich heute an dessen Betreiber, das Ehepaar Gregor, denke, das seit 1970 für die Ausrichtung der 68er-Sektion des Berlinale-Forums zuständig ist, dann überkommt mich leises Mitleid: Mehr als ein Drittel ihres langen Lebens haben sie in dunklen Kinosälen verbracht! Ist demgegenüber nicht die Filmignoranz all der Berlinale-Besucher, die nur ein Interesse am Scheinwerferlicht, an den TV-Kameras, den roten Teppichen und den halb nackten Filmstars haben, viel lebendiger und gesünder? Ist der Platz vor den Kinos nicht vielmehr die Agora – und drinnen nichts als Lug und Trug: idiotische, ausgedachte Handlungen und hanebüchene Dialoge bzw. Tricks/Stunts von überbezahlten Halbaffen in teuren Kulissen?
Roland Barthes vermutete bereits: „Amerikanischer Film – das ist ein Pleonasmus.“ Heute, da man Bestseller nach US-Blockbustern schreibt (Jonathan Franzen, Elizabeth Wurtzel), sich nachts als Hauptdarsteller träumt und tagsüber in Lebensplanung und Outfit berühmte Filme kopiert, ist es nur konsequent, wenn man wenigstens auf der Berlinale diesem ganzen Schwachsinn zu entkommen trachtet, indem man die Filme meidet und sich gleich unter die Filmschaffenden mischt.
Max ist es übrigens schon zweimal passiert, dass so eine Berlinale-Braut, die ihn in ihr Hotelzimmer einlud, dort fragte, ob er was dagegen habe, wenn sie „das Ganze“ auf Video festhalte.
Über Dreharbeiten
In der Wiener Straße in Kreuzberg standen sich „Bullen“ und „Autonome“ gegenüber, die Straße war mit Polizeifahrzeugen abgeriegelt. Seltsam nur, dass die Polizisten ganz entspannt wirkten, obwohl die jungen Antifas mit Baseballschlägern bewaffnet waren: Das hat es in Kreuzberg bisher noch nicht gegeben, auch nicht, dass die Kontrahenten neun Tage lang „kämpften“ – und zwar immer vor dem Fischrestaurant von Demirel in der Wiener Straße 10: Hier sollte sich eine Gruppe von Neonazis verschanzt haben. Tatsächlich war dieses Gartenlokal einst eine SA-Kneipe, mit einem „wilden KZ“ im Keller, wo sich eine Kegelbahn befand. Von hier aus stürmten die rechten Rollkommandos einst mehrmals das jüdische Kaufhaus gegenüber: Heute befindet sich dort eine Feuerwehrwache.
Die Gefechte vor dem türkischen Restaurant waren inszeniert – für die RTL-Produktion „Abschnitt 40“. Der Regisseur hatte das Lokal in „Spreeklause“ umbenannt, der Wirt bekam für die Dauer der Dreharbeiten ein Ausfallhonorar. Zwar passte alles nicht recht zusammen: die Überbewaffnung der Autonomen, die Anwesenheit von Neonazis ausgerechnet in Kreuzberg und dann noch in einem türkischen Lokal, die Schüchternheit der Polizisten-Statisten -, aber eigentlich war das auch egal, denn fast täglich wird irgendwo in Berlin ein Aspekt aus der jüngsten deutschen bzw. Berliner Vergangenheit von einem Filmteam verbraten: RAF, 2. Juni, Stasi, Love Parade, Christiane F., Russenmafia, Führerbunker, Mauertote, der 8. Mai, der Kreuzberger 1. Mai, der 20. Juli, der 17. Juni, der 9. November – 1918, 1968, 1989 … Nicht zu vergessen die akuten filmisch aufbereiteten Juvenilprobleme mit Multikultitouch und deutschen Halbstars, die um Liebe, Sex, Eifersucht, Partydrogen, Schwangerschaft und Autorennen kreisen!
Nicht nur leben immer mehr Ich-AGs davon, dass sie diesen Filmproduktionen in puncto Schminke, Catering, Kabel und Kostümen zuarbeiten, auch an den vielen Locations, die für diese Filme benötigt werden, bleibt immer mehr hängen: Der Tierpark in Friedrichsfelde verlangt zum Beispiel 200 Euro die Stunde fürs Drehen, das leer stehende „Café Moskau“ in der Karl-Marx-Allee nimmt 1.000 Euro pro Tag. Auch die Allianz-Versicherung als Besitzerin des einstigen Stasi-Versorgungstraktes in der Normannenstraße will für jede authentische filmische DDR-Vergangenheitsbewältigung 1.000 Euro täglich.
Die Low-Budget-Filmer müssen sich deswegen etwas einfallen lassen. Der Regisseur Andreas Goldstein von Next-Film wich etwa für eine kleine Stasi-Szene in seinem Film „Detektive“ in den Trauungssaal des Standesamtes von Mitte aus, weil der nur 50 Euro die Stunde kostete. Bei bestimmten Locations wollen aber darüber hinaus auch noch die normalen Nutzer pekuniär ruhig gestellt werden: Im Märkischen Viertel war das eine die Dreharbeiten störende Jugendgang, der der Regisseur nur mit einer Einladung ins nächste McDonald’s beikommen konnte; am Bahnhof Zoo wurden neulich die Fixer von einem Fernsehteam laufend mit Bier und Tabak versorgt, damit sie sich so gaben, wie sie dort immer am U-Bahnausgang rumlungern; und auch die Gäste des Lokals „Stiege“, wo man früher gerne „Liebling Kreuzberg“-Szenen drehte, wurden kürzlich von einem Filmteam gebeten, sich „ganz normal, wie immer“ zu verhalten, also zu reden, zu essen und zu trinken. Dafür spendierte die Regisseurin ihnen Rotwein und Grappa. In Dimitris Kreuzberger Kneipe „Markthalle“, die vor allem durch „Herr Lehmann“ bekannt wurde und seitdem ein Schnitzel gleichen Namens auf der Speisekarte führt, scheinen viele Gäste nur darauf zu warten, dass sie dort mal wieder gefilmt werden – und dabei auch noch zu einer kostenlosen Mahlzeit kommen.
Viele russische Exilanten zieht es als Kleindarsteller nach Babelsberg: Einige der dort ansässigen Filmfilm-Firmen annoncieren seit „Stalingrad“ und „Der Pianist“ ihre Castingtermine dann auch regelmäßig in den hiesigen russischen Zeitungen. Andere verbinden ihr Casting listig mit Top-Events – wie eine „Miss-Ostdeutschland-Wahl“ in einer Rathenower Großdisko.
Bei großen Atelierfesten und sonstigen Feiern passiert es immer öfter, dass plötzlich ein Kamerateam auftaucht – und statt dass die Gäste wie weiland die Kommune 1 oder die Kreuzberger Autonomen es sich verbeten, ohne Bezahlung gefilmt zu werden, zahlen die Filmer anschließend bloß den Gastgeber aus: für seine „gelungene Party-Inszenierung“, die genau genommen nur ihnen galt. Weil viele Partygäste es inzwischen sogar genießen, wenn sie vorübergehend in einen Filmscheinwerfer getaucht werden, gibt es auch bereits Fakefilmteams, die zu solchen Anlässen auftauchen und sich wichtig machen – obwohl sie überhaupt nichts drehen und auch gar keinen Film eingelegt haben.
Wenn das Kino die Couch der Armen ist, wie Roland Barthes meinte, dann wird im Zeitalter des medialen Tittitainment der Kurz- und Kleindarsteller bald den Industrieproletarier ersetzen.
Dreidimensionale Filme
Bei der Europremiere des 45 Minuten langen Unterwasserfilms „Sharks 3D“ im Imax am Potsdamer Platz wurden die Zuschauerreihen mit verlosten Karten aufgefüllt. Der anschließende Applaus fiel dennoch mäßig aus: „Zu wenig action!“, bemängelten viele. Da ist der Kinobesitzer „Discovery Channel“ selbst schuld, denn sein Programm ist ansonsten voll mit blutrünstigen Haifilmen, in denen die Kameramänner ständig neue Haischutzvorrichtungen testen. „Sharks 3D“ wurde dagegen ohne Taucherkäfige gedreht; er will „das schlechte Image dieser Tiger der Meere korrigieren“, wie die Filmemacher Jean-Jacques Mantello und Jean-Michel Cousteau vorab erklärten. Mit dem 3D-Verfahren präsentierten sie uns diese Fische nun erstmalig zum Greifen nahe: Ich musste ein paarmal sogar den Kopf einziehen, um einer vor ihnen flüchtenden Makrele auszuweichen. Die Haie wurden jedoch meistens in ruhigen Einstellungen und von ihrer besten Seite gezeigt, denn die Regisseure gingen davon aus: „Es gehört zu unserer Natur, nur das zu schützen, was wir mögen.“ Der Mitproduzent aus der UN-Umweltschutzbehörde erklärte: „They are not man-eaters. Sharks are there to do their job: cleaning up the ocean!“
Zu den Unterwasser-Filmpionieren zählte Hans Hass, der seine Ausrüstung noch speziell anfertigen lassen musste, heute kann sich jeder Taucher damit in seinem Unterwasser-Shop eindecken. Das haben wir vor allem dem „Calypso“-Team von Jacques-Yves Cousteau zu verdanken. Sein Sohn Jean-Michel Cousteau präsentierte nun als Präsident der „Ocean Futures Society“ den Film „Sharks 3D“. In Berlin läuft parallel dazu eine Hai-Komödie über seinen Vater: „Die Tiefseetaucher“ von Wes Anderson, die man sich ebenfalls ansehen sollte. Inhaltlich geht es, wenn ich so sagen darf, um das ständige Filmen und Gefilmtwerden, damit man weiter im Geschäft bleibt – und weiter mit der hier „Belafonte“ genannten „Calypso“ über die Meere schippern kann, wobei man auch schon mal die Konkurrenz piratisiert und selbst böse piratisiert wird; zu allem Überfluss meutern irgendwann auch noch die Praktikanten an Deck. Über und unter Wasser nichts als Haie, wobei sich egoistische Leidenschaften gegen alle ökologische Moral stemmen: Auf die Frage, welchem „wissenschaftlichen Zweck“ denn seine „Jagd auf den Jaguarhai“, der seinen besten Freund tötete, diene, antwortet Captain Ahab/Nemo/Bligh/Cousteau/Zissou (gespielt von Bill Murray): „Rache!“
Noch reiner um die ökonomische Verwertung von Raubfischen kreist „Darwins Albtraum“ von Hubert Sauper und Nick Flynn. Darin geht es um den Nilbarsch im Victoriasee, dessen Filetstücke in die EU exportiert werden, während den Einheimischen nur Kopf und Schwanz bleiben. „Bevor der Barsch im Victoriasee ausgesetzt wurde, gab es hier viele Fischarten. Er fraß sie alle auf. Aber ökonomisch ist das gut“, so beurteilt ein Fischexporteur diese postkoloniale und ökologische Katastrophe.
Wer danach noch näher an den Victoriabarsch ranwill, dem sei die Lebensmittelabteilung des KaDeWe und das „Nordsee“-Restaurant in Mitte empfohlen. Lebende Haie gibt es schräg gegenüber im Sea Life Center des Aqua-Doms zu sehen, halb lebende im „Shark-Club“ an der Friedrichstraße. Die kleinen Clownfische aus „Findet Nemo“ schwimmen im Seewasseraquarium der Kantine des Arbeitsgerichts am Lützowplatz sowie auch in mehreren Aquarien der beiden Zoos. Dort leben auch etliche Seeschildkröten. Die von innen leuchtenden Meerestiere aus „Die Tiefseetaucher“ kann man real in einigen Neuköllner Tierhandlungen bewundern: Es sind Zebrafischchen aus dem Labor der taiwanesischen Firma Taikong Corp., denen man das Gen einer Qualle, die fluoreszierendes Protein synthetisiert, auf das Genom pfropfte. Ihre Einfuhr in die EU-Länder ist noch verboten, weswegen es dieses erste transgene Haustier vorerst nur als Bückware gibt – ab 39 Euro.
Die doppelten Berliner
und die halbe Miete
Seit dem Umzug der Berlinale vom Zoo-Palast an den Potsdamer Platz ist die Paris-Bar nicht mehr so von Cineasten überlaufen. Deswegen horchten wir auch auf, als ein Mann am Nebentisch seiner Begleiterin auf die Frage, was er denn vorhabe, antwortete: „Ich will einen Film machen!“ Für seine Begleiterin schien das jedoch keine Überraschung zu sein – sie fragte nur zurück: „In Schwarzweiß oder Farbe?“ Das stand wohl noch nicht fest. Heraus kam kam dann aber, dass der Mann in Kalifornien lebte und genug Geld bekommen hatte, um einen Berlin-Film „17 Jahre nach dem Mauerfall“ zu drehen, wobei er jedoch noch auf der Suche nach „einer wirklich guten Geschichte“ war. Und das war auch der Grund, warum er mit der Frau in der Paris-Bar saß.
Sie war eine „Hauptstadt-Journalistin“, wie er sie nannte, und lebte bereits seit längerem hier. Vorher hatte sie in Köln gearbeitet, war dann aber nach Berlin versetzt worden – „anfangs gegen meinen Willen“, wie sie ihrem Gesprächspartner erzählte, um damit anzudeuten, dass sie „noch nicht so drin“ sei – in „diesen ganzen Berlin-Diskursen“. Der Mann kuckte sie daraufhin erstaunt an – und sie präzisierte: „Ich komm zu nichts, höchstens, dass ich nach Feierabend noch zur Kontaktpflege manchmal in eine Kneipen gehe, in denen sich Abgeordnete treffen.“ Sonst habe sie noch nicht viel mitgekriegt von der Stadt, außer dass sie mal mit einer Kollegin und deren Kinder in die zwei Berliner Zoos gegangen sei. „Erzähl mir was von den Zoos“, bat der Mann.
Es stellte sich heraus, dass ein Freund von ihm kurz nach der Wende schon einmal mit amerikanischem Geld einen „Berlin-Film“ gemacht hatte – auf die nämliche Art und Weise, indem er vor Ort eine „tragfähige Geschichte“ gesucht und gefunden hatte: „Ein Gefreiter der Roten Armee ist desertiert, als seine Einheit aus Berlin abgezogen wurde. Er versteckt sich im Tierpark Friedrichsfelde – und ernährt sich dort von dem, was die Tiere täglich zu fressen kriegen. Irgendwann gelangt er in den Besitz einer Uniform – und betätigt sich fortan als Aufsichtsperson. Da gerade ein Hundeverbot im Tierpark durchgesetzt werden sollte, ermahnt er die Besucher, ihre Hunde nicht von der Leine zu lassen. Ansonsten macht er die Entdeckung, dass im Zoo nachts mehr los ist als am Tag. Das war die ganze Story, wobei man das mit der Uniform zuletzt sogar noch weggelassen hat …“
„Wer hat denn den Rotarmisten gespielt?“, wollte die Frau wissen. „Ich habs vergessen“, sagte der Mann, „der Film war ein Flop. Aber erzähl mir mehr von den Zoos, ich wusste gar nicht, dass es hier zwei gibt.“
„Es gibt hier alles doppelt“, meinte die Frau. „Alle kulturellen und sozialen Einrichtungen gibt es einmal im Westen und einmal im Osten. Sogar die Charaktere, Lebensentwürfe und Projekte. So trifft man zum Beispiel in einem Westberliner Supermarkt einen Mann aus dem Osten, der die Kunden auf Türkisch und Kurdisch begrüßt und ihnen beim Einpacken hilft – und umgekehrt gibt es im Osten in der vietnamesischen Großmarkthalle jemanden aus Westberlin, der sich nahezu komplett in die vietnamesische Szene integriert hat.“
„Das ist in Amerika nichts Ungewöhnliches“, unterbrach sie der Mann, „lass uns lieber noch mal auf die zwei Zoos zurückkommen…“
„Ihr scheint da drüben Berlin unbedingt mit ,Hinter Gittern‘ identifizieren zu wollen“, meinte die Journalistin etwas spitz, „da könnte man auch zwei Gefängnisse nehmen, eins im Westen und eins im Osten. Die Ostler im Westknast sehnen sich zum Beispiel nach dem Ostknast zurück, weil da die Gefangenen untereinander angeblich mehr kommuniziert haben. Andererseits haben sie in den Westknästen mit dazu beigetragen, dass die Gefangenen sich jetzt landsmannschaftlich segregieren – in Afrikaner, Russen, Araber, Türken, Deutsche und so weiter…“
„In Amerika ist das schon lange üblich“, meinte der Mann – bereits etwas müde, wohl weil das Gespräch immer wieder auf Europa/Amerika hinauslauf.
„Interessieren dich die Ost-West-Probleme in Berlin eigentlich?“, fragte die Frau.
„Not really,“ bekam sie zur Antwort, es sei jedoch sehr freundlich von ihr, dass sie sich die Zeit für ein Gespräch darüber genommen habe. „Lass uns noch was trinken – und vergiss die Filmidee, ist nicht so wichtig, ich hab schon einige Autoren darauf angesetzt. Eigentlich brauch ich jetzt nur noch ein paar gute Drehorte.“ „Aber wofür?“, fragte die Frau – schon fast verzweifelt.
„Eine gute Location ist bereits die halbe Miete“, bekam sie zur Antwort.
Die Pioniere vom Wedding
Im russischen Sexshop vis a vis von Schering gibt es einige Löcher in den Wänden zwischen den Videokabinen. Hierhin lotste eines Tages Jürgen seinen jungen griechischen Freund Papadopulos. Der Name wurde von der Redaktion geändert. Letzterer heißt eigentlich Alexander.
Seit einer Rockveranstaltung im Humboldthain hatte er in Jürgen einen großzügigen Spender gefunden, der ihm immer wieder Geld lieh, ohne es zurückzuverlangen. Irgendwann wollte er dafür jedoch Zärtlichkeiten. Alexander wollte davon aber nichts wissen. Andererseits fand er Jürgens Wunsch auch wiederum nicht so abwegig oder unverschämt, dass er ihn fortan gemieden hätte.
Nach wie vor trafen sie sich im Musik-Café am Nettelbeckplatz. Und Jürgen gab Alexander auch weiterhin einen aus, wenn dieser mal wieder pleite war. Irgendwann einigten sie sich sogar: Und zwar im besagten russischen Sexshop. Die meisten Sexshops, denen z.T. Bordelle angeschlossen sind, befinden sich inzwischen in russischer Hand – was aber wenig oder gar nichts besagt.
Alexander ging in eine der Kabinen, schaute sich die Pornos an und wichste dabei – während Jürgen ihm durch das Loch der Kabine nebenan zuschaute – und sich dabei ebenfalls einen runterholte. Es klappte jedoch nicht. Alexander entschuldigte sich später damit, dass er sich „irgendwie beobachtet gefühlt“ habe. Jürgen konterte: „Du beobachtest doch selber – wie die Frauen in den Filmen z. B. blasen, ficken und wichsen …“
Sie versuchten es noch einmal. Anschließend meinte Alexander: „Diesmal lag es am Sekundenanzeiger des Geldautomaten. Da waren nur noch ein paar übrig und ich überlegte, ob ich so kurz vorm Orgasmus noch ein ganzes 2-Euro-Stück einwerfen sollte – ein anderes hatte ich nicht. Das hat mich dann aus der Kurve getragen“.
„Das hast du schön gesagt,“ erwiderte Jürgen, der in seiner Freizeit gerne Ausflüge an den Lausitz-Ring organisiert und einen BMW fährt. Schließlich klappte es aber doch. Und dann gelang es Alexander sogar noch, sich mit dem Keuchen von Jürgen in der Nachbarkabine zu koordinieren. „Ich komme mir bald vor wie ein Flugzeugpilot, der einen Crash ansteuert“, meinte er neulich zu mir. „Unglaublich, auf was Du da alles achten musst: die geilsten Stellen in den Filmen finden und anklicken, auf das Display des Münzautomaten achten, das Atmen in der Nachbarkabine genau registrieren und das alles dann noch mit dem eigenen Orgasmus per Hand kombinieren …“ Dabei schaute er mich beifallsheischend an. Oder jedenfalls kam es mir so vor. Sein Vergleich mit den Todespiloten gefiel mir jedoch nicht.
Eher erinnerte mich seine Leistung in der Wichskabine an das „Prüffeld 7“. So heißt ein Film über Pynchon und Peenemünde vom Berliner Regisseur Robert Bramkamp. Dabei geht es durchgehend um die Abwesenheit der Frau beim Bau der Rakete (V2), die dann selber eine Frau ist, kein Phallus, wie man naheliegenderweise denken könnte. Das zentrale Verbindungselement zwischen Mensch und Maschine ist dabei die Hand. Der Film endet dann auch mit dem Pynchon-Song „There’s a Hand“.
Das erzählte ich Alexander. „Und? Weiter …“, fragte er. „Na ja,“ sagte ich, „bei Dir ist die Frau dreifach abwesend – erst nur als Video, dann über Bildschirm und der dann noch mal gespiegelt. Anwesend ist dagegen eine Restzeitanzeige sowie das interpretationsbedürftige Atmen nebenan. All das musst du mit der Hand am Joystick quasi steuern, wobei die Hand selbst gesteuert wird, in dem Moment, wo die Pflicht gegenüber dem Mann nebenan in eigene Lust übergeht. So seh ich das.“ „Ich werd mir den Film daraufhin mal ankucken“, versprach Alexander.
Rinderpfleger und -filmer
Dass gerade ich – gelernter Rinderpfleger aus der Wesermarsch – den neuen Film von Jean Rouch, „Der Traum ist stärker als der Tod“ rezensieren sollte … Denn er handelt von der Rinderpflege am Niger. Dort werden fünf Sprachen gesprochen – ich verstand kaum eine. Aber die früheren Jean-Rouch-Filme spielten bereits an diesem Fluss: „Madame L’Eau“ und „Ich bin müde vom Stehen, ich liege“. Und dabei ging es ebenfalls um die Wahrheit von Träumen, das Opfern von Tieren, das Wahrsagen mit Sandzeichnungen und um Frauen, die sich in Trance tanzen.
Im Mittelpunkt dieses Jean-Rouch-Films stehen wieder drei Senioren – ein alter Bauer (mit Jaguar-Cabrio diesmal), ein alter Godié-Spieler und ein alter Hirte. Eindringlich verdeutlicht der Regisseur wieder seine „Cinéma verité“-Überzeugung, dass die Kamera die Handlung beeinflusst, weswegen sie mit einbezogen werden muss. Hier ist er es jedoch eher selbst, der bei den Veranstaltungen dabei ist und von den Tänzerinnen Huldigungen entgegennimmt, es wird ihm sogar ein Lied gewidmet.
Während der Film „Madame L’Eau“ von der landwirtschaftsschädigenden Selbstveränderung des Flussbettes handelt – und wie Jean Rouch dabei zusammen mit dem holländischen Entwicklungshilfeminister helfend eingreift -, geht es in „Le rêve plus fort que la mort“ um die Veränderung des Niger durch den Menschen selbst: Auch das muss „geheilt“ werden. Während damals noch Windmühlen aus Holland halfen, müssen nun allerhand Ritualopfer her.
In der Wesermarsch hat man stets beides auf einmal erledigt: Erst den physikalisch-technischen Deichbau und dann – auf der Krone – ein metaphysisches Schafopfer. Nicht zu vergessen die ganze Papiermagie vor diesem Fluss-Doppelzauber: Stempel, Unterschriften, Bittgesuche etc. Auch die Feste sind hier wie dort nicht nur jahreszeitlich identisch, sondern auch ähnlich ritualisiert, wobei man im Film jedoch nicht erfährt, was bei den Solos Angabe, Selbstdarstellung und peinlich ist. Aber das weiß man bei den hiesigen Tanzveranstaltungen auch nicht genau. Generell geht es stets darum, dass die Männer mittels Musik die Frauen zum Tanzen bringen.
Selten sah ich so gute Rinderaufnahmen wie in diesem Film: schwimmende Rinder, ruhende Rinder und ganze Herden, die am Ufer entlanggetrieben wurden. Gewiss, der Elbemarschbauer und Regisseur Detlev Buck hat einen ganzen – gelungenen – Film über Rinder gedreht. Aber wer den Film „Die Generallinie“ von Sergej Eisenstein gesehen hat, weiß, wie selbst großen Filmern die Rinderaufnahmen völlig misslingen können.
Die Rinder am Niger sollen jedoch auch noch – laut Forumskatalog – wunderkräftig, das heißt bei der Heilung – „damit die Dinge wieder so werden, wie sie waren“ – wesentlich sein. Ich verstehe das so: „Wer keine Rinder mehr hat – ist im Arsch!“ In dieser alten Wesermarschweisheit steckt naturgemäß eine Menge Metaphysik, aber wenn es im Film noch metaphysischer gemeint ist, dann habe ich es nicht verstanden. Es gab für die Übersetzung Kopfhörer im Kino, aber meine waren tot.
Der „Otzenrather Sprung“
Die riesigen Schaufelbagger haben sich schon fast an das kleine Bushäuschen herangefressen. Es sieht ähnlich aus wie in der Lausitz, wo das Dorf Horno sich weigert, zugunsten der Braunkohle zu weichen.
Jens Schanze wollte in seiner Schwarzweiß-Doku eigentlich zeigen, wie sich die Menschen auf ihren Umzug aus der westdeutschen Tagebauzone Garzweiler II – ein paar Kilometer weiter am Niederrhein – vorbereiten.
Doch während der einjährigen Dreharbeit begegnete er vor allem Menschen, „die angesichts der fremdbestimmten Zukunft wie gelähmt sind“. Im Schnitt-Gegenschnitt lässt er die Betroffenen, Arbeiter und Bauern, sowie die Macher, Rheinbraun-Manager, zu Wort kommen. „Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Planung des neuen Hauses“, ruft z. B. ein für den Abbau verantwortlicher Rheinbraun-Direktor den Bewohnern eines Dorfes, das abgerissen wird, zu. Im Gegensatz zu den ostdeutschen Braunkohleopfern Horno und Heuersdorf regt sich in den drei Dörfern des rheinischen Reviers jedoch kaum Widerstand, auch wenn hier 50 Quadratkilometer Heimat verschwinden sollen.
Die Baggerbrigaden scheinen vor allem von der Größe des Vorhabens enthusiasmiert zu sein. Und die Ortsfunktionäre raten den resignierten Leuten: „Lassen Sie kein Fest aus in den nächsten Jahren.“
Lange bevor die Großbagger dem Ort nahe kommen, stirbt alles Lebendige. Bis es nur noch „um die Interessen der Umsiedler“ geht – und um ihre Kooperationsbereitschaft: „Mit 98 Prozent der Leute komme ich klar“, sagt ein Umsiedlungs-Manager. Die Betroffenen meinen jedoch: „Ein Scheißspiel – meiner Meinung nach.“ Es ist schwer, dem Druck des Konzerns und des Staates zu widerstehen.
Die Aktivisten in der Lausitz haben noch nicht aufgegeben. Für die Garzweiler-Orte scheint es zu spät zu sein.
Der Film von Jens Schanze wirkt schon nostalgisch. So nostalgisch, das ihn irgendwann auch die Rheinbraun zeigen könnte. „Wir sind sehr offen“, meint ein Umsiedlungsberater. Aber wie kann ein Filmemacher denn auch solidarisieren?
Ein Film über ein Möbelkaufhaus
Unverständlich, warum das Berlinale-„Forum“ diesen Film „Mit Ikea nach Moskau“ ablehnte. Obwohl ich zugeben muss, dass er etwas dichter hätte sein können. Egal, die Eröffnung der 153. Ikea-Filiale und dann noch in Moskau – das ist schon eine Dokumentation wert. Dabei hatte Regisseur Michael Chauvistré auch noch ausgesprochenes Glück mit den Mitwirkenden: zwei sehr souveränen Verkäufern aus der alten Spandauer Ikea-Filiale, die einst zur Versorgung Westberlins gebaut worden war. Manuela ist eine Realistin aus dem Osten und Ulf ein sentimentaler Wessi. Bei Ikea-Spandau, Westberlin, lernten sie sich lieben, verließen ihre jeweiligen Partner, setzten ihre Kinder auf E-Mail-Distanz und zogen zusammen. In Chauvistrés Film „Mit Ikea nach Moskau“ bauen sie die Moskauer Filiale mit auf.
Kurz vor dem Eröffnungstag beherrscht die beiden vor allem die bange Frage: Werden genug Kunden kommen? Die deutsch-schwedisch-russische Ikea-Truppe fühlt sich ein wenig wie ein großes Theaterkollektiv vor der Premiere. Die Regale wurden mit Werbegeschenken vollgepackt, eine Tombola organisiert, ein Wachdienst eingerichtet, „Hamburger Reiter“ angemietet usw. Doch die Massen kommen schon Stunden vor der Eröffnung, insgesamt sind es schließlich 37.000 Menschen, die sich da auf dem riesigen Ikea-Parkplatz in klirrender Kälte zu immer neuen Schlangen formieren. Zuletzt hilft sogar der aus Schweden eingeflogene Firmenpatriarch Ingvar Kamprad aus. Auf diese lockere Weise lernt die kleine Kassiererin Manuela den großen Kreator der Ikea-Philosophie persönlich kennen, während Ulf immer noch gekränkt darüber ist, dass man ihn nicht an einer Sitzung teilnehmen ließ, auf der er dem berühmten Mann hätte nahe kommen können.
Das Filmteam folgt einigen Moskauer Ikea-Kunden bis nach Hause, wo sie ihre Schränke, Lampen etc. sofort zusammenbauen und in Gebrauch nehmen. Denn das ist neben allem Gerede vom großartigen Teamgeist der Mitarbeiter, die permanent zusammen Ikea-Lieder singen, der Kern der ganzen Ikea-Philosophie – und ihres Erfolgs. Der US-Wirtschaftsforscher Jeremy Rifkin spricht von einer „schwerelosen Ökonomie“. Gemeint sind damit Firmen, die ihr fixes Kapital, also die Produktionsanlagen, nur pachten bzw. irgendwo und so billig wie möglich produzieren. So ließ Ikea früher viel in der DDR herstellen und jetzt in China. Während seiner Inspektion der Moskauer Ikea-Filiale kommt der Firmengründer Ingvar Kamprad darauf zu sprechen. Vor allem aber liegt ihm die Präsentation seines berühmten Billy-Regals am Herzen, das wahrscheinlich als einziges Ikea-Produkt noch in Schweden gemacht wird: aus handgefällten und dann zerschredderten Fichten.
Eine schwedische Studie über die Zunahme der „schwerelosen Ökonomie“ kommt zu dem Schluss, dass der Anteil des „intellektuellen Kapitals“ der meisten Unternehmen einen fünf- bis 16-mal höheren Börsenwert erreicht als das Sachkapital, von dem Ersteres sich zunehmend abkoppeln. Gleichzeitig werden jedoch auch angehende Intellektuelle bei Ikea als Konsumenten mit der hinterm Horizont verschwundenen Produktion symbolisch wieder versöhnt, indem sie zu Hause ganz alleine, mit einer komischen Gebrauchsanweisung in der Hand, das Halbfertigprodukt fertig erstellen.
Im Grunde hat der alte Schwede das Kunststück fertig gebracht, Leo Tolstoi mit Henry Ford zu vereinen. Dazu kommt nun noch eine Prise Bill Gates, also die verdammte Logistik. Schon am ersten Tag gingen in Moskau die Ikea-Bleistifte aus! Für Momente malte sich bei Dispatcher Ulf das entsetzte Gesicht von General Paulus aus – angesichts der absoluten russischen Weite und Wegelosigkeit. Dabei wurden die deutschen Ikea-Mitarbeiter durchaus komfortabel in Moskau untergebracht, und die schwedischen Mitarbeiter noch komfortabler, etwa mit rundum verspiegeltem Orgien-Bett. Bei Ikea kann man solche Schweinereien zum Zusammenbasteln bis heute noch nicht kaufen!
Das, was die DDR befürchtete zu werden – eine verlängerte Werkbank der Westkonzerne – hat Ikea umgedreht und schon längst realisiert: Der Westkunde wird als Individuum spielerisch zur verlängerten Werkbank des Ostens, von wo die Ikea-Halbfertigprodukte angeliefert werden. Und der halbgebildete Westkunde weiß dies durchaus zu schätzen. Das ist nicht nur eine Frage des Preises. Denn ohnehin werden in der pseudointellektuellen Dienstleistungsgesellschaft von Industrie und Handel immer mehr Reparatur- und Handwerksbetriebe „gelegt“, indem man zunehmend laiengerechtere Halbfertigprodukte anbietet. Bei den Heimwerker- und Baumärkten vergeht kein Tag, an dem nicht ein neues Do-it-yourself-Verfahren angeboten wird. Hierbei kommt Ikea durchaus die Rolle der Avantgarde zu, indem es die Produktionslinie bis zum Kunden verlängert hat.
Eines der neuen Probleme, die dabei auftreten, besteht in der „Gebrauchsanweisung“. Als Prä-Ikea-Mensch lese ich so etwas nicht: Lieber nehme ich in Kauf, dass zum Beispiel meine Cracker irgendwann lappig oder pappig schmecken, als dass ich bei ihrer Verpackung nach Gebrauch die Laschen A und B wieder mit dem Schlitz C vereinige. Die Push-Button-Generation ist aber bereits anders „programmiert“: Es gibt inzwischen jede Menge junge Konsumenten, die nichts anderes als Gebrauchsanweisungen lesen – und im Internet kommunizieren. Das trägt natürlich zu deren Verbesserung bei, wie andererseits auch die Tendenz, sich mehr Mühe beim Verfassen von Gebrauchanweisungen in den diversen Sprachen zu geben. Die Exportnation BRD zum Beispiel bietet inzwischen in Kooperation mit großen Konzernen (u. a. Siemens) arbeitslosen Journalisten und Akademikern Umschulungen zu „Gebrauchsanweisungs-Redakteuren“ an.
Das führt dazu, dass die Do-it-yourself-Idee längst nicht mehr auf Hausausbau, Kachel- oder Klempnerarbeiten beschränkt ist. Bei den Elektronikgroßmärkten kann man sich bereits mit Hightech-Teilen eindecken, um sich seine eigenen Rechner, CD-Brenner und Drucker zu bauen. Der Tag ist nicht mehr fern, da die meisten Autofabriken, die ja nur noch mit vorgefertigten Teilen produzieren, schließen werden, weil man als Autokäufer sich einfach ein Paket zusammenstellen kann – und sich das Auto dann zu Hause in der Garage in Form wieder „voneinander unabhängig betriebener Privatarbeit“ (Marx) zusammenbaut.
Dass dieses Verfahren dem Holz-Kapital Schwedens einfiel, ist nicht zufällig, denn dort erheischte der proliferierte Sozialstaat geradezu solche „produktiven“ Freizeitbeschäftigungen für seine Bürger. Gesamtgesellschaftlich gesehen finden die von der Arbeit entsetzten Massen damit erneut Anschluss an die gesellschaftlichen Produktionsprozesse. Ikea ist damit eine privatwirtschaftliche AB-Maßnahme von fast schon globalem Ausmaß. Man könnte auch von einem Branchenfaschismus sprechen – wenn man sich noch der Nazi-Arbeitskampfparole „Massenkonjunktur – nicht Lohnkonjunktur!“ erinnert.
Jugoslawien ist das Partisanenland schlechthin. Und fast alle schrieben ihre Erinnerungen auf. Die Hälfte von ihnen, nämlich 400.000 Leute, hatte man sogleich nach dem Krieg in Rente geschickt, und die meisten von ihnen waren noch jung, um die dreißig etwa. Die „Kunst“ der neuen jugoslawischen Politiker bestand vor allem darin, die linke Partisanentradition mit den jeweiligen rechten Nationalismen zu verknüpfen. Dieser Prozess begann bereits unter Tito und war zunächst gegen die neomarxistische Studentenbewegung 1968 gerichtet. Nach deren Zerschlagung entstand eine Reihe von Filmen, die sich kritisch mit dem Land auseinandersetzten: die so genannte „Schwarze Welle“. Später wurde ihr von oben mit einer „Roten Welle“, in der das Partisanenthema mit Hollywoodstars verkitscht wurde, entgegnet.
In Berlin wurde jetzt der „schwarze“ Partisanenfilm „Frühe Werke“ von Zelimir Zilnik gezeigt, dem dafür 1969 auf der Berlinale ein Goldener Bär verliehen wurde. Der Regisseur war Dissident und gehörte zur Nomenklatura. Sein Film über drei junge Männer und eine revolutionäre Frau, die vergeblich die Kulturrevolution aufs Land zu tragen versuchen, zeigt, wie sehr die jugoslawische Studentenbewegung mit der im Westen identisch war.
„Frühe Werke“ bezieht sich zwar auf Marx, könnte aber genausogut auch auf Godard gemünzt sein. Und die Land- und Betriebsarbeit der vier Helden im 2CV könnte genausogut auch in Freiburg oder in der Toscana gedreht worden sein. Tatsächlich entstanden damals hunderte solcher oder ähnlicher Filme. Selbst die Hauptdarsteller sahen alle gleich nach Jeunesse dorée aus und gaben sich gerne nackt und natürlich. Da hat sich die Berlinale-Jury wohl gesagt: „Geben wir Zilnik den Bären – dann ärgern wir wenigstens Tito und nicht unsere neue Klasse!“ Die „balkan black box“ zeigte von Zilnik außerdem noch den 1994 entstandenen Film „Marmorarsch“. Dieser handelt von den neuen Pseudopartisanen – von „Männern!“, wie Merlin, einer von zwei Transvestiten, die die Hauptrolle darin spielen, abfällig meint. Als Prostituierte schläft sie vor allem mit jungen Serben, wobei sie sich als Blitzableiter für deren Aggressionen versteht. Was der Belgrader Anthropologe Ivan Colovic mit seiner Analyse einiger serbischer Alltagsmythen unter dem Titel „Bordell der Krieger“ versuchte, unternimmt hier Zelimir Zilnik, der inzwischen in Budapest lebt, in einem Spielfilm – mit wunderbaren Schauspielern.
Mit den alten Partisanen, die nicht sterben wollen, beschäftigt sich auch Emir Kusturicas Film „Underground“. Die Verbindung der Unbeugsamen mit der Oberwelt stellt ein Schmuggler her, der ihnen ihre selbst gebauten Waffen abnimmt. Er redet ihnen ein, die Deutschen würden noch immer das Land besetzt halten – „was inzwischen schon fast wieder Realität geworden ist,“ wie die „balkan black box“-Festivalveranstalter in ihrem Info schrieben. „Underground“ entstand 1995.
Mit der Vermarktung der Partisanen und ihrer alten Mythen befasst sich außerdem noch der kroatische Film „Marschall Titos Geist“. Daneben gab es aber im Rahmen des Festivals am Montag auch noch einen ganzen „Partisanenabend“ – im Verein der Visionäre. Dabei kamen neben einer Jugo-Oldie-Disco alte „Partisanenfilme im Original“ zur Aufführung. Zudem wurde in einer Reihe von Diskussionsforen mit Filmemachern und Produzenten aus dem ehemaligen Jugoslawien thematisch an die Filmbeiträge angeknüpft: „Im Mittelpunkt steht hier eine Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Transformation auf dem Balkan und ihr Potenzial für die Öffnung lokaler, unabhängiger Kulturlandschaften“. Aus diesen – ein etwas unglücklich gewähltes Wort – „Landschaften“ waren zuvor bereits einige pazifistische junge Anarchisten angereist, um in der Volksbühne-Ost von ihren „Projekten“ zu berichten.
In Berlin lebt inzwischen der 1953 geborene Filmregisseur Zoran Solomun. Sein Dokumentarfilm über den chinesischen Markt in Budapest handelt von vier Balkan-Intellektuellen, die sich nun auf ihre alten Tage als Schmuggler durchschlagen müssen. Zoran Solomun erzählte mir einmal: „Es stimmt, der Partisanen-Mythos hat sich bei uns lange gehalten. Als wir 1990 nach Berlin kamen, war meine Tochter 9 und mein Sohn 11 Jahre alt. Sie hat sich in ihrer Entwicklung als Mädchen nicht so sehr wie ihr Bruder mit mir identifiziert. Und diese ganze jugoslawische Partisanen-Geschichte interessiert sie kaum. Manchmal betrachtet sie z. B. meine Tante, die Partisanin war, wie eine Fremde. Mein Sohn hat dagegen etwas mehr von mir. Gerade dieser Tante schrieb er 1991 in einem Brief: ,Liebe Tante, es geht uns gut, Berlin ist eine schöne Stadt, hier sind alle Leute Deutsche – nur wir sind die einzigen Partisanen.‘
Er wollte sie natürlich ein bisschen ärgern. Gleichzeitig aber zeigt das, wie weit diese einfache Weltsicht – der Partisanen von einst – gegangen ist. Es hat natürlich in Jugoslawien immer Leute gegeben, die sich nie als Partisanen begriffen, immer nur als Kroaten, Serben etc. Aber fast alle, die an der Macht waren, hatten eine Identität als Partisanen.“
„Das Frühlingstreffen der Feldhüter“ von Dimos Avdeliodis
Das „Frühlingstreffen der Feldhüter“ ist eine kleine, aber genaue anthropologische Studie über Menschen in Uniform. Dimos Avdeliodis drehte ihn auf der Insel Chios. Bis in die Siebzigerjahre gab es dort wie auch anderswo in Griechenland die Institution der Agrophylakon – der Feldhüter. Sie schützten die Felder vor Fruchträubern, waren aber zugleich auch die basisnächste Polizeiinstanz der rechten Regierung auf den Dörfern. Hier – sozusagen auf dem Vorposten an der Volksfront – hatten sie die Freiheit der Verhaltenswahl.
Etwas überwachen heißt zuvörderst, gegen den eigenen Schlaf zu kämpfen. Nachdem der erste Feldhüter bei der Verfolgung einer jungen Feldfruchtdiebin überraschend gestorben ist, werden nacheinander vier neue eingestellt – alle scheitern: zu vier unterschiedlichen Jahreszeiten, die natürlich in der Landwirtschaft eine wichtigere Rolle als für die Menschen in der Stadt spielen. Der erste neue Feldhüter ist motorisiert und hat einen Hund, ist jedoch faul, abergläubisch und lässt sich von den Dörflern durchfüttern – er wird schließlich von einem Schwarm Bienen in die Flucht geschlagen. Spätestens seit Isaak Babels „Reiterarmee“ haben Bienenstöcke eine große Funktion bei der Schilderung von Kriegen auf dem Dorf. Für den Zweiten Weltkrieg sei der slowakische Roman „Die verlorene Division“ von Ladislav Tazky erwähnt. Zuletzt spielten sie in dem tadschikischen Dorf-Film „Der Flug der Biene“ eine Rolle.
Der zweite Feldhüter ist autoritär, übereifrig und schurigelt die Dorfbewohner, zum Beispiel zwingt er den Barbier, ihn noch nachts zu rasieren. Er liebt die Macht. Der schönen Feldfruchtdiebin kann er sich dementsprechend auch nur gewaltsam nähern. Der dritte ist älter und selbstbewusster, er biedert sich jedoch bald bei den in der Dorfkneipe Sitzenden an, und statt ihnen zum Beispiel das Kartenspiel zu verbieten, verfällt er selber dem Glückspiel. Zuletzt wird er verhaftet. Für die junge Diebin hat er keinen Blick, dafür klaut er ihr jedoch Holzscheite. Erst der vierte Feldhüter, der den Frühlingsdienst antritt – bekanntlich der schönste, aber auch anstrengendste -, konzentriert sich dann ganz auf das Mädchen. Ihretwegen rasiert er sich sogar. Und als er wegen mangelnder Meldungen entlassen wird, zieht er auch noch glücklich die Uniform aus – sodass dem Einfangen der Diebin – die natürlich inzwischen eine starke Uniform-Aversion entwickelt hat – nichts mehr im Wege steht: zwei glückliche Arbeitslose, die Täter und Opfer nur noch spielen – und zwar auf einem griechischen Tulpenfeld in der ersten warmen Sonne.
Avdeliodis hat seinen Film mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ unterlegt, außerdem sagt er, dass der letzte „Feldhüter des Frühlings“ für ihn Odysseus verkörpert: „Er weiß, dass das Leben etwas Vergängliches ist und man es für einen kurzen Augenblick ergreifen muss, solange noch Zeit ist … Auch Liebe ist eine Art von Krieg.“ Avdeliodis ist der Meinung, „dass jeder Filmemacher eines Tages an den Ort zurückkehren muss, an dem er aufgewachsen ist“, das meinen, glaube ich, alle Dorffilmer.
William S. Burroughs streichelt glutäugige Araberjungen, und Armin Mueller-Stahl trägt einen Tropenanzug: Der Regisseur Peter Goedel beschwört in einem abendfüllenden Filmessay noch einmal den Mythos der Stadt Tanger
Dies ist ein ärgerlicher Film, der nicht zum Schluss kommt, der keine Fragen oder Probleme aufwirft oder Spannung erzeugt, sondern nur noch einmal lang und breit in Tanger und um Tanger all die Zelebritäten zelebriert, die einem schon seit langem zum Halse raushängen. Zuerst einmal die schwulen Künstler: Truman Capote, Jean Genet, Allen Ginsburg, der zweite Sohn des Earl of Pembroke und W. S. Burroughs, von dem das Credo stammt: „Schriftsteller werden, reich und berühmt sein, in Tanger oder Paris rumhängen und über Proust reden, während man bekifft eine zahme Gazelle streichelt oder einen glutäugigen Araberjungen!“ Und drumherum trifft man dann all die reichen Müßiggänger, Kalten Krieger, Kriegsgewinnler, Adligen, Millionärstöchter und Malerinnen – vornehmlich aus den USA.
Ihre Hochzeit hatte diese Tanger-Party-Scene gleich nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Unabhängigkeit Marokkos 1956. Den Anfang machte Paul Bowles, aus einem völlig idiotischen Grund. Gertrude Stein sagte zu ihm: „Jeder geht nach Villefranche, wie langweilig, geh nach Tanger, das ist cool!“
Bowles blieb bis zu seinem Tod 1999 dort. Der Regisseur Peter Goedel hat ihn für seinen Film „Tanger – Die Legende einer Stadt“ noch interviewen können. Und dazu noch jede Menge andere ältere Menschen, die leider nur noch senile Plattheiten von sich geben. Der Autor Mohamed Choukri: „Tennessee Williams amüsierte sich gern“. Die Buchhändlerin Isabelle Gerofi: „Genet las dem Friseur Mallarmé vor – stellen Sie sich das mal vor!“ Der alte OSS/CIA-Agent Gordon Browne: „Die Deutschen wohnten im Hotel Rif, die Engländer und Amerikaner im Minzah-Hotel“. Der Schmuggler Sultan: „Es gab viele Methoden, die Ware aus dem Hafen zu schmuggeln.“ Die ehemalige Prostituierte Dona Anita: „Ich wurde in Tanger geboren. Was soll ich sagen. Es war großartig. Das kann man nicht beschreiben“. Die US-Malerin Marguerite McBey: „Wir waren um 8 Uhr eingeladen, kamen aber erst um 9.“ Der ehemalige Chefkoch des Restaurants „1001 Nächte“: „Die Zeit verändert alles.“ Und wieder Bowles: „Es gab jede Nacht Partys.“ Wieder Choukri: „Es war ein kleines Paradies.“ Dazwischen gibt es ein paar Dokumentaraufnahmen.
Weil es sich um einen „poetic film essay“ handelt, gibt es auch noch einen durchlaufenden, tiefsinnigen Filmstar: Armin Mueller-Stahl, der allerdings nichts anderes tut, als im Tropenanzug durch Tanger zu flanieren und den Geliebten der 1956 in der Stadt verstorbenen Marie Levant gibt. Zweimal spielt er in einem Hotelzimmer schlecht, dass er schlecht geträumt hat, wobei jedesmal ein Amulett Marie Levants vor seinem geistigen Auge auftaucht. Zitate aus ihren Briefen an ihn sequentieren die 96 Filmminuten: „Chérie, ich kann nicht schlafen / Chérie, unser erster Tanz, erinnerst Du Dich / Chérie, ich habe mehrere Einladungen zum Diner ausgeschlagen / Chérie, Von den großen Künstlern ist niemand mehr da / Chérie, heute nacht konnte ich lange nicht einschlafen / Chérie, gestern habe ich einen der wenigen schönen Tage erlebt / Chérie, ich muß jetzt los, ich bin mit John zum Essen verabredet. Ich liebe Dich.“ Dazwischen tröten arabische Flöten, denn die ganzen reichen Amis und Europäer haben sich in Tanger für die Einheimischen nicht interessiert, höchstens für ihre Musik. Außerdem war es den Marokkanern nicht erlaubt, deren Restaurants und Hotels zu betreten. „Es ist tragisch, was die Europäer da angerichtet haben,“ meint Juan Goytisolo, der einzige intelligente Interviewpartner in Goedels Film.
Zugegeben, ich bin ungerecht und habe den bösen Blick, weil ich keine Prominenten mag, erst recht keine amerikanischen und schon gar keine Männergesellschaften. Aber wer sich für Tanger und seine wilden Künstler-Drogen-Treffs von damals interessiert – für den ist der Farbfilm ein absolutes Must.
„Da waren so viele Mauern, da war nix mit Nähe. Nur purer Sex“: Carl Andersens „Märchen von der Liebe“
Die etwa 8 Paare sind so aufgenommen, als würden sie sich gegenseitig erzählen, warum es zwischen ihnen nicht geklappt hat. Dazwischen hat der Regisseur noch kurze Sequenzen aus einem vermeintlichen Amateurporno geschnitten, der damit endet, dass die weibliche Darstellerin endlos den auf sie gespritzten Samen ihres „Partners“, der zugleich Kameramann ist, wegwischt.
Wir sind zwar seit „Mein Essen mit André“ einiges an gefilmten Beziehungsgesprächen gewohnt, aber die 60-Minuten-Länge des Films von Carl Andersen ist gerade richtig. Irgendjemand hat ihn mal als „einzig männlichen Frauenfilmer“ bezeichnet – dabei gibt es unter den Regisseuren gar keine anderen.
Dennoch ist es wahr, dass in seinem Film die lesbischen Pärchenprobleme überwiegen. Da sagt die eine: „Es war ein Spiel – und wurde mir irgendwann zu viel.“ Und die andere – „Katja, 25, Kellnerin“ – sagt: „Da waren so viele Mauern, da war nix mit Nähe. Nur purer Sex ohne Bedeutung, das hat uns nicht weitergebracht …“
In einer anderen Beziehung sagt eine Verkäuferin: „Ich habe manchmal gerne gekocht für sie.“ Und ihre Freundin, eine Steuergehilfin, meint dazu: „Irgendwann wurde es zu viel: Immer war sie fröhlich, immer lächelte sie. Das hat mich wahnsinnig gemacht!“
Weil das alles nicht besonders erkenntnisheischend ist und der Regisseur auch sonst keine Fragen stellt, hat er neben den Slapstick-artigen Pornoeinlagen noch einen kleinen Witz parat: Die oben erwähnte sanfte, weibliche Katja entpuppt sich bei ihrer nächsten Beziehung – zu einem jungen Mann -als durchaus dominant. Er sagt über sie: „Ich dachte, das ist eine Frau, die weiß was sie will …Und natürlich pass ich mich da auch an dich an.“ Und sie sagt bloß: „Deine Schwäche war lächerlich.“
Vielleicht erkennt man daran schon, dass die jungen Menschen ihre sozialen Positionen erst ausprobieren. Aber auch, dass sie sich dabei vor Verfilmungen hüten müssen: Eines der Beziehungsgespräche wird von einer älteren Schauspielerin und ihrem jungen Freund geführt, den sie enttäuscht hat: „Ihre Sinnlichkeit kam nur im Film vor, nicht im Leben, wo sie nicht zu ihrem Altern stehen konnte – und sich in die Vergangenheit flüchtete, wie toll sie da war.“ Sie entgegnet: „Ich war von meiner Attraktivität nicht mehr überzeugt – um einen jüngeren Mann auch noch halten zu können. Deswegen habe ich die Beziehung abgebrochen – damit es ein Traum bleibt.“
„Das Lied vom jungen Akkordeonspieler“ von Satybaldy Narymbetov
Der kleine Junge Esken lebt in einem kasachischen Dorf und lernt Akkordeonspielen. Die Dorfbewohner haben viel Zeit füreinander. Und manchmal geht es ihnen wie dem Filmemacher Narymbetow: Sie wissen irgendwie nicht weiter. Der Große Vaterländische Krieg ist gerade zu Ende gegangen. Es sind noch japanische Kriegsgefangene im Dorf. Eskens Vater ist ihnen gegenüber allzu freundlich. Dafür muss er eines Tages für zwei Jahre ins Arbeitslager. Auch die Japaner werden abgeholt. Viele sind inzwischen gestorben. Der Regisseur zeigt dazu ein Denkmal, das jetzt an die in Kasachstan umgekommenen Japaner erinnert.
Dies sind sicher herausragende Ereignisse im Dorf jener Jahre, in denen Esken groß wurde. Daneben wird noch die ganze Palette der dörflichen Sonderlinge vorgeführt: die Prostituierte Aspasia, die schöne neue Bibliothekarin, die Dorfpolizisten, die Säuferclique usw. Sex and Crime in einem sozialistischen Kasachendorf. Dieses bekommt dadurch aber leider nicht die Tiefe, die beispielsweise das aserbaidschanische Postwende-Dorf in dem Film „Flug der Biene“ hatte oder die niederländische Nachkriegs-Kleinstadt in dem Roman „Tod am Leuchtturm“ von René Appel. Dabei scheint gerade diese Erinnerungszeit merkwürdig genug zu sein, um sich eine längere Zeit damit zu beschäftigen. In Ost wie West und hinter sowie vor den Gittern wurde die „Befreiung“ nämlich als eine solche gar nicht richtig wahrgenommen. Gleichwie. In diesem Kontext darf man dann vielleicht den kasachischen Film „Das Lied vom jungen Akkordeonspieler“ als schon mal einen guten Anfang, Ansatz, ansehen.
„Der Flug der Biene“ von Djamshed Usmonov und Min Wen Hun
Der 1965 geborene Regisseur Djamshed Usmonov stammt aus der ehemaligen Sowjetrepublik Tadschikistan. Er studierte Film in Moskau und lebt nun in Paris. Seine bisherigen drei Filme spielen in seinem Heimatort Ascht, einem über 3.000 Jahre alten Bergdorf, wo seine Familie schon immer lebte und er „jeden Stein und jeden Baum“ kennt: „Ein Regisseur sollte nur über das erzählen, was er kennt“, meint er. Für seinen neuen Film „Der Flug der Biene“ nahm er eine koreanische Kofinanzierung in Anspruch. Dafür musste er jedoch den Regisseur Min Wen Hun in Kauf nehmen, mit dem er sich dann aber sehr gut verstand.
Es geht um einen Dorflehrer, der jetzt in der neuen Zeit nicht mehr genug verdient, um Frau und Kind zu ernähren. Er schreibt zudem an einem Buch, das niemand veröffentlichen will – statt sich um seinen bäuerlichen Nebenerwerb zu kümmern. Aus seinem Nachbar ist inzwischen ein reicher Agrar-Händler geworden, der sich sogar Angestellte leisten kann. Heimlich beobachtet dieser – von seiner Toilettengrube aus – die Frau des Lehrers. Als ihn der Lehrer zur Rede stellen will, lässt er ihn durch seine Leibwächter rausschmeißen. Der Lehrer beschwert sich beim Bürgermeister, dem das Privateigentum quasi heilig ist, obwohl er noch unter einem gewebten Lenin sitzt.
Doch der Lehrer ist ein eigensinniger Mann, er legt sich mit dem Bürgermeister an, und die Situation im Dorf eskaliert – bis ein Polizist den kleinen Sohn des Lehrers auf Weisung des Bürgermeisters festnimmt. Der Lehrer nimmt sogar dessen Heimeinweisung in Kauf, um den Bau einer eigenen Toilettengrube auf seinem Grundstück – direkt neben dem Haus des Bürgermeisters – durchzusetzen. Irgendwie kommt aber alles wieder ins Lot. Auch der Stein des Anstoßes – die immer tiefer werdende Toilettengrube – ist am Ende verschwunden: In der Grube sprudelt eine Quelle, und aus der Quelle wird wunderbarerweise ein Brunnen.
Regisseur Djamshed Usmonov sagt über sein Sujet: „Diese Geschichte hat vor mehr als 100 Jahren mein Großvater erlebt, sie ist Teil unserer Familienmythologie.“ Diesen Rahmen hat er mit einer anderen Geschichte erweitert, die der Lehrer im Film seinen Schülern erzählt. Sie basiert auf einer persisch-tadschikischen Dichtung über die Weisheiten Alexanders des Großen und handelt davon, wie eine Biene einmal Wasser fand. Diese Legenden über Alexander von Makedonien sind „kanonbildend in Tadschikistan“, meint Usmonov, der mit einer alten Kamera und sowjetischem Negativ-Material drehte.
Sein stilsicherer Sinn für persische Bild-Ornamentik ist Djamshed Usmonov wahrscheinlich in die Wiege gesungen worden, vielleicht hat Min Wen Hun mit koreanischer Strenge dann sogar noch die letzten Arabesken daraus entfernt. Wundern würde es mich nicht, ich kenne jedoch bisher nur diesen einen Film von Djamshed Usmonov, der ihn selbst ziemlich treffend als „einfach, ruhig und sanft“ bezeichnet.
Mich erinnerte er gleichzeitig an den sowjetischen Film „Der erste Lehrer“, zugleich der erste kirgisische Film überhaupt. Das Drehbuch schrieb seinerzeit Tschingis Aitmatow. Es geht darin um einen gerade erst aus dem Krieg heimgekehrten Rotarmisten, der in seinem kirgisischen Dorf als kommunistischer Lehrer allein die große proletarische Revolution verkörpern muss.
Übrigens war dieser erste Lehrer damals mindestens so eigensinnig wie dieser letzte tadschikische Lehrer heute – in der wieder neuen Zeit.
Hühnerstehler, Holzhacker, Heimkinder und eine graue Sonne über Tschernobyl
Der Themenschwerpunkt heißt das „Ritual“ und der Länderschwerpunkt „Mexiko“. Es werden viele Filme über und von Indianern gezeigt. Ich habe mir vorab fünf aus Osteuropa angeschaut. Gleich der erste – von Aleksei Shipulin über einen Sheriff in einer kleinen russischen Stadt – hat mich begeistert. Dieser Hauptwachmeister – Sanja Iwaschkow – schaffte es nämlich, den neuen Zeiten voll gewachsen zu sein. Erwischt er einen Dieb, der einer alten Frau die Hühner geklaut hat, zwingt er diesen, der Besitzerin im Garten zu helfen und Holz zu hacken. Alle alten Frauen träumen seitdem davon, bestohlen zu werden. Sanja ist stark: Mit vier Mann, die ihn beleidigen, nimmt er es auf. Sind es mehr, wartet er ab, bis sie nach Hause gehen, um ihren Sieg zu feiern. Dann verhaftet er sie, sperrt sie ein – und feiert erst einmal selbst. Anschließend lässt er sie wieder frei. In seinem Ort gibt es keine Verbrechen mehr: Alles ist friedlich. Dennoch gefällt den Vorgesetzten in der Stadt seine unkonventionelle Art nicht. Eines Tages kommt ein neuer Sheriff in den Ort – Sanja wird entlassen, er betrinkt sich. Zum Glück wird der neue schon bald ermordet. Die Vorgesetzten kommen zu Sanja und sagen: „Du kannst wieder bei uns anfangen, Sanja!“
Der nächste Film stammt aus Litauen, er ist sehr kurz und dreht sich um das alte Badehaus in einer Kleinstadt: „The Bathhouse“ von Rimantas Gruodis. Die alten Frauen klagen: Das Wasser ist schlecht, der Präsident hält seine Versprechungen nicht, die Russen sind alle am Arsch, die Kolchose hat man unsinnigerweise aufgelöst usw. Die alten Männer klagen: Überall wimmelt es von Dieben, die Bolschewiki haben seinerzeit die Sauna zerstört, es ist Pilzsaison, aber man findet kaum welche, nur die KGBler kriegen anständige Renten: Das ist doch absurd usw. Trotz der Klagen fühlen sich aber eigentlich alle im Badehaus ganz wohl, und die Administration teilt sogar Bons dafür aus, so dass man nicht zu bezahlen braucht.
Der dritte Film stammt aus Estland und ist von Tönis Lepik „The Stories of Koue Liisu“. Dabei handelt es sich um eine zahnlose 94-jährige Frau namens Pauline Vapper, die Wodka-Lieder singt und Geschichten aus ihrem Leben erzählt – über den Kommunismus, den Krieg, die Kirche und die Nachbarn. Ihre Eltern zogen mit Beginn des Ersten Weltkriegs auf eine kleine estnische Insel – ein Jahr wollten sie bleiben, aber Pauline Vapper lebt dort noch heute.
Geradezu herzergreifend fand ich den weißrussischen Film „Holiday for Orphans“ von Galina Adamowitsch. Er handelt von einer Gruppe Heimkinder, deren Eltern zumeist Säufer waren: „Ich wollte nicht leben, meine Mutter trank.“ „Großvater schlug im Suff meine Mutter mit der Axt.“ Nur die Kinder kommen in diesem Film zu Wort. Sie werden eines Tages alle von einem italienischen Hilfswerk eingeladen. Dort – in Italien – teilt man sie auf verschiedene Familien auf, die sich rührend um sie kümmern. Schon bald sagen Nastya und die anderen Mama und Papa zu ihren Gasteltern – und alle weinen, als es irgendwann wieder nach Hause geht. Fortan ist ihnen das weißrussische Kinderheim, in dem sie sich zuvor so behütet vorkamen, verleidet: Sie haben Heimweh nach Italien.
In allen Filmen, die ich sah, spielte die Kindheit bzw. Kinder eine große Rolle – auch in dem letzten: „White Sky“ von Susanna Helke aus Finnland. Es geht darin um eine russische Arbeiterfamilie, die im Wohnkomplex eines nordischen Nickel-Kombinats lebt: Die Gewässer sind schon lange tot und die Bäume ringsum abgestorben. Die Kinder sammeln Mutanten, und wenn die Fabrik eine bestimmte Sorte Rauch ausstößt, müssen in der Siedlung die Fenster geschlossen werden. Man lebt dort wie auf dem Mond: komfortabel mit gutem Gehalt, aber künstlich – andauernd muss man Sauerstoff inhalieren, die Arbeiter bekommen reinen Alkohol, um sich inwendig zu reinigen. Zu allem Überfluss war die Familie 1986 auch noch der Tschernobyl-Radioaktivität kurzzeitig ausgesetzt. Die Mutter befürchtet deswegen, dass all diese Lebensumstände ihrer Tochter Katja bereits zu sehr zugesetzt haben: „Auf deinen Zeichnungen ist die Sonne immer grau.“
Singsang in Sibirien
Irgendwo in Amerika – in einem etwas heruntergekommenen Wohnviertel – sitzt ein blinder Blues-Sänger inmitten seiner Geräte und Musikstücke. Eines Tages hört er ein sibirisches Lied – von einem Obertonsänger aus Tuwa – im Radio. Wo ist das überhaupt: Tuwa? Und was ist das für ein seltsamer Gesang? Der schwarze Bluessänger namens Paul Pena bemüht sich, all das herauszubekommen. Er lernt in der Folgezeit sogar ein bisschen Tuwanisch und außerdem den Obertongesang. Seine Sehnsucht nach Tuwa wird derweil immer größer. Seine Freunde machen sich schon über ihn lustig: Ach Paul, du mit deiner Tuwa-Macke!, sagen sie. Dennoch nennen sie sich bald alle zusammen „Friends of Tuwa“. Es sind nicht unbedingt Loser, aber Winner erst recht nicht. Und deswegen brauchen sie sehr, sehr lange, bis ihr „Tuwa-Projekt“ steht. Im Kern besteht es darin, dass sie allesamt – als ein Filmteam – nach Tuwa fliegen und Paul Pena dort ein paar Obertonlieder zum Besten gibt, inmitten von einheimischen Sängern, die ebenfalls alle diese Art Gesang beherrschen.
Während ihrer Expeditionsvorbereitung passiert jedoch Folgendes: Überall in der westlichen Welt entdecken Filmemacher, Musiker und Globetrotter Tuwa. Nach dem politisch aufgeladenen Nicaragua-Run, dem menschenrechtlich totgerittenen Tibet und dem bereits völlig verwimwenderten Kuba ist Tuwa plötzlich der neue Hotspot. Tuwa – wo es noch mehr Pferde als Menschen gibt und wo „Yahoo!“ noch nicht triumphiert hat beziehungsweise nicht mehr triumphiert, seitdem die Sowjetmacht kollabierte. Die deutschen Kamerateams der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kennen bereits jeden Winkel und jedes Tal in Tuwa. Bednarz, Ruge, Riefenstahl und Rimski-Korsakow – alle haben sie schon da gedreht. Da gibt es ferner den verrückten Ami, der sich dort auf die Suche nach dem Grab Dschingis Khans machte – aber nichts als Hanffelder bis an den Horizont fand (auch gut). Dann den Tuwa-Dichter aus Leipzig, der eine Gruppe in der Mongolei arbeitslos gewordener Tuwaner zurück in ihre und seine Heimat begleitete. Dann einen Berliner, der jedes Jahr mit der Videokamera durch Tuwa reist. Den alljährlichen Tuwa-Stand auf der Internationalen Tourismus-Börse. Die zwei Künstlerinnen, die als Trekker dort unterwegs waren. Die Tochter eines Steglitzer Immobilienhändlers, die auf Tuwas kleine Pferde steht, ihr Bruder, der die dortigen Kamele lieber mag und so weiter.
Kein Wunder, dass der „Genghis Blues“, so heißt der Film über die Tuwa-Expedition von Paul Pena, bei der Berlinale erst einmal abgelehnt wurde: Inzwischen haben sie dort bereits eine Art Tuwa-Aversion entwickelt. Zudem ist der Film weniger eine Tuwa- als eine Pena-Expediton. Immer wieder wird gezeigt, wie er in der Tuwa-Hauptstadt – dem Mittelpunkt Asiens – auf dem großen Oberton-Gesangsfestival auftritt. Und sogar einen Preis einheimst. Es ist ein erfrischend dilettantischer Film geworden, der sich nicht scheute, die schönsten Bilder gleich drei-, viermal zu verwenden. Nur der Werbetrailer, der derzeit in den Kinos läuft, ist etwas irreführend: Man sieht vor allem Tuwa-Männer in historischen Kostümen, die auf schnellen Pferden über die Grasebenen sausen. Im wirklichen Film kommt so etwas nur am Rande vor – wie im wirklichen Leben im Übrigen auch.
Dafür ist die Kamera immer dabei, wenn Pauls Tuwa-Freunde ihm ein Ständchen an einem Fluss singen oder wenn sie ihn zu zweit auf die Bühne oder von der Bühne weg begleiten; oder wenn er unterwegs einer Gruppe von Arbeitern ein Tuwa-Lied singt – und die sich darüber sehr freuen. Der Film – und sein Trailer – ist so amerikanisch wie Apple-Pie. Und wir als Antiamerikaner können uns an seiner Machart nicht satt sehen. Außerdem macht es Spaß sich vorzustellen, wie dieser blinde Amerikaner – mit dem guten Gehör eines Musikers und einem Blindenstock ausgerüstet, der wie ein Minensuchgerät aussieht – dieses fremde Land bereist, in sich aufnimmt.
Natürlich gibt es Tuwa inzwischen auch im Internet – zigmal, und in Amsterdam einen Musikladen, der alle möglichen Cassetten und CDs mit Musik aus Tuwa im Angebot hat. Ich bekam von dort neulich eine Aufnahme mit Knastliedern aus Tuwa, die ich für eine SWF-Sibirien-Reportage verwendete. Der Redakteur, der anfangs noch nie etwas von Tuwa gehört hatte, sagte – als ich ihm das fertige Band schickte: „Musste das wirklich sein? Inzwischen wird hier im Sender sogar schon von der Sportredaktion nur noch Tuwa-Musik verwendet!“ Ich tat empört, musste ihm aber insgeheim recht geben: Dieser Tuwa-Trend hat bereits etwas Enervierendes, zumal dort ein Tal wie das andere aussieht – und alle von Bergen umgeben sind. Von denen die Obertonsänger tagaus, tagein ihr Liedgut schmettern.
Aber in Kuba tun sie auch nichts anderes als permanent Musik zu machen, und in Tibet beten sie rund um die Uhr – dalailamisch. Man muss da ja auch gar nicht hinfahren, es reicht, sich diesen merkwürdigen Tuwa-Film im Kino anzuschauen – und sich dabei sein eigenes „Expeditionsprojekt“ auszumalen: Tuwa gehört zu Sibirien. Und Sibirien ist eine einzige riesige weiße Projektionsfläche.
„Ausfahrt Ost“ erzählt von drei Langzeitarbeitslosen
Kürzlich tauchte ein dreibeiniger Wolf kurz vor Berlin auf. Zwei Wochen lang lebte er mit einer deutschen Schäferhündin im Wald zusammen, dann nahm man ihn gefangen. Da war was los im Odergebiet. Die Grenzschützer mussten einen harten Rüffel einstecken: Wie zum Hohn war der Wolf auch noch dreibeinig über die „sicherste Grenze der Welt“ gelangt. Der Quasi-Titelsong des Films „Ausfahrt Ost“ ist ein Country-Hit: „Wilde Pferde, wilde Wölfe, wildes Land“. An ihn musste ich bei der Wolfsnachricht denken.
Der wilde Osten: „Geh nach Sibirien, junger Mann, dort wachsen dir die Gürkchen ins Maul“, riet Gorki einst. Seit 1917 kommen kaum noch solch gute Nachrichten von dort. Sie werden sogar immer schlimmer. Der Tagesspiegel vermutete deswegen auch sofort, dass der Wolf von dorther gekommen sein müsse. Dazu passt, dass jetzt gerade der Spätheimkehrer-Bestseller „So weit die Füße tragen“, der als TV-Serie seinerzeit der erste deutsche Straßenfeger war, in Sibirien neu verfilmt wird. Es geht darin um die Flucht eines deutschen Kriegsgefangenen aus sibirischen Lagern, lange nach der Schlacht um Stalingrad, die ebenfalls gerade neu verfilmt wird. Der Westen nutzt seine Deutungsmacht unbarmherzig aus. Der FAZ-Slawist Schlögel meinte neulich schon: „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft!“ Ich halte es dagegen mit Adorno, für den Sibirien bereits kurz hinter Frankfurt am Main – ab dem Vogelsberg etwa – begann.
Die beiden jungen Filmemacherinnen Judith Keil und Antje Kruska drangen nun weit darüber hinaus: Sie kamen etwa bis Magdeburg, wo sie wegen allzu „schlechtem Wetter und schlechter Sicht eine zufällige Abfahrt“ nahmen. Schließlich landeten sie in der Trucker-Raststätte „Hungriger Wolf“ – nahe der Ortschaft Möser (sic). Dort lernten sie die zwei langzeitarbeitslosen Ostler Nico und Lenne kennen sowie den nochbeschäftigten Tomcat, der sich als rebellischer Südstaatler begreift – und oft auch so herumläuft. „Eigentlich alles Antihelden“, wie die zwei Filmemacherinnen meinen. „Loser“, um im Jargon der Countrymusik zu bleiben.
Neben ihrem Hang-out, dem Truck-Stop „Hungriger Wolf“, spielt natürlich auch das für die Jungs zuständige Arbeitsamt eine Rolle in dem sehr liebevollen Film. Es geht um Feststellungs- und Umschulungskurse. „Wir wissen, Sie können das Maßnahmenziel erreichen“, sagt z. B. ein Sachbearbeiter zu Nico. Es geht ferner um die Fahrerlaubnis und um einige vergebliche Versuche, mittels Heiratsanzeigen die richtige Frau zu finden. Die drei Antihelden sind oft aber ungern lonely. Die Mutter des einen macht sich bereits Sorgen, dass sie an der langen Arbeitslosigkeit ihres Sohnes vielleicht mitschuldig sein könnte.
Bei einer erstmaligen Besprechung des Films „Ausfahrt Ost“ war mir dazu natürlich sofort die Berliner Treuhandanstalt – mit den von ihr „Großflugtagen“ genannten Massenentlassungen – eingefallen. Und deswegen hatte ich abschließend nur noch darauf hingewiesen, dass einerseits viele Treuhand-Manager „Fuchs“, „von Bismarck“ oder „Wolf“ mit Nachnamen hießen – und von den Ostbetriebsräten einer sogar „Lammfromm“. Jetzt – mit Erscheinen des dreibeinigen Wolfs kurz vor Berlin – ist mir natürlich klar, warum. Und auch dass das Imperium jetzt anscheinend wölfisch zurückschlägt! Das beruhigt mich in gewisser Weise. Ich glaube an die Gerechtigkeit! Aus dem im letzten Jahr entstandenen Film „Ausfahrt Ost“ geht das jedoch noch nicht direkt hervor – dass sich im Osten langsam ein (dreibeiniger) Widerstand formiert. Das Rebellische wirkt da – in Möser – noch etwas verstockt.
Mit „Ein Mensch wie Dieter“ geht die Langzeitbeobachtung der Golzower weiter
In der Endlos-Dokumentation von Barbara und Winfried Junge sehen wir heuer das Leben von Dieter – vom Anfang bis fast zum Ende. Diese der Welt längste Langzeitbeobachtung einer Gruppe von Jungen und Mädchen aus dem Oderbruch geht immer weiter: Jedes Jahr liefern die beiden Defa-Dokumentarfilmer aufs Neue einen aktualisierten Zusammenschnitt von einem oder mehreren ihrer Protagonisten, die 1961 bei Beginn dieses Projekts in Golzow eingeschult wurden.
Das Dorf ist heute berühmt wegen seiner LPG, die sich seit ihrer DM-Eröffnungsbilanz zu einer der modernsten Großlandwirtschaften Europas, mit einer Tochtergesellschaft in der Ukraine, entwickelte. Wie so viele aus der gefilmten Schülergruppe arbeitete auch Dieter zunächst auf der Golzower Kolchose. Später wechselte er seiner Frau zuliebe in einen städtischen Wohnungbaubetrieb über. Noch heute, da die beiden mit ihren Kindern in einem komfortablen Landhaus im Oderbruch leben, spielen sie abwechselnd die Ernährer oder planen, zusammen zu arbeiten.
Zwischendurch arbeitete Dieter allerdings mehrmals alleine im kapitalistischen Ausland – auf DDR-Baustellen. Nach der Wende dann auch in Westberlin. Wie viele andere aus dem Oderbruch nahm das Ehepaar anschließend an einem Allgäuer Amway-Blitzverkaufstraining teil. Ob hier oder auch auf einer Baustelle mitten in der lybischen Wüste – früher oder später tauchte das Ehepaar Junge nebst Kamerateam auf. Selbst bei einer Belehrung durch seine dortigen Kaderleiter filmen sie ihn.
Seit 39 Jahren geht das nun schon so. Dieter wurde darob – logisch! – immer besser. Und reifer sowieso. Seine Frau hat sich inzwischen mit einem mobilen Altenpflegedienst selbständig gemacht. Inzwischen sind auch die Kinder bereits groß. Aufregung verursachte vor ein paar Jahren das Jahrhundert-Hochwasser an der Oder. Und natürlich sein Hausbau, der, wie üblich, länger dauerte und teurer war, als urspünglich geplant. Zudem verlor er zwischenzeitlich auch noch seinen Arbeitsplatz, weil die einem Westkonzern unterstellte Baufirma Pleite ging.
Nicht nur die etwas herablassend-wohlwollend wirkenden Fragen von Winfried Junge, die über all die Jahre gleich klingen, machen aus dieser Langzeit-Beobachtung eine fortwirkende DDR-Propaganda. Auch die von Klein auf an ihre Kamerabegleitung gewöhnten Helden aus Golzow verstehen es wie wohl kaum jemand, eine gute Figur im Film zu machen.
Auch wenn Jürgen im Gegensatz zu Dieter eher maulfaul war, Marieluise immer etwas gezwungen wirkte und Brigitte erst sehr spät „selbstbewusst“ wurde. Insgesamt haben es die Kommunisten wie keine andere Diktatur verstanden, aus völlig verstockten Vorwerk-Bewohnern redegewandte Komsomolzen zu schmelzen. Erst seitdem man aus Schwertern Pflugscharen macht, geht es dort wieder andersrum. Dieter und seine Frau sind inzwischen etwas dick geworden, sie gehören nicht gerade zu den Wendeverlierern. Darauf deuten Mittelklassewagen und Handy hin.
Nach dem Hochwasser bot die Landesregierung den Betroffenen im Oderbruch an, eine der im Zweiten Weltkrieg gesprengten Brücken nach Polen wiederherzustellen. Entsetzt winkten dort alle ab: „Wir brauchen jetzt erst mal Ruhe, Ruhe und noch mal Ruhe!“ Das gilt selbstverständlich für das gesamte Territorium der DDR, aber für Dieter aus Golzow besonders. Deswegen will er mit diesem Film auch die Langzeitbeobachtung für sich als abgeschlossen betrachten.
Er war mal ein schöner Junge und hat sich auch später nie unterkriegen lassen. Es hat den Anschein, dass er immer anständig geblieben ist. So könnte eine Synopsis seines Lebens schon jetzt lauten. Möge er jedoch 100 Jahre alt werden – und sein Kamerateam nicht locker lassen! „Krieg und Frieden“ ist eine Kurzgeschichte dagegen.
Anomalien auf dem Dorfe: Eduard Schreiber dokumentiert „Zone M“
Bei der „Zone M“ handelt es sich um ein anomalisches Gebiet. Davon gibt es etwa 200 auf der Welt, dieses befindet sich im Ural: Der Kompass funktioniert nicht richtig, es gibt merkwürdige Strahlungen und Vegetationsverformungen. In der Nähe dieser Anomaliezone liegt das Dorf Moljobka. Dort lebt Emil Batschurin. Der Geologe aus Perm begreift sich als Stalker. Nachdem vor einigen Jahren ein geheimnisvolles „Objekt“ in der Zone gelandet war, gründete Batschurin ein UFO-Forschungsinstitut, das in Moljobka Symposien veranstaltet.
Eduard Schreibers Film zeigt den Umgang der Dörfler mit der Anomalie – in den anormalen Zeiten nach dem Zerfall der Sowjetunion. Der betrunkene Traktorist der aufgelösten Sowchose, Aljoscha, meint: „Batschurin, der Trottel, hat sich diese Anomaliezone ausgedacht. Und die Leute fahren darauf ab … Dabei ist das gar keine Anomaliezone, sondern eine Verrücktenzone.“ Zwar besteht Fedja, ein Augenzeuge der Landung des unidentifizierten Objekts in Zone M, auf der nächtlichen Wahrnehmung, aber seine Frau behauptet: „Wenn der besoffen ist, sieht er noch ganz andere Sachen.“
Moljobka liegt auf einer Anhöhe an einem kleinen gewundenen Fluss. Am anderen Ufer beginnt die Zone. Es gibt einen Fährmann, Iwan, er ist fast 70 Jahre alt und raunt: „Ich habe schon viele übergesetzt!“ Dort drüben waren einst die heiligen – schamanistischen – Stätten der Nansen, eines ursibirischen Volkes, das heute noch jenseits des Ural siedelt: behauptet jedenfalls der Regisseur Eduard Schreiber, der es wahrscheinlich von Rawil Chadejew weiß, ein ehemaliger MIG-Pilot und Philosoph, der in Schreibers Dokumentarfilm über den Abzug der Roten Armee aus der DDR „Lange nach der Schlacht“ einer der Helden war. Rawil Chadejew machte dann den Regisseur mit einigen Leuten im Dorf Moljobka bekannt. Vor allem mit dem Geologen Batschurin, der ein 40 Hektar großes Waldgrundstück im Ural kaufte, auf dem sich eine kleine Erdgasquelle befindet, die einige umliegende Orte versorgt. Batschurin finanziert damit seine UFO-Forschungen, die bereits in J. Vallées Kompendium: „UFO Chronicles of the Soviet Union“ erwähnt werden.
Von diesem internationalen Gedankenaustausch über die symposialen Moljobka-Meetings ist es nur noch ein Katzensprung zur Idee des Fremdenverkehrs. Wobei wir im konkreten Falle von einem romantischen Anomalie-Tourismus, eine Art Last-Minute-Stalker, auszugehen hätten, der im Film selbst schon mal einen optimalen Anreiz findet – weil darin Erkenntnis und Interesse aufs Schönste zusammenkommen. Das Ganze entwickelte sich aus dem Zerbröseln der sowjetischen Volkswirtschaft. Schreiber in seinem Film-Exposé: „Am Abend des 31. März 1995 nahmen mehrere Einwohner von Moljobka ein leuchtendes Objekt wahr, das sich aus dem Fluss Sylva erhob und als Kuppel über der zerstörten Kirche (sic!) niederging.“
In „Sieben Lieder aus der Tundra“ erzählen Anastasia Lapsui und der Finne Markku Lehmuskallio vom Leben der Nenzen in nördlicher Schneelandschaft
Die Nenzen, früher Samojeden genannt, sind ein im Nordwesten Russlands sesshaft gewordenes Nomadenvolk. Die Nenzin Anastasia Lapsui und der Finne Markku Lehmuskallio haben schon viele Filme über ihre arktische Heimat zusammen gedreht. Zuletzt lief in der Forum-Reihe: „Uhri – Das Opfer“ – ein Dokumentarfilm über die Selkupen, die in der sibirischen Taiga jagen. Für die Regisseurin, deren Volk in der nahezu baumlosen Tundra lebt, ist der Wald „beunruhigend und unheimlich“ – und vieles war ihr bei den Selkupen unverständlich.
In ihrem neuen Film nun – „Seitsemän Laulua Tundralta“, „Sieben Lieder aus der Tundra“ -, der halb Dokumentar- und halb Spielfilm ist, sind viele ihrer eigenen Erfahrungen und Erinnerungen eingeflossen. Sie schrieb auch das Drehbuch. Markku Lehmuskallio merkte dazu an: „Die Nenzen haben keine professionellen Schauspieler, nur einfache Leute – Nomaden, Jäger und Fischer. Sie stellten uns ihre Zelte, ihre Rentiere, Boote und vor allem sich selbst und ihre Zeit zur Verfü- gung … Die Rolle des obersten Landwirts wurde vom obersten Landwirt gespielt, die des Lehrers von einem Lehrer – alle spielten sich selbst.“
So erzählt der Film die Geschichte ihrer Familien, ihre eigene Geschichte. Anastasia Lapsui erinnert sich an die Geschichte einer Sandbank im Fluss, wo noch heute einige Erdhöhlen und die Überreste eines Hauses zu sehen sind: Dort arbeitete bis zum Ende der Stalinzeit eine Frauen-Fischerbrigade. Sie galten als „Feinde des Volkes“ und kamen aus allen Republiken. Ihr Lager grenzte an die Hütte der Familie Lapsui. Sie fischten unmittelbar nebeneinander, hatten aber keinen Kontakt: Die Nenzen hatten Angst vor den so genannten Volksfeinden. Ein blondes junges Mädchen kam jedoch regelmäßig zu ihrer Hütte und setzte sich neben die Eingangstür. Sie schaute den Nenzen bei der Arbeit zu und weinte leise.
Diese ebenso schöne wie traurige Geschichte kommt jedoch in den „Sieben Liedern aus der Tundra“ nicht vor, obwohl der Film bis zur Kollektivierung der Landwirtschaft zurückreicht. Die Gesichter der Beteiligten sind eindrucksvoll, noch mehr die kargen Schwarzweiß-Szenen in der Schneelandschaft, die sich stets bis an den Horizont erstreckt – und der man anscheinend nur mit einem bis zum Äußersten konzentrierten Minimalismus gewachsen ist.
Die Kehrseite davon ist, dass dadurch die Gesamtgeschichte etwas Holzschnittartiges bekommt – insbesondere dann, wenn die Großgeschichte in die Lebensgeschichten der Einzelnen hineinspielt, sie bestimmt. Im Falle der Nenzen ist das: die Kollektivierung der Landwirtschaft und der Vernichtung der Kulaken, der Große Vaterländische Krieg, den einige von ihnen als Soldaten an der Leningrader Front erlebten, die Planerfüllungs-Zwänge ihrer Kolchose, die Verkörperung der Macht vor Ort sowie die Alphabetisierungskampagne, die für die jungen Nenzen eine Trennung von ihren Eltern bedeutet, da man sie in Internaten konzentriert.
Durch das Komprimieren dieser komplexen Großereignisse auf kurze Szenen bekommt der Film in seinen inszenierten Passagen etwas dumpf Antikommunistisches – dieses Märchenhafte tut ihm nicht gut. Erst recht nicht, wenn man weiß, dass die Regisseurin an einige dieser Ereignisse eine viel schärfere Erinnerung hat.
Ein Film über sowjetische Fliegerinnen
Schneller, höher, weiter! So lautete die bolschewistische Formel, mit der sich ein ganzes Volk in die Luft und später in den Weltraum katapultieren sollte. Allein in Moskau entstanden in den Dreißigerjahren elf Fliegerclubs. Berühmt und gefeiert wurden vor allem die ersten Pilotinnen und Fallschirmspringerinnen. Selbst junge Kolchosbäuerinnen träumten davon, in die Luft zu gehen – und taten das auch.
Regine Kühn und Eduard Schreiber haben für den Film „Aviatricen“ das Originalfilmmaterial über diese sowjetischen Heldinnen noch einmal durchforstet. Dazu wurden einige der ehemaligen Pilotinnen-Stars, die heute als Rentnerinnen mehr oder weniger verarmt in Moskau leben, interviewt. Es war ein Rausch! Und er ist noch nicht ganz verflogen.
Noch immer ist das Fliegen in Russland fast so selbstverständlich wie bei uns das Fahrradfahren, noch immer gibt es dort mehr Pilotinnen als anderswo auf der Welt. Und ich fühle mich in einer Maschine oder einem Hubschrauber von Aeroflot noch immer hundertmal sicherer als in einem dösigen Lufthansa-Flugzeug. Der Grund für diese „Sicherheit“, aber auch für die Weltraumflüge, wurde mit dem Massensport Fliegen in den Dreißigerjahren gelegt – von Stalin persönlich, wenn man den beiden Filmemachern glauben darf: auch wieder so eine „Wahnsinnsleistung“. Ein ganzes Volk bewegt sich in immer dünnere Luft!
Der 59-minütige Film „Aviatricen“ läuft am Sonntag um 21 Uhr und Montag, 19 Uhr im Babylon-Mitte, Rosa-Luxemburg-Straße. Anschließend stehen die beiden Regisseure Rede und Antwort.
Wende-Aufarbeitungen
„Wer Country-Musik spielen will, muss eine Menge Mist gerochen haben!“ (Hank Williams)
In der so genannten Wende wandte sich der Merian-Herausgeber wegen eines „Berlin-Hefts“ an mich. Ich sollte eine Geschichte des Glühlampenkombinats Narva – bis zu seiner Privatisierung, an der damals die Treuhandanstalt arbeitete – beisteuern. Mein mit 5.000 Mark und einem Essen im Hotel Esplanade honoriertes Konvolut bekam ein Schönschreiber in Ulm, der daraus einen richtigen Merian-Artikel machte. Am Schluss schrieb er – sinngemäß: Es sieht zwar alles nicht sehr rosig aus, aber die nun kommende D-Mark wird es richten. Diesen Satz konnte ich gerade noch verhindern. Mein Text hatte im Grunde aus dem Nachweis bestanden, dass das Glühlampenwerk just von der D-Mark – bzw. von ihren industriellen Platzhirschen – platt gemacht wird.
Nun lief der „erste umfassende Dokumentarfilm über die Geschichte der Treuhand“: die MDR-Produktion „Schlussverkauf DDR“ von Axel Grote und Michael Jürgs. Und der beginnt gleich so: „Streng bewachte Geldtransporter bringen die heiße Ware in den letzten Winkel der real kaum noch existierenden DDR – die D-Mark. Und mit ihr kommt die Marktwirtschaft. Eine Treuhandanstalt mit Sitz in Berlin soll es richten …“
Man habe mit diesem zweiteiligen Dokumentarfilm, so die Verantwortlichen auf einer Berliner Pressekonferenz im Polnischen Kulturinstitut, einigen „Mythen“ um die Treuhand – wie Sündenbock, Betrüger, Top-Wirtschaftsanierer – entgegenwirken wollen! Ein polnischer Journalist nannte das Ergebnis anschließend abfällig: „Eine zweistündige Tagesschau“. Ein amerikanischer Journalist meinte: „Grober Unfug – ‚Es gab keine Alternative!‘ Die ist doch gleich nebenan in Polen – wo ganz ohne Treuhand wirklich ein Wirtschaftswunder passierte, im Gegensatz zu Ostdeutschland, wo sich bald bloß noch Wirtschaftsprozesse gegen Anlage- und Sanierungsbetrüger mit Strafprozessen gegen Neonazis ablösen.“
Im Film wird zu dieser einmaligen Erfolgsstory „Aufbau Ost“ der Treuhand-Kontrolleur im Finanzministerium John von Freyend zitiert: „Ohne Patriotismus wäre das alles nicht möglich gewesen!“ Ganz recht! Ohne sofortige Gebietsansprüche hätten westdeutsche Großkonzerne wie RWE und Siemens, BASF und Deutsche Bank nicht die ausländischen Investoren – wie Samsung, General Electric und Phoenix-Japan – vom Kauf ostdeutscher Industriebetriebe abhalten können. Die Fabriken wurden stattdessen von den Interessenvertretern der BRD-Konzerne in der Treuhand schubweise „abgewickelt“. Die Massenentlassungsschübe hießen treuhandintern „Großflugtage“.
Darüber verliert man im Film jedoch kein Wort. Stattdessen wird noch einmal wohlfeil auf „maroden Anlagen“, „Stasi“, „Spießigkeit“, „SED-Misswirtschaft“, „Potemkinschen Dörfern“ etc. herumgeritten. Alle kolonialen Eroberungen Europas waren ohne Eleganz, meint Eric Hobsbawn. Die der Deutschen waren jedoch besonders debil. Und die DDR-Einverleibung war der Gipfel an verbrecherischer Dummdreistigkeit! Dass man zu ihrer Aufarbeitung ausgerechnet den MDR beauftragte, verdient ganz besonders gewürdigt zu werden.
Hier abschließend nun nur noch den letzten Satz aus diesem primitiven Propagandaschinken („Vergleichbares kannte man bisher nur aus staatlichen Desinformationskampagnen“, schreibt die FAZ – freilich nicht über den Treuhand-Film sondern über die „Wehrmachtsausstellung“ des Reemtsma-Instituts): „Einigkeit und Recht und Freiheit – hupende Trabis: ein grenzenlos glückliches Volk bestätigt sich selbst!“ Der Produzent der Firma Tele-Potsdam konnte abschließend nur noch stammeln: „Danke. Für dieses gewaltige Stück Aufklärung!“
Nackter Krüger
Die täglichen Filmbesucher und die nächtlichen Filmpartygänger sind scharf getrennt. Vor allem verblüffen die vielen blonden bzw. brünetten Mädels auf den Empfängen. Sie sind nicht an Filmen interessiert, aber an den Filmschaffenden, die für sie Teil des hinteraktiven „Mediums“ sind, wie sie diese Branche, in der sie Tritt fassen wollen, schon gern mal nennen. Besonders lustig ging es auf der Party des Filmboards „Berlin und haste ma ne Mark Brandenburg“ im Cinemaxx uffn Potsdamer Platz zu, wo der „Partner in Tolerance“ Daimler-Benz eine kleine VIP-Ecke separiert hatte. Alle wollten natürlich dorthin – aber nur unsere Mädels schafften es, sich an der Doppelkontrolle vorbeizumogeln. Es war nicht das dort aufgebaute Permanent-Buffet, das sie anzog, und auch nicht der überall ausgeschenkte Sekt. Eine kleine Blitzumfrage unter ihnen ergab, daß es den meisten im Kino zu dunkel ist: „Da sieht man ja nichts!“ Außerdem sehnen sie sich, egal bei welchem Film, derart auf die Leinwand, daß hinterher – draußen – meist ihre „gute Laune futsch“ ist. Mit Viola Stephans „Damenwahl“- Erkenntnis dürfen wir annehmen, daß die armen Filmparty- Mädels überhaupt keine Wahl haben: „Es ergibt sich einfach so!“ – aus diesem Nachtleben.
Auch Atze Brauner erschien auf dem Filmboard-Benz-Beisammensein mit einem jungen Mädel – ein Happy-End? Zu den eifrigsten Film-Partygängern gehört unser ehemaliger Jugendsenator, den man nur noch „Der nackte Krüger 33-Eindrittel“ nennt. Auf der Niedersachsen-Fete im Café am Opernpalais traf ich mehrere feuilletonistische „Stimmungskanonen“, die emsig auf der Suche nach witzigen Geschichten waren. Und das fanden sie gar nicht lustig: „Wenn man erst mal in der Mühle drinsteckt…“ entschuldigte einer seine schlechte Bierlaune.
Pjotr Luziks Film „Okraina“
Es wurde alles immer schlimmer“ – so beginnt der Erstlingsfilm des 1960 geborenen Pjotr Luzik. Es geht darin um den Rachefeldzug einer kleinen Gruppe von Dorfbewohnern, die man im Zuge der Privatisierung enteignet hatte. Bevor sie sich wieder glücklich auf ihre Traktoren schwingen und ihr Land bewirtschaften können, müssen sie noch einmal die ganze grausame Geschichte durchspielen.
Und die handelt von den früheren Bauernaufständen eines Stepan Rasin über alle Bürgerkriegs- greuel bis zum Verhandlungsbluff ausgeschlafener Kolchosbauern. Puschkin-Gedichte, alte Zeltlieder, die Erinnerung an die Weißen, die Faschisten – aber das Glück immer stur im Visier.
Und so fing alles an: Ölbohrer kommen ins Ural-Dorf Romanowsky. Die Dörfer rebellieren, müssen sich aber fügen. Man zeigt ihnen eine Urkunde mit vier Siegeln: die 14.000 Hektar ihrer ehemaligen Kolchose „Heimat“ hatte man erst in kleine Grundstücke aufgeteilt und dann verkauft – an wen, wußte niemand. Aber so waren Ungerechtigkeit und Absurditäten in ihr Dorf gelangt. Immer mehr junge Leute verdingten sich in der Stadt.
Ein paar Alte machen sich schließlich mit Folter und Mord auf die Suche nach der Wahrheit, die sie bis in die hauptstädtische Firmenzentrale eines Ölkonzerns (Lukoil?) führt. Als erstes ist der ehemalige Kolchosvorsitzende dran. Schließlich gesteht er: Mit Essen und Trinken, zwei alten Traktoren und einem Privatmotorrad hatten drei windige Geschäftsleute und ein gestandener Parteifunktionär ihn dazu gekriegt, das Land zu verkaufen. Nach seinem Geständnis schließt er sich der Veteranenbrigade an. Ein schwindsüchtiger Junge, den sie mitnehmen, reift dabei zum Mann.
Während es bei dem örtlichen Businessman ausreicht, ihm die Rippen zu brechen, müssen der Parteifunktionär und der Öl-Boß dran glauben. Anschließend nehmen sie die Sekretärin des letzteren auf dem Motorrad mit zurück ins Dorf, wo sie voraussichtlich Kolchos-Buchhalterin oder Agronomin wird. Wir haben es hierbei mit einer „strengen, fast absurden Fabel“ – vom schier ewigen Gegensatz zwischen Stadt und Land, Lohnarbeit und Kapital, „Maschinen und Wölfe“ (Boris Pilnjak) – zu tun.
Der Filmkritiker Igor Manzow schreibt über Luziks „Okraina“: „Man kann sich nicht mehr erinnern, wann zuletzt dem Menschen soviel Ehre in russischen Filmen erwiesen wurde.“
Und ein amerikanischer Rezensent meinte begeisternd: „Fraglos eines der zwingendsten Rußland- Features der letzten Jahre.“
„Die Zeit des Tschou En-lai“
Der weißrussische Regisseur wurde hier 1997 durch seinen gemeinen Dokumentarfilm über Lukaschenko „Der gewöhnliche Präsident“ bekannt, der in seiner Heimat noch immer nicht gezeigt werden darf.
„Die Zeit des Tschou En-lai“ ist ein Dokumentarfilm über den „ergebensten Mitstreiter Mao Tse- tungs“ und sein „tragisches Schicksal“, dessen 100. Geburtstag sich 1998 jährte.
Aus diesem Anlaß beauftragte die russische Filmproduktion „Rakus“ Juri Chaschtschewatskij, einen Film über Tschou En-lai zu machen. Ihm standen dafür die Archive in Krasnogorsk und Belyje Stolby, beide bei Moskau, zur Verfügung. An Spielfilmmaterial verwendete er nur einige Landschaftsszenen.
Vor dem Hintergrund des Schicksals von Tschou En-lai beschreibt Juri Chaschtschewatskij das Scheitern der kommunistischen Utopie und das Scheitern des Versuchs, das kommunistische Glück zu erringen – schreibt das Forum-Programmheft.
Der Regisseur beginnt mit Bildern von einem zurückfließenden Wasserfall – der großen Mauer, Marionettentheater und Maos Triumphen. Das inzwischen rotstichig gewordene sowjetische Archivmaterial wurde von ihm dabei teilweise blau und gelb umgefärbt. Der Lange Marsch, die Rote Garde, der große Steuermann auf der Tribüne, der Tod Tschou En- lais. „Er starb 1987 und hinterließ keine Kinder, keinen Reichtum. Er hat nicht einmal ein Grab“.
Der leicht ins Resignative spielende Kommentarton wird besonders unseren ehemaligen Maoisten gefallen. Auch die russische Revolution kommt darin vor, die der junge Mao dann ja quasi ins Chinesische hinein verlängerte: Erneut waren die Imperialisten – not amused!
Aber die Partisanen parierten prima. Einer ihrer Politkommissare hieß Tschou. Vielleicht stammt von ihm die Idee, die Tornister seiner Truppen zum Plakatanschlag zu nutzen? Der Imperialismus machte daraus später Bandenwerbung und Schlimmeres.
Die Sowjetunion läutete unterdes bereits den Anfang vom Ende ein – mit dem Chruschtschowschen Revisionismus. Die Chinesen konterten mit Stalin – und Grenzattacken über Amur und Ussuri. Im Inneren wurden Deichbauten über Massenmobilisierungen forciert. Tschou lachte.
Auch die Spatzen-Vernichtungskampagne wurde ein voller Erfolg – und die Mao-Bibel mit der Kulturrevolution zu einem Exportschlager. Allein in Berlin verteilte die Kommune1 an der Gedächtniskirche Tausende. Das gehört aber nicht mit zum Film. Mao durchschwimmt den Gelben Fluß. Und alle tun es ihm nach! Ich will hier jedoch nicht den ganzen Inhalt vorwegnehmen.
Dieser Wald ist viel zu voll
Was für die Intelligenz auf der einen Seite – in Paris etwa – die Angst vor dem weißem Papier ist, wurde auf der anderen Seite zur faszinierenden „weißen Wand“ – Sibirien als riesige Projektionsfläche. Selbst „Hollywood heads for Siberia“, vermeldete jüngst ein Film-Fachblatt. Während die einen wahre Horror-Szenarien von dort mitbringen: voller Kälte, Entbehrungen, Gulag-Resten, Altkommunisten, Mafiabanden, Umweltkatastrophen und Genozide, preisen die anderen Mensch und Natur, Baikalsee, Behring-Robben und Bodenschätze in den höchsten Tönen. Der Publizist Lothar Baier bedichtet den äußersten sibirischen Norden als „Arktisches Arkadien“, die FAZ titelt: „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft“.
Im Schnittpunkt all dieser Wunsch-Wahrnehmungen: „Nowosibirsk“, der geographische Mittelpunkt der ehemaligen Sowjetunion! Dieser noch immer real existierende Ort befindet sich westlich des Flusses Jenissei zwischen dem Öl- und Gaszentrum Nischniwartowsk im Südwesten und der Hafenstadt Dudinka im Nordosten. Er liegt am Fluß Tas im Heiligen Hain des kleinen Volkes der Selkupen. Hier beginnt der Film der Nenzin Anastasia Lapsui und des Finnen Markku Lehmuskallio. „Uhri – die Opfergabe“ unterscheidet sich wesentlich von den meisten anderen „Sibiriensia“ – erst einmal dadurch, daß die beiden Filmemacher es augenscheinlich nicht eilig hatten, schnell wieder in ihr gemütliches Zuhause zurückzukehren. Sie haben sich ordentlich Zeit genommen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber (vor allem in Sibirien) nicht, zudem Lapsui auch nach diesem „film about a forest“ noch Wert auf die Feststellung legt, daß die Taiga – der Wald – für Tundra-Nenzen eigentlich beunruhigend und unheimlich ist.
Alle sibirischen Völker glauben an eine beseelte Natur, den Nenzen beispielsweise ist der Wald „zu voll“. Aber sogar die Taiga-Selkupen am Fluß Tas schützen ihren fest bebauten Sommerplatz mit einem Holzzaun vor Waldgeistern, sie wollen „raus“ aus Sibirien.
Das Reinfinden dauert – und ist darüber hinaus ein dem Auge verborgener Vorgang. Denkbar schwierig für den Filmer also. Auch wenn er, wie Markku Lehmuskallio, weiß: „Wenn ich einen Moment filme, fühle ich, daß ich etwas Unsichtbares festhalte.“ Diese Schußversuche (im Englischen kommt das Filmen – Shooting – aus der Jägersprache) bedeuten, da es sich gezielt um eine Ethnographie von Jägern handelt, daß die Bild- und Tonschützen, die FilmemacherInnen, sich der Erfahrung einer „generationenübergreifenden Kontinuität“ vergewissern.
Immer wieder schauen sie dem Jäger und Fallensteller ins Gesicht und gucken, wie er in den Wald guckt, reinhorcht. Und so wie die Selkupen sich an ihren heiligen Plätzen für all das bedanken, was der Wald ihnen „gab“ – Elche, Auerhühner, Bären, Zobel, Hechte und andere Fische, dazu Beeren sowie Feuerholz – so ist auch dieser Film in gewisser Weise das Abtragen einer Dankesschuld: eine Gegen-„Gabe“, dessen einzelne Teile „Platzwechsel“, „Zivilisation“, „Freizeit“, „Eine Tragödie“ usw. heißen. Sie werden von Liedern zusammengehalten. Eins – über das Hosenflicken – singt die Selkupen-Mutter, während sie eine Hose flickt. Es geht so: „Ich lebe mit meinen leisen Liedern/ Mit leisen Liedern flicke ich die zerrissene Hose meines Sohnes/ Mein Sohn, der einem Schwan ähnelt/ Zerreißt immer wieder seine Hose/ So schnell, daß ich keine Worte dafür finde…“
Wir verstehen, was sie singt, aber was das Lied wirklich bedeutet, das wissen nur die Selkupen selbst – meint Markku Lehmuskallio. Es muß noch viel getan werden, um alle sibirischen Geheimnisse – wenigstens der Selkupen in der Mitte – zu verraten!
Unterrichtseinheit Ei
Drygas, Piewowski, Brzozowski – was holt sich das Kino von Kornel Miglus da bloß immer für eigenartige Leute ins Haus? Die polnische Schule (des Dokumentarfilms) ist auf dem besten Wege, das zu werden, was in den Fünfzigern und Sechzigern das polnische Plakat und dann das polnische Theater im Ausland waren. „Ich ließ mich nicht zum Spielfilm verleiten, zum düsteren Warten auf die Sonne im Spielplan, zu den zigmal wiederholten Szenen im Atelier“, erzählt Brzozowski. „Eines Tages lief ich davon und wanderte durch Polen. Dort fand ich alles: ständige Überraschungen, merkwürdige Menschen, verblüffende Situationen. Es war so, als hätte ich auf einem Baum geschaukelt… Von diesem fröhlichen Baum der ,dokumentaren Ahnungslosigkeit‘ holte mich Jerzy Bossak auf den Boden. Er hat mir beigebracht, Verantwortung zu übernehmen.“
Über die Filmhochschule Lodz, an der Bossak lehrte, sagte einmal der Regisseur Kazimierz Kutz: „Bedingung für die Aufnahme war zwar die Mitgliedschaft im Kommunistischen Jugendverband, aber unsere Lehrer hatten ihre Überzeugungen, und sie hatten den Mut, sie nicht nur zu äußern, sondern auch für sie zu kämpfen. Ich denke, wenn man das Geheimnis der Entstehung dessen sucht, was man später die polnische Schule nannte, dann liegt gerade hier die Ursache – in der ideologischen Spannung.“
Heute ist der 1932 geborene Brzozowski selbst Professor an der Filmhochschule Lodz, deswegen besorgte er auch gleich die Auswahl der studentischen Arbeiten, die nun im Polnischen Kulturinstitut gezeigt werden. Die „ideologische Spannung“ in seinen eigenen Arbeiten liegt z.B. darin, daß er in den sechziger Jahren, als die KP Polens langsam auf einen antisemitischen Kurs einschwenkte, mehrmals das „jüdische Thema“ behandelte: 1963 in „Eine Impression über das Töten“ – ein Kurzfilm über ein Paar, das aus dem Zug springt, der in ein Konzentrationslager fährt. 1967 „Spuren“: Passantengeschichten sowie ein kurzes Laientheaterspiel über die von Deutschen verschleppten Juden eines Dorfes. Die Dreharbeiten mußte Brzozowski zwischen 1967 und 1982 „aus politischen Gründen“ unterbrechen. 1968 „Archäologie“: Ausgrabungen in der Nähe des dritten Krematoriums des Vernichtungslagers Birkenau.
Neben diesen Filmen zeigt das Kulturinstitut auch noch drei Dokumentationen von Brzozowski über Laos und Vietnam: Kriegsfilme. Zunächst „Laos, die rote Erde“, über den permanenten Ausnahmezustand, der Zivilisten und Soldaten zwingt, nahezu ihr gesamtes Leben in Berghöhlen zu verlegen: schlafen, Textilien weben, Zeitungen drucken, kochen, ins Theater gehen, Lieder anstimmen. Ein zartes Mädchen singt „Das Blut unserer imperialistischen Feinde wird fließen“.
Der zweite Film heißt ausdrücklich „Drei Lieder, in Laos gehört“. Der dritte, „Das Feuer“, zeigt ohne Hast die Schönheit des Alltagslebens in einem vietnamesischen Reisbauerndorf. Nach einem B-52-Angriff blieb nichts mehr davon übrig. Berühmt machte den Wajda-Assistenten Brzozowski sein mehrfach preisgekrönter Kurzfilm „Das ist ein Ei“ (1965) – eine nahezu kommentarlose Dokumentation über die Unterrichtseinheit „Ei“ in einer polnischen Blindenschule. Schließlich wird auch noch die „politische Impression“ „Salome“ gezeigt. Eine Aufführung des Pantomimenensembles von Tomaszewski. Die halbnackte Schleiertänzerin in der prachtvollen Barockkirche verlangt den Kopf des Johannes nicht umsonst. Was wollte uns der Regisseur damit 1968 sagen? Ich gestehe, ich weiß es nicht (mehr), die anderen Filme von Brzozowski sind aber ganz eindeutig – in ihrer ideologischen Anspannung.
Ein Kreuzberger Dokumentarfilm von Imma Harms und Thomas
Winkelkotte über den Wandel von „mein“ und „dein“ seit der Wende
Das Gebiet zwischen Mariannenplatz und Köpenicker Straße war bis Ende 1989 eine Idylle „im Schatten der Mauer“ gewesen: Künstlerhaus Bethanien, Georg- von-Rauch-Haus mit Wohnwagen drumherum, die Thomaskirche und dahinter zwei Schrebergärten mit einem zweistöckigen Bethaus und drei Bäumen auf einer ehemaligen Verkehrsinsel, wo Osman Kalin und Mustafa Akyol mit ihren Frauen und Kindern Sonnenblumen und Gemüse anbauen. Sie wohnen im letzten stehengebliebenen Haus dahinter. Kalin ist schon 1944 – „als Verbündeter“ – nach Deutschland gekommen. Ihre Gärten befinden sich im Westen, stehen aber auf DDR-Gebiet. Deswegen hat niemand vom Tiefbauamt oder von der Polizei dort etwas zu sagen gehabt, und die Grenzoffiziere ihnen die Gartenanlage sogar ausdrücklich erlaubt. Die Nachbarn stiften später Zaunmaterial.
Nach der Wiedervereinigung rücken ihnen jedoch Planer und Tiefbauamtsleiter aus Mitte auf die Pelle. Der Kreuzberger Bürgermeister hält zwar schützend seine Hand über die „Öko-Laube“, aber er hat dort bald nichts mehr zu sagen. Die Mauer ist verschwunden und der gleich dahinter verlaufende Luisenstädtische Kanal, der als Todesstreifen zugeschüttet war, soll mit ABM und enormen Sachmitteln (wieder) zu einer Lennéschen Promenade rückgebaut werden. Der Pastor der Thomasgemeinde, wo man mangels Gläubigen bereits darüber nachgedacht hat, sich das inzwischen renovierte Kirchenschiff mit einer islamischen Gemeinde zu teilen, verhindert zweimal eine Räumung der Schrebergärten. Dann geht jedoch den Kanalplanern gottlob! das Geld aus, und es kehrt erst einmal wieder Ruhe ein.
Inzwischen hat der Innensenator aber die Rollheimer-Siedlungen auf dem Kanalmittelteil „Engelbecken“ und dann auch auf der anderen Spreeseite an der „East Side Gallery“ räumen lassen. Ein Teil dieser Wagenburg verlagerte sich daraufhin an den Bethaniendamm auf den imaginär gewordenen Mauerstreifen zwischen Kinderbauernhof, Rauch-Haus und den zwei türkischen Gemüsegärten. Auch diese Siedlung wird schließlich mit schwerem polizeilichen Räumgerät auseinandergetrieben … All diese gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um ihr „Paradies“ lassen Osman Kalin und Mustafa Akyol nicht kalt. Das Ehepaar Kalin verkauft seine Zwiebeln auf dem Markt am Maybachufer. Irgendwann verrücken sie den Zaun zwischen den beiden Gärten um einige Meter, so daß sich ihr Land auf Kosten von Akyols Anbaufläche vergrößert. Der quasi interne Streit darüber gefährdet das Biotop der beiden Türken nun zusätzlich. Vielleicht wollten sie damit aber auch nur die ganzen Konflikte um sie herum wieder zu ihrer eigenen Angelegenheit – zwischen zwei Grundstücksbesitzerfamilien – machen?
Der Film „Was man so sein eigen nennt“ von Harms und Winkelkotte beantwortet diese Frage nicht, obwohl er sonst vor philosophischen Erörterungen – z.B. der Frage, was permanentes Glück und flüchtiges Eigentum überhaupt sind – nicht zurückscheut.
Leben und Werk des polnischen Filmemachers Marek Piwowski
„Marek war der Begabteste von
uns allen, aber auch der Faulste.“
(Kazimierz Kutz)
Der junge Piwowski mußte während seiner elf Schuljahre 13mal die Schule wechseln. Zum Film kam er während des Krieges: „Da sah ich einmal in einer deutschen Wochenschau in Warschau deutsche Panzer auftauchen – und wieder verschwinden. Hinter der Leinwand waren sie nicht: Ich verstand das nicht – und beschloß, mein Leben diesem Wunderwerk zu widmen.“ In dem Film hatten die Deutschen die Russen in die Flucht geschlagen. Später beschlagnahmten die Russen das Wochenschaumaterial, bearbeiteten es und zeigten die Filme erneut: Jetzt waren plötzlich die Deutschen auf der Flucht: „Noch ein Wunder!“
1955 versuchte er zusammen mit einem Freund von Stettin aus nach West- Berlin zu flüchten. Sie wurden an der Grenze verhaftet. „Wir versuchten ihnen einzureden, daß wir uns verlaufen hätten. Ich bekam zwei Jahre aufgebrummt und mußte in einer oberschlesischen Kohlenmine arbeiten.“ 1956 kam Piwowski bei einer Amnestie frei. Zuerst wollte er wieder in einer Kohlenmine zu arbeiten anfangen, dann beschloß er jedoch, Journalist zu werden. Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Warschauer Universität und gewann später einen Reportage- Wettbewerb mit einer Humoreske über Seeleute bei der Zeitschrift Novocultura. Mit seinem Freund Frykowski zusammen schrieb er unter anderem einen Artikel über einen Schweden, der jedes Jahr in Zopot Urlaub machte. Der Schwede versuchte daraufhin die beiden Autoren zu verklagen. Diese hatten sich unterdessen an der Filmhochschule in Lodz eingeschrieben. Frykowski, Sohn reicher Eltern und eine Art sozialistischer Playboy, wurde später der erste private Filmproduzent Polens. Er ging dann in den Westen, wo er zuletzt für Roman Polanski „Wenn Katelbach kommt“ produzierte. 1968 wurde Frykowski von Charles Manson ermordet.
Piwowski beteiligte sich 1967 an einem internationalen Filmfestival in Bremen – zum Thema „Was machen junge Leute zwischen 16 und 18 Uhr?“. Für seinen Beitrag „Es brennt, es brennt, endlich passiert etwas“ filmte er ein Feuerwehrfest, auf dem eine Scheune in Flammen aufgeht, und das Treiben von Freeclimbern am Führerbunker „Wolfsschanze“. 1968 begann er mit den Dreharbeiten zu seinem ersten Spielfilm: „Rejs“ (was eine „Sauftour“ aber auch eine „kosmische Odyssee“ sein kann, in diesem Fall jedoch mit „Dampferfahrt“ zu übersetzen ist). „Ein Journalist sah sich die Dreharbeiten auf dem Schiff an. Anschließend sagte er: ,Das wird ein Film gegen die Regierung.‘ – Was nicht falsch war. Der Film kam dann 1970 nur mit einer Kopie – also halb zensiert – in die Kinos. Das war jedoch die beste Reklame: Nach einem Jahr kannte ihn jeder. 1971 sagte mir der Vizekultusminister auf dem Filmfestival in Lagow: ,Marek, hör auf, hier weiter Blödsinn zu erzählen, ich werde Rejs zum italienischen Filmfestival in Pessaro schicken.‘ Das tat er dann auch – jedoch mit einer Kopie ohne Untertitel.“
1994 bekam der Film auf der Berlinale Standing ovations. Inzwischen ist er in Polen derart berühmt, daß in den Studentenclubs meist eine japanischen Synchronfassung gezeigt wird: Jeder kennt die Dialoge! Die polnische Kritik lobte den zur Hälfte mit Laiendarstellern gedrehten Film bereits 1970 als ein „philosophisches Traktat“. Auf einem Weichsel-Vergnügungsschiff sollen zwei blinde Passagiere mit den Ausflüglern ein anspruchsvolles Kulturprogramm einstudieren. Die Fahrgäste, ihrem Milieu enthoben, verknoten dabei Jargon und Offizialsprache: „These, Antithese, Synthese, Kultur, Mißachtung…“; ein gelehrter Humanist stammelt: „Hier ist es wunderschön, wunderschön…“; eine Dame: „In so schönen, naa Umständen, naa Natur…“; ein Viertelgebildeter, der als halbgebildet gelten will: „Und wer wird dafür zahlen? Wir, das heißt die Gesellschaft“; ein Halbgebildeter, der glaubt die Säule der Nation zu sein: „Also muß man ran an die Arbeit und: bauen!“
Nach „Rejs“ drehte Piwowski einige Aufklärungsfilme – über Alkoholismus („Der Korkenzieher“, 1971) und über Geschlechtskrankheiten (nur für Erwachsene). Der Chef des Warschauer Dokumentarfilmstudios Bossak gab ihm das Geld dafür. Als provokatorisches Element enthielt der Alkoholiker- Film u.a. Zitate von einer Plenarsitzung des Parlaments, auf der gerade die Erhöhung des Plansolls bei der Alkoholproduktion beschlossen wurde. Später kamen einige TV-Produktionen: Raymond Chandler, Georges Simenon und – während des Kriegsrechts – „Catch 22“. 1980 drehte Piwowski einen Dokumentarfilm über Chomeini. Im Jahr darauf bot man ihm eine Filmprofessur in Bagdad an. Statt seiner ging ein Freund von ihm hin: „Er braute sich dort seinen Alkohol selbst – und ist nun gesundheitlich ruiniert. Gut, daß ich die Stelle nicht angenommen habe!“ 1984 offerierte man ihm erneut eine Gastprofessur: am Film-Department der City University von New York.
„Ich schrieb ihnen: Ich könne nur etwas über Gangster- und Westernfilme erzählen. Sie waren einverstanden. Auf die Schnelle mußte ich mir daraufhin Dutzende von US-Filme reinziehen. Damals lehrte dort schon die tschechische Mafia, unter anderem Milos Forman. Die Studenten hielten zu meinem Glück nicht viel von Theorie – sie fingen sofort an, Filme zu drehen. Normalerweise arbeiten sie dabei mit den berühmtesten Filmschauspielern zusammen, das ist dort so üblich. Ich zwang sie, selbst zu schauspielern – um sich später als Regisseur besser in ihre Darsteller reinversetzen zu können.“ 1989 flog Piwowski wieder nach Polen – anläßlich der ersten freien Wahlen dort. Danach kehrte er in die USA zurück. 1993 drehte er „Agathas Entführung“. Der Film handelte von der neuen Klasse in Polen, die dieselben alten – amoralischen – Methoden benutzt, um nach oben zu kommen: „Unsere Desillusion oder besser Illusion war, alles Böse mit dem (kommunistischen) System identifiziert zu haben. Inzwischen glaube ich, in Polen kann überhaupt kein System auf Dauer existieren.“ Piwowski drehte „Agathas Entführung“ erneut mit Schauspielern und Amateuren: „Ich bevorzuge Amateure, weil man dabei öfter überrascht wird, mit Profis zu arbeiten ist jedoch einfacher. Wenn man jedoch die Wahl hat – zwischen mehr Wahrheit und mehr Schönheit, dann sind die Amateure wahrer.“
1997 folgte wieder eine Fernsehproduktion: „Krok“ („Der Paradeschritt“) – ein in Deutschland undenkbares TV-Projekt: Der polnische Geheimdienst will herausbekommen haben, daß der Aufnahme Polens in die Nato nichts mehr im Wege steht – bis auf den unmöglichen Paradeschritt der polnischen Armee. Einige hochkarätige Militärs versammeln daraufhin heimlich diverse Vertreter des öffentlichen Lebens in einem Theater, um ihnen neue Paradeschritte vorzuführen und sie diskutieren zu lassen. „Krok“ war im letzten Jahr der meistbejubelte Film auf dem Festival von Lagow. In Piwowskis nächstem Fernsehfilm geht es um Fußballfans. Zur Erholung macht der heute 63jährige Dauerläufe um Fußballstadien. In Berlin, das er – nach seiner mißglückten Republikflucht 1955 – doch noch Anfang 1998 erreichte, joggte er um das Olympiastadion. Eingeladen hatte ihn das polnische Kulturinstitut – anläßlich des 50jährigen Bestehens der Filmhochschule von Lodz.
Der Regisseur Kazimierz Kutz urteilte über diese wohl bekannteste Filmhochschule der Welt: „Ich denke, wenn man das Geheimnis der Entstehung dessen sucht, was man später die Polnische Schule nannte, dann liegt gerade hier die Ursache – in der ideologischen Spannung.“ Über ihren Lehrer Jerzy Toeplitz schrieb Andrzej Kostenko: „Er erzählte uns viel über Europa und die Welt. Er verfolgte eine geistreiche Politik, um uns das Bewußtsein eines Europas ohne Eisernen Vorhang, das Bewußtsein, daß Polen kein verlorener Planet ist, einzuimpfen.“
Nah dran: „Zerrissen“
Die Premiere von Uwe Gooß‘ Dokumentarfilm hatte etwas von einer Beerdigungsfeier – konzentriert war es in der Kneipe in Berlin-Kreuzberg, und nüchtern. Mike K., der Protagonist, dessen Familie bei der Premiere dabei ist, starb 1985 an einer Überdosis Heroin, seine Freundin Heike im vergangenen Jahr an Aids.
Wohl auf Wunsch der Düsseldorfer Eltern – der Vater ist Architekt, die Mutter betreibt eine Galerie-Boutique – wurde der Nachname K. verkürzt.
Anfang der Achtziger brachten es die beiden laut SFB zu „Punk- Ikonen“ – sie als Cover-Girl der Berliner Stadtillustrierten Zitty, er in Fernsehshows. „Er hatte zwar zerrissene Hosen an und so, war aber immer sauber, und die Schuhe immer geputzt“, erzählt seine Mutter. Sein Kumpel Campino von den Toten Hosen ergänzt: „Und die meisten Nieten auf der Jacke.“ Mike war in Düsseldorf von der Privatschule geflogen, klaute dem Vater 20.000 Mark und machte sich mit Heike auf nach Berlin, wo er 1980 die Kneipe „Chaos“ eröffnete. Freilich nicht in „SO 36“, dem legendären Kreuzberger Kiez, wie der SFB behauptet, sondern in „61“.
Der Sender sitzt weit weg von diesen „Problemvierteln“, sein Film blieb jedoch durchgehend nahe dran. Regisseur Uwe Gooß gehörte einst zur selben Scene wie Mike. Angesichts der Alternativen – Knarre, Fixe oder Kamera – entschied er sich schließlich für letzteres.
Anders Mike: Nachdem der seine Kneipenkonzession verloren hatte, hätten sie beide, so erzählt sein Freund im Film, „aus lauter Liebe“ zu ihren Freundinnen wie diese angefangen zu fixen. Die Mädchen arbeiteten in einer Peepshow, die Jungs versuchten es mit Beschaffungskriminalität. Die Eltern zogen unterdes nach Freiburg aufs Land. Einmal kam Mike zum Entzug, Vater und Sohn versöhnten sich wieder und bauten zusammen einen Resthof aus: „Da waren wir ein Superteam!“, erinnert sich der Vater.
Maciej Drygas‘ „Im Zustand der Schwerelosigkeit“
Die besten Analysen Rußlands kommen nach wie vor von polnischen Intellektuellen. Besonders ihren Filmen haftet dabei manchmal so etwas wie Rache an. Diese ist am besten süß – das heißt wehmütig. Ein gutes Beispiel dafür ist der Dokumentarfilm von Maciej Drygas „Im Zustand der Schwerelosigkeit“ (1995) über die langsam in Agonie übergehende sowjetische Raumfahrt. Dazu werden eine Reihe von Kosmonauten und Wissenschaftlern interviewt. Ihre freimütigen Reden kontrastiert der Regisseur mit Bildern der Raumstation Mir, die weiter still durch das All gleitet. Das russische Raumfahrtzentrum stellte Drygas sein Filmarchiv zur Verfügung.
Ausgangspunkt des Films ist ein Raumfahrtereignis Anfang der neunziger Jahre: Der Kosmonaut Serge Krikalew, der die Erde alleine im All umkreiste, kann nicht wie geplant zurückkehren, weil die sich auflösende Sowjetunion dafür kein Geld mehr hat. Langsam gehen seine Lebensmittel oben zur Neige. „Ich fühle eine gewisse emotionale Anspannung“, wird dazu aus seinem Funkprotokoll zitiert. Der erste von Drygas interviewte Kosmonaut (K1) thematisiert bereits die Unsterblichkeit.
Der zweite Kosmonaut (K2) erklärt: „Es ist wie bei einem Bergsteiger. Wenn er es schafft, fühlt er sich anschließend menschlicher, wenn er scheitert, ist er um eine Erfahrung reicher. Das Wichtigste dabei ist aber, sich selbst überwunden und dabei etwas empfunden zu haben, was nur einigen wenigen Auserwählten zuteil wird.“ Dazu werden aus dem Filmarchiv die ersten Flug- und Raketenexperimente gezeigt, die noch häufig verunglückten. Der kluge Kosmonaut (K3) formuliert ein erstes Fazit: „Die Schwerelosigkeit fühlte ich gar nicht – es war wie in einem Traum zu fliegen!“ K4 war angesichts der Unendlichkeit des Weltraums „geschockt“. Und K5 fühlte sich im dahinsegelnden Raumschiff auf „mystische Weise“ ständig beobachtet, bei Außenarbeiten verspürte er eine Art Sog, sich abzunabeln.
Bilder von einem Ausstieg lassen seine Ergriffenheit ahnen. Der Bodenstation berichtet ein Kosmonaut: „Wir haben gerade gegessen und müssen viel furzen, es stinkt bei allen gleich. Über Sachalin habe ich ein bißchen Flüssigkeit getrunken. Unser Kommandant hat dort gedient.“
Auch Tausende von Polen „dienten“ dort – in der Verbannung. K2 kommt auf das schreckliche „Heimweh“ zu sprechen, das einen dort oben befällt: „Ziolkowski (der Begründer der russischen Raumfahrt, 1857-1935) sagte einmal: Die Menschen werden die Erde verlassen. Das ist falsch. Es geht nicht – wegen des Heimwehs. Was kann man dagegen tun? Arbeiten ist die einzige Lösung! Und in der freien Zeit? Da habe ich das Klo gespült. Das ist sehr nützlich. Fünf Minuten – und die schlechten Gedanken sind weg.“ K2: „Am besten, man vergißt dort oben alle menschlichen Gefühle – und hält sich hundertprozentig an sein Flugprogramm, aber die Gefühle kommen wieder: im Schlaf. Kein Mensch hat solche Träume wie die Kosmonauten im Weltraum.“
Die Traumdeutung ist ein wichtiger Teil der Psychoanalyse. Diese hatte in der Sowjetunion nach der Ausschaltung der Trotzkisten offiziell fast nur noch in der Person von Otto Juljewitsch Schmidt überlebt (Ehemann der pädagogischen Psychoanalytikerin Wera Schmidt, deren „Experimente“ 1968 im Westen wiederausgegraben wurden). Der Lehranalytiker Otto Schmidt war erst Herausgeber der „Psychoanalytischen Bibliothek“ und dann bis 1941 der „Großen Sowjet-Enzyklopädie“, vor allem war er jedoch Leiter der mächtigen „Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg“ und für die Polarforscher und -flieger verantwortlich, die populären Vorläufer der Kosmonauten. Zuvor, 1934, hatte man ihn selbst als Polarfahrer aus dem Eis gerettet. Diese „gescheiterte“ Expedition machte Schmidt so berühmt wie danach nur noch der erste bemannte Raumflug den Kosmonauten Juri Gagarin.
Emmanuel Lévinas sprach 1991 im Zusammenhang mit Gagarin einmal über Heldentum und Heimweh – als die zwei Seiten ein und derselben Wiederentdeckung: von „Welt und Kindheit“. Der zweite Kosmonaut (K2) in Drygas‘ Film erzählt: „Um die Erinnerungen, die einem vorm Einschlafen kommen, zurückzudrängen, hörst du dir die letzten Gespräche mit deiner Familie auf Tonband an. Alle vierzehn Tage können wir mit unseren Angehörigen reden. Und wenn du dann deren vertraute Stimmen noch einmal hörst und noch einmal, dann verschwinden die Erinnerungen. Man weiß, daß man gegen sie ankämpfen muß. Glücklichsein ist sicher ein starkes Gefühl – das ist aber auf langen Raumfahrten verboten: Man muß es unterdrücken.“
Archivmaterial: Ein Huhn flattert hilflos in der Schwerelosigkeit einer Kabine herum. K1 erzählt: „Die Landung ist ein kompliziertes psychologisches Problem. Während des Fluges gibt es oben keine Zigaretten, keinen Alkohol und keine Sexualität. Wir denken oft an unsere Frauen – das ist normal. Aber im Moment der Landung denke ich: Wenn alles glattgeht, werde ich erst einmal eine rauchen und einen Wodka trinken. Lieber Gott, laß es gutgehen… Und wie schön dann unten alles aussah. Die Tulpen blühten. Gleich nach der Landung schmeckte die erste Zigarette einfach wunderbar, auch der Weinbrand, sie gaben uns ein winziges Glas voll. Ein Produkt aus Erde und Sonne. Dann am dritten Tag der Besuch unserer Frauen: Noch jetzt kommen mir fast die Tränen, wenn ich davon erzähle. Das sind alles normale menschliche Gefühle. Aber wir waren auch angehalten, über den Tod zu sprechen, über die Angst vor dem Tod.“
Dazu Bilder von Übungen zur Flugvorbereitung. K4: „Sie teilten uns in drei Gruppen, jede bekam eine andere Betäubung, die, die ich bekam, unterdrückte die Schmerzempfindung – bei vollem Bewußtsein. Noch heute erinnere ich mich an alles, was sie mir antaten – ich wurde mehrmals ohnmächtig. Es war faszinierend, fast wie ein Gefühl von Unverletzbarkeit. Während dieses zweieinhalbstündigen Experiments gelangte ich vier- oder fünfmal auf die andere Seite des Lebens. Keiner der Ärzte kennt den Bewußtseinszustand nach Eintritt des Todes. Jeder von uns bemühte sich, so gut er konnte, aus dem Kollaps wieder hervorzukommen. Einige schafften es nicht, sie blieben seelische Wracks. Die Ärzte halfen uns in keiner Weise. Sie stellten auch nie eine Diagnose, sondern sagten höchstens: ,Du bist für die Tests nicht geeignet!‘ Offiziell existierten wir nicht einmal als Testpersonen. Das war sehr bequem für sie. Wir hatten alle eines gemeinsam: eine Leidenschaft für die Fliegerei und den Himmel. Die Tests waren ein Raumflugersatz. Es war wie ein Kampf: Ich schaff‘ das, ich werde es versuchen!“
Dazu filmte Drygas ein menschliches Wrack im Rollstuhl. „Viele Male habe ich gedacht: Ich gebe auf. Nein, ich habe dann doch weitergemacht.“ K3 fügt hinzu: „Schon als ich beschloß, Kosmonaut zu werden, versuchte ich mich mit gefährlichen Situationen vertraut zu machen. Irgendwann schien es mir, daß ich dem Tod ins Auge sehen konnte. Aber dem war nicht so. Es kam noch viel schrecklicher. Die Angst steigerte sich bis zum Verrücktwerden. Ich dachte, daß mir nur noch fünf Minuten zu leben blieben – bevor das Raumschiff auf der Erde zerschellte, so wie das von Komarow.“
Dazu wird Archivmaterial von dessen verunglückter Landung und vergeblicher Reanimation gezeigt. Eine Verantwortliche für die Flugkontrolle schildert die letzten Minuten. Dann Bilder von der Beerdigung.
K4 setzt seinen Bericht über die Vorbereitungen auf den Flug fort: „Trotz dieser schrecklichen Tests und meines schlechten psychischen Zustands denke ich, es war eine interessante Zeit – ein Abenteuer. Schon bei den Übungen im Simulator zum Beispiel fühlte man sich weit, weit von allen irdischen Problemen entfernt. Das regte die Phantasie an.“ Alte Archivaufnahmen von Experimenten mit Hunden und Affen, letztere kucken entsetzlich traurig. In den zwanziger Jahren hatte sich Otto Schmidt übrigens für eine künstliche Kreuzung von Mensch und Affe eingesetzt. Dann neuere Aufnahmen von dem mit Trümmern und Müll übersäten Weltraumforschungsgelände Baikonur und von einigen Fehlstarts.
K2: „Die Zeit von Gagarin – das war großartig. Die ganze Nation war begeistert: Es ist gelungen! Wir sind die ersten, wir haben gewonnen!“ K5 ergänzt: „Jetzt wollen die Leute was davon haben. Die Leute wollen, daß etwas Nützliches bei der Weltraumforschung herauskommt.“ K3: „Wir haben unser Hauptproblem nicht gelöst. Wir können in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen.“
Es folgt ein letzter Funkdialog zwischen Serge Krikalew und einer Diensthabenden in der Bodenstation, die ihn wegen der sich verzögernden Rückkehr beruhigt: „Hauptsache, du bist gesund.“ „Ja.“ „Du mußt auf dich aufpassen und darfst die Übungen nicht vernachlässigen.“ „Das ist nicht das Problem!“ „Aber was können wir denn für dich tun?“ „Ich bin jetzt exakt acht Monate hier oben – und nicht mehr motiviert, weiterzuarbeiten.“ „Das passiert hier unten jetzt auch: Niemand fühlt sich mehr in der Lage, was zu arbeiten. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Und das Schlimmste ist: Wir haben die Talsohle noch nicht einmal erreicht.“ „Wann wird das sein?“ „Ich weiß nicht, ich weiß nur, daß alles noch viel schlimmer werden wird…“ Eine sehr junge Testperson springt mit dem Fallschirm ab: das letzte Bild.
Was für ein Film! Vergeßt alle Science-fiction, Nasa-Dialoge und Propagandastreifen von der Dasa, wie sie in Peenemünde und demnächst in eurem „Space Park“ gezeigt werden. Auch die Wanderausstellung über Weltraumforschung – zuletzt im Berliner Haus der Russischen Kultur – ist dagegen nur Kosmoskitsch.
„Die Zivilisationsbringer“
In Guatemala gibt es eine „Verifizierungskommission“ der Regierung zur Aufklärung der Bürgerkriegsmassaker in den siebziger und achtziger Jahren. Das Geld dafür kommt unter anderem vom Deutschen Entwicklungsdienst, Kommissionsvorsitzender ist Professor Fomuschat, Völkerrechtler an der Berliner Humboldt-Universität. Auf sein Drängen hin wurden jetzt die Massengräber in Panzos, Nordguatemala, geöffnet. Dort waren 1979 etwa 150 Indianer bei einer Demonstration für ihre Landrechte von der Armee erschossen worden.
In vielen sozialistischen und postkolonialistischen Ländern gibt es derzeit Restitutionsbestrebungen, das heißt verwaltungsrechtliche Versuche, ehemals Enteigneten ihre Immobilien zurückzugeben: in Tschechien, Südafrika, Neuseeland und Deutschland. In Zimbabwe, vormals Rhodesien, hat man gerade damit angefangen, die großen Farmen der Weißen zu enteignen, um das Land an die Armen zu verteilen. 350.000 Landarbeiter sind derzeit auf derartigen Farmen beschäftigt. Die dem Schutz des Privateigentums verpflichtete internationale Presse geht davon aus, daß die Arbeitslosigkeit in Zimbabwe wegen dieser Landreform demnächst ansteigen wird und daß die Enteignungen insgesamt „verheerende Folgen“ für die Wirtschaft des Landes haben werden.
Ähnliches prophezeit man auch Guatemala, wenn die dortige Zivilregierung auf Druck der zunehmenden Zahl von Armen daran ginge, die Großgrundbesitzer, die zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen und 60 Prozent des Bodens besitzen, zu enteignen. Die Besitzer der Fincas sind zumeist Deutsche, das Land gehörte seit Beginn des Jahrhunderts Firmen wie der Hanseatischen Plantagen- Gesellschaft. Die Deutschen bekamen es von der Regierung geschenkt, sie mußten nur für die Vermessung zahlen. Dann ließen sie große Flächen roden und bauten Kaffee an: Die Arbeitskräfte dafür mußten immer wieder von sogenannten Kommissionen in den Dörfern ausgehoben werden.
1933 wurde die Zwangsarbeit in Guatemala eingeführt – auf Grundlage eines „Gesetzes gegen Vagabundentum“, das man sich aus den Sklavengesetzen von Deutsch-Südwestafrika quasi übersetzte. 1934 motorisierte Mercedes-Benz die guatemaltekische Polizei. Als der nordamerikanische „Hinterhof“ Guatemala an der Seite der USA in den Krieg eintrat, wurden die Deutschen in Texas interniert und später gegen amerikanische Kriegsgefangene aus deutschen Lagern ausgetauscht. 1944 wählte das Land von der Größe der DDR – nach einer „Volkserhebung“ und Freien Wahlen – den Landreform-Sozialisten und gebürtigen Schweizer Jacobo Arbenz zum Präsidenten. Er begann, die Ländereien an die Indianer zu verteilen, die heute zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen. Rund 500.000 von ihnen verdingen sich als Saisonarbeiter auf den Fincas.
1954 wurde Arbenz mit Hilfe der CIA gestürzt – und mußte ins Ausland gehen. Im Zuge der Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt entwickelte sich eine linke Bewegung gegen die Militärdiktatur, deren Todesschwadrone allein zwischen 1978 und 1982 über 5.000 Oppositionelle ermordeten. „Die achtziger Jahre waren betrüblich, der Kommunismus hat auch hier um die Ländereien gekämpft“, erinnert sich ein deutscher Unternehmer, der in dem Film „Los Civilizadores“ interviewt wird.
Die beiden Filmemacher Thomas Walter und Uli Stelzner sind schon seit Jahren in Guatemala tätig. Zuerst drehten sie einen Film über Landlose, die vor der Repression nach Mexiko geflüchtet waren, dann einen über Landbesetzungen in Guatemala. Ihr neuer Film über die deutsche Kolonie scheint ebenfalls von Sympathie für seine Protagonisten getragen zu sein. Zumeist sind es alte Finca- Besitzer und deren kaufmännisch tätige Nachkommen sowie westdeutsche Konzernrepräsentanten, die man allesamt getrost als „rechtsnational“ bezeichnen darf: „Das wird man hier draußen!“
1986 stattete Mercedes-Benz die guatemaltekische Polizei erneut mit modernster Technik aus, nachdem diese – mit westdeutscher Entwicklungshilfe – neu organisiert worden war. Heute besteht diese Hilfe vornehmlich in der Exportberatung. Zwar entfallen immer noch 23 Prozent des Exportvolumens auf den Kaffee, aber mehr und mehr asiatische und europäische Textilunternehmen errichten sogenannte Maquilas – Betriebe zur Textilendfertigung – in Guatemala: Sie beschäftigen inzwischen über 70.000 Menschen. Die koreanischen Unternehmer gelten als besonders rücksichtslos: An vielen Wänden steht „Koreaner raus!“ Diese loben hingegen insbesondere die Fingerfertigkeit und Mentalität der indianischen Arbeiterinnen. Auch ein alter Finca-Besitzer meint: „Ich habe immer gerne mit den Indianern gearbeitet.“ Ein deutscher Textilunternehmer ist mit den koreanischen einer Meinung: „Die Menschenrechte und alle möglichen Vergünstigungen – das kann man nicht von heute auf morgen einführen!“
Guatemala hat die höchste Analphabetenquote in Lateinamerika. In einigen Fincas organisierten die Deutschen früher eine Art Schulunterricht für die Kinder ihrer Landarbeiter, von denen deswegen noch heute viele die deutsche Nationalhymne singen können. Nichtsdestotrotz gehörten die Finca-Besitzer, neben den Textilfabrikanten, zu den ersten, die von der Guerilla angegriffen wurden. Eine einst pädagogisch-engagierte Finca-Erbin erinnert sich: „Das sind die gleichen Menschen, die in der Schule auf meinem Schoß gesessen haben. Meine Schwägerin hat damals schon gesagt: ,Paß auf, die Indianer sind falsch.‘ Ich muß leider sagen: Sie hat recht gehabt!“ Eine Lehrerin an der deutschen Schule meint noch heute: „Dieses Land würde nur besser werden, wenn es eine Diktatur auf rechter Seite wäre.“ Aber, gibt ein deutscher Unternehmer zu bedenken: „Die Indianer haben (auch) ein ganz anderes Denken, da kommen wir nicht rein.“ Im Film wird dazu passenderweise ein indianischer Gebetsritus gezeigt.
„Es müssen schöne Zeiten gewesen sein, man hat damals deutsch gelebt“, seufzt ein eher junger Repräsentant von BMW. Dennoch seien auch heute noch die Deutschen „alles fröhliche, glückliche – und erfolgreiche Leute“. Der gesamte Kolonialismus war laut Eric Hobsbawm („Das Zeitalter der Extreme“) ohne Phantasie. Bei den Deutschen kommt dabei jedoch stets eine spezielle Note hinzu: das Schwanken zwischen verlogener Sentimentalität und grausamster Systemik – bis heute. Die im Film interviewten Unternehmer reden beständig um beide Pole herum. Die Frauen sind etwas offenherziger, deswegen findet eine Finca- Besitzerin auch nichts dabei zu berichten: „Die Arbeiter hatten die Angewohnheit, sich nachts in ihren Unterkünften zu unterhalten. Das hat mich gestört (…) und da wurde das abgestellt.“
Neben den Interviews wurde in diesem Film auch noch jede Menge guatemaltekisches Archivmaterial verarbeitet – mit etwas zu viel Militärmarschmusik für meinen Geschmack. Dafür beginnt und endet das Ganze an einem Pazifik- Traumstrand, der so aussieht, als sei Guatemala touristisch noch ziemlich unerschlossen. Die 260 Millionen Dollar, die der Tourismus im Jahr einbringt, nannte die FAZ dann auch neulich ein nur „unzureichend genutztes Wirtschaftspotential“, was sie mit der „schlechten Infrastruktur“ und der „wachsenden Kriminalität“ erklärte.
Weil also Guatemalas gesamter Export und damit die Gesamtwirtschaft noch immer primär von den Finca-Besitzern abhänge, würden „viele in- und ausländische Beobachter eine Landreform fordern“, Enteignungen wären jedoch „weder national noch international durchsetzbar“, und würden überdies nur den „jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen der Guerilla und dem Militär neu entflammen“. Der Mercedes-Benz-Repräsentant vor Ort rät deswegen zu mehr „Zeit und Geduld. Wir sind (demokratiemäßig) auf einem guten Weg.“ Und der ist wahrscheinlich erst dann abgeschlossen, wenn alle Indianer entweder im Gefängnis gelandet sind oder eine Anstellung als private Wachposten gefunden haben.
Das wäre dann eine amerikanisch-nachgebesserte Deutsch- Demokratie – analog etwa dem Deal amerikanischer Konzerne mit guatemaltekischem Erdöl: Sämtliche Vorkommen werden von ihnen ausgebeutet und exportiert, um anschließend das Öl, als Kraftstoff, wieder zu reimportieren – diese schöne „Veredelung“, gleichzeitig eine „Verelendung“, schlägt sich mit drei Prozent in der Ausfuhr- und mit elf Prozent in der Einfuhrstatistik Guatemalas nieder.
„Und plötzlich sahen wir den Himmel“
Was gibt es Schöneres, als klugen Frauen zuzuhören und zuzuschauen? Torres, Jorge, Estevechea und eine ihrer im Gefängnis geborenen Töchter, Gabriela, waren Aktivistinnen bei den Tupamaros. Die drei deutschen Frauen, Berberich, Czenki und Möller, standen der RAF bzw. der Bewegung 2. Juni nahe. Das 100minütige Video „Und plötzlich sahen wir den Himmel“ wurde in Montevideo, Frankfurt und Berlin gedreht, an den Wohnorten der interviewten Frauen. So ist es trotz des Versprechens der feministischen Filmgruppe (deren „Projekt“ zudem von einer Vielzahl von Initiativen unterstützt wurde) doch bloß eine Dokumentation von „Talking Heads“ geworden.
Von Irmgard Möller sehen wir wenig mehr als ihre Freilassung 1994, dafür kommt ausführlich Gisela Wiese zu Wort, die jahrzehntelang erst Zeugen in Naziprozessen betreute und dann RAF-Prozesse besuchte. Sie ist „Pazifistin, aber nicht um jeden Preis“, und wird in der typischen Frauenpose (am Abgrund, d.h. am Geländer) interviewt. Monika Berberich spielt auf einem Hinterhof mit ihrer zahmen Krähe „Erna“. Yessie Macchi Torres raucht in der Küche Zigaretten. Die südamerikanischen Terroristinnen sind bedeutend runder als ihre eher verhärmten deutschen Kampfgenossinnen. Vielleicht liegt es daran, daß erstere nach einem halben Sieg und Ablösung der Militärdemokratie amnestiert wurden (aus dem Foltergefängnis wird gerade ein Supermarkt), während letztere bis zum bitteren Strafende und der ebenso empfundenen Wiedervereinigung hinter Gittern bleiben mußten? Und dann sind die einen katholisch und die anderen protestantisch…
Der Titel des Films „Und plötzlich sahen wir den Himmel“ bezieht sich auf eine Aktion der im „Frauen-Konzentrationslager“ von Montevideo Inhaftierten, die ihnen als eine besonders gelungene in Erinnerung geblieben ist: Wochenlang lösten sie heimlich die Verankerung der Fensterverkleidungen hinter den Gittern. Auf ein Signal hin wurden dann alle Verkleidungen auf einmal herausgedrückt. Die Tupamaro-Kämpferinnen erzählen aber auch von ihren Liebhabern, zeigen Fotos, bekamen Kinder im Knast, bedauern, daß sie ausgerechnet in der Blütezeit ihrer Schönheit inhaftiert waren. Dazu wird eine Blüte gezeigt. Und das Guerilla-Vorbild hüben wie drüben wird in dem Film als Schriftzug eingeblendet: Che.
Das streng antifaschistische Frauenfilmkollektiv, auf dem Foto so jung wirkend, hat alle in der alten Sowjetunion einst entwickelten feministischen Propaganda- Tricks drauf – obwohl es natürlich weiß, daß die Waffe der Kritik (Beta-Cam) die Kritik der Waffen (hier Kalaschnikow, dort eine 38er) nicht ersetzen kann. Vergleicht man diese jüngste Terroristinnengeneration des Westens (Monika Berberich wurde erstmalig in den Sechzigern im Osten – als Fluchthelferin – inhaftiert) mit den schon fast zu Klassikern gewordenen weiblichen politischen Gefangenen in Rußland – von der „Dekabristin“ Maria Wolkonskaja über die Terroristinnen Vera Sassulitsch und Vera Figner bis zur „Trotzkistin“ Jewgenia Ginsburg -, dann fällt einem auf, daß man es hier mit einer fortdauernden echten Romantik zu tun hat.
„Das Romantische war vielleicht, daß wir alle glücklich waren“, meint Yessie Macchi Torres, eine ehemalige Chefsekretärin, über ihre Untergrundzeit. Monika Berberich spricht davon, daß dabei „die Frauen sehr viel weniger zu verlieren und sehr viel mehr zu gewinnen“ hatten. Und Graciela Jorge, die zu den Frauen in der 1. Reihe der Tupamaros gehörte, erwähnt, daß sie einen starken Zulauf vor allem aus dem „Lumpenproletariat“ hatten. Man spürte diese romantische Ganzheitlichkeit, wie die evangelische Pastorin von Bischofferode, Christine Haas, das 1995 nannte, noch in den ersten deutschen Terroristinnen- Veröffentlichungen: in der Biographie von Katharina de Fries „Gestreifter Himmel“ beispielsweise. Aber zuletzt war davon nur wenig mehr als DDR-Kitsch übriggeblieben.
Selbst solche Aufarbeitungen gingen jedoch tiefer als die der mit den „Genres“ (Wassili Axjonow) hadernden männlichen Terroristen. „Wir wollten nicht mehr reden, sondern handeln“, sagt die eine im Film und „die Sprache der Guerilla ist die Aktion“, sagte neulich ein anderer (auf einer deutschen Bühne). Um so trauriger ist es, daß keine der acht Frauen bei ihrer heutigen Arbeit – in action also – gefilmt wurde. Bis auf Graciela Jorge – kurz als Ansagerin im Tonstudio, und Monika Berberich – als Fahrradkurierin, ein Job, den ich ebenfalls für Kitsch halte, wenn auch für einen legitimen: Um jung und sportlich zu sein und damit Geld zu verdienen (für das Lumpenproletariat der einzig mögliche individuelle Aufstieg aus der Misere, und für die anderen auch nicht gerade ein Existenz-Handicap!).
Der Videofilm als „Hinteraktives Medium“ – d.h. daß hinter der Kamera grundsätzlich mehr passiert als vor ihr – produziert jedoch selbst seine „Aktion“. Das Frauen- Filmkollektiv (mit dem etwas süßlichen Firmennamen interoceana – alles meert) spricht in einem Faltblatt von „Anekdoten zu den Dreharbeiten“ – und erwähnt zwei, die in ihrer Auswahl das ganze „Projekt“ quasi noch einmal romantisch zusammenklammern: „Die gescheiterten Versuche der Uruguayas, den Deutschen den Tango beizubringen, der als Überfall anmutende (sic!) Einsatz der SEK Frankfurt, bei dem das Filmteam mit schußbereiten Waffen umstellt und aus dem Bus gezwungen wurde.“ Dazu paßt, daß die BRD im Film von ihnen am liebsten mit soldatischen Männern illustriert wird.
Aber das sind alles Kleinlichkeiten. Was bleibt, ist der Eindruck, daß die porträtierten Frauen wirklich was geleistet haben, und die Hoffnung, daß die kommende Terroristinnengeneration mindestens genauso klug ist und dazu beiträgt, die Welt vollends „durchzuromantisieren“, wie das in den frühen Anfängen der „Bewegung“ hieß. Es war übrigens der russophile Nietzsche, der als erster darauf hinwies, daß diese Anfänge schon damals nur von einem guten Halbdutzend Frauen (jüdischer Frauen) wirklich verstanden wurden.
Wenn die Dschunken Trauer tragen
Bereits auf der Berlinale deutete sich der Themenwechsel an – weg vom Beziehungskuddelmuddel und hin zu Existenzproblemen. Dennoch dominierten dort noch die Psycho-Dialoge: Den Russen ging es primär um den „Sinn des Lebens“ – wobei sie nicht mal vor Abstechern in Sekten und Kirchen zurückscheuten. Das asiatische Kino bearbeitete durchgehend die neuen Leiden des jungen Wang: Einsamkeit, Paranoia, Psychosen – die ganze Palette der Zerstörung familialer Gewißheiten. Aber schon die französischen Liebesfilme kamen nicht mehr ohne „Arbeitslosigkeit“ und „Klassenkampf“-Anspielungen in Schwung. Erst recht nicht die deutschen Langzeit-Dokumentarfilme – von Barbara und Winfried Junge über „Die Kinder aus Golzow“ und wie sie sich nach der Wende durchs Leben wurschteln; von Regine Kühn und Eduard Schreiber über den Abzug einer GUS-Hubschrauberstaffel aus Jüterbog und was dann mit ihnen geschah; sowie Kerstin Stutterheims und Niels Bolbrinkers Spurensicherung bei der Filmfabrik Wolfen, zu dessen Premiere der Orwo- Betriebsrat Interviews gab, die wiederum die Geschäftsführung und Stadtverwaltung in Wolfen zu geharnischten Gegenerklärungen veranlaßten.
Nur drei Filme wurden aus Afrika eingereicht, 190 dagegen aus den USA. Aber auch in Afrika ist man zunehmend der amerikanischen „Basic Action“ um Eifersucht, Cabriolets und Koffern voller Dollars überdrüssig, so daß etwa in Ghana schnellgedrehte Videospielfilme, die z. B. männliches Mobbing von Sekretärinnen auf beruflicher Erfolgssuche in der Hauptstadt thematisieren, ein großes Publikum finden. Eine Auswahl davon lief gerade im KOB. Auch auf der anderen Seite – beim gerade beendeten EthnoFilmFestival im Berliner Museum für Völkerkunde – ging es mehrfach um Arbeitsprobleme: im finnischen Film „House of Full Service“ z. B. Vollends in die Existenzgründung verlagert hat sich die „Handlung“ beim neuen Kaurismäki-Film „Wolken ziehen vorbei“: Zwei Arbeitslose eröffnen ein Restaurant mit dem sinnigen Namen „Zur Arbeit“ – und man bangt mit ihnen, ob sie es schaffen, genügend zahlungskräftige Kunden in ihr Lokal zu ziehen.
Uns fesselt ein ökonomisches Drama deswegen zunehmend mehr als ein psychologischer Plot, weil die ganz normale „Existenzbedrohung“ durch Lohndumping, Unternehmerwillkür, Abwicklung und Entlassung bereits eine kritische Masse erreicht hat. Mindestens einmal am Tag sitzt man irgendwo in einer Pizzeria, in einem Döner-Imbiß oder einer Kneipe und fragt sich: Wird es den Besitzern gelingen, da mehr als die Ladenmiete herauszuwirtschaften? Auch Kinobetreibern attestiert man zunehmend Waghalsigkeit. Wo selbst hochetablierte und -alimentierte Kultureinrichtungen behaupten: Wir müssen uns jetzt finanziell etwas einfallen lassen! Und sogar auf Ewigkeit programmierte Konzerne – wie AEG, KHD, Brau und Brunnen – sich auf Kleinbetriebsgrößen „gesundschrumpfen“.
Es ist nicht die Ratlosigkeit, die endemisch geworden ist – das war sie zu Rezessionszeiten immer, sondern das Zerbröseln des Politischen, Allgemeinen und Gesellschaftlichen, was einem Hoffnung, Optimismus und Kraft nur mehr aus dem Singulären ziehen läßt. Ein neuer Existenzialismus macht sich da breit, der diesmal kein kunstphilosophisches Phänomen ist („Je ne regrette rien“), sondern eher ein neuer Breitensport: „Die ontologische Revolution des Existenzbegriffs gipfelt in der Gleichsetzung von Wahrheit und Gegenwart“ – Heinz Bude.
„ORiginal WOlfen – Aus der Geschichte einer Filmfabrik“
Das Ost-West-Dokumentarfilm-Duo betreibt seine Spurensicherung im Rahmen der Projekt- Werkstatt „Industrielles Gartenreich“ des Bauhaus Dessau. Zu diesem seit dem 18. Jahrhundert – zunächst mit ABM-Kräften – entstandenen „Reich“ in Sachsen-Anhalt zählt die nach englischem Vorbild gestaltete Landschaft zwischen Dessau und Wörlitz, das mitteldeutsche Braunkohlerevier um Gräfenhainichen sowie die auf der Grundlage der Braunkohle entstandene Industrie in Bitterfeld/ Wolfen und dem Kraftwerkskomplex ein Vockerode/Zschornewitz. Nicht zu vergessen die Junkers- Werke und das Bauhaus in Dessau selbst. Vor allem das Orwo-Filmwerk, früher Agfa, verdankt seine Existenz in Wolfen der nahen Energiequelle Braunkohle.
Der Dokumentarfilm über das Werk, in dem vor der Wende noch 15.000 Leute arbeiteten, schlägt einen Bogen vom Beginn des Aufbaus im Ersten Weltkrieg, den vornehmlich Frauen leisteten (die Männer waren im Krieg), bis zum Abbruch des inzwischen riesigen Fabrikkomplexes in den letzten vier Jahren – wiederum hauptsächlich durch Frauen, die zuletzt die Mehrheit der bei Orwo Beschäftigten stellten. In der Filmfabrik wurde zunächst Kinopositivmaterial hergestellt, später kam noch Röntgen- und Fliegerfilm zur Luftaufklärung dazu. 1936 wurde dort der erste Farbfilm entwickelt.
Einer der interessantesten Gesprächspartner der Filmemacher ist ein inzwischen in den Vorruhestand geschickter „Emulsionär“, der über die „Höhen und Tiefen“ Agfa/Orwos berichtet und für den 1980 die Periode der Stagnation begann – mit der sukzessiven Abwicklung und Demontage des Kombinats unter Treuhandregie, wogegen sich ab 1991 langsam der Widerstand der Arbeiter formierte.
Heute wird nur noch fremdes Filmmaterial von etwa 100 Orwo- Mitarbeitern konfektioniert, daneben haben sich noch etwa 100 Orwo-Forscher mit einer Firma selbständig gemacht. Die eigentliche Filmproduktion ist in einem Werksmuseum gelandet.
Nicht schlecht, Herr Specht!
Christian Specht traf ich 1986 zum ersten Mal – in der U-Bahn, Linie 1, wo er mit einem Tonband nebst Mikrophon aus Massivholz einige Fahrgäste interviewte. Zum Glück nicht mich! Er war von schwerer Statur und so impertinent, daß viele der Interviewten sich arg bedrängt fühlten: augenscheinlich ein Verrückter! Aber wie harmlos?
Seit ihrer Gründung war die taz immer auch Obdach und sogar Büro für irgendeinen draußen ungewöhnlich Gemaßregelten. Mit Christian Specht kam 1987 zum ersten Mal jemand, der draußen nicht gescheitert war, sondern – im Gegenteil – immer wieder einen direkten Bezug zur „Bewegung“ herstellte: Bei jeder Demonstration, Hausbesetzung oder Massenveranstaltung war er dabei.
In den ersten Jahren meist ausgerüstet mit hölzernen, bemalten ZDF-Kameras, -Mikrophonen, -Gitarren und -Gewehren. Dazu besaß Christian noch „echte“ Presseausweise, die ihm taz-Kulturredakteurin Sabine Vogel regelmäßig neu ausstellte – er verlor sie immer wieder. Es kam deswegen sogar einmal zu einer kleinen Anfrage der CDU.
Auch ohne dieses alberne Polit- Echo war Christians „Holz-Journalisten“-Phase schon ziemlich genial. Und so nimmt es nicht wunder, daß der Avantgardist Stiletto ihn bald „entdeckte“ – und ein Interview mit ihm im Merveband „Berliner Design“ abdruckte sowie eine Sammlung Spechtscher Holz-Objekte anlegte, die er bald teuer verkaufen konnte. Für Christian waren diese von einem Tischler-Kollektiv hergestellten Utensilien irgendwann abgelebt, und er wechselte zu Symbolen, Fahnen und Parteien.
Der taz hielt er weiterhin die Treue, sogar einen Schreibtisch hat er dort mittlerweile, und immer wieder findet sich ein taz-Mitarbeiter, der seine Parolen oder Flugblätter vormalt. Auch Christians Geldsammlungen für irgendwelche Veranstaltungen beginnen meist in der taz. Denn mit der Bewegung in Kontakt zu bleiben, das kann mitunter teuer werden: Als ihn einmal die Autonomen nicht zu einer Antifa-Demo nach Plauen mitnehmen wollten, nahm er z.B. kurzerhand ein Taxi für 500 DM.
Jetzt haben zwei Filmer, Imma Harms und Thomas Winkelkotte, einen Film über ihn gedreht: „Oh Mitternacht, Oh Sonnenschein“. Harms war früher taz-Redakteurin, für Winkelkotte ist es die Abschlußarbeit an der Film- und Fernsehakademie. Die 52minütige Dokumentation wurde am Samstag vor über 200 begeisterten Zuschauern im Künstlerhaus Bethanien uraufgeführt.
Auch ich war begeistert, dennoch ist der Film erst ein Anfang in der Auseinandersetzung mit Christian Spechts politischem Engagement. Dazu gehört auch seine Vorliebe für Volksmusik – die er im Stil von Karaoke (ohne Bildschirm) eine Weile lang sogar in der taz-Kantine vortrug, bevor diese an einen ostdeutschen Bildhauer vermietet wurde. Sehr gut war dazu im Film schon mal die Spechtsche Spontan-TV- Show auf den Treppen vor dem Bethanien-Haus.
Dann sein Wirken in den Parteien des Preußischen Landtags – bei FDP, Grünen, SPD und PDS. Sie alle besucht er regelmäßig, er läßt sich mit ihren Emblemen und Mitgliedschaften ausstatten und trägt ihnen seinerseits Neues aus der Bewegung zu. Selbst die „Zivischweine“, „Zivilbullen“ im Polizeijargon genannt, kennt er fast alle – und enttarnt sie immer wieder gerne in situ, indem er sie bittet, sich auszuweisen. Manchmal fühlte er sich auch gezwungen, sie anzuschreien. Dafür wurde er aber auch von ihnen schon öfter zusammengeschlagen. Einige Polizeikontakte werden im Film mit wackeliger Kamera genüßlich mitverfolgt, die PDS wird dagegen arg vernachlässigt: Dabei ist sie die noch am meisten an Bewegungen interessierte Partei. Dafür zeigt der Film einen Aspekt von Christian Spechts Leben, den ich bisher noch gar nicht kannte: den als Sozialfall tendenziell von „Ausgrenzung“ Bedrohten. Hierzu wurden im Film neben dem taz-Empfangskollektiv ehemalige Lehrerinnen sowie die Oma des amtlich als Analphabeten Anerkannten zitiert.
Beim Betrachten des Films wird deutlich, wie wichtig Christians Arbeit an und mit den etablierten Parteien ist (bei der PDS-Fraktion weiß man das im übrigen selbst). Es ist genaugenommen eine Fortsetzung seiner holzjournalistischen Tätigkeit im Virtuellen, wie man heute gerne sagt: am „Logo“. Und sie war notwendig: In Gambia werden auf Wochenmärkten schon jede Menge Audio-High-Tech- Geräte verkauft, die aus Vollholz geschnitzt sind. In der taz verpaßt man sich gerade selbst eine „Reportage“-Schulung von einem Geo-Journalisten. Und die Politik? Es würde mich nicht wundern, wenn Herr Specht demnächst als Investor erfolgreich auftritt: das Lächeln dazu hat er.
Schlechtgelauntes Dienstleistungsfeuilleton zum Filmfest
Potsdam ist einfach Scheiße. Potsdam hat nur eine miese Vergangenheit, keine Gegenwart und erst recht keine Zukunft. Der Siemens-Statthalter in Berlin verspricht: Erst wenn die Gegend um Potsdam so schön entwickelt ist wie die um den Starnberger See, wo die Siemens-Erben leben, könne daran gedacht werden, den Firmensitz wieder nach Berlin zu verlegen. Das ist eine handfeste Drohung, die Potsdamer SPD-Politik bemüht sich seitdem eifrig, das Terrain dergestalt vorzubereiten.
Auf dem Pots1000-Fest steckte man die Arbeitslosen in preußische Uniformen – als „Lange Kerls“, bei der Eröffnung einer Passage der Quadriga GmbH ließ man sie jetzt in Ritterrüstungen antreten. Für eine neue Potsdam-Erkundung „Preußischer Abend“ wurde gerade ein „Zillebus“ angeschafft, und auf dem Theaterschiff spielt man ein „Romantisches Ritter-Rührstück“. Das Bier heißt „Rex“, und das extra für Potsdam designte Poller-Programm nennt sich „Fritz“. Ist das nicht alles fürchterlich? Es könnte komisch Camp und schön schwul sein, allein die Homosexualität bleibt an der Berliner Siegessäule und Potsdam so stockheterosexuell wie sein Bürgermeister. Überall sprießen bunte Passagen und Gewerbe-Karrees aus dem Boden, mit Niedervoltlampen bestückt und in die ORB- Horrorfarben der Saison – Pink (Minol), Babyrosa (Telekom) und Türkis (Sorat) – getunkt.
Potsdam-Babelsberg wiederum, einst eine proletarische Enklave im Hohenzollern-Muff, ist an den Wochenenden tot und ausgestorben. Einzig am Anleger der Weißen Flotte, die demnächst ebenfalls Konkurs anmelden wird, und in den albern vergoldeten Anlagen der Hohenzollern-Immobilien schlendern lustlos ein paar Leute umher – und denken nicht daran, den „Europäischen Salon für Liebhaber des jungen Films“ anzusteuern: das 700.000 Mark teure Potsdamer Filmfestival. Es findet im Kulturhaus „Altes Rathaus“ und schräg gegenüber im Filmmuseum des „Marstalls“ statt und wird zumeist von Westberlinern besucht, weswegen es sinnvollerweise einen Shuttle von hier nach dort und zurück gibt.
Auch das Filmmuseum wurde, zumindest im Erdgeschoß, entDDRisiert, das heißt mit modernstem Equipment und Design aufgemotzt, dazu lebensgroße Ufa- Stars sowie – überlebensgroß – Anita Ekberg. Ähnliche Pappkameraden stehen im Kulturhaus, das der erste Nach-Wende-Westdirektor Hilscher von Osram niedervoltilluminieren ließ und dann mit aus den ganzen Hochadels- Museumssalons drumherum abgeschleppten Edel-Polstermöbeln vollstellte. Der hervorragende Kenner antiker Möbel, Hilscher, ist mittlerweile an Krebs gestorben. Mit seinen Raubzügen wollte er – in den Worten von Stolpe, die dieser bei jeder spekulativen Grundsteinlegung im Großraum Potsdam-Babelsberg äußert – „aus einer Stätte des Grauens einen Ort der Hoffnung schaffen“. Noch jetzt kann man an der Außenwand des Kulturhauses das entsetzte Ost- Graffito entziffern: „Hilscher macht alles kaputt!“
Weil das „Festival-Team“, das im übrigen streng hierarchisch-autoritär organisiert ist, das kulturhauseigene Kellerrestaurant nicht gut genug fand, wurde für die Dauer des Salons extra ein Musikcafé-Zelt auf den Vorplatz zwischen der Kirche, wo einige Penner unterm Vordach wohnen, und dem grauen Container-Konstrukt, in dem das Hans-Otto-Theater ensembelt, aufgestellt: Im Zelt regnet es durch, und es gibt keinen Grappa im Angebot – zugegeben, ich bin schlecht gelaunt, wie jedesmal, wenn ich in Potsdam bin!
Aber gleich der erste Film euphorisiert mich geradezu: „Les Hommes du Port“ – ein viel zu kurzer (64-Minuten-) Dokumentarfilm von Alain Tanner über die seit über 100 Jahren anarchosyndikalistisch organisierten Hafenarbeiter von Genua. Da machte es überhaupt nichts, wenn an der Ankündigung im Festival-Faltblatt nichts stimmt – und von „Matrosen“ und „atemberaubend schönen Bildern von einem Dokumentarliebhaber“ gefaselt wird: Tanner ist eher Spielfilm-Enthusiast, und es geht rein um Landratten!
Aber ich war mal kurzzeitig Matrose und, wichtiger noch: Wir wohnten 15 Jahre in Bremen am Fluß und gingen an jedem Wochenende in den Hafen. Von daher weiß ich, was ein Lukenfiez ist, nämlich der wichtigste Mann beim Be- und Entladen des Schiffes: Er steht an der Ladeluke und dirigiert mit seinen Händen bzw. Fingern den Kran, von dem aus man nicht in die Luke schauen kann. Neben dem Lukenfiez stehen die Registrateure der internationalen ControllCo, jeweils einer für den Käufer und den Verkäufer. Bevor ich wegen der Bundeswehr als Matrose, als Meßpiedel genauer gesagt, anheuerte, arbeitete ich bei einer Schiffsmaklerei, die mit ihren Konnossementen, die ich dann abzustempeln hatte, bisweilen ebenfalls noch an der Luke bzw. im Schuppen vertreten ist. In den fünfziger Jahren arbeitete Alain Tanner in einer Genueser Schiffsmaklerei. Damals lernte er den dortigen Hafen kennen, nicht jedoch die wunderbare Hafenarbeiter-Gewerkschaft und die auf ihre alten Tage immer noch so gut aussehenden Hafenarbeiter. Das hat er nun gründlich nachgeholt, und auf das Ergebnis können die Genueser Hommes du Port wirklich stolz sein, insbesondere die dortigen Lukenfieze.
Weichende Erben
Seit der Wende drängen nicht nur die arbeitslos gewordenen Ostler in den Westen, umgekehrt sickern auch immer mehr West-Glücksucher in den Osten ein. Die wesentlichsten Betriebe sind inzwischen in westdeutscher Hand, dito die großen Forste, die besten Böden, sämtliche Interhotels, fast alle Lehrstühle und Leitungsstellen in Behörden.
„Lieber nach Osten als nach Kanada“, ein Dokumentarfilm von Sophie Kotanyi und Ulli Frohnmeyer, verfolgt die mehrjährige Enwicklung eines „landwirtschaftlichen Projekts“ in Mecklenburg- Vorpommern von Anne Schritt und Wilhelm Höper aus Schleswig- Holstein. Als „weichende Erben“ konnten beide den Hof ihrer Eltern nicht übernehmen. Schon immer waren solche Nachgeborenen dort nach Pommern ausgewichen. Anne und Wilhelm gelang es 1991, ein 300 Hektar großes kirchliches Gut in Strellin zu pachten, auf dem sie biologisches Getreide anbauen und eine Milchviehproduktion aufbauen wollten.
Die Filmemacher sind schon lange mit den beiden befreundet: Ulli Frohnmeyer arbeitete einmal auf dem Hof von Wilhelms Eltern. Der gebürtige Schwabe ist Diplomlandwirt und war stellvertretender Leiter der Grünen Woche, jetzt arbeitet er als Umweltberater bei der Messeleitung. Sophie Kotanyi ist in Ungarn geboren, wuchs in Belgien auf und hat schon mehrere Langzeitfilmprojekte realisiert, erwähnt sei der über eine Agrar- Kooperative auf den Kapverdischen Inseln und eine dreijährige Dokumentation der Veränderungen eines Dorfes in Guinea-Bissau durch Entwicklungshilfe, den sie dort gerade auf Dorfplätzen zeigt.
Auch an dem Film über das vorpommersche Landwirtschaftsprojekt arbeitete Sophie Kotanyi mit ihrem Freund Ulli Frohnmeyer drei Jahre lang, und im Sommer wird er mit einem Videobus von der mecklenburg-vorpommerischen Filmförderung in verschiedenen Dörfern gezeigt werden.
Für das junge Bauernpaar galt es erst einmal, sich einzurichten, Arbeitskräfte einzustellen und einen großen Kuhstall zu bauen. Die Landmaschinen wurden auf Kredit gekauft. Zur Einweihung des Stalls gab es ein Dorffest, und der Pfarrer der Nachbargemeinde, Schorlemmer, hielt eine Rede. Inzwischen kann die Ernte als biologisch anerkannt verkauft werden, so daß sich der Betrieb mit seinen 4 bis 5 Mitarbeitern zu einem Drittel davon trägt, ein weiteres Drittel bringt die Milchproduktion, und das letzte kommt über EG-Mittel herein.
Ihren filmenden Begleitern war bei diesem „Aufschwung Ost“- Beispiel wichtig: Wie würden die Nachbarn, das Dorf Strellin und die Mitarbeiter auf die Westler reagieren? Und würden sich diese als Kolonialisten gebärden beziehungsweise als solche angesehen werden? Anne und Wilhelm trafen zunächst tatsächlich auf Skepsis und Mißtrauen. „Wir hatten befürchtet, daß es schwer sein würde, dies zu dokumentieren“, meint Sophie Kotanyi, „aber die ,Einheimischen‘ sprachen offen über ihre Gefühle vor der Kamera.“
Unerwartete Probleme gab es jedoch mit Anne und Wilhelm, „die sich bald vor uns fürchteten und versuchten, ein allzu glattes Bild von sich abzugeben. Es plagte sie die Angst, ihre Bemühungen um Akzeptanz in der Gegend wären gefährdet, würden sie sich offen über die Menschen in ihrer neuen Umgebung äußern. Sie versuchten zu kontrollieren, was in den Film hinein dürfte und was nicht. Neben der Anstrengung des Hof-Aufbaus produzierten wir mit unserer Anwesenheit als Filmteam zusätzlichen Streß. Außerdem bereitete unsere Kamerafrau aus der DDR, Julia Kunert, ihnen Mühe, offen zu ihren Meinungen zu stehen. Uns schubsten sie dafür mehr als einmal, unsere ,Berührungsängste‘ mit den Einheimischen zu überwinden.“
In „Es lohnt sich heute mehr, nach Osten zu ziehen, als nach Kanada“, so der vollständige Gedanke von Anne, geht es auch um ihre immer noch unklare Rolle zwischen Haushalt, Kindern, Buchhaltung, Vermarktungsaktivitäten und ihrem Anspruch, Mit- Chefin auf dem Hof zu sein. Wilhelms Rolle als Chef ist vergleichsweise einfacher gestrickt, aber auch er – von antiautoritärem Gedankengut angekränkelt und bemüht, kein Besserwessi zu sein – kann und will dabei nicht einfach auf traditionelle Verhaltensmuster zurückgreifen.
Selbst wenn das bisweilen der eine oder andere Mitarbeiter verlangt, der LPG-Kader gewohnt war. Dafür gab es „früher“ keine Entlassungen, selbst bei exzessivstem Alkoholkonsum nicht, wohl aber jetzt – bei dem neuen Gutsherrn, der nicht nur von staatlichen und marktwirtschaftlichen Strukturen abhängig ist, sondern sich auch noch mit den Zwängen der europäischen Agrarförderung auseinandersetzen muß.
„D.E.N.S. – Die eigentlich nicht sind“ – ein Dokfilm
Für die meisten von uns ist, zumindest bis zur deutsch-deutschen Vereinigung, Obdachlosigkeit kaum denkbar gewesen, jedenfalls nicht als angstvoller Eigenantrieb zu einkommensteigernden Aktivitäten. Wie leichtfertig wurden früher Wohnungen, Häuser gar, aufgegeben und – vorübergehend – aus der Reisetasche gelebt. Für Christian, einen jesuitischen Werkzeugmacher, der mit ehemals obdachlosen Männern zusammen in einer Wohngemeinschaft lebt und sich jüngst am Hungerstreik einer Gruppe von aus dem Kreuzberger „Engelbecken“ vertriebener Wohnwagen-Leute beteiligte, ist diese „Randgruppe“ das vielleicht einzige noch verbliebene revolutionäre Subjekt – in seiner Theologie der Befreiung. Der normale Bürger möchte die Obdachlosen am liebsten überhaupt nicht wahrnehmen, und selbst den Kreuzberger Linken fiel die Solidarität mit den „Rollheimern“ schwer, die von „Deportation“ sprachen, als ca. 900 Polizisten und eine Müllfirma ihr Hab und Gut, auf das sie zuvor mit großen Buchstaben „Eigentum“ schreiben mußten, an den Stadtrand transportierten. „D.E.N.S. – Die eigentlich nicht sind“ ist deswegen ein sehr guter Titel für diesen Dokumentarfilm von Carsten Lippstock, in dem es im wesentlichen um sechs Penner geht. Und wären da nicht zwischendrin immer mal wieder kurze Interviews mit Obdachlosigkeits-Experten und -Projektmitarbeitern, würde man nach kurzer Zeit den Dokumentarfilm- Charakter völlig vergessen, so diskret und zugleich dicht rückte das Kamerateam den Hauptdarstellern auf den Pelz.
Gerd Jensch, Erwin, ein weiterer „Kollege“ und der Freund von Else kommen durch den Suff langsam herunter und warten eigentlich nur noch auf nicht mehr anstrebbare „bessere Zeiten“ und „Platten“. Nicht so Else Spritulle (was für ein Name!), die ihren Eigensinn noch durchaus verfolgen kann: „Ich habe keine Lust, dafür arbeiten zu gehen, daß ich im Hotel wohnen darf.“ (Beides hatte ihr das Sozialamt vermittelt, aber im Hotel durfte sie ihren Freund nicht mit aufs Zimmer nehmen, und also ging sie mit ihm zusammen erneut „auf Platte“.)
Wieder anders der obdachlose Georg Heyer, dessen kleinbürgerlicher Eigensinn sogar noch derart intakt ist, daß es ihm gelingt, so sauber und nüchtern wie ein Büroangestellter herumzulaufen. Als Begründung für sein „Versagen“ gibt er die zu „starke Belastung“ in seinem früheren Beruf, Krankenpfleger, an. Kirchliche Aufenthaltsräume besucht er, um dort mal kurz „die Seele baumeln zu lassen“. Folglich ist er es auch, der nach einiger Zeit Anschluß an einen staatlich geförderten Obdachlosentreff findet, aus dem dann u.a. ein Zeitungsprojekt hervorgeht. In einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Haus beansprucht er sofort den schönsten Raum für sich.
Sein Gegenpol ist Erwin, der sich, in einem abgewrackten Auto hockend, schon fast aufgegeben hat, sich dann aber dank Georg und dessen pflegerischen Kenntnissen in ein Krankenhaus einweisen läßt, wo man ihm einen halben Fuß amputiert.
Statt Ansätze zu einer Gegenwelt (immerhin ist rund ein Viertel der gesamten Menschheit mehr oder weniger obdachlos) bleibt als Fazit des Films, und auch wohl der meisten mitteleuropäischen Obdachlosenprojekte, dieser Restwille zur kleinbürgerlichen Existenz das scheinbar einzige, wo Helferszene und Selbsthilfegruppen ihre Reintegrationshebel ansetzen (können). Das ist zuwenig! Aber so etwas darf man gar nicht sagen – mit eigener Wohnung, Waschmaschine, Laptop und liquider Lebensabschnittsbegleiterin. Ich gebe es deswegen hier quasi nur zu bedenken.
An einer Stelle läuft ein junger Dichter kurz von rechts nach links und deklamiert: „Verbrannt, an der Pforte zu den süßesten Nächten!“ Daran sieht man mal wieder: „Lyrik ist nichts weiter als ein nasser Lumpen im Spülbecken!“ (Charles Bukowski) Dennoch: Der Film „D.E.N.S.“ ist mit sehr viel mehr Empathie als diese kleine Nörgelei hier an ihm zustandegekommen, und das sieht man auch sofort.
„Der Bootgott vom Segelsportclub“
Der Regisseur Robert Bramkamp und die Künstlerin Susanne Weirich haben das Problem des Widerspruchs zwischen Lokalismus und Globalisierung noch einmal in Angriff genommen. Dieses Problem drängt sich auf, es zeigt sich vor allem an der derzeitigen Auflösung der Volkswirtschaften, dadurch, dass die Betriebswirtschaften sich transnational verflüchtigen, während Staat und Nation ans Territorium gefesselt sind und ihnen so nichts anderes übrig bleibt, als ebenfalls betriebswirtschaftlich zu agieren – einmal, indem sie ihr „Tafelsilber“ (die Infrastruktur) verscherbeln, und zum anderen, in dem sie bis runter zu den Regionen und Gemeinden eine absurd konkurrente „Standortpolitik“ betreiben. Das Vergesellschaftungs-Problem bleibt: Wie kann man sich immobilisieren (verankern) und gleichzeitig Welt erfahren (internationalisieren)?
Für Bramkamp/Weirich begann die Beantwortung dieser Frage zunächst mit Ausflügen über Land. Einmal stießen sie auf halber Strecke nach Frankfurt (Oder) auf einen See, an dem Dichter und Intellektuelle kurten. Heute haben sich dort – am Scharmützelsee bei Bad Saarow – die Neureichen aus Berlin mit Golf- und Tennisanlagen eingepflanzt. Aber am Seeende gibt es noch laut Bundeskulturstiftung den alten „sozialen Mikrokosmos ,Seesportclub Wendisch-Rietz'“, wo man auf zweimastigen, noch immer nicht vom Westen offiziell anerkannten DDR-„Kuttern“ seinen Segelschein machen kann. Dies taten die Berliner Freiberufler. Damit hatten sie sich dort schon mal freizeitmäßig verankert. Aber dann kamen sie auch noch mit einem Filmteam an und drehten mit dem sich bereits leicht zur Agonie neigenden Verein und seinen Aktivisten eine Dokufiktion, die sich nun im Internet fortsetzt, wobei der Film wie die Exposition für das Internet-Projekt wirkt.
Im Film fungiert als ABM-Kraft vor Ort und gleichzeitiger sumerischer Schöpfergott Enki, den man quasi in die Scharmützelsee-Topografie projiziert hat, der Schauspieler Schortie Scheumann. Die Lexika zählen Enki zu den halb-anthropomorphen „chtonischen Unterweltgöttern“, dessen Unterleib in ein Boot ausläuft. Er gilt als „Kulturbringer“, weiter heißt es über ihn: „All die verschiedenen Aspekte der von ihm eingesetzten Stadtgötter sind in Enki selbst vereint“, konkret und für den Scharmützelsee bedeutet dies: Er disponiert dort eine wachsende Zahl von „Me“s – und diese wiederum äußern sich, wenn in Funktion, in bestimmten „Fähigkeiten“, die kommuniziert werden, u. a. im Netz. Es handelt sich bei dem Ganzen um ein „Erzählprojekt“- und damit um Kunst. Im Gegensatz zu vielen Internetideen ist es jedoch primär-geerdet – und muss nicht erst über seine Warenform um reale Anerkennung bzw. Clicks ringen.
Zur Premiere des Films „Der Bootgott vom Segelsportclub“ in Duisburg gab es einen Shuttleservice des Vereins. Ins Internet verlängert sich das Projekt nun zum einen mit weiteren „Lokalismen“ (wie die ortsansässigen Fischer, ein Honda-Händler aus der Umgebung, der die Bootsmotoren des Vereins wartet sowie die Klosterbrauerei in Neuzelle mit ihrer Biersorte Enki).
Da es Bramkamp/Weirich um „möglichst unterschiedliche Erzählperspektiven“ geht, kommt dazu noch eine wachsende Zahl von „Internationalismen“ ins Spiel: Auf Mesopotamien spezialisierte Archäologen und verschiedene Künstlergruppen etwa. Das Projekt „Enki100.Net“ ist nach oben hin offen, nach unten fokussiert es die virtuellen Kräfte jedoch, das ihrige zum Erhalt und Ausbau des Soziotops Seesportclub e.V. beizutragen. Das reicht vom Sponsoring (Klosterbrauerei) über „den besten Büchertisch“ (b-books), die individuelle Vereinsmitgliedschaft und die Wasseranalyse eines limnologischen Instituts bis zum gemeinsamen Kampf gegen das Röhrichtschutzgesetz. All diese Netzteilnehmer figurieren als „Me“s im Internet und sind durchnummeriert, wobei ihre Identifikationszahlen sich auch noch mal als Pappschilder in den Sumpf- und Schilf-Rändern des Scharmützelsees wiederfinden, wodurch sie sich gleichsam um das Vereinsheim herum (optisch) verorten.
Einerseits wird der Seesportclub dadurch an die Welt angeschlossen, die er mit dem Ende der DDR scheinbar verloren hatte, und andererseits wird damit die Welt (oder das, was sich dafür ausgibt) am Scharmützelsee gleichsam geerdet. Dadurch soll das vermieden werden, was schon Herbert Achternbusch einst beklagte: „Da wo früher Weilheim und Passau war, ist jetzt Welt … Die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“
In Berlin stößt man auf Schritt und Tritt auf solche schwarzen Löcher – durch Welt liquidierte Orte, aber auch auf solche, die aufgrund eines fehlenden oder weggefallenen Weltanschlusses in Agonie versinken. Das „Weltniveau“ ist eine Frage des Kapitaleinsatzes (als scheues Reh bzw. gefräßige Heuschrecke), beim Erzählprojekt „Seesportclub“ kommt im Gegensatz zum Recreation Center Bad Saarow vor allem symbolisches Kapital zum Einsatz. Die Teilnehmer sind optimistisch.
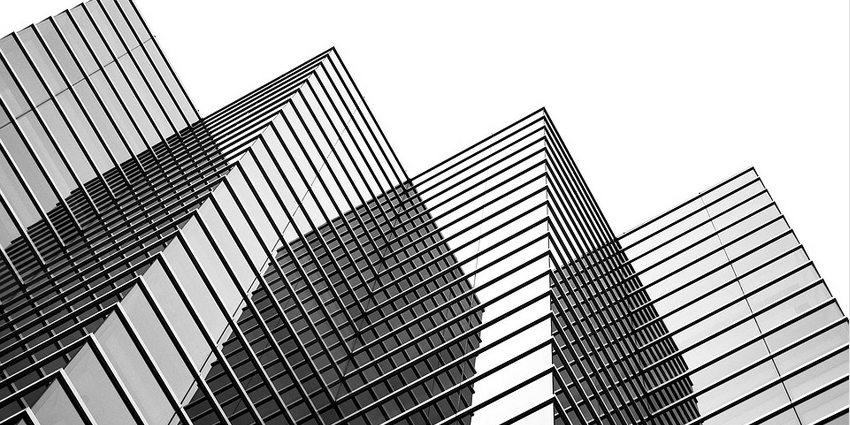



Keine Hyperlinks in Euren Kommentar-Plugin
hier im „Klartext“:
http://auguststrasse-berlin-mitte.de/x-filme-drehort-auguststrasse
und
http://auguststrasse-berlin-mitte.de/der-spandauervorstadt-poller-und-kein-ende