Wie bereits kurz erwähnt arbeitet der Bildhauer Andreas Wegner derzeit an einem bundeskulturstiftungsgestützten Kunstprojekt namens „Le Grand Magasin„. Es besteht erst einmal darin, ausgewählte Waren von Produktivgenossenschaften aus ganz Europa in der Galerie des Kunstamts Neukölln ab dem 19. September zum Verkauf ausgestellt werden. Von da aus weitet sich das EU-geförderte Projekt nach Usti nad Labem, Budapest und an den Plattensee aus, außerdem kommen eine Reihe von Künstlerinnen, die sich mit Genossenschaften beschäftigten, mit ins Spiel, sowie Diskussionen, Veranstaltungen etc.. In diesem Zusammenhang, quasi im Vorfeld, soll deswegen hier auch immer mal wieder von Genossenschaften die Rede sein.Die taz ist übrigens ähnlich wie die Junge Welt eine (Leser-) Konsumgenossenschaft, in der dann eine Produktivgenossenschaft (der Mitarbeiter, die vorher einen Verein mit diversen GmbHs bildeten) aufging. Dies war die “kleine Lösung” (zur Behebung der bis dahin immer wiederkehrenden “taz-Krisen”) – vor allem der Nicht-Redakteure, die damit die “große Lösung” der Redakteure ausstachen. Diese favorisierten ein Sanierungs-Konzept, das darin bestand, sich z.B. an den Spiegelverlag/Augstein, also an das Kapital, zu verkaufen. Etwa so wie der aus einem Wagenbach-Putsch einst entstandene Rotbuch-Verlag an Rowohlt. Ähnliches unternahm zuvor auch das taz-Vorbildprojekt “Liberation”, indem es sich mit dem “Big Business” verband. 2006 wollte der Kapitalgeber das weiterhin Verluste machende Blatt jedoch wieder loswerden und versuchte, es ausgerechnet an den deutschen Springerverlag zu verscherbeln, wo dann wahrscheinlich der ehemalige Frankfurter “Autonomie”-Herausgeber Thomas Schmid für die “Libé” verantwortlich gewesen wäre, der einst gegen den Springerstiefel-Verlag kämpfte und nun dort ausgerechnet für dessen “Intelligenzblätter” zuständig ist: “Mit Schmid”, sagt ein Springer-Mitarbeiter etwas gespreizt, “soll in der ganzen Gruppe eine gewisse Intellektualität einziehen”. Na gut.
Zurück zu Wegners Genossenschaftsprojekt. Bei einer Recherche in einer Produktivgenossenschaft hörte ich neulich von einem Mitarbeiter/Genossen, dass diese Form der kollektiven Arbeit und dem Besitz an Produktionsmitteln heute wichtiger denn je sei, da sich alles immer mehr flexibeln würde, ständig müsse man darauf gefaßt sein, seinen Arbeitsplatz oder gar seine ganze Firma zu verlieren – und noch viel mehr. Deswegen käme es nun gerade darauf an, „seinen Platz (zu) finden“. Ein anderer Genosse meinte jedoch zweiflerisch: Die Genossenschaften, die in Deutschland meist Alternativbetriebe oder Betriebe ohne Chef wären, ohne eine eingetragene Genossenschaft zu sein, hätten wie die ganze Alternativbewegung eine Art Halbwertzeit, d.h. irgendwann würde der kollektive Schwung einer egoistischen Einstellung zum Betrieb weichen.
1. Seinen Platz finden
Ich sehe, dass die natürlichen Dinge es schwer haben, ihren gerechten Platz in der Natur zu finden,“ schreibt Vilém Flusser. Es gibt aber z.B. Bäume, die schaffen das. Und es gibt Menschen, die dafür kämpfen, dass sie diesen Platz – und damit ihr Leben – nicht verlieren. So lebte z.B. die Tochter eines Wanderpredigers, Julia „Butterfly“ Hill zwei Jahre in 60 Meter Höhe in Kalifornien auf einem Redwood-Baum, um diesen und andere vor dem Gefällt-Werden zu schützen. Ähnlich versuchten auch gerade zwei Frauen in Kreuzberg, einige am Landwehrkanal stehende Linden zu retten. Daneben gibt es aber auch Bürgerinitiativen, die Menschen helfen, ihren Platz zu behalten oder erst mal zu finden, auch dabei geht es um „Gerechtigkeit“. Aber muß man unbedingt „seinen/einen Platz“ finden? Immer wieder – trotz aller Widrigkeiten – gelingt es jemandem in meiner Umgebung, einen Partner fürs Leben zu finden und einen Arbeitsplatz, der ihm gefällt. Da hat er dann seinen Platz gefunden – und wird darüber eventuell alt. Dies geht meist einher mit der Ausprägung von allerhand Gewohnheiten und Schrulligkeiten. Daneben wird so jemand dann auch erwachsen, d.h. erst einmal groß und quasi raumfüllend, aber dann auch gleich dickleibig und gemütlich, wenn nicht behäbig, was mit Gedankenfaulheit einhergehen kann, die ich mir damit erkläre, dass der- oder diejenige mit seiner/ihrer Umwelt mehr oder weniger im Einklang ist – und die öffentlichen Meinungen teilt, mithin seinen Frieden mit der Gesellschaft oder das was er/sie dafür hält, gemacht hat. Manche entwickeln dabei sogar regelrechte Platzhirschallüren.
So gesehen ist das „Seinen Platz finden“ nicht nur dann, wenn man es nicht schafft, ein Problem. Was übrigens die Eltern derjenigen, der oder die so etwas ansteuern, selten nachvollziehen können, denn sie wünschen sich meist, dass ihr Sohn oder ihre Tochter früher oder später „ihren eigenen Platz“ finden. So wie diese sich dann bemühen, umgekehrt für ihre Eltern einen Platz zu finden (im Altersheim z.B.). In diesem Modell geht es realistischerweise nur um das geschickte Auffinden von Plätzen – beginnend mit einem Kita-Platz, einem Platz an einer guten Schule, mit einem vernünftigen Studienfach an einer angesehenen Universität, in einer guten Firma, an schönen Urlaubsorten, in vertrauenserweckenden Krankenhäusern, in einem kostengünstigen Altersheim usw.. Selbst in Kneipen neigen sie dazu, sich „ihren Platz“ zu sichern. Auf dem Land habe ich wiederholt Leute getroffen, die schon mit 24 quasi alle ihre Plätze gefunden hatten – und auch dementsprechend alt aussahen. Demgegenüber standen all die, die noch auf der Suche waren – und die die ihnen zur Verfügung stehenden Plätze nur gleichsam ausprobierten. Auf Dauer machten sie diese jedoch alle nervös, unleidlich, so dass sie weiter zogen. Dabei lassen sich unterschiedliche (energetische?) Reichweiten unterscheiden.
Die „Situationisten“ schlossen einmal ein Mitglied aus ihrer Gruppe aus – mit der Begründung, ihm sei das „Mißgeschick“ passiert, alt geworden zu sein, bevor er 30 wurde“. Man kennt solche Leute, vielleicht sogar mehr als einem lieb ist: Sie sind mitunter sogar vorbildlich. Und sei es nur, weil sie „das Glück, das die Tapfersten von uns nie verläßt“ für sich gepachtet zu haben scheinen. Plötzlich lassen sie jedoch los oder greifen zu, oder wie soll ich sagen? Sie sind quasi am Ende, d.h. dort, wo sie sich vielleicht sagen: „Besser wird es nicht“ oder „Der Spatz in der Hand…“ Wieviele nennen ihren/ihre jeweilige Geliebte(n) sogleich Spatz? Diesen Worten haftet jedoch etwas Überholtes an, so wie „Mein Platz ist an Deiner/Seiner Seite“. Und doch gibt es anscheinend noch eine tiefe Sehnsucht nach solchen „Plätzchen“. Dass sie zunehmend unsicherer/prekärer werden, macht sie, die Sehnsucht, noch schwerer oder schwermütiger. Oskar Lafontaine spielt gerne auf dieser Geige, die man zu Recht als „völkisch“ abtun kann, wenn er z.B. verkündet, nur sichere Arbeitsplätze schaffen auf Dauer Identität, wie „umgekehrt flexible Arbeitsverhältnisse zur Zerstörung des Charakters und zum Verlust der Selbstachtung führen“. Laut einer Umfrage lehnen insbesondere die Bewohner der DDR (70%) einen „Wohnortwechsel selbst bei drohender Arbeitslosigkeit“ strikt ab. Andererseits gibt es wohl nirgendwo sonst einen derartig weit gefächerten Druck auf die dort seit langem Lebenden, dass sie endlich ihre ganzen Plätze räumen. Da wünscht man sich, wieder platziert zu werden.
2. Sone und solche Höllen
Langsam überwinden die Deutschen ihre Scheu, sich selbständig zu machen – verkünden die abhängig beschäftigten „Experten“ in den entsprechenden Dienststellen, allen voran den Arbeitsämtern (vulgo: Bundesagentur für Arbeit). Einige Jahre lang sah es so aus, dass fast nur die türkischen und russischen Einwanderer mit Existenzgründungen liebäugeln würden – und sei es auch nur, weil erstere zu den ersten gehörten, die ihre Festarbeitsplätze nach der beschissenen Wiedervereinigung verloren und letztere ähnlich wie die Araber hier gar nicht erst einen Festarbeitsplatz fanden. Die Berliner Volksbank reagierte darauf derart feinfühlig, dass sie um 2000 ihre deutschen Existenzgründerberater feuerten und stattdessen Russen und Türken einstellte, damit die ihre Landleute qualifiziert berieten. Nun aber – mit gehöriger Verspätung – sollen angeblich auch die Kerndeutschen sich einen Ruck gegeben haben. Spätestens jetzt sollten wir uns jedoch fragen: Ist es überhaupt wünschenswert – dass sich alle als Kleinkrämer versuchen? Da hocken sie dann den ganzen Tag solipsistisch in ihren trostlosen Friseursalons, engen Kiosken, Spätkaufläden und Dönerbuden, heißen Bio-Imbissen und zugigen Webdesigner-Lofts, denken sich immer neue Sonderangebote aus, erweitern ihre Servicepalette, verlängern die Öffnungszeiten, schimpfen über ihre faulen, vom Arbeitsamt bezahlten Mitarbeiter, über die schmutzige Konkurrenz, über nichtsnutzige Ausländer und dreiste Kriminelle, wählen immer weiter rechts und werden überhaupt immer reaktionärer und dümmer… Wollen wir wirklich ein einig Volk von selbständigen Asozialen werden?
Der US-Schriftsteller Kurt Vonnegut warnte bereits 1953 (!) in seinem Buch „Player Piano“ vor dieser Auswirkung der Computerisierung, d.h. vor den Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen des kybernetischen Denkens bei seiner umfassender Anwendung, die erst in den Achtzigerjahren langsam griff. In seinem Aufruhr-Horrorszenario, in dem er die Militärforschung des „Fathers of Cyborg“ Norbert Wiener und des Mathematikers John von Neumann weiter dachte, geht es bereits um die Folgen der „Maschinisierung von Hand- und Kopfarbeit“, d.h. um die vom Produktionsprozeß freigesetzten Menschenmassen, die überflüssig geworden sind und nur noch die Wahl haben zwischen 1-Dollarjobs in Kommunen und Militärdienst im Ausland, wobei sich beides nicht groß unterscheidet. Theoretisch könnten sie sich auch selbständig machen – „Ich-AGs“ gründen, wie das 1997 in Wisconsin entwickelte „Trial Job“-Modell nach Übernahme durch die rotgrüne Regierung hierzulande genannt wurde: „Reparaturwerkstätten, klar! Ich wollte eine aufmachen, als ich arbeitslos geworden bin. Joe, Sam und Alf auch. Wir haben alle geschickte Hände, also laßt uns alle eine Reparaturwerkstatt aufmachen. Für jedes defekte Gerät in Ilium ein eigener Mechaniker. Gleichzeitig sahnen unsere Frauen als Schneiderinnen ab – für jede Einwohnerin eine eigene Schneiderin…“
Da das nicht geht, bleibt es dabei: Die Massen werden scheinbeschäftigt und sozial immer schlechter endversorgt, während die staatlichen und privaten Sicherheitsmaßnahmen zunehmen sowie Rauchen und ähnliche Eigenmächtigkeiten verboten werden. Gleichzeitig ist eine kleine Elite mit hohem I.Q., vor allem „Ingenieure und Manager“ (Problemlöser/Kreative), emsig dabei, die Gesellschaft bzw. das, was davon noch übrig geblieben ist – „Das höllische System“ (so der deutsche Titel des Romans) – weiter zu perfektionieren. Und das heißt: erbarmungslosester Amerikiki-Darwinismus als Leitwissenschaft und -währung, hochkomplexe Wissensgesellschaft – jeder kann auf einer Computertastatur rumhacken und jeden Scheißdreck googeln, Tabletten für alle psychischen Probleme, dümmstes Tittitainment, Fit for Fun, Coffee to Go, Anglizismen to Run, Gangsta-Rap to puke and Fucking bzw. Communicating the brain away. Was früher „High sein, Frei sein, Terror muß dabei sein“ hieß, also Lust am Widerstand und am Verweigern war (und epidemisch wurde), nebst „solidarischem Handeln“ und „politischem Engagement“ – das hört sich nun – aus der Rückschau z.B. eines exmaoistischen und immerhin noch schwulen taz-Redakteurs so an, in einem Text über eine junge Buchautorin:
„Sie kann nicht berichten, wie diese seltsamen 70er waren – ein Jahrzehnt im Aufbruch und eines des Abschieds von deutscher Hörigkeit gegenüber allen Obrigkeiten. Sie war nicht dabei in dieser Solidaritätshölle…“ Ähnlich sieht das auch unser SPD-Gesundheitsminister: Neulich fragte ihn der stern-Redakteur in einem Interview nach dem armen kleinen Eisbär im Westberliner Zoo, woraufhin dieser reaktionäre Schwachkopf Sigmar Gabriel ihm antwortete: „Knut hat Substanz und Kraft! Das unterscheidet ihn von Oskar Lafontaine. Der erzählt Märchen, sagt den Menschen, die Globalisierung sei rückholbar. Er sagt: Raus aus Afghanistan. Er will, dass wir uns aus der internationalen Verantwortung stehlen. Das ist feige.“
3. Die Genossenschaft als „Chimäre“
Europäischen Dachverband der Produktivgenossenschaften (CECOP) in Brüssel fühlt man sich auch für die Belange von „Sozialgenossenschaften“ und „selbstverwalteten Betrieben“ zuständig. Sozialgenossenschaften gibt es vor allem in Italien, Schweden, Finnland und Spanien, selbstverwaltete Betriebe besonders im deutschsprachigen Raum (als Verein, AG oder GmbH). An Produktivgenossenschaften gibt es in Italien über 60.000, in Deutschland kaum noch welche, dafür wirtschaften hier seit 1968 so viele selbstverwaltete Betriebe, das sie sich inzwischen zusammengeschlossen haben – mit einer eigenen Zeitschrift „Contraste“ und im „Netz e.V.“, das in den Dachverband CECOP eingebunden ist.
Seit 2006 – mit der erneut überfälligen Novellierung des Genossenschaftsgesetzes von 1889 – hat allerdings die Zahl der Genossenschaftsgründungen insgesamt in Deutschland wieder zugenommen: Statistisch gesehen ist inzwischen sogar jeder vierte Deutsche Mitglied irgendeiner Genossenschaft, von denen es inzwischen mehr als 8.000 gibt. Davor waren von 31.000 (1938) eingetragenen Genossenschaften nur noch 8.600 übrig geblieben. „Die Genossenschaft ist eine Organisationsform zwischen Kapitalgesellschaft und gemeinwirtschaftlichem Unternehmen, in der die Begünstigten zugleich Kapitalgeber, Entscheidungsträger und Kontrolleure der Organisation sind, schreibt der Vorsitzende eines Genossenschaftsprüfungsverbandes Michael Bock, sie „ist daher durch eine Doppelnatur charakterisiert: Die Mitglieder sind gleichzeitig Anteilseigner, Entscheidungsträger und Leistungsabnehmer bzw. Nutznießer gemeinsamer Tätigkeiten. In diesem Zusammenhang greift der Begriff ‚Selbsthilfe‘. Selbsthilfe ist das wichtigste Merkmal jeder genossenschaftlichen Tätigkeit. Er ist nicht gleichbedeutend mit Solidarität und Gegenseitigkeit, sondern ist vordergründig auf eigene Interessen gerichtet.“
Dies sah auch der Anarchist Peter Kropotkin so, gleichwohl betrachtete er in seinem antidarwinistischen Werk „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ die Genossenschaft als einen großen (zivilisatorischen) Fortschritt – im Hinblick auf das Ziel: eine von unten organisierte Gesellschaft freier Individuen. Die Frühsozialisten, wie Fourier und Owen, sahen das ähnlich. Und noch in der katholischen Sozialbewegung wird die Produktivgenossenschaft als geradezu „ideale Unternehmensform“ gepriesen. Der Friedensforscher Johan Galtung meinte: „Die ‚Gegenseitige Hilfe‘ ist, wie ich das sehe, das Normale. Das ist so normal, dass man es manchmal nicht sieht. Kropotkin hat das Offenbare und Normale gesagt, und Darwin hat einige Einzelfälle herausgeholt und daraus das ‚Typische‘ gemacht.“ Dies läßt sich insbesondere auf die berühmte 1968 in „Science“ veröffentlichte Studie von Garet Hardin „The Tragedy of Allmende“ münzen. Nach Hardin geht jede Genossenschaft bzw. auf Gemeinschaftseigentum basierende Wirtschaftsweise früher oder später am „Egoismus“ ihrer Teilnehmer zugrunde. Im Neodarwinismus gipfelte diese Ansicht dann 1976 in dem Pamphlet „Das egoistische Gen“ des englischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins, das tausende von Gentechniker und Gehirnforscher „inspirierte“. Auf Hardin bezogen sich in der Folgezeit mindestens ebensoviele Kritiker des Genossenschafts- und Gemeinschaftseigentums – wenn sie sich stattdessen für Privatisierung oder Verstaatlichung aussprachen. Neuerdings hat dagegen Elinor Ostrom anhand empirischer Beispiele noch einmal die Stabilität von Allmenden und Genossenschaften über hunderte von Jahre herausgearbeitet – sie spricht in diesem Zusammenhang von einem „dritten Weg“. Einen solchen erwähnte auch Johan Galtung: „Ich möchte betonen, da Kropotkin immer im Gegensatz zu Darwin dargestellt wird, dass es einen japanischen Ansatz gibt, den von Kinji Imanishi. Das ist eine völlig andere Evolutionstheorie. Er beschreibt ebenfalls die Zusammenarbeit, aber auch, dass die Natur sich immer verändert und die Natur sehr viel dynamischer ist, auch in einer kurzzeitigen Perspektive des Dynamischen, und da eröffnen sich neue Nischen. Diese Nischen sind leer. Es gibt keine Tiere, keine Pflanzen, es ist sozusagen wie im Himmelreich. Und dann kommt ein Ei dazu oder ein Samen und fühlt sich ganz wohl und hat dort die Möglichkeit, sich zu entfalten. Das ist weder Kooperation noch Streit, sondern ganz einfach eine Potentialität. Man könnte sagen, dass eine Art, wie Darwin sie dargestellt hat, ein wenig ist wie die britischen Kolonialisten, und das war ja auch sein Modell: Er findet etwas Unterlegenes, und das wird dann ausgerottet. Bei Kropotkin dagegen sind diese Arten liebenswürdig und auf Kooperation eingestellt. Für Imanishi sind sie Entdecker, sie sind auf Entdeckungsreise und finden etwas, wo sie Möglichkeiten haben. Ich sage das nur, weil ich denke, in einer westlichen Ökonomie sind wir verloren.“
Seit der Notwendigkeit der Umwandlung der ostdeutschen Kollektivlandwirtschaften nach westdeutschem Recht haben sich dort viele LPG für die Form einer Agrarunternehmens als Produktivgenossenschaft entschieden. Ihren linksradikalsten Vorläufer fanden sie in den israelischen Kibbuzim, aus denen jahrzehntelang die staatliche Elite hervorging. Zuletzt pries sie Michail Gorbatschow als Vorbild bei der Umstrukturierung der sowjetischen Kolchosen während der Perestroika. Inzwischen haben jedoch die meisten sozialistischen Kibbuzim in Israel vor der kapitalistischen Marktwirtschaft sozusagen kapituliert – und agieren nunmehr als „normale“ Wirtschaftsbetriebe, wobei die Landwirtschaft oftmals nur noch einen kleinen Teilbereich ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausmacht. Und statt an der Aufhebung der Trennung von Kopf- und Handarbeit weiter zu arbeiten, haben viele Kibbuzim oben – an der Verwaltungsspitze – und unten – am Fließband bzw. auf dem Feld – Lohnarbeiter von außerhalb eingestellt. Diesen Weg (allen Fleisches) sah bereits Karl Kautsky voraus, als er über die katholischen Kongregationen urteilte: „Es geht aber mit diesen geistlichen Produktivgenossenschaften wie mit den weltlichen. Sobald sie gedeihen, hören ihre Mitglieder auf, selbst zu arbeiten, und lassen andere für sich schanzen, die ausgebeutet werden. Unter feudalen Verhältnissen geschieht das in feudalen Formen, unter kapitalistischen in kapitalistischen.“
Im „Gothaer Programm“ von Ferdinand Lasalle hieß es einst: „Die deutsche Arbeiterpartei verlangt, um die Lösung der sozialen Frage anzubahnen, die Errichtung von Produktivgenossenschaften mit Staatshilfe unter der demokratischen Kontrolle des arbeitenden Volks. Die Produktivgenossenschaften sind für Industrie und Ackerbau in solchem Umfang ins Leben zu rufen, daß aus ihnen die sozialistische Organisation der Gesamtarbeit entsteht.“
Karl Marx merkte dazu an: „An die Stelle des existierenden Klassenkampfes tritt eine Zeitungsschreiberphrase – ‚die soziale Frage‘, deren ‚Lösung‘ man ‚anbahnt‘. Statt aus dem revolutionären Umwandlungsprozesse der Gesellschaft ‚entsteht‘ die ’sozialistische Organisation der Gesamtarbeit‘ aus der ‚Staatshilfe‘, die der Staat Produktivgenossenschaften gibt, die er, nicht der Arbeiter, ‚ins Leben ruft‘. Es ist dies würdig der Einbildung Lassalles, daß man mit Staatsanleihn ebensogut eine neue Gesellschaft bauen kann wie eine neue Eisenbahn!“
Im Sozialismus stellte sich das Problem natürlich anders dar. Dazu heißt es in der „Geschichte der KPDSU(B)“: „Lenin betonte, dass unter der Diktatur des Proletariats, auf Grundlage des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, bei Sicherung der Führerrolle des Proletariats in Bezug auf die Bauernschaft, bei Vorhandensein einer sozialistischen Industrie eine richtig organisierte, Millionen von Bauern erfassende Produktivgenossenschaft das Mittel ist, mit dessen Hilfe in unserem Lande die vollendete sozialistische Gesellschaft errichtet werden kann.“
Für Stalin waren dann die von der Partei durchgesetzten und die Dorfgemeinschaften ablösenden Kollektivlandwirtschaften (Kolchosen) die logische Fortsetzung der bäuerlichen Einkaufs- und Konsumgenossenschaften – nunmehr als „Produktivgenossenschaften“.
Im Westen blieb das alte Problem jedoch bestehen: Eins, zwei, drei, viele Genossenschaften zu gründen oder den Kampf gegen die Eigentümer der gegenständlichen Arbeitsbedingungen zu organisieren, d.h. aufzunehmen bzw. zu forcieren…
Im Programm der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ hieß es: „Die Befreiung der Arbeit erfordert die Verwandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesellschaft und die genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit“. Rosa Luxemburg schrieb: „Was die Genossenschaften, und zwar vor allem die Produktivgenossenschaften betrifft, so stellen sie ihrem inneren Wesen nach inmitten der kapitalistischen Wirtschaft ein Zwitterding dar: eine im kleinen sozialisierte Produktion bei kapitalistischem Austausche. In der kapitalistischen Wirtschaft beherrscht aber der Austausch die Produktion und macht, angesichts der Konkurrenz, rücksichtslose Ausbeutung, d.h. völlige Beherrschung des Produktionsprozesses durch die Interessen des Kapitals, zur Existenzbedingung der Unternehmung.
Praktisch äußert sich das in der Notwendigkeit, die Arbeit möglichst intensiv zu machen, sie zu verkürzen oder zu verlängern, je nach der Marktlage, die Arbeitskraft je nach den Anforderungen des Absatzmarktes heranzuziehen oder sie abzustoßen und aufs Pflaster zu setzen, mit einem Worte, all die bekannten Methoden zu praktizieren, die eine kapitalistische Unternehmung konkurrenzfähig machen. In der Produktivgenossenschaft ergibt sich daraus die widerspruchsvolle Notwendigkeit für die Arbeiter, sich selbst mit dem ganzen erforderlichen Absolutismus zu regieren, sich selbst gegenüber die Rolle des kapitalistischen Unternehmers zu spielen. An diesem Widerspruche geht die Produktivgenossenschaft auch zugrunde, indem sie entweder zur kapitalistischen Unternehmung sich rückentwickelt, oder, falls die Interessen der Arbeiter stärker sind, sich auflöst. Das sind die Tatsachen, die Bernstein selbst konstatiert, aber mißversteht, indem er die Ursache des Unterganges der Produktivgenossenschaften in England in der mangelnden ‚Disziplin‘ sieht. Was hier oberflächlich und seicht als Disziplin bezeichnet wird, ist nichts anderes als das natürliche absolute Regime des Kapitals, das die Arbeiter allerdings sich selbst gegenüber unmöglich ausüben können.“
In der „Geschichte des Bundes der Kommunisten“ hatte Friedrich Engels bereits ähnlich argumentiert: „In den amtlichen Veröffentlichungen des Vereins [dem Vorläufer des Bundes] laufen daher auch die im ‚Kommunistischen Manifest‘ vertretenen Ansichten kunterbunt durcheinander mit Zunfterinnerungen und Zunftwünschen, Abfällen von Louis Blanc und Proudhon, Schutzzöllnerei usw., kurz, man wollte allen alles sein. Speziell wurden Streiks, Gewerksgenossenschaften, Produktivgenossenschaften ins Werk gesetzt und vergessen, daß es sich vor allem darum handelte, durch politische Siege sich erst das Gebiet zu erobern, worauf allein solche Dinge auf die Dauer durchführbar waren.“
Das ewige Entweder-Oder – Lasalle versus Marx, Darwin versus Kropotkin – verliert jedoch an Schärfe, wenn es praktisch darum geht, mit Lohnarbeit in restaurativen Zeiten überleben zu müssen – während der Widerstand gegen die kapitalistischen Zumutungen immer mehr nachläßt und zerfällt: Dann ist es jedenfalls angenehmer, in einer Genossenschaft zu arbeiten als in einem kapitalistischen Betrieb. Und das gilt selbst dann noch, wenn „durch politische Siege“ ein „Gebiet“ nach dem anderen erobert wird. Ob allerdings schon durch immer mehr Gründungen von „selbstverwalteten Betrieben“ bzw. Kooperativen und ihre stetige „Vernetzung“ eine nachhaltige Veränderung der Produktionsverhältnisse erreicht werden kann, dürfte nach den obigen Ausführungen mehr als fraglich sein. Eine Ausweitung der Problemlage auf das Ökologische der produzierten Waren ändert daran überhaupt nichts – dies ist bloß eine Verschiebung, die den sozialen und politischen Aspekt der Produktionsprobleme zugunsten der natürlichen eliminiert.
4. Ganz Deutschland – eine Kita
Die Arbeirtsämter aber auch sogar feministische Selbständigen-Beratungen predigen meist die „Ich-AG“ – so gut wie nie eine „Wir-eG“. Da beim individuellen sich selbständig machen das Risiko in jeder Hinsicht viel größer ist, zögern die meisten – und ziehen es nach ein paar Beratungen und Erkundungen vor, wieder einen festen Arbeitsplatz anzustreben – und sich dazu gewerkschaftlich zu organisieren. So ist es richtig – aber:
Neulich wurde auf einer Protestdemonstration schon wieder ein schwarzer Sarg mitgetragen. Diese unsinnigen Särge gehören schon fast zur deutschen Protest-Standardkultur, verbunden mit Transparenten, auf denen irgendwas mit „Zu Grabe tragen…“ steht, und – wie kürzlich wieder beim BVG-Streik – roten Plastikwesten von der Gewerkschaft sowie kleinen Trillerpfeifen für jeden. Die einzige, die damit (und das schon seit Jahrzehnten) eine einigermaßen gute, „authentische“ Figur macht, ist die PDSlerin Angelika Skrypczak aus Marzahn, die deswegen auch von allen Zeitungen immer wieder gerne als „Streikposten“ oder „Protestierende“ bzw. „Demo-Teilnehmerin“ photographiert wird. Meistens herzlich lachend.
Das Gegenstück, aber nicht minder beliebt bei den Medien, ist jene unbekannte Arbeiterin, die es in jedem Betrieb gibt, und die sozusagen auf Befehl weinen kann – sobald die Presse kommt oder ein Politiker (mit Presse) auftaucht, der „sofortige Hilfe“ zusagt. Neben der Arbeiterin, die weint, weil ihrer Abteilung gekündigt wurde oder weil das ganze Werk nach Moldawien verlegt werden soll, baut sich dann regelmäßig noch ein leicht väterlich wirkender Betriebsrat auf. Er sagt jedesmal: „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Auch der zuständige Gewerkschaftssekretär ist meist nicht weit. Er gibt aus dem Stand eine Einschätzung der gesamten Branche ab, der es gar nicht mal so schlecht geht. In diesem speziellen Fall hätte man jedoch schon früher „gegensteuern“ können bzw. müssen. Worauf unweigerlich das Wort „Managementfehler“ fällt – oder, noch schlimmer: „Mißmanagement“.
Wenn es sich um einen Streik handelt, stehen etwas abseits auch noch einige Streikposten herum, die farbig abgesetzte Armbinden tragen. Sie halten in einer Tonne ein Feuer in Gang – das sogenannte „Mahnfeuer“ – und werden deswegen auch gerne „Mahnwache“ genannt. Sie haben sich am Haupteingang des Betriebes aufzuhalten: vor dem Schlagbaum. Wenn es regnet, stellen sie sich unter das Dach des Pförtnerhäuschens. Der Pförtner läßt sich nicht anmerken, wie er das Ganze findet. Er tut so, als wäre der Arbeitskampf kein Ausnahmezustand, sondern die normalste Sache der Welt und er schon mit ganze anderen Problemen fertig geworden. Bei den Streik- oder Protest-Aktionen deutscher Arbeiter unter der Führung ihrer Gewerkschaft hat man stets den Eindruck, dass da eine ungeheure Infantilisierung des Proletariats geschieht. So wie ja auch die „lebendige Demokratie“ sich hierzulande meist darin erschöpft, dass man „wählen“ geht – d.h. als debil Analphabetisierter sein Kreuzchen in einer Wahlkabine macht. Ein Vorgang, der fatal dem kurzen Wichsen in einer Peepshow-Kabine ähnelt. Es riecht auch in beiden Kabinen gleich.
Dazu paßt, dass z.B. die Beschäftigten bei Opel in Eisenach so wenig Interesse an „ihren“ vier Mal im Jahr jeweils an einem Samstag stattfindenden Betriebsversammlungen haben, dass die Konzernleitung (!) ihre Teilnahme mit 100 Euro „belohnt“. Als die Arbeitgeber den Tarifvertrag kündigten und es daraufhin zu Warnstreiks kam, stand die Eisenacher Gewerkschaftschefin unter dem Druck ihrer Organisation, dass das Opel-Werk sich den Protesten anschloß. Statt zu einem Warnstreik reichte es jedoch erst mal nur zu einer schwachsinnigen Unmutsäußerung: die Arbeiter zogen ihre grauweißen Einheitsuniformen aus und streiften sich „etwas Buntes“ über. Auch das entsetzte schon die Geschäftsführung, die zusammen mit dem Maschinentakt die Arbeiter zu strengster Disziplin und Sorgfalt erzieht. Als dann jedoch die Beschäftigten trotz Androhung rechtlicher Schritte sogar für eine Stunde rausgingen, gesellte sich die Werksleitung wieder locker zu ihnen. Später holte die Gewerkschaft die Arbeiter mit Bussen zu einer Nachmittags-Demonstration in Erfurt aus dem Werk: „Dort haben sie dann eine richtige Show abgezogen: Opel marschiert ein – die Opelaner! Inzwischen wissen sie, daß sie die ersten sind, die auf die Straße gehen müssen bei Tarifkonflikten“, erzählt ihre Gewerkschaftsführerin – im Ton einer Mutter, die ihren Kindern endlich anständiges Benehmen beigebracht hat.
Ein Intelligenzblatt schrieb neulich: „Noch nie wurde in Deutschland so viel gestreikt wie in diesem Jahr, aber auch noch nie wurde so wenig erreicht.“ Die Gewerkschaften müßten sich was Neues überlegen – oder so ähnlich.
5. Sonnentage im Homodrom
Als Spinozisten können wir Affizierungen kaum überschätzen, so daß wir uns beispielsweise durchaus vorstellen können, ein Arbeitspferd stehe einem Ochsen näher als einem Rennpferd. Historisch gesehen war das Arbeitspferd mit der Erfindung des Motors und dann des Autos zum Aussterben verurteilt, es überlebte jedoch – als Freizeitpferd: im Hippodrom. Paul Virilio schlägt nun – im Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft bzw. von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft – ein Homodrom – für Arbeitslose – vor. Man spricht hierbei auch von „Überflüssigen“ oder „dauerhaft Abgehängten“.
Aber wie hat man sich das vorzustellen – ein Homodrom? Aus dem Fernsehen kennt man einige Stadien, in die man Menschen zusammentrieb, um sie zu vernichten: das Vélodrom in Paris nach dem Enzug der Deutschen in die Stadt, das Stadion von Santiago de Chile nach der Machtergreifung von Pinochet usw. Aber auch einige Stadien, in man die Menschen lockte, um sie zu unterhalten – mit Fußball und Rockkonzerten beispielsweise. Um aber noch mal auf das Hippodrom zurück zu kommen: Diese eher urbane Einrichtung hat sich längst dekonzentriert, d.h. die „Sodomiterei als Rasensport“, wie Karl Kraus das Freizeitreiten nannte, hat sich längst wieder über das ganze Land ausgebreitet und es entstehen immer mehr Reitwege. Analog dazu muß man sich auch ein Homodrom nicht mehr als ein Stadion oder ähnliches Rundgebautes vorstellen. Es geht also auch nicht mehr nur im Kreis, eher schon im „Ziczac à double ziczac“, wie es Laurence Sterne als Romandhandlung vorschwebte, oder noch eher wie ein Ausschwärmen. Der Arbeitslose als jemand, der nicht mehr zurückkommt: Das Homodrom ist ein virtuelles Karussel, das immer mehr beschleunigt und dabei seine Fahrgäste weit hinausschleudert. Hui!
6. Gemeinsam sind wir Staat
„Der Staat – das kälteste aller kalten Ungeheuer,“ fluchte Nietzsche. Die „Floppy“-Zeitschrift „Myriapoda“ (Tausendfüßler“) bereitete kürzlich in der Torstraßen-Eckkneipe „Baiz“ ihre vierte Ausgabe vor – mit dem Schwerpunkt „staatenbildende Insekten“: Ameisen, Bienen und Termiten. Nicht zuletzt unter dem Aspekt der „Arbeitsteilung“, die sich bei den Bienen bis zu ihren Züchtern erstreckt, bei denen es eine scharfe Trennung zwischen Hand- (Imker) und Kopfarbeiter (Bienerforscher) gibt. Unbeachtet blieb bisher das Individuum – und dort u.a.. das Verdauungssystem, das z.B. bei den Termiten besonders interessant ist. Sie leben von extrem schwer verdaulicher Nahrung: von Holz. Wenn gesagt worden ist, dass wir (Menschen) nicht ohne unsere Darmbakterien, vor allem E.coli, leben können, sie jedoch sehr wohl ohne uns, und dass die im Pansenmagen der Kuh lebenden Bakterienkulturen diese im Grunde die Kuh sind – dann gilt dies noch viel mehr für die Termiten. Eine wahre Herkulesarbeit leisten sie in deren Darm, in dem sie das Holz bis dahin aufspalten, das die Termiten es verdauen können, wobei die Mikroorganismen komplizierte Umwandlungsprozesse arbeitsteilig angehen. Die Termiten müssen ihre Nachkommen rechtzeitig mit ihrem bakterienreichen Kot füttern – sonst sind sie später nicht lebensfähig.
Vermißt wurde auch ein Exkurs über Hummeln, speziell Erdhummeln, die Deleuze und Guattari zu einem ganzen Beziehungsmodell inspirierten: „Werdet wie der Klee und die Hummel!“ Als Land der Hummeln gilt Island, wo sie fast die ganze Insel für sich haben – und kaum Feinde. Es gibt hier drei Arten, eine – Bombus jonellus – bereits seit den Anfängen der Besiedlung der Insel (durch die Wikinger im 9. Jhd.). Die anderen beiden Arten – Bombus lucorum und Bombus hortornum – gelangten erst später mit Frachtschiffen nach Island. Es genügt eine einzige Hummel, um eine Population zu begründen. Bei der ersten Generation ist die Königin noch ihre eigene Arbeiterin. Einige US-Biologen haben behauptet, gemäß ihres Gewichts und ihrer Flügelgröße dürfte die Hummel eigentlich nicht so gut fliegen können wie sie es tut. Ähnlich haben einige US-Ökonomen behauptet, die nordischen Staaten dürften mit ihrer sausozialen Wirtschaftspolitik eigentlich gar nicht so erfolgreich sein wie sie es sind. Das hat diese Staaten nun bewogen, die Hummel als ihr gemeinsames Wappentier zu wählen. „In Island gibt es Jahre, da man nach besonders harten Wintern keine Hummeln mehr sieht, aber dann sind sie doch wieder da,“ so der Hobbyhummelforscher Kristjan Bjarki Jonasson. „Die Insel war früher stark bewaldet, aber dem Schiffs- und Hausbau sowie auch den Heiz- und Räucheröfen fielen nach und nach fast alle Bäume zum Opfer, hinzu kam noch die Überweidung – durch zu viele Schafe. Dieser Verwüstungsprozeß ist aber seit Jahrzehnten rückläufig: Erst einmal werden jährlich 8 Millionen neue Bäume auf der Insel gepflanzt und zum anderen gibt es auch immer weniger Schafe – wird die Landwirtschaft überhaupt immer weniger wichtig für die isländische Wirtschaft.“ Dies komme auch den Hummeln zugute – und damit den Überlebenschancen ihrer Königinnen.
Und das trägt wiederum entscheidend zur Vermehrung der isländischen Pflanzenwelt bei: „Hummeln sind ausgezeichnete Bestäuber, die durch ihre lange Zunge und das so genannte Vibrationssammeln besonders gut tiefe Blüten bestäuben können. Sie werden daher inzwischen rund um das Jahr für die Bestäubung im Gewächshaus gezüchtet.“ Allerdings haben sie auch zahlreiche Gegenspieler. So gibt es Kuckuckshummeln die die Nester ihrer Verwandten übernehmen und ihren Nachwuchs von den Arbeiterinnen aufziehen lassen. Der schlimmste Gegenspieler ist jedoch die moderne Landwirtschaft: „Das Abmähen blühender Flächen, Insektizide und Monokulturen haben zu einem dramatischen Artensterben geführt, so dass sich viele Hummelarten inzwischen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten finden,“ schrieb der Bund für Naturschutz (NABU), als er die Steinhummel zum „Insekt des Jahres“ kürte.
7. Die Gegenseitige Hilfe
Es gibt Kaufs- und Verkaufs-Genossenschaften. In ersteren sinken mit jedem neuen Mitglied die Preise und in letzteren die Löhne, grob gesagt. Nach dem Genossenschaftstheoretiker Franz Oppenheimer gilt bei den Genossenschaften ein „Transformationsgesetz“. Zwischen den theoretisierenden Genossenschaftsgegnern und den -anhängern wird darüber gestritten, wobei es im wesentlichen um die Auslegung eines Oppenheimer-Zitats geht, es lautet: „Nur äußerst selten gelangt eine (gesperrte) Produktionsgenossenschaft zur Blüte. Wo sie aber zur Blüte gelangt, hört sie auf, eine (offene) Produktivgenossenschaft zu sein.“
Die Produktivgenossenschaften (sowie auch die „Magazingenossenschaften“) wandeln sich quasi automatisch zu „Ausbeutergenossenschaften mit aristokratischer Verfassung, die sich gegen Beitrittslustige sperren“. In der Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen merkt Werner Kruck dazu an: Wo man sich aber von der „Forderung nach Offenheit“ löst, hat man eine „Produzenten-Assoziation, die sich am Markt behaupten muß und auch kann“. In Israel wurden so gut wie die meisten Agrarassoziationen aus denen einst die Elite des Landes gekommen war und die besten landwirtschaftlichen Errungenschaften, aufgelöst. Sie hatten zuvor schon immer mehr „Kibbuzfremde“ beschäftigt und in immer profitablere Geschäftsbereiche investiert. In China hat man sogar sämtliche Dorfgenossenschaften quasi von oben aufgelöst – bis auf eine.
Die Folge war ähnlich wie bei der Umwandlung der osteuropäischen LPG und Kolchosen: Rund 9/10tel der „Kommune“-Mitglieder mußte emigrieren. Den Verbliebenen wurde eine andere Einstellung zur Produktion abverlangt. Anderswo wird die Prosperität der Genossenschaften durch eine Veränderung des Produkts erreicht. So scheint z.B. die Alternative taz auf dem besten marktwirtschaftlichen Weg zu einer reinen Arbeitsplatzerhaltungsgenossenschaft zu sein. Wie überhaupt die genossenschaftlichen Alternativbetriebe eine Halbwertzeit haben. Irgendwann sind sie ununterscheidbar von den restlichen Marktteilnehmern. Selbst unter den Bedingungen des großen sozialistischen Schwungs und des russischen Bürgerkriegs machte der Pädagoge und Gründer von Landkommunen für „gefährdete Jugendliche“ Anton S. Makarenko diesbezüglich eine ernüchternde Erfahrung:
„Anfangs [ab 1920] waren wir geneigt, nur die Landwirtschaft als wirtschaftliche Betätigung zu betrachten, und unterwarfen uns blind der alten These, die da behauptet, daß die Natur veredle. Diese These war in den Adelsnestern entwickelt worden, in denen die Natur in erster Linie als ein sehr schöner und gepflegter Ort für Spaziergänge und Turgenjewsche Erlebnisse aufgefaßt wurde…Die Natur aber, die den Gorki-Kolonisten veredeln sollte, schaute ihn mit den Augen der ungepflügten Erde an, des Unkrauts, das ausgerodet werden mußte, des Mistes, der gesammelt, aufs Feld gefahren und dann ausgestreut werden mußte, eines zerbrochenen Fuhrwerks, eines Pferdefußes, der geheilt werden mußte… Was konnte es da schon für eine Veredelung geben!“ Ähnlich war es dann mit den Gewerken, d.h. mit den „Kinderkolonien, die ihre Motivationsbilanz auf das Handwerk aufbauten“. Makarenko beobachtete dabei stets ein und das selbe Ergebnis: dass die Jugendlichen als angehende Schuster, Tischler, Maurer etc. immer mehr „Elemente des Kleinbürgerlichen“ annahmen. Und diese stehen der Entwicklung eines revolutionären Kollektivs entgegen, wie er es anläßlich des Umzugs der Gorki-Kolonie in eine größere (in der Nähe von Charkow) sogar an sich selbst entdeckte – nachdem sie alle ihr knappes Hab und Gut zusammengepackt hatten und dabei eine Menge sauer erworbenes bzw. organisiertes „Eigentum“ zurück ließen:
„All diese ungestrichenen Tische und Bänke allerkleinbürgerlichster Art, diese unzähligen Hocker, alten Räder, zerlesenen Bücher, dieser ganze Bodensatz knausriger Seßhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit war eine Beleidigung für unseren heldenhaften Zug…und doch tat es einem leid, diese Dinge fortzuwerfen.“ Aber auch der „heldenhafteste Zug“ ist irgendwann abgefahren. Nicht selten kommt dann so etwas wie ein neuer „Kollektivegoismus“ auf: Hauptsache unsere Genossenschaft blüht auf – und sei es auf Kosten anderer Genossenschaften. Da hilft auch kein Zusammenfassen zu immer größeren Einheiten. Bereits im „Jahr des großen Umschwungs“ 1929 ließ dazu der großartige Andrej Platonow einen der repressierten Großbauern (Kulaken) in seinem Roman „Die Baugrube“ sagen: „Ihr macht also aus der ganzen Republik einen Kolchos, und die ganze Republik wird zu einer Einzelwirtschaft…Paßt bloß auf: Heute beseitigt ihr mich, und morgen werdet ihr selber beseitigt. Zu guter Letzt kommt bloß noch euer oberster Mensch im Sozialismus an.“ Stalin, der das Manuskript las („mein einziger Leser“ – so Platonow), schrieb an den Rand: „Schweinehund“.
8. Produktiv-Genossenschaften
Die meisten Produktiv-Genossenschaften gibt es in Italien, darauf folgt Tschechien. Dort gibt es sie – mit Unterbrechung während der deutschen Okkupation – seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Entstanden sind sie wegen der starken ausländischen Konkurrenz – z.B. in der Textilindustrie. Deswegen taten sich einige kleine böhmische Textilunternehmer zusammen und gründeten eine Genossenschaft. In der Schweiz gibt es bereits seit dem 15.Jahrhundert Genossenschaften – mit formeller Satzung, um z.B. „die Nutzung der Almen, der Wälder und des Ödlands besser zu regeln,“ wie die Allmende-Forscherin Elinor Ostrom schreibt, die verschiedene Genossenschaften in der Schweiz, in Japan, in Spanien und auf den Philipinen studierte, um empirisch nach einen „dritten Weg“ zwischen Verstaatlichung und Privatisierung zu suchen. Neuerdings hat dies auch das EU-Büro von Sarah Wagenknecht unternommen, in dem es zwei Studien über die Berliner Wasserwerke und die Sparkasse, die privatisiert werden sollen, in Auftrag gab. In Tschechien ist man quasi den umgekehrten Weg gegangen: Dort hat die Regierung des Neokons Vaclav Klaus in den Neunzigerjahren ein Genossenschaftsgesetz erlassen, dass diesen eine faktische Gleichstellung mit Kapitalunternehmen ermöglicht. Konkret heißt das z.B. dass eine mährische Genossenschaft, die Textilien produziert, sich ein Statut verpasst, in dem die Stimmen der Genossen sich nach der Höhe ihrer Einlagen richten. Auf diese Weise bringen es der Vorsitzende und sein Stellvertreter auf 68% der Stimmen. Die Löhne der rund 200 Näherinnen bewegen sich an der untersten Grenze der Durchschnittslöhne, die in Südböhmen/Mähren gezahlt werden – und sie arbeiten dafür im Akkord. Anders eine benachbarte Produktivgenossenschaft, in der Nagelscheren und Ähnliches sowie Taschen hergestellt werden. Hier herrscht noch ein relativ gemütliches Arbeitsklima, das sich wesentlich von den chinesischen Textilfabriken unterscheidet, in denen hunderte von jungen Mädchen für einen Hungerlohn im Akkord z.B. T-Shirts zusammennähen, angetrieben von miesen Vorarbeitern, die ihre Arbeiterinnen nicht selten nach Feierabend auch noch sexuell ausbeuten. Aber diese versklavenden Arbeitsbedingungen sind weltweit vorbildhaft – auch die tschechischen Produktivgenossenschaften müssen sich an ihnen messen: d.h. ihre Lohnkosten dürfen nicht wesentlich über den chinesischen liegen. Und in der technologischen Entwicklung sind die Chinesen inzwischen sowieso führend. Also bleibt den tschechischen Betrieben nichts weiter übrig, als Marktnischen zu besetzen: Sie stellen z.B. tolle Uniformen für die Schweizer Armee her oder schicke Erste-Hilfe-Taschen für die österreichische Bundesbahn. Mitunter können sie auch einen Absatzmarkt mit ökologisch sauberen Produkten halten – z.B. Kinderspielzeug aus Buche mit Naturfarben bemalt. Solche Produkte leistet sich dann die obere Mittelschicht in Japan und Amerika. Und die solcherart teures Kinderspielzeug herstellende Genossenschaft freut sich natürlich, wenn chinesisches Billigspielzeug unter Blei- und Kadmiumverdacht gerät, auch wenn sie deswegen noch lange nicht in die US-Schweinekette „Toys R Us“ aufgenommen wird. In Deutschland gibt es nur wenige Produktivgenossenschaften, die meisten nennen sich schlicht Alternativbetriebe und haben sich als GmbH oder AG registrieren lassen. Aber in Berlin gibt es die taz und die Junge Welt als eingetragene Genossenschaften. Die erstere ist älter und operiert enger am Markt. Dabei tut sich jedoch ein Widerspruch auf: während die 7900 Geldgeber – als Zeichner von Genossenschaftsanteilen – das „linke Projekt“ mit ihrem Geld unterstützen wollen, drängt es die Redakteure zur (schwarz-grünen) Mitte. Dies hat zur Folge, dass es zunehmend schwieriger für die taz wird, weitere „Linke“ als Genossen zu gewinnen. Die Redakteure mag das jedoch nicht anfechten, insofern sie darauf spekulieren, mit ihrem Mainstreamkurs bald so erfolgreich wie z.B. die Bild-Zeitung zu sein – und damit gut und gerne auf weitere Genossen verzichten zu können. Hier ist die Genossenschaft also bloß ein finanzieller Nothebel, der mit dem eigentlichen Projekt kaum etwas zu tun hat. Wie es bei der Jungen Welt aussieht, weiß ich nicht, das mag die kommende Vollversammlung diskutieren. Grundsätzlich gilt jedoch, dass Journalisten für jeden Genossen unsichere Kantonisten sind. Nicht umsonst galten sie den Bolschewiki als „Klassenfremde“ – entfernter als die Verbrecher. Man muß sie deswegen besonders hart ins Joch zwingen. Pressefreiheit – d.h. für diese halbgebildete Schweinebande bloß, sich trotzdem einen Namen machen zu wollen. Ich weiß, wovon ich rede.
9. Zerknirschung und Optimismus
Der Philosoph des Judentums Emmanuel Lévinas meinte nach dem ersten bemannten Weltraumflug 1961: Mit Gagarin wurde endgültig das Privileg „der Verwurzelung und des Exils“ beseitigt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion gab jedoch einer der letzten Kosmonauten auf der MIR-Raumstation zu bedenken: „Wir haben unser Hauptproblem dort oben nicht gelöst. Wir können seit Gagarin in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen.“
Wie im Himmel also auch auf Erden – tat sich derweil ein ähnliches Schwanken zwischen Optimismus und Zerknirschung auf. So meinte z.B. der brasilianische Philosoph Vilèm Flusser: „Wir dürfen also von einer gegenwärtig hereinbrechenden Katastrophe sprechen, welche die Welt unbewohnbar macht, uns aus der Wohnung herausreisst und in Gefahren stürzt. Dasselbe lässt sich jedoch optimistischer sagen: Wir haben zehntausend Jahre lang gesessen, aber jetzt haben wir die Strafe abgesessen und werden ins Freie entlassen. Das ist die Katastrophe: dass wir jetzt frei sein müssen. Und das ist auch die Erklärung für das aufkommende Interesse am Nomadentum.“
Man spricht von den alten – viehzüchterischen – Nomaden, deren Welt am untergehen ist, und den „neuen“, oder „modernen Nomaden“, die angeblich und nicht zuletzt dank Internet schwer im Kommen sind. Bei diesen Stadtnomaden unterscheidet man heute – wenigstens in Berlin – zwischen „urbanen Pennern“ und der „digitalen Bohème“. Beide zählen zur „kreativen Intelligenz“ und gemeinsam ist diesen jungen „Laptoppern“ auch die zunehmende Unmöglichkeit bzw. ihre Ablehnung einer Festanstellung. Im Gegensatz zu den ersteren, die mit ihrer prekären Selbständigkeit hadern, sehen letztere darin jedoch optimistisch gestimmt eine Chance.
Die „Bohème“ leitet sich von den Zigeunern ab, schon Michel Foucault riet in seinen Thesen zur Einführung in das nicht-faschistische Leben: „“Glaube daran, dass das Produktive nicht seßhaft, sondern nomadisch ist!“ Wenig später machten Gilles Deleuze und Félix Guattari daraus eine ganze postmoderne „Nomadologie“, wobei sie davon ausgingen, dass mit dem Übergang von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft bzw. von der Industrie- zur Informationsgesellschaft alle „geschlossenen Systeme“ (Krankenhäuser, Knäste, Fabriken, Schulen usw.) sich öffnen müssen – und uns allen u.a. bald das schreckliche „Lifelong Learning“ drohe. Der US-Arbeitsminister unter Clinton Robert Reich versuchte demgegenüber diese Entwicklung 1997 eher optimistisch zu sehen, in dem er den o.e. neuen Mittelschichtstypus, der sich im Zusammenhang der Globalisierung und der Reprivatisierungen nach dem Zerfall der Sowjetunion, herausmendelte zu den 20% Gewinnern der neuen Ökonomie zählte, die er „Problemlöser“ und „Problemfinder“ nennt. Dazu rechnet er Broker, Juristen, Programmierer, Gentechniker, Werbetexter usw..
Nur an ein Segment daraus dachte die linke Kulturpolitikerin Adrienne Goehler, als sie die sich immer mehr „verflüssigenden“ sozialen Umwelten in den Blick nahm, um die nomadisierenden Kreativen als produktive Antwort darauf zu begreifen. Da deren äußerst mobile Existenz bald für alle gelten soll, werde sich dabei aufs Ganze gesehen der „Sozialstaat zur Kulturgesellschaft“ wandeln, so Goehlers These, die der SPD-Theoretiker Peter Glotz bereits vorformulierte, als er 1987 vermeinte, die wachsende wirtschaftliche Bedeutung des Kultursektors erkannt zu haben. Dieser positiven Sicht auf alle „Verflüssigungen“ – infolge der dritten industriellen Revolution – hält der exilierte polnische Soziologe Zygmunt Baumann das Elend der „Überflüssigen“ entgegen: also das Schicksal all derer, die weltweit eine neue Existenzweise suchen – dabei jedoch nicht mehr wie noch vor 150 Jahren auf so genanntes „unterbesiedeltes Land“ auswandern können. Mit diesen hält es Krzysztof Wodiczko, wenn er meint: „Der Künstler muß heute als nomadischer Sophist in einer migranten Polis aufzutreten lernen.“ Denn die Migranten sind jetzt – laut Neal Ascherson – zu Subjekten der Geschichte geworden: „die Flüchtlinge, die Gastarbeiter, die Asylsucher und die Obdachlosen“. Oder wie der Exilpalästinenser Edward Said es ausdrückte, „die Fackel der Befreiung“ ist von den seßhaften Kulturen an „unehauste, dezentrierte, exilische Energien“ weitergereicht worden, „deren Inkarnation der Migrant“ ist. Die Plätze, Märkte, Parks und Bahnhofshallen der großen Städte werden durch sie zu neuen „Agoren“ (den Versammlungsplätzen in der griechischen Polis).
Neues Prekariat, kreative Klasse, Urban Nomads – das sind einige der Schlagworte für all jene jungen gutausgebildeten Leute hierzulande, die versuchen, sich als „Projektemacher“ (vulgo „Jobnomaden“) durchzuschlagen, weil es infolge der Umwandlung der Industriegesellschaft in eine Informations- oder Mediengesellschaft bzw. einer Disziplinargesellschaft in eine Kontrollgesellschaft, die alle geschlossenen Systeme zwingt, sich zu öffnen, immer weniger Festanstellungen für sie gibt. Im deindustrialisierten Berlin stellt sich diese Situation besonders drastisch dar, deswegen entstand hier auch eine zwischen Pessimismus und Optimismus schwankende Betroffenendiskussion, die um die Begriffe „urbane Penner“ und „digitale Bohème“ kreist. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder gerne der Begriff des „Scheiterns“ thematisiert. Da diese Diskussion auch in der taz geführt wird – eine „Creative Village“-Gruppe veröffentlichte sogar ein taz-buch über das Scheitern und eine der umstrittenen Autorinnen, die sich dazu mit einer Buchveröffentlichung („Verflüssigungen“) zu Wort meldete, Adrienne Goehler, ist Aufsichtsrätin der taz – soll sie für diesmal auch Thema der „Generation Praktikum“ sein.
10. Die fortschreitende Trennung von Hand- und Kopfarbeit
Folgen wir den Arbeiten des marxistischen Erkenntnistheoretikers Alfred Sohn-Rethel, in diesem Fall seiner kleinen Schrift „Das Geld – die bare Münze des Apriori“ dann bereitete sich ausgehend von Italien und im 15./16. Jhd auch in Deutschland eine Spaltung der Bauhütten vor. Diese errichteten u.a. die gotischen Kathedralen – ihre Auftraggeber waren Bischöfe, Äbte, Fürsten. Die Bauhütten waren Kollektive (Artel/Genossenschaften) mit einem Steinmetz-Meister als Verantwortlichen und sie waren groß: Sie umfaßten Laubhauer, Holzbildhauer, Lehrlinge, Gesellen, Köche etc. – aber keine Architekten oder dergleichen. Die Spaltung, die eine Trennung von Hand- und Kopfarbeit war – bewirkte kurz gesagt, dass das Gros der Handwerker in den Bauhütten mit der Zeit über die Zünfte und Manufakturen bzw. Fabriken zu bloßen (Hand-)Arbeitern degradiert wurde, während ein kleiner Teil sich zu Künstlern und Ingenieuren bzw. Wissenschaftlern aufschwang.
Einer der wenigen, die das aufhalten wollten, war das Nürnberger Bauhütten- und Zunft-Mitglied Albrecht Dürer, in dem er für seine Lehrlinge, damit sie nicht zu bloßen Handarbeitern herunterkamen, zwei überaus wichtige – mit eigenen praktischen Erfindungen angereicherte – Bücher schrieb: „Vnderweysung der messung mit dem zirckel vnd richtscheyt“ (= Underweysung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheyt), bei Hieronymus Andreae, Nürnberg 1525 und „Etliche vnderricht, zu befestigung der Stett, Schloß vnd Flecken“, bei Hieronymus Andreae, Nürnberg 1527. Dürer war beflügelt vom deutschen Bauernkrieg, der ebenfalls etliche Aufhebungen von Trennungen zum Ziel hatte („Als Adam grub und Eva spann – wo war denn da der Edelmann?!“), als die Bauernrevolte niedergeschlagen wurde, mußten sich auch Dürer eine Zeitlang verstecken, er entwarf in dieser Zeit ein wunderbares Bauernkriegsdenkmal. Mit seinen grandiosen „Unterweisungen“ für Lehrlinge und Gesellen scheiterte er jedoch – nach zwei Seiten: Diese hatten kein Interesse, sich darin einzuarbeiten, die Schriften waren ihnen zu kompliziert. Und die italienischen Wissenschaftler und Künstler, die seine Schriften über alle Maßen lobten und benutzten, hatten überhaupt kein Interesse daran, sie zu vermitteln, denn sie lebten davon, dass sie den Handwerkern, beim damals wegen der Verbreitung der Feuerwaffen boomenden Festungsbau z.B., ihr Wissen verkauften. Sie machten daraus also quasi ein Geheimwissen und ein Geschäft.
Das war der Beginn der bis heute anhaltenden Trennung von Hand- und Kopfarbeit, bzw. zwischen Proletariat und Ingenieur/Wissenschaftler/ Künstler. Letzterer versuchte immerhin in seinen Werken – die er ja praktisch schuf und auch verkaufte – die Einheit gewissermaßen zu postulieren, das ist das „Utopische“ an den Kunstwerken (- die Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit), wie es Benjamin und Adorno herausarbeiteten. Aber auch beim Künstler, den Thomas Kapielski einmal als Bauchladen-Besitzer bezeichnete, ging dann die Trennung weiter. Ich erinnere an die Büros bzw. Ateliers von Dumas und Rembrandt – bis hin zu Anselm Kiefer und Günter Uecker, die Ausführende, Schreiber, Pinsler, Assistenten, Manager etc. beschäftigten. Anselm Kiefer hatte einen Kunsthistoriker, der für ihn die „Themen“ bearbeitete und Uecker eine Landkommune, die für ihn nagelte. D.h. auch diese Künstler stellten für die ihnen unangenehme Hand- bzw. Vorarbeit oder auch Organisationstätigkeit Leute an, eine Art von Lehrlingen aber auch Spezialisten, Finanzmanager, Wissenschaftler etc. Andere, wie Jeff Koons und Richard Serra lassen ihre Werke in hochtechnisierten Metallfabriken produzieren.
Was den Künstlern blieb, war die Kopfarbeit, d.h. sie denken sich Sujets, Themen, Ideen aus. Neulich erfuhr ich, dass die Avantgarde unter ihnen nicht einmal mehr das macht: Sie lassen auch noch denken…Es gibt inzwischen Künstler in Berlin, die beschäftigen bis zu 50 Mitarbeiter, in den USA sogar einen, der über 80 Angestellte hat. Wie hat man sich eine solche Kunstproduktion vorzustellen? Der serbische Regisseur Zoran Solomun hat diese Frage in einem Artefilm über international erfolgreiche Galeristen mitbedacht. In einer Mail schrieb er mir kürzlich: „Na ja, sie lassen nicht denken, sie machen dass aber ganz oberflächlich und bequem. Ich habe im Film einen Chinesischen Künstler der einfach im Internet surft und Motive, die er gut findet seinen Assistenten zum Malen gibt. Murakami, der grosse Star, lässt dann auch wahrscheinlich denken, aber das kann man nicht beweisen, das ist nur eine Vermutung, da er über 100 Mitarbeiter hat, und sicher sind unter diesen auch Leute die Konzepte und Ideen entwickeln.“ Ganz sicher kann man jedoch über diese Künstler-Unternehmer sagen: Sie produzieren alle noch Renaissancekunst. Die wahre Kunst, so der Philosoph, Vilèm Flusser, beginnt nämlich mit der Gentechnik: „Erst mit ihr werden sich selbst reproduzierende Werke möglich“.
11. Das Elend an der Wurzel packen
Ab Ende der Siebzigerjahre arbeitete ich einige Jahre in verschiedenen Landwirtschaften Westdeutschlands, und ab 1989 noch einmal einige Monate in einer LPG. Hier wie dort handelte es sich zwar um konventionelle Landwirtschaften, daneben beschäftigte ich mich aber auch mit alternativ bzw. biologisch wirtschaftenden. Dabei geriet ich mehr und mehr von der Konsumenten- in die Produktionssichtweise – und kam darin zu der Überzeugung, dass das Problem des Gesundseins von Lebensmitteln mit dem Übergang von der Gebrauchswert- zur Tauschwertproduktion entsteht. Mit ein Grund, warum ich von Bio-Waren weder als Betriebshelfer auf Höfen, die so etwas herstellen, noch als Käufer heute groß etwas zu tun haben will.
amit will ich nicht sagen, dass die „normalen“ Lebensmittel in Supermärkten, dass Gemüse ausHolland oder Spanien, besser ist – im Gegenteil. Aber diese gerade boomende Biobranche steht über kurz oder lang vor dem selben Problem wie die konventionell wirtschaftenden Bauern und die Weiterverarbeiter bzw. -vermarkter ihrer Produkte: Ab einer bestimmten Größe und Produktionsmenge ist einem der Endverbraucher scheißegal, geradezu ein Feind. Das war schon bei den Abgaben an die Obrigkeit so: Bei den Eiern wurden nur die kümmerlichsten genommen, bei den Hühnern die dünnsten usw.. Bei einem Bauern in der Wesermarsch mußte ich einmal einen großen LKW mit Strohballen beladen, die für einen holländischen Großbetrieb bestimmt war. Am Ende hatte der LKW jedoch nicht genügend Zentner drauf – das Stroh war zu leicht gepresst worden. Der Bauer kam, überlegte kurz und dann bespritzte er die trockenen Ballen auf dem LKW so lange mit einem Wasserschlauch, bis sie das erforderliche Gewicht hatten. Ein Irrsinn – aber mit Methode. Ähnlich war es in der LPG, wo ich in der Rindervormast arbeitete, morgens als erstes auszumisten und dann frisches Stroh einzustreuen hatte. Mein Kollege Egon brachte dies mit dem Traktor von einer Miete auf dem Feld heran. Nachdem er mehrmals völlig vergammeltes, nasses Stroh geracht hatte, bat ich ihn, mir endlich wieder trockenes zu bringen, so stünden die Rinder schon nach fünf Minuten wieder im Matsch. „Nein,“ erwiderte er, gerade das nasse, vergammelte lasse sich besonders leicht holen und transportieren. Ähnlich absurd ging es beim Verladen der Mstbullen zu: Sie wurden jedesmal derart verdroschen, dass der Schlachthof sich beklagte, weil er wegen der vielen Blutergüsse ganze Partien aus dem Leser rausschneiden mußte (bei Schafen wird übrigens heute das Fell und die Wollen auf Kostengründen überhaupt nicht mehr verwertet, sondern weggeschmissen). Der Schlachthof sorgte irgendwann dafür, dass die Rindermastbetriebe mit Stäben ausgerüstet wurden, die elektrische Schläge verteilten. In unserer LPG blieben die Rinderpfleger jedoch bei Holzstöcken und Mistgabeln.
Nebenbeibemerkt wirkt sich der Eigentumsbegriff hier bei westdeutschen Bauern durchaus aggressionshemmend – und damit rinderschonender – aus. Es ist aber auch die schiere Betriebsgröße, die einen von den Tieren (und Pflanzen) entfremdet, wenn man so sagen will, d.h. ab einer bestimmten Herdengröße sind die Kühe eben nur noch Nummern. Das geht z.B. in der zur GmbH umgewandelten LPG von Schmachtenhagen so weit, dass dort der Computer automatisch mitteilt, welche Kuh ausrangiert werden muß – indem er ihre Milchleistung mit ihrem Futterverbrauch gegenrechnet: auf Leistungsabfall steht die Todesstrafe. Und so ist es überall. Hinzu kommt, dass ab einer bestimmten Größe alles rund laufen, dass man also auch „schwierige Tiere“ schnell abstoßen muß. Es kann natürlich keine allgemeine Rückkehr zur reinen Gebrauchswert-Produktion, also zur Subsistenzwirtschaft, geben, aber ebensowenig bringen es beim derzeitigen Zwang zum Wachstum die immer feiner werdenden „Qualitätskontrollen“ und umfangreicher werdenden „Überwachungen“ – wie sie immer wieder nach „Gammelfleisch-Skandalen“ etwa gefordert werden. Zudem ermittelt man mit den Qualitätskriterien immer nur bestimmte Wareneigenschaften – und nie z.B. die, dass das Elend und der Frust bei ihrer Herstellung in sie eingeht – und sie so vergiftet. Ja, regelrecht vergiftet.
12. Gerechtigkeitsschlingel und Leistungsfeteschisten
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – diese Gewerkschaftsforderung galt einmal für Gastarbeiter und gilt noch immer nicht für Ostdeutsche. Letztere machten sich daneben frühzeitig auch noch für die Forderung „Leistung muß sich wieder lohnen“ stark. Beides wird geradezu pingelig im alternativen Beschäftigungssektor befolgt. Gemeint sind damit Tauschhandelssysteme in von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Regionen – auf der Basis von lokalen Währungen bzw. Verrechnungssystemen: LETs (Local Exchange Trading Systems) genannt.
Die Idee geht auf den Science-Fiction-Roman „And Then There Were None“ von Frank Russell (1951) zurück und wurde zuerst in Kanada, dann aber auch in Neuseeland, Australien und in den USA realisiert. In England gab es Mitte der Neunzigerjahre in über 200 Kommunen LET-Systeme. Heute wirbt dort eine so genannte „Timebank“ für diese Art von Nachbarschaftshilfe mit ausgleichender Gerechtigkeit. Die Heilbronner „ImpulsWerkstatt“ hat darüber gerade einen Dokumentarfilm gemacht, den man sich als DVD bei ihr bestellen kann. Das System der Zweitwährung basierte ursprünglich auf der „Schwundgeldtheorie“ von Silvio Gesell. In den Zwanzigerjahren wurde die Idee eines eigenen Geldkreislaufs bereits erfolgreich in mehreren von besonders hoher Arbeitslosigkeit betroffenen Gemeinden Österreichs und Deutschlands ausprobiert. Und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so etwas kurzzeitig erneut: z.B. wurde im Landkreis Vogelsberg eigenes Geld und auch Briefmarken gedruckt. Diese „Zweitwährung“, mit der nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern sogar Arbeitslöhne bezahlt wurden, hatte und hat den Vorteil, daß sie unter maximaler Ausnutzung der eigenen Ressourcen der jeweiligen Gemeinde funktioniert und so quasi mit der – legalisierten – Grauzone zwischen Schwarzarbeit und Nachbarschaftshilfe ein zweites Bruttosozialprodukt erwirtschaftet.
Dies geschieht jedoch stets in einem regional begrenzten (Kiez-)Rahmen. „Eine landesweite Ausdehnung der Systeme würde uns genau dort wieder hinbringen, wo wir gerade hergekommen sind: Der Reichtum würde dann von einem zentralen Machtblock abgeschöpft, und die kleinen Gemeinden hätten wieder das Nachsehen“, so eine der „Lets“-Pioniere: Liz Shephard. Im Prenzlauer Berg wurden 1993 von Bert Papenfuß so genannte „Knochen“ in Umlauf gebracht: Mit dem von Künstlern gestalteten Kunstgeld konnte man in 23 Läden einkaufen. Beim LET-System geht es jedoch nicht um die Währung, es reicht auch eine Buchführung über Leistungen – um z.B. das Haareschneiden einer arbeitslosen Friseusin mit dem Babysitten eines vorzeitig in Ruhe geschickten Postbeamten zu verrechnen. In Kreuzberg wurden solche „Systeme“ nach 1993 immer wieder angeschoben. Sie sind jedoch nur für Nebenbei-Beschäftigungen gut und um den Freundeskreis zu erweitern, was dann der regulären Jobsuche zugute kommt. Sie werden deswegen auch von Staats wegen nicht fiskalisch verfolgt, sondern sogar unterstützt.
Die Stadtforscherin Antonia Herrscher kritisiert daran, dass sie allesamt noch einer protestantisch-kapitalistischen Ethik verpflichtet sind, d.h. einer verdammten „Gerechtigkeit“, die stets sauber im Gegenrechnen aufgehen will. Das betrifft auch die spätestens seit 1993 immer mal wieder organisierten Diskussionsveranstaltungen über „gerechte und ökologisch verträgliche Geldordnungen“. Der Nürnberger Marxist Robert Kurz würde all den daran interessierten Aktivisten vorwerfen: „Sie denken selber in den Kategorien der Ware und wollen sich gar keine Vorstellung über eine Welt jenseits davon machen…Was dann als vermeintliche Kritik einer Welt der Waren übrig bleibt, ist nichts als eine verkürzte und nebelhafte Denunziation von (subjektiver) ‚Profitgier‘ und ‚Geldgeilheit’…Das Geld ist aber nur die Erscheinungsform der universellen Warenproduktion, nicht deren Wesen, das in ‚abstrakter Arbeit‘ und Wertform gründet.“ Und abstrakt wird die Arbeit, z.B. Rasenmähen,dadurch,dass man sie mit einer anderen, z.B.Zaunstreichen, in ein Verhältnis setzt – mathematisiert.Die eigene Arbeit oder auch der Freundschaftsdienst tritt einem dabei als etwas Fremdes gegenüber. Wir sind bereits alle derart entfremdet – seit Einführung des Geldes etwa 500 vor Christi in Ionien, dass wir selbst für das Aushalten einer Freundin Dankbarkeit, wenn nicht gar Liebesdienste erwarten – spätestens nach einem Zerwürfnis mit ihr fragen wir uns: Hat es sich gelohnt? Und fangen dabei an zu rechnen: 12 Umarmungen, 6 Küsse, 2 mal vögeln – 3 Bordellbesuche wären billiger gewesen, preisgünstiger. Wahre Liebe ist reine Verschwendung – und so sollte auch die Arbeit sein, d.h. produktorientiert. Das kann aber keine Ware sein, die dabei rauskommt.
13. Nichtformelle Einkünfte
Laut einer Umfrage der Hermes Kreditversicherung entsteht der Berliner Ökonomie jedes Jahr durch den „Klau am Arbeitsplatz“ ein Schaden von 1,75 Milliarden Mark. Das ist grober Unfug! Wie einem jeder nicht auf den Kopf gefallene Unternehmer versichern kann, „reorganisieren“ die Mitarbeiter gerade mit Diebstählen ihre immer wieder durch den Profitzwang zerstörte Unternehmensbindung.
Ein Berliner Funkgerätehersteller erzählt: „Ich sehe das sogar gern, wenn meine Angestellten Geräte oder Werkzeug mit nach Hause nehmen, das ist eine ebenso effektive wie kostengünstige Weiterbildung nach Feierabend. Nur einmal habe ich einen Mitarbeiter angezeigt: der hatte einen Keller angemietet und die Sachen weiterverkauft.“ Der Berliner Kurier ließ die Hermes- Umfrage durch einen Arbeitsrechtler kommentieren: „Klauen berührt immer das Vertrauensverhältnis“ – und „rechtfertigt generell eine fristlose Kündigung“. Seitdem der „Kurier“ einem Westkonzern gehört, gelten dort sogar telefonische Privatgespräche am Arbeitsplatz als eine Art Diebstahl. Bei der taz kann man dagegen ohne schlechtes Gewissen alles benutzen: Telefon, Kopierer, Faxgerät, Frankiermaschine etc., sogar Disketten, Papier und Ordner werden einem gerne nach Hause mitgegeben. Dieser „Großzügigkeit“, die auch ein vor einiger Zeit eingestellter „Sparkommissar“ nicht beschnitt, liegt – wie übrigens genauso in japanischen Betrieben – der Gedanke zugrunde, daß dadurch die Identifikation mit dem Betrieb gestärkt wird.
Zwei Berliner Getränkeauslieferungsfirmen machten die Probe aufs Exempel: Die eine kontrollierte ihre Mitarbeiter, die andere nicht. Bei der letzteren war nicht nur das Betriebsklima weitaus besser, es rechnete sich auch, denn die Kontrolle ist teuer, und außerdem fühlten sich die Mitarbeiter dadurch herausgefordert, sie ständig zu überlisten: „Alle Tage Sabotage!“ Der Registrierkassen-Hersteller NCR zum Beispiel muß jedes Jahr ein neues Kassenmodell auf den Markt bringen, weil Kassierer und Kellner bis dahin das System „geknackt“ haben. Aus einem ähnlichen Grund sind Supermarktkonzerne allen Betriebsführungstheorien zum Trotz an einer hohen Fluktuationsrate in ihren Filialen interessiert: Sobald sich jemand „eingearbeitet“ hat, fängt er auch schon an zu klauen – übrigens sind Frauen dabei weitaus mutiger als Männer. Bei Karstadt werden die Mitarbeiterinnen deswegen am Ausgang nach dem Zufallsprinzip kontrolliert. Auch bei Opel in Eisenach wurde dies neulich – von General Motors – eingeführt. Weil zur gleichen Zeit einige Mitarbeiter von Opel Gleiwitz dort hospitierten, meinten die Eisenacher, dies geschähe jetzt nur wegen der Polen. Mit dieser Selbstbelügung wollten sie sich ihre noch hohe Betriebsidentifikation erhalten.
Die schärfsten Kontrollen gibt es in den Seehäfen beim Löschen (durch die internationale Firma Controllco), dennoch ist es ihr noch nie gelungen, einen Diebstahl zu verhindern, wenn die Hafenarbeiter an einer Ladung interessiert waren, und ihr Interesse daran ist wegen der Kontrollen – „Ehrensache“. Bei Opel in Rüsselsheim gab es einmal eine gut verankerte Sponti-Betriebsgruppe. Einmal ließ sie ein Flugblatt verteilen, in dem es hieß: „Einen Schraubenzieher mitgehen lassen macht 8,60 Mark, eine Rohrzange macht 28,40 Mark … usw. Das reicht aber noch nicht: Deswegen 1 Mark mehr für alle pro Stunde!“ Fast schmissen die Arbeiter die Betriebsgruppe deswegen raus, weil zwar alle klauen und das auch jeder weiß, aber keiner darüber spricht. Ähnlich verhielt es sich bereits mit Dostojewskis Bericht über seinen sibirischen Gefängnisaufenthalt, „Aufzeichnungen aus einem Kellerloch“: Die Kriminellen nahmen es ihm übel, daß er darin einige ihrer Überlebenstricks „verriet“ – und wollten deswegen noch lange Zeit danach aus „Dostojewski“ nie was vorgelesen bekommen.
Für 250.000 Mark Waren stehlen Berliner Verkäufer angeblich täglich – und was ist mit den steigenden Mieten, Steuern, etc. und dem miesen letzten HBV-Tarifabschluß? „Wir sind noch lange nicht quitt!“ so sagte es neulich meine Lieblingskassiererin im Kreuzberger PLUS-Markt – und vergaß prompt, einen Kasten Bier unten in meinem Einkaufswagen abzurechnen. Auch das gibt es: uneigennützigen Diebstahl! Eine besonders edle – weil gemeinschaftsstiftende – Form der Kriminalität. In der DDR und noch mehr in der UDSSR – wo fast alles vergesellschaftet wurde – galt der Diebstahl fast als rechtens. Ein Sportlehrer aus Luckau rechtfertigte seine Privatisierungen von Volkseigentum stets mit den Worten: „Erich Honecker hat doch selbst gesagt ‚Wir können noch viel mehr aus unseren Betrieben rausholen‘.“ Weil in Russland auch heute noch massenhaft die mageren Löhne durch Diebstahl ausgeglichen werden, sprechen die Soziologen dort „wertneutral“ von „nichtformellen Einkünften“. Dabei gilt es ihrer Meinung nach, die Balance zu finden: „Wenn die Belegschaft zu wenig klaut, kommt sie nicht über die Runden, wenn sie zu viel klaut, geht ihr Betrieb pleite“. Und eigentlich wollen wir das doch alle: uns ausbalancieren.
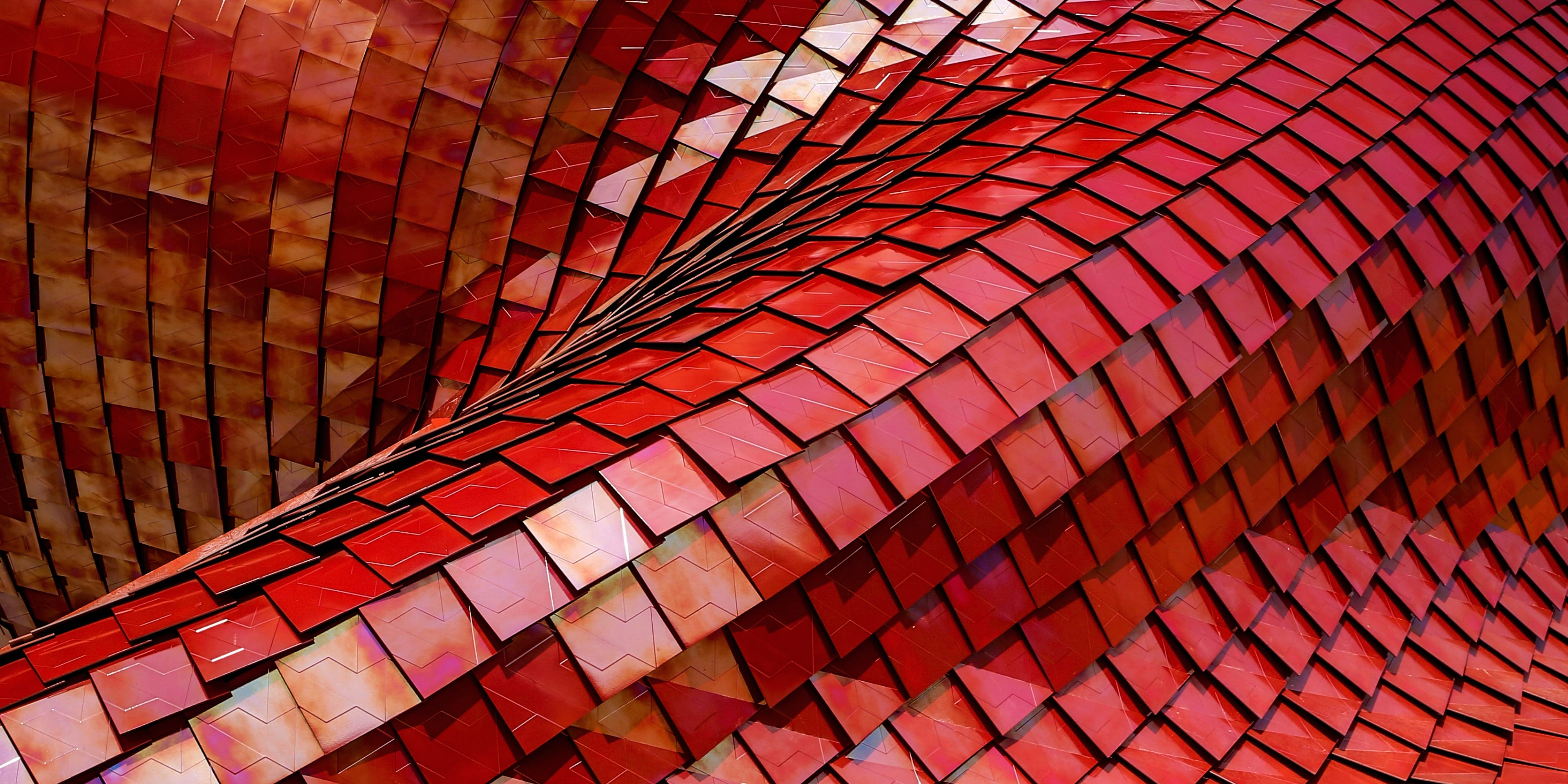



Zum Problem der Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, das vor allem während der chinesischen Kulturrevolution überall diskutiert wurde (inzwischen freut man sich ja schon, wenn man bloß irgendeinen dämlichen Bildschirm-Arbeitsplatz ergattert hat – und egal was tut), schien das neue Buch von Richard Sennett „Handwerk“ einiges beizutragen, aber weit gefehlt, es ist völlig seicht und verplaudert – und macht schlechte Laune. Schlichtweg jeder Tätigkeit und selbst der hirnlosesten kann er eine handwerkliche Qualität abgewinnen. Wenn es bloß darum geht, dann verwundert um so mehr, dass er nicht einmal Solschenyzins Erstroman aus den Sechzigerjahren dazu herangezogen hat: „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“. Von dem Fehlen aller Bücher, die Alfred Sohn-Rethel darüber schrieb, ganz zu schweigen. Aber damit soll hier noch nicht alles gesagt sein über das Buch „Handwerk“.