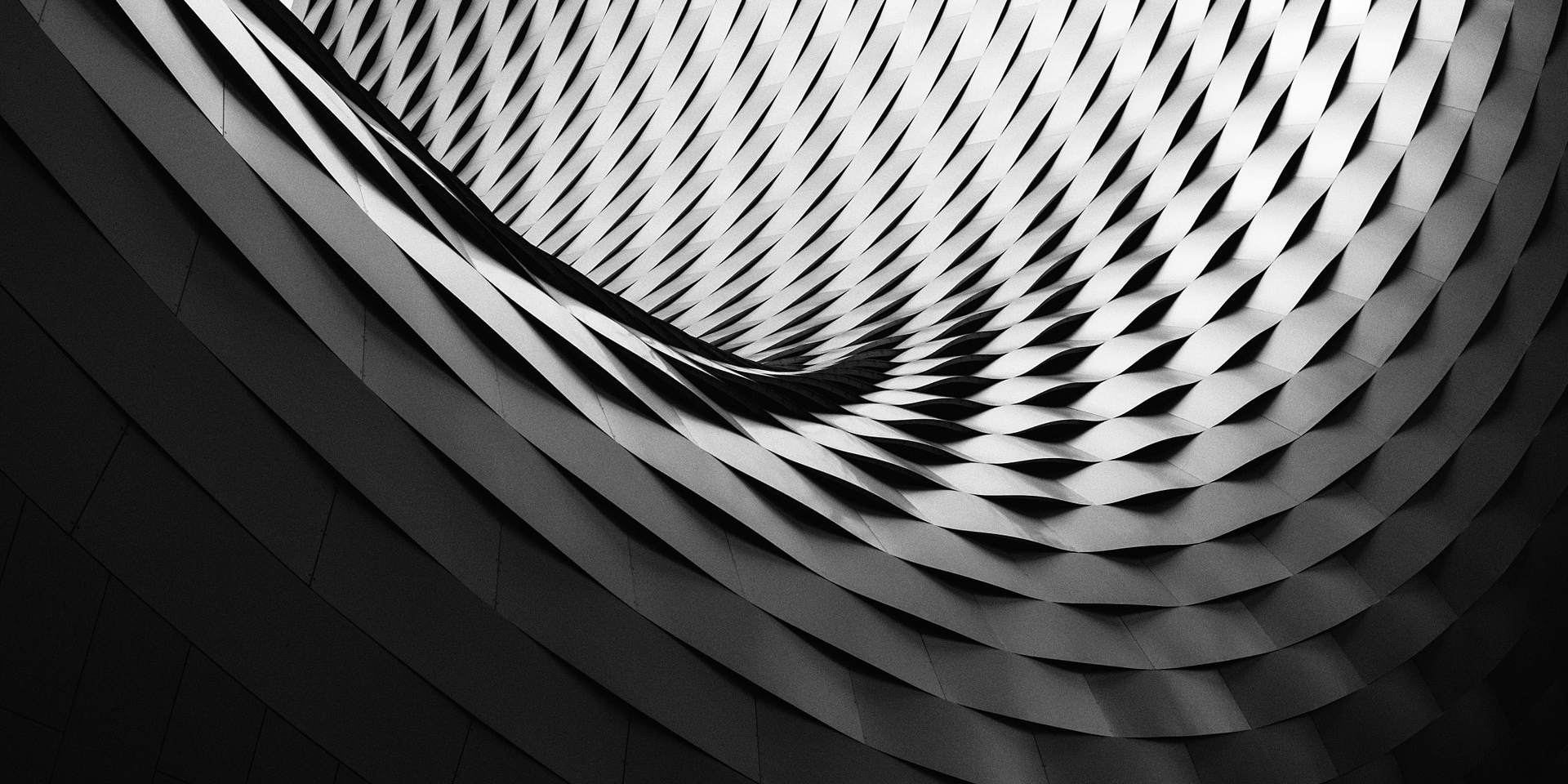Florence Hervé verdanken wir die letzten Informationen über die Beduinen in der Negev-Wüste, ihr Artikel wurde heute in der Jungen Welt veröffentlicht:
Staubige Ebenen, Steppen, Schluchten, Lehmhügel und farbige Erosionskrater wechseln sich ab, dazwischen weiße Dörfer und grüne Oasen. Der Negev – »die Trockene« auf Hebräisch –, das sind 12000 Quadratkilometer Wüste, über die Hälfte des israelischen Staates, doch leben hier nur zehn Prozent der Bevölkerung. Gelegen zwischen dem Tal von Beer Sheva im Norden, dem Arava-Tal im Osten, dem Roten Meer im Süden, und dem Gazastreifen und Ägypten im Westen.
Der Negev: Das sind auch vorbeiziehende Ziegenherden und braune Kamele, eingezäunte blühende Kibuzzim, antike Stätten und hochmoderne Solarforschungsinstitute, Fischzucht und Anbau von Wein, Blumen, Gurken und Tomaten. Und das sind Elendshütten, Müllhalden und Militärsperrzonen, Trainingsflächen für die Armee, Standorte von Nuklearanlagen. Das ist der brutale Gegensatz von stiller Abgeschiedenheit und dröhnendem Lärm der Kampfjets. Armut und Reichtum bestehen im Negev eng nebeneinander und sind doch völlig ungleich verteilt. Armut ist arabisch, exakt: beduinisch.
»Heute kann ich es laut sagen. Ich bin eine Beduinen-Frau mitten in der Wüste. Ich arbeite und pflege die Traditionen.« Stolz klingt in ihren Worten. Fatmah, etwa 50 Jahre alt, lebendige grüne Augen, träumte als Kind davon, Lehrerin zu werden. Daraus wurde nichts, wegen der Vertreibungen und wegen der Tradition. Mit 13 war Schluß mit der Schule, sie wurde Schäferin und arbeitete bei den Eltern. Danach der übliche Weg: Heirat mit einem Hirten, der irgendwann LKW-Fahrer wurde, zwölf Kinder. Ein Leben in Armut, zunächst im Zelt, dann in einer Wellblechhütte, heute in einem Haus.
Und doch ein Leben in Würde. Da half die Arbeit. Fatmah hatte von einem Webereiprojekt für Frauen gehört. Ihren Mann hat sie nicht gefragt, sie hat einfach begonnen hier zu arbeiten. Sie schmunzelt: »Mein Mann war zunächst nicht sehr glücklich darüber.« Das war Anfang der 1990er Jahre, da fing sie als Weberin im freundlichen, grünen Lakiya-Haus an der Hauptstraße an. Die Webkunst hatte sie von der Mutter gelernt, die jeden Handgriff kannte. Heute ist sie auch Managerin im Projekt. »Die Arbeit tut mir gut, körperlich und moralisch«.
Sie ist eine der 70 Frauen, die für die Weberei von Lakiya arbeiten – die meisten von ihnen zu Hause, da die Männer ihnen nicht erlauben, Heim, Herd oder auch das Dorf zu verlassen. Fatmahs Töchter sind den Weg der Bildung und der Selbstständigkeit gegangen – eine von ihnen, Maryam, erfüllte den Traum der Mutter und wurde Lehrerin, eine andere Krankenschwester. Lediglich eine von ihnen kann noch auf überkommene Weise weben.
Lakiya, eines der insgesamt sieben vom israelischen Staat anerkannten Beduinen-Dörfer: Hier leben 8000 Menschen, es gibt eine Moschee, etwa 15 Kilometer entfernt liegt Beer Sheva, die Hauptstadt der Negev-Wüste, die inzwischen über Elektrizität und Wasser verfügt. Nicht nur von ihr trennen Lakiya Welten, sondern auch vom nur ein paar Kilometer entfernten Omer mit dessen 6300 Einwohnerinnen und Einwohnern, ein kleines blühendes Paradies mitten in der Wüste. Blaue Jacaranda-Bäume, grüne Sträucher, bunte Bougainvilleen, rosa Lorbeere und duftende Eukalypten säumen die gepflegten Straßen, umranden die Villen. In Omer wohnen jüdische Israelis, in Lakiya Beduinen mit israelischer Staatsangehörigkeit. Bürger dritter Klasse. Da bedarf es keiner Extra-Mauer.
»Staatliches Land«
Und doch haben es die Menschen in Lakiya noch gut im Vergleich zu den 76000 Beduinen, die in den 45, von Israel nicht anerkannten Dörfern leben: in Wellblechhütten oder in Zelten aus schwarzen Plastikplanen, verstreut im Niemandsland, ohne Strom und Müllversorgung, ohne fließendes Wasser, kurz: ohne jegliche Infrastruktur. Im Sommer steigen die Temperaturen auf über 50 Grad. Diese vom Staat als »illegal« bezeichneten Behausungen werden regelmäßig von Bulldozern zerstört. »Die israelische Regierung betrachtet uns als Hindernis, als demographische Bedrohung«, sagt Amal Elsana Alh’jooj, eine Beduinin aus Lakiya. »Die Araber werden von vielen Juden als Feinde gesehen, nicht als gleiche Bürger. In den Medien sind wir kaum vorhanden«. Und wenn von Beduinen geredet wird, dann meist im Zusammenhang mit Kriminalität und Drogenhandel. Ausnahme ist ein einsamer Beduine in der Knesset, ein einziger Abgeorneter im israelischen Parlament – er ist ein Onkel von mir, fügt sie hinzu.
Seit der Gründung Israels und der folgenden Erklärung der Negev-Wüste zu »staatlichem Land«, über das die Zentralregierung verfügt, mußten über 80 Prozent der ehemaligen arabischen Hirtennomaden Südpalästinas in die angrenzenden Länder fliehen. Die israelische Regierung versucht heute noch, so viele Beduinen wie möglich auf kleinstem Raum in der Wüste seßhaft zu machen. Diese werden in den Siedlungen geduldet, der Rest ist unerwünscht. Der Negev ist der Hinterhof der Regierung, da wird kein Schekel oder Dollar investiert – wenn man von den vielen militärischen Anlagen und den vorbildhaften Kibbuzzim wie Sde Boker, dem Wohnort des ersten israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion, absieht. Die Zukunft liege in der Wüste, sagte dieser – es fragt sich nur, welche Zukunft und für wen? Beduinen sind eine nationale Minderheit innerhalb einer Minderheit: 20 Prozent von Israels Staatsangehörigen sind Araber, Bürger zweiter Klasse, 13 Prozent der Araber sind Beduinen, Bürger dritter Klasse – und Beduininnen Bürgerinnen vierter Klasse.
Ein Platz zum Sterben
Um in Lakiya, seinem Ursprungsgebiet, wohnen zu dürfen, mußte der Stamm von Amal Elsana Alh’jooj lange Jahre kämpfen. 1952 wurden die Beduinen aus der Lakiya-Region von der israelischen Staatsgewalt in Richtung Jordanien vertrieben. Der Stamm war zäh, widersetzte sich und harrte 40 Tage an der Grenze aus. Man zog vor den Obersten Gerichtshof Israels und wandte sich an die UN. Dem Stamm wurde dann von einer Tel Aviver Behörde eine »Umsiedlungsalternative« in Tel Arad angeboten, nahe des Toten Meers. »Ein Platz zum Sterben«, kommentiert die 35jährige Amal, »ohne Wasser und ohne Gras für die Schafe. Es war sehr hart.« Dort wurde sie in einem Lager geboren. Erst 1976 konnte der Stamm – inzwischen auf 700 Menschen angewachsen – nach Lakiya zurückkehren. Damals war Amal vier Jahre alt: »Es war wie ein Traum«, erinnert sie sich an die Rückkehr, »alle Autos waren mit palästinensischen Flaggen geschmückt.«
Die erste Karriere von Amal in Lakiya war die einer Schäferin. Sie war fünf Jahre alt, »ein Mädchen der Wüste«. Es hieß: Aufstehen um 5.30 Uhr, dann durch die Steppe mit der Herde, abends zurück nach Hause. Zeit zum Lernen blieb nicht übrig. Doch fühlte sie in der Wüste Weite, Sicherheit und Geborgenheit, war irgendwie in der kargen Landschaft aufgehoben. Bis sie 14 Jahre alt und ihr bewußt wurde, daß etwas falsch läuft. »Die Wüste akzeptierte mich als Mädchen, die Menschen aber nicht.« Die fünf Söhne ihres Vaters, eines Hirten und LKW-Fahrers, durften weiter zur Schule gehen, sie nicht. »Wegen der Tradition«, hieß es.
Jahrelang hatte sie in Tel Sheva, einem der sieben genehmigten Beduinen-Dörfer, die Elementarschule besucht, war eine brillante Schülerin: »Ich verschlang Bücher«, meint sie, um zu ergänzen: »Und ich war eine Ruhestörerin.« Sie rebellierte gegen die Unterdrückungsverhältnisse, denen die Mädchen und Frauen ausgesetzt waren, und entwickelte erste Aktivitäten, brachte Frauen das Lesen und Schreiben bei – ihre eigene Mutter wurde zu ihrer ersten Schülerin. Amal sah auch nicht ein, daß Männer Räumlichkeiten zur Entwicklung ihrer Aktivitäten von der Beduinen-Gemeinschaft bekamen, Frauen aber nicht. Sie war inzwischen 17.
1993 gründete sie eine Frauenorganisation mit, es ging um ein Stickerei-Projekt, das mit sieben Frauen in Lakiya startete. Sticken – Amal ahnt schon die Frage der Europäerin –, ob das nicht wieder etwas typisch weiblich sei? Und sagt gleich, es sei wichtig, von dem Stand auszugehen, auf dem sich die Menschen befinden. Die Arbeit bringe Selbständigkeit, auch Kraft und Bewußtsein: »Sticken, weben ist eine Art und Weise, auf die sich Beduininnen ausdrücken: mit Kleidern, Farben und Design.«
Stickerei sei eben nicht nur Modesache: »Politische Meinungen und persönliche Gefühle werden dabei ausgetauscht – zum Beispiel zum Sechs-Tage-Krieg zwischen Israel und Ägypten im Juni 1967, als die israelische Armee 1967 die ägyptische Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, die Westbank und Ost-Jerusalem sowie die syrischen Golan-Höhen besetzte. Oder Sabra und Shatila.« In den palästinensischen Flüchtlingslagern wurden am 16.September 1982 etwa 1500 Menschen in einer einzigen Nacht von libanesisch-christlichen Milizen ermordet. Israelische Soldaten sahen dem Massaker tatenlos zu. »Herzlichen Glückwunsch! ›Operation Freunde‹ ist genehmigt«, erklärte damals Ariel Scharon, seinerzeit Verteidigungsminister, der den Einmarsch in den Libanon befohlen hatte. Lakiya steht inzwischen für eines der 52 Projekte, die es heute gibt und an denen 52000 Beduininnen beteiligt sind, nicht zuletzt durch Amals’ Engagement.
1993, da war Amal auch eine der ersten Beduininnen an der Universität von Beer Sheva, die ein Studium der Sozialwissenschaften belegten. Sie war engagiert, organisierte Demonstrationen gegen die Zerstörung von Häusern und das Ausreißen von Olivenbäumen im Auftrag der Regierung in Tel Aviv. Sie tat das, was ihr Vater eigentlich immer selbst tun wollte, sagt sie: »Es gab zwei Stimmen in meinem Vater – die eine verbot traditionsgemäß der Tochter die Öffentlichkeit, die andere begrüßte ihr Engagement.«
Heute wohnt Amal Elsana Alh’jooj in Beer Sheva, Metropole der Negev-Wüste, 200 000 Bewohner, viele Hochhäuser, jede Menge Lärm und Chaos, eine Universität und ein Beduinenmarkt, »eine heiße und häßliche Stadt« – so der Reiseführer Lonely Planet, der nicht ganz unrecht hat. Amal würde gern weiter in ihrer geliebten Wüste, in Lakiya leben, »aber dort kann ich als Frau nicht einfach gegen Mitternacht nach Hause kommen«, sagt die vielbeschäftigte Frau eines Bürgerrechtsanwalts, Mutter von Zwillingen und Community Leader – von wegen der »bösen Zungen«.
Amal bedeutet Hoffnung
Im Büro von »Nisped«, des Negev-Instituts für Strategien des Friedens und der Entwicklung, das sich in der neunten Etage des Golden Tulip Hotels befindet, hat sie sich ein Stündchen für uns freigeschaufelt – zwischen zwei Sitzungen.
Amal Elsana Alh’jooj ist eine anerkannte und vielgefragte Politikerin, Initiatorin, Leiterin von unzähligen Organisationen wie des Arab-Jewish Center for Equality, Empowerment and Cooperation, eine Abteilung von Nisped, die Partnerschaftsprojekte zwischen Juden und Arabern, Gemeinschaftsprogramme zur Selbsthilfe und Weiterbildung für Kleinunternehmen fördert. Eine erfahrene Frau, die in den vergangenen 15 Jahren der Arbeit vor Ort wichtige Impulse gegeben hat. Dafür bekam sie Auszeichnungen und viel Anerkennung, gehörte 2005 zu den 1000 Frauen, die für den Friedensnobelpreis nominiert wurden.
Kein Grund zum Ausruhen, sagt Amal, die sich »palästinensische Bürgerin Israels« nennt, von der Lebensart her Beduinin, von der Nationalität Araberin, Muslimin von der Religion her, zudem Frau und Mutter und Internationalistin. »Jeden kleinsten Fortschritt müssen wir erkämpfen, manches geht eben über den Obersten Gerichtshof«, sagt sie. Hinzu komme die Auseinandersetzung mit der äußerst patriarchalen Beduinen-Gesellschaft, in der Frauen allein für Kindererziehung und Haushalt zuständig sind und kaum die Möglichkeit haben, das Dorf zu verlassen.
Amal verhehlt nicht, daß sie oft in Konflikt mit ihrer Familie gerät – einer Familie, die sie liebt und in der Zusammenhalt und Geborgenheit bestimmend sind. Als sie Sprecherin der Gemeinschaft wurde, erntete sie Empörung, und es kam auch Eifersucht auf: »Ein neidischer Vetter zündete das Auto meines Vaters an, weil seine Tochter eine Aktivistin war. Mein Vater hat für meine Selbständigkeit viel zahlen müssen.«
Wenn sie die Familie besucht – dreizehn Kinder von 18 bis 44 Jahren – ist sie als Person willkommen, ihre Politik und ihr Feminismus weniger. Doch habe sie viele harte Diskussionen mit ihren Brüdern – sie seien stolz auf sie, würden sich jedoch zugleich vor ihr fürchten. Auch gebe es harte Diskussionen mit der sonst offenen Mutter und viele Tränen, wenn diese einen Ehrenmord mit den Worten »Sie hat es verdient« entschuldigt. »Das macht mich wahnsinnig«, sagt Amal. Hier würden Verbrechen legitimiert. »Als ob die Ehre einer Gesellschaft von diesem organischen Ding abhängen würde!«
Die Politikerin sieht die Widersprüche in der beduinischen Gemeinschaft schon und versucht, mir zu erklären, warum Frauen wieder verstärkt Kopftuch und Schleier tragen: »Die traditionelle Lebensweise der Nomaden wurde zerstört; wir befinden uns in einer Gesellschaft im Wandel, viele empfinden dies als Bedrohung für die Traditionen und die Kultur. Und greifen auf überholte frauenfeindliche Traditionen zurück.«
Amal sieht eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin, den Beduininnen zu mehr Bildung zu verhelfen, und empfindet eine große Verantwortung, ihre Stimme zu erheben, Rechte einzufordern und gleiche Voraussetzungen und Lebensbedingungen zu schaffen – für Beduinen wie für Juden. Sie selbst ist ein Beispiel für eine gebildete und selbstbewußte neue Generation von Beduininnen. Der Name Amal bedeutet übrigens Hoffnung.