Die Geschichte der Genossenschaften ist in allen Ländern durchaus unterschiedlich verlaufen, und auch einige Genossenschafts-Vordenker sind durchaus typisch für ein bestimmtes Land – was Charles Fourier in Frankreich war Robert Owen in England.
Richard Saage – Jg. 1941, Politikwissenschaftler, Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – veröffentlichte 1999 in der Zeitschrift „Utopie kreativ“, Heft 107 (September) einen ebenso langen wie erhellenden Text über Robert Owen:
Vom philanthropischen Unternehmer zum utopischen Visionär. Robert Owens Utopie der »neuen moralischen Welt« (1)
I.
Robert Owen zu Ehren wurde auf dem Kensal Green Friedhof in London ein Gedenkstein errichtet, der folgende Inschrift trägt: »Er begründete und organisierte Kinderschulen. Er sicherte Frauen und Kindern eine Arbeitszeitverkürzung in den Fabriken. Er war ein früher liberaler Vorkämpfer des Aufbaus eines nationalen Bildungssystems. Er arbeitete hart daran, ein internationales Schiedsspruchverfahren voranzubringen. Er war einer der prominentesten Engländer, der die Menschen lehrte, einen höheren sozialen Status dadurch anzustreben, daß die Interessen von Kapital und Arbeit zu versöhnen sind. Er widmete sein Leben und ein großes Vermögen dem Ziel, seine Landsleute durch Erziehung, Selbstbewußtsein und moralische Würde zu verbessern. Sein Leben war geheiligt durch menschliche Zuneigung und noble Taten«. (2) Zweifellos gilt das viktorianische Pathos dieses Nekrologs mehr dem philanthropischen Unternehmer als dem Utopisten Owen: Er schreibt den Ruhm und die gesellschaftliche Anerkennung fort, die sich der Fabrikherr Owen in seinem Musterbetrieb in New Lanark erwarb, als er der Welt in der Frühphase der industriellen Revolution zeigte, daß sich gewinnorientiertes Wirtschaften und eine weitgehende betriebsnahe Sozialpolitik nicht ausschließen müssen, sondern einander ergänzen können: »Minister, Gesandte, Prinzen, Könige und Kaiser interessierten sich für seine erfolgreichen Reformen; der König von Preußen verlieh ihm die Goldene Medaille und der Kaiser von Rußland gewährte ihm den kaiserlichen Schutz«.(3) Nach eigenen Angaben hat ihm der Großherzog von Rußland und spätere Zar Nikolaus den Vorschlag unterbreitet, aus dem überbevölkerten England zwei Millionen Menschen nach Rußland auswandern zu lassen, damit dort unter der Leitung Owens ein neues New Lanark aufgebaut werden könne. (4) Bis 1824 sollen jährlich bis zu 2000 Besucher eine Art Wallfahrt zu diesem Musterbetrieb unternommen haben.
Doch so anerkannt der Sozialreformer Owen im zeitgenössischen Kontext auch war, so umstritten blieb sein utopisches Denken, das mit dem Scheitern seiner parlamentarischen Reforminitiativen und dem Ende seiner unternehmerischen Tätigkeit sein gesellschaftliches Engagement zunehmend beherrschte. Auf der Idee von der vollkommenen Linken warfen ihm Marx und Engels vor, er habe die Notwendigkeit des Klassenkampfes ebensowenig erkannt wie die welthistorische Rolle des Industrieproletariats als revolutionäres Subjekt der Transformation des Kapitalismus in den Sozialismus. Und im konservativen Spektrum kritisierte ihn Friedrich Gentz mit den Worten: »Wir wissen wohl, was sie wollen, aber wir wollen nicht, daß die Massen wohlhabend und unabhängig werden. Wie sollen wir sie dann regieren?«(5)
Was ist uns über die Biographie dieses Mannes bekannt (6), der wie niemand vor ihm die Möglichkeiten der bürgerlichen Öffentlichkeit nutzte, um durch Vorträge und Schriften das Publikum »für seine Pläne zu gewinnen«? (7) J.F.C. Harrison unterteilte Robert Owens Leben in sechs Abschnitte, die jeweils einem dominanten Thema oder Projekt gewidmet waren. (8)
Die erste Periode von 1771 bis 1799 umfaßt seine Kindheit. Geboren in Newtown, Montgomeryshire (Wales), als Sohn eines Sattlers, Eisenwarenhändlers und Postmeisters verließ er nach seiner Schulausbildung mit zehn Jahren das Elternhaus, um – nach einem kurzen Aufenthalt in London – eine dreijährige Ausbildung als Verkäufer in Stamford anzutreten. Um 1788 zieht er nach Manchester um, wo er bei einer Textilfirma arbeitet. Nach kurzer Zeit gründet er mit dem Mechaniker John Jones eine eigene Baumwollspinnerei. Ab 1795/96 avanciert Owen zum Gründer und Geschäftsführer der großen »Charlton Twist Company«: Zum Manchester Establishment gehörend, hat er es bereits mit 25 Jahren zum »wohlsituierten Bürger und Fabrikherrn« (9)gebracht, der sich zudem in der Literarischen und Philosophischen Gesellschaft der Stadt engagiert und sich dort durch seine Diskussionsbeiträge einen Namen macht. 1799 kauft er mit seinen Teilhabern die »New Lanark Twist Company« in Schottland von David Dale, dessen Tochter Caroline er ein Jahr später heiratet.
Die Zeit zwischen 1800 und 1824 stellt den erfolgreichsten Lebensabschnitt in Owens Biographie dar. In diesen Jahren entwickelt er New Lanark zu einer Muster-Fabrik und verdient gleichzeitig ein Vermögen. »Owens Karriere war eine der großen Erfolgsgeschichten der frühen industriellen Revolution«.(10) Doch bereits um 1812 beginnt sich Owen vom gewöhnlichen Muster eines Industriellenlebens zu lösen. Sein Denken wird zunehmend von seinen Erziehungsideen und seinen sozialen Konzepten zur Hebung des Lebensstandards der abhängig Beschäftigten beherrscht, die er nun von der Betriebsebene auf die Gesamtgesellschaft übertragen will. Insbesondere nach dem Napoleonischen Krieg vollzieht sich die endgültige Wandlung Owens vom bürgerlichen Sozialreformer zum utopischen Visionär. In dem Maße, wie sich seine Pläne für eine Rekonstruktion der Gesellschaft konkretisieren, wird seine Kritik an den bestehenden sozialen gesellschaftlichen Verhältnissen immer radikaler. Die Folgen dieser Entwicklung las- sen nicht auf sich warten: Große Teile der englischen Oberschicht und die Kirche, die Owens Experiment in New Lanark bisher große Sympathie entgegenbrachten, distanzieren sich von ihm. Nachdem er seine Bemühungen, durchgreifende soziale Refor- men durch die parlamentarische Gesetzgebung zu erreichen, ent- täuscht sieht, gibt er das Projekt in New Lanark auf, um in Ameri- ka eine Kommune zu gründen. In dieser kommunitarischen Phase seines Lebens (1824-1829) bricht er seine langjährigen Beziehungen zur Geschäftswelt endgültig ab. Stattdessen festigt sich sein Ruf als utopischer Sozialreformer mit überzeugten Schülern auf beiden Kontinenten. Vier Fünftel seines Vermögens investiert er in die Kommune von New Harmony, Indiana. Doch dieses Experiment scheitert ebenso wie der Plan des Aufbaus eines ganzen Staates nach seinen Ideen in Mexiko. Owen kehrt nach England zurück, wo seine Ideen für fünf Jahre (1829-1834) die englische Gewerk- schaftsbewegung prägen. Zwar gelingt es ihm 1834, die englischen Gewerkschaften in einem zentralen Dachverband zu einigen. Doch der entschlossene Widerstand der Unternehmer und des Staates bewirken den raschen Zusammenbruch dieses Projekts. Die jetzt folgende Periode zwischen 1835 und 1845 steht im Zeichen der Herausbildung einer sektiererischen Organisation von Anhängern Owens, in denen er die Rolle eines Patriarchen spielt. Sich dem Spiritualismus zuwendend, wirbt er gleichzeitig in den letzten Jahren seines Lebens durch zahlreiche Schriften und Vorträge weiter ungebrochen für seine Ideen. 1858 stirbt er in seinem Geburtsort Newtown. Kurz vor seinem Tod hat er folgendes Fazit seines Lebens gezogen: »Mein Leben war nicht nutzlos. Ich habe der Welt Wahrheiten gebracht; wenn sie nicht danach handelte, so hat sie sie nicht verstanden. Ich aber bin meiner Zeit voraus«.(11)
Robert Owen hat ein umfassendes literarisches Werk hinterlassen. Insgesamt sind weit über hundert gedruckte Bücher, Pamphlete, Reden und Streitschriften bibliographiert worden, die in Zeitschriften veröffentlichten Artikel nicht mitgezählt. Auch die Sekundärliteratur ist seit dem frühen 19. Jahrhundert kaum noch zu überblicken. Trotz dieser großen Resonanz, die Robert Owens Denken bis auf den heutigen Tag für sich reklamieren kann, steht eine Edition seiner gesammelten Werke noch immer aus. Doch unbestritten ist, daß Owens »The Book of the New Moral World« (1836-1844) als die »Bibel« seiner Anhänger galt: Tatsächlich wird in diesem Buch das utopische Denken Owens am prägnantesten zusammengefaßt. Einige Jahre nach seinem radikalen Experiment in New Harmony entstanden, erhellt diese Schrift in idealtypisch reiner Weise die gemeinsame Schnittmenge, die Owens Denken mit der klassischen Utopietradition teilt.
Wie schon Morus vor ihm, so ging auch Owen von der Annahme aus, die zivilen und militärischen Eliten hätten sich zu einem Machtkartell der Gewalt und des Betrugs verbunden, das die staatliche Gewalt dazu mißbrauche, die große Masse der Bevölkerung im Zustand der Armut, der Uneinigkeit, des Verbrechens, des Elends und der sozialen Degradierung zu halten (V 17). Die Gesellschaft, so konstatierte Owen, sei ein Chaos. Sie biete ein Szenario der Unordnung und der äußersten Verwirrung. Es gebe keine Verbindung der Teile, keine Ord- nung und Harmonie. Ein rationales Ziel der Gesellschaft, das jeder begreifen könne, fehle (II. 46). Wie konnte es nun aber zu der Herausbildung eines sozio-ökonomischen Systems kommen, dessen Schrecken in der Sicht Owens selbst die feudalen Beziehungen zwischen Bauer und Grundherr in einem rosigen Licht erscheinen läßt?
Owen schloß zwar die Notwendigkeit oder Nützlichkeit des Privateigentums vor der wissenschaftlich-technischen Entfaltung der materiellen Produktivkräfte nicht grundsätzlich aus. Unter den Bedingungen der Industrialisierung jedoch sei es ein unnötiges und durch nichts relativierbares Übel (VI 42). Dieses Übel bestehe darin, daß es das Bewußtsein und den Charakter seines Besitzers in vielfacher Weise depraviere. Es rufe in ihm Stolz, Eitelkeit, Ungerechtigkeit und den Hang zur Unterdrückung hervor, und zwar in völliger Mißachtung der natürlichen und unveräußerlichen Rechte seiner Mitmenschen. Es enge die Sichtweise des Privateigentümers auf den engen Kreis seines eigenen Ichs ein und hindere ihn daran, die großen allgemeinen Interessen wahrzunehmen, ohne die eine Verbesserung der Lebensbedingungen aller nicht möglich sei (VI 41). In dem Maße also, in dem der Industrialisierungsprozeß den egoistischen Erwägungen der Fabrikherren unterworfen sei, stehe eine weitere Verschärfung der gesellschaftlichen Verelendungstendenz auf der Tagesordnung.
Owen sah aber nicht nur den wissenschaftlich-technischen Fort- schritt durch die vom Privateigentum bewirkte Depravation des Bewußtseins der Unternehmer gefährdet; auch die gesellschaftliche Form der von der Verfügung über Privateigentum bestimmten Produktionsverhältnisse liegt ihm zufolge quer zu den Interessen der Gesamtheit. Diesen Zusammenhang suchte Owen durch die These zu belegen, daß große Teile des möglichen gesellschaftlichen Reichtums ungenutzt bleiben: Darüber hinaus würden unge- heure Summen nutzlos verschwendet werden. Im einzelnen nennt Owen folgende Beispiele: Eine Ressourcenvergeudung größten Stils gehe auf den aufwendigen Distributionssektor zurück, der nach dem Marktprinzip arbeite. Auf Grund des profitorientierten Handels existierten in den Dörfern, Städten und Metropolen mehr Warenhäuser und Läden, als notwendig sind. Diese Form der Verteilung entziehe nicht nur der Produktion wertvolle Arbeitskräfte; sie laufe auch auf eine ungeheure Verschwendung von Zeit hinaus. Zugleich laste sie den Konsumenten die Kosten dieser Verteilung auf: Die Folge sei, daß der Preis der Ware ein Vielfaches der Herstellungsinvestition betrage. Auch veranlasse der Konkurrenzdruck die Händler, die Qualität der zu verkaufenden Artikel zu mindern. Darunter müßte insbesondere die Unterschicht leiden, weil der Konsum dieser minderwertigen Waren die Gesundheit vieler Arbeiterinnen und Arbeiter ruiniere und oft den frühzeitigen Tod herbeiführe. Auch unterböten sich viele konkurrierende Händ- ler zu Lasten der Produzenten in der Herabsetzung ihrer Preise, um ihre Kundschaft zu erhalten (II 21 f).
Sodann werde durch eine falsche Ausbildung an Schulen und Universitäten, die der bloßen Reproduktion der bestehenden Klassengesellschaft diene, ein unendliches Potential intellektueller und materieller Ressourcen verschwendet (II 14, VII. 61). Noch schwerer wiege, daß das bestehende Ausbildungssystem die in den arbeitenden Klassen schlummernden geistigen Potenzen überhaupt nicht berücksichtigt (VII 61). Stattdessen verdeutliche die Industrialisierung zunehmend die destruktiven Elemente des individua- listischen Prinzips in der Wirtschaft: Es stehe im Gegensatz zur Entwicklung einer höheren Qualität der Menschheit, weil es jedes Individuum zur offenen Feindschaft gegen seine Mitmenschen zwinge und auf diese Weise die einzelnen zu selbstsüchtigen Wesen mache. Und schließlich komme die bestehende Klassengesellschaft ohne ein machtvolles System der Gewalt und der Manipulation (fraud) nicht aus. Die Aufrechterhaltung dieses Repressionsapparats verschlinge jährlich ebenso gewaltige Summen wie die enormen Ausgaben für die Armeen und Kriegsflotten. Ebenso bedeutsam seien freilich die Kosten zu Lasten der Gesellschaft für den Aufbau und den Einsatz dieser Kriegsmaschinerie (VII. 59).
Owen war davon überzeugt, daß dieses in seinen Augen irratio- nale System an seinen eigenen Widersprüchen und Konflikten zerbrechen werde. Doch was wollte er an dessen Stelle als Alternative anbieten? Zweifellos folgte er der utopischen Tradition seit Morus, wenn er sein Ideal einer besseren Welt antithetisch den kritisierten Verhältnissen seiner Zeit konfrontiert. Der Übergang von der rohen, irrationalen und chaotischen Gesellschaft der Gegenwart zum rationalen Gemeinwesen der Zukunft werde jedermann die Differenz zwischen den Extremen des Irrtums und des Elends einerseits und der Wahrheit und der Harmonie andererseits vor Augen führen (VI 64). An die Stelle des Mißtrauens, der Unordnung und der Uneinigkeit trete »eine Superstruktur der Ordnung, der Weisheit und des Glücks« (a superstructure of order, wisdom, and happiness) (V 6). Eines der klarsten Prinzipien des neuen rationalen Gemeinwesens besteht Owen zufolge darin, daß individuelle und allgemeine Interessen unlösbar ineinander verwoben seien (III 17). Zugleich avanciere die Wahrheit allein zur Richtschnur der Regelung der menschlichen Angelegenheiten (I/XVIII): Es ist charakteristisch, daß Owen sie in ähnlicher Weise interpretiert wie Platon. Wie dessen Ideen, so ist die Wahrheit als Fundament des Staates in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft identisch mit sich selbst: Sie enthält niemals einen Widerspruch und stimmt stets in allen ihren Teilen in vollkommener Einheit mit sich selbst überein (II 37).
II.
Die Harmonie, Überschaubarkeit und Transparenz der sozialen Verhältnisse in Owens idealem Gemeinwesen wirft die Frage nach der materiellen Basis auf, die ihnen zugrundeliegt. Owens Antwort deutet darauf hin, daß sich sein Denken ab 1820 in der Tradition des kommunistischen Gemeineigentums bewegt, wie es seit Platon und Morus das Muster der Sozialutopie zutiefst geprägt hat. In der »neuen moralischen Welt« herrschen ökonomische, wissenschaftlich-technische sowie soziale und politische Rahmenbedingungen vor, unter denen das Privateigentum nicht abgeschafft werden muß im Sinne gezielter Maßnahmen (I/X); vielmehr überhole es sich histo- risch von selbst (V 8 f). Angesichts des Überflusses an materiellen Gütern erscheine nämlich die Verteilung des Reichtums unter den Individuen zu ungleichen Teilen und dessen Akkumulation zu individuellen Zwecken ebenso nutzlos und schädlich wie der Versuch, das Wasser und die Luft in ungleichen Mengen an verschiedene Individuen zu verteilen oder diese Güter für die Zukunft zu horten (I/XII). Mit der Einführung des Gemeineigentums verbindet Owen freilich nicht wie die klassische Utopietradition das Eintreten für eine zentralisierte Planwirtschaft. Vielmehr setzt er auf dezentralisierte Produktivgenossenschaften.
Dies vorausgesetzt, zerfällt Owens ideale Gesellschaft in viele überschaubare Einheiten, die durch den Austausch von Gütern und Dienstleistungen miteinander verbunden sind (II 18). Das Minimum und Maximum der Einwohnerzahl dieser Assoziationen schwankt – je nach den örtlichen Verhältnissen – zwischen 500 und 2000 Personen (V 62). Bei drohender Übervölkerung wird Land urbar gemacht, so daß sich neue Assoziationen ansiedeln können (VI 55f). Auch die Siedlungsgröße dieser Genossenschaften ist vorgegeben: Sie bemißt sich an dem Umfang des Landes, das eine Assoziation benötigt, um sich ernähren zu können (ebd.). Keine der Wirtschaftseinheiten ist politisch isoliert: Sie bilden zunächst ein Kirchspiel, die Kirchsprengel wiederum Kreise, aus deren Zusammenfassung Bezirke entstehen usw., bis am Ende die gesamte Welt genossenschaftlich organisiert sein wird. Ein marktorientierter Wettbewerb findet weder zwischen den Genossenschaften noch zwischen den wirtschaftenden Individuen innerhalb der einzelnen Assoziationen statt. Owen war davon überzeugt, daß die Produktion für die Bedürfnisbefriedigung der einzelnen allen anderen Wirtschaftssystemen weit überlegen sei (II 18 f). Das Profitmotiv ersetzte er durch das normative Postulat, daß der größtmögliche Umfang des gesellschaftlichen Reichtums sich in Übereinstimmung mit der Gesundheit und dem Glück der Pro- duzenten zu benden habe und daß er zum Nutzen aller zu ver- wenden sei (III 35). In der Produktionssphäre der Assoziation selbst sah er ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Landwirt- schaft, Industrie und Handwerk vor. Dem Agrarwesen räumte er sogar eine gewisse Priorität ein: Es müsse den höchsten Entwick- lungsstandard erreichen, weil Industrie und Handwerk allein nicht ein einziges Individuum ernähren könnten (II 18).
Grundsätzlich gilt nach Owen für die Produktion der Imperativ, daß die größtmögliche Menge des wertvollsten Reichtums mit ei- nem Mindestmaß an ungesunder oder unbefriedigender Handarbeit innerhalb kürzester Zeit und mit möglichst geringer Vergeudung von Kapital und zum Nutzen aller zu produzieren ist (IV 44). Die Produktion erfolge dann zu einem Preis, der weniger als ein Viertel der gegenwärtigen Kosten an Zeit und Arbeit beträgt. Außerdem seien die Waren von höchster Qualität, weil sie einem strikten Reinheitsgebot unterlägen (II 20). Die Feinstruktur der einzelnen landwirtschaftlichen und industriellen oder handwerklichen Genossenschaftsbetriebe machte Owen abhängig von der Beschaffen- heit des Bodens, des Klimas und anderer lokaler Besonderheiten (II 20). Doch bewege sich die Produktion in jedem Fall auf dem höchstmöglichen technischen Niveau (II 19). Auch müsse jede Assoziation über hinreichende Mittel verfügen, um aus eigener Kraft die dauerhafte Versorgung ihrer Mitglieder zu gewährleisten. Die große Bedeutung, die Owen dem Produktionssektor beimaß, erhellt aus der Tatsache, daß er neben der Distribution, der Erziehung und der Verwaltung zu den vier zentralen Politikfeldern der Gesellschaft der Zukunft gehört. Dies vorausgesetzt, verwundert es nicht, daß Owen das monetäre System als Medium der Distribution der Güter ablehnt. Als die Güterknappheit vorherrschte und die Mittel der Produktion des ge- sellschaftlichen Reichtums schwer zu beschaffen waren, hätten Gold, Silber und Papiergeld eine nützliche Rolle gespielt (VII). Unter den Bedingungen der Überproduktion jedoch habe es die Gesellschaft polarisiert, indem es eine Klasse versklavter Produzenten des Reichtums und eine Schicht verschwenderischer Konsumenten desselben hervorbrachte (I/XXIV). Wenn es überhaupt noch eine Rolle spielte, dann in der Phase des Übergangs von der alten zur neuen Gesellschaft. In der »neuen moralischen Welt« Owens sind demgegenüber alle Tauschäquivalente obsolet. Da Güter aller Art in solchem Überuß produziert werden, daß sie die Nachfrage bei weitem übersteigen, habe sich der in Form von Geld ausgedrückte Preis eines Gegenstandes überlebt: Zum ersten Mal in der Geschichte höre das Glück auf, käuflich zu sein; es gebe jetzt nur noch eine Entsprechung von guten Taten und angenehmen Gefühlen (I/XXIV).
Owen folgte Morus nicht nur in der Vorstellung, daß mit der Abschaffung des Geldsystems Gold und Silber auf ihren wahren Wert zurückgeführt werden: Er liegt unter dem von Eisen und Stahl (V 9). Auch sah er wie die klassische Utopietradition vor, daß jede Assoziation oder Genossenschaft über Magazine und Warenhäuser verfügt, in der alle Kategorien der produzierten Güter sorgfältig ge- lagert und in bester Qualität der Bevölkerung zur sofortigen Kon- sumtion zugänglich gemacht werden (II 25). Die Assoziationen organisierten ohne Mühe die Verteilung durch geeignete Personen selber (V 29). Auf diese Weise hoffte Owen, daß die Distribution der Güter mit einem Minimum an Arbeits- und Transportkosten auskommt: Ein Prozent an Kapital und Arbeit, die das alte Verteilungssystem benötigen, würden mehr als ausreichen, um eine bessere Bedürfnisbefriedigung zu gewährleisten (II 24). Ohne Frage steht und fällt dieses System der Produktion und Distribution ohne Geld, Markt, individuelles Gewinnstreben und Konkurrenz mit der Erwartung einer Überflußgesellschaft, die unbegrenztes Wirt- schaftswachstum verspricht. Diesen Optimismus versuchte er mit folgenden Argumenten zu begründen: 1. Owen optierte für eine vollständige Mobilisierung der Arbeitsressourcen. Wie die älteren Utopisten auch, so sah er ein Grundübel der alten Gesellschaft darin, daß sie aufgrund einer falschen Arbeitsorganisation einen großen Teil des verfügbaren Arbeitspotentials brach liegen läßt. Er verglich in diesem Zusammenhang den Menschen mit einer komplizierten, komplexen und lebendigen Maschine. Unter günstigen Voraussetzungen arbeite sie höchst effizient und harmonisch. Werde sie aber nur arbeitsteilig eingesetzt, so erreiche sie das Gegenteil: Da nur einige Teile dieser Maschine arbeiten, verkümmerten ihre Energien (III 30 f). Demgegenüber schafften in der »neuen moralischen Welt« Maschinen die Voraussetzung einer Überwindung der Arbeitsteilung: Sie produzierten Nadeln, Bolzen oder andere noch wertlosere Gegenstände, zu deren Herstellung in der alten Gesellschaft die menschlichen Potenzen geopfert werden müßten (III 22). Indem ferner jeder eine seinem Alter entsprechende Tätigkeit verrichte, übe er sie in hochqualizierter Weise freiwillig und fröhlich aus (V 65). Diese Motivation erfahre noch dadurch eine Verstärkung, daß Wissenschaft und Technik die menschenunwürdige Arbeit wegrationalisierten (VI 22): Jeder einzelne profitiere nun von der Ausbildung, die ihn befähige, genausoviel Vergnügen bei der Produktion wie bei der Konsumtion des gesellschaftlichen Reichtums zu empfinden (I/XIV). Und schließlich reichten angesichts der zu erwartenden Steigerung der wissenschaftlich-technischen Produktivkräfte vier Stunden angenehmer Arbeit aus, um einen Überfluß an qualitativ hochwertigem Reichtum zu produzieren (VI 40).
2. Die älteren Utopisten orientierten sich am klassischen Vorbild einer »besten Verfassung« und der Tugend der Bürger. Innerhalb dieses normativen Rahmens beschrieben sie die Institutionen und die von ihnen von Anfang an positiv aufgewertete Rolle von Naturwissenschaft und Technik in ihren idealen Gemeinwesen. Owen ersetzt dieses normative Ideal durch den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt selbst und erhebt ihn zum eigentlichen Fun- dament der neuen Gesellschaft. Einerseits erstreckt sich die exakte Wissenschaft nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die Anthropologie der Menschen und ihre reale Vergesellschaftung: Zum ersten Mal in der Geschichte, so Owen, sei es realistisch, daß die sozialen Prozesse unter der Kontrolle von Sozialingenieuren stehen, »die die Operationen der Gesellschaft beeinussen und lenken« (II 7). Andererseits verallgemeinern die wissenschaftlich-technischen Einrichtungen (scientic arrangements) den gesellschaftlichen Reichtum auf einem so hohen Niveau, daß er die Bedürfnisbefriedigung des Menschengeschlechts übersteigt und der Konkurrenz, dem Streben nach individueller Akkumulation sowie der gesellschaftlichen Ungleichheit den Boden entzieht (I/XX, II 19).
3. Die ältere Utopietradition ging in der Regel von einer rigiden Ethik des Konsumverzichts aus, der einer Ablehnung materialistisch-hedonistischer Lebenseinstellungen insgesamt entsprach. Demgegenüber sieht Owen das Streben nach Glücksmaximierung in der anthropologischen Struktur der Menschen verankert (III 2). Das Leben der Individuen in der neuen Gesellschaft werde eine ununterbrochene Kette von Vergnügen und vernünftiger Unterhaltung ermöglichen (VI 49). Ihr Wohlbefinden steigere sich in diesem irdi- schen Paradies in einem Maße, daß der menschliche Geist in seinem depravierten und bornierten Zustand unfähig sei, es sich auch nur vorzustellen (V 78). Jedermann verfüge dann über Mittel zur Steigerung seines Vergnügens (means of progress and enjoyment increased), die diejenigen eines Potentaten in der individualistischen Konkurrenzgesellschaft mindestens zwei- bis viertausend Mal übersteigt (II 47). Die von der Vernunft gesetzte Konsumgrenze sah Owen lediglich darin, daß der rationale Mensch sich niemals in der Befriedigung seiner Neigungen irre: Er treibe seinen Konsum nur so weit voran, wie es der Sicherung seiner Gesundheit und seines höchsten, d.h. moralisch geläuterten Vergnügens dient (III 23 f.). III. Wie kann nun die politische »Superstruktur« (superstructure) charakterisiert werden, die sich über das System der materiellen Reproduktion des »besten« Gemeinwesens Owens erhebt? Wie die meisten Utopisten sieht Owen die eigentliche Grundlage des politi- schen Gemeinwesens in der Struktur der Geschlechterbeziehung: Sie sieht die völlige Gleichstellung der Frauen mit den Männern (VI 26) bei der Wahrung ihrer Lebenschancen in Politik, Wissenschaft, Kultur etc. vor. In Owens »neuer Gesellschaft« gibt es kein anderes Motiv für die Vereinigung der Geschlechter als die gegenseitige Liebe: Ihrer Erfüllung stehen keine künstlichen Hindernisse wie Standesunterschiede etc. im Wege; im Gegenteil: Sie erhält von der Gesellschaft jede nur denkbare Unterstützung, um ihr Dauer zu verleihen (V 71). Die Gründe der Rivalität und der Eifersucht entfallen, weil jeder die Ursachen dieser Affekte kennt und gelernt hat, ihnen eine positive Wendung zu geben (VI 9). Sollte aber dennoch eine Trennung unvermeidbar sein, so wird sie rasch und ohne Nachteile für die Beteiligten und die Gesellschaft vollzogen (V 71).
Zugleich verändert sich die Struktur der Familie grundlegend: Die Funktionen der Hausarbeit und der Erziehung werden aus ihrem Binnenraum herausgelagert und der Assoziation übertragen. Wie einerseits Gemeinschaftsküchen die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten, so wird andererseits das Erziehungsrecht den Genossenschaften übertragen. Vor den eigensüchtigen Interessen der Familie, der religiösen Sekten, Klassen und Parteien geschützt, erwartete Owen von der Erziehung in den öffentlichen Kindergärten wahre Wunder: Sie lege die psychischen und intellektuellen Grundlagen des »neuen Menschen«. Nach seiner weiteren Entfaltung in den sozio-politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Institutionen der »neuen moralischen Welt« erreichten sie eine Vollkommenheit, daß sie den Individuen der bürgerlichen Gesellschaft in jeder Hinsicht im Verhältnis 1:100 überlegen seien. (VI 23). Der solchermaßen mit einem »neuen Bewußtsein« (a new mind) und einem »neuen Geist« (a new spirit) ausgestattete Mensch könne nun das alte Menschheitsziel, ein »irdisches Paradies« (terrestrial paradise) (II 35) zu schaffen, erfolgreich in Angriff nehmen.
Die den patriarchalisch-autoritären Kern der traditionellen Ehe- und Familienstruktur auflösende Form der Geschlechterbeziehun- gen, die Owen seinem politischen System im engeren Sinne verordnet, bestimmt auch dessen Struktur: Sein ideales politisches Gemeinwesen verlegt die zentralisierte, über der Gesellschaft stehende Staatsgewalt in die Assoziationen selbst. Nur mit dem Mittel gewaltfreier Überzeugung ausgestattet, bilden die Genossenschaften basisnahe Regierungsausschüsse für innere und äußere Angelegenheiten im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. Die Politikfelder der Innenausschüsse (domestic government) umfassen den gesamten Bereich der Wirtschaft (Produktion, Distribution, Konsumtion), der Wissenschaft und Technik, der Erziehung sowie der Freizeit- gestaltung (VI 66). Die Mitglieder der Ausschüsse für Außenbezie- hungen empfangen Besucher und Delegierte anderer Assoziationen oder Genossenschaften und pflegen die gegenseitigen Kontakte. Sie beschließen mit den Vertretern der anderen Genossenschaften den Bau oder die Renovierung von Straßen. Auch tauschen sie den erwirtschafteten Überschuß untereinander aus. Ferner sind sie zuständig für den Transfer neuer technischer Erndungen, Entdeckungen etc. Und schließlich helfen sie beim Aufbau neuer Assoziationen, deren Bewohner sich aus der Überbevölkerung der bestehenden Genossenschaften rekrutieren (VI 76).
Doch zugleich war sich Owen darüber im klaren, daß die Regie- rung der Übergangszeit, in der die Transformation des alten in das neue System stattfindet, ohne Stärke und Entschlossenheit (energy and decision) (II 42) ihre schwierigen Aufgaben (II 43) nicht würde erfüllen können. In dieser Phase komme es darauf an, daß die fähigsten Männer und Frauen, durch Wahlen vermittelt, in die Regierungsfunktionen gelangen, um den Wandel vom gegenwärtigen Chaos der Unbeständigkeit zum rationalen Gemeinwesen (rational state) rasch und gewaltfrei herbeizuführen (VI 61). Aber charakteristisch für Owen ist auch, daß er die demokratischen Wahlen als Modalität der Legitimation von Herrschaft und als Mittel der Rekrutierung politischer Eliten in seiner vollendeten rationalen Gesellschaft ablehnt: Sie trügen nicht dazu bei, das größte Übel, nämlich die Uneinigkeit unter den Menschen, zu beseitigen. Weder könne die Welt, so lautet seine zentrale These, gut und friedlich regiert noch die Einheit des Gemeinwesens erhalten werden, solange die Inhaber von Regierungsfunktionen (governor) gewählt (elected or selected) sind.
Owen teilte zweifellos die Skepsis Platons gegenüber der Demokratie, wenn er bei der Bestellung der Ämter das demokratische Wahlrecht durch das Anciennitätsprinzip (V 65) ersetzte: In ihm allein sah er die Garantie dafür, daß eine gemeinwohlorientierte Politik auf Dauer gestellt wird. Erst nachdem jeder einzelne bis zu seinem 30. Lebensjahr als Erzieher, Produzent und Verteiler des gesellschaftlichen Reichtums Erfahrungen gesammelt hat, billigt Owen ihm die Reife zu, in die Schicht der amtsfähigen Bürger aufzusteigen. Zur politischen Klasse im engeren Sinne gehören freilich erst die über 60jährigen: Da sie über den größten Überblick und über das umfassendste Wissen verfügen, treffen sie – auch wenn sie nicht mehr unmittelbar politisch aktiv sind – in allen möglichen Konfliktfällen die denitive Entscheidung. Es ist nicht übertrieben, wenn man diese Ältesten mit den Philosophen in Platons »Politeia« vergleicht.
Tatsächlich ist Platons absoluter Primat der Einheit und Homogenität des Gemeinwesens auch die Signatur des politischen Systems der rationalen Gesellschaft Robert Owens. Es erscheint daher nur konsequent, wenn in seinem »besten« Gemeinwesen konfligierende Parteien durch eine »allerhöchste öffentliche Deklaration« abgeschafft werden; ihre Existenz sei der fundamentalste Irrtum, auf dem alle bisherigen Gesellschaften basierten (I/IX). Als Instrumente des Austrags gesellschaftlicher Interessenkonflikte sei ihnen ohnehin der Boden entzogen, weil die gesellschaftlichen Ursachen konfligierender Interessen entfallen und sich die »neuen Menschen« a priori gemäß dem »bonum commune« verhalten. Die Zusammenkünfte der Amtsträger gleichen denn auch einem Familientreffen von Brüdern und Schwestern. Lange Reden werden nur selten gehalten: Was zählt, ist ausschließlich wirkliches Wissen. Undurchdachte Ideen äußert niemand. Man hört den erfahrensten Funktionsträgern zu, nimmt ihre Pläne zur Kenntnis und diskutiert sie auf höchstem Informationsniveau, um in der Regel einstimmig zu entscheiden. Treten Schwierigkeiten in einigen Details auf, so wird die Angelegenheit an den Ältestenrat (committee of the old) weitergeleitet. Der Entscheidung, die er trifft, stimmen dann alle Mitglieder der Assoziation zu, »wie die Kinder der Entscheidung ihrer Eltern« (VI 76).
Es steht außer Frage, daß diesem Konzept einer im Prinzip konfliktfreien politischen Willensbildung ein monistisches Vernunftkonzept zugrundeliegt. Daß die Wahrheit pluralisiert in ihren verschiedenen Aspekten von unterschiedlichen Institutionen und Individuen kontrovers artikuliert werden kann, war für Owen kein Thema. Zwar macht er sich immer wieder stark für ungehinderte Meinungs-, Gewissens- und Handlungsfreiheit (z. B. IV 12, VI 16). Doch – in der Tradition Platons stehend – besteht die Prämisse dieser Option darin, daß die Freiheit der einzelnen in nichts anderem bestehe als in der Verwirklichung der Gesetze Gottes und der Natur, die jeder einzelne erkenne und nach denen jeder handle (III 71).
Wenn es trotz der sorgfältigen Erziehung und trotz der vernünftigen gesellschaftlichen Umwelt, in der der einzelne existiert, zu individuellen oder kollektiven Akten der Opposition gegen das Glück der Gesellschaft kommt, so kann auf der Folie des monistischen Vernunftbegriffs Owens dieses Verhalten nur der Ausfluß einer Geisteskrankheit sein: Diese Individuen werden in ein Sanatorium (house of recovery) eingeliefert und so mild wie möglich behandelt, bis ihre geistige Gesundheit wieder hergestellt ist und sie in die Gesellschaft reintegriert werden können (III 7). Andere Meinungsverschiedenheiten in bestimmten Sachfragen werden von kompetenten Schlichtern aufgrund ihrer Sachkompe- tenz einvernehmlich geregelt (III 77).
Die Homogenität und Koniktfreiheit des politischen Systems der rationalen Gesellschaft Owens scheint perfekt zu sein. Um so be- merkenswerter ist es, daß Owen weder auf politische Institutionen noch auf Modalitäten der Koniktregelung gänzlich verzichtet (VI 81). Da solchen Auseinandersetzungen aber keine unversöhnlichen gesellschaftlichen Interessendivergenzen zugrundeliegen, könnten sie rasch und ohne Aufwand diskursiv gelöst werden.
IV.
Wie stellte sich Owen nun, so muß abschließend gefragt werden, die Transformation der individualistischen Konkurrenz-Gesell- schaft seiner Zeit in das rationale Gemeinwesen der Zukunft vor? Owen selbst wandte sich immer wieder gegen den Vorwurf, seine antizipierte Gesellschaft der Zukunft sei nichts weiter als eine Utopie (I/XVIII). Er wollte nicht mit den Utopisten von Platon bis Fourier verwechselt werden (II 48f) und lehnte es ab, die rationa- len Grundsätze seines »besten« Gemeinwesens mit bloßen Ideen im Sinne Platons zu identizieren. Owen forderte vielmehr seine Leser direkt zur Tat auf! Der Sieg sei zum Greifen nahe und die Stunde der Erlösung von den Übeln der alten Gesellschaft stehe unmittelbar bevor (V 80). Die gegenwärtigen Parlamente hätten zu Recht allen Kredit bei den Massen verloren: Um der gegenwärtigen Krise der individualistischen Konkurrenz-Gesellschaft Herr zu werden, reichten endlose Diskussionen nicht aus. Jetzt seien Taten, keine Reden gefordert!
Gleichwohl wandte sich Owen gegen einen ahistorischen Voluntarismus als Motor der Umwälzung. Der Transformationsprozeß ist vielmehr, Hegel vorwegnehmend, durch und durch dialektisch. Owen hat, charakteristisch genug, zu keinem Zeitpunkt seine »neue moralische Welt« als die einfache Negation der kapitalistischen Industriegesellschaft seiner Zeit hingestellt; ihm ging es vielmehr, hegelisch gesprochen, um deren »Aufhebung«. Die rationale Gesellschaft der Zukunft werde im Kern das Potential zur Ermöglichung des Glücks aller verwirklichen, das sich ansatzweise bereits in der alten Gesellschaft als nützlich für die Menschen er- wiesen habe (III 45): Er dachte hierbei vor allem an den wissen- schaftlich-technischen Fortschritt und die industrielle Entfaltung der Produktivkräfte (VII 3 ff.). Alle notwendigen Mittel zum Aufbau der rationalen Gesellschaft stünden als Rohmaterial im Schoß der alten Sozietät zur Verfügung: Es komme nur darauf an, sie im Interesse der Gesamtheit zu nutzen (VII 54 f.). Selbst dem wirtschaftlichen Konkurrenzsystem des Individualismus mit seiner kapitalistischen Verwertung des Privateigentums und seinem monetären Geldsystem wird konzediert, daß es eine notwendige und wichtige Rolle in der Geschichte des menschlichen Fortschritts spielte, weil er die Industrialisierung erzwang (V 51).
Doch mit welchen Mitteln und nach welchem Muster sollte dieser Totalumbau der Gesellschaft, der, wie wir sahen, auf eine vollständige Veränderung der Eigentumsverhältnisse, des Wirtschaftssystems, der Familien und des politischen Systems hinauslief, vollzogen werden? Wie schon bei Saint-Simon, aber auch bei Fourier zu beobachten ist, setzte Owen von Anfang an auf eine friedliche Umwälzung, die vom Konsens aller getragen ist (I/XII): Der Wandel werde erfolgen, so betonte er immer wieder, ohne den Geist, Körper oder persönlichen Besitz irgendeines einzelnen anzutasten, welcher Klasse, welchem Rang und welcher Nation er auch angehöre (I/IX f.). Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Initiative der Transformation auch nicht von einer revolutionären Organisation ausgehen, sondern von den jeweiligen Regierungen der Länder, an die die Menschen gewöhnt sind (V 47). Owen setzte dabei unbeirrt auf die Einsicht der Regierungen, daß die Beibehaltung der individualistischen Konkurrenz-Gesellschaft notwendig in Krieg und Chaos enden müsse: eine Perspektive, an der auch die Herrschenden und Privilegierten kein Interesse haben könnten.
Ausgehend von der vieldiskutierten Prämisse seiner Erziehungstheorie, »daß der Mensch seinen Charakter nicht selber bilden kann, sondern daß dieser von ihm gebildet wird«(12), verfügten zudem die Regierungen über die entscheidenden Mittel, die Eigenschaften der Individuen, die unter ihrem Einuß und ihrer Kontrolle stehen, im Sinne der »neuen Ordnung« zu formen (II 35 f.) und so die Umwälzung rasch und ohne Gewalt und Chaos herbeizuführen. Unterstützt würden sie vor allem von den Schichten, die zwar am fleißigsten sind, aber am meisten unter der Unwissenheit, der Armut und den Spaltungen der alten Gesellschaft zu leiden haben: die Unter- und Mittelschichten (the lower and middle classes) (VII 48 f.).
Alles komme darauf an, daß sie sich verbündeten.
In diesem Falle stünden die gesamten Errungenschaften der alten Gesellschaft der zu schaffenden »neuen moralischen Welt« zur Verfügung. Der einzige Grund, der ihr Zusammengehen bisher verhindert habe, sei ihre Unwissenheit gewesen. Die Mittelschicht müsse lernen, die Arbeiterschaft geduldig mit den Prinzipien der neuen Gesellschaft vertraut zu machen. Und die abhängigen Produzenten in den Fabrikhallen stünden vor der Aufgabe, ihre Ignoranz und Vulgarität abzulegen.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, daß Owens utopischer Entwurf nicht jenseits aller gesellschaftlichen Interessenkonstellationen angesiedelt ist. Dadurch, daß sich die aufgeklärten Geister der Mittelschichten kraft ihrer Einsicht in die Struktur der neuen Gesellschaft vom depravierenden Zwang der alten Verhältnisse befreien können, fällt ihnen der Schlüssel zur Umgestaltung der Gesellschaft zu: die Erziehung. Dennoch gibt es Dimensionen im utopischen Denken Owens, die nicht wissenssoziologisch relativierbar sind: Wie niemand vor ihm zu Beginn der Industrialisierung hat er Handlungspotentiale der Industriearbeiterschaft erschlossen, die ihren Niederschlag in einer ihrer Zeit weit vorauseilenden Erziehungskonzeption ebenso gefunden hat wie in der modernen Genossenschafts- und Gewerkschaftsbewegung.
(1) Zitiert wird nach folgender Edition: Robert Owen: The Book of the New Moral World. In seven Parts (1842-1844), New York 1970. Die Owen-Zitate befinden sich im Text. Die erste römische Ziffer kennzeichnet den Band, die zweite arabische oder römische Ziffer die Seitenzahl.
(2 )Zit. n. J.F.C. Harrison: Robert Owen and the Owenites in Britain and America, London 1969, S. 8.
(3) Helmut Jenkis: Sozial- utopien – barbarische Glücksverheißungen? Zur Geistesgeschichte der Idee von der vollkommenen Gesellschaft, Berlin 1992, S. 328.
(4) Robert Owen: Life of Robert Owen. Written by himself, 2 Vols., London 1857/58, S. 146.
(5) Zit. n. Jenkis: Sozialutopien (Anm. 3), S. 328.
(6) Zu Leben und Werk Robert Owens vgl. u.a. Owen: Life (Anm. 4); Thilo Ramm: Die großen Sozialisten als Rechts- und Sozialphilosophen, Stuttgart 1955, S. 384-456; Karl-Heinz Günther: Einleitung zu: Robert Owen, Pädagogische Schriften, Berlin 1955; Harrison: Owen (Anm. 2); G.D.H. Cole: The Life of Robert Owen. New introd. by Margaret Cole, London 1965; Markus Elsässer: Soziale Intentionen und Reformen des Robert Owen, Berlin 1984; Jenkis: Sozialutopien (Anm. 3), S. 324-341.
(7) Georg Weippert: Owen, Robert, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 8, Tübingen, Göttingen 1964, S. 144.
(8) Harrison: Robert Owen (Anm. 2), S. 5ff.
(9) Elsässer: Soziale Intentionen (Anm. 6), S. 51.
(10) Harrison: Robert Owen (Anm. 2), S. 6.
(11) Zit. n. Jenkis: Sozial- utopien (Anm. 3), S. 340.
(12) Zit. n. Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 5, Berlin 1986.



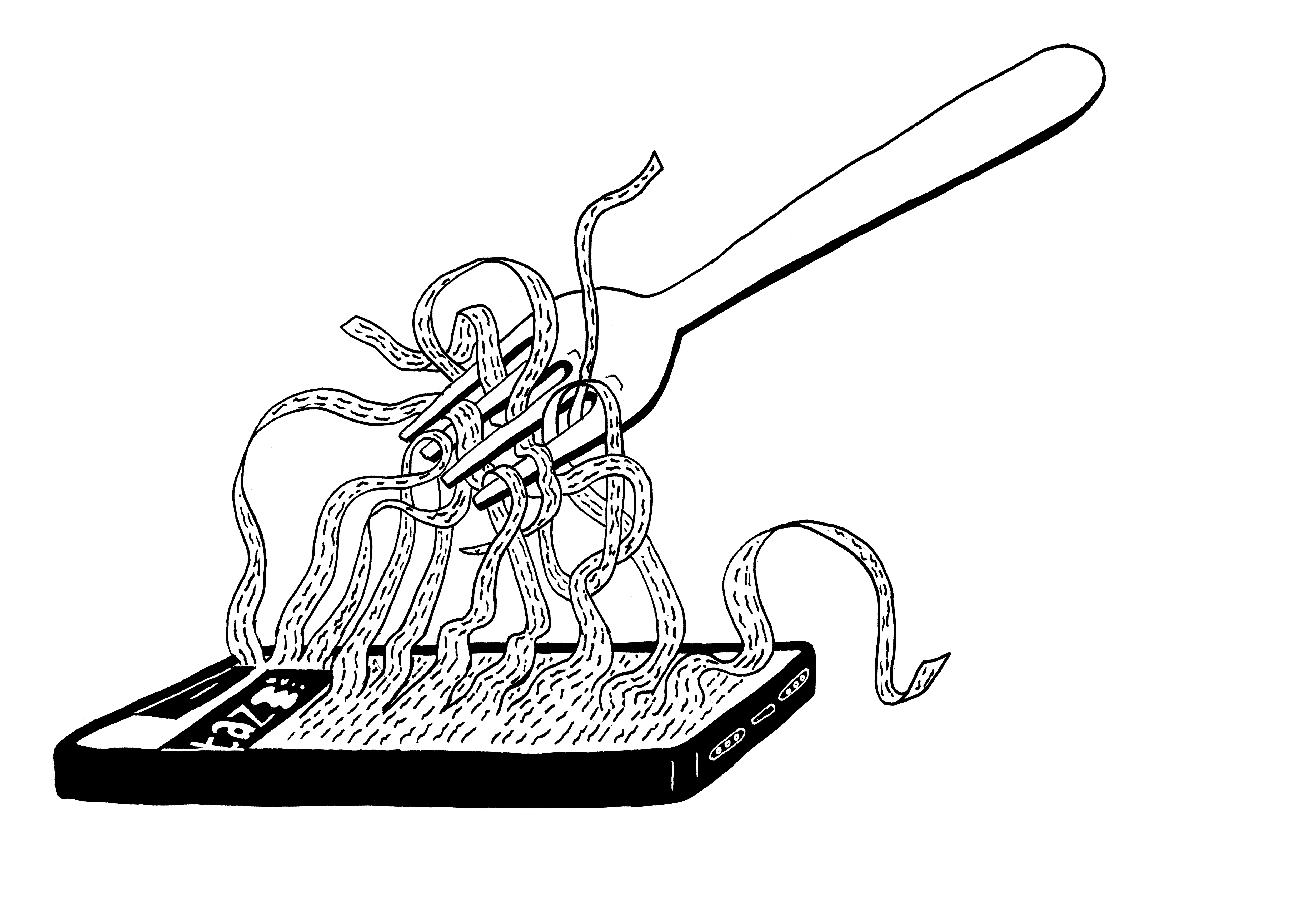
Streng nach Plan
„Die unternehmerische Freiheit ist ein bloßer Irrtum, der auf Informationsmangel beruht!“ (Helmut Gröttrup, UDSSR-Raketenbauer und Siemens-Chefinformatiker)
Mich hat es immer gewundert, dass die Bolschewiki dahin tendierten, die Klassenherkunft derart materialistisch abzuleiten, dass sie sie biologisierten. Wenn etwa die Kinder eines Ausbeuters oder Kulaken als eben solche begriffen wurden. Langsam verstehe ich, dass sich dahinter ein anderes (juristisches) Denken verbirgt. Und dunkel erinnere ich mich an die Konzeption eines Bolschewiki für eine neue proletarische Justiz, die 1970 als Raubdruck zirkulierte. Das Individuum wird darin sozusagen radikal negiert. Es ist völlig vergesellschaftet – allerdings nicht mehr im Sinne einer „Charaktermaske“, sondern als direkter Repräsentant seiner Klasse, seiner Herkunft und Nationalität (n-1). Das berührt sich mit der „Rasse“, diese wird jedoch sogleich durch Rekurs auf die Zahl außer betracht gesetzt, gleichsam überwölbt von „Gleichheit“ und „Planerfüllung“. Darin steckt auch ein schöner Gedanke: Dass jeder jeder sein kann. Mit der Betonung auf „könnte“. In die Wirklichkeit bildete sich jedoch dies ein: „Du schreibst eine Denunziation; du brauchtest sie nicht einmal zu unterschreiben. Alles, was du sagen mußtest, war, daß er Leute bezahlt hatte, um für ihn als Tagelöhner zu arbeiten, oder daß er drei Kühe besessen hatte.“ Die Leute betrachteten die so genannten Kulaken „als Vieh…; sie hätten keine Seelen, sie würden stinken…; sie seien Volksfeinde und beuteten die Arbeit anderer aus…Und es gab für sie keine Gnade, selbst die Kulaken-Kinder waren geringer als eine Laus“, schreibt Wassilij Grossmann 1955 in seiner Abrechnung mit der Kollektivierung der Landwirtschaft und der Liquidierung des Kulakentums als Klasse: „Alles fließt“, die 1989 in der DDR veröffentlicht wurde. Als Klasse liquidieren – das begriff ich als bloße Formel für eine flächendeckende Immobilien- und Bodenreform. In einem quasi offiziellen Roman aus den Dreißigerjahren „Wasja in der Metro“ deckt eine U-Bahn-Baubrigade eine junge Kollegin, obwohl sie herausbekommen hat, dass es sich dabei um ein „Kulakenmädel“ handelt, weil sie derart fleißig mithilft, den Plan zu übererfüllen, dass es einer Selbst-Entkulakisierung gleichkommt. Und das alles ist gut gemeint – in diesem Roman.
Ein solches Ego-Projekt oder vielmehr Wir-Werden strebten im übrigen auch all jene an, die Tagebuch führten – über ihre alltäglichen Bemühungen, ein „Neuer Mensch“ zu werden. Angedacht war dies schon bei den (christlichen) Pfadfindern: „Jeden Tag eine gute Tag“ – und erst recht bei den Jungpionieren dann. Deren veröffentlichte Tagebücher klingen allerdings mitunter so, als hätten ausgereifte Pädagogen sie verfaßt, was in der Tat der Fall war. Dennoch sollte man das „Strebend sich bemühn..“, zumal beim Aufbau des Sozialismus, nicht gering schätzen. Ich denke da nur an all die „Aufbaustunden“, die der Weissenseer Ingo Kuckuck seinerzeit beim Anlegen des Kamelgeheges im Tierpark Friedrichsfelde ableistete. An diese Tätigkeit und das dazugehörige Aufbaustundenheft erinnert er sich noch heute gerne. Ähnlich geht es etlichen Marzahnern, die beim Aufbau des dortigen Volksparks eingesetzt waren – und deswegen eine „ganz andere Beziehung zu diesem Erholungspark“ haben, wie sie sagen.
Zurück zur Klassenjustiz: Auf dem Papier beanspruchte die zukünftig proletarische humanistischer zu sein als die bürgerliche. Noch in den Sechzigerjahren sprach man von (gerechten) „Volksurteilen“, veranstaltete „Tribunale“, und einige bewaffnete Gruppen richteten „Volksgefängnisse“, u.a. in Westberlin, ein. Und bis heute wird diskutiert, ob die Gruppenaussage, Bundesanwalt Buback ermordet zu haben, nicht reicht – als Geständnis. Der Staat nahm desungeachtet kürzlich drei RAF-Mitglieder in Beugehaft, um herauszufinden, wer von ihnen denn nun wirklich geschossen hat.
Diese Art von Wirklichkeitsbegriff kann nur als allzuspätbürgerlich bezeichnet werden, ebenso wie die derzeitige Wahrheitsfindung in den Siemens-Schmiergeld- und Streikbrechergewerkschafts-Prozessen. Statt radikale Aufklärung nun emsigster US-Empirismus. Schon aus Liebe zur Erkenntnistheorie muß man das als Korinthenkackerei ablehnen. Sie endet regelmäßig nicht in größerer Klarheit, sondern in schnöder Zahlung (von Bußgeldern). Wenn nicht gleich ein sogenannter „Deal“ ausgemacht wird. Auf der anderen – sozialistischen – Seite erwähnte Julius Wolfenhaut in seinem Bericht „Nach Sibirien verbannt“, dass ein Mann, der sich auf Dienstreise befand, in seiner Abwesenheit verhaftet werden sollte. Als er wenig später davon erfuhr, packte er schicksalsergeben seine Sache, verabschiedete sich von seiner Familie und stellte sich: „Jene aber blickten ihn gleichmütig an: ‚Kannst nach Hause gehen, wir haben den Plan schon erfüllt‘.“ Als Lehrer in Sibirien mußte Wolfenhaut seine Schüler zur Erntehilfe in die Kolchose begleiten. Nachdem sie alle Steckrübenfelder abgeerntet hatten, meldete er dies ein wenig stolz dem Brigadier: „Der machte eine wegwerfende Handbewegung. ‚Die verfaulen hier alle, wir haben nicht genug Beförderungsmittel, um sie einzubringen.‘ Wozu bauen Sie sie dann an?'“ „Es steht im Plan. So geht das nun von Jahr zu Jahr,“ meinte er resigniert. Andrej Amalrik, einst ebenfalls nach Sibirien verbannt, berichtete Ähnliches über seine Arbeit auf einer Kolchose dort. Er sollte dort Zahnpfähle einsetzen, dies waren jedoch schon alle angefault. Während der Arbeit begann der Autor ob der ganzen Schlamperei an der Planwirtschaft überhaupt zu zweifeln. Wie umgekehrt viele Unternehmer, u.a. Robert Owen, an der Planlosigkeit der Marktwirtschaft schier verzweifelten. Einige amerikanisierte Kommunisten setzen heute ihre Hoffnung auf Computer und Internet: Damit könne man nun endlich in Echtzeit sozialistisch planen und regieren, meinen sie.