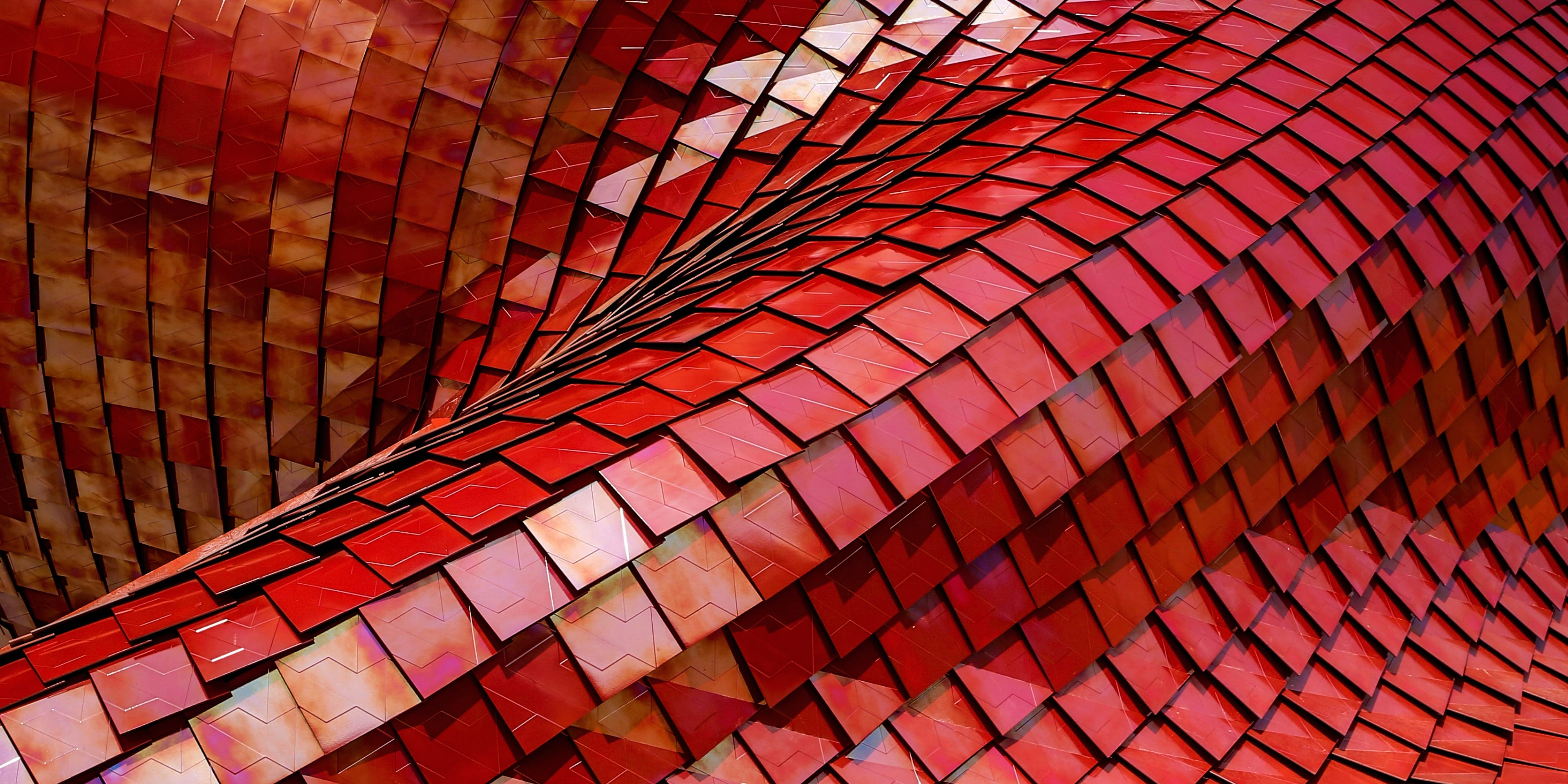Auf der 14. Internationalen Genossenschaftswissenschaftlichen Tagung in Köln standen die betriebswirtschaftlichen Genossenschaftsprobleme, die sich von Problemen anderer Unternehmen meist nicht groß unterscheiden, im Vordergrund. Sie wurden mit Hilfe der Spieltheorie und Modell-Analysen angegangen.
Um Probleme von Konsumgenossenschaften ging es nur am Rande. Dabei hielt Mathias Fielder vom Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften in Hamburg in diesem Workshop einen der anregendsten Vorträge. Er sprach über Dorfläden, die gerade eine Wiederbelebung erfahren – auf genossenschaftlicher Basis diesmal. In gewisser Weise gehört auch das Neuköllner „Le Grand Magasin“ dazu – und deswegen fragte man uns auch, warum wir noch nicht Mitglied im ZdK seien, zumal auch die taz dort Mitglied sei.
Ich möchte hier deswegen noch einmal in mehreren Anläufen auf den Dorf-„Laden“ von Erwin Strittmatter zu sprechen kommen – als Beispiel für eine Verkaufsstelle auf dem Dorf. Die Geschichte beginnt jedoch mit einem Räsonnement nicht über das Ende der Dorfläden, sondern über das Elende der Dörfer überhaupt – Abschied vom Dorf betitelt:
1.
Mit der bolschewistischen Revolution und der darauffolgenden Kollektivierung der Landwirtschaft – als Basis der nachgeholten Industrialisierung ging nicht nur die russische Dorfgemeinschaft unter, im Westen ist inzwischen sogar das Dorf selber verschwunden, wie der holländische Sozialforscher Geert Mat 1996 am Beispiel des friesischen Ortes Jorwerd zeigte; seine Studie trägt den Titel „Der Untergang des Dorfes in Europa“.
Derzeit werden gleich zwei berühmte Dorfschriftsteller verunglimpft: der soeben verstorbene Alexander Solschenizyn – als „Gulag-Kanone“ (taz) und der 1994 gestorbene Erwin Strittmatter – als ehemaliger Angehöriger eines SS-Gebirgsjäger-Regiments (faz). Solschenizyn hatte 1963 mit seiner Erzählung „Matrjonas Hof“ den Anfang mit einer neuen, nicht mehr heroisch-sozialistischen „Dorfliteratur“ gemacht, im Jahr darauf wurde er dafür für den Leninpreis vorgeschlagen. Schon in seinem zuvor veröffentlichten Lager-Bericht „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ war es ihm darum gegangen, dass man gute handwerkliche Arbeit leisten sollte – auch und gerade unter den widrigsten Umständen. In einem anderen Lager-Bericht ging es dann um eine dreiköpfige Brigade in einem kleinen Gulag-Luxus-Lager bei Moskau, die an einer abhörsicheren Telefonanlage für Stalin arbeitete. Sie bestand aus dem Mathematiker Solschenizyn, dem Sprachwissenschaftler Lew Kopelew und dem Ingenieur Dimitri Panin. Solschenizyn hat ihre intellektuelle Zwangsarbeit in seinem Buch „Der erste Kreis der Hölle“ beschrieben, Kopelew in „Aufbewahren für alle Zeiten“ und Panin in den „Notebooks of Sologdin“. Aus seinem altrussischen Arbeitsbegriff folgte für Solschenizyn später: „Es geht nicht darum, immer mehr zu verdienen, sondern immer weniger zum Leben zu brauchen.“ Aus seinen Lagererfahrungen heraus war er davon überzeugt, dass die fortdauernde literarische Verherrlichung der Verbrecher beginnend mit Puschkin und erst recht dann dann durch die kommunistischen Schriftstellern, denen die Schurken – im Gegensatz zu den „klassenfremden“ Intellektuellen und Künstlern – sogar als „klassennahe“ galten, habe wesentlich mit zu der anschwellenden Flut von Schurkentum beigetragen, unter dem das Land bzw. die Gesellschaft bis heute leide. Im Zusammenhang seines „Hauptwerkes ‚Archipel Gulag'“ meinte Solschenizyn einmal, unter den geradezu unmenschlich harten Bedingungen des Lagers scheide sich in moralischer Hinsicht die Spreu vom Weizen. An diesem Punkt zerstritt er sich mit Warlam Schalamow, der die Lager nur als schädlich und schändlich begriff, für alle, die damit in Berührung kamen und noch kommen.
Von einem Solschenizynschen Ethos der (bäuerlich-handwerklichen) Arbeit und des dörflichen Miteinanders war auch Strittmatter beseelt, der sich lieber einen Reaktionär schimpfen ließ, als Pfusch und falsche Gefühle durchgehen zu lassen. Der „Halbsorbe“ Strittmatter zählte sich zu den „kleinen Leuten“ auf dem Land – und nicht zu den großen urbanen Intellektuellen. Er arbeitete als Bäcker, Kellner, Gärtner, Fahrer, Hundesdresseur, als Land- und Fabrikarbeiter, war Amtmann in der Niederlausitz und Vizepräsident des DDR-Schriftstellerverbandes. Sein Hauptwerk thematisiert den „Laden“ seiner Eltern im Lausitzer Heideort Bohsdorf, wo er geboren wurde. Sein letztes Buch „Vor der Verwandlung“ versammelt lose Geschichten aus einem märkischen Vorwerk bei Gransee Schulzendorf, wo er sich 1957 vom Preisgeld seines ersten Nationalpreises für das Stück „Katzengraben“ einen Resthof gekauft hatte. Über die Arbeit dort schrieb er – rückblickend an seinem 80.Geburtstag 1992: „allein über hundert Fohlen sind hier geboren. Es gab nur eine Ponystute, mit der ich nicht ins Gespräch kam.“ Über das dörfliche Miteinander heißt es an anderer Stelle: „Ich war neu für das Dorf und seine Vorwerke und bestrebt, mich bei den Dorfbewohnern beliebt zu machen. Meine Kindheit als Sohn eines Dorfladenbesitzers sprang hervor, wozu, sagt? Ich war doch nicht drauf angewiesen, dass die Dorfleute zu mir kaufen kamen…Vielleicht hieß es drinnen in mir, ganz leise und ohne in mein Bewußtsein zu dringen, grieß die Leite und sei freindlich, vielleicht koofen se deine Bücher.“
2.
Für Elias Canetti ist der Dichter ein „Hüter der Verwandlungen“. Die Verwandlungsfähigkeit macht ihm das Menschliche aus. Ein Leben ohne eine fortwährende Verwandlung scheint ihm ein verarmtes, degeneriertes Leben zu sein, da es nur auf Leistung und Spezialisierung ausgerichtet ist. Zur Verantwortung des Schriftstellers gehöre es deswegen, sich gegen eine solche Verkümmerung zu stellen. Das erinnert an die „Blödigkeit“, die das aufstrebende Bürgertum bei seinen öffentlichen Auftritten zu überwinden trachtete – und die deswegen bei Hölderlin zum eigentlichen „Dichtermuth“ wird oder umgekehrt: Die „Blödigkeit – ist nun die eigentliche Haltung des Dichters,“ wie der Germanist Georg Stanitzek anmerkt.
Erwin Strittmatter war immer äußerst wandlungsfähig – nicht erst als Schriftsteller: „Halbsorbe aus der Niederlausitz“, wie er sich nannte. Und das, was er daraus an Texten machte, war so konkret, dass es den Sozialistischen Realismus gewissermaßen überholte ohne ihn einzuholen. Seine Protagonisten waren „realistische Gestalten im Kern“, deren „Weltsicht“ von einem „plebejischen Wirklichkeitssinn bestimmt“ wird, wie es im Klappentext über einen in der DDR erschienenen Roman von Bohumil Hrabal heißt. Der tschechische „Arbeiterschriftsteller“ nennt sein Schreiben selbst „totalen Realismus“. Ähnliches könnte man auch über Strittmatters Romane und Erzählungen sagen. In der Lausitz, d.h. im Sorbischen meinten seine Leute anfänglich – über seine ersten Werke: „Das wird nich sere gekooft wern, was doa drinne steht, verstehn bloß wir.“
Strittmatter wollte eigentlich 1992, als sein letzter – neunter – Roman erschien, mit dem Schreiben aufhören – und fortan, d.h. für den ihm noch verbliebenen Rest seines Lebens „lieber durch die Wälder streifen“. sich am Wachsen und Gedeihen seiner kleinen Landwirtschaft erfreuen. Oder höchstens noch an den dritten Band seiner Dorf-Trilogie „Der Laden“ einen über das „Vorwerk“ hängen. Daraus wurde dann eine lose Erzählung über einige Leute aus seinem märkischen Ort Schulzenhof, wo er ab 1957 lebte. Dieses letzte Buch hat den Titel „Vor der Verwandlung“. Strittmatter war also noch nicht am Ende. Und in der Tat geschieht es gerade, dass sich sein Bild in der Öffentlichkeit wandelt, verwandelt wird. Jedenfalls wird alles darangesetzt – in den gesamtdeutschen Feuilletons.
Seine Lebensgefährtin Eva Strittmatter, die „im Gegensatz zu ihm nie an Verwandlung glaubte“, gab das Verwandlungs-Buch 1995 posthum heraus. Gleich am Anfang schrieb Erwin Strittmatter darin: „Als mich die erste Grasmücke begrüßte, wußte ich, dass ich mich dieses Jahr noch nicht verwandeln würde.“ Dafür hatte er dann noch das Vergnügen, das Erscheinen des letzten Romans „Laden III“ mit zu bekommen. Der Westberliner Anarchist Fritz Teufel, der 1992 als Fahrradkurier arbeitete, stellte ihm die Druckfahnen zu. „Sie sind Schriftsteller, fragte er, ist damit denn noch was zu machen? Ich konnte ihm keine bündige Antwort geben,“ schreibt Erwin Strittmatter über diese kurze Begegnung. Er war damals tatsächlich unsicher, wie das Publikum seinen neuen, letzten, Roman aufnehmen würde – drei Jahre nach der Wende im Osten. Im Westen war er nie verlegt worden, dafür gab es dort gleich mehrere Literaturkritiker, die jedes neue Buch von Strittmatter zuverlässig verrissen. Ende 1961 war der erste Band seiner Trilogie „Wundertäter“, 25.000 Exemplare, von einem Westverleger sogar kurz vor der Auslieferung eingestampft worden, weil Strittmatter sich partout nicht vom Mauerbau distanzieren wollte. Die Hälfte dieses Buches ist nebenbeibemerkt eine Verarbeitung seiner Kriegserlebnisse, wovon er eines aus Griechenland in einer seiner Nachtigall-Geschichten später ergänzte.
Zuletzt verwirrte ihn auch noch sein Ostverleger – nach dem Mauerfall, indem er die Buchhändler anläßlich des Erscheinens von „Laden III“ zu einem „Schaufensterwettbewerb“ aufrief, woraufhin man Strittmatters Bücher fortan mit Backstubengeräten, Pferdehalfter, Semmelkörbe, Gartengerät, Hauspantoffel und Strohballen zusammen ausstellte. So dass seine Werke, die von DDR-Bauern und -Dörfern handelten, gleichsam eine Epoche zurückverlagert wurden: in die gute alte Zeit. Womit sie auf ein Publikum, das nun angeblich auf „den großen neuen Berlinroman“ wartete, doppelt und dreifach obsolet wirkten. Zu Strittmatters 80.Geburtstag rückte dennoch die gesamtdeutsche Presse bei ihm draußen „im Wald“ an.
Nun, vierzehn Jahre nach seinem Tod, interessiert die Kapitalmedien jedoch nur noch ein Aspekt an seiner Person: Ob er, der uns so üppig mit Details aus seinem Leben gefüttert hat, als ehemaliger Angehöriger einer SS-Gebirgsjäger-Einheit mögliche mörderische Einsätze, an denen er teilnahm, verschwieg. Strittmatters Fall ähnelt dem von Günter Grass, obwohl Strittmatter sich so gut wie nie als eine „moralische Instanz“ aufspielte, eher das Gegenteil. Nach dem Besuch einiger „68er“ mit „fester Anstellung in der Regierung“, die sich gegenüber Strittmatter abfällig über die Nachwendepolitik äußerten, notierte er: „Ich riet, man sollte sich der Wünsche nach einer Weltgerechtigkeit entschlagen und in dieser Hinsicht stolz und unangreifbar werden.“ Dennoch konnte er sich gleichzeitig als „Kommunist“ für eine strenge Unterscheidung zwischen wahren und falschen Bedürfnissen (im Volk) erwärmen – wenn auch nur einen Gedankengang lang.
Im großen Ganzen verließ er sich aber erkenntnispraktisch auf seine Verwandlungsfähigkeit. Das begann schon mit seinem ersten Text, den er kurz nach dem Krieg in einer Weimarer Zeitung veröffentlichte. Es ging darin um die Enteignung und Verteilung des Gutsbesitzes an Landlose, Heimkehrer und Vertriebene. Strittmatter arbeitete damals vermittelt über das Arbeitsamt als Gärtner in Thüringen und seine Mutter hatte ihm geschrieben, er möge doch nach Hause kommen und sich auch ein Stück Land nehmen, „es ist noch etwas Rest“. Der Brief der Mutter machte ihn nachdenklich: „Ich bin immer landhungrig gewesen.“ Erst recht dann ihr zweiter Brief, in dem sie ihren Sohn zur Eile mahnte, „sonst wäre auch das letzte Stück Land aus dem Bodenfonds vergeben, und die Bossdomer Flure aufgeteilt. ‚Vom Bodenfonds‘ – wie meine Mutter das hinschreibt, so als hätte es den schon immer gegeben wie Margarine oder Himbeermarmelade.“ Statt nach Hause zu fahren schrieb Strittmatter einen Text über „die Gefühle eines Menschen“, der nun ein Stück Land sein eigen nennt: „Noch ehe ich etwas von der Aktion, die man später die Bodenreform nennen wird, gesehen habe, schreibe ich über sie.“
Als der Gartenbesitzer, sein Chef, mit der Zeitung ankommt, in dem Strittmatters Artikel steht, und wissen will, wann er gemerkt habe, dass er ein Schriftsteller sei, erklärt ihm der Autor, „meine Verwandlung vom Hilfsarbeiter zum Schriftsteller hat sich plötzlich auf dem Arbeitsamt vollzogen.“ An anderer Stelle ergänzt er, dass sein Chef, Herr Höhler, „doch die Verwandlung eines gewöhnlichen Menschen in einen Schriftsteller im eigenen Garten und auf seinem Mist miterlebt“ habe. Dem Obstgutsbesitzer gefiel der Artikel, merkwürdigerweise kam er aber nicht darauf, dass ihm selbst auch bald eine Verwandlung, die Enteignung seines Gutes nämlich, drohte. Für Strittmatter hält der Erfolg seiner Verwandlung nicht an: seine zwei nächsten Texte werden abgelehnt: „Meine Beziehungen zum Kulturredakteur in Weimar haben sich gelockert. Er hat mich bezichtigt, ein Feind der Zukunft zu sein. Das halte mal einer aus! Das nehme mal einer hin!“ An anderer Stelle erklärt er dazu: „Ich war ein Glaubender in Sachen Politik geworden und ein Unsicherer, ein Ungesicherter in Sachen Kunst, und ich mußte erst wieder einer werden, der sich seiner Vergangenheit nicht schämt, sondern sich über sie wundert…“ Der ein „Selbstdenker“ (wieder) wird.
In seiner Trilogie „Der Wundertäter“ thematisierte Strittmatter später seine Hinwendung zur Schriftstellerei ausführlich. Bertold Brecht, mit dem er vier Jahre zusammenarbeitete, und der sich gleich ihm besonders für die sozialistische Umgestaltung der ostelbischen Landwirtschaft interessierte, kritisierte daran: „Man schreibt nicht über Dichter, man schreibt über Arbeiter.“ Strittmatter war nun aber ein Arbeiter – und der „Hauptmensch“ in ihm, so behauptete er auch weiterhin, „treibt Handarbeit – und läßt sich knechten.“ Der gelernte Bäcker, aus kleinbäuerlicher Elternhaus, war zuvor Kellner, Fahrer, Kaninchenzüchter, Hundedresseur, Soldat, Land- und Fabrikarbeiter gewesen.
Sein Stück „Katzengraben“ verdankte sich bereits der Zusammenarbeit mit Brecht, der sich in Brandenburg ein „Laienspiel über die Landwirtschaft in der DDR“ angesehen hatte – und dabei auf den Autor – Strittmatter – aufmerksam geworden war. Später vermittelte Strittmatter dem Regisseur Benno Besson einen Arbeits- und Studienplatz in der LPG seines Dorfes. Neben Bertolt Brecht hatte zunächst auch die offizielle DDR-Kritik „die Lebensgeschichte des Stanislaus Büdners, vom poetisierenden Bäckergesellen zum kritischen Schriftsteller“ scharf kritisiert, aber dann erlebte der Autor doch noch „wie sein Protagonist – die Verwandlung vom Bäcker zum hofierten Romancier“.
Posthum kommt es nun wie erwähnt sogar noch zu einer weiteren Verwandlung: vom hofierten DDR-Schriftsteller zum verfemten Nazi und – fast noch schlimmer – zum Stasispitzel „IM Neupeter“.
In einer seiner „Nachtigallgeschichten“ – hatte es über das Ende des Ersten Weltkriegs und den ersten „Heimkehrerball“ bereits resümierend geheißen: und so „winselte [ich] mich in einer der ersten Verwandlungen meines Lebens hinein.“ Das Ende der DDR tangierte Strittmatter weniger. Während es auch und gerade unter den Bauern und in den ostdeutschen Dörfern mächtig gärte, wie man so schön sagt. Die BRD hatte 1961 im Wiedervereinigungsplan des dafür einst zuständigen „Gesamtdeutschen Ministeriums“, festgelegt, dass die LPGen aufgelöst werden müßten. Der diese von der EU abgesegnete Bauernpolitik nun exekutierende Freiherr von Heeremann als Bauernpräsident und der Allgäuer Kleinbauer Ignaz Kiechle als BRD-Landwirtschaftsminister sprachen ganz offen auf DDR-Versammlungen von der Zerschlagung der kollektivierten Landwirtschaft. Hatten nicht sämtliche in den Westen geflüchteten ostelbischen Bauern davon berichtet, dass sie durch brutalen Zwang ins Werk gesetzt worden war? Der RIAS berichtete in seinen Brandenburg-Sendungen noch täglich davon.
Die meisten Bauern nahezu im gesamten Ostblock wollten jedoch nach 1989 ihre Landwirtschaftskollektive nicht mehr verlassen. In Russland lehnten sie sogar das ihnen geschenkte Land zur Vergrößerung ihrer eigenen kleinen Privatwirtschaft ab. Der zunehmende Druck von außen stieß auf das „Beharrungsvermögen“ im Inneren und ließ das Leben auf dem Land auch in Ostelbien immer heterogener werden. Das wirklich Neue war jedoch mit der Bodenreform nach dem Krieg passiert. Die Kollektivierung der Landwirtschaft thematisierte Strittmatter in seinem tragikkomischen Roman „Ole Bienkopp“.
Statt in dem hektischen Durcheinander der Wendezeit seine dicken Romane zu lesen, unternahm ich lieber Ausflüge über Land in den Osten – u.a mit dem ehemaligen Kulaken Emil Kort aus Kampehl, der sich 1984 mit Pferd und Wagen durch die DDR aufgemacht hatte, und immer noch einige Pferde auf seinen nun restituierten Weiden in der Prignitz stehen hat. Einmal kamen wir an Strittmatters „Schulzenhof“ im Ruppiner Land vorbei. Strittmatter, der dort 1994 starb und dann auch beerdigt wurde, war wie Kort ein Pferdenarr . „Den mußt du lesen,“ meinte Emil Kort, „in seinem ‚Ole Bienkopp‘ schildert er, wie die ‚Neue Bauerngemeinschaft‘ am Starrsinn der Parteibürokratie zerbricht. Wie mich hat man ihn dafür der Sabotage bezichtigt.“
Emil Kort wurde mit etlichen Jahren Uranbergbau bestraft, Ernst Strittmatter bekam jedoch den Nationalpreis für seinen „Bestseller“ und der Roman wurde Pflichtlektüre der 12.Klassenstufe. „Das Leben ist ja so spukhaft,“ meinte der Autor diese erneute Wendung in seinem Leben und in der Kulturpolitik der Partei.
Im Herbst 1993 war ich in der Lausitz unterwegs – ein bißchen auch auf den Spuren des Dichters. Ich kuckte mir „Den Laden“ seiner Eltern an. Er wurde 1999 zu einem Museum ausgestaltet. Noch beeindruckender fand ich einen anderen, einen Fleischerladen ganz in der Nähe, der nun „Schlachtshop“ hieß.
Eva Strittmatter schreibt, dass Erwin Strittmatter im Oktober 1993 ebenfalls in der Lausitz unterwegs war, zusammen mit der Bibliothekarin Sylvia B. aus Spremberg, „mit der er in den letzten Jahren die geheimen Plätze seiner Jugendlieben aufgesucht hatte, Erinnerungsfahrten in das Land, nach dem sein Heimweh ging.“ Der halbsorbische Dorfdichter verarbeitete im „Wundertäter“, wie auch in fast allen anderen Büchern und Trilogien sowie Klein- und Kurzgeschichten die eigenen „Lebenserfahrungen“. Gerade in seinen Erzählungen erinnerte mich Strittmatter an Bohumil Hrabal, der sich seinerseits auf den Schwejk-Autor Hasek berief. Die beiden nahezu Gleichaltrigen, Strittmatter und Hrabal, eint überdies, dass sie sich in vielen Arbeiter-Berufen ausprobierten und ihre Bücher sich aus diesen Erfahrungen speisten. Ersterer meinte, bereits anhand seiner eigenen Lebensführung den Beweis führen zu können, „dass der Mensch unterderhand und oft, ohne sich selber von diesem Vorgang zu verständigen, ein anderer wird.“
Gleichzeitig bleibt jedoch immer etwas hängen, bei dem einstigen Jungkommunisten Strittmatter, den man 1947 zunächst zum Amtsvorsteher seines Heimatortes Bohsdorf machte, war es u.a. das „Zweitlächeln“ bzw. „Kellnerlächeln“, das er auch späterhin noch manches Mal benötigte, „und obwohl wir unsere Gesellschaft doch revolutionieren, wird es heute noch dann und wann von mir verlangt,“ klagte er – in „Die blaue Nachtigall“.
Seine halbe Verwandtschaft bestand aus Sorben. Die Sorben in der Lausitz sollten während der Nazizeit als „führerloses Arbeitsvolk“ zum Straßenbau in den Osten deportiert werden, ihre Organisation, die Domowina, wurde verboten. Sie gehörte dann mit zu den ersten, die nach dem Einmarsch der Roten Armee wieder zugelassen wurden, später unterstützte die SED „ihre“ Sorben großzügig. Strittmatter erwähnt in seinen Werken den einen und anderen sorbischen Verwandten, er selbst „war hingegen stets nur – wie soll ich mich charakterisieren? – ein Lebensverbraucher.“ Nach dem Pistolenschuß eines betrunkenen sowjetischen Offiziers erlebte er aber doch einen der „kurzen Augenblicke, in dem er gewissermaßen in „Eigenleistung einen Richtungswechsel“ vollbrachte.
Ein Kulturwissenschaftler, den er beim Kuren kennenlernte, fragte ihn einmal: „Wie’s mit dem Schreiben so“ ginge. „Das eben versuche ich herauszukriegen,“ erwiderte Strittmatter, woraufhin sein Freund meinte: „Mit Schreiben was über Schreiben rauskriegen? Is ja wohl reine Empirie!“
3.
Der Einschleichjournalist Oliver Jungen schreibt in der FAZ: Es sei eine „Tatsache, dass Erwin Strittmatters literarisches Schicksal längst besiegelt ist“. Reines Wunschdenken! So heißt es z.B. über die Amerikanisierung gleich im ersten Band seiner „Laden“-Trilogie: „Großvater Josef reist nach Kanada und teilt Großmutter im ersten Liebesbrief mit, er habe einen Job gefunden…das Wort fängt sogleich mächtig an, in unsere Familiensprache einzudringen.“ Die Großmutter wird gefragt, was ihr Liebster denn drüben für eine Arbeit gefunden habe. Er habe einen Job, antwortet sie. Aber ein Job ist doch eine Arbeit, erwidert man ihr. Nein, sagt die Großmutter, „ein Job ist ein Job ist ein Job.“ Nach einiger Zeit schickt der Großvater ihr money für die Überfahrt. Auch dieses Wort nistet sich in der „Familiensprache“ ein, bei seinem sorbischen Onkel wird daraus jedoch Muni – „das ist eigentlich die Abkürzung für Munition, was tuts, sie sind ja verwandt – Geld und Munition.“ Irgendwann bringt sich der Großvater in Amerika mit einer pocket-gun um, die Großmutter erzählt daheim die Story von seinem Tod jedoch anders. Wenn sie wütend ist, z.B. auf den Vater von Strittmatter, sagt sie: I kill you. Wenn er morgens nicht aufstehen will, ruft sie ihm zu: „Henry, go on! Der Vater wälzt sich herum und kehrt ihr den Rücken zu. Master must first out of bed in the morning, sagt die Amerikanische etwas lauter.“ Den Kindern bringt sie „bit by bit bei, dass sie reich ist.“ Strittmatters Mutter säubert ihr nach Ladenschluß die Fingernägel. Die andere Oma macht das wütend: „Amerikanische Moden, sagt sie. Zuogar für ihre Finger braucht se noch ne Moagd.“
In unserer nunmehrigen Dienstleistungs- und Selbständigkeitsgesellschaft aktueller denn je sind auch Strittmatters 1983er-Bemerkungen über das Einzelhandelsgeschäft seiner Mutter. So darf er z.B. nie etwas Kritisches über jemanden im Dorf sagen: „Alles unsere Kundschaft. Ich sehe, was ich sehe, aber Mutters Laden macht mich zum Parteigänger, ich soll nur sehen, was dem Geschäft nicht schadet. Diese Nötigung verfolgt mich mein Leben lang: Andere verlangen von mir, daß ich sehe, was sie wünschen.“ In seinen jungen Jahren wurde es einmal so schlimm damit, dass er zu seiner Großtante Maika gehen mußte, damit diese ihm sein „Geschäftsgespenst“ austrieb. Aber auch weiterhin heißt es: „Der Loaden, der Loaden“ – geht vor. Selbst der jähzornige Vater darf seine Beschimpfungen nie „bis zur Feindschaft ausweiten. Der Laden! Der Laden!“ Immer wieder muß Strittmatter dort die Mutter vertreten, und dann bringt ihm der Großvater auch noch den „Pferdehandel“ bei. Bis zuletzt wird Strittmatter Pferde züchten – und dafür sorgen, dass dabei immer was abfällt. Die Eltern standen mit der Bäckerei und dem Laden in Konkurrenz zum Nachbarn – dem Mittelmüller. Eines Tages beschließt dieser, sein Brot den Kunden frei Haus zu liefern: „Siehe, der Service, den sich der Mittelmüller ausdachte, hat Erfolg.“ Strittmatter und sein Großvater beginnen daraufhin ebenfalls, das Brot auszuliefern: „Wir gewinnen unsere Brotkunden auf den drei Vorwerken zurück und wir gaunern der Konkurrenz einige Kunden ab.“ Strittmatter lernt Mundharmonika, sein Mutter beschäftigt ihn daraufhin im Laden als „Kundenservice: Jeder Schichtler, der jahrsüber sein Bier im Laden getrunken hat, erhält an seinem Geburtstag ein Sonderkonzert“. Als das Anschreiben überhand nimmt, muß er für seine Mutter ein Schild für den Laden malen: Borgen tun wir morgen. „Meine ausgezeichnete naive Mutter bedachte [jedoch] nicht, daß jemand, der ein Theaterplakat liest noch lange nicht ins Theater geht.“ Die Jungs des Mittelmüllers kaufen mit von ihrem Vater geklauten Geld im Laden von Strittmatters Mutter Süßigkeiten und Getränke – und veranstalten bei ihr auf dem Hof ein Fest: „Meine Mutter steht hinter der gerafften Gardine, sieht unserem Treiben zu und ist nicht unglücklich über das schöne Sonntagsgeschäft. Ich muß an das denken, was Großtante Maika gesagt hat: Wer Geschäfte macht, den hat der Deibel schont am Ursche.“ Dennoch gilt auch weiterhin: „Meine Schwester und ich knicksen und dienern, und wir grüßen jedermann im Dorfe, und tun wir es nicht, werden wir getadelt. Wir grüßen, grüßen: Der Loaden, der Loaden!“ So machen ihn seine Eltern „zum Mitsklaven ihres Ladens“ – und noch zu den Genossen später war er so „freudlich, auch wenn sie mich erniedrigten“ – dass seine Geliebte ihn einen „niederschlesischen Neurotiker“ nannte. Da „befreite“ er sich endlich, schreibt er. Aber noch als er sich vom Nationalpreis-Geld den Schulzenhof im Ruppiner Land kauft – und danach im neuen Dorf herumgeht, nach allen Seiten nickend und sich bekannt machend, denkt er: Sei freundlich zu den Leuten, vielleicht kaufen sie deine Bücher…
4.
„Sie werden doch nicht sagen wollen, daß wir in Bälde eine Welt nach dem Muster der amerikanischen Plutokraten einrichten wollen: Overalls, alles aus dem gleichen Stück, aus dem gleichen Stoff, Hüte dazu mit Krempen so breit wie die Schutzschirme von Jahrmarktshändlern und Jeans für alle?“ Fragte der Besitzer eines Obstgutes, Höhler, seinen Erntehelfer Erwin Strittmatter 1945. Doch, doch, genau das wollte er. Und später in seinen Romanen (u.a. in „Der Laden“ Band 2 und 3) hat Strittmatter darauf bestanden, dass auch der Osten, schier die ganze Welt, sich nach dem Krieg amerikanisiert hat – bis unter die Haarwurzeln sozusagen. Wir erinnern uns: die erste Jeans – Made in the GDR – wurde sogar stolz im Ostberliner Museum unter den Blinden ausgestellt: in einer Glasvitrine. Neben dem letzten Zollstock des DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck, ein gelernter Tischler. Als in den Achtzigerjahren die amerikanisch-russischen Beziehungen einfroren, gingen einige US-Aktivisten von „Citizen Diplomacy“ empirisch der Frage nach: „Wo auf der Welt ist der ‚Amerikanische Traum‘ noch lebendig?“ Antwort: „Nur noch in der UDSSR!“ Da wünschte sich z.B. ein Arbeiter aus den Togliattiwerken einmal neben den Kollegen in den Fordwerken am Band zu stehen; ein anderer, einmal einen Amijeep zu fahren. Seit dem „Zusammenbruch des Sozialismus“ sind selbst beinharte Trotzkisten zu den Plutokraten übergelaufen: die ganzen US-Präsidentenberater z.B. – Wolfowitz et al.. So wie sie früher für den „Internationalismus“ waren, kämpfen sie nun für die „Globalisierung“. Und im Café Einstein Unter den Blinden hockt der Ex-US-Botschafter für Deutschland Kornblum mit dem Goethe-Schriftsteller Peter Schneider zusammen – sie reden darüber, „what Europe has to do“: „We!“ Schneider erzählt stolz, dass er nunmehr das fünfte Mal in den Super-Gehirnwaschsalon „Harvard“ eingeladen wurde, wo auch die französischen Linksintellektuellen, wo Joschka Fischer und zuletzt der georgische Präsident schon auf CIA-Linie getrimmt wurden. „We!“ Das ist das selbe globale Schweine-Wir, das auch „unser“ Deutschlandpräsident Köhler, ein vormaliger IWF-Manager, stets gebraucht – in seinen Reden: Einmal meint er damit „Uns alle“ (das „Volk“), und im selben Atemzug „Wir“ – die „Elite“, d.h. die US-Plutokraten, die Siemens-, die Mercedes-, die McKinsey-Manager und Er, die sich alle mehr Mühe geben (sollen/müssen), um „uns“ das alles zu verklickern, was sie mit dieser Welt vorhaben – mit uns, damit wir auch richtig spuren, d.h. endlich „begreifen“. In dieser ganzen ekelhaften Restaurationszeit, in der sich die miesesten Säcke als „Elite“ nach oben mendelt, setzen viele linke Intellektuelle in der Dritten Welt ihre Hoffnungen auf China – als eine Art dritte Kraft, aufstrebend zu einer neuen Großmacht. Aber vergeblich – wie Strittmatter sagen würde, bereits im 1.Band seines „Ladens“: „zu spät!“
Die heutigen Arbeitssklaven in China heißen „Dagongmei“ bzw. „Dagongzai“. „Mei“ stand schon immer für „kleine Schwester“, „zai“ für „Sohn“. Aber „dagong“ ist quasi brandneu: es heißt arbeiten im Sinne von „jobben“. Die Dagongmei bzw. -zai sind „Jobber“, und zwar von der elendsten Sorte, die in rechtsfreien „Work-Zones“ ihr junges Leben für den Profit ausländischer alter Säcke (Investoren) hingeben. „Dagong“ heißt so viel wie „für den Boss arbeiten“, der dann auch gerne wie unser aus „kleinsten Verhältnissen“ stammender SPD-Reform-Kanzler Schröder „Boss-Anzüge“ trägt.
Zwei feministisch inspirierte Untersucher des neuen Job-Phänomens in Hongkong – Pun Ngai und Li Wanwei – schreiben in ihrem soeben im Kollektivverlag „Association A“ erschienenen Buch „Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen – Dagongmei“: „Dieses neue Wort steht in deutlichem Gegensatz zu den Begriffen ‚gongren‘ – Arbeiterinnen und Arbeiter, und ‚wuchan jieji‘, Proletariat, die zu Zeiten Mao Tse Tungs benutzt wurden. Die ‚gongren‘ waren privilegiert, die Propaganda nannte sie Herren des Landes.“ Während die neuen „Jobber“, ob männlich oder weiblich, nicht einmal als Erwachsene gelten, sondern bloß Spielmaterial der „neuen Bosse“ sind, auch in sexueller Hinsicht. Und alle tragen sie Jeans. Amijeans! To cut a long us-story short: Bis China sich zu einer dritten Kraft aufgeschwungen hat, sind die Chinesen längst solche Amiheloten wie Schröder, Fischer, Schneider, Köhler etc. geworden. Also vergesst die Chinesen! Nicht umsonst haben die Plutokratenmedien von FAZ bis NYT sofort ihre „besten“ Leute nach dort in Marsch gesetzt: „Da geht es jetzt nämlich ab!“ (taz) Und bestenfalls kommen dabei einige weitere hundert Millionen Überamis bei raus.
5.
Da ist noch viel mehr drin – „in Strittmatters Laden“, schrieb mir Lena aus Bremen. Dabei hatte sie nur den Fernsehfilm „Der Laden“ gesehen. Der TV-Dreiteiler kam so zustande: Der Münchner Regisseur Jo Baier stieß 1992 durch Zufall während einer Fahrt durch Ostdeutschland auf Strittmatters Romane. Für 2 DM kaufte er ein Exemplar des „Ladens“, das er in einer für DDR-Literaturreste reservierten Ecke eines Ladens entdeckte. Baier war begeistert von der Geschichte, die kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1919 beginnt und über drei Jahrzehnte den Lebensläufen der Familie Matt und ihres Dorfladens in der Lausitz folgt.
„Es geht darin um den Kampf der kleinen Leute um ein bißchen Glück, Geschichten, die überall aktuell sind…,“ so begründete er damals seine Mühen um die Verfilmung des „Ladens“, die der Autor, Strittmatter, ihm noch selbst quasi anvertraut hatte. Der ORB gab dem Regisseur dafür sein ganzes Fernsehspiel-Budget eines Jahres, aber die Sendeanstalten im Westen stellten Bedingungen. Als Ko-Autor für das Drehbuch gewann Jo Baier dann Ulrich Plenzdorf („Die Legende vom Glück ohne Ende“). Während der Ost-Autor auf das Politische des „Ladens“ abhob, wollte der Westregisseur eher dessen lebendes und totes Inventar ausmalen. Bis Baier sich durchgesetzt und 11 Mio DM für die Dreharbeiten zusammen hatte, ging sein Produzent pleite, wollte die Witwe Eva Strittmatter nach einem WDR-Fernsehbericht über die Stasi-Akten ihres Mannes das Filmprojekt stoppen, und ein Teil der ARD-Anstalten zuletzt auch noch die Ausstrahlung des ihrer Meinung nach zu anspruchsvollen Dreiteilers auf die Nacht verlegen. Der Tagesspiegel schrieb: „Dabei muß ‚Der Laden‘ den im Vorfeld oft gezogenen Vergleich mit Reitz Hunsrücker ‚Heimat‘ wahrlich nicht scheuen“.
Gesendet wurde der Film dann 1998 auf Arte, gedreht hatte ihn Baier nicht am Niederlausitzer Originalschauplatz – in Bohsdorf, das ihm „nicht malerisch genug“ dünkte, sondern in dem scheinbar vergessenen Flecken Roddan in der Prignitz. Die sorbische Niederlausitz war infolge des seit den Achtzigerjahren forcierten Braunkohleabbaus wohlhabend geworden – und speziell Bohsdorf durch die „Strittmatter-Fans“. Es gab und gibt mehrere Gaststätten und Pensionen im Ort: „Schon seit der erste Band des ‚Ladens‘ erschienen ist, zieht es die Besucher dort hin. Das Buch war Bück-Ware,“ schreibt die Berliner Zeitung. Der „Erwin-Strittmatter-Verein“ ist sich sicher, dass trotz aller Schmäh aus dem Westen („Strittmatters literarisches Schicksal ist längst besiegelt“) auch in Zukunft der Besucherstrom nicht abreißen wird. Und die „Zukunftsagentur Brandenburg“ (ZAB) bescheinigte darüberhinaus der Lausitz insgesamt „eine sehr gute Zukunft als Industrie- und Wirtschaftsstandort – wenn sie sich als Bestandteil der Hauptstadtregion versteht und entsprechend vermarktet“. Der Loaden, der Loaden! Ausdrücklich lobte die ZAB in diesem Zusammenhang das TIP – den „Technologie und Industriepark“ Cottbus.
Inzwischen scheint der mehrfach medial verwurstete „Laden“ eine Art „Black Box“ geworden zu sein: Man weiß nicht, was drin ist und will es auch gar nicht wissen, versucht aber durch Inputs dem Output interpretatorisch beizukommen. 412 Eintragungen finden sich im Internet zu den Stichworten „Strittmatter“ und „SS-Vergangenheit“. Gleich nach den FAZ-Artikeln über das vermeintlich verschwiegene Wissen des Autors über die „NS-Verbrechen“ seiner Truppe im Zweiten Weltkrieg kündigte der Bürgermeister von Spremberg an, dem 1994 verstorbenen Strittmatter die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen. Auch die Brandenburgische Landesregierung, die alljährlich einen „Erwin-Strittmatter-Preis“ an verdiente Literaten des Volkes vergibt, soll nun angeblich mit dem Namen ihres 5000-Euro-Preises hadern. Was mit dem „Erwin-Strittmatter-Gymnasium“ in Spremberg, Gransee und Marzahn sowie mit den vielen ostdeutschen Erwin-Strittmatter-Straßen und Hinweisschildern geschehen wird, ist noch unklar. Erst einmal sollen die „Spremberger und Granseer Schüler“ jetzt „das Leben des Schriftstellers in der NS-Zeit beleuchten,“ wie die Lausitzer Rundschau meldete. Der von Lokalhonoratioren durchsetzte „Erwin-Strittmatter-Verein“ in Spremberg unterstützt das, will sich aber unabhängig davon weiterhin um das Werk von Erwin Strittmatter verdient machen. Dazu ließ er bereits den ehemaligen „Laden“ 1999 zu einem Strittmatter-Museum umbauen und daneben eine „Strittmatter-Begegnungsstätte ‚Unter Eechen'“ errichten. Darüberhinaus macht auch die Spremberger Bibliothekarin Sylvia Blaesing Werbung für Strittmatter: „Ich lese im ,Laden‘ wie andere in der Bibel. Es ist der Wohlklang seiner Worte, diese Poesie, die der Seele gut tut.“ Die Süddeutsche Zeitung schrieb kürzlich über den Autor – unbeleckt von jeglicher Lektüre seiner Romane: „Sein sozialistischer Realismus machte ihn gleichwohl zu einem Bestsellerautor…“ (im Osten) „Lesen Sie auf der zweiten Seite, warum es möglicherweise gut ist, dass Strittmatter ausgerechnet in der FAZ angegriffen wurde“. Haste Töne?!
Im Gegensatz zur TV-Verfilmung, die kurz nach dem Krieg endet, reicht die Handlung des Romans „Der Laden“ bis in die Jetztzeit. Der 3. Band beginnt mit der „Stunde Null“ in Bohsdorf 1945: Die Dagebliebenen und bis dahin Zurückgekehrten trafen sich auf dem Dorfplatz „Unter Eechen“ und trugen alle noch brauchbaren Dinge aus den zerstörten Häusern zusammen, um sie gerecht unter sich aufzuteilen. Die Idee dazu kam vom alten Grubenwächter Nickel. Eine Frau, die diesen kurzen aber „vollkommenen Kommunismus“ nicht miterlebt hatte, sieht später eine andere in ihrer Samtjacke herumlaufen: „Eine Frechheit, denkt sie. Daheim beschwichtigt sie später ihr Mann, er will nicht, dass seine Frau gegen die edle Stunde aufmuckt.“ Die Ladenumsätze von Strittmatters Mutter gingen unterdes immer weiter zurück, das „Manko“ wurde größer, so dass er schließlich von der Konsumgenossenschaft übernommen wurde. Zum Leiter der „Verkaufsstelle“ machte man Strittmatters Bruder, die Mutter klagte: „könn die denn gar nich noachfiehln. dass man selber een Stücke Loaden is?“ Aus den meisten Bohsdorfern waren inzwischen Kleinbauern geworden, sie nannten sich „Bodenreformer“. Die Bodenreform war jedoch, „wie Paule es nannte, ein Dardanellengeschenk“. Erst sollten sie gemäß einer Weisung des russischen Kreiskommandanten Mais anpflanzen, der aber in der Lausitzer Sandheide nicht gedeiht. Dann wurden sie „halb freiwillig und halb mit Druck“ zu einer LPG zusammengeschlossen, die sie „Frohe Zukunft“ nannten. „Sie verhielten sich jedoch in ihr wie früher in ihren Vereinen: Wer keine Lust hatte, erschien nicht zur Gemeinschafts-Arbeit. Niemand fühlte sich verantwortlich für die zu Schlägen bürokratisch vereinigten Felderchen. Zuvor standen sie bis nachts auf ihren Beeten und bekratzten und bezupften sie…“ Wegen der schlechten Erträge wird die LPG schließlich in eine Obstbau-Genossenschaft umgewandelt. Das Obst gedeiht. Die neuen Obstbauern „denken an eine Marmeladenfabrik“. Strittmatter wohnt da schon nicht mehr im Dorf. Aber als er erfährt, dass man die „Unter Eechen“ in Bohsdorf fällen will, um an der Stelle eine neue, größere Konsum-Verkaufsstelle zu errichten, fährt er mit seinem Wartburg empört dort hin – kommt aber zu spät. „Hauptmotiv für das Fällen der Eichen war die Geldgier des Bürgermeisters und des Gemeinderates,“ schreibt er.
Aus dem Laden seiner inzwischen verstorbenen Mutter macht man die Poststelle des Dorfes. Nach der Wende wird die Post geschlossen, das Haus verkommt langsam. Die Felder der Obstbaugenossenschaft werden an einen „Ausländer“ verkauft. Der läßt die 175.000 Apfelbäume fällen – und „kassierte Prämien für die Vernichtung“ (8000 DM pro Hektar).
Dennoch entstehen bald überall „blühende Landschaften“: So „blüht im Dorfe der Konkurenzkampf wieder auf, den ich in der Jugend dort erlebte. Ob ihr es glaubt oder nicht: Die Konsumverkaufsstelle, für die man die alten Eichen abholzte, unterlag im Konkurenzkampf. Wie damals [als seine Familie 1919 nach Bohsdorf zog] haben Nachkommen der Sastupeits einen Kramladen aufgemacht. Ich weiß nicht, wer es jetzt ist, der sich, wie einst meine Eltern, über die Konkurrenz ärgert… Das Neue ist das Alte. Wieder stehen auf dem Dorf-Anger wie zum Ende der Zwanzigerjahre Arbeitslose umher und vertreiben sich die Zeit mit ketzerischen Reden gegen die Selbstherrlichkeit der Politiker, und bald wird man nach dem starken Mann rufen, der die Krämer aus dem Tempel treibt und einen Arbeitsdienst für die Arbeitslosen erfindet und die Räuber und Diebe von den Straßen fegt…Es ist Mai, und es blüht alles um mich herum.“