Vorarbeiten zu einer „Theorie des kommunikativen Handels“
Man kann sich der Leistungsschau der europäischen Produktivgenossenschaften „Le Grand Magasin“ sowohl von den Produkten als auch von deren Produktion her nähern. Und natürlich von der „ansprechenden“ Ausstellungs- bzw. Verkaufsästhetik – ihrer Präsentation in der Neuköllner Galerie.
Beginnen wir mit den Produkten, den Dingen… Welche Geschichten lassen sich an ihnen festmachen – erzählen? Wenn die kapitalistische Gesellschaft als eine ungeheure Warenansammlung und damit Geschichtensammlung erscheint, dann sollte man vielleicht mit ihrem Nullpunkt beginnen. In ethymologischer Hinsicht befindet sich dieser dort, wo man noch nicht zwischen „Ding“ und „Thing“ unterscheidet – vor der ersten Warenproduktion. Wenn der Wissenssoziologe Bruno Latour von einer „Dingpolitik“ spricht, dann meint er genau diese „archaische“ Bedeutung von Zusammenkommen/Versammlung und Sache/Angelegenheit, für deren Wiederaufgreifen er in seinen Büchern, aber auch 2005 mit der Ausstellung „Making Things Public“ plädiert. Die Dingpolitik, die wir ins Spiel bringen, versammelt jedoch keine nordischen „Dingmenschen“ (Abgeordneten) an ihrem „Althing“ (Parlament), sondern Gegenstände (Waren) und Konsumenten in einer Kunstgalerie. Wohl wissend, dass die eigentlichen Wirtschaftssubjekte (die Produzenten) in Wirklichkeit auch Objekte/Dinge geworden sind. Man spricht deswegen auf der einen Seite von der „Ware Arbeitskraft“, von „Humankapital“, „Arbeitsmarkt“ usw.. und auf der anderen Seite von der „Verdinglichung des gesamten gesellschaftlichen Lebens“ (Cornelius Castoriadis) in der Ersten Welt bzw. von dem „kolonisierten Ding“ (Frantz Fanon) in der Dritten Welt.
Die Verdinglichung der Lebensverhältnisse führt überall dazu, dass wir ein sachliches Verhältnis zu Personen und ein persönliches zu Sachen entwickeln. Diese „Wiedervergesellschaftung der Arbeit“ geschieht nur in ihrer abstrakten Form. Denn die Warenproduktion läßt nur eine solche zu. In ihrem „gesamten Umkreis herrscht Abstraktheit“, erklärt dazu Alfred Sohn-Rethel: „In erster Linie ist der Tauschwert selbst abstrakter Wert im Gegensatz zum Gebrauchswert der Waren. Der Tauschwert ist einzig quantitativer Differenzierung fähig, und die Quantifizierung, die hier vorliegt, ist wiederum abstrakter Natur im Vergleich zur Mengenbestimmung von Gebrauchswerten. Selbst die Arbeit…wird als Bestimmungsgrund der Wertgröße und Wertsubstanz zu ‚abstrakt menschlicher Arbeit‘, menschlicher Arbeit als solcher nur überhaupt. Die Form, in der der Warenwert sinnfällig in Erscheinung tritt, nämlich das Geld,…ist abstraktes Ding und in dieser Eigenschaft, genaugenommen, ein Widerspruch in sich. Im Geld wird auch der Reichtum zum abstrakten Reichtum, dem keine Grenzen mehr gesetzt sind. Als Besitzer solchen Reichtums wird der Mensch selbst zum abstrakten Menschen, seine Individualität zum abstrakten Wesen des Privateigentümers. Schließlich ist eine Gesellschaft, in der der Warenverkehr den nexus rerum bildet, ein rein abstrakter Zusammenhang, bei dem alles Konkrete sich in privaten Händen befindet.“
Diese (politische) Agonie oder Abwesenheit der Subjekte hat eine weitere „Indifferenz“ zur Folge, die der Philosoph Jean Baudrillard in allen Dingen, die zur Ware geworden sind, aufscheinen sieht: eine „Objektstrategie“, womit er sagen will, dass die Verführung auf die Seite der Dinge übergegangen ist: „Wenn die Warenform den früheren Idealzustand des Objektes zerstört (seine Schönheit, seine Authentizität und auch seine Funktionalität), dann darf man nicht versuchen, ihn wieder zum Leben zu erwecken, indem man das formelle Wesen der Ware verleugnet, sondern man muß im Gegenteil diese Aufspaltung der Wertformen bis ins Unendliche steigern – und darin besteht die gesamte Strategie der Moderne.“ Deswegen sieht Baudrillard nur noch eine „einzige radikale Lösung“ nämlich „das zu potenzieren, was in der Ware neu, originell, unerwartet und genial ist, das heißt die formelle Indifferenz gegenüber der Dimension des Gebrauchs und des Wertes und die Vorherrschaft der schrankenlosen Zirkulation.“ Der Philosoph folgt hier dem Dichter Baudelaire, für den die gewöhnlichen Waren zur „absoluten Ware erhoben“ käufliche Kunstwerke werden – und somit „reine Objekte“, die Verführung und andere Wirkungen produzieren. „Wie wir wissen, können die Wirkungen auch gleich Null sein, aber es ist die Aufgabe des Kunstwerkes, diese Nullität zu fetischisieren…“ Von diesem sozusagen letzten Auf-Begehren der Dinge als Ware/Kunst nun zurück zu ihrem Nullpunkt – als sie noch (bitter) gebraucht wurden:
In Erwin Strittmatters Heimatort Bohsdorf in der Niederlausitz z.B. sah die „Stunde Null“ 1945 so aus, dass die Dagebliebenen und bis dahin Zurückgekehrten, die wenigen Überlebenden, sich auf dem Dorfplatz „Unter Eechen“ trafen, alle noch brauchbaren Dinge aus den zerstörten Häusern zusammentrugen – und sie gerecht unter sich aufteilten. Die Idee dazu hatte der alte Grubenwächter Nickel. Eine Frau, die diesen kurzen aber „vollkommenen Kommunismus“ nicht miterlebt hatte, sah später eine andere in ihrer Samtjacke herumlaufen: „Eine Frechheit, denkt sie. Daheim beschwichtigt sie später ihr Mann, er will nicht, dass seine Frau gegen die edle Stunde aufmuckt.“
Schon der erste Weltkrieg hatte die Waren bzw. ihre Werte in Mitleidenschaft gezogen: u.a. die „Zigarillos“. Der Wiener Alfred Polgar notierte damals: „Vor dem Krieg kannten sie nur wenige Zigarrenraucher. Heute kennen nur wenige Zigarrenraucher eine andere Sorte. Was nämlich die Welt der Dinge anlangt, so hat der Krieg die Erniedrigten erhöht, und die Kleinen, Unbekannten, Mißachteten zur Geltung gebracht. Im Reich der Sachen ist das Proletariat heute obenauf. Also wurden auch die Zigarillos populär, von denen vorher kein Mensch was wußte, und von denen die, welche was wußten, nichts wissen wollten.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg listete der Dichter Günter Eich, als er sich noch in englischer Kriegsgefangenschaft befand, die ihm verbliebenen „letzten Dinge“ in einem kurzen Gedicht mit dem Titel „Inventur“ auf: Mütze, Mantel, Rasierzeug, Brotbeutel, Socken, Handtuch, Zwirn…Es war nicht mehr viel übrig geblieben.
Ebenfalls um eine solche „Inventur“ (der Nachkriegszeit allerdings) ging es 50 Jahre später in einer gleichnamigen Ausstellung des Neuköllner Heimatmuseums. Dabei beeindruckten jedoch nicht mehr die Dinge an sich, erst recht nicht ihr (ursprünglicher) Gebrauchswert, sondern die Geschichten, die etwa ein Dutzend Autoren dazu erzählten. So beschrieb z.B. der in Neukölln aufgewachsene Künstler Thomas Kapielski den distinktiven Ding-Konsum – ausgehend von ihren großen Lagern (Karstadt am Hermannplatz und Hertie an der Karl-Marx-Straße) bis in die Vorwerke des „Problembezirks“: „Sah ich vier Wasserkessel, wußte ich, welchen Britz kauft, welchen Rudow bevorzugt, welchen Buckow wählt und welchen Neukölln. Alles bekam eine Klarheit, eine verstehende Ordnung…Wo der Rudower einen schlichten Dachgepäckträger auf dem alten Kombi zu Nutzschmuck macht, muß der Neuköllner des Zentrums Kredit auf ein Surfbrett nehmen. Der Buckower setzt sublim die Moden in Umlauf, denen der Neuköllner rastlos nachzulaufen sich verschrieben hat.“
Der Künstler konnte sich hierbei auf den Jesuiten Michel de Certeau berufen, der in seinen „kriegswissenschaftlichen Analysen“ der „Alltagspraktiken des gemeinen Mannes“, die er auch „Aktivitäten von Verbrauchern“ und „Konsum-Taktiken“ nennt, als eine „Sekundär-Produktion“ begriff („Die Kunst des Handelns“, 1988). Dabei geht Certeau davon aus, „dass die Verbraucher, so wie die Indianer, mit und in der herrschenden Kulturökonomie die zahlreichen und unendlichen Metamorphosen des Gesetzes dieser Ökonomie in die Ökonomie ihrer eigenen Interessen und Regeln ‚umfrisieren‘. In den elektronisierten, informatisierten Riesenstädten und ihren immer engmaschigeren Systemen „löst sich das Individuum von ihnen, ohne ihnen entkommen zu können; es bleibt ihm nur, sie immer wieder zu überlisten, ‚Coups zu landen'“, wobei es auf die Kunst von früheren Jägern, Landlauten und Wilderern zurtückgreift. Certeau spricht dabei von einer „operativen Logik“ der Konsumenten, für die es möglicherweise schon Beispiele „in den Jahrtausende alten Finten sich tarnender Fische und Proteus-Insekten gibt und die überall von der heute in der westlichen Welt vorherschenden Rationalität verdeckt wird.“
Aus der Sammlung der Museums-Exponate in der Neuköllner Ausstellung ist mir ein hölzerner Kochlöffel auf weißem Sockel in Erinnerung: Solche Dinger gaben die Mütter in der zwischen Britz, Buckow und Rudow gelegenen Neubausiedlung Gropiusstadt ihren kleinen Kindern mit auf die Straße, damit sie später an die zu hoch angebrachten Wohnungsklingeln rankamen, wenn sie wieder ins Haus wollten. Die großen Kinder machten sich einen Spaß daraus, ihnen die Löffel abzujagen. Diese Geschichte fanden die Ausstellungskuratoren in einem Buch über die in Gropiusstadt aufgewachsene „Christiane F: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.
Manche Ding-Geschichten erzählen sich auch quasi von selbst: So z.B. die Foto-Ausstellung der Zeitschrift GEO, die eine internationale Fotografengruppe 1994 in 30 Ländern rund um den Globus zusammenstellte. Dazu hatten sie jeweils eine Familie gebeten, ihr gesamtes Hab und Gut vor ihrer Wohnstätte aufzubauen – und sich davor ablichten zu lassen. Einige afrikanische Familien besaßen gerade einmal 30 Dinge, westeuropäische Haushalte im Durchschnitt über 10.000.
Die Geschichte eines Gegenstandes kann auf der anderen Seite aber auch so privat sein, dass eigentlich nur noch sie – die schriftliche oder mündliche Erzählung – Bedeutung hat. Das Ding wäre dann eine bloße Zugabe. Erwähnt sei dazu Pablo Nerudas „Ode an die Dinge“ und Arundhati Roys Erinnerungs-Roman: „Der Gott der kleinen Dinge“.
Der dem alten Istanbuler Bürgertum nachhängende Schriftsteller Orhan Pamuk will demnächst mit seinem „Museum der Unschuld“ diese oder ähnliche Privatgeschichten quasi wieder rückverwandeln in Dinge. Die Süddeutsche Zeitung zeigte dazu kürzlich Fotographien von etwa 50 Objekten aus der Pamuk-„Sammlung“ – verbunden mit der Behauptung: „So wie Augenblicke durch die Zeit müssen Gegenstände durch eine Geschichte verbunden sein.“ Leseprobe: „Das Gebiss nahm ich an mich, schlug es in ein Taschentuch und steckte es ein, dann ging ich ins Wohnzimmer und setzte mich meiner Mutter gegenüber in den Sessel meines Vaters. ‚Mama, ich nehme Papas Gebiß mit. Nur damit du dich nicht wunderst. Sie machte eine Geste, die wohl bedeuten sollte: ‚Wie du meinst‘.“
Dieses Ding – das Gebiß – wird nun vielleicht ein Exponat. Aber brauchen Pamuks Geschichten so etwas? Er wolle mit solch „Zufälligem“ die Allgemeinheit „erfreuen“, erzählte er der Süddeutschen Zeitung. Wir bewegen uns auf dem Feld der Belletristik und der Kunst. Dazu gehört auch die Satire – einer „Arnold-Haus-Schau“ etwa, die zeigt, was für Geschichten dabei z.B. herauskommen, „Wenn das Milchkännchen erzählen könnte“. Gut dass es nicht erzählen kann, heißt es am Ende fast erleichtert.
Zu einem ähnlichen Schluß kommt auch ein kurzer polnischer Dokumentarfilm über vier Männer aus Polen, die in einem westdeutschen Vergnügungspark als Ahörnchen, Bhörnchen, Pellepinguin und Balduin der Bär beschäftigt sind, wo sie unaufhörlich die Kinder zum „Fröhlichsein und Singen“ animieren müssen. Eigentlich – im Inneren sozusagen – sind sie jedoch so unglücklich, aus familiären und gesundheitlichen Gründen, dass ihnen eher nach Selbstmord zumute ist. Hier stemmt sich das Ding – Ahörnchen z.B. – gegen die Geschichte – wie gegen „seine“ innere Wahrheit.
Das Gegenteil ist der Fall bei den Geschichten des 1990 gestorbenen sowjetischen Schriftstellers Sergej Dowlatow – z.B. in seinem Roman „Der Koffer“, der ganz ohne Abbildungen/Exponate auskommt: Es geht darin um die wenigen Dinge, die er 1978 mit in die USA – in die Emigration – schleppte: Finnische Acrylsocken, Nomenklatur-Schuhe, ein gediegener Zweireiher, ein Offiziersgürtel, eine Jacke von Fernand Léger, ein Popeline-Hemd, eine Wintermütze und ein Paar Autohandschuhe. Ihre Glaubwürdigkeit beziehen „deren“ Geschichten aus ihrer mehr oder weniger unglücklichen Besitznahme durch den Autor und der Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber in der Schilderung. Um die Glaubwürdigkeit der Gegenstände selbst, ging es dem Regisseur Otar Josseliani in seinem Film „Die Günstlinge des Mondes“ : „Dinge wechseln den Besitzer, gehen im Tausch der Ware gegen Geld von Hand zu Hand und begründen damit ihre eigenen kleinen Geschichten,“ schreibt ein Filmkritiker.
Wenn wir bei der Wahrheit sind, berühren wir gesichertes Wissen, ganze Wissenschaften. Neuerdings haben zwei taz-Redakteure, Stefan Kuzmany und Peter Unfried, Sachbücher über einige Dinge geschrieben – aus der Sichtweise von aufgeklärten Kosumenten, die ihre Kenntnisse (um ökologische Zusammenhänge) gewissermaßen in die Tat umsetzten: „Konsumieren lernen, aber richtig“ heißt das erste – von Kuzmany über „Gute Marken – Böse Marken“; und schlicht „Öko“ das andere von Unfried über „Al Gore, der neue Kühlschrank und ich“. Bei beiden Büchern handelt es sich um „Selbstversuche“, d.h. es geht um Geschichten, die dabei entstehen, wenn man der Herstellung und dem Vertrieb eines Konsumgegenstands nachgeht.
Kuzmany und Unfried haben beide einen Bruder, der es besser weiß, sowie eine Freundin/Frau, die sie besser kennen. Kuzmanys konsumkritische Selbsterziehung beginnt damit, „wie ich lernte, McDonald’s nicht mehr zu lieben“. Bei seinen weiteren Produktrecherchen wird man mitunter an das erzählende Milchkännchen aus der „Arnold-Hau-Schau“ erinnert. So als er die „Sara-Lee“-Produkte aus dem Badezimmer verbannte: „Zu meinem Erstaunen meldete sich da plötzlich der Drum-Drehtabak in meiner Hemdtasche: ‚Lass mich raus! Ich will weg!‘ ‚Du bleibst schön hier‘. Das hätte mir gerade noch gefehlt. ‚Erzähl mir nicht, dass du eigentlich Drum von Sara Lee heißt, Kumpel’…“ Nein, aber der Drehtabak gestand ihm dann, dass er von Douwe Egberts aus Holland stamme – und diese Firma gehöre Sara Lee. Kuzmany wußte es jedoch besser: Der Geschäftszweig Tabak war bei Sara Lees Übernahme abgetrennt und an „Imperial Tobacco“ verkauft worden. Und überhaupt geht es dem Autor dabei eigentlich um das gesundheitsschädliche Rauchen.
Im nächsten Kapitel um das Problem: Was mache ich mit meinem alten Computer, wenn ich mir einen neuen, leistungsstärkeren kaufe? – Weltweit fallen bereits stündlich 4000 Tonnen giftiger Elektroschrott an. Außerdem sollte man auch noch die PC-Produktionsbedingungen beachten. Kuzmany steht dabei mit seinem Bruder im Wettbewerb: „Wessen Rechner ist fairer hergestellt?“
In seinem Kapitel über Oberhemden erwähnt Kuzmany ein extremes Beispiel von „fair trade“: 2005 kaufte eine Kölnerin ein Hemd für ihren Mann, in dem sich ein Zettel des Textilarbeiters befand, der es hergestellt hatte – in einer Fabrik in Bangladesh. Die Frau recherchierte erst dessen Authentizität, dann schickte sie ihm Geld. Als der Textilarbeiter um mehr bat, schickte sie ihm weiteres Geld. Rückte dafür jedoch bald mit einem ganzen Team von SternTV bei ihm an. In dem Film über diese Begegnung zwischen Konsument und Produzent meinte sie dann: „Nach der Geburt meiner Kinder war das Treffen mit Gazi das schönste Erlebnis, das ich je hatte.“
Wie Unfried macht auch Kuzmany irgendwann bei den Billigflügen die CO2-Rechnung auf. Nachdem er sich zum Verzicht auf solche Flüge durchgerungen hat, wird auch dieser Entschluß seinem persönlichen CO2-Ausstoß sozusagen gutgeschrieben. Auch eine anschließende Suche nach dem konkreten Huhn (nennen wir es Lotte), das seine Bio-Eier legte, löst sich ihm in Logarithmen auf – insofern die Eierfarm zwar auf ihrer Internetseite mitteilt, wieviel Prozent ihrer Hühner gerade freilaufen, eierlegen, schlafen usw., aber das ist ein Computer-Programm, das mit den Hühnern auf der Farm nichts zu tun hat. Außerdem befindet Lotte sich, so sie überhaupt existiert, auf einer ganz anderen Farm. Und die Firmen, die das Bio ihrer Eier zertifizieren, gibt es gar nicht oder nicht mehr. Obwohl Kuzmany verspricht, weiter nach der angeblich glücklichen „Bio-Henne“ zu forschen, lautet sein Fazit schon jetzt: „Wir müssen den Konzernen ständig einen Grund geben, ihre Produkte noch umweltfreundlicher zu machen und ihre Angestellten noch besser zu behandeln.“
Dem zweiten taz-Autor, Peter Unfried, geht es demgegenüber eher darum, das energieeffizienteste Produkt zu finden und zu kaufen. Obwohl er anscheinend über eine größere Kaufkraft als Kuzmany verfügt, immerhin hat er eine Eigentumswohnung, endet seine Recherche im Selbstversuch ebenfalls mit einem Mix aus Reduzierung der Wünsche (die jährlichen Kalifornienflüge z.B.) und der Reduzierung des persönlichen CO2-Ausstoß beim Kauf (eines Autos z.B.). Mit diesem neuen „Dreiliter“-Auto begann im übrigen das ökologische Denken und Handeln von Unfried, Nun meint er, ein „Loha“-Leben zu pflegen (einen „Lifestyle of Health and Sustainability“). Die Definition dessen übernimmt er vom Hamburger „Trendforscher“ Mathias Horx: Die Lohas integrieren „bisher als widersprüchlich angesehene Bedürfnisse wie Nachhaltigkeit und Genuss, Umweltorientierung und Design, Ethik und Luxus, Einfachheit und Technik.“ Sie denken nicht mehr wie der „querulatorische Njet-Set – die 68er“ in „Entweder-Oder-Kategorien“. Wobei es bei „Nachhaltigkeit“ und „Technik“ um „Effizienz“ geht – vor allem bei Unfrieds Bruder, der dafür jedoch „keinerlei Produktgefühle“ hat. Während für den Autor gilt: „Der Kauf eines energieeffizienten Kühlschranks kann glücklich machen. Selbstverständlich nur in der Edelstahlausführung.“
Bei seiner Ökostrom-Recherche hat Unfried die glückliche Idee gehabt, Rocko Schamoni zu fragen, ob mit Ökostrom betriebene Gitarren auch besser klingen? Der verneinte das: „Atomfreie Gitarrentöne klingen schleimig, ohne Biss, anbiedernd, tesstubenhaft, weicheimäßig.“
Unfried bemühte sich dennoch weiter, den Klimawandel qua eigener Lebensführung zu stoppen – mit Energiesparlampen, jede Menge Sachbücher zum Thema usw..Da kam schon der nächste Einwand: „‚Du bist doch überhaupt kein Öko‘. So was sagt meine liebe Frau gerne mal.“ Von der neuen Idee läßt er sich jedoch nicht mehr abbringen: „Wir kaufen nur noch gute Waren, die ökologischen und sozialen Mehrwert haben.“ Er liegt damit voll im „Trend“, wie nicht nur das Hamburger „Trendbüro“, die Berliner „Intelligenzagentur“ und der Kulturwissenschaftler Nico Stehr ihm z.T. persönlich bestätigen. Die US-Futorologin Patricia Aburdene spricht sogar von einem „Megatrend“. Vor allem hat Unfried dann aber der Öko-Film des US-Politikers Al Gore „angemacht, wie man so sagt. Während die gefilmeten Selbstversuche der Amerikaner: Leo Hickmans „Fast nackt“ – über ein ökologisch und ethisch geführtes Leben, und Morgans Spurlocks „Supersize me“ – über eine konsequente Fastfood-Ernährung, ihm die Richtung des Handelns wiesen. Ähnlich wie Kuzmany aß Unfried daraufhin erst mal einen Hamburger – seinen letzten. Von dem engagierten Autor des McDonald’s-Buches „Fast Food Nation“, Eric Schlosser, mußte er sich dann allerdings sagen lassen: „Der wahre Wandel kommt durch kollektive Aktion und nicht durch individuelle Wahl.“
Über solche Einwände, darunter auch die von Adorno über das richtige und das falsche Leben, geht Unfried leichtfüßig hinweg. In der taz-Redaktion hält man ihn, den stellvertretenden Chefredakteur, nebenbeibemerkt für einen Verfechter der schwarz-grünen Koalition. Sein „bescheidenes“ persönliches Ziel lautet indes – am Ende des Buches: „80 Prozent weniger [CO2-Ausstoß] und nur noch erneuerbare Energie verbrauchen.“
Solche oder ähnliche „Umwelt“-Geschichten als pragmatische „Detailstudien“ häufen sich spätestens seit den Siebzigerjahren und den „Reports“ des 1968 gegründeten Club of Rome – „zur Lage der Menschheit“. Man könnte in diesem Zusammenhang auch – mit dem Kulturwissenschaftler Nico Stehr – von einer „Moralisierung der Märkte“ sprechen, die mehr und mehr zum „Bestandteil der Produktions- und Konsumtionsprozesse“ wird – ohne dabei einen „Bruch mit dem Kapitalismus zu signalisieren“.
Aus der Landkommunenbewegung heraus entstand dazu 1981 ein moralisch oder ethisch motivierter Selbstversuch von Peter Mosler im hessischen Vogelsberg: „Die vielen Dinge machen arm“. Während zur gleichen Zeit einige größere Land-Genossenschaften – wie die „AA-Kommune Friedrichshof“ und die „Longo-Mai-Kooperative“ – alles Eigentum kollektivierten und (dadurch) gleichzeitig reduzierten.
1995 verbanden sich diese und ähnliche Konsumkritiken noch mit eher produktivistisch orientierten Ding-Geschichten – z.B. in der Werkbund-Wanderausstellung „Welche Dinge braucht der Mensch?“ Sie fand unter der Schirmherschaft von Ernst Ulrich von Weizsäcker statt – damals noch Präsident des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie. U.a. stellte dort Karl August Chassé eine Ding-Forschung anhand der „Lebensbedingungen von Sozialhilfeempfängern“ vor. Damit zeigte er, „daß, je länger Armut andauert, desto stärker die Einschränkungen in entscheidenden Lebensbereichen werden. Am Beginn einer Armutsphase läßt sich gleichsam noch von der Substanz leben.“ Erst nach und nach werden die Anzüge fadenscheinig und die Dinge weniger, wird Urlaub, Auto, Telefon, Tageszeitung usw. „abgeschrieben“.
Wir befinden uns hier und jetzt wahrscheinlich noch in der ersten Phase, aber schon drängen andere als konsumistische „Warenanalysen“ (wieder) auf den Markt. Zitiert sei eine marxistische – von Robert Kurz aus seinem Buch „Weltkapital“, die sich explizit gegen eine ökologische Geschichte richtet – nämlich gegen die des französischen Bauernaktivisten José Bové, die dieser 1999 in einem „Manifest“ veröffentlichte. Darin heißt es, dass „die bäuerliche Landwirtschaft wirtschaftlich effizient sein und eine hohe Wertschöpfung aufweisen muß.“ Dies sei „Voraussetzung für die Produktion von Qualität.“ Robert Kurz warf Bové und seiner neuen Bauerngewerkschaft daraufhin vor, „sie denken selber in den Katagorien der Ware und wollen sich gar keine Vorstellung über eine Welt jenseits davon machen…Was dann als vermeintliche Kritik einer Welt der Waren übrig bleibt, ist nichts als eine verkürzte und nebelhafte Denunziation von (subjektiver) ‚Profitgier‘ und ‚Geldgeilheit’…Das Geld ist aber nur die Erscheinungsform der universellen Warenproduktion, nicht deren Wesen, das in ‚abstrakter Arbeit‘ und Wertform gründet.“ Im Zusammenhang der US-Finanzkrise ist nun 2008 erneut wieder in allen bürgerlichen Medien von übergrosser „Gier“ die Rede.
Ohne hier näher auf den Unterschied zwischen Wertschöpfung und Wertform einzugehen, wollen wir der Marxschen „Warenanalyse“ immerhin entnehmen, dass der Ware ein „Fetischcharakter“ eigen ist und sie „voller theologischer Mucken“ steckt. Man erinnert sich vielleicht an den „Cargo-Cult“ – einiger Stämme in Papua-Neuguinea, die mehrmals mit „dem Lebensnotwendigen“ versorgt wurden – von Hilfsorganisationen aus der Luft. Die Betroffenen entwickelten darüber eine regelrechte Transportflugzeug-Verehrung, die einer neuen Religion gleichkam – mit Holzflugzeugen als Fetische.
Die Geschichte ähnelt den „Forschungen eines Hundes“ von Franz Kafka aus dem Jahr 1922. Es sind Analysen über den Ursprung der Lebensmittel – seiner Nahrung, die alle voraussetzen, dass diese von oben – aus der Luft gewissermaßen – kommen (so wie bereits die alte Menschheitsidee, dass alle guten Dinge von Gott kommen). Obwohl die „Forschungen“ also nur angestellt wurden, um die Herkunft des Hundfutters vom Herrn (Herrchen) zu ermitteln, wird dieser darin ausgeklammert. Kafkas Text ist somit eine Kritik an den bürgerlichen Wirtschaftswissenschaften, die auch alle das voraussetzen, was sie vorgeben, erst erforschen zu wollen: die Quelle allen Reichtums (des Gewinns). Zugleich ist Kafkas Hundeforschung aber auch eine antitheologische Satire.
Bereits 1899 veröffentlichte der US-Philosoph Thorstein Veblen eine „Theorie der feinen Leute“, in der es ihm um den Drang nach Prestige-Dingen ging – d.h. um „demonstrativen Konsum“, wobei für ihn das „Prestige“ etwas war, was primitive Gesellschaften eng mit einer Zaubermacht verbinden. Veblen war „einer der ersten, der sich von der dominanten Produzenten-Orientierung abwandte und die Kategorie des Verbrauchs als ein sowohl gesellschaftliches als auch ökonomisches Phänomen entdeckte,“ merkt Nico Stehr dazu an. Viele Rezensenten bezeichnen seine Analyse als Satire.
In dem dreibändigen Roman von Erwin Strittmatter „Der Laden“, gemeint ist damit das Bohsdorfer Einzelhandelsgeschäft seiner Mutter, wird der Ursprung, besser gesagt: das Herkommen der Waren (und zugleich auch das vieler neuer Wörter) sozialgeographisch begriffen: Sie folgen den Schiffsrouten, Eisenbahnstrecken sowie Landstraßen – und gelangen auf diesen Wegen von New York, Paris oder London über Berlin nach Cottbus, dann nach Spremberg und schließlich in Strittmatters Dorf. Nicht selten geschieht das im Zusammenhang einer „Mode“ und diese kommt meist von oben, d.h. von den großstädtischen und prestigeträchtigen, gleichwohl selbstermächtigten „Eliten“. Und sie breitet sich nach Art einer „Ansteckung“ aus, die man sich vielleicht gar nicht grippeähnlich genug vorstellen kann, jedenfalls dann, wenn man dem Soziologen Roger Caillois in seiner 1960 veröffentlichten „Mimese/Mimikry“-Forschung folgt. Auch Strittmatter spricht noch von Ansteckung – bei all den Ding-Moden, die den Weg in den Dorfladen seiner Mutter fanden, die dafür eine Mode-Zeitschrift abonniert hatte.
Über Strittmatters sorbische Heimat heißt es heute: „Die Lausitz hat als Industrie- und Wirtschaftsstandort eine sehr gute Zukunft, aber nur, wenn sie sich als Bestandteil der Hauptstadtregion versteht und entsprechend vermarktet,“ so der Leiter der Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB) Detlef Stronk. Ausdrücklich lobt die ZAB dabei das TIP – den „Technologie- und Industriepark“ Cottbus. Für Robert Kurz ist solch ein Denken Ausdruck einer Art von „Schlußverkauf“ – d.h. der Anfang vom Ende, jedenfalls der Nationalökonomien, die seit den nun transnational operierenden Betriebsökonomien obsolet geworden sind und selbst nur noch betriebswirtschaftlich agieren können – einmal, indem sie gegeneinander und bis runter zu den letzten Großgemeinden „Standortmarketing“ betreiben, gleichzeitig ihre ganze Infrastruktur verscherbeln („wenn dabei jedoch die Konkurrenz eingeführt wird, dann ist es keine Infrastruktur mehr“) und zum anderen, indem sie sich bald nur noch auf Sicherheitsaufgaben beschränken. Hintergrund dafür ist die Verselbständigung des Finanzkapitals – mit der die materielle Produktion zu einem „Nebeneffekt“ geworden ist, von dem jedoch „das Wohl und Wehe von Betrieben und ganzen Regionen abhängt, die nicht aus ihrem ‚Standort‘ aussteigen können, so wenig wie ein Mensch aus seinem Körper.“
In der Frankfurter Werkbund-Ausstellung wurde diese Ding- bzw. Waren-Ausweitung nicht thematisiert (sie war noch nicht in den Blick geraten), dafür wurde jedoch noch einmal ausführlich die schon im Titel „Welche Dinge braucht der Mensch?“ anklingende Frage von Herbert Marcuse nach den wahren und falschen Bedürfnissen der Menschen diskutiert. Sein Ansatz steht in gewisser Weise quer zu der konsumistischen Forderung nach ökologisch sauberen und handwerklich ordentlichen „Qualitätsprodukten“ – wie sie die taz-Redakteure Peter Unfried und Stefan Kuzmany formulierten, aber auch zu Richard Sennetts Buch „Handwerk“ und – neuerdings, ihm darin folgend – zu Holm Friebes und Thomas Ramges Trendstudie „Marke Eigenbau“. Dafür kommt jedoch die Diskussion über wahre und falsche Bedürfnisse anthropologisch regelmäßig in Teufels Küche.
Auch Marxisten wie Paul Cockshott und Allin Cottrell, die sich neuerdings für die Computertechnik und speziell das World Wide Web begeistern, weil damit (endlich) eine optimale Steuerung („Kybernetik“ auf Griechisch) der Gesellschaft, insbesondere ihrer Produktion und Verteilung, möglich wird, entkommen diesem „Bedürfnisproblem“ nur halb. Es ist dabei von einer „vernetzten Rätemacht“ und einer „Planwirtschaft auf der Höhe der Zeit“ die Rede.
1983 veröffentlichte der Kanadier Robert Blondin das Ergebnis einer Recherche rund um den Globus: „Le bonheur possible“. Sein Ziel war es, die glücklichsten Menschen zu finden. Er befragte mehr als 2000 Menschen und fand dabei heraus, dass jene besonders glücklich waren, die aus einer Krise gestärkt hervorgegangen sind und nicht jene, die eher von ihren Bekannten als glücklich eingeschätzt wurden, weil sie zu den Reichen, Schönen und Mächtigen zählen. Seine „Glücksformel“ lautete schließlich: „Glückliche Menschen ziehen das Wesentliche dem schmückenden Beiwerk vor, das Sein dem Haben, das Nützliche dem Angenehmen, das Dauerhafte dem Flüchtigen, das Ausreichende dem Zuviel, das Notwendige dem Überfluss, kurz: die Bedürfnisse dem Wünschen und Begehren.“ Der Medientheoretiker Norbert Bolz wandte dagegen 2008 ein: „Wir haben gar keine Bedürfnisse mehr. Wann haben Sie das letzte Mal Kleider gekauft, weil Ihnen kalt war?“
In der Werkbund-Ausstellung 1995 machen sich gleich mehrere Autoren Gedanken über die Dauer – d.h. die Langlebigkeit – von Produkten. Sie ist sowohl im Sinne der Ökologie als auch der Verbraucher. Die Geschichten über Sollbruchstellen und andere lebensdauerverkürzende Maßnahmen an den Dingen sind mittlerweile Legion. Für gewöhnlich wird dafür im Westen die Kartell- bzw. Monopolbildung in bestimmten Branchen verantwortlich gemacht, und im Osten die sozialistische (arbeiterselbstherrliche) Schlamperei, verbunden mit einem ständigen Materialmangel – in beiden Fällen also die Produktionsverhältnisse.
Die Stiftung „Warentest“ meinte unterdes, „die Braunware brauchen wir gar nicht mehr auf Haltbarkeit zu testen, bevor unsere Ergebnisse rauskommen, haben die Hersteller schon drei neue Modelle auf den Markt geworfen.“ Darüberhinaus erfinden sie laufend neue Anschluß-Geräte. Auch diesen Produktideen ist ein Kapitel im Werkbund-Katalog gewidmet.
Konservative Gesellschaftskritiker wie der Amerikaner Daniel Bell sahen insbesondere in der immer aufwendiger werdenden Werbung für die Dinge (bis hin zur Ware „Erlebnis“) die Gefahr, dass sie – verbunden „mit den Emblemen von Glamour und Sex“ – aus Konsumenten hedonistische Kretins macht, für die „nicht mehr die Arbeit“, sondern allein der „Lebensstil“ zählt. Das kommt dabei raus, wenn man es dem Individuum erlaubt, all „seine Bedürfnisse zu befriedigen“! Der Kulturkonservative Bell berührt sich hier mit dem Gesellschaftskritiker Marcuse, der den von der Kapitallogik aufgezwungenen Wunsch der Massen, ständig „shoppen“ zu gehen – und dafür immer angestrengter „jobben“ zu müssen, als „repressive Entsublimierung“ – als eine unterdrückerische Toleranz bezeichnete.
Viele empfinden auch das angestrengt ökologische „Shopping“ als eine üble Zumutung. Obwohl sie zustimmen: „Die Preise sagen ‚Kauf mich‘, aber sie sagen nicht die ökologische Wahrheit,“ wie es bei Ernst Ulrich von Weizsäcker im Katalog-Vorwort heißt. Zu diesem Problem organisierte der Bremer Künstler Andreas Wegner 1998 in Wien eine Verkaufsausstellung, die er „Point of Sale“ nannte. Dazu mietete er einen großen leerstehenden Laden, wo er rund 2000 Lebensmittel verkaufte, in deren Preise er die gesellschaftlichen Folgekosten, die bei Herstellung und Transport entstehen, eingerechnet hatte. Auf diese Weise kosteten die normalen Supermarktprodukte bei ihm etwa drei Mal so viel wie die Bio-Produkte. Er beendete die Verkaufsausstellung mit einem gehörigen Verlust.
Ernst Ulrich von Weizsäcker beruft sich im Katalog-Vorwort u.a. auf Ivan Illich, der in seinem „Selbstbegrenzung“ die Rechnung aufgemacht hatte: Wenn der „typische Amerikaner“ nur 1500 Stunden im Jahr für sein Auto aufwendet, um das Geld für Benzin, Steuer und Versicherung zu verdienen, um mit dem Auto zu fahren, einzuparken, es zu waschen usw., und damit durchschnittlich 10.000 km jährlich zurücklegt, dann braucht er für sechs Kilometer eine Lebensstunde. „So gesehen erscheint der Autofahrer als groteske Figur, denn er bewegt sich mit seinem aufwendigen Fahrzeug langsamer fort als jeder Radfahrer.“
Peter Unfried konzentriert sich – anders als diese Konsumgegner – nun eher auf die unterschiedliche „Ökobilanz“ der einzelnen Auto-Fabrikate („Marken“). Immerhin kommt er, aber auch Kuzmany, morgens mit dem Fahrrad zur taz. Aber das ist eine andere Ding-Geschichte – das sogenannte „taz-fahrrad“.
Eine Zeitlang standen dabei in der Anschaffungskommission des „taz-shops“ die neuen ökologisch-technischen Gesichtspunkte gegen die alte produktivistisch-arbeiterliche Solidaritätsforderung. Deren Verfechter hätten gerne die „Strike-Bikes“ aus Nordhausen, wo die Arbeiter gerade ihre Fabrik besetzt hatten, in die taz-Dingwelt aufgenommen – statt wie bisher die Fahrräder des „Velo de Ville“-Vertriebs bei Münster. Die Geschichte des „Strike-Bikes“ begann mit einer Idee der Hamburger Anarchisten von der FAU, indem sie der Belegschaft nahelegten, während ihres Streiks doch die Produktion – in Eigenregie – wieder aufzunehmen, obwohl die Fabrikbesitzer, amerikanische Investoren, die Hälfte der Produktionsanlagen abtransportiert hatten. Am Ende entstand daraus ein wenn auch erst einmal kleiner „selbstverwalteter Betrieb“. Ähnliches geschah ab 1973 auch bei der französischen Uhrenfabrik LIP. Schon bald trugen alle Linken aus Solidarität eine Armbanduhr von LIP. Die Arbeiter gründeten eine Genossenschaft. Bei der 2001 besetzten argentinischen Kachelfabrik Zanon war das schon schwieriger – mit den Solidaritätsabkäufen. Aber heute ist Zanon ebenfalls eine Genossenschaft und hat ihre Mitarbeiterzahl bereits von 200 auf fast 400 verdoppelt.
Etwas anders verlief die Geschichte des ersten FCKW-freien Kühlschranks, den der VEB dkk Scharfenstein im Erzgebirge nach der Wende mit einem Patent der Umweltschutzorganisation Greenpeace herstellte. Dadurch entkam das Werk der Abwicklung durch die Treuhandanstalt. Heute ist die „Foron“-Fabrik eine Tochtergesellschaft der italienischen Antonio Merloni S.p.A. Fabriano, einem weltweit tätigen Hausgerätehersteller. Den seinerzeit für dieses Greenpeace-Projekt Verantwortlichen Benny Härlin interessierten die Industriearbeitsplätze im Erzgebirge zu keiner Zeit, nur der weltweite Ersatz aller Kühlschränke durch FCKW-freie. Sein Engagement war vor allem konsumistisch motiviert.
Statt eines neuen Produkts oder einer selbstorganisierten Produktion auf kleiner Flamme entschied man sich beim Ostberliner Batteriewerk BAE/Belfa nach der Wende für einen bloßen Etikettenschwindel: In einer neugeschaffenen „Geheimabteilung“ wurden statt der eigenen Batterien einfach billige aus Indien mit dem Belfa-Logo überklebt. Als zwei Münchner Investoren das Werk übernahmen wurde daraus eine „Nischen- und Private Label“-Strategie, d.h. die Eigenproduktion wurde gänzlich eingestellt und nur noch Importbatterien mit „Marilyn Monroe-“ und „Bayern München“-Motiven beklebt. Wegen Qualitäts- und dann auch Absatzproblemen ging die Fabrik 1998 pleite.
Erwin Strittmatter erwähnt ebenfalls eine Art „Geheimabteilung“, zu der sich die Frauen seiner „Sippe“ in der ersten Zeit nach dem Krieg regelmäßig zusammenfanden – ähnlich wie früher in der „Spinnstube“. Sie klebten dort für die Abrechnung mit der sowjetischen Verwaltung Lebensmittelkarten zusammen: jeweils 100 Stück auf einen Bogen. Seine Schwägerin Elvira klebte jedoch immer nur 90 drauf – ohne dass es jemandem auffiel. „Alles Technik! sagt Elvira.“
Es gibt eine Produktkultur, für deren gedeihliche Entwicklung sich u.a. der Deutsche Werkbund einsetzt, ihre neueste Blüte sind Auktionen für Sammler von Gebrauchsgütern. In München wurden gerade Dinge aus Plaste (auf der „Plastic Fantastic“) verauktioniert. Die immer kürzeren Produktzyklen machen auch die banalsten Alltagsdinge schnell zu seltenen Objekten, deren Sammeln sich unter Umständen lohnt.
Es gibt auch noch andere Gründe dafür: „Sammeln ist Intimität mit dem Gegenstand, nicht mit dem Menschen,“ meint Iris Hanika – in einem „Alltags“-Heft zum Thema „Sammeln“, in dem sie Geschichten von (männlichen) Sammlern versammelte. Während es von Friebe und Ramge begrüßt wird, dass die Endverbraucher immer häufiger über die Produkte, die sie kaufen, reden, lautet Hanikas Résümee: Das Sammeln „ist ein Transportmittel zur Eroberung und Aneignung von Welt [nur], sofern sie sich auf das Sammeln bezieht.“ Hier klingt Karl Marx nach: „Das Privateigentum hat uns so dumm und einseitig gemacht, dass ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir ihn haben, besitzen.“
Die Münchner „Kunstzeitung“ spricht dagegen in ihrer Juliausgabe von „Helden des Konsums“ und meint damit die Sammler von Alltagsgegenständen bzw. Massenprodukten. Bei dieser „Konsumenten-Avantgarde“ sei es zu einer „Interessenverlagerung“ gekommen, „die einem Wandel in der Dingkultur entspringt: Je aufwendiger und differenzierter Konsumgüter gestaltet werden, desto mehr Bedeutungen artikulieren sich darin auch“.
Für den Autor, Wolfgang Ullrich, sind die Ding-Designer bereits „die wahren Interpreten unserer Zeit“, weil sie z.B. allein durch die „Gestaltung von Flaschenform und Verschlusskappe darüber entscheiden, ob man das Trinken von Mineralwasser als fitmachenden Event, als Akt der Entspannung oder als eine Art von Therapie empfindet“. Dagegen ließe sich einwenden, dass es eher die Inszenierungen des Produkts auf dem Markt sind, die der Interpretation gewissermaßen den Weg zu den Käufern weisen, als die Produktgestaltung von Anfang an. Solche Interpretationen sind rückläufig, d.h. sie holen irgendwann die Produzenten (und Produktdesigner) vom anderen Ende, vom Verbraucher her, ein. Dafür spricht auch Ullrichs eigener Befund, dass die „Konsumenten sich heute schon fast wie Sammler benehmen“. Das Sammeln ist ihm, indem es die Dinge durch Vergleich „zum Sprechen bringt, ein Verfahren, um Einsichten zu gewinnen“ – also eine Spielart der Aufklärung. So müssten sie – die Sammler – „sich [beispielsweise] darüber klar sein, warum oder wann sie einen Pfefferstreuer oder lieber eine große Pfeffermühle aus Holz oder aber ein elektrisches Modell mit gläsernem Körper haben wollen, ja was für einen Stellenwert das Pfeffern – und das Essen – dadurch jeweils erfährt. Wer sich mit dem Blick des Sammlers auf eine Kaufentscheidung vorbereitet, wird die Differenzen schnell erkennen und dann das Stück wählen, das den eigenen Vorstellungen am besten entspricht.“ Umgekehrt beherrsche jemand, der dabei die falsche Wahl trifft, „das Konsumieren als anspruchsvolle Kulturtechnik nicht“.
In der Frankfurter Werkbund-Ausstellung „Welche Dinge braucht der Mensch?“ war in diesem Zusammenhang noch (eher bedürfnis- als produkt- bzw. designorientiert) von einer Scheinwahl die Rede: Wolfgang Pauser erwähnte dort als „Beispiel die elektronische Pfeffermühle mit Beleuchtung! Das ‚Timing des Mahlverzögerungszyklus wird von einer internen Quarzuhr gesteuert, die mit 1/50.000 Sek. Genauigkeit arbeitet‘. Ist einmal der Akku aufgeladen und die Korngröße eingestellt, kann es losgehen: ‚Ein Druck auf den Sensor bewirkt, dass sich die Mühle öffnet und das Licht das zu pfeffernde Gericht beleuchtet…Bei sehr trockener Luft könnte es für einige Benutzer erforderlich sein, den Finger etwas anzufeuchten (nicht naßmachen!), um den Sensor zu aktivieren, da trockene Haut nicht so gut leitet‘. Frau Reckzügel, die in ihrer Wiener ‚Großhandelsagentur für neuzeitliche Haus- und Küchengeräte‘ derartige Nützlichkeiten vertreibt, kommentiert das Ding lakonisch: ‚Die komische Mühle ist nur für Leute, die schon alles haben. Dieser Blödsinn war der Renner zu Weihnachten‘.“
Der Autor folgert daraus: „Der Not der Konsumenten, nichts mehr zu brauchen, steht auf der Seite der Produzenten die Not gegenüber, kaum noch etwas verbessern zu können. Auf dem Boden dieser Pattstellung wuchern die Scheintechniken.“ – Die der Sammler durch Vergleiche natürlich auch wieder ebenso subtil wie liebhaberisch interpretieren könnte. Vorbilder dazu wären vielleicht Marcel Proust, Walter Benjamin und Francis Ponge, deren Bücher sich auch als Ding-Geschichten lesen lassen. „Es ist, als krieche Ponge in die Dinge hinein“, schreibt ein Rezensent über den Autor, der nach dem (schmutzigen) Krieg, in dem er der „Résistance“ angehört hatte, u.a. ein Buch über „Die Seife“ veröffentlichte, denn „über die Seife läßt sich viel sagen. Buchstäblich alles, was sie von sich selbst berichtet, bis zu ihrem völligen Verschwinden, bis zur Erschöpfung des Themas.“
Das „Museum der Dinge“ des Westberliner „Werkbund-Archivs“ sammelte eine zeitlang ausgehend von der Studentenbewegung solche Gegenstände – deren Geschichte ihnen jedoch gleichsam persönlich anhaftete – als Schicksalsschläge bzw. mehr oder weniger sichtbare Nutzungsspuren. So wie z.B. einige Dinge in den „Erinnerungen“ der in Prag geborenen Tito-Partisanin Jara Ribnikar. Die jugoslawischen Partisanen hatten sich einer strengen Moral unterworfen: Wer einem Bauern etwas stahl, wurde von seinen eigenen Kameraden erschossen. Die Autorin meldete sich zwei mal zu einem derartigen Erschießungskommando. „Einmal hatte eine junge Genossin nur ein Stück Seife gestohlen.“
Heute lädt das „Museum der Dinge“ und sein „Museumsladen“ zu einer „Nacht der Dinge“ ein und präsentiert dabei seinen jüngsten Katalog „Kampf der Dinge“. Auf seiner Webpage wirbt es mit dem „Ding des Monats“, stellt die neuen „Dingpfleger“ vor und weist ferner alle Ding-Liebhaber auf sein nächstes „Offenes Depot“ hin.
In der Neuköllner Verkaufsausstellung „Le Grand Magasin“ wurde für die Dinge, die da von den Produktivgenossenschaften aus ganz Europa kommen sollten, erst einmal ein Modell der Galerie von einem Architekten angefertigt und danach dann die aufwendig und farblich ausgetüftelten Regale gebaut. Als die ersten Produkte per Post ankamen und zur Probe ausgestellt wurden, zeigte es sich jedoch, dass die allzu schönen Stellflächen der (Massen-)Ware gewissermaßen die Show stahlen. Kurzentschlossen rissen die Ausstellungseinrichter daraufhin alle ihre Galerieeinbauten wieder ein – und installierten stattdessen einfache hellgraue Regale. Aber auch die mußten schließlich weichen: Nun sind die Produkte einfach in den Räumen arrangiert.
Nun zur Produktionskultur:
Im „Le Grand Magasin“ wird man darüber mit Schildern, Fotos, Filmen, Firmenkatalogen und anderen Werbematerialien sowie mit Veranstaltungen und einem Katalog informiert. Maxim Gorkij schlug einmal im sowjetischen Schriftstellerverband vor, eine Bibliothek mit Fabrik-Biographien zusammen zu stellen. Es kamen auch einige gute Bücher dabei heraus. Bereits seit Beginn der Arbeiterbewegung kennt man „Geschichten aus der Produktion“ – auch über die Herstellung von Dingen. Ähnlich hatten zuvor bereits die Bauern mit Beginn des Bauerkriegs das Wort in eigener Sache ergriffen. Bertold Brecht meinte sogar einmal: Eigentlich sei mit den altägyptischen Sklavenliedern bereits „alles gesagt“. Desungeachtet haben sich diese Geschichten inzwischen enorm vermehrt. Und auch wenn die Produktion selbst scheinbar hinter dem Horizont – bis hin nach China – verschwunden ist, so wurde doch hier z.B. gerade das Buch „Dagongmei“ von zwei Hongkonger Arbeitssoziologinnen, Pun Ngai und Li Wanwei, herausgegeben: „Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen“, lautet der Untertitel. 2002 lief auf der „Berlinale“ bereits ein sechstündiger Film von Wang Bing über die Abwicklung des riesigen Industriekomplexes „Tiexi District“ in der Hauptstadt der mandschurischen Provinz Liaoning, wo zu Hochzeiten bis zu einer Million Menschen arbeiteten. Der „Tiexi District“ war das Symbol für den „Traum einer Generation“, schrieb der Germanist und ehemalige Rotgardist Fang Yu dazu im Berlinale-Katalog.
Seit dem Ende des Sozialismus wurden bereits hunderte solcher Verabschiedungen des Proletariats gedreht. Hierzulande entstanden sie meist im Rahmen der Pflichtprogramme öffentlich-rechtlicher Sender – und befaßten sich z.B. mit der „letzten Schicht“ auf einem Lausitzer Braunkohlebagger, im Kalibergwerk Bischofferode und im Wolfener Filmwerk ORWO – oder mit der Abwicklung einer Textilfabrik in Bombay, einer Werkzeugmaschinenfabrik in Moskau, einer Kolchose in Polen. Berühmt wurde der amerikanische Dokumentarfilm über die Schließung der Chrysler-Fabrik in Flint „Roger and Me“ (von dem die IG Metall mehrere Kopien zu Schlungszwecken erwarb); ferner der englische Spielfilm „Brassed Off“ über die Arbeiter einer globalisierungungsbedingt platt gemachten Zeche in Yorkshire; der aufwendige französische Film „Réprise“ – über die stillgelegte Batteriefabrik „Wonder“ (von dem die französischen Gewerkschaften ebenfalls etliche Kopien erwarben); außerdem der finnische Film von Aki Kaurismäki über zwei Arbeitslose, die eine Kneipe mit dem sinnigen Namen „Zur Arbeit“ eröffnen; sowie der englische Dokumentarfilm von Ken Loach über den Kampf der entlassenen „Docker von Liverpool“; und die Hommage von Alain Tanner auf die Genueser Hafenarbeiter: „L’Hommes du Port“, die ihre Arbeitsplätze quasi eigenhändig privatisieren.
Dieser Film kommt der chinesischen Langzeitdokumentation „Tiexi District“ am nächsten: Alain Tanner arbeitete einst selbst im Hafen von Genua. Und den Aufnahmen des jungen Regisseurs Wang Bing merkt man an, daß er ebenfalls mit seinen Protagonisten eng befreundet ist. Dreieinhalb Jahre drehte er illegal in dem riesigen Industriekomplex, der währenddessen langsam abgerissen wurde. Weil sich dabei 319 Manager sowie der Bürgermeister von Shengyang persönlich bereicherten, wurden sie von einem Gericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. In Wang Bings Film ist noch von „gongren“ (Arbeiterinnen und Arbeiter) sowie auch von „wuchan jieji“ (Proletariat) die Rede. Die „gongren“ waren privilegiert, die Propaganda nannte sie zu Zeiten Mao tse Tungs „Herren des Landes“. In dem Buch von Pun Ngai und Li Wanwei ist dagegen bereits im Titel von „Dagongmei“ die Rede: „Mei“ stand schon immer für „kleine Schwester“, „zai“ für „Sohn“. Aber „dagong“ ist quasi brandneu: es heißt arbeiten im Sinne von „jobben“, „für den Boss arbeiten“. Die Dagongmei bzw. -zai sind „Jobber“, und zwar von der elendsten Sorte, die sich in rechtsfreien „Work-Zones“ für den Profit aus- und inländischer Investoren verausgaben.
Während der Kulturrevolution hatte der marxistische Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel den Güterbahnhof von Nanking besucht. Anschließend meinte er, der Zentralcomputer dort würde nicht mehr gegen die Eisenbahner eingesetzt, sondern in ihrem Sinne genutzt werden. Dies galt ihm als ein Beweis dafür, dass die chinesischen Genossen auch im industriellen Bereich versuchten, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufzuheben, nicht nur, indem sie die gebildete Jugend aufs Land schickten – gemäß den berühmten drei Mits: Mit den Bauern leben, arbeiten und lernen. In Norditalien kam es zur gleichen Zeit zu einer Annäherung und Kooperation zwischen Arbeitern und Ingenieuren, die als eine neue „Bewegung“ wahrgenommen wurde.
Ähnlich wie in China, wo es heute über 100 Millionen Wanderarbeiter gibt, wandern auch hier etliche Millionen Osteuropäerinnen – u.a. als Erntehelfer nach Spanien, Irland oder Italien. Einige haben bereits ihre Erfahrungen veröffentlicht. In der Ausstellung „Social Cooking Romania“, die 2007 in den Räumen des Berliner Kunstvereins NGBK stattfand und von dem Bukarester Künstler Dan Mihaltianu kuratiert wurde, erfuhr man nicht nur solche Produktions-Geschichten, sondern darüberhinaus auch noch quasi den gesamten Lebenslauf vieler rumänischer Dinge, jedenfalls der eßbaren: vom Anbau und der wirtschaftlichen Lage der Bauern über die Verarbeitung und den Handel bis zur Zubereitung, dem Genuß und der dazugehörigen Geselligkeit. Dabei wurde von den Künstlern auch noch die Zeit vor und nach dem „Zusammenbruch des Sozialismus“ unterschieden. Die meisten rumänischen Erntehelfer arbeiten in Italien. Ihre oft fürchterlichen Erfahrungen bezeugen, dass Brecht mit seinem Hinweis auf die altägyptischen Sklavenlieder nicht so ganz Unrecht hatte, denn bereits die Griechen holten sich aus Rumänien, damals Thrakien genannt, ihre Sklaven und die Römer dann ebenfalls: Sie nannten das Land Romania.
Zur Produktionskultur sammeln traditionell die Gewerkschaften Geschichten. Es geht ihnen dabei um sichere Arbeitsplätze, weniger fremdbestimmtes bzw. nicht-entfremdetes Arbeiten, eine „gerechte Entlohnung“, das Betriebsklima und die körperliche Unversehrtheit. Die Dinge/Produkte, die da am Ende bei herauskommen, interessieren sie weniger.
Dazu sahen wir z.B. neulich in einem für das Projekt „Le Grand Magasin“ gedrehten Dokumentarfilm von Minze Tummescheit und Arne Hector eine Gruppe arbeitslos gewordener Textilarbeiterinnen in der Emilia Romana, denen eine Apothekergenossenschaft eine Puppenwerkstatt finanzierte. Man schaute ihnen bei der Arbeit und ihren Gesprächen zu, während die eine oder andere Frau aus dem Off ihre Geschichte erzählte. Fast am Ende ihres „Erwerbslebens“ hatten sie jetzt einen sehr angenehmen, um nicht zu sagen gemütlichen Arbeitsplatz. Ihre Produkte sahen wir jedoch kein einziges Mal.
Umgekehrt lenkte man kürzlich bei einer Betriebsbesichtigung in der Waschmaschinen-, Herde- und Kühlschrankfabrik Fagor der baskischen Genossenschaft Mondragon, die weltweit 102.000 Mitarbeiter beschäftigt, unsere Blicke vor allem auf die Fließstrecken und die moderne Technik, die allerdings immer noch sehr viele Handarbeiter benötigt, die gemäß der Bandgeschwindigkeit eine bestimmte Norm schaffen müssen. Auch in den zwei Werbe-DVDs von Mondragon, die wir uns nach dem Besuch des „Showrooms“ mit den Fagor-Produkten ansahen, kamen die Arbeiter so gut wie nicht vor: nur Forscher in weißen Kitteln, Konferenzteilnehmer in Anzügen und Studenten der Mondragon-Universität in Hörsälen sowie an Hightech-Instrumenten.
Anders das Werbe-Video der tschechischen Genossenschaft DUP – eine Leder- und Metallfabrik, wo u.a. Manikürsets hergestellt werden. Es wurde für ihren Hauptabnehmer in der Ukraine produziert. Man sieht vor allem feuer- und funkensprühende Maschinen und den nach der Wende angeschafften Schweißroboter „Emil“ sowie einige Arbeiterinnen an Schleifsteinen.
Und wieder anders die Werbe-DVD der 1950 von Glasbläsern gegründeten Genossenschaft CIVE bei Florenz: Hier hat man sich für sorgfältig ausgeleuchtete Photographien ihrer edelsten Produkte entschieden. Auf einer weiteren Werbe-DVD aus Italien kommt der genossenschaftliche Produktionsbetrieb nur in Form einiger Luftaufnahmen vor.
Grundsätzlich ließe sich zu den Unterschieden zwischen den Produktivgenossenschaften in Ost- und Westeuropa vielleicht sagen: Im Osten reicht die Produktionstiefe nach wie vor weiter als im Westen, wo oft nur noch in Asien hergestellte Teile zusammenmontiert werden. Und dann ist man u.a. in Tschechien zwar verbal antikommunistischer eingestellt als z.B. in Italien, aber dennoch sind die ganzen Genossenschaften dort anscheinend noch viel arbeiterlicher geprägt als im Westen. Obwohl es z.B. in Tschechien eine Genossenschaft gibt – Vyvoj (es werden dort in Akkordarbeit Anzüge und Uniformen hergestellt), in der es dem Geschäftsführer und seinem jungen Stellvertreter bereits gelungen ist, 70% der Stimmen aller 100 Genossen auf sich zu vereinen. „Das ist doch keine Genossenschaft mehr,“ meinten dazu mehrere Genossenschaftsvorsitzende aus der Toskana sowie auch der dortige Verbandsvorsitzende. Umgekehrt war eine leitende Angestellte in der Genossenschaft der Glasbläser Cive bei Florenz sehr an einer Zusammenarbeit mit Designern bzw. Desingstudenten interessiert, wie sie vom Projekt „Le Grand Magasin“ auch angestrebt wird – während die darauf angesprochenen tschechischen Genossenschaften dazu erst einmal keine Meinung hatten, obwohl sie einen viel größeren Design-Nachholbedarf in bezug auf Produkt, Verpackung und Werbung haben als die italienischen Genossenschaften, denen mitunter das Design wichtiger als die Produktion zu sein scheint. Aber das erklärt es vielleicht schon: Wir haben ein gutes Produkt, was sollen wir daran noch herumdoktern? mögen sich die tschechischen Genossen eventuell gesagt haben. Für die Ausstellung „Le Grand Magasin“ gestaltete schon mal die Künstlerin Barbara Steppe zusammen mit der Tischlergenossenschaft BMT in Anklam exemplarisch ein Side-Board.
Wenn man dieses Möbel oder die Puppen der italienischen Textilarbeiterinnen-Genossenschaft, die Kühlschränke der baskischen Genossenschaft, die tschechische Galanterieware und die toskanischen Glasgefäße – als Waren auf dem Markt (aber auch als Exponate in einer öffentlichen bzw. privaten Sammlung) sieht, „geht“ laut Marx „kein Atom Naturstoff in ihre Wertgegenständlichkeit ein“ – und damit auch keine Produktionsgeschichte (mehr).
Joseph Beuys hat dies an den „Ready-Mades“ (eine als Kunst ausgestellte Fahrradfelge, ein Bidet und ein Flaschentrockner) kritisiert: Marcel Duchamp habe sie mit einem Federstrich (mit seiner Signatur) von allen Herstellungsbedingungen isoliert.
Anfang der Achtzigerjahre war die in dieser Hinsicht sonst nicht sonderlich pingelige Kapitalzeitung FAZ besonders aufgebracht über den geplanten Bau einer sowjetischen Gaspipeline – mit deutscher Hilfe, d.h. mit Röhren von Mannesmann. Sie setzte sich deswegen vehement für ein von den USA gefordertes „Röhrenembargo“ ein – und begründete dies u.a. damit, dass „an der Pipeline der Schweiß, das Blut und die Tränen von Heeren sowjetischer Arbeitssklaven kleben“ würde. Dies war glatt gelogen, denn die Arbeiter an der Gastrasse waren überaus privilegiert – und es gab zu jeder Zeit mehr Arbeitswillige als gebraucht wurden.
Andersherum sprach die FAZ angesichts der japanischen Produktionsmethoden des neuen Opel-Werks Eisenach zynisch von einem „ästhetischen Gesamtkunstwerk“, in dem die „Menschen am Band einer Ballettgruppe gleichen“ – wohl wissend, dass sie ihre Arbeit auch nicht viel länger durchhalten als Balletttänzer: „Schwerbehinderte werden nicht eingestellt, die produziert Opel Eisenach inzwischen selbst – siebenundzwanzig bis jetzt,“ bemerkte dazu die IG-Metallchefin des Tarifbezirks 2001 bitter. Der Pipeline und den Autos sieht man all dies nicht an.
Bei individuell hergestellten Dingen ist das etwas anders: Seien es von Hausmeistern gebastelte Verkehrsabweiser (Poller) oder von Indianerinnen hergestellte Ponchos, die immer einen Webfehler haben, „damit der Geist hindurch kann“.
Wenn man den „Trendforschern“ Friebe und Ramge in ihrem Buch „Marke Eigenbau“ glauben darf, dann werden solche Objekte nicht nur immer massenhafter hergestellt, sie finden auch zunehmend leichter als Ware einen Käufer – u.a. über Ebay, Etsy und ähnliche Internet-Umschlagsplätze, die sie als einen „globalen Marktplatz für Handgemachtes“ bezeichnen, und den sie wegen seiner Wachstumsraten bereits als einen „Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion“ interpretieren. Wobei „das Spektrum dieser Produkte von Filztaschen für iPods über Kerzen, Schmuck, Stofftiere, Keramik und Textilien bis hin zu Aktfotogafien und Dominapeitschen mit bunten Glasperlen an den Enden reicht“, wie es über diese „Micro-Brands“ bloß summarisch heißt. Dazu zählt für die beiden Trendforscher jedoch als „Exempel“ auch das Nordhäuser „Strike-Bike“. Zuletzt postulieren sie damit eine Ende der Geschichten, die von der Aufspaltung in Kosumenten und Produzenten handeln – und sehen bereits die Heraufkunft eines neuen Menschen, den sie mit dem US-Zukunftsforscher Alvin Toffler „Prosument“ nennen: „Zwischen Amateur- und Profisegment eröffnet der Prosument neue Nischen und Spielräume für Anbieter, die seine Bedürfnisse verstehen“. Einmal mehr wird hier die Warenproduktion unangetastet gelassen, um noch einmal fröhlich zu anthropologisieren, d.h. die wahren Bedürfnisse ins Spiel zu bringen.
Dazu wird ein Lampenhersteller am Kollwitz Platz zitiert, der von seinen teuren Unikaten gut leben kann, weil seine Kunden sich nicht mit billigen „Art-Deco-Plagiaten aus Vietnam“ zufrieden geben wollen. Auch sie haben anscheinend ein Bedürfnis nach dem Wahren. Aber je näher dem das von ihnen gekaufte Ding kommt, desto länger fallen sie zwangsläufig beim Hersteller als Kunden aus, er braucht also immer wieder neue – und die könnten in diesem „hochpreisigen Segment“ schon bald selten werden. Es sei denn, er bietet laufend neue Produkte an.
So wie der 1988 vom Landesgeschäftsführer der Grünen in Nordrhein-Westfalen gegründete und kürzlich vom Otto-Versand übernommene Laden „Manufactum“, dessen ständiges Motto da lautet: „Es gibt sie noch, die guten Dinge“ – die aus „Qualitätsarbeit“ entstanden. Dem gegenüber stand Andy Warhol mit seinem Diktum: „All is pretty“ -und der Wahl seiner Siebdruck-Motive: Campbell-Suppendosen und Brillo-Waschpulverkartons. Vordergründig gehört dazu auch noch die Arbeit von Joseph Beuys: „Wirtschaftswerte“ 1984. Sie bestand aus über hundert DDR-Waren des täglichen Bedarfs, die der Künstler auf Arbeitsregale stellte. 1998 wurde eine ähnliche Ausstellung, „Wunderwirtschaft“ genannt, in der Ostberliner „Kulturbrauerei“ gezeigt. Es ging dabei jedoch sehr viel didaktischer um „DDR-Produktdesign“, aber auch um partielle Versorgungsengpässe u.a. bei Würfelzucker – also um Produktionsaspekte. In bezug auf die Produkte haben wir es hierbei inzwischen mit einem abgeschlossenen Sammelgebiet zu tun. Bei deren Formgestaltung verfolgte die DDR im übrigen offiziell eine Linie jenseits von „bürgerlichem Kitsch“ und „kaltem Formalismus“, heraus kamen dabei Dinge, die den „Charme bemühter Anständigkeit“ besaßen, wie eine Rezensentin schrieb. Während sich nach innen – in den volkseigenen Betrieben – anscheinend eine gewisse „Brigadegemütlichkeit“ breit gemacht hatte. Diese wurde dann von der Treuhandchefin Birgit Breuel 1993 prompt als „versteckte Arbeitslosigkeit“ umgedeutet – um ihre Massenentlassungswellen (treuhandintern „Großflugtage“ genannt) zu rechtfertigen: Die Betriebe waren quasi überbelegt, auch wenn sie in Wahrheit ständig weitere Arbeitskräfte gesucht und sogar Gastarbeiter eingestellt hatten.
Die ostdeutsche Betriebsräteinitiative behauptete demgegenüber, daß die DDR nicht an zu viel Unfreiheit, sondern eher an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrunde gegangen war. Dem Betriebsratsvorsitzenden des Eisenacher Opel-Werks, Harald Lieske, fiel dazu sofort seine eigene Instandsetzungs-Abteilung im früheren VEB Automobilwerk Eisenach ein, „wo bis zu zehn Leute beschäftigt waren, aber nur für drei Arbeit da war“. Heute gehe die Tendenz bei der nach modernsten Fertigungsmethoden funktionierenden Opel-Fabrik genau in die entgegengesetzte Richtung: Die sechs- bis sieben-köpfigen „Teams“, mit ihren von außen bestimmten „Team-Sprechern“, die nebenbei noch als Springer fungieren, sollen durch die Selbstorganisation ihrer Arbeitspensa nebst ständiger Verbesserungsvorschläge kontinuierlich die Schnelligkeit (Produktivität) steigern – bei mindestens gleichbleibender Qualität. Lieske rechnete vor: „Fünf Sekunden braucht der Mitarbeiter zwischendurch, um wieder er selbst zu sein – und genau die wird hier gesucht. Jede Zeitverschwendung wird immer wieder aufgestöbert, um neue Operationen unterzubringen. Es ist aber nirgends mehr Luft. Höchstens noch bei einem günstigen Optionen-Mix.“ So werden intern die Kundenwünsche genannt, von denen einige mehr Arbeit machen als andere: der Einbau geteilter Rückenlehnen hinten oder ein Schiebedach beispielsweise. Bei der Zeit-Planung ging man von dreißig Prozent derart ungünstiger Optionen aus, jetzt sind es jedoch mitunter schon über sechzig Prozent: „Das ist dann nicht mehr zu schaffen. Damit fährt man unweigerlich über den Takt hinaus und muß das Band anhalten.“ Lieske klagte, „die meisten Mitarbeiter haben noch zu wenig Selbstbewußtsein, um sich dagegen zu wehren, aber viele bauen sich auch gerade mit günstigen Krediten von Opel Häuser am Stadtrand.“ Die erste Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle Eisenach, Renate Hemsteg, klagte dagegen vor allem über den Opel-Betriebsrat, der sich zu wenig für seine Leute einsetze. Von den vielen Mitarbeitern, die beim Übergang, der „Stunde Null“, vom VEB zu Opel/General Motors auf der Strecke blieben, redet keiner mehr.
Bereits 1953 beschrieb der US-Schriftsteller Kurt Vonnegut in seinem Buch „Das höllische System“ die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen des kybernetischen Denkens bei seiner umfassender Anwendung. An einer Stelle heißt es über die davon Betroffenen: „Reparaturwerkstätten, klar! Ich wollte eine aufmachen, als ich arbeitslos geworden bin. Joe, Sam und Alf auch. Wir haben alle geschickte Hände, also laßt uns alle eine Reparaturwerkstatt aufmachen. Für jedes defekte Gerät in Ilium ein eigener Mechaniker. Gleichzeitig sahnen unsere Frauen als Schneiderinnen ab – für jede Einwohnerin eine eigene Schneiderin.“
Da das nicht geht, bleibt es dabei: Die Massen werden scheinbeschäftigt und sozial mehr schlecht als recht endversorgt, sie haben die Wahl zwischen I-Dollar-Jobs im Inland und Militäreinsätzen im Ausland. Es kommt zu einem Aufstand, der jedoch niedergeschlagen wird.
Anders in dem o.e. Buch „Marke Eigenbau – Der Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion“, der dank Internet ebenso friedlich wie siegreich verläuft – jedenfalls bis jetzt und wenn man den Autoren glauben darf. Es geht ihnen um einen aus Amerika kommenden neuen „Trend“ zur Handarbeit und zum individuellen Produkt sowie zur immateriellen Produktion. In letzterer steckt heute auch für Toni Negri und Michael Hardt „das größte revolutionäre Potential“. Für die neuen Handarbeiter, die in kleinen Stückzahlen aufwendig produzieren, eröffnen sich nun mit dem Internet neue Möglichkeiten mindestens der Vermarktung – bis dahin wie gesagt, dass der alte Gegensatz zwischen Konsumenten und Produzenten langsam verschwindet. Als Beispiel erwähnen Friebe und Ramge einen Australier, der gerne Bier trinkt und elektronisch die Botschaft verbreitete, dass er Leute suche, die mit ihm ein neues Bier kreieren und produzieren. Er fand über tausend – die sich das dann auch etwas kosten ließen. Und heute ist ihre Brauerei ein blühendes Geschäft. So entsteht aus einem Dingwunsch eine virtuelle Konsumgemeinschaft, die sich zu einer realen Produktionsgenossenschaft zusammenschließt.
Um die Handarbeiten mit Gewinn zu „erlösen“, inszenieren ihre Hersteller im Internet einen „Social Commerce“. Wir kennen ihn noch aus den Einzelhandelsläden. Aus Erwin Strittmatters Romantrilogie „Der Laden“ wissen wir ferner, was für persönlichkeitsdeformierende Folgen das hat: So durfte Strittmatter z.B. als Kind nie etwas Kritisches über jemanden im Dorf sagen: „Alles unsere Kundschaft. Ich sehe, was ich sehe, aber Mutters Laden macht mich zum Parteigänger, ich soll nur sehen, was dem Geschäft nicht schadet. Diese Nötigung verfolgt mich mein Leben lang: Andere verlangen von mir, daß ich sehe, was sie wünschen.“ Immer hieß es: „Der Loaden, der Loaden“ – geht vor. Selbst der jähzornige Vater durfte seine Beschimpfungen nie „bis zur Feindschaft ausweiten. Der Laden! Der Laden!“ Immer wieder mußte Strittmatter dort die Mutter hinterm Tresen vertreten. Die Eltern standen mit der Bäckerei und dem Laden in Konkurrenz zum Nachbarn – dem Mittelmüller. Eines Tages beschließt dieser, sein Brot den Kunden frei Haus zu liefern: „Siehe, der Service, den sich der Mittelmüller ausdachte, hat Erfolg.“ Strittmatter und sein Großvater begannen daraufhin ebenfalls, das Brot auszuliefern: „Wir gewinnen unsere Brotkunden auf den drei Vorwerken zurück und wir gaunern der Konkurrenz einige Kunden ab.“ Strittmatter lernte Mundharmonika, woraufhin seine Mutter ihn prompt im Ladengeschäft als „Kundenservice“ einbaute: „Jeder Schichtler, der jahrsüber sein Bier im Laden getrunken hat, erhält an seinem Geburtstag ein Sonderkonzert“. Als das Anschreiben-Lassen überhand nimmt, muß er für seine Mutter ein Schild für den Laden malen: „Borgen tun wir morgen“. „Meine ausgezeichnete naive Mutter bedachte [jedoch] nicht, daß jemand, der ein Theaterplakat liest noch lange nicht ins Theater geht.“ Die Jungs des Mittelmüllers kauften mit von ihrem Vater geklauten Geld im Laden von Strittmatters Mutter Süßigkeiten und Getränke – und veranstalteten bei ihr auf dem Hof ein Fest: „Meine Mutter steht hinter der gerafften Gardine, sieht unserem Treiben zu und ist nicht unglücklich über das schöne Sonntagsgeschäft. Ich muß an das denken, was Großtante Maika gesagt hat: Wer Geschäfte macht, den hat der Deibel schont am Ursche.“
Dennoch gilt auch weiterhin: „Meine Schwester und ich knicksen und dienern, und wir grüßen jedermann im Dorfe, und tun wir es nicht, werden wir getadelt. Wir grüßen, grüßen: Der Loaden, der Loaden!“ So machen ihn seine Eltern „zum Mitsklaven ihres Ladens“ – und noch zu den Genossen später war er so „freundlich, auch wenn sie mich erniedrigten“ – dass seine Geliebte ihn einen „niederschlesischen Neurotiker“ schimpfte. Da „befreite“ er sich endlich, schreibt er. Aber noch als er sich vom Nationalpreis-Geld den Schulzenhof im Ruppiner Land kauft – war er bestrebt, sich im neuen Dorf beliebt zu machen…“Vielleicht hieß es drinnen in mir, ganz leise und ohne in mein Bewußtsein zu dringen, grieß die Leite und sei freindlich, vielleicht koofen se deine Bücher.“ An anderer Stelle spricht Strittmatter von seinem „Kellnerlächeln“, dass er sich in jungen Jahren in diesem seinem „Zweitberuf“ angeeignet hatte oder aneignen mußte – und das er nun nicht wieder los wird, „obwohl wir unsere Gesellschaft doch revolutionieren, wird es heute noch dann und wann von mir verlangt,“ empörte er sich 1972.
Ähnlich bezeichnete der Dramatiker Heiner Müller einmal das schlechtgelaunte Nichtlächeln der Kellnerinnen in der DDR als eine „echte Errungenschaft des Sozialismus“. Man könnte hierbei vielleicht auch von einem „Socialist Commerce“ sprechen.
Die Internet-„Kommunikation“ einer Ware oder Dienstleistung soll das nun noch toppen, dialektisch aushebeln -versprechen jedenfalls Friebe und Ramge, indem es nicht nur „den Konsumenten und den Produzenten wieder zusammenbringt“, sondern auch das Produkt und seinen Hersteller/Anbieter – das ist das eigentliche „Social“ am Geschäft: „Bei handgemachten Produkten kauft ein Kunde nicht nur ein Produkt, er kauft eine Person und eine Geschichte hinter dem Produkt…Die große Kunst besteht darin, die Verbindung von Produkt und Produzenten authentisch herzustellen.“ Als Beispiel für eine geradezu begnadete Herstellerin von Authentizität erwähnen die Autoren eine US-Kunstudentin namens Emily Martin, die Comic-inspirierte Malerei, lustig genähte Puppen und Kleider aus Secondhand-Läden anbietet – und in ihrem Blog „Inside a Black Apple“ zeigt, wie sie näht, wie ihre Katze aussieht, dass sie gerne Blaubeer-Muffins ißt usw..
Ihr „persönlicher Auftritt“ ähnelt dem der „Profile“ in Online-Partnersuchdiensten. Hier wie dort geht es um so etwas wie „Tele-Marketing“. Authentizität und Auftrittsprofessionalität werden dabei prospektiv enggeführt. Die Soziologin Eva Illouz hat eine Reihe von Amerikanern und Israelis befragt, die via Internet nach einem Partner suchten – und dazu ihr „privates Selbst in einen öffentlichen Auftritt verwandelten“. Sie machten sich quasi zu einem Ding, das sich auch und vor allem körperlich – bildlich – einer Markt-Konkurrenz aussetzt: „Fast alle haben erwähnt, dass ein Treffen von ihnen verlangt, sich zu ‚vermarkten‘ und sich so zu verhalten, als ginge es um ein Jobinterview“ bzw. um ein Verkaufsgespräch.
Vorexerziert hatte diese Entwicklung bereits das rigide US-Prostitutionsverbot, aus dem die legale Pornofilm-Produktion quasi hervorging – als Schule von Appeal und Appearance, die inzwischen Weltgeltung beansprucht, und seit dem Internet ebenfalls von immer mehr „Eigenbau-Marken“ flankiert wird. Überhaupt werden Produktionsgeschichten zunehmend zu Vermarktungsproblemen von Produkten bzw. diese laufen jenen den Rang ab.
Die amerikabegeisterten Trendscouts Friebe und Ramge haben nichts gegen erfolgreiches Verkaufen und Gewinne machen, im Gegenteil. Fast schon enzyklopädisch zählen sie diesbezüglich alle neuen US-Möglichkeiten auf und referieren dazu die entsprechende Literatur. Ihre versöhnlerische Botschaft teilen sie mit dem Slawisten Karl Schlögel, den man inzwischen ebenfalls als einen Sänger der Marktwirtschaft bezeichnen kann, wobei er sich jedoch eher auf die Offline-Loser in Osteuropa konzentriert. Während bei ihm von einer realen „Basarphase“ des Handels, der nach dem „Zusammenbruch des Sozialismus“ einsetzte, die Rede ist, sprechen Friebe und Ramge von einem „Basar-Branding“ im Internet, wo „die Produkte längst wieder mehr selbst kommunizieren als die Werbung, die für sie gemacht wird. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen aufgrund der interaktiven Medien viel mehr Zeit damit verbringen, über Produkte zu reden.“ Im Osten verbringen „die Menschen“ dagegen mehr Zeit damit, in den Besitz von Produkten zu gelangen – und konzentrieren sich daher beim Basar-Handel auf die lebensnotwenigsten. Wohingegen es beim „Basar-Branding“ u.a. auf die „Status Stories“ ankommt: Mit diesem „Trend“ bezeichnen die Autoren Marken, „die gar kein Interesse daran haben, der breiten Masse ihre Geschichte aufzudrängen…Von daher ist es an den Konsumenten, die Geschichte weiterzutragen, mit denen sie die Marke versorgt.“
Karl Schlögel schreibt (in „Die Geburt des Basars aus dem Zerfall“), dass die „Marktbesuche“ über Staatsgrenzen hinweg den Osteuropäern zu „Schulen des Lebens“ werden, d.h. wenn man ein Leben „im Sog und im Schatten des Basars“ führt, werden „nicht Institutionen ausgewechselt, sondern eine ganze Lebensform“. Diese ist zwar nicht mehr geplant – wie im Sozialismus, sie hat dennoch eine, wenn auch schwer erkennbare „Ratio“: Sie wird nämlich (wieder) gelenkt von einer „unsichtbaren Hand“ (der Marktwirtschaft selbst), die „nicht nur stärker als die Faust jedes noch so mächtigen Diktators ist, sondern auch effizienter“, denn sie setzt sich aus der „kollektiven Intelligenz Tausender von Menschen“ zusammen – aus der Summe ihrer Handelstätigkeiten quasi.
Diese Geschäfte bewegen sich als „Open Source“ noch ganz diesseits des Internet-Shoppings bzw. -Marketings und auch der Online-Partnersuche, bei dem Interviewte und Interviewer fortwährend ihre Rollen tauschen, so wie sich die Konsumenten immer öfter zu Produzenten wandeln und umgekehrt. Der französische Philosoph Jean Baudrillard hat dies rechtzeitig kommen gesehen: „Wir dürfen nicht mehr miteinander reden, wir müssen kommunizieren!“ Auch bei der US-Army brüllt der Spieß nicht mehr „You understand?!“ sondern „Do we communicate?!“ Der slowenische Jetzt-Philosoph Slavoj Zizek will zwar nicht bestreiten, dass sich mit der elektronischen Revolution die (Waren-)“Kommunikationsmöglichkeiten“ enorm vermehren, er befürchtet jedoch, dass damit die „Illusion“ schon „auf die Seite der Realität selbst“ übergegangen ist, „auf der Seite dessen, was Menschen tun“. Und dies geschieht via Internet. Aus Hand- und Kopfarbeitern werden dabei „Projektemacher“. Der Soziologe Rainer Zoll erkennt in dieser sich heute geradezu epidemisch ausbreitende Spezies bereits eine neue soziale Bewegung: „Was ist Solidarität heute?“ fragte er sich – und kam dabei in seiner Studie zu dem Schluß: Die alte proletarische internationale Solidarität sei immer ein „Schwachpunkt“ gewesen, heute gäbe es jedoch einige hervorragende Beispiele von „gewissermaßen individueller, oft auch kollektiver internationaler Solidarität“, u.a. von jungen Menschen, „die sich in Entwicklungsländern engagieren“. Auch für Friebe und Ramge sollen diese Projektemacher eine soziale Bewegung gewissermaßen ersetzen, was sie mit Wörtern wie „immer mehr“ und „zunehmend“ andeuten.
Der Soziologe Sergio Bologna hat in seinen Untersuchungen über die „Neuen Selbständigen“ dagegen aufgezeigt, dass die meisten italienischen Genossenschaften, zu denen diese sich zusammenfinden, bloß eine mehr oder weniger hilflose Reaktion auf das massenhafte Outsourcen und Verschlanken der großen Konzerne ist. Und das wiederum war die Antwort des Kapitals auf die Erfolge der Arbeiterbewegung in den Siebzigerjahren. „Umherschweifende Produzenten“ nennen Toni Negri, Maurizio Lazzarato und Paolo Virno die neuen Selbständigen: „Für das kapitalistische Kommando über die Subjektivität ist es notwendig, sich ohne Vermittlung zu etablieren; statt Aufgaben und Abläufen werden die Subjektivitäten selbst bestimmt und vorgezeichnet. ‚Seid Subjekte‘, lautet daher die Direktive und wird zum Slogan westlicher Gesellschaften. Partizipatives Management heißt die entsprechende Machttechnik, dazu gedacht, ‚Subjektwerdungen‘ zu konstituieren und zu kontrollieren. Wenn es nicht länger möglich ist, dem Subjekt bloß ausführende Tätigkeiten zuzuweisen, bedarf es Vorkehrungen, ihre Fähigkeiten zur Planung und Leitung, zur Kommunikation und Kreativität den Bedingungen der ‚Produktion um der Produktion‘ willen, anzupassen. ‚Seid Subjekte‘ ist also ein Ordnungsruf, weit entfernt, den Antagonismus zwischen Hierarchie und Kooperation, zwischen Autonomie und Kommando auszulöschen. Stattdessen wird dieser Antagonismus auf höherer Ebene reproduziert, in dem er die Persönlichkeit der individuellen Arbeiterin und des individuellen Arbeiters mobilisiert und sich ihr zugleich entgegenstemmt. ‚Seid Subjekte der Kommunikation‘, lautet also die Parole des Managements – und damit verbunden ist die Drohung, sogar totalitärer zu werden als durch die rigide Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, von Entwurf und Ausführung.“
Aus der daraus resultierenden Atomisierungs- und Flexibilisierungs-Not der einst Organisierten und Familial-Seßhaften machen Friebe und Ramke nun via Internet und wie zuvor auch schon in Friebes Buch über die „Digitale Bohème“ eine politische Tugend, indem sie unermüdlich nachweisen, dass diese „Subjekte“ als zunächst nur Endverbraucher auf dem globalen Markt zur kollektiven Tat zurückfinden (können) – und dabei sogar noch Gemeinschaftseigentum schaffen: eine Art intellektuelle Allmende.
Der Soziologe Ulrich Beck spricht ähnlich optimistisch gestimmt von einer neuen medial sich inszenierenden Konsumentenmacht: „Warum der einzelne Konsument ein bestimmtes Produkt nicht kauft, ist nicht so wichtig. Was zählt, sind gerade massenhafte Mit-Nichtkäufer.“ Es geht dabei also um die Anzahl – mit der mindestens ein Konzern, der aus ethischen oder ökologischen Gründen von den Kunden boykottiert wird – rechnen muß. Dabei wird die Erwerbsidee bzw. Nichterwerbs-Entscheidung des Einzelnen von Beck, sowie auch von Friebe und Ramge wie eine Mutation behandelt. Auch diese ist nur von Bedeutung – insofern sie sich durchsetzt: statistisch relevant in der Population wird – und schließlich in der Art. Aber „unterhalb der Schafsart kann man nur noch die Schafe zählen,“ wie Michel Foucault meinte.
Die auf den Menschen bezogene „Art“ ist in unserem Zusammenhang der Konsument bzw. Kunde oder Käufer und die sich durchsetzende Mutation der Trend bzw. die Mode oder der Verkaufshit (Blockbuster). Er beginnt nicht selten in einer Nische – d.h. in der berühmten Garage als provisorische Produktionsstätte. Und heraus kommen dabei oft erst einmal auch nur Nischenprodukte:
In Kreuzberg gibt es z.B. einen „Mitteleuropa-Laden“, der u.a. gehäkelte Tangas und handgedrehte Seile verkauft, die in kleinen polnischen Werkstätten hergestellt werden: Solche Nischenprodukte verdanken sich anfänglich beim Finden der ersten Verkaufsstellen einer ähnlich händlerischen Solidarität gegenüber den Herstellern wie etwa die „Fair Trade“-Produkte in den „Weltläden“ und in einigen Supermärkten, die z.B. lateinamerikanischen Bauern einen „guten Preis“ für ihre Bananen zahlen. Dies begann mit der „Teekampagne“ des Berliner Wirtschaftswissenschaftlers Günter Faltin, der im übrigen meint, dass die Bauern dabei nicht in jedem Fall besser stellen als bei den sozusagen normalen Weltmarktpreisen. Eine kleine, aber wachsende Schar von Kunden honoriert desungeachtet eine solche „Handelsmoral“, indem sie die im Vergleich zum Weltmarkt überhöhten „Fair Trade“-Preise akzeptiert. Die taz, die anfänglich noch zur Unterstützung der Sandinistas ihren Kaffee aus Nicaragua bezog, läßt sich heute für ihren „shop“ von einem der 70 deutschen Großhändler/Importeure beliefern, die mit der Fairtrade-Labelling-Organisation „TransFair“ einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben. Damit soll gewährleistet werden, dass die Anbauer für ihre Produkte genug bekommen, um nicht gezwungen zu sein, ihre kleine Landwirtschaft aufzugeben – und sich als Erntehelfer auf großen Plantagen zu verdingen. Ähnlich verhält es sich mit den diversen Öko-Labels und neuerdings z.T. auch mit Regionalprodukten, die unter der „Dachmarke Rhön“ oder „Eifel“ etwa vermarktet werden.
Ohne alle Zertifikate und Logos funktionierten in den Siebzigerjahren noch die Geschäftsbeziehungen zwischen den Landkommunen, Demeterhöfen und den ersten Bioläden. Den Warenverkehr gewährleistete anfangs einzig Charlie – mit seinem regenbogenfarbenen LKW. Bei den Bio-Produkten wird im übrigen weniger der Handel als die Gesundheit und das Wohlbefinden der Konsumenten „moralisiert“
Weniger von Gütesiegeln abhängig sind die Waren aus Großbritannien im Laden „Old England“ sowie die italienischen Waren im Kreuzberger Buchladen „Dante Connection“ und im nahen Lebensmittelladen „Alimentari e Vini“.
Ähnliches trifft auch auf Recyclingsprodukte aus der Dritten Welt zu: Spielzeug aus Coladosen, Haushaltsgeräte aus Konservendosen, Wasserbehälter und Schuhe aus Autoreifen oder Koffer aus Teekisten. Letztere werden von der 20köpfigen Kooperative „Artisans Recyclage“ in Dakar/Senegal hergestellt. 1987 stellte die Projektgruppe „Stoffwechsel“ der Universität Kassel aus diesen Dingen eine Ausstellung zusammen. Im Jahr darauf erschien im Verlag „Trickster“ das Buch „Aladins Neue Lampe“ zum selben Thema. Dazu hatte sich der Ethnologe Jürgen Grothues auf den Märkten in Pakistan und Marokko umgetan und photographiert: „In seinen Texten beschreibt er ihre Lebenssituation, ihre Klein- und Kleinstbetriebe und die sich bereits tradierenden Produktionsverfahren in ihrem ‚Dialog‘ mit dem Material“, hieß es dazu in der Verlagsankündigung. Den Titel verdankt das Buch einer Öllampe aus Sri Lanka: „Drei wichtige Stadien der künstlichen Lichterzeugung wurden dabei auf geradezu geniale Art miteinander verbunden“, schreibt der Autor. „Eine ausgediente elektrische Glühbirne, Symbol für den technischen Erfindungsgeist, dient als Ölbehälter für eine Lampe, eine der frühesten Formen der Lichterzeugung. Der Zwischenschritt in der technischen Entwicklung, die Petroleumlampe, ist für die gesamte Konstruktion formgebendes Prinzip. Thomas Alfa Edison rückwärts wäre ein passender Name für die Erfindung. Erstaunlich, daß diese einzigartig anmutende Lampenidee auch in Tanzania und Ghana realisiert wurde.“ Solche Recyclingsprodukte verkaufte zuletzt eine holländische Bühnenbildnerin in ihrem „Kitchen-Club“ – einem Marktstand auf dem Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg.
Noch einen Schritt weiter als die Hersteller von „Aladins neuen Lampen“ gehen einige afrikanische Handwerker, die technische Geräte, z.B. Radios (Ghettblaster) und Mobiltelefone, aus Massivholz „nachbauen“. Oder Photographen, die ihre Kunden vor gemalten westlichen Konsumgütern wie volle Kühlschränke und Farbfernseher ablichten. Ihre Porträts vor diesen Produkt-Kulissen wurden hier bereits mehrmals auf Ausstellungen gezeigt: zuletzt im Berliner „Haus der Kulturen der Welt“ und auf der „documenta“ in Kassel. Es ist dies auch eine Form der Verwandlung von Massenware in ein Kunstwerk – und sie resultiert aus Konsumnot.
In den Siebzigerjahren bot der Westberliner Laden „Bale Bale“ am Savignyplatz erstmals billiges Kunsthandwerk und vor allem Textilien aus Indonesien an. Heute entwirft die Firma u.a. Teakholzmöbel, die bloß noch in Indonesien hergestellt werden – und hat damit aus ihrer Nische herausgefunden: „Our mission is to become the leader in the export business community by creating new products and designs, producing high quality products, at competitive price with guaranteed on-time shipment.“ Ähnlich wandelte sich ein Laden mit „Lebensmittel aus Brandenburg“ in der Kreuzberger Oranienstrasse, der 1994 von einigen ehemaligen Stasi-Mitarbeitern eröffnet wurde. Er lief nicht besonders gut, auch nicht als einige junge Araber ihn übernahmen. Die Nische war zu klein. Erst seitdem ein türkischer Händler das Sortiment um Bio-Produkte erweiterte, egal aus welcher Region, lohnt sich das Geschäft. Nebenan hat eine „Food-Coop“ ihr Kellerlager: Die Kundschaft besteht hier aus ihren Mitgliedern, denen sie ein begrenztes Sortiment an Lebensmitteln bietet, die alle von Biobauern aus Brandenburg stammen.
Auch die Verkaufsausstellung Le Grand Magasin ist genaugenommen ein Nischenmarkt – für all die Dinge, die von Produktivgenossenschaften aus der EU hergestellt werden. Zwar werden sie zum Teil auf hochmodernen Fertigungsanlagen in riesigen Fabriken gefertigt und viele dieser Genossenschaften – u.a. die weltweit größte Genossenschaft Mondragon im Baskenland und die älteste italienische Genossenschaft Ceramica d‘ Imola in der Toskana – verfügen dafür inzwischen auch über entsprechende Absatzmärkte, aber indem die „Le Grand Magasin“-Veranstalter in Berlin, Usti nad Labem, Budapest und Dunaujvaros mehr oder weniger strikt auf Artikel aus genossenschaftlich organisierten Produktionsstätten abheben, denen man diese künstlerisch homogenisierte Bezugsquelle nicht ansieht, so dass man mit Geschichten (Informationen) darauf hinweisen muß, heften sie den ausgestellten Dinge etwas Zusätzliches an. Aus einer Massenware wird dadurch wieder ein Nischenprodukt, dessen potentielle Käufer so etwas wie Überzeugungstäter sein müssen. Ähnliches trifft auch auf die internationale Leistungsschau bzw. Verkaufsmesse mit Genossenschaftsprodukten zu, die jetzt erstmalig organisiert von Brasilianern in Lissabon stattfindet, aber auch auf die nationalen Genossenschaftsmessen z.B. im polnischen Kielce und in der mongolischen Hauptstadt Ulanbaatar und im slowakischen Nitra. Aber das muß nicht so bleiben – wenn immer mehr Kunden „durch richtiges Konsumieren die Welt verändern“ (wollen), wie der Spiegel diese trendige „Moralisierung der Märkte“ nennt.
Der Initiator der Berliner Verkaufsausstellung „Le Grand Magasin“, Andreas Wegner, verwahrt sich im übrigen dagegen, die Genossenschaftsprodukte aus der EU in einem Atemzug mit den „Fair Trade“-Produkten aus der Dritten Welt zu nennen, die zumeist aus „Genußlebensmittel“ bestehen: „Ist es denn nicht traurig, die Spielräume unser Entscheidungsmöglichkeiten auf ein paar Trommeln, bunte von Hand geflochtene Einkaufstaschen, gebatikte T-Shirts mit Hanfsymbol, dazu den „politischen“ Zapatistenkaffee zusammengeschmolzen zu sehen, ganz abgesehen von der Problematik, Handlungsspielräume und Kritikformen generell mit konsumistischen Aktivitäten verknüpfen zu wollen.“ Auch wenn auf seiner Verkaufsausstellung die Artikel teilweise als Kunstwerke wie auf einem Sockel präsentiert werden, hebt er zuallererst auf die Art und Weise ihrer genossenschaftlichen Produktion ab. Und dazu ist ihm der Genossenschaftsvordenker Charles Fourier ein Vorbild, er widmete ihm 2007 bereits eine Ausstellung im „Projektraum des Deutschen Künstlerbundes“.
Damit sind wir bei den Genossenschafts-Utopisten angelangt, bei der utopischen Produktion.
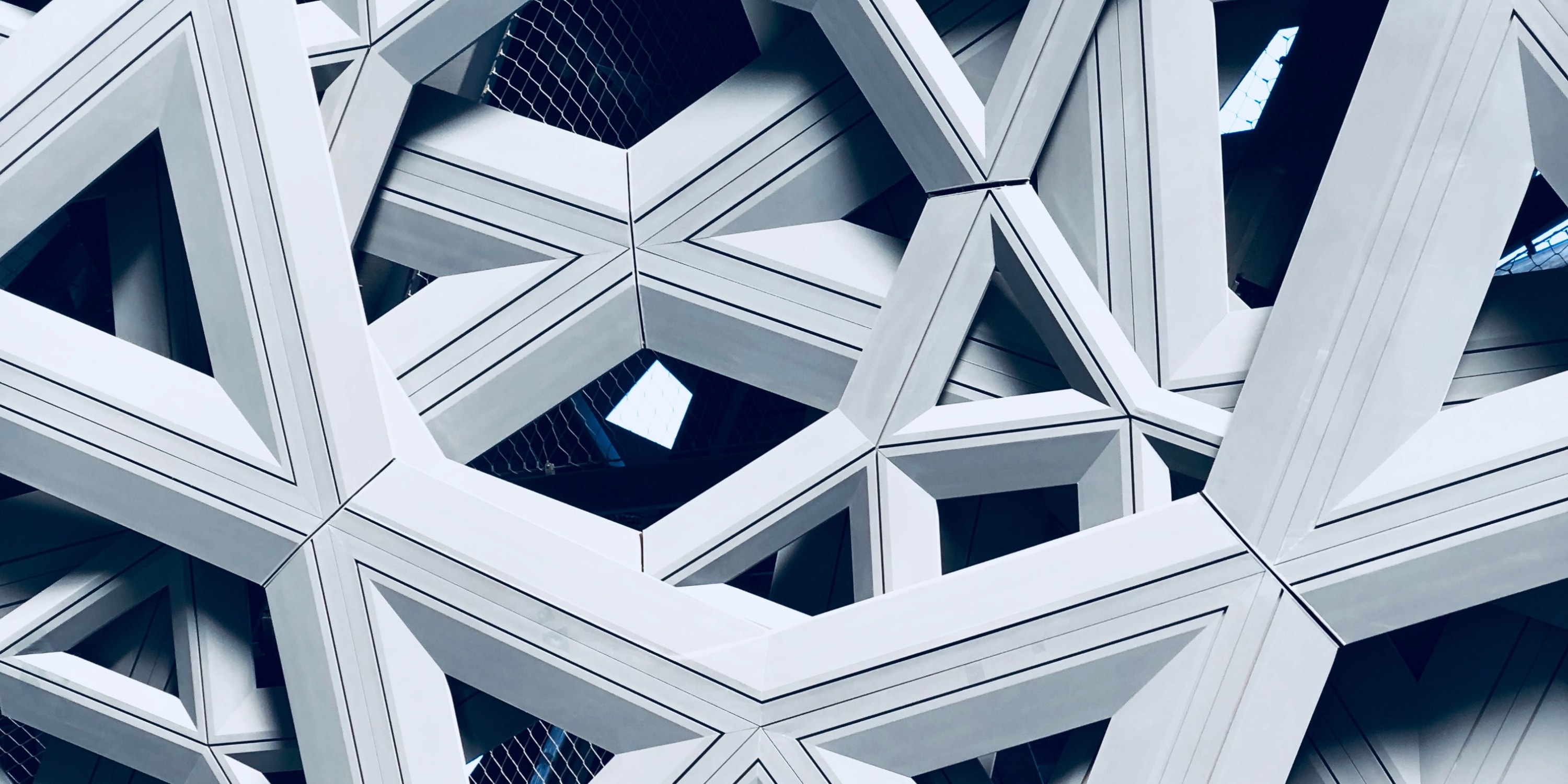



Diese von Gorkij initierten Fabrik-Biographien kann man auch als geframte Projekt-Dokumentationen bezeichnen, geframt, weil sie in literarischer Form das bei der Beschreibung herausarbeiteten, was die Bolschewiki als neue „Gesellschaft“ bezeichneten, sie stellten damit den individuellen Fall in einen größeren Rahmen, der ihnen gleichsam als maßgebend gilt. Mandelstam, Platonow u.a. haben immer wieder dagegen angeschrieben.
Nach der siegreichen Revolution und nach Bürgerkrieg entstanden überall „Projekte“, wurde die UDSSR mit einem Netz von Projekten überzogen. So meinte z.B. der Chefingenieur des o.e. armenischen Wasserkraftwerks: „Wenn ich hinter einem vorliegenden Projekt nicht ein Gefolge von zwei, drei, vier, zehn, einer ganzen Kette von Projekten erblicke, dann steht die Sache schlecht und ist nichts.“ Umgekehrt könnte man natürlich auch das Scheitern im scheinbaren Erfolg bei der taz mit dem Ausbleiben „einer Kette von Projekten“ erklären, so wie Trotzki bereits das Scheitern des „bolschewistischen Projekts“ nach der Niederschlagung der Revolution in Deutschland ahnte.Je mehr dies deutlich wurde, desto üppiger entwickelte sich die Projektliteratur. Den Aufbau-Roman „Das Wasserkraftwerk“ der Stalinpreisträgerin Marietta Schaginian habe ich bereits erwähnt. Genannt sei ferner Anton Semjonowitsch Makarenkos Buch über den Aufbau einer „Kolonie“ für verwaiste Kinder und Jugendliche: „Der Weg ins Leben“, das sich wesentlich von seinem darauffolgenden Roman „Flaggen auf den Türmen“ unterscheidet, in dem es um die Realisierung seines zweiten Projekts – einem Industrieobjektfür Jugendliche – geht, und das bis in die Sprache bereits ganz von „Planerfüllung“ durchdrungen ist. Dann das Buch „Die Baugrube“ vom sowjetischsten aller sowjetischen Schriftsteller Andrej Platonow, der darin wie auch in seinen anderen Werken schon sehr genau zwischen einem Emanzipations-Projekt und einer -Bewegung unterschied. „Scheißkerl!“ schrieb Stalin an den Rand eines seiner Manuskripte. Außerdem Wassili Ashajews Bestseller über eine sibirische Großbaustelle: „Fern von Moskau“, zu dem Alexander Solschenizyn in seinem Buch „Der Erste Kreis der Hölle“ anmerkte, dass es ein verlogenes Werk sei, denn ohne dass es erwähnt wird, ginge es darin um ein Zwangsarbeitslager in Sibirien – „vielleicht sogar von einem Sicherheitsoffizier geschrieben“. Schließlich noch Fjodor Gladkows Bestseller „Zement“, aus dem Heiner Müller 1972 ein Theaterstück machte. Gladkow hatte sein Werk bei jeder Neuauflage überarbeitet – und dabei aus den Alltags-Dialogen sukzessive Sonntags-Reden, d.h. eine trockene Funktionärssprache, gemacht. Walter Benjamin, der das Buch in den Zwanzigerjahren las, hatte den Autor gerade deswegen gelobt, weil er ihm als der Erfinder des bolschewistischen Argot galt. Für seine Bühnenfassung gab Müller daraufhin zusammen mit Fritz Mierau die erste Übersetzung von 1927 noch einmal – quasi heimlich – heraus. Schließlich sei noch der Aufbauroman „Das Sägewerk“ von Anna Karawajewa aus dem Jahr 1927 erwähnt. Soeben erschien auf Deutsch ein polnischer Roman von Daniel Odija, der ebenfalls „Das Sägewerk“ heißt. Es geht darin um die Bewohner eines Kolchosdorfes mit einer Kolchosensiedlung, aber seit der Wende ohne Kolchose, dafür jedoch mit einem neuen Sägewerk, das ein Projektemacher (Businessman) aufbaut und womit er einige neue Arbeitsplätze schafft. Er wird mächtig und kann sogar Politikern die Stirn bieten, aber nach einer Reihe von Fehlschlägen geht es bergab. Am Ende zündet er sein Werk an, damit es nicht seinen Gläubigern in die Hände fällt. Odijas neuer Roman könnte fast das Drehbuch zu einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 1997 von Ewa Borzecka sein: „Arizona“, in dem sich bereits einige identische Szenen finden. Der Film handelt ebenfalls von einer Gruppe langzeitarbeitsloser Bauern aus einem Staatsbetrieb, der aufgelöst wurde (bis 1989 wurde 20% der Gesamtfläche von solchen „Kolchosen“ bewirtschaftet), das Gutsgebäude kaufte ein Städter. In den Mittelpunkt ihrer Dokumentation stellte die junge Regisseurin den einzigen Lebensmittelhändler des Dorfes. Er fährt einen Mercedes und verkauft den Armen zwar in der Not kein Brot mehr, versorgt sie jedoch ohne Ende mit dem Billigwein „Arizona“. Dafür darf er die Sozialhilfe seiner Stammkunden bei der Behörde direkt kassieren. Borzeckas Dokumentationen des Elends – neben „Arizona“ ist das noch ein Film über Warschauer Obdachlose, die in der Kanalisation hausen sowie einer über ledige Mütter, die sich durch Beischlafdiebstähle ernähren – bezeichnete die polnische Kritik als „Pornographie“. Es gibt sogar einen „Gegenfilm“ dazu: die Komödie: „Geld ist nicht alles“. Im Suff entführen darin arbeitslose Bauern einen Yuppie aus Warschau, der zufällig mit seinem dicken Auto durch ihr Dorf kommt. Statt ein Lösegeld einzubringen, hilft er ihnen dann jedoch, die Kolchose für die Marktwirtschaft fit zu machen. Odijas Roman „Das Sägewerk“ kreist ebenso wie sein Dorf um den Sägewerksbesitzer Mysliwski, der seinem mißratenen Sohn zuletzt auch noch seinen Mercedes überläßt – und sich ganz dem Alkohol widmet bzw. ergibt. Einen Nachwenderoman über einen ähnlich scheiternden Unternehmer in einem Dorf gibt es auch von einem deutschen Autor – von Matthias Göritz: „Der kurze Traum des Jakob Voss.“ Hier ist es ein ehemaliger Bürgermeister, der – gleichermaßen inspiriert von frühsozialistischen wie spätkapitalistischen Ideen – einen riesigen Entenmastbetrieb aufbaut, mit dem er pleite geht. Im großen Ganzen hatte der holländische Sozialforscher Geert Mak dies alles bereits in seiner Studie über den „Untergang des Dorfes in Europa“ am Beispiel des friesischen Ortes Jorwerd befürchtet: Heute wird auch auf dem Land „ein Projekt nach dem anderen konzipiert – ausgereift und unausgegoren, brauchbar und wahnwitzig, alles durcheinander“, resümierte er. Feriendörfer, Yachthafen, Straußenzuchten, Transrapid – es wimmelt von Masterplänen. So wurde Jorwerd zu einem Global Village – und verschwand damit. Eine solche individuelle Projektemacherei hat also kein Zukunft, im Gegensatz etwa zu dem sowjetischen Sägewerksprojekt der Karawajewa. Ihr Roman wurde damals auf Deutsch im „Bücherkreis“-Verlag des sozialdemokratischen „Vorwärts“ veröffentlicht und behandelt im Gegensatz zu Odijas „Sägewerk“ den Aufbau eines modernen neuen Dorfes – mit Elektrizität, industriellen Arbeitsplätzen, Kollektivlandwirtschaft, Wohlstand und Frauenemanzipation. Hier wie dort kommt es dabei zu Toten und Verwundeten und einigen Alkoholismen, aber unter den Kommunisten geht es voran: ein Dorfsowjet wird gewählt und das Proletariat aus der Stadt bringt eine neue Kultur mit aufs Land…Auch hier geschieht eine Brandstiftung im Sägewerk – unter Alkoholeinfluß, aber der Täter realisiert hier sozusagen im letzten Moment noch, dass er damit Volkseigentum vernichten würde – und alarmiert die „Feuerwehr“. „Wann werdet ihr endlich begreifen, daß ihr jetzt selber die Herren seid?“ hieß es zuvor. Ein etwas später auf Deutsch erschienener und noch agitatorischer angelegter Kolchosenroman aus der Sowjetunion – von Sergej Tretjakow – hieß schon im Titel „Feld-Herren“. Sowohl in dem Roman von Karawajewa als auch in dem von Odija regnet es viel. Manchmal sitzen die Menschen auch bloß so da, als ob es ihnen auf den Kopf regnen würde. Und hier wie dort geht es um den Aufstieg und Untergang eines gewitzten Kulaken. Was jedoch 1929 eine Befreiung war und Fortschritt bedeutete, auch im Zusammenhang der Schaffung neuer weniger entwürdigenderer Arbeitsplätze sowie auch eines Genossenschaftsladens – statt des wie auch schon wieder bei Ewa Borsecka skrupellosen Einzelhändlers, ist 2003 der Verlust eines Unternehmers, einer letzten Wirtschaftseinheit mit Arbeitsplätzen. Zurück blieben „die Leute“ – als habe man sie „allein ihrem Schicksal überlassen. Nie hatte man ihnen beigebracht, mit sich selber etwas anzufangen. Immer hatte ihnen jemand gesagt, was sie tun sollten. Jetzt sagte ihnen keiner mehr etwas. Sie mußten es sich selber sagen.“ Heißt es bei Odija. Aber das ist rein rhetorisch – denn so weit geht der Autor nicht in seinem polnischen Dorfroman. Vielleicht ist das die Crux der Projektemacherei schlechthin, dass sie per definitionem nicht die Massen ergreifen, mitreißen kann, wie man so sagte. Mit anderen Worten: Die Begeisterung läßt sich nicht wie Salzheringe einpökeln! Deswegen haben vielleicht alle Projektaufbau-Romane – im Gegensatz zu solchen über das Scheitern von Projekten – etwas Verlogenes. Der in der Haft gestorbene Dichter Ossip Mandelstam schrieb – zu Zeiten der großen sowjetischen Aufbau-Romane: „Es ist so weit gekommen… Sämtliche Werke der Weltliteratur teile ich ein in genehmigte und solche, die ohne Genehmigung geschrieben wurden. Die ersteren sind schmutziges Zeug, die letzteren – abgestohlene Luft.“ Und in den Samisdat-„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“ behauptete Boris Jampolski 1975: „Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer‘, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karawajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten‘, so ist das reine Phantasie.“ Im Westen findet dies sein Gegenstück in den Autobiographien von Unternehmern und Projektemachern. Man nennt dieses Genre hier auch „Success-Stories“. Sie handeln durchweg von Idioten – im klassischen Sinne, also von solchen, die sich erfolgreich um ihren oikos kümmerten – und keinen Gedanken an die polis verschwendeten. Die Weltmeister darin dürften all jene Amerikaner sein, die es mit Lug und Trug vom Hausierer-Sohn zum Multimillionär (wie John D. Rockefeller), vom Webersohn zum „Stahlbaron“ (wie Andrew Carnegie), vom Coca-Cola-Verkäufer zum „Großinvestor“ (wie Warren Buffett) oder vom Programmierer zum „E-Monopolisten“ (wie Bill Gates) brachten. Und die dann als „Superreiche bzw. „reichste Männer der Welt“ ihre „Verantwortung“, ihre „soziale Ader“ oder ihre „Vision“ entdeckten bzw. derart vom „schlechten Gewissen“ geplagt wurden, dass sie mitsamt ihrem oikos sich am Ende – kurz vor Toresschluss – doch noch der (langlebigeren) polis zuwandten. In Form eines gemeinnützigen Projekts – einer Kultur-, Wissenschafts-, Friedens- oder Gesundheitsstiftung z.B.. Wobei letztere nicht selten eine Medizin (er)finden sollen – gegen eine Krankheit, an der zuvor der Big Spender noch gestorben war. Hiermit verklammert sich quasi postmortem die Hoffnung auf ein Fortleben des Selbst mit dem Fortschritt der Gesellschaft. Und das private, an sich geraffte Kapital, das dabei jede Menge Soziales „schöpferisch zerstörte“, soll nun testamentarisch – im Handstreich sozusagen – wieder gesellschaftlich sinnvoll wirken. Wenn das erste Leben ein ebenso gemeines wie unsicheres Alltagsprojekt war, dann ist das zweite gewissermaßen ein hieb- und bibelfestes Sonntagsprojekt. Abschließend möchte ich in diesem Zusammenhang noch kurz auf die sogenannten Internet-Projekte eingehen: Bei der Zerschlagung bzw. Privatisierung der bisherigen Wirtschaftseinheiten und der wachsenden Priorität des Individuums vor allem Gesellschaftlichen – bietet sich ja als neue Möglichkeit, um zueinander zu finden, das Internet quasi von selbst an, das einige ihrer Nutzerkollektive – „Indymedia“ und „Labournet“ z.B. – inzwischen sogar als neue Alternative zu den alten Gewerkschaften und sonstigen politischen Organisationsformen begrüßen. Das Berliner online-magazin „infopartisan“ kam jedoch kürzlich nach über zehnjährigem Bestehen zu dem entgegengesetzten Resultat, dass man die Leute gerade nicht über so ein Internetforum organisieren kann – damit werde das Pferd gewissermaßen von hinten aufgezäumt: „Sie müssen sich erst zu konkreten Aktivitäten zusammenfinden, erst dann wird – in einem zweiten Schritt, dieses Medium vielleicht für sie brauchbar“.