Liebe Tazler,
in Anbetracht der sich mehrenden Kinderkriegpausen und Erziehungsurlaube
gebe ich einen kleinen Text dazu (zu bedenken), den der
Wissenschaftsredakteur, der nach eigener Einschätzung ein geharnischter
„Darwinist“ ist und nicht einmal eine Rezension eines Symbiose-Buches
wegdrucken wollte, ganz bestimmt nicht akzeptiert hätte. Weswegen ich
ihn hier sozusagen kostenlos ins Intranet stelle:
Die ZDF-Sendung „Aspekte“ und die Bild-Zeitung
vermelden immer wieder gerne kommunistische Schandtaten. Zur Not auch
welche aus der Frühzeit der Bewegung. So berichteten sie z.B., dass
Stalin „Untermenschen“ bzw. „Arbeitssklaven“ züchten wollte. Wie das?
1927 hatten der spätere „Held der Sowjetunion“ Otto Julewitsch Schmidt
und sein Institutsleiter Ilja Iwanowitsch Iwanow auf der
Affenforschungsstation in Suchumi/Abchasien versucht,, Menschen mit
Affen zu kreuzen. Damit wollten sie anti-kreationistisch gestimmt die
nahe Verwandtschaft von Menschenaffen und Menschen beweisen. Der Versuch
mißlang: Zwar gab es etliche experimentierfreudige Frauen, aber nur
einen männlichen Schimpansen – und der starb, bevor es zum Äußersten
kam. Erst seit 1972 weiß man, dass es gar nicht gegangen wäre: die
beiden Arten haben sich zu sehr auseinandergelebt.
Und die Westmedien haben in ihren Meldungen einfach „Stalin“ zwei alte
französische Pläne untergeschoben: 1717 riet Jean Zimmermann in Paris,
zur Produktion einer Arbeiterschaft ein leichtes Mädchen von einem
Orang-Utan bzw. ein Menschenaffenweibchen von Männern schwängern zu
lassen. 1889 schlug der Rassismustheoretiker Georges Vacher de Lapouge
in Montpellier vor, durch solche Kreuzungen „gelehrige Arbeiter“ –
„Halbmenschen“- „herzustellen“. Er hielt dies für möglich, denn „der
Unterschied zwischen Menschenaffen und Menschen ist geringer als z.B.
der zwischen Makaken und Langschwanzaffen. Und diese Affen aus
unterschiedlichen Familien haben schon mehrfach erfolgreiche Kreuzungen
hervorgebracht.“
In diesen Tagen diskutieren die Medien, ob man einem
Neurowissenschaftler an der Bremer Uni verbieten soll, Hirnexperimente
an Makaken durchzuführen. „Noch Descartes hätte jede Untersuchung an
Affen abgelehnt“, schreibt Cord Riechelmann in der Süddeutschen
Zeitung, „einfach deshalb, weil er den Tieren Geist und Seele absprach“.
Riechelmann will nun die Affenforschung erneut „enthumanisieren“ – damit
diese Tiere in der Forschung nicht länger als Menschenersatz
(„Modellorganismen“) herhalten und leiden müssen. Anders Julia Voss in
der FAZ: Sie rekapituliert noch einmal den über hundertjährigen Protest
gegen Tierversuche und kommt dann auf neurobiologische Experimente mit
Kraken zu sprechen, die die Forscher verblüfften, indem sie zusahen, wie
diese ein Glas mit Futter füllten, es zuschraubten und ihnen gaben. Die
Kraken griffen sich das Glas, schraubten es auf und aßen den Inhalt. Im
Berliner „Sea Life Aquarium“ führt ein Krake neuerdings das selbe vor.
Julia Voss schreibt: „Das ist der Unterschied zum 19.Jhd.: Der Konflikt
ist nicht mehr der zwischen Herz und Verstand – es steht Forschung gegen
Forschung.“
Nicht nur die Kraken, auch die Jugend und die Affen forschen: So
betreiben Paviane in Nigeria z.B. Empfängnisverhütung mit Pflanzen. Die
weiblichen Tiere schlucken dazu die Früchte der Pflanze Vitex donaia, in
der das Hormon Progesteron enthalten ist. Diese ihre Forschung könnte
sogar geeignet sein, den darwinistischen Wissenschaftlern ihren
wichtigsten tragenden Begriff als Vorurteil zu dekonstruieren: „das
Überleben des Tüchtigsten“! Denn diese größtmögliche „Fitness“
attestieren die Darwinisten all denjenigen Individuen einer Art, die die
meisten Kinder zeugen. So definiert z.B. der Oxforder „Ultradarwinist“
Richard Dawkins, Erfinder des „egoistischen Gens“, die „Fitness, um
deren Maximierung sich alle Tiere ständig bemühen“, als die „Gesamtzahl
der Nachkommen, die zukünftig leben werden“. Die feministische
Forschung der nigerianischen Paviane legt jedoch nahe, dass genau das
Gegenteil der Fall ist: „Je weniger Nachkommen desto fitter!“ Das wissen
z.B. auch die Menschenfrauen in einigen Stämmen Neu-Guineas mit
besonders rigider Geschlechtertrennung: Sie forschen laufend nach neuen
empfängnisverhütenden Mitteln. Die Männer versuchen sie als
Prädarwinisten daran zu hindern, indem sie die nicht mehr gebärfähigen
alten Frauen auf ihre Seite ziehen. Sodann dienen diese ihnen als
Polizisten, die die jungen Frauen darin hindern müssen,
empfängnisverhütende Mittel anzuwenden.
Hinter solchen Frauenforschungen steckt laut einigen Embryologinnen am
Pariser Institut Pasteur die richtige Ahnung, dass das Austragen eines
Kindes und das Wachsen eines bösartigen Tumors identische Vorgänge sind:
Der Fötus ist ein fremdes Stück Fleisch, ein Pfropf, den der Körper der
Mutter abzustoßen versucht. Aber dem Fötus wie dem Krebs gelingt es, das
Immunsystem seines Wirts erfolgreich zu blockieren. Zwischen ihnen gibt
es laut den Embryologinnen nur einen wesentlichen Unterschied: „Aus der
befruchteten Eizelle entwickelt sich ein neuer Staat, mit dem Krebs
bricht dagegen die Anarchie aus.“
Es ist demnach wahrscheinlich die schiere Ignoranz, wenn z.B. der
NDR-Tierfilmer Heinz Sielmann einen tanzenden Mückenschwarm über einen
Teich filmt und den Insekten raunend attestiert: „Sie haben nur ein Interesse,
sich zu vermehren.“ Der französische Genetiker und Nobelpreisträger
Jacques Monod behauptete: „Was für die Bakterie wahr ist, muß auch für
den Elefanten wahr sein.“ Und sein Kollege Francois Jacob fügte in
seinem Buch „Die Logik des Lebenden“ hinzu: „In einem Lebewesen ist
alles auf Fortpflanzung hin angelegt“ (programmiert?!). So „träumt“ z.B.
ein Bakterium davon, „zwei zu werden“. Könnte es nicht sein, dass dies
eher sein Alptraum ist?
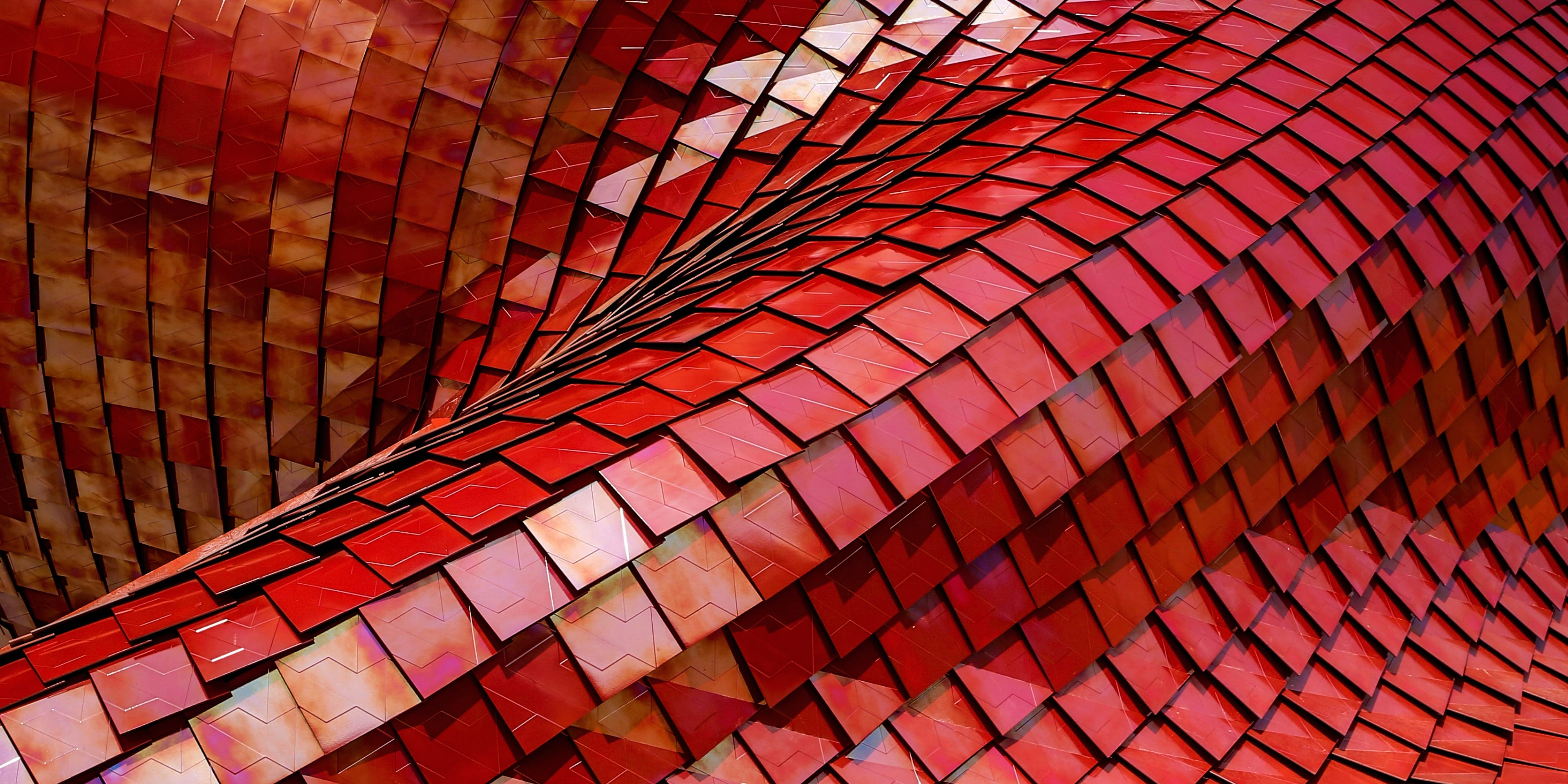



Anhand von Kotproben Aussagen über das Verhalten zu treffen, das trieb zwei US-Wissenschaftler – Michael Muehlenbein und David Watts – um, als sie im Kibale-Nationalpark in Uganda Schimpansenscheiße einsammelten. Heraus kam dabei laut SZ die Erkenntnis, dass „wer oben in der Rangordnung steht, nicht nur Vorteile hat.“
Denn „dominante Affen haben mehr Würmer als rangniedrige Tiere“. Die Forscher vermuten, „dass aggressives Verhalten – das unabdingbar ist, um in der Rangordnung aufzusteigen – das Immunsystem beeinträchtigt. Parasiten können dann schlechter abgewehrt werden.“
Neben den Parasitenbefall bestimten sie im Kot von 22 männlichen Schimpansen auch den Testosteronspiegel. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Teststeron-Konzentration und Aggressivität, gleichzeitig unterdrückt das Hormon aber auch die Immunabwehr.
Da haben die US-Anthropologen also nur 1 und 1 zusammenzählen müssen. So macht Anthropologie Spaß! Auch bei einigen Fischarten und Steppenwühlmäusen haben im übrigen ranghohe Tiere mehr als andere mit Parasiten zu kämpfen und besitzen eine schwächere Immunabwehr, fügt die SZ hinzu, kommt dann aber damit, dass es auch sein kann, dass die Ranghohen mehr als andere gekrault werden und herumvögeln, wobei sie sich leicht Parasiten einfangen können.
„Untersuchungen anderer Forscher deuten z.B. darauf hin, dass gesellige Schimpansen eher an Atemwegserkrankungen leiden und häufiger verunglücken.“
Was sind das wieder für seltsame „Forschungen“?
Auf der gleichen SZ-Seite wird im übrigen berichtet, dass in Uganda die Pest ausgebrochen ist. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass es vielleicht auch eine andere Kankheit sein kann, die bisher noch unbekannt ist.
„Infizierte geben die Krankheit meist durch Husten weiter,“ klärt uns die SZ erst mal auf. „Führend bei der Untersuchung sind die Centers for Disease Control, die US-Seuchenschutzbehörde.“ Schon wieder sind da also US-Forscher in Uganda zugange.
Aber nicht nur dort: Die US-Botschafter in 68 nicht-afrikanischen Ländern wurden jetzt angeblich angewiesen, den Kot der jeweiligen Regierungsmitglieder heimlich einzusammeln und zur Untersuchung an die Yale Universität zu schicken.
Die Leitwissenschaft Biologie hat nun also nach der Kriminologie anscheinend auch die Kunst der Diplomatie umgekrempelt.