Der praktische Solipsismus im Rausch der Geschwindigkeit und im Licht der Erkenntnis – Alfred Sohn-Rethels
Als Student in Heidelberg (1920/21) beschäftigte sich Alfred Sohn- Rethel „solide eineinhalb Jahre“ mit der Marxschen Warenanalyse, „um sie auf Herz und Nieren zu prüfen“. Dann versuchte er eine „kritische Abweichung“ zu formulieren.
Und damit ist er heute immer noch beschäftigt. Marx, so sagt er, habe sein eigenes Präzept der 1. Feuerbachthese nicht befolgt („Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts und der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als menschliche sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv…“) Statt also nur auf die Eigenschaften Gebrauchswert und Tauschwert zu achten, müsse man auf die Tätigkeiten Gebrauchen und Tauschen zurückgreifen, dann werde einem vieles klar, was Marx verhültt geblieben sei, sagt Sohn-Rethel: „Ohne Befolgung der Feuerbachthese hätte ich nicht von der Warenanalyse zur materialistischen Erkenntnistheorie vorstoßen können“.
Als ich ihn im Sommer 1986 nach längerer Zeit wieder einmal in Bremen besuche, sitzt er wie fast immer an seinem Schreibtisch und denkt. Dabei schaut er sinnend an die Decke. Vor ihm liegen ein Blatt Papier, drei Bleistifte (Stärke „5 B“), sein altes Taschenmesser und ein Schleifstein aus belgischem Basalt („Das sind die Besten!“). Wenn an der weißen Decke nichts mehr zu holen ist, spuckt Alfred Sohn-Rethel auf den Schleifstein, schärft sein Messer darauf und spitzt dann mit der scharfgemachten Klinge die drei Bleistifte an.
Zur Zeit ist er mit dem Vorwort für eine französische Übersetzung seines Buches „Geistige und körperliche Arbeit“ beschäftigt. Zuvor hatte er, gewissermaßen zur Entspannung, einige Geschichten aus seinem Leben aufgeschrieben, die seine Mitbewohnerin Bettina Wassmann dann in ihrem Verlag veröffentlicht hatte. Eine, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die er im Londoner Exil verbrachte, heißt „Sigurds Ratten“. Er hatte sie eines Abends beim Essen Bettina Wassmann erzählt. Nein, eigentlich hatte er etwas ganz anderes erzählt: Von seiner Arbeitsgruppe in Oxford, wo er den Numismatiker George Thomson kennengelernt hatte, der über die Frühgeschichte Griechenlands forschte. Mit ihm hatte er dann darüber gesprochen, wie mit dem ersten Geldverkehr das abstrakte Denken entstanden sein könnte. Bei Thomson hatte Alfred Sohn- Rethel das historische Material gefunden, das seine – 1972 unter dem Titel „Geistige und körperliche Arbeit“ veröffentlichte – marxistische neue Erkenntnistheorie mit der Plausibilität des Empirischen anreicherte. Später – in den siebziger Jahren, wieder in Deutschland, an der Bremer Universität, hatte er sich derart in das Griechenland der Ersten Philosophen eingearbeitet, daß man, wenn er in einem Seminar darüber sprach, das Gefühl bekam, er sei dabei gewesen, habe das antike Athen noch selbst erlebt. Ähnliches empfand man, wenn er über die Renaissance sprach – über die intellektuellen Duelle der oberitalienischen Mathematiker und dann über die Versuche Albrecht Dürers, die sich abzeichnende Aufspaltung der Handwerker in wenige Künstler oder Wissenschaftler – Kopfarbeiter – einerseits und viele (Hand-) Arbeiter andererseits aufzuhalten.
– Alfred, wenn einem mit Deiner Bearbeitung der Warenanalyse sozusagen ein Licht aufgegangen ist – über den Ursprung unseres wissenschaftlichen Denkvermögens und über die abstrakte Herstellung des gesellschaftlichen Zusammenhangs, in dem wir leben, dann wird man an allen Ecken und Enden immer wieder auf deine Erklärung gestoßen. Der Begriff der „Zeitökonomie“ beispielsweise, den Du in deinem Buch ‚Ökonomie und Klassenstuktur des deutschen Faschismus‘ bei der Erklärung des Nationalsozialismus verwendet hast…
– Darauf bestehe ich auch heute noch, ja heute erst recht, denn das ist meiner Meinung nach ein Schlüssel… Es geht nach wie vor um das Produzieren mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit, um aus den fixen Kosten, die dominierend geworden sind, den bestmöglichen Profit herauszupressen. Dafür kommt es ja auf die Stückkosten an, die am geringsten sind, wenn eine möglichst große Menge von Stücken sich in die fixen Kosten teilen und wenn kontinuierlich und pausenlos produziert werden kann. Dieser Kausalzusammenhang bewirkt, daß die heutige Großindustrie in der Rationalisierungsform des Fließbetriebes den Markt von vornherein mit Überproduktion beliefert. Dem Monopolkapital geht es längst nicht mehr um die Befriedigung irgendwelcher bestimmter Bedürfnisse, nach der es sich ausrichten könnte, wie das anfangs des 19. Jahrhunderts wohl noch der Fall gewesen ist. Heute geht es nur noch um die Höchstausnutzung der Kapazitäten mit Hilfe elektronischer Betriebsmittel zwecks maximaler Tempobeschleunigung. Wenn der Ausstoß bei allem Reklamedruck nicht abzusetzen ist, dann muß er eben außerhalb des Marktes untergebracht werden, nämlich in Gestalt von Rüstungsmaterialien oder Großverschwendung wie Raumfahrt etc., die nicht mehr aus dem Markt, sondern aus Staatsmitteln bezahlt werden. So ging es im Deutschland der 30er Jahre. Wenn der Staat mit solchen Zahlungen hantiert und nicht so reich ist wie die USA, dann müssen die Zahlungen mit der Gewalt der Diktatur aus dem Volk herausgepreßt werden. Oder aber man läßt die Schulden Schulden sein, auch wenn sie in die Hunderte von Milliarden Dollar steigen, und oben drauf noch SDI. Freilich gibt es außer der gleichartigen Ökonomie auch Verschiedenheiten, z.B. solche wie zwischen Reagan und Hitler und zwischen der soliden amerikanischen Demokratie und der deutschen Klassenverwirrung nach der Inflation. Aber wie groß ist der Unterschied zwischen dem Nazirassismus und dem Jingoismus à la ‚Top Gun‘? Gleichwohl zugegeben: das Skelett ist dasselbe, die Muskulatur aber, die es bewegt, eine andere. Die computerisierte Produktion und die Massenarbeitslosigkeit bei ständig wachsender Krisen-Lähmungsdauer sind hinzugekommen. Und der Krieg als Belebungsfaktor wie in den Dreißigern ist uns verwehrt, falls wir uns nicht selbst mitsamt der Zivilisation vernichten wollen. Heute handelt es sich um die Alternative, ob diese Gesellschaft sich durch einen Krieg selbst vernichtet oder sich durch zunehmende Arbeitslosigkeit zerstört. Das sind die Alternativen des Systems. Und das ist gar nicht sonderlich weitläufig gedacht, sondern ganz schlüssig und meiner Meinung nach unausweichlich. Der Einstieg in die Computerisierung der Produktion bewirkt hierbei keine Veränderung, nur eine Steigerung. Etwas anderes wäre es , wenn die Arbeitlosen selbst initiativ würden. Viele tun das ja auch, aber in ungenügendem Maße und mit ungenügenden Mitteln. Man sagt, daß ein qualifizierter Facharbeiter nach drei Jahren Arbeitslosigkeit alles Fachkönnen verloren hat. Er kommt dann nicht mehr in den inzwischen veränderten Arbeitsprozeß rein, er findet sich nicht mehr zurecht.
– Unterschätzt du damit nicht die Schwarzarbeit, die Schattenwirtschaft, die Selbstorganisation?
– Es gibt darin sicher eine Menge vielversprechender Ansätze und Projekte, aber die sind – mindestens derzeit noch nicht – verallgemeinerbar. Die ganze Profit-Basis hat sich ja mittlerweile verändert, die geht nur noch zum Teil und in ganz bestimmten Bereichen auf den Mehrwert zurück, aber in der High-Tech-Produktion gibt es ja kaum noch Arbeiter. Die machen ihren Profit nur aus der Konkurrenzjagd nach dem Kapitalumschlag mit der größten Geschwindigkeit. High-Tech- ist High- Speed-Produktion…
– Auch im intellektuellen Bereich. Das führt dann zu solch dromologischen Exzessen wie in dem Buch von Tracy Kidder ‚Die Seele einer neuen Maschine‘, in dem es um den Bau eines neuen Computers geht; über den 35jährigen Projektleiter steht dort: ‚Er war ein cleverer und ausgelassener alter Herr.‘ Normalerweise sind diese Leute bereits mit 30 „burned out“ – ausgebrannt, immer heller und kurzlebiger müssen sie strahlen. Apropos: Das erinnert mich an eine Bemerkung Rolf Schwendters: In den 20er Jahren beschloß das internationale Glühbirnen-Kartell (mit Ausnahme Japans), die Brenndauer von 28 auf 24 Stunden herabzusetzen; sowie auch an Dein Berliner Osram-Beispiel aus der Zeit der Hochinflation, als die Arbeiter mit Glühbirnen bezahlt wurden, was als Tauschmittel natürlich nur für kurze Zeit funktionierte – dann hatten alle Händler genug Birnen für den Rest ihres Lebens auf Lager. Du hast ja auch mal eine Glühbirnenfabrik in Rotchina besucht, während der Kulturrevolution: Dort brannten sie länger und heller. In deinen Seminaren bist Du vor allem immer wieder auf Parmenides zu sprechen gekommen, für den die Vernunft ein Geschenk der Göttin Dike war, in Form eines strahlend hellen Lichts…
– Mit Parmenides habe ich es ja nun ganz besonders: Ich leite die Abstraktion aus der Vergesellschaftung ab, und zwar aus dem Austausch, und die Weise, wie dieses Denken entsteht, hat mit dem ‚Geist‘ nichts zu tun. Die Trennung des Tausches vom Gebrauch, die die Ursache ist für die Abstraktion, geschieht nur der Tatsache nach – in den Handlungen. Das Bewußtsein nimmt daran nicht teil. Das kann sich ruhig mit dem Gebrauchswert beschäftigen, während getauscht wird. Nun ist aber die Frage, wenn das die Ursache des abstrakten Denkens sein soll, wie ich sage, dann muß man aufweisen können, wie sich diese Realabstraktion, die nichts mit dem Denken zu tun hat, umsetzt in die Denkabstraktion. Das hat Christine Woessler damals schon bemängelt, daß das bei mir nicht klar wird. Nun ist das natürlich sehr knifflig, aber ich habe mittlerweile eine Methode gefunden – und die zielt auf Parmenides ab. In einem früheren Aufsatz ‚Das Geld – die bare Münze des Apriori‘, den Du ja in einer früheren Version – als eine „Kritik der Kantschen Erkenntnistheorie“ in der Zeitschrift ‚Neues Lotes Folum‘ abgedruckt hast, freundlicherweise von allen Stalin- und etlichen Lenin-Zitaten befreit, die ich bei der Abfassung in den Fünfzigerjahren da reingeschrieben hatte, um den ML-Kollegen in Japan, aber auch in Ostberlin verständlich zu bleiben…In diesem Aufsatz hakte ich schon an der Tatsache ein, daß das Geld emittiert wird mit dem Versprechen, seinen Verschleiß zu ersetzen – für verschlissenes Geld bekommt man Neues auf der Bank. Der große Postraub in England damals basierte darauf: Eigentlich hatten die nur Altpapier – Makulatur – gestohlen, aber es wurde wieder Geld,dadurch daß sie es stahlen…
– Was hat der Postraub mit Parmenides zu tun?
– Das Geld darf sich nicht verschleißen, folglich braucht man dafür Materialien, die nicht verschleißbar sind. Solche Materialien gibt es in der Natur aber nicht. Das Geld hat also eine virtuelle Materie, mit der es natürlich nicht umlaufen kann, weil sie nicht sichtbar ist, und auchkeinen Geldwert hat. Das Geld steht immer ineins mit einem gebrauchswerten Material, Edelmetall ist ja Gebrauchsgut; also an die reine Tauschabstraktion kommt man nur auf dem Wege, daß man auf der Verschleißersetzung insistiert. Und da hat man nun eine merkwürdige Substanz, die keine natürliche und nicht anschaulich ist, die sich dem Parmenides aufgedrängt hat. Denn der einzig wirkliche Begriff, der dem entsprach, zu seiner Zeit, ist das „tò ón“ des Parmenides, sein Seins-Begriff. Dieser Begriff, den er da entwickelt hat, ist verträglich mit dem virtuellen Geldbegriff, und dieser virtuelle Begriff der Materie, die nicht verschleißbar sein darf, ist ein echter Bestandteil der Realabstraktion. Da kommt er her und wird bei Parmenides zum Begriff. Hegel bemerkt in seiner „Geschichte der Philosophie“ dazu: ‚Mit Parmenides hat das eigentliche Philosophieren angefangen, die Erhebung in das Reich des Ideellen ist hierin zu sehen‘. Ich bilde mir etwas darauf ein, daß ich das gefunden habe, denn es ist sonst wahnsinnig schwer, den Weg zu finden, auf dem man überhaupt beweisen kann, daß eine Realabstraktion, oder ein Teil davon, sich in Denkabstraktion übersetzt hat.
– Gleichzeitig hat sich Parmenides aber auch schon Gedanken darüber gemacht, wo die Vernunft, das abstrakte Denken, denn nun herkommt…
– Ja, er hat sein ‚tò ón‘ nicht erfunden. Das ist sehr wichtig. Es ist ihm fertig gegeben worden. Er sagt, es ist von Dike, der Göttin des Rechts und der Wahrheit. Hier habe ich die Stelle – über das Seiende: ‚Weil ungeworden, ist es auch unvergänglich, ganz, einzig, unerschütterlich, ohne Ende, und nie war es oder wird es sein, da es jetzt zugleich ein einheitliches zusammenhängendes Ganzes ist. Was wolltest du denn auch für einen Ursprung für das Seiende erfinden, woher sollte es gewachsen sein…‘ Er kommt da an den Begriff heran. Und weiß natürlich nicht, daß es mit dem Geld zu tun hat. Da muß ihm erst später ein anderer – Anaxagoras – aushelfen. um seinem Begriff des Einzigen, Unvergänglichen, des Seins, die nötige Bewegung zu verschaffen. Anaxagoras führt dabei als erster – etwa gleichzeitig mit Demokrit – den Atom- Begriff ein. Dadurch lockert sich das Feld auf und dadurch kann dieser Gedanke und die Bewegung für die Naturwissenschaft ausgewertet werden. Ich habe jetzt für die französische Übersetzung meines Buches ‚Geistige und körperliche Arbeit‘ einiges überarbeitet darin, vielleicht kann ich daraus einen Abschnitt Dir hier mal vorlesen:
‚Die Tauschabstraktion gehört zum Warentausch, sie gehört nicht zu seiner geschichtlichen Vorform, dem Geschenk- oder Gabentausch. Der Gabentausch ist gekennzeichnet durch die Verpflichtung der Reziprokation der empfangenen Gabe, der Warentausch aber darüberhinaus gekennzeichnet durch das Postulat der Äquivalenz der getauschten Objekte. Diese Unterschiede und Gegensätze bedürfen der Aufklärung. Die erste umfassende Erforschung des Gabentauschs ist Anfang des Jahrhunderts durch Marcel Mauss erfolgt. Seine zwanzigjährigen Untersuchungen kamen 1924 in Paris zur Veröffentlichung in seinem berühmten Essay ‚Die Gabe – Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften‘. Seine Methode ist die des präzisen Vergleichs, sie reicht aus, ihm zur genauen Beschreibung der Phänomene in ihrer ungeheuren vielfachen Komplexität zu verhelfen. Eine historische Erklärung des Gabentauschs als solchen hat er nicht angestrebt. Es findet sich bei Mauss nicht einmal eine Definition dessen, was er unter ‚archaischer Gesellschaft‘ verstanden wissen will. Ich sublimentiere jedoch aus eigenem eine solche, wie sie mir am offenkundigsten erscheint. Als archaisch sollen Gesellschaften verstanden sein, welche zumindestens für ihre Primärproduktion, also Bodenbearbeitung, mit keinen anderen als steinzeitlichen Geräten und Werkzeugen ausgestattet sind. Mit solchen Ausrüstungen ist keine Einzelproduktion, keine individuelle Selbsterhaltung möglich, deshalb kollektive Produktion und Gemeineigentum der einen oder anderen Art eine Notwendigkeit. Nun präzisiert Marcel Mauss sein Forschungsproblem wie folgt: ’so untersuchen wir von all diesen Prinzipien im Grunde doch nur ein Einziges: Welches ist der Grundsatz des Rechts und Interesses, der bewirkt, dass in den rückständigen oder archaischen Gesellschaften das empfangene Geschenk obligatorisch erwidert wird?‘ Das ist sein Puzzle. Was liegt in der gegebenen Sache für eine Kraft, die bewirkt, dass der Empfänger sie erwidert?
Und dazu sage ich: In der Frage folgt Mauss bereits einer falschen Fährte: Die Erwiderung haftet nicht am Ort des Austauschs, sie haftet auch nicht am Zeitpunkt oder an der Sache, die Erwiderung hängt vielmehr an der Person. Eine Person, die eine Gabe, die sie empfangen hat, ohne jedwede Erwiderung ließe, sie also als ihr persönliches und definitives Eigentum behandelte, würde sich in einen unerträglichen Gegensatz zu ihrem kollektiven Gemeinwesen setzen und ihre Ächtung provozieren. Hier haftet auch die Person für ihre soziale Bewährung und Bestätigung an der Erwiderung. Kein Zweifel deshalb, innerhalb eines archaischen kollektiven Gemeinwesens ist die Erwiderung der empfangenen Gaben genugsam zuverlässig. Ist das aber in anderen, späteren Gesellschaften auch noch so? Das auf das Steinzeitalter folgende Bronzezeitalter bringt in den wesentlichen Punkten noch keine Umwälzung hervor, da Bronze zu kostbar ist und nur den Herrschenden für Waffen und Luxusgegenstände zur Verfügung steht, die Primärproduzenten hingegen in der Hauptsache bei ihren Steinwerkzeugen beläßt. Allerdings verschafft die Anlage von Bewässerungssystemen in den großen aluvialen Flußtälern vom Nil bis zum Hoang-Ho in China den Herrschern in der Bronzezeit eine erheblich gesteigerte Agrarausbeute. Der entscheidende Bruch in der Tradition der archaischen Gesellschaften tritt ein durch die Eisengewinnung und die sich entwickelnde Eisenbearbeitung. Das Eisenerz ist nahezu überall verfügbar, jedenfalls war dies in Griechenland der Fall, und Metallgeräte sowie Werkzeuge aus Eisen ungleich billiger und überdies härter als diejenigen aus Kupfer und seinen Legierungen. Die Verwendung von Eisengerät in der Bodenbearbeitung bringt eine wirtschaftliche Umwälzung in der Agrarproduktion hervor. Sie kann jetzt erfolgreicher als Einzelwirtschaft betrieben werden als in der umständlichen und aufwendigen Art der vorhergehenden kollektiven Aluvialwirtschaft. Mit dem Übergang zur Eisentechnik entsteht die Ökonomie der kleinen Bauernwirtschaften und der unabhängigen Handwerksbetriebe, die beide – nach Marx‘ berühmter Fußnote – ‚die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen in ihrer besten Zeit bilden, nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeinwesen aufgelöst und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft bemächtigt hat‘.
Im Eisenzeitalter tragen die Einzelwirtschaften die Verantwortung für ihre Selbsterhaltung. Vor diesem Hintergrund ist nun freilich auf die Bereitschaft zur Erwiderung beim Gabentausch kein Verlaß mehr, und der Austausch muß eine tiefgreifende Umformung erfahren, eben die Umformung zum Warentausch, d.h. die zuvor im zeitlichen Abstand zur Gabe lose erfolgende Erwiderung verkoppelt sich jetzt strikt mit ihr zur prompten Bezahlung der Gabe an Ort und Stelle, so daß die beiden Akte des Austauschs wechselseitige Bedingung füreinander werden und zur Einheit und Gleichzeitigkeit eines Tauschgeschäfts zusammengekettet sind. Die Partner dieses Verhältnisses stehen nun als Käufer und Verkäufer erst eigentlich in vollem Sinne der Tauschhandlung und Tauschverhandlung sich gegenüber.
Keiner der beiderseitigen Akte des Gebens und Nehmens ist für sich der Tauschakt. Der Tauschakt ist das komplexe Verhältnis, in dem die beiderseitigen Handlungen sich zur Einheit des Austausches aufwiegen. Das ist keine physische Einheit, sondern ein Rechtsverhältnis. Das Mengenverhältnis ihrer Warenposten, auf das die Tauschpartner sich einigen, hat Vertragscharakter, schriftlichen odermündlichen.
Im Warentausch ist der Akt gesellschaftlich, aber die beiden Mentalitäten sind privat; das sagt sich bündiger und klarer auf englisch: In commodity exchange the act is social, the minds are private. Das Gesellschaftliche am Warentausch ist also der bloße Akt der Besitzübertragung in absoluter Abstraktion von allem, was die Privatbesitzer im Kopf haben. Der gesellschaftliche Akt allein ist tauschwertig, quantitätsbestimmt, absolut abstrakt und generell, die privaten Mentalitäten sind gebrauchswertig, qualitätsbestimmt, konkret und individuell. Am reinen Abstraktionscharakter des Tauschaktes hängt die Funktion der Vergesellschaftung, die bei privater Warenproduktion an der Warenzirkulation hängt. Durch die Abstraktheit des Tauschaktes werden die Waren, die seinen Gegenstand bilden, in einen identisch übereinstimmenden Formkanon gesetzt, in dem sie alle als bloße Quantitäten vergleichbar miteinander sind und Objekte eines interdependenten Marktverkehrs werden können. Einzigm dadurch ist die Marktgesellschaft der Warenproduktion – das mirakulöse Phänomen einer Gesellschaft nach Prinzipien des Privateigentums – und somit auch die Warenproduktion selbst überhauptmöglich. Dieser hintergründige Funktionalismus ist den Individuen vollkommen verschlossen, er spielt sich ab im Blindpunkt des individuellen Bewußtseins. Kant hätte ihn als transzendental qualifiziert, Marx und Engels bezeichneten sein Ergebnis als Verdinglichung. Den Individuen der bürgerlichen Gesellschaft kann er sich schwerlich anders denn in der idealistischen Fetischgestalt des ‚Geistes‘ verbrämen, weil die Abstraktionsformen, die sie ihm verdanken, gänzlich unsinnlich und körperlos und doch persönlich zu eigen sind. Materialistisch verstehen sich diese Formen nicht als Geistesprodukte, sondern als die Vergesellschaftungsformen des Denkens.
Darin erweist sich dem geschichtlich zeitlosen Denken sein Geschichtsgrund in der Struktur des Warentausches. Die Allgemeingeltung des ‚rationalen‘ Denkens erstreckt sich über alle Formationen der Warenproduktion, vom Beginn des Eisenzeitalters in der griechischen Antike bis zum Anbruch des Atomzeitalters und der Elektronik von der Mitte unseres Jahrhunderts an. In seiner absoluten Abstraktheit enthält der gesellschaftssynthetische Tauschakt eine begrenzte Vielfalt von Elementen, deren hauptsächliche ich analytisch aufgewiesen habe; diese Elemente fügen sich zum strukturellen Schema der Mechanik zusammen. Auf die Entdeckung dieses Schemas und seiner Mathematisierbarkeit hat Galilei die mathematische und experimentelle Methode der exakten Naturwissenschaft gegründet bzw. zu ihrer Ausbildung durch Newton den Grund gelegt. Dabei verkennt er die Mechanik des Austauschaktes – d.i. der abstrakten Physikalität der Warenbewegung, und des Geldumlaufs zwischen je zwei Eigentümern – als die Grundgesetzlichkeit der Natur. Die Naturwissenschaftler glauben, die Ausschaltung des Anthropomorphismus und den Zugang zur objektiven Naturerkenntnis geschaffen zu haben, sie haben aber nur einen früheren durch ihren eigenen Anthropomorphismus ersetzt. Der allerdings hat die entscheidenden Vorteile der mathematischen Methode und des messenden Experiments für sich. Auch die exakte Naturerkenntnis erfährt aber ihr geschichtliches Ende durch die Ablösung des Maschinenzeitalters durch das Atomzeitalter. Atomare Vorgänge entziehen sich dem mechanistischen Zugriff.
– Ich möchte noch einmal auf den Akt des Tauschens zurückkommen: Was passiert dabei genau?
– Die Individuen stellen dabei Gesellschaft her, sie wissen es nicht, aber sie tun es, und zwar in einer Weise, an der die Natur keinen Anteil hat. Zuvor basierte der gesellschaftliche Nexus auf der gemeinsamen Produktion und Konsumption, also auf dem elementaren Naturverhältnis des Gemeinwesens, dem man sich mit den Mitteln der Magie zu vergewissern suchte. Innerhalb eines Warentauschs sind alle Handlungen für die beiden Akteure gemeinschaftliche, ihre Handlungen können nicht mehr aufgelöst werden in beiderseitige Einzelbeteiligungen; nur wenn sie den Vertrag unterschreiben, dann muß jeder seine eigene Unterschrift leisten. Es ist alles gemeinschaftliche Handlung, und das, obwohl sie in einem Verhältnis der wechselseitigen Fremdheit zueinander stehen, in einem praktischen Solipsismus, wie ich das nenne. Die Gemeinschaftlichkeit des Handelns tritt also hier ein – im Bereich der Zirkulation, in dem Maß der Auflösung der früheren gemeinschaftlichen Produktion und Konsumption. Also der gesellschaftlichen Gemeinschaft der Natur gegenüber. An die Stelle tritt jetzt Privatproduktion und da wird im Verhältnis zur Natur ganz was anderes gebraucht: der Einzelne muß der Natur gegenübertreten, gedanklich. Dabei kommt ein ganz anderes Verhältnis zur Natur auf. Ein überlegtes Verhältnis, ein beobachtendes Verhältnis, und das tritt in der Tat auf zu Beginn der griechischen Zivilisation, mit den ionischen Naturforschern. Die Naturforschung ist der eigentlich Inhalt der griechischen Philosophie, mit Ausnahme von Sokrates und der Sophistik. Die ganzen Vorsokratiker, das geht noch bis zu den Römern, bis zu Lukrez, das ist alles beschäftigt mit der Theorie der Natur, als Folge der Auflösung der gemeinwirtschaftlichen Produktion und Konsumption, und das dreht sich um auf die gemeinschaftliche Besorgung des Zirkulationsprozesses und eine ganz neuartige Gesellschaft. Da sieht man richtig, wie sich die Gesellschaften umwälzen. Ich sehe das jedenfall so. Und dadurch ergibt sich ein sehr klares Bild dessen, was da wirklich passiert ist. Denn diese ersten Praktiken des Warentauschs haben da das Privateigentum verbreitet und den Rechtscharakter des Tausches. Und diese beiden Dinge gehören zur Grundlage der Polis.
– Die Spartaner scheinen die gemeinschaftszerstörende Kraft dieser Dinge erkannt und gefürchtet zu haben, dort wurde immer wieder der Privatbesitz aufgehoben und das Land – zu gleichen Teilen – wieder verlost, um erneut gleiche Ausgangsbedingungen für alle Freien zu schaffen…
– Die Spartaner durften ja nicht tauschen, weil sie kein Geld haben durften. Und das Geld war dazu nötig. Bei mir entsteht ja kraft der Tauschabstraktion das was Marx auch die Warenform nennt, quantitativ und abstrakt und vollkommen identisch gleich, in jedem einzelnen Fall. Und der einzelne Fall ist jeweils dieses Tauschverhältnis, da entsteht die Warenform, hier und da und dort, überall. Und um die nun zur Gesellschaft zusammenzuschweißen, braucht man Geld, das Geld ist die universalisierte Warenform als separates Ding – Münze.
– Und wer garantierte den gleichbleibenden Wert des Geldes, die Stadt?
– Das ist nun die Frage. Es gibt etliche Anzeichen dafür, dass es die sogenannten Tyrannen gewesen sind, wenigstens die frühen aus dem 7. und 6. Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Sie scheinen für die ausgegebenen Münzen die nötige Garantie getragen und die entgegenstehenden traditionellen Ordnungen und Fürsten beseitigt zu haben, um dadurch den Bestand der betreffenden Polis vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Wir wissen nicht, wann es zur Münzprägung gekommen ist, ob z.B. vor oder nach der schweren Agrarkrise in Attika, aus deren bestandsbedrohenden Ausmaßen Solon durch seine Reformen in den ersten Jahren des 6. Jahrhunderts den athenischen Staat rettete. Er hat selbst gesagt, daß er sich zum Tyrannen hätte aufschwingen können, wie Pisistratos zwanzig Jahre später das getan hat. Vergleichbare Krisenzustände scheinen in Korinth geherrscht zu haben und dort Grund zur Geldprägung gewesen zu sein. Die Krise erwuchs aus der abnehmenden Getreideerzeugung der heimischen Bauern bei wachsender Bevölkerung und geographischer Engigkeit des Staatsgebietes. Nach der solonischen Reform ging Athen zur Beschaffung des fehlenden Getreides von auswärts über, etwa von Naukratis oder vom Pontus, im Austausch gegen Olivenöl und Wein, von denen der nötige Überschuß auf den Gütern der Adligen sich gewinnbringend anbauen ließ. Aristoteles bezeichnet in der ‚Politik‘ für einen solchen Handel die Verwendung von Geld als eine Notwendigkeit. Aber das darf nicht zu der verkehrten Vorstellung führen, als ob nun der gesamte äußere und innere Güterverkehr Athens stoßartig zum Warentausch mit Geldwirtschaft übergegangen sei. Im Gegenteil, der Warentausch kann zu Anfang nur eine seltene, episodische Rolle gespielt haben, und es hat einer mehrhundertjährigen Zeit bedurft, um den Warentausch im Alten Griechenland zur vollen Entwicklung kommen zu lassen. Erst Ende des 4. Jahrhunderts und im anschließenden Hellenismus ist dieser kulturell beklagenswerte Umschwung erreicht; er bezeichnet auch das Ende der Polis. Wie aber war der vorangehende Zustand, also die eigentliche griechische Antike beschaffen? Das Konstitutionsgesetz der Antike lautet: Fortführung des Gabentauschs unter Bedingungen der Eisenzeit und der Münzprägung, also trotz eines seiner klassischen Grundlage im kollektiven Gemeinwesen entgegengesetzten Hintergrunds. Die Reziprokation der empfangenen Gaben, worauf der Gabentausch beruht, konnte nicht mehr als selbstverständliche Regel unterstellt werden; Er bedurfte der Sicherung durch Sakralisierung, d.h. der Pflege des mythologischen Götterkultes und des sakralen Opferdienstes, institutionalisiert und überwacht durch die Priesterschaft der zahlreichen Tempel, um die herum jede Polis erbaut war. Zwei Schriften insbesondere haben Pionierdienste für die Einsicht in diese Zusammenhänge geleistet: Bernhard Laum ‚Heiliges Geld‘, 1924 und Horst Kurnitzky ‚Triebstruktur des Geldes‘, 1974. Merkwürdig ist freilich, daß beide Autoren die geschichtliche Grundlage der Phänomene, die sie beschreiben, ignorieren und ihre Arbeiten als vernichtende Kritik an der Marxschen Geldtheorie verstehen! Darin haben sie auch acharnierte Anhänger gefunden.
Bei diesen historischen Geschichten will ich aber gar nicht so in die Einzelheiten gehen, das sollen andere machen. Ich kann ja kein Griechisch und kann mich nicht in die griechischen Details einmischen. Jedenfalls, das ist so die Grundlage dessen, was ich z.Zt. schreibe und das führt meinen Gedanken ziemlich weiter – erstens ins Genauere und dann überhaupt weiter, dadurch, daß ich zum ersten Mal einen Verbindungsfaden aufgespürt habe, wie die Realabstraktion die Denkabstraktion hervorbringt. Denn das ist ja doch allerhand, wenn man das verfolgen kann, und bis man es verfolgen kann. Nun findet man natürlich nicht überall und jedesmal einen solchen Ariadnefaden für einen Begriff – z.B. für den Begriff des Atoms oder für den der Bewegung auch, der dann ja weiter gegangen ist. Im Großen und Ganzen aber kann man sagen, dass in der gesamten griechischen Philosophie bis Aristoteles die Umsetzung der Realabstraktion in Denkabstraktion auf dem Plan stand. Das wußten sie natürlich nicht.
– Aber es gibt doch Hinweise, dass zumindest die Dichter es mitunter geahnt haben, einige Verse in Sophokles‘ ‚Antigone‘ z.B.: ‚Oh, nichts trug solch ein Unheil in die Welt/ als Gold! Die Städte stürzt es in den Staub/ Die Menschen treibt es weg von Haus und Herd/ Des Mannes Sinn betört’s mit arger Lehre/ Und bringt den Guten selbst zu böser Tat/ Zu Schurkerei treibt es den Menschen an/ Und lehrt ihn jede gottvergssne Tat…‘
– Ja, sehr richtig. Die griechische Philosophie hat jedoch wegen dieser Gesamtthematik diese einzigartige Bedeutung für uns. Und deswegen sind ihre Inhalte immer noch Diskussionsgegenstände – mit Kant, Hegel usw.. Es existiert immer noch eine Diskussionsgemeinschaft mit den ‚Alten‘.
– Während Deine mit den ‚Jungen‘ – der Frankfurter Schule – abgerissen ist…
– Vor einiger Zeit hat der Hamburger Philosophieprofessor Stefan Breuer eine Untersuchung angestellt über das Verhältnis von Adorno und Horkheimer; er hat diese Sache in der Zeitschrift ‚Leviathan‘ und veröffentlicht. Diese Arbeit war sehr gut, er wußte aber natürlich nichts von meinem Briefwechsel mif Adorno, er hat nur die Gegensätze zwischen den beiden herausgearbeitet und daß Horkheimer Kantianer geblieben ist, und erkenntnisteoretisch jedenfalls ein Idealist war. Ich habe Stefan Breuer angeschrieben und ihm gesagt, daß ich seine Einschätzung teile und daß ich dem noch etwas hinzufügen möchte, wobei ich ihm einen Brief von Adorno an mich aus dem Jahr 1936 geschickt habe. Das hat Stefan Breuer interessiert und es ist daraus ein Briefwechsel zwischen ihm, Bodo v. Greiff und mir entstanden, der dann in der Zeitschrift ‚Leviathan‘ abgedruckt wurde, zusammen mit Auszügen aus dem Brief von Adorno. Es konnten nur Auszüge sein, da der Herausgeber des Adornoschen Nachlasses, Dr. Rolf Tiedemann, Einwände geltend gemacht hatte. Dazu kommt aber nun noch folgendes: Dieser Brief von mir, auf den sich Adorno in seinem Antwortschreiben bezieht, und der so großen Eindruck auf ihn gemacht hat, den hat er gegenüber Benjamin und Horkheimer verheimlicht; ich habe ja später mit Benjamin in Paris zusammengearbeitet. Adorno war da noch in England und Horkheimer schon in Amerika, und da wurde Benjamin gebeten, den Gutachter zu machen für meine ‚Kritische Liquidierung des Apriorismus‘ und dabei haben wir uns natürlich weidlich gesehen und nie hat er da ein Wort geäußert, das auf diesen Brief sich bezogen haben könnte, ebensowenig Horkheimer in seinem Brief an mich. Und dadurch ist meine Teilhabe am Kreis des Instituts für Sozialforschung doch irgendwie unter den Tisch gefallen, vielleicht sollte man das jetzt nicht länger verschweigen…
– Aber in Adornos „Negativer Dialektik“ gibt es doch immerhin einen Hinweis…
– Ja, aber einen ungenauen, was da zitiert wird, das habe ich so nie gesagt, dass abstrakte Arbeit im Transzendentalsubjekt enthalten sei. Würde ich auch nie begründen können. Es gibt dazu eine Fußnote in meinem Buch ‚Geistige und körperliche Arbeit‘, auf Seite 90. Ich weiß also nicht, warum Adorno das geheimgehalten hat, das kann sich jeder selbst ausdenken, auf jeden Fall, Tiedemann hat nie was von mir gehalten, und diese Geschichte zwischen Adorno und mir ist ihm auch nie zu Ohren gekommen, er hat die Briefe von Adorno an mich noch nie gesehen. Schriftlich ließ er mir mitteilen, ‚daß eine Verwendung des Adornoschen Briefes an Sohn- Rethel vom 17. November 1936, sei es durch Abdruck oder Zitat, nicht in Betracht gezogen werden kann‘ – mit der Begründung, daß er ‚weder die sachliche Stellung Adornos zu dem Buch Sohn- Rethels‘ (gemeint ist die Veröffentlichung des ‚Luzerner Exposés‘ 1986) ’noch die persönliche Beziehung zur Person, wie sie etwa der gesamte Briefwechsel dokumentierte, in irgend angemessener Form repräsentiert.‘ Er weiß offenbar nicht, daß ich Adorno mit Kracauer zusammen schon 1924 auf Capri kennengelernt und dann 45 Jahre lang mit ihm bis zu seinem Tod 1969 in Beziehung gestanden habe.
– Was hat es mit dem jüngst erschienenen Buch auf sich, das von Jochen Hörisch herausgegeben worden ist: ‚Alfred Sohn-Rethel – Soziologische Theorie der Erkenntnis‘, in dem dein ‚Luzerner Expose‘ abgedruckt ist?
– Das ist der erste Darstellungs- und Begründungsversuch meines theoretischen Standpunktes, unmittelbar nach dem Verlassen Deutschlands im Februar 1936 in Angriff genommen.
– Ein starker Satz darin ist mir in Erinnerung geblieben: „‚Gesellschaft‘ ist, im Sinne dieser Untersuchung, ein Zusammenhang der Menschen in bezug auf ihr Dasein, und zwar in der Ebene, in der ein Stück Brot, das einer ißt, den anderen nicht satt macht.“
———————————————————————————————————————————–
Aus einem Brief von Theodor W. Adorno an Alfred Sohn-Rethel:
„17. November 1936, Merton College, Oxford
Lieber Alfred,
ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich Ihnen sage, daß Ihr Brief die größte geistige Erschütterung bedeutete, die ich in der Philosophie seit meiner ersten Begegnung mit Benjamins Arbeit… erfuhr. Diese Erschütterung registriert … die Tiefe einer Übereinstimmung, die unvergleichlich viel weiter geht, als Sie ahnen konnten, und auch als ich selber ahnte. (…)
Und nur das Bewußtsein dieser Übereinstimmung, … die aber im wesentlichen in der kritisch-immanenten Überführung (= dialektischen Identifikation) des Idealismus in dialektischen Materialismus; in der Erkenntnis, daß nicht Wahrheit in der Geschichte, sondern Geschichte in der Wahrheit enthalten ist; und im Versuch einer Urgeschichte der Logik besteht – nur diese ungeheure und bestätigende Übereinstimmung verhindert mich, Ihre Arbeit genial zu nennen. (…)
Wie ich danach unsere Begegnung herbeisehne, bedarf keines Wortes. So hätte es Leibniz zumute sein müssen, als er von der Newtonischen Entdeckung hörte, und vice versa. Halten Sie mich nicht für wahnsinnig. Ich glaube nun gewiß, was ich schon lange von meinem Versuch annehme: daß es uns konkret gelingt, den Idealismus zu sprengen: nicht durch die ‚abstrakte‘ Antithese von Praxis (wie nach Marx), sondern aus der eigenen Antinomik des Idealismus. (…)“
Vgl. dazu auch die Diskussion über diesen Brief – zwischen A. Sohn-Rethel, S. Breuer und B.v. Greiff in der Zeitschrift ‚Leviathan‘ (Juli 1986): .Differenzen im Paradigmakern der Kritischen Theorie“ (II).
———————————————————————————————————————————-
Aus einem Gespräch, das ich mit dem inzwischen verstorbenen Bielefelder Philosophen Jürgen Frese führte, in dem es eigentlich um Alfred Seidel ging, dessen Buch „Bewußtsein als Verhängnis“ wir im Bremer Impuls-Verlag wiederveröffentlicht hatten und über das Frese einen sehr guten Aufsatz veröffentlicht hatte:
„Mit dem Adorno-Nachlaßverwalter Rolf Tiedemann habe ich in den Fünfzigerjahren in Frankfurt studiert. Wir wohnten im selben Studentenwohnheim an der Bockenheimer Warte. Es gab nur eine Küche auf dem Flur, mit nur einem Kühlschrank, in dem jeder seine Lebensmittel aufbewahrte. Jeder schrieb seinen Namen auf die Wurst und den Käse. Eines Tages bekam Tiedemann eine Stelle als studentische Hilfskraft in der Bibliothek des Instituts für Sozialforschung. Und schon am nächsten Tag hatte er seine ganzen Lebensmittel neu beschriftet – mit ‚Rolf Tiedemann, Institut für Sozialforschung‘.“
———————————————————————————————————————————
Anfang 2000 wandte der von Freiburg über Bochum an die Berliner Humboldt-Universität gekommene Kulturwissenschaftler Friedrich A. Kittler sich zum Entsetzen seiner Studenten von den Neuen Medien ab und den Alten Griechen zu – und zwar gründlich. Er startete sogar eine Schiffsexpedition ins Mittelmeer, um dem Gesang der Sirenen auf die Tonspur zu kommen. Es gibt darüber inzwischen eine sehr schöne CD, auf der er davon erzählt. Im Internet fand ich einen Text von Kittler, in dem er im Zusammenhang seiner Griechenstudien auch Alfred Sohn-Rethel erwähnt:
(…) Die üblichen Mathematikgeschichten verzeichnen es wie eine Nebensache, daß die griechischen Buchstaben seit etwa 450 vor unserer Zeitrechnung eine zweite, nämlich arithmetische Bewandtnis annahmen: Alpha stand zugleich für Eins, Beta für Zwei, Gamma für Drei undsoweiter. Zum erstenmal in aller Mediengeschichte entsprangen die Zeichen für Kardinalzahlen der Reihung oder Ordinalität eines Alphabets. Ganz entsprechend kennt die Epigraphik, also unsere nur sogenannte Hilfswissenschaft von altgriechischen Inschriften, nur ein „ästhetisches Verlangen“ zumal der Athener, „größere Einfachheit, Symmetrie und Gleichförmigkeit“ zwischen den einzelnen Buchstabenformen zu stiften. In Wahrheit hat der sogenannte Stoichedon-Stil im archaischen Athen den Buchstabenformen war in Wahrheit eine der Möglichkeitsbedingungen von Wissenschaft überhaupt. Buchstabenformen, lehrt unsere Trägheit einen faulen Materialismus, den aber von Leukippos alles unterscheidet, seien immer nur der Trägheit menschlicher Hände nachgegangen: Kursivschriften auf glatten Flächen, Keile in Tonscherben, Lapidarlettern auf Steinen ewiger als Erz. Daß am Anfang unserer Kultur jedoch eine Ökonomie der Zeichen selber stand, die sich um ihre Träger kaum mehr scherte, widerlegt jeden Materialismus, der Zeichen überliest (vgl. Sohn-Rethel). Es gibt keinen Geldhandel ohne Münzen, aber auch keine Münze ohne Schrift Bild Zahl. Es gibt keine Tragödie ohne Buchstaben, aber – ins tragische Ohr Tübingens gesagt – auch keinen „vesten Buchstaben“, den dieses Feuer nicht geläutert hätte.
Zu seinem 60. Geburtstag 2003 wurde eine Festschrift für Friedrich Kittler veröffentlicht, darin schrieb Jochen Hörisch einen Beitrag mit dem Titel „Benjamin zwischen Bataille und Sohn-Rethel“.
———————————————————————————————————————————
2008 veröffentlichte der ebenfalls an der Bremer Universität lehrende und seit Ende der Sechzigerjahre bereits über Probleme der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie forschende und publizierende Sozialwissenschaftler Helmut Reichelt ein ebenso wunderbares wie dickes Buch – „Neue Marx-Lektüre“ betitelt, in dem er noch einmal auf Adorno und Sohn-Rethel eingeht bzw. in dem er von ihnen und dem Begriff der „Realabstraktion“ ausgeht.
———————————————————————————————————————————
Ich beendete dagegen 1978 vorübergehend meine Beschäftigung mit der Marxschen Warenanalyse und der davon ausgehenden Sohn-Rethelschen Erkenntnistheorie – und ging erst einmal in die Landwirtschaft (aus). 1979 bat mich die inzwischen mit Alfred Sohn-Rethel verheiratete Verlegerin Bettina Wassmann um einen Beitrag für eine Festschrift zu Ehren von Alfred, da ich zusammen mit Gustav von Campe zu seinen „treuesten Studenten“ gehört hatte. Helmut Reichelt wurde leider nicht angesprochen, dafür jedoch viele Bremer Uni-Dozenten und Radioredakteure, die sich, im Gegensatz zu einigen Professoren an der Ostberliner Humboldt-Universität Jahrzehnte zuvor, so gut wie gar nicht mit ihm und seinen Überlegungen auseinandergesetzt hatten. Einen Beitrag von einem Japaner, der meist stumm in seinen Seminaren gesessen und dann über die Wirkungsgeschichte Alfred Sohn-Rethels in Japan etwas geschrieben hatte, nahm Bettina unübersetzt mit ins Buch auf. Und meinen Beitrag, der nach hinten gehört hätte, verwendete sie als eine Art Vorwort.
———————————————————————————————————————————-
Kürzlich kam der Siegener Germanist Georg Stanitzek in einem Vortrag noch einmal auf meinen Text zu sprechen:
Im Jahr 1979 hat dieser Student dem akademischen Leben bereits mehr oder weniger den Rücken gekehrt. In diesem Jahr aber nimmt er nochmal an ihm teil, indem er den von ihm hoch geschätzten Universitätslehrer Sohn-Rethel verabschiedet, und nicht irgendwie, sondern in einer grund-akademischen Form, nämlich im Zusammenhang einer Festschrift, „L’invitation au voyage zu Alfred Sohn-Rethel“. Und nicht mit irgendeinem Beitrag, sondern mit einem, der die Festschrift eröffnet und betitelt ist: „Propemptikon für einen Professor“. Propemptikon, das ist ein Gelegenheitsgedicht, genauer: ein ‚Geleitgedicht für einen Abreisenden‘ – wobei Höge dies zugleich unter der Hand zu einem ‚Apopemptikon‘ gerät: Gedicht, das vom Abreisenden an die Zurückbleibenden gerichtet wird. Die Emeritierung des marxistischen Theoretikers ist nämlich nicht der einzige Abschied, um den es geht. Zugleich erklärt der Verfasser seinen eigenen Abschied von der Universität; er tut es mit einer desillusionierten Diagnose der Protest- und Reformbewegung nach 1968: Es ist vorbei? – [Zitat:] Es „geraten jetzt wieder die individuellen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten mehr und mehr ins Blickfeld: Qualifikationen, Karrieren, Perspektiven, Haus und Garten, etc.[etera]; oder wissenschaftlich ausgedrückt: Forschungsschwerpunkte, Spezialisierungen, Publikationsstrategien, etc.[etera] ‚Lebenslogik‘, nennt es Améry.“ – Was seine, Höges eigene Generation angeht: Die jungen Dozenten „konkurrieren über kurz oder lang mit den Studenten älteren Semesters um die wenigen offenen Stellen. Und die einen wie die anderen müssen sich in der ‚wissenschaftlichen Auseinandersetzung‘ profilieren, sie können nicht mehr in der Art eines ‚Zusammenspiels‘ ([Klaus] Heinrich) in einer sozialen Bewegung propulsieren. Im Gegenteil.“
Bremer Seminaren des Typs „Projekt: Organisationsformen der Arbeiterklasse nach 1945“ weiß Höge wenig abzugewinnen; er hält ein Beispiel aus Paris-Vincennes dagegen: „Séminaire sur les mots ‚too much‘ et ‚good vibration'“. Und er merkt an: „Wirklich phantasievolle Gedanken hält man an der Bremer Universität normalerweise für einen ’schlechten Witz‘, bestenfalls für einen ‚guten‘.“
Auch selbstkritisch heißt es rückblickend: Es „haftete unseren eigenen Versuchen auch immer so etwas wie eine gewisse ‚Unredlichkeit‘ an, eine wissenschaftliche Unredlichkeit, wie sie jetzt zu beobachten ist, […] die man auch als ‚Denkfaulheit‘ bezeichnen kann, gekoppelt an den Zwang, schnell ‚Ergebnisse‘ vorlegen zu wollen. Überall bei der neuen – in die wissenschaftlichen Institutionen vorrückenden – Intelligenz. (Sohn-Rethel hat für seine Arbeit vierzig Jahre gebraucht).“ Genug Gründe, dieser Universität den Rücken zu kehren. Doch dass dieses Verhältnis zur Universität mit ihren Traditionen und Formen ambivalent bleibt, wird deutlich, wenn dieser Anfang-30-Jährige nicht ansteht, nun ins Genre laus temporis acti und im Zuge dessen tatsächlich ins Lateinische zu verfallen: „Im 13.Jahrhundert schrieb der Franziskaner-Mönch Giacopone da Todi, der joculator Domini, ein schwermütiges Gedicht, darin er den Verlust der ‚großen Persönlichkeiten‘ beklagte: ‚Dic ubi Salomon, olim tam nobis / Vel Sampson ubi est, dux invincibilis[?‘]“… Es folgen acht weitere lateinische Verse, die ich aber erspare. Denn wir sind ja schon beim Thema: Wo ist Simson? Nimmt er hier nicht die Gestalt des „Gebildeten“ als ‚ewiger Student‘ an, den Clemens Brentano um 1800 als Gegenbild zum Philister aufgestellt hat?
So viel aus Stanitzeks Vortrag – den er im Rahmen einer Berliner Tagung über den „Philister“ hielt.
———————————————————————————————————————————-
Zehn Jahre nach „L’invitation au voyage“ kam erneut eine Festschrift für Sohn-Rethel heraus – zu seinem Neunzigsten Geburtstag. Die taz-bremen schrieb über dieses „Ereignis“ Anfang 1989:
Er ließ mich nicht aus dem blauen Blick, und er wollte, daß ich es verstand, was im Herbst als seine achte und letzte „Attacke, ich nenne es Expose“, bei Suhrkamp erscheinen wird: „Das wird von der Geschichtswissenschaft und Philosophie lange nicht verdaut werden – aber das steht. Und das wird ohne Schleier dargestellt.“ Achtundsechzig Jahre lang ist er der Erkenntnis auf der Spur geblieben, und heute wird er neunzig: Alfred Sohn-Rethel. Wie ein Zündfunke war in den Anfangsjahren der Bremer Universität sein Band „Geistige und körperliche Arbeit“ übergesprungen und hatte beileibe nicht nur Sozialwissenschaftler oder Philosophinnen, sondern die sonst kühlen Rechner, Informatiker, Ingenieurinnen und Elektrotechniker Philosophie und Erkenntnistheorie lesen und interdisziplinär debattieren lassen. Daß und wie Mathematik und Naturwissenschaften überhaupt nicht neutrale und „richtige“ Grundlagen anboten, sondern selbst in ihren Fragestellungen und Denkweisen durch Kapitalismus und Warentausch bestimmt sein sollten, forderte damals Lehrende und Studierende zu heftigen Debatten heraus. „Wir haben auf Fahrten im Bus gehockt und uns die Köpfe heiß geredet, da war Alfred gar nicht bei“, erinnert sich der Informatik -Professor Frieder Nake, „samstags vormittags kam er mal zu den Naturwissenschaftlern und trug vor; und das hatte heftigen Einfluß auf Studierende und Lehrende. Wir waren alle angesteckt und haben gesagt: Wir machen jetzt andere Wissenschaft. Die theoretische Begründung lieferte Sohn -Rethel, das Instrumentarium war das Projektstudium.“ Und an die „Sternstunde, als uns das Buch in die Hände fiel“, erinnnert sich Sozialwissenschaftler Helmut Reichel noch heute, der allerdings später andere Wege der Theoriebildung einschlug. So einfach ging das mit der anderen Bremer Wissenschaft, auch mit dem damals hoffnungsvollen Blick ins kulturrevolutionierende China, dann doch nicht. Aber daß „mit diesem verführerischen Ansatz diese Neutralitäts -Illusion gekippt wurde“, das gilt auch noch für Mathematik -Professor Ludwig Arnold: „Ich verehre ihn nach wie vor, den geistreichen Denker, aber ich bin nicht mehr so sein Jünger. Das war empirisch nicht zu fassen.“ Dem 90jährigen Alfred Sohn-Rethel kam es gestern überhaupt nicht darauf an, in Anerkennung zu baden: „Ich bilde mir nichts ein, dazu hat es zu lange gedauert.“ Ihm geht es um Gedanken, und zwar um die eigenen: „Ich verlasse mich nur auf mein Denken. Was ich schreibe, habe ich alles selbst gedacht, das macht mich auch so attackierbar.“ Einen Verwandten spricht er zwischendurch auf einen „Einwand“ an, der ihm keine Ruhe läßt, und die beiden verwickeln sich kurz in eine Debatte um die Rolle der Computertechniker beim Finanz- und Industriekapital. Das mit der fehlenden Empirie, dem Nachweis an der Wirklichkeit, ficht Sohn-Rethel nicht an: „Man kann nicht den Zeigestock drauf halten. Was passiert, findet hinter dem Rücken der Akteure, die sich vergesellschaften, statt. Die eigentümliche Verborgenheit der Wahrheit liegt gerade an dem Prinzip des Privateigentums, des Warentauschs, also gerade der Negation von Gesellschaft.“
In Bremen erfuhr der Intellektuelle Anfang der 70er, als er schon über das Pensionsalter hinaus war, akademische Anerkennung als Gastprofessor. „Er hat zur Politisierung der Naturwissenschaftler entscheidend beigetragen“, erinnerte sich die Gesellschaftswissenschaftlerin Prof. Heide Gerstenberger, „der Generationen-Unterschied hatte überhaupt keine Bedeutung!“ 68 Jahre passionierter Theoriearbeiter: „Da muß man ganz diszipliniert sein. Nachts hab‘ ich Gedanken, wenn ich sozusagen gar nicht dabei bin. Morgens muß ich aus dem Bett springen und sie aufschreiben, heute zum Beispiel war das ganz stark.“ Gibt es Wünsche zum Geburts tag? „Ja, Bücher vor allem. Und sonst? Da mußt Du Bettina fragen, die mein Leben kennt – ich bin ja so glücklich dran!“ Mir fiel ein, was mir die 49jährige Verlegerin und Ehefrau – Bettina Wassmann vor ein paar Wochen im Gespräch erzählte: „Die meisten Menschen denken, daß eine so viel jüngere Frau für Alfred Mut und Hoffnung bedeuten müßte. Es ist genau umgekehrt! Für mich ist es eine große Hoffnung, daß ein Mensch in so hohem Alter so klug und so produktiv sein kann!“
„Epistemologie der abendländischen Geschichte“, Frankfurt/Main 1989.
———————————————————————————————————————————–
Einige Monate später verlieh die Universität Bremen Alfred Sohn-Rethel die Ehrendoktorwürde. Die Laudatio hielt Oskar Negt, die taz veröffentlichte einige Auszüge daraus:
Lobende und ehrende Erklärungen habe ich schon häufig abgegeben. Der Mühe, dem offensichtlich hohen Sinn einer Laudatio einen Inhalt mit Augenmaß zu verleihen, unterziehe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben. Meine Unsicherheit beginnt am Anfang. Hier soll ein Denker geehrt werden, dessen Lebenswerk fast ein Jahrhundert erfaßt. Was für ein Jahrhundert! Kaum eine geschichtliche Tragödie, die sich Menschen in ihren perversesten Phantasien haben ausdenken können, hat diese Realtität ausgelassen. So stellt sich mir die beunruhigende Frage, mit welchem Recht ich Urteile über ein solches Leben fällen kann. Was mir den Atem verschlägt, ist das Problem, wie ein Mensch mit wachen Sinnen und einem lebendigen Verstand bei diesen Brüchen, Zerstörungen und Verdrehungen seine moralische und geistige Unversehrtheit bewahren kann – so lebendig vor uns sitzend, als hätte er die Zukunft für sich… Man sehe sich doch einmal die Gegenwartsdenker an, welche die Moderne, diesen äußerst widerspenstigen, mit Haken und Ösen versetzten Prozeß, längst hinter sich gelassen zu haben meinen, wie sie ihre theoretische Identität manchmal nach Jahresfristen wechseln; und einige gibt es unter ihnen, die lernen noch schneller. Wenn sie ihr fünfzigstes Lebensjahr erreichen, werden sie die gesamte Klaviatur möglicher thoretischer Positionen, die es in den vergangenen zwei Jahrhunderten gegeben hat, mit Überzeugung durchgespielt haben, ohne daß sie unter dem Gefühl litten, mit ihrer Identität sei vielleicht etwas nicht ganz in Ordnung. Wo aber der kollektive Gedächtnisverlust zu den bedeutendsten Signaturen der intellektuellen Vereldendung einer Protestkultur gehört, entsteht neues Vertrauen zu Menschen, die langsam lernen und buchstäb lich Trauer bei der Verabschie dung eines Gedankens, den sie einmal gefaßt haben, empfinden.
Sohn-Rethel ist einer von diesen langsam und schwerfällig Lernenden, übrigens ohne sich dessen zu schämen, sondern es freimütig zu bekennen und damit den Blick frei zu bekommen für das wirklich Neue, das im Alten heranwächst… Was hält eine Gesellschaft im Innersten zusammen; worin bestehen die Konstitutionsbedingungen einer Objektwelt, in der Zusammenhang entsteht, obwohl Klassenkämpfe, die Selbstzerrissenheit des menschlichen Daseins, Krieg und Völkermord doch eher auf zentrifugale Kräfte der Zerstörung und des Auseinanderlaufens hinweisen. Wie sich Drohung und ökonomisches Wachstum unter Bedingung anarchischer Warenproduktion im Kapitalismus … herstellen, war ja das entscheidende Problem von Marx im Zweiten Band seines Ka pital, als er die sogenannten Reproduktionsschemata ausformuliert. Es muß da Kräfte bei den Menschen geben, die durch Herrschaftsapparate und Aneignungskampf von ihren assoziativen Bindefähigkeiten nicht völlig zu trennen sind. Aber für die gesellschaftliche Radikalisierung des Synthesis -Problems bildet nicht Marx, sondern Kant die entscheidende philosophische Provokation. Sohn-Rethel ist kein treuer Gefolgsmann Kants, aber er hat seinem Denken die Treue gehalten… Wenn ich darüber nachdenke, wo und wann ich den Namen Sohn-Rethel zum ersten Mal gehört habe, so fällt mir eine dumpfe Eckkneipe nahe der Bockenheimer Warte in Frankfurt ein, wo Hans-Jürgen Krahl und seine politischen Freunde auf das Bündnis von Intellektuellen und Arbeitern regelmäßig anzustoßen pflegten. Auch ich besuchte diese Kneipe zuweilen; Krahl zog mich eines Nachts ins Vertrauen und stelle mir die Frage: „Weißt Du eigentlich, wer der originellste marxistische Kopf der Gegenwart ist?“ Ich rätselte, nannte alle, die ich kannte. Er machte dem Spiel ein Ende und sagte: Sohn-Rethel. Ich war verblüfft: Merkwürdig, ich kannte noch nicht einmal den Namen. „Dann lies seine Vorträge an der Humboldt-Universität über Warenform und Denkform.“ Da wir gerade beim Trinken waren, brachten wir auf Sohn-Rethel einen Toast aus – mit einem doppelten Doppelkorn, der typischen Krahlschen Maßeinheit. Es mag 1967 gewesen sein… Wer das Glück hat, 90 Jahre alt zu werden und das sprichwörtliche biblische Alter erreicht hat, kann den kleinen Ausgleich für die Jahrzehnte verweigerter Anerkennung und erlittenen Unrechts noch zur Kenntnis nehmen. Aber was ist das für eine Art und Weise, mit den vom Faschismus vertriebenen Intellektuellen umzugehen, wenn Anerkennung vom Gnadenstand des Weisheitsalters abhängt, also einem biologischen Tatbestand zu danken ist?
Irgendetwas am Neuaufbau der Universitäten nach 1945 im Teilstaat der Bundesrepublik muß so grundsätzlich falsch gelaufen sein, daß wohl die, die kräftig mitgemacht hatten, und auch die vielen anderen, die mit eingezogenem Kopf die Zeit überlebten, nach dem Ende des Schreckens sich selber einreden konnten, sie seien im Widerstand gewesen – und nicht die, die vertrieben wurden. Es waren nicht einzelne, sondern es war eine ganze Generation der produktivsten Köpfe, die Deutschland verlassen mußte: Adorno, Horkheimer, Bloch, Kracauer, Walter Benjamin, Lukacs und viele andere, die weniger bekannt sind. In diese Gesellschaft von produktivsten Köpfen des 20. Jahrhunderts gehört Alfred Sohn-Rethel.
——————————————————————————————————————————-
1991 erinnerte sich ein mir unbekannter Manfred Dworschak in der Bremer taz-ausgabe noch einmal an den im Jahr zuvor Verstorbenen:
Die kleinen Bücher müssen wir unbedingt loben. Sie sind statt beeindruckend lieber freundlich und machen, wie Snacks, dem Lesemagen keinerlei Beschwerden. Vor mir liegt eins von kaum fünfzig Seiten, das ist so gescheit und leicht, das schwimmt sogar in Milch: Alfred Sohn-Rethel: Das Ideal des Kaputten. Über neapolitanische Technik. Nämlich war Sohn-Rethel, der 1990 verstorbene Multi-Gelehrte, auch einmal, als junger Mann und Hungerleider, im damals billigen Italien gewesen, von 1924 bis 1927 im Großdenkers-Kaff Positano nahe Capri. Dort hauste er und schweifte und hatte Besuch von Adorno, Bloch, Benjamin und Kracauer und andere gute Einfälle. Ganz nebenher schrieb er die drei im Buche vertretenen Erzählungen, aber was heißt Erzählungen bei einem Sohn-Rethel, es ist intellektuelle Kleinkunst. Vesuvbesteigung 1926. Geringere würgen am Naturerlebnis, der trainierte Denker aber verflüssigt es sogleich in springlebendige Rede. Wo er hintritt, tritt er nicht bloß an sich hin, sondern für uns, er ist von Berufs wegen überall der exemplarische Mensch. Also auch auf dem Vesuv, in schwefelgelber, phosphorgrüner, kupferroter oder schwarzer Lava-Nacht, einer Nacht von äußerster Unheimlichkeit, und ganz jenseits allen Lebens. Als wir uns dann aber den Leuten anschlossen und unsere Pferde und unseren Guida wiederfanden, bemerkte ich dort ein wenig Gras, auf das ich den Fuß setzte und das mir das Gefühl des organischen Wachstums wiedergab. Er liefert in allem gleich die Metapher, mit der sich der allgemeine Mensch in der Welt auffinden läßt. Dazu muß man schon mit hierhin bitte den Stadtplan den Augen denken können. Eine Verkehrsstockung in der Via Chiaia zu Neapel. Mitten auf der Kreuzung will ein Esel seinen Karren nimmer schleppen, es kommt zu Stau und Häufung aufgeregter Menschen und genüßlichem Eklat, und am meisten Freude hat Sohn-Rethel, weil er schon wieder das allgemeine Neapel sieht, das noch halb bäuerliche Improvisorium, wo Kühe in fünften Etagen und Hühner in Behördenpapierkörben hausen und alles nicht anders als irgendwie gerade noch mal eben klappt.
Womit wir beim dritten, dem Hauptstück sind, betreffend, daß technische Vorrichtungen in Neapel grundsätzlich kaputt sind. Dort, wo Vertrauen ausschließlich die Dinge verdienen, die man selber repariert hat, darf nur das unenträtselt Spirituelle von vorneherein funktionieren, zum Beispiel die Osrambirnen-Korona der Kirchenmadonna. Sonst herrscht Stromausfall und Bastelei in Permanenz, zum großen Vergnügen von Sohn-Rethel, dem überhaupt die Welt gut Freund ist und gern den Gefallen tut, am Ende die passende Pointe fahren zu lassen: Da kommt ein Gassenbub daher und tritt dem Esel in den Bauch, worauf es hinten lange Pffft macht, und das erlöste Tier trottet weiter.
——————————————————————————————————————————–
1998 veröffentlichte ein leitender Redakteur bei Radio Bremen zusammen mit Bettina Wassmanns Verlag zwei CDs mit Lebensgeschichten von Alfred Sohn-Rethel – gesprochen von ihm selbst. Die taz-bremen schrieb:
Im allerersten, jagdgrünen Vorlesungsverzeichnis der Bremer Uni von 1973/74 ist ein Kurs „Kapital 1“ für „Sozialwissenschaftler im engeren Sinn“ angekündigt. Abgehalten wurde er vom Gast-Prof Alfred Sohn-Rethel. „Die Thematik ist vorgegeben durch die Auffassung von Marx und Engels, daß im Schoße des Kapitals die materiellen Vorbedingungen des Sozialismus heranreifen.“ So orthodox dies auch klingen mag, Sohn-Rethel verscherzte sich die Sympathie gar mancher Verfechter der jungfräulich-reinen marxistischen Lehre durch seine Kritik am Objektivitäts-anspruch der Naturwissenschaften. Echte Marxisten bekreuzigten sich damals vor den Naturwissenschaften. Trotz Sohn-Rethels zarten Korrekturen an Marx: Oskar Negt rühmte ihn während des Ansteckens eines bordeauxroten Stofffetzens namens „Ehrendoktorwürde“ am 9.2.88 gerade für seine mangelhafte Begabung zum Wendehals: „Er ist einer von diesen langsam und schwerfällig Lernenden, übrigens ohne sich dessen zu schämen, sondern es freimütig zu bekennen und damit den Blick frei zu bekommen für das wirklich Neue, das im Alten heranwächst.“
Langsam und schwerfällig: Immerhin soll Sohn-Rethel sein einziges, großes Werk „Geistige und körperliche Arbeit“ achtmal überarbeitet haben. Ein Lebenswerk, das ihn über Jahrzehnte begleitete. Und noch 1988 konnte an der Bremer Uni vom „Neuen, das im Alten (Marxismus) heranwächst“ geredet werden. Auf einen Nachruf in der taz auf Sohn-Rethels Tod am 6.4.1990 hagelte es kontroverse Leserbriefe: Rührende Nachwehen einer Zeit, in der über (linkes) Politikverständnis noch gestritten wurde. Hochschulprofs erinnerten sich damals, daß Sohn-Rethel „zur Politisierung der Naturwissenschaften entscheidend beigetragen“ hat. Denn er reihte die Naturwissenschaften in den gesellschaftlichen Überbau ein: In „Warenform und Denkform“ wird gezeigt, daß es sich bei Kants „Kategorien“ von Wahrnehmung und Erkennen keineswegs um unveränderbare, göttliche, automatisch in jedes Hirn gepflanzte Konstanten handelt, sondern daß sie geprägt wurden von der Gesellschaft, genauer, von der Erfindung des Geldes. Erst jene „Realabstraktion“ vom Gebrauchswert durch das Geld, die zum Beispiel aus einer saftigen Wurstsemmel ein schnödes Objekt für 3 Mark 60 macht, erzwang und ermöglichte dem Denken die logische Abstraktion und abstrakte Begriffe wie „das Sein“, aber auch „der Gewinn“. Denkstrukturen spiegeln Kapitalstrukturen wieder. „Das Geld ist die bare Münze des Apriori.“ Oder: „Die Logik ist das Geld des Geistes.“
Zum 100. Geburtstag von Sohn-Rethel erinnert Radio Bremen und der Verlag von Sohn-Rethels Ehefrau, Bettina Wassmann, mit einer schönen Doppel-CD an eine Zeit vor Kreiter und vor der kollektiven Denunziation des Marxismus. Auf CD 1 erzählt Sohn-Rethel in unpretentiöser Weise sein Leben: Geboren ist er in der Nähe von Paris. Das wollten seine Eltern nicht verlassen. So wurde der neunjährige Junge in Pflege gegeben bei einem mit der Familie befreundeten Düsseldorfer Großindustriellen. Ein klügerer Freund weckte Skepsis gegenüber der Mär, der 1. Weltkrieg sei ein unausweichlicher Präventionskrieg. „Ein Schleier zerriss.“ Einmal im Mißtrauen geschult, wünschte er sich zu Weihnachten 1915 dann auch gleich Marxs Kapital. Fürderhin gab es für ihn lange keinen Zweifel, daß es im Leben um die „Beseitigung dieser verfluchten, korumpierten, unsagbaren Gesellschaft“ geht. Spannend sind Sohn-Rethels Einschätzung des Spartakusaufstands (er habe leider eine spätere, erfolgversprechendere Revolution verhindert) ebenso wie Plaudereien über merkwürdige Tierhaltung (nämlich in Papierkörben) in Neapel und über die kleine deutsche Intellektuellenkolonie, besetzt mit Adorno, Bloch, Kracauer und Benjamin, im preisgünstigen Capri. Ab 1931 arbeitete Sohn-Rethel auf Vermittlung seines Pflegevaters beim „Mitteleuropäischen Wirtschaftstag“. Ehe er, als Halbjude klassifiziert, 1936 in die Schweiz emigrierte, konnte er so die Widerstandsgruppe „Neu-Beginnen“ mit Informationen über die Verflechtung von Schwerindustrie und NSDAP versorgen. 1937 bewarb er sich um eine Lehrerstelle am in New York operierenden „Institut für Sozialforschung“ und scheiterte trotz Adornos Fürsprache an Horkheimers Veto. Von 1937-72 lebte Sohn-Rethel in England, seit 1951 als simpler Französischlehrer. 35 für die Wissenschaft verlorene Jahre. Auf Adornos Beerdigung fiel Sohn-Rethel Siegfrid Unseld in die Arme. So konnte 1970 endlich bei Suhrkamp sein Hauptwerk erscheinen. So ist der Tod jenes Mannes, der Sohn-Rethel 30 Jahre zuvor Zugang zu den Chefetagen akademischen Diskurses gewähren wollte, dafür verantwortlich, daß er doch noch wahrgenommen wurde und im Alter von 73 endlich die heißersehnte Unikarriere – in Bremen – starten konnte.
Trotzdem frotzelt Sohn-Rethel auf der CD über das weihevolle Getue Adornos und über seinen wirtschaftspolitischen Unverstand. CD 2 versammelt die altväterlich-romantisch-enthusiastische Beschreibung einer Vesuvbesteigung, eine Geschichte von zwei Ratten, die arbeitsteilige Kooperation besser hinkriegen als die meisten Menschen, und einen Vortrag, in dem Sohn-Rethel sein Lieblingsthema von der Aufteilung in Kopf- und Handarbeit exemplifiziert anhand italienischer Renaissancekünstler. So nüchtern Sohn-Rethels Stimme im biografischen Teil ist, so inbrünstig spricht er über die nächtliche Vesuvlandschaft. Die Fähigkeit zum Schwärmen ist eben unverzichtbar für einen zähen Marxisten.
———————————————————————————————————————————–
Im Oktober 2005 führte Gabriele Goettle ein Interview mit Bettina Wassmann, das in der taz unter dem Titel „Hand- und Kopfarbeit“ abgedruckt wurde.
In einer Vorbemerkung dazu heißt es: Bettina Wassmann, Buchhändlerin u. Verlegerin in Bremen. 1948 Einschulung i. d. Volksschule/Horn. 1958 Mittlere Reife. 1958-1961 Ausbildung z. Buchhändlerin, Buchhandelslehre bei Rodewald in Bremen. 1961-1969 Arbeit als Buchhändlerin in Wolffs Bücherei, Berlin, Bundesallee 133. Mai 1969 Rückkehr n. Bremen. Juli 1969 Eröffnung d. eigenen Buchhandlung in Bremen, Am Wall 164. Herausgabe von bibliophilen Büchern im Eigenverlag. Künstlerische Gestaltung d. einzelnen Buchstaben d. Alphabets (im Briefmarkenformat auf Bögen). Buchtitel d. Verlages u. a.: Djuna Barnes: „Der perfekte Mord“; Detlev Claussen: „Abschied von gestern. Kritische Theorie heute“; Jochen Hörisch: „Das Abendmahl, das Geld und die neuen Medien“; Hermann Melville: „Bartleby, der Schreiber. Eine Geschichte aus der Wall-Street“; Oskar Negt: „H. c. Alfred Sohn-Rethel“; Alfred Sohn-Rethel: „Das Ideal des Kaputten“. Bettina Wassmann wurde 1942 in Plauen im Vogtland geboren (wohin d. Familie sich v. d. Bombardierung Bremens in Sicherheit gebracht hatte). Ihr Vater war Baumwollhändler (Baumwoll-Börse Bremen), die Mutter Künstlerin. Bettina Wassmann war mit Alfred Sohn-Rethel verheiratet (der 1990 starb). Zum besseren Verständnis Alfred Sohn-Rethels will ich versuchen, ihn in einem Miniaturporträt hier kurz vorzustellen. Er war 1899 geboren, Gelehrter, ohne weltfremd zu sein, Erkenntnistheoretiker und exzellenter Marx-Kenner. Von allen Marxisten war er wohl der originellste. Seit den 20er-Jahren arbeitete er an den Hauptthesen seiner materialistischen Erkenntnistheorie und -kritik, kam aber erst in den 70er-Jahren zu Abdruck, Bekanntheit und Ehrungen. Er hat sich weder durch die vernichtende Kritik Horkheimers noch durch das hohe Lob Adornos von seinen Überlegungen abbringen lassen und arbeitete bis ins hohe Alter als unbeirrbarer Außenseiter an seiner ketzerischen Theorie vom Geld.
Mit wahrer Engelsgeduld bewies er seine These, dass sich die Denkform aus der Warenform entwickelt, dass das Transzendentalsubjekt sich der eigentümlichen Form der Ware, des Tauschs und des Geldes verdankt, dass der Ursprung des reinen Denkens in der Warenform liegt und nicht umgekehrt. Er ist mit hartnäckiger Ausdauer der Bildung des Begriffs nachgegangen, dem Geld als bare Münze des Apriori, der Tauschabstraktion. Es ist ihm gelungen, das Geheimnis der Transzendentalphilosophie zu entschleiern durch die Entdeckung des Transzendentalsubekts in der Warenform. Aus dem akribischen Lüften dieses Schleiers besteht sein Lebenswerk. Der Buchladen von Bettina Wassmann liegt in der Innenstadt Bremens, am Wall, einer sich lang und bogenförmig dahinziehenden Geschäftsstraße, in der neben Kunsthalle, Anwaltsverein und Oberverwaltungsgericht unter anderen auch Galerien, Mode- und Designgeschäfte, Restaurants, Cafés, Antiquitätenhändler, Bibliotheken und das Friedensbüro für Kriegsdienstverweigerer residieren. Gegenüber der Geschäftsmeile erstreckt sich ein Park, die Wallanlage, mit ihren im Zickzack der ehemaligen Zitadellenform verlaufenden Wassergräben. Diese unscheinbare Grünanlage war die erste öffentliche Parkanlage Deutschlands. Am Wall 164 liegt hinter einem Jugendstilfenster der winzige Buchladen mit seiner kunstvoll dekorierten Auslage. Die seitlich liegende Glastür ist schwer und schließt nicht von selbst. Innen ist es eng, aber nicht überfüllt. Es gibt keine Bücherstapel in der Ecke, die jeden Moment umzufallen drohen, es ist nicht kruschelig, jedes Ding scheint seinen Platz gefunden zu haben. In den schwarzen deckenhohen Regalen stehen, sorgfältig ausgewählt und präsentiert, laufende Titel und Neuerscheinungen. Daneben die Bücher aus der eigenen Produktion und selbstverständlich die Klassiker wie Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Lukács, Bloch, Sohn-Rethel. In einer robusten Fächermappe sind die Briefmarkenbögen des Alphabets einsortiert, hinter den Glasscheiben der beiden schwarzen Vitrinenschränke hängen Zeitungsausschnitte und Fotos, ich erkenne Meret Oppenheim und Alfred Sohn-Rethel. Es gibt eine große Papierrolle in einem zierlichen Metallgestell, das sowohl hält als auch schneidet. Wir werden freundlich aufgefordert, in den schmalen Lücken Platz zu nehmen. Bettina Wassmann füllt die Kaffeetassen aus einer Thermoskanne, stellt sie auf die Marmorplatte des Verkaufspults neben den Computer und erzählt, dass sie nun schon 36 Jahre lang diesen Buchladen führt.
„Er war mal größer, es gab eine Treppe nach oben. Das war die große Zeit des Ladens – der Buchläden überhaupt. Anfang der 70er-Jahre war das ja virulent, es gab einen unglaublichen Lesehunger durch die allgemeine Politisierung, durch die Studentenbewegung, und ich gehörte natürlich mit zu den Gründern der politischen Buchhandlungen, des linken Buchhandels, der sich rasch entwickelte. Diese Zeit war unglaublich lebhaft und optimistisch, aber natürlich macht so ein Laden alle Brüche mit, alle langen Wellen der Konjunktur, um es mit Keynes zu formulieren. Die Brüche und Wege der 68er-Linken kennen wir ja, es wurde entsprechend ruhiger, und es wurde natürlich unglaublich schwierig. Von heutigen Zeiten wollen wir gar nicht sprechen. Aber damals, 69 im Sommer, als ich hier gegründet habe, war das unvorstellbar, dass es je wieder so einen Rückfall, so eine Lethargie geben könnte. Damals bin ich zurückgekommen aus Berlin, wo ich über sechs Jahre gearbeitet habe in Wolffs Bücherei, das war eine sehr wichtige Zeit. Ich erzähle vielleicht am besten etwas chronologisch. Also ich komme ursprünglich aus einer, wie man sagt, guten Familie, gut situiert, mein Vater war Baumwollhändler, hat eine große Firma geleitet, und eines Tages waren dann die Kunststoffe absolut auf dem Vormarsch, und da brach der eben ein, der Baumwollbereich. Solche Zäsuren gibt’s eben immer. Und als das alles zusammenkrachte bei uns, da dachte ich, so, jetzt muss ich auf eigenen Beinen stehen, ich kann ja nicht rumheulen, dass das Haus nun auch noch verkauft ist und alles, das hilft ja nicht. Da war ich Anfang 20, hatte meine Buchhandelslehre fertig und beschloss, nach Berlin zu gehen.
Ich habe mich bei Marga Schöller beworben. Die war die beste Adresse. Für diejenigen, die es nicht wissen: Marga Schöller ist, glaube ich, 1905 geboren und hat mit 24 ihre kleine Bücherstube am Kurfürstendamm 30 eröffnet. Sie war so gut, dass bald alle zu ihr kamen, von George Grosz über Brecht, Musil, Canetti bis hin zu Kästner und Baldwin. Und sie führte während der NS-Zeit keine braune Literatur, die verfemte Literatur hat sie in ihrem Keller versteckt. Deshalb war sie auch eine der Ersten, die nach 45 wieder eine Lizenz als Buchhändlerin bekamen. Und sie hat es wieder geschafft, die Gruppe 47 tagte bei ihr, man ging einfach zu Marga Schöller. Als ich ankam, war’s Winter, ich hatte das Auto meines Bruders geliehen, von Halensee kommend lag der Laden auf der linken Seite, im Schaufenster hingen die ganzen Essays aus der Presse, Fotos, alles, was interessant war.Wenn man reinkam, hatte man bereits was gelesen. Die ganze Atmosphäre war zauberhaft, alle waren enorm gebildet. Leider wurde für mich nichts daraus. Marga Schöller war überaus freundlich und sagte, wir sind sehr dafür, aber erst in einem Jahr. Ich war sehr enttäuscht, sehr. Das merkte sie und sagte, also es gibt da eine Buchhandlung, die schätze ich sehr, aber der Mann ist ganz schwierig, es ist schwer, mit ihm zu arbeiten. Trotz allem, er ist hervorragend! Wolffs Bücherei, Bundesallee 153. Ich fuhr hin mit meinem VW, ging erst mal rein wie eine normale Kundin, und der beschriebene Herr Wolff trat auf mich zu mit einer Zigarette in der Hand. Das hatte erst mal viel Autonomie, in anderen Buchläden durfte man nicht rauchen, da durfte man gar nichts. Ich sagte dann, weshalb ich da war, und tatsächlich war’s so, dass er grade auf eine Mitarbeiterin hatte verzichten müssen. Er war ja ein bisschen cholerisch, er litt selber drunter, aber die wenigsten können das aushalten. Vier Wochen später habe ich angefangen. Es war eine wunderbare Zeit, wir haben uns sehr befreundet. Er hatte eine großartige Frau an seiner Seite, Nadeschda. Sie waren ja beide russischer Herkunft und man muss wissen, dass der Großvater von Andreas Wolff der berühmte Buchhändler und Verleger Maurice Wolff war, der in Moskau am Newski Prospekt seinen Laden hatte, in dem die ganze literarische und künstlerische Elite Russlands ein und aus ging. Er konvertierte übrigens irgendwann vom jüdischen zum protestantischen Glauben, was später seinen Kindern und Enkeln sehr zugute kam als staatenlose russische Emigranten in Nazideutschland. 1883 ist er gestorben, und sein Sohn Ludwig – der Vater von Andreas – übernahm den Laden. Als die Familie dann im Zuge der Revolution enteignet wurde und nach Deutschland emigrierte, war Andreas Wolff 15. Er hat ja dann eine Verlagslehre gemacht und später seine Buchhandlung in der Bundesallee eröffnet, 1931 bereits. Nach dem Krieg hat er in Frankfurt mit seinem Freund Peter Suhrkamp zusammen den Suhrkamp Verlag aufgebaut, da war er bis 1955 Geschäftsführer, dann ist er wieder in seinen Buchladen in der Bundesallee gegangen. Also, der Andreas Wolff hatte eine große Familientradition im Rücken und ich habe unendlich viel von ihm gelernt. Auch über Typografie, etwa anhand der Herstellung seiner Friedenauer Presse, er hat mir sogar die Frauen vorgestellt, die das noch nähten damals, die Fadenheftung. Also das war eine absolute Handfertigkeit, diese Knoten zu machen. Katja Wagenbach, seine Tochter, macht ja seit den 80er-Jahren ihren eigenen Verlag und hat die Friedenauer Presse sehr erfolgreich weiterentwickelt. Ich weiß noch, damals, 1963/64 war es, da kam Klaus Wagenbach rein in Wolffs Bücherei. Er kam gerade von Brod aus Israel, wegen Kafka, und hatte Krach mit dem Fischer Verlag. Bald darauf hat er irgendwie seine Briefmarkensammlung verkauft oder so was, und mit Katja – sie war ja damals seine Frau – den Wagenbach Verlag gegründet in der Jenaer Straße. Und zur Verlagseröffnung gab es ein großes Fest. Wir sind natürlich hingefahren. Ich hatte damals einen wunderbaren Opel Kapitän übrigens, mit dem bin ich immer mit Wolff OE wenn die Tür zufiel, klang das wie bei einem Geldschrank. Perfekt! Gut, also wir trafen dort auf Ingeborg Bachmann, fuhren mit ihr im Aufzug plaudernd hoch, und sie fand das so amüsant, dass sie einfach auf den Abwärtsknopf gedrückt und gesagt hat, reden wir doch noch ein bisschen. Berlin war ja damals wie ein Aquarium, wir sind zu allen Lesungen in die Akademie der Künste gegangen, an Mayröcker erinnere ich mich, an ihr ,Arbeitstirol‘, so hieß es, glaube ich, an Thomas Bernhard. Ach OE damals lebte Helen Wolff noch, die Frau von Kurt Wolff von Pantheon Press. Und der alte Bondy. Viele dieser wunderbaren Leute sind tot. Es gab natürlich die herrlichsten Lesungen auch in Wolffs Bücherei, da wurde Literaturgeschichte gemacht, kann man sagen. Sie kamen alle, Enzensberger, Uwe Johnson, Max Frisch, Günter Bruno Fuchs, Günter Grass, Nicolas Born und viele andere. Ich erinnere mich noch z. B. an Enzensberger, ich glaube, er stellte Gedichte vor, und an der Hand hatte er seine Tochter mit dem bezaubernden Namen Tanaquil, den hab ich nie vergessen. Viele der Autoren kamen natürlich auch als Kunden, einige wohnten sozusagen um die Ecke. Es ist sehr gut, wenn man von wirklichen Könnern lernt, wenn man so einen König an seiner Seite hat, den man aber eines Tages auch wieder verlässt. Das ist manchmal grausam, aber nötig.
Wir haben uns gestritten über linksbündig oder nicht bei Heinrich Manns Essay ,Mein Bruder‘. Soll das linksbündig sein oder zentriert, und ich sagte, bei der Familie muss es zentriert sein. Der Streit war ausufernd, und mir fehlten dann auch die Argumente. Jedenfalls dachte ich, ich möchte jetzt weg. Es war auch genug mit Berlin. Das war also 1969. Ich ging nach Bremen zu meinen tapferen Eltern. Heute geht man nach einer Insolvenz ja ins Gasthaus und bestellt Champagner, damals war das noch furchtbar. Es war ja alles verkauft. Aber Jakobs Kaffee, die hatten ein Grundstück, das haben sie meinem Vater, glaube ich, geschenkt, die waren ja alle in der SPD. Und mein Vater hatte dann mit Tonträgern sich was aufgebaut, deshalb habe ich ja auch diese dämliche Musiksammlung. Die auf dem Flohmarkt sagen immer, Mensch, was du da verkaufst, ist ja unglaublich. Ich könnte dafür natürlich viel mehr Geld verlangen, aber ich bin immer froh, wenn die Kiste leer ist. Gut, ich war wieder hier, und ich saß im Garten und wusste nur eins: nie wieder angestellt sein! Bin viel spazieren gegangen, mit dem Fahrrad herumgefahren in der Stadt. Dieses Haus hier war grade im Umbau, davor traf ich Olaf Dinné im Blaumann – er hat Anfang 1980 die Grünen mit gegründet. Er ist Architekt und ein scharfer Hund, hat auch wunderbar Aufstand gemacht gegen schreckliche Baupläne. Der stand also hier und sagte: Na, willst du einen Laden haben? Und ich bekam einen Laden, erst oben, praktisch auf dem Flur, der war noch viel kleiner als dieser hier. Und ich habe angefangen, meine Bestellungen loszulassen OE“
Eine Kundin betritt den Laden und fragt in die Runde: „Haben Sie die Einstein-Biografie von Gero von Boehm, ,Wer war Albert Einstein?‘ ist, glaube ich, der Titel?“ Bettina Wassmann fragt: „Ist die gut? Also, Thomas Levenson habe ich gelesen, sie wollen aber Gero von Boehm, soll ich’s bestellen?“
Die Kundin braucht es aber sofort und wird zum nächsten Buchladen geschickt, der ein paar Häuser entfernt ist. „Also ich habe ganz klein angefangen, war quasi die erste linke Buchhandlung und habe den gesamten Marx bestellt. Da war der Laden dann bereits so gut wie voll, insgesamt übervoll. Ich habe noch nie so einen vollen Laden erlebt. Mein erster Kunde war Günter Abramzik, er war ein guter Freund von Bloch. Später war er Pastor Primarius am Dom zu Bremen und auch zuständig für die Evangelische Studentengemeinde nach der Gründung der Bremer Universität 1971. Die waren sehr progressiv. Ich habe auch was von ihm herausgegeben ,Von wahrer Duldung‘. Na ja, dann gab’s die Ausschreibung für den Uni-Buchladen, wir haben uns beworben und ihn bekommen. Aber es war auf Dauer einfach zu viel Stress und Hektik. Inzwischen war der Laden hier umgezogen und ich hab den Uni-Buchladen dann wieder aufgegeben. Aber das war ja später. Ich wollte ja erzählen, wie alles losging mit Alfred. Wir – Barbara Herzbruch und ich – wir wohnten zusammen, waren befreundet. Sie wurde übrigens später die zweite Frau von Klaus Wagenbach. Also, wir gingen Anfang der 70er in eine Vorlesung von Alfred Sohn-Rethel, der Gastprofessor war. Das Thema war ,Geistige und körperliche Arbeit‘. Wir haben über den Titel sehr gelacht. Es war komplett voll. Es herrschte eine ungeheuer konzentrierte Atmosphäre. Ich habe überhaupt nichts verstanden, nichts! Machen wir uns klar, wenn man in der marxistischen Terminologie nicht zu Hause ist, auch nicht in der Ökonomie, dann ist es unmöglich. Ich habe Barbara immer angestoßen, aber sie hat auch nichts verstanden, obwohl sie Ökonomie studierte.
Was aber sehr faszinierend war, war die Komplexität dieses Menschen, der da saß. Er hatte auch in den Pausen eine geradezu fantastische Ausstrahlung, es war sehr still, aber er war überhaupt nicht autoritär, er war herzlich, sanft, warm. Er wurde verehrt und hat das ohne Eitelkeit hingenommen. Er war ein ganz besonderer Mensch, mich hat das sehr beeindruckt. Kennen gelernt habe ich ihn dann während eines Festes. Er wohnte zum ersten Mal hier in einer Wohngemeinschaft, mit 74 Jahren bei Thomas Kuby war das, und man hat ihn da unter die Fittiche genommen, es gefiel ihm gut. Und auf diesem Fest haben wir uns ein bisschen unterhalten und auch verabredet. Das war 1973. Und dann tauchte Alfred hier im Buchladen auf und er kaufte viel zu viele Bücher, vielleicht aus Absicht, er konnte sie gar nicht transportieren und fragte, ob ich sie ihm liefern könne. Also, es gibt Begegnungen im Leben, wo man plötzlich nicht sprechen kann. Ich dachte, na was ist das denn! Ich war richtiggehend schüchtern, das ist sonst gar nicht meine Art. Und ich habe also die Bücher hingebracht, wir haben uns unterhalten. Ich habe auch wieder gesprochen, viel über Benjamin. Es gab ja diese Werkausgabe, gebunden, später dann die Briefbände. Wir sind dann so zweimal in der Woche essen gegangen, und ich habe ihn immer gebeten, dass er mir aus der Zeit der Emigration erzählt, vor allem von Benjamin, der gemeinsamen Zeit in Paris, der Zusammenarbeit. Und von Adorno in Paris, und wie das damals war mit dem Institut usw. Ich habe das alles in mich aufgenommen, er hat sehr schön erzählt. Manchmal dachte ich, es ist vielleicht unhöflich, dass ich ihn immer sozusagen nach den Berühmtheiten frage, aber ich war plötzlich irgendwie blockiert, konnte nicht sprechen, die ganze Aura hat mich gefangen genommen. Dabei war er gütig und lieb und hatte überhaupt nichts von jemandem, der einen gleich zwirbelt, wie Adorno. Irgendwann ist Alfred dann zu uns in die Bismarckstraße, zu Barbara Herzbruch und mir, gezogen. Und da ging’s dann enorm los. Wir haben richtig ein Haus geführt, abends saßen bei uns die Freunde von der Uni und es wurde natürlich richtig gekocht, auch Alfred hat gekocht. Und auch mit meiner verlegerischen Arbeit ging es dann los, mit der Festschrift zu Sohn-Rethels 80. Geburtstag. Da habe ich mir eine Festschrift einfallen lassen ,L’invitation au voyage‘ ist der Titel, das ist eine Zeile aus einem Baudelaire-Gedicht. Und da ist dann eine wunderbare Mischung zusammengekommen, auch aus diesem Arbeitszusammenhang, ,Mechanisierung der Kopfarbeit‘, also da waren Leute aus der Kybernetik, aus den Naturwissenschaften, aus den Geisteswissenschaften, die da zusammengearbeitet haben mit viel Liebe. Solch interdisziplinäres Zusammenspiel hat die Uni Bremen ja durchaus mal ausgezeichnet. Und dann haben wir 18 Beiträge gehabt, sehr unterschiedliche, da sagte ich mir, jetzt bekommt jeder Beitrag ein Heftchen geschneidert. Wir hatten nachher dann 18 Heftchen in einer schönen Mappe.
Ich habe damals auch dem wunderbaren Roberto Calasso, dem Verleger des exquisiten Mailänder Adelphi Verlages, die Festschrift geschickt. Er ist ja nicht nur Verleger, er ist auch Autor. Auch seine Frau, die Fleur Jäggi, ist Autorin. Na ja“, sie seufzt, „sie haben diesen wunderbaren Verlag, und eben das Kleingeld von Fiat. Jedenfalls hat er gesagt: Das ist die schönste Festschrift, die ich je gesehen habe. Dieses Lob hat mich sehr gefreut. Also, die Sammlung trägt wilde Züge. Da ist ein Text dabei über Alfred Seidel, das war ein alter Freund von Alfred aus der Heidelberger Studienzeit, also aus den 20er-Jahren, dieser Alfred gehörte damals schon in die Prinzhorn-Therapie, weil er unter schweren Depressionsattacken litt. Sohn-Rethel sagte immer, er habe nie jemand Schlaueren kennen gelernt, und das ohne jede Sinnlichkeit. Und der schrieb mit 23 Jahren ein Werk, das hieß ,Bewusstsein als Verhängnis‘.“ Die Gäste lachen schallend, dann fährt die Gastgeberin fort: „Alfred liebte ihn sehr. Eines Tages hat sich Alfred Seidel das Leben genommen. Und wisst ihr, wo? Auf dem Bahnhofsklo! Also, das war auch so ein Grund, weshalb ich mich aus der Uni-Buchhandlung zurückgezogen habe, um mich ganz Alfred und meinen unmittelbaren Interessen hier zu widmen. Es hat gereicht. Man kann sich nämlich überfordern, ganz schrecklich. Viele von den Leuten, die ich kannte, sind krank geworden davon. Barbara Herzbruch ist so ein Beispiel. Sie ist mit 44 gestorben an Krebs. Ich bin am Wochenende immer nach Berlin gefahren, hab mir da eine kleine Wohnung genommen und habe sie besucht, in Rudow, in der Onkologie. Dort ist Barbara ganz jämmerlich eingegangen. Was mich betrifft, so habe ich es zum Glück immer geschafft, die Dinge dann zu ändern, wenn die Überforderung und die Unlust überhand genommen haben. Das liegt wahrscheinlich an den wunderbaren Erfahrungen meiner Kindheit. Ich komme ja aus einer Familie, die war unendlich musikalisch – Adorno hat mal an Benjamin geschrieben: ,Musik ist Abschaffung von Angst‘. Mein Vater hatte Musik studiert. Meine Mutter hatte eine große handwerkliche, taktile Begabung, sie hat Kunst studiert. Es gibt eine schöne Geschichte von ihr. Meine Eltern reisten mal in die USA, mein Vater hatte Bankgeschäfte zu erledigen, Vorfinanzierungen, da gab’s ein befreundetes jüdisches Bankhaus, und das Ganze dauerte seine Zeit. Meine Mutter sagte, mach du mal deine Geschäfte, ich gehe ins Metropolitan Museum. Dort traf sie zufällig auf einen der Leiter, einen Bremer aus der Kurfürstenallee. Sie konnte kaum Englisch und rief: ,Rettung! Haben Sie eigentlich auch Spitzen hier?‘ Meine Mutter hatte sich nämlich aus Interesse auch mit Spitzen beschäftigt und konnte sogar selbst klöppeln. Also sie hatten Spitzen, alles unsortiert und durcheinander. Sie erklärte sich bereit, das alles zu ordnen und zu sortieren, die Kustoren wurden geholt und sie bekam alles, was sie brauchte. Sie hat die Spitzen nach Alter und Herkunft sortiert und auf Pappen gezogen, Spitzen aus dem 15. Jahrhundert, aus Brügge, aus Brüssel usw. Das war meine Mutter. Wir sind fünf Kinder, und alle haben Begabungen. Mein Bruder Christoph hat eine Begabung für Gläser, mit verbundenen Augen ertastet er ein Glas und kann sagen, 16. Jahrhundert. Fantastisch. Und wir haben alle musiziert, ich spielte Klavier, die anderen Geige. Wir waren eine wohlhabende Familie. Die Nachbarskinder sind sozusagen bei uns aufgewachsen, denn bei uns ging es überhaupt nicht spießig zu, es gab nicht diese autoritäre Welt, die ja noch verbindlich war, die gab’s bei uns nicht. Im Zentrum stand immer das Künstlerische. Das Musikalische war sozusagen der Gegenentwurf, den man sich leisten konnte durch die prosperierenden Geschäfte. Also, wir sind nach Salzburg gefahren als Kinder, wir haben am Kobenzl gewohnt in diesem zauberhaften Hotel – wir waren ja befreundet mit allen, und ich saß mehr in der Küche als in unseren Zimmern. Ich habe mit George Szell Fußball gespielt, da war er Mitte 50 so was, er war mit seinem Cleveland Orchestra da. Wir haben den ,Don Giovanni‘ gesehen mit Furtwängler in der Felsenreitschule, ein herrliches Erlebnis, von dem ich heute noch OE“
Ein junger Mann betritt den Laden, grüßt knapp und reicht Bettina Wassmann, die nahe der Tür sitzt, einen Zettel. Im gleichen Moment ertönt Dudelsackmusik. „Haben Sie einen Kassettenrekorder in der Tasche?“, fragt Frau Wassmann erstaunt. „Nee, Telefon“, sagt der Kunde, klappt das winzige Gerät auf, tritt einen Schritt zur Seite und tauscht lautstark Banalitäten aus. Bettina Wassmann studiert den Zettel, nimmt einen Stift und korrigiert etwas, während der junge Mann das Gespräch beendet. Dann sagt sie in neutralem Tonfall: „Falsch geschrieben, Updike schreibt sich mit k, nicht mit c. Na, so geht’s schon mal.“ Sie empfiehlt die Thalia Buchhandlung. Der junge Mann sagt: „Gut, mach ich, tschüs“, und verlässt ohne zu danken den Laden.
„Damit komme ich immer sehr schlecht zurecht, mit unhöflichen Leuten. Auf dem Flohmarkt, das ist ja eine Massenveranstaltung, da kommen oft Leute an den Tisch… und wenn dir dann auch noch jemand die Ehre nimmt, deine Sachen schlecht macht, um den Preis runterzutreiben, und du sitzt seit vier Uhr früh da, dann ist das deprimierend. So einfach sind die Zeiten ja nicht! Das war auch mal anders, früher kamen hier andere Kunden rein, also jetzt nicht unbedingt nur so genannte Intellektuelle, es war einfach bunter. Anfang der 90er-Jahre etwa – Alfred war schon tot -, da kam Otto Rehhagel hier manchmal in den Laden, er war ja Vereinstrainer bei Werder Bremen, hat hier einen wunderbaren Fußball entwickelt, und er war ein großer Gedichteleser, ein begeisterter. Er traf hier Reinhild Hoffmann, die nach Kresnik das Bremer Tanztheater machte. Und er hat uns ins Café eingeladen, weil er von ihr etwas wissen wollte über ihre Trainingsmethoden. So muss das sein, ein ständiger Austausch von Wissen. Auch zwischen Leuten, die sich hier im Laden vielleicht zufällig treffen. Aber die Linken verachten ja den Fußball, die haben nie den Spaß mitentwickeln können, den andere daran haben. Es ist ja ein Spiel, bei dem es auch sehr um Körperintelligenz geht und um das blitzschnelle Zusammenwirken einer Gruppe. Aber man konnte einfach mit fast keinem über Fußball reden, außer mit Detlev Clausen, der diese schöne Adorno-Biografie gemacht hat. Oder auch mit Dietrich Sattler, dem Herausgeber der Hölderlin-Ausgabe, an der er 20 Jahre, glaube ich, gearbeitet hat. Der schrieb, als Werder Bremen, ich meine, zum zweiten oder dritten Mal nicht Meister wurde, einen genialen Traueraufsatz. Das war genial gestrickt nach dem Motiv der Kästchenwahl von Shakespeares ,Kaufmann von Venedig‘ – nur so für sich hat er das geschrieben, um über diese Niederlage hinwegzukommen, denn so eine Niederlage ist ja schwer für einen, der Fußball liebt. Und er hat mir diesen kleinen Essay hier gezeigt, und der war so zauberhaft geschrieben, dass ich sagte, hör mal, das muss unbedingt veröffentlicht werden. Mir fiel gleich Wagenbach ein, aber beim zweiten Nachdenken erinnerte ich mich, dass Wagenbach Sport hasst, so wie Churchill ,no sports!‘, und ich dachte, das wird er nicht machen wollen. Aber es war einfach so toll geschrieben, dass ich’s ihm trotzdem gegeben habe.
Und dann muss man ja auch noch wissen, dass es ein Riesenproblem war, mit Dietrich Sattler mal ins Stadion zu gehen. Der hatte richtig eine Phobie, der bekam Zustände, wenn er sich zwischen Massen begeben sollte, dann auch noch zwischen hoch erregte Massen! Ich habe ihn so reingeleitet, habe also auf ihn aufgepasst. Wir saßen unter 40.000 Fußballfans. Und hinter uns erschallte ein Chor von unglaublichen Männerstimmen. Das waren alles Werftarbeiter von der AG-Weser, wenn die da in so einem 200 Meter langen Schiffsbauch arbeiten und dauernd einander was zurufen, dann kann man sich vorstellen, was die für Stimmen bekommen. Na ja, jedenfalls hat Wagenbach diesen Essay gedruckt. Im Freibeuter. Heute, wie gesagt, ist das alles viel schwieriger geworden. Eben andere Kunden. Ich muss flexibel sein. Ich arbeite da beispielsweise mit einer Modehandlung zusammen, mit einer alten Freundin von früher. Sie hat das beste Modegeschäft in Bremen. Eine Modefirma mit Literatur. Wir machen das vier- bis fünfmal im Jahr, Modenschau, und ich mach das literarische Rahmenprogramm. Sensationell! Da erscheinen 80 bis 100 Damen, Kundinnen, und zwischen dem Defilee kommt dann z. B. Gertrude Steins ,Das Geld‘ oder von Schiller ,Das Glück‘. Viele der Damen sind leitende Geschäftsfrauen. Die eine oder andere kommt dann auch schon mal hier in den Laden und kauft Bücher, und zwar nicht zu knapp. So habe ich noch ein Standbein. Man muss ja. Aber ich mache meinen Weg nicht kaputt. Nur hier zu sitzen und zu warten, das kann so oder so ausgehen. Am Samstag war’s z. B. sehr gut. Es war sehr heiß, da saßen natürlich alle draußen, wir tranken ein Wasser, da rief jemand: Bettina, du hast Kunden! Die ganze Straße hat natürlich gelacht. Im Laden standen zwei Ehepaare und ich, sind fünf Personen. Da ist es hier ja schon überfüllt. Das waren Gäste der Stadt und sie haben so wundervoll eingekauft, dass ich am Samstag eine richtig gute Kasse hatte. Bücherberge haben die gekauft, zauberhafte Menschen! Für die Mieten war das wichtig. 600 Euro habe ich hier und noch mal 600 Euro zu Hause. Also machen wir uns nichts vor, die Zeiten sind ganz schwierig. Wir müssen wirklich immer sehen, wie wir es packen. Ganz viele Läden mussten hier raus. Mit dem Verlag – na ja, Verlag in dem Sinn ist es ja nicht, es ist eine Buchladenedition -, das habe ich einfach im Moment eingestellt. Meine Drucker haben auch Insolvenz gemacht. Niederschmetternd! Wir haben viel diese Bibliothek von der Süddeutschen verkauft. Obwohl der Rabatt kaum der Rede wert ist, habe ich’s gemacht. 1.000 Bände wurden verkauft!“ Sie schlägt ein Buch auf. „Hört mal, ich habe hier den schönen Satz von Alfred gefunden: ,Aber auch die freudsche Theorie gehört zur Priesterschaft des kapitalistischen Kults‘ OE das Verdrängte, die sündige Vorstellung IST das Kapital, ist die Hölle des Unbewussten, verzinst.‘ Ich muss jetzt Alfred wieder auflegen. So viel ist klar.“
——————————————————————————————————————————–
Und die Zeit ist auch gerade gut geeignet dafür. Die Weltläufte drängen den Leuten den Marxismus geradezu auf. (Ich werde mich bemühen, noch weitere Texte über Alfred Sohn-Rethels materialistische Erkenntnistheorie hier anzuhängen.)
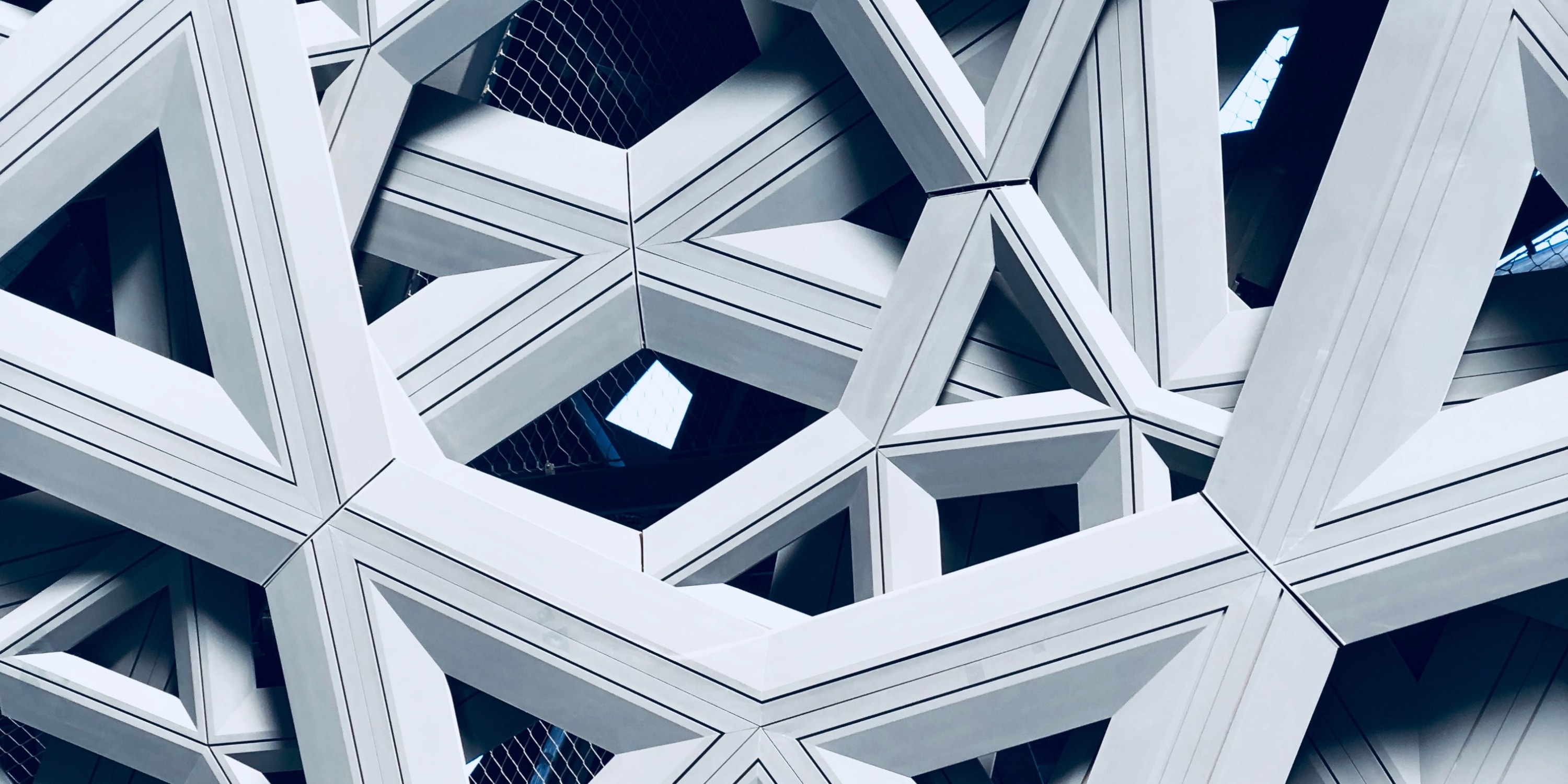



Fortsetzung des obigen Vortrags über „Warenform und Denkform
Eine Einführung in den Grundgedanken Alfred Sohn-Rethels“ von Manfred Dahlmann, der plötzlich abbrach, weil in einen Kommentar nicht mehr reingeht:
… sondern im tatsächlichen Verhalten der Menschen.
Marx vermag also auf diese Weise Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen und unmittelbar auszusprechen, daß es die Gesellschaftlichkeit des Menschen ist, die ihm auch die Geltungsgründe seiner Urteile liefert.
Doch befriedigt ist Sohn-Rethel keineswegs. Er wird diese ersten Seiten immer wieder durchgehen, um seinem Unbehagen auf die Spur zu kommen. Sehr schnell weiß er, wo Marx anfängt, ungenau zu argumentieren – und zwar an der Stelle, an der Marx den Begriff der abstrakten Arbeit einführt: Gemeint kann ja nicht sein, was bis hin zu Robert Kurz die Marxisten unter abstrakter Arbeit verstehen: so etwas wie ein ungegenständliches, aber doch außerhalb des Denkens existierendes Ding, das von der konkreten Arbeit erzeugt würde. Marx kann in diesem Begriff nur die Abstraktion von der Arbeit gemeint haben, also eine rein gedankliche Tätigkeit – alles andere würde seine Ausführungen dazu unverständlich machen und wäre im übrigen reine Metaphysik. So gefaßt stellt sich natürlich sofort die Frage: Wer abstrahiert denn hier eigentlich? Auf diese Weise könnte man tatsächlich die Frage nach dem Transzendentalsubjekt nahtlos bei Marx einführen – aber bewegt sich dann im Kreis, d.h. Marx hätte dann auch wieder nichts anderes getan als die Philosophen nach Kant und hätte dem Transzendentalsubjekt nur einen anderen Namen gegeben. Also gilt es den gordischen Knoten zu sprengen.
Dazu sollte man sich eines vor Augen führen: all den Namen, die einen Ort bezeichnen, aus dem sich die Existenzbedingungen des Menschen in letzter Instanz restlos erschließen lassen sollen: also Transzendentalsubjekt, Geist, Wille, Macht, Sprache usw. – aber auch dem, was Marx den Wert nennt –, ist eines gemeinsam: Es handelt sich um Reflexionsbegriffe, um Begriffe also, die in der Wirklichkeit nicht sinnlich wahrnehmbar sind. Was empirisch gegenständlich in der Wirklichkeit erscheint, muß erst noch durch viele Vermittlungen hindurch als ein durch dieses Dritte Konstituiertes ausgewiesen werden. Gerade die marxsche Lösung hilft hier gar nicht so viel weiter, wie es auf den ersten Blick scheint: der Wert ist zwar unmittelbar als gesellschaftlich erfaßt, aber die Gesellschaft ist schließlich auch nichts anderes als ein Reflexionsbegriff: es ist zwar einleuchtend, daß der Mensch nicht als einzelnes Wesen existieren kann, sondern ein gesellschaftliches ist – aber dies wurde weder von Kant noch von Hegel oder irgendeinem anderen Philosophen nach Kant je wirklich bestritten. Sie, diese vielen Philosophen – und das tun die jeweiligen Adepten dieser Philosophien bis heute –, stritten mit allen anderen allein darum, den Begriff gefunden zu haben, aus dem z.B. das Urteil, daß der Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist, seine Geltungskraft und seine Bedeutung für den Menschen erlangt. In Frage steht nun – und die Antwort auf diese Frage stellt den Fortschritt dar, der seit Kant der einzig mögliche ist: in Frage steht, ob es ein Kriterium gibt, aus dem heraus entschieden werden kann, welcher Name für dieses Dritte der richtige ist?
Meine Behauptung, jetzt nun endgültig formuliert, ist: Sohn-Rethel liefert das Kriterium, gemäß dem entschieden werden kann, daß letztlich Marx der Philosoph war, der den richtigen Begriff des synthetisierenden Dritten gefunden hat.
Der Beweis, den Sohn-Rethel führt, besteht in einem ganz einfachen, aber in seiner Einfachheit genialen Verfahren. Er sagt: ersetzen wir doch einfach die Stelle, die bei Marx der Wert einnimmt, durch das Geld. Doch besser, wir müssen hier ganz genau sein: auch Geld ist ja eine Reflexionsbestimmung – mit höchst metaphysischen Mucken, wie Marx im Fetischkapitel ausgeführt hat. Wir müssen nicht Geld sagen: sondern Münze. Und zwar ganz banal die Münze, die ein jeder von uns als Pfennig, Groschen oder Markstück in seiner Tasche hat.
Was haben wir gewonnen? Tatsächlich haben wir einen sinnlich wahnehmbaren, empirischen Gegenstand in der Hand – einen Gegenstand, den jeder kennt. Dieser Gegenstand ist für jeden der gleiche – und dies vollkommen ungeachtet der Tatsache, daß jeder einen anderen in der Hand hält. Dieser Gegenstand verdankt sich rein menschlicher Konstitution: kein Tier, auch die Götter nicht, benötigen Geld. Und, das ist der entscheidende Beweisschritt für Sohn-Rethel: tatsächlich mag die konkrete Münze physikalischen Veränderungen in der Zeit unterliegen: denken aber muß ich das Geld als sei es durch alle Zeit- und Räumlichkeit hindurch ein sich selbst gleiches Wesen. Darin unterscheidet es sich von allen anderen empirischen Dingen. Und weiter: für dieses Geld, resp. die Münze, kann man was kaufen: jeder was anderes – in der Entscheidung, was er kauft, ist jeder frei. Was man für das Geld haben will, ist also in die Beliebigkeit eines jeden Individuums gestellt. Descartes läßt grüßen. Und doch ist die Geltung des Geldes in seiner Objektivität unüberschreitbar. Und so weiter und so fort – man kann auf diese Weise die gesamte Wertformanalyse von Marx hereinholen, und nicht nur genau zeigen, wie durch diesen kleinen ‚Trick‘ nicht nur dessen Wertformanalyse geradezu empirische Beweiskraft erlangt, sondern, wie Sohn-Rethel auch vorführt: daß all die philosophischen Begriffe, vom Beginn der Entstehung der Philosophie an, nichts anderes darstellen als eine Reflexion auf die in einem jeden Geldstück verborgenen Geheimnisse.
Mehr noch: Und jetzt komme ich auf das eingangs gemachte Versprechen zurück, erklären zu können, warum denn diese naturwissenschaftliche Denkform noch existiert, obwohl ihr doch Sohn-Rethel den Boden unter den Füßen weggezogen habe, warum also die Menschen, wie Hegel behauptet, denkfaul sind: dies deshalb, weil eine konsequente Selbstreflexion im Denken auf das Geld zeigen würde, daß das Geld gar nicht ist, was es zu sein scheint: es gar nicht die in sich selbst ruhende Identität darstellt, die einen von allen äußeren Umständen unabhängigen Wert an sich repräsentiert. Ganz im Gegenteil: nur die freie Entscheidung der Individuen, das Geld als Maßstab des Wertes zu akzeptieren macht das Geld zum Geld. Diese freie Entscheidung, das liegt in der Natur der Sache, könnte eigentlich widerrufen werden. Und die Möglichkeit eines solchen Widerrufs begründet den Horror, erklärt die Urangst jeden Bürgers, die er, wo es nur geht, zu bannen sucht. Die Identität, unter der der Mensch das Geld gezwungen ist zu betrachten, damit es bleibt, was es ist: nämlich allgemein anerkannter Repräsentant des Werts, dieser aus einer Urangst heraus bewirkte Zwang, erklärt, daß das rein analytische Denken der Wissenschaft – obwohl es von Kant in jeder Hinsicht als falsch erwiesen wurde – dennoch beibehalten wird: koste es an logischen Antinomien, was es wolle. Die Identität des Geldes im Verschiedenen, seine absolute Unüberschreitbarkeit – bei völliger Freiheit in der konkreten Anwendung – genau das ist nicht nur die Grundlage naturwissenschaftlichen Denkens, sondern die Grundlage des bürgerlichen Denkens und seiner Praxis insgesamt.
Ich hoffe, keiner kommt auf die Idee zu sagen, ich hätte hier behauptet, Sohn-Rethel würde so etwas wie eine Philosophie des Geldes entfalten, nach dem Motto: Geld regiere die Welt oder so ähnlich, und als solche bestimme das Geld sogar das Bewußtsein der Physiker und Mathematiker. Das wäre schiere Metaphysik – wäre nichts weiter als nur ein anderer Ausdruck des rein analytischen Denkens, wie etwa ein Lenin es vorführt, wenn er sich als Erkenntnistheoretiker versucht. Sohn-Rethel behauptet noch nicht einmal, daß etwa Kant mit seinem Transzendentalsubjekt eigentlich vom Geld rede, Hegel, wenn er vom Geist ausgeht, Nietzsche, von der Macht usw. Nichts davon soll hier behauptet werden, nichts davon würde Sohn-Rethel gerecht. Es ging nur darum zu zeigen, daß, wenn man nur konsequent genug auf die Funktionsmechanismen des Geldes in der Gesellschaft reflektiert (wohlgemerkt: ich muß nur diese Reflexionsleistung tatsächlich erbringen, ich brauche in dieser weder zu wissen, noch zu sagen, auf was ich tatsächlich reflektiere), daß dann die Erkenntnis, daß all diesem Funktionieren ein Drittes zugrundegelegt werden muß, aus dem heraus alle Urteile ihre Geltung beanspruchen können, unausweichlich ist und daß es dann eben unausweichlich ist, etwas von einem Transzendentalsubjekt, einem Geist, einem Willen, einer Macht usw. zu schwafeln, das es wäre, das die Welt in ihrem Innersten zusammenhält, das also des Pudels Kern wäre – womit ich wieder bei Goethe und Hörisch angelangt bin.
Nichts ist hier von dem, was Kant über das Transzendentalsubjekt, nichts von dem, was Hegel über den Geist, nichts von dem, was Marx über den Wert gesagt hat, in irgendeiner Form in seiner Wahrheit zurückgenommen. Kein einziges wissenschaftliches Gesetz ist in seiner Geltung bestritten. Sohn-Rethels „Trick mit dem Geld“, wie ich das genannt habe, zerreißt aber den metaphysischen Schleier, der über all diesen philosophischen Reflexionsbestimmungen – und gerade die naturwissenschaftliche Erkenntnisform ist eine solche Reflexionsbestimmung par excellence – liegt. Nun, sollte man meinen, werden sie dem Verstand unmittelbar zugänglich und können sich vor dem Richterstuhl der Vernunft als sinnvoll in Geltung gesetzte beweisen. Denn das, von dem man den Schleier herunterzieht, wird sichtbar: sollte man meinen.
Was aber wird sichtbar, wenn man Sohn-Rethel folgt? Es fällt schwer, für das, was nach ihm offen zutage liegt, die Worte zu finden. All das Gerede der letzten zweitausend Jahre Menschheitsgeschichte über Ideale, über das Schöne, Wahre, Gute, über Wissenschaft und Vernunft, über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, diente, und dient weiterhin, einem einzigen Zweck: nämlich dem, alles zu tun, damit der Grund, aus dem heraus das Geld seine allgemeine Geltung erlangt, nicht verloren geht. Denn ohne diesen Grund gäbe es weder ein gültiges Recht, weder einen Staat, weder eine naturwissenschaftliche Erkenntnis noch sonst ein allgemeines: es gäbe noch nicht einmal das Ich, mit dessen unüberschreitbarer Realität sich die Menschen der Neuzeit schließlich abgefunden haben, und mit dem sie sich zu identifizieren gelernt haben, damit sie in dieser Gesellschaft funktionieren können. Aus diesem Ich heraus kann sich das Individuum die Sicherheit verschaffen, doch nicht allein zu sein auf dieser Welt, doch nicht die fensterlose Monade zu sein, vor der es Leibniz so grauste. Aus der Angst davor, erkennen zu müssen, daß es selbst es ist, das all das in Geltung setzt, was es dann als unüberschreitbar geltendes wieder reidentifiziert, konstituiert das zum Philosophen mutierte Individuum die tollsten metaphysischen Systeme. Und wie diese Philosophen konstruiert ein jedes Individuum sich eine Realität, die es, obwohl es allein es ist, das sie konstruiert, sie dennoch nicht gestalten will, sondern deren Gestaltung es einem Wesen überläßt, von dessen Existenz es dann auf einmal doch nichts weiter wissen will. Es konstituiert das Kapital und mutiert damit zu einem Subjekt, das damit zufrieden ist, die Verantwortlichkeit, die dieses Individuum als Mensch für seine Konstruktion eigentlich hätte, auf dieses Kapital abwälzen zu können. „Man muß realistisch sein“: in diesem Satz drückt sich der abgrundtiefe Skandal, die Unverschämtheit aus, mit der der Mensch unter kapitalistischen Bedingungen mit sich selbst umgeht.
Bevor ich zum Schluß komme, müssen unbedingt noch zwei Bemerkungen zu Sohn-Rethels Philosophie gemacht werden, die nicht seine Erkenntnis in Frage stellen können, sondern die seine Ausführungen, d.h. die Art und Weise, wie er seine Erkenntnis zur Darstellung bringt, betreffen. Hier gibt es Defizite, die unübersehbar sind, Defizite, die an die Defizite der Ausführungen Kants zum Transzendentalsubjekt erinnern. Denn Sohn-Rethel vermag z.B. nicht, zu erklären, wie denn das Geld sich in Kapital transformieren konnte. Bei ihm erscheint es so, als ob mit der gleichzeitigen Entstehung des Münzgeldes und der Philosophie auch das Transzendentalsubjekt schon voll entwickelt vorläge: zumindest kann Sohn-Rethel diesen, vom Linkshegelianismus völlig zu recht vorgebrachten Einwand nicht hinreichend entkräften. Dazu nur so viel: Er kann dies nicht, weil er nicht scharf genug zwischen einer sozialen Synthesis, wie sie in der Antike vorlag, und der heutigen, der kapitalistischen, unterscheidet. Ich habe in diesem Vortrag mit meinen Verweisen auf Aristoteles Sohn-Rethel stillschweigend in dieser Sache zu korrigieren versucht: das konnte hier natürlich nur implizit geschehen und wird so keinen Linkshegelianer von seinen Vorbehalten abbringen. Ich behaupte zudem, daß eine hinreichende Lösung dieses Problems philosophisch gar nicht zu leisten ist: sondern hier muß man historisch-empirisch argumentieren und sich dem Prozeß der ursprünglichen Akkumulation erneut widmen. Aber dies ist ein anderes Thema, und ich kann nur versichern, daß Sohn-Rethels Grundgedanke auch in einer solchen Hinwendung zur Geschichte nichts an Bedeutung verliert.
Zweitens: auch in einen Vortrag über den Erkenntnistheoretiker gehört zumindest der Hinweis, daß Sohn-Rethel eine Faschismustheorie vorgelegt hat, die, im Kontext der vielen schiefen Faschismusanalysen gesehen, ihresgleichen sucht. Doch, und dieses Manko hat er selbst gesehen, ohne es lösen können: ihm gelingt es, seltsamerweise muß man sagen, nicht, eine konsistente Verbindung seiner Erkenntniskritik zu seiner Faschismustheorie zu ziehen. Auch dies ist alles andere als ein unlösbares Problem – was ich an dieser Stelle wiederum nur versichern, nicht aber wirklich belegen kann (hierzu kann ich allerdings auf den Vortrag von Joachim Bruhn heute abend verweisen.)
Wenn ich hier immer von „lösbaren Problemen“ spreche, so soll dies natürlich nicht heißen, daß nicht doch auch unlösbare auftauchen könnten: doch dies kann erst der Fall sein, wenn man sich der Erkenntnis von Sohn-Rethel wirklich stellt und nicht in einer Abwehrhaltung verharrt, die beim normalen akademischen Philosophiebetrieb nicht weiter verwundert, die aber dem Linkshegelianismus – von den Krisis-Leuten um Robert Kurz ganz zu schweigen – schlecht zu Gesicht steht. Mit seinen Defiziten ist Sohn-Rethel durchaus mit Kant vergleichbar, dessen Defizite von Hegel ja auch sehr schnell überwunden werden konnten. In Bezug auf Sohn-Rethel braucht es heute einen ihn korrigierenden Hegel allerdings nicht mehr: denn mit Marx gibt es einen, der, wenn man ihm den Gedanken von Sohn-Rethel quasi unterzieht, die meiste Arbeit in dieser Hinsicht schon geleistet hat.
Eine Kritik der durch das Kapital konstituierten Synthesis kann nach Sohn-Rethel jedenfalls nicht mehr so tun, als stelle der Kommunismus nichts weiter dar als die Lösung der vom Kapitalismus aufgeworfenen Probleme. Der Kommunismus, stellt er denn wirklich etwas anderes vor als einen sozial reformierten Kapitalismus, hat auf die zentrale Frage eine Antwort zu geben, wie denn in ihm die Synthesis beschaffen sein soll, aus der heraus sich der einzelne Mensch tatsächlich als das mit Vernunft begabte Gattungswesen konstituiert, als das ihn die Philosophen immer postuliert haben. Mit Sohn-Rethel sind alle bisherigen Antworten auf diese Frage als philosophische enttarnt worden, d. h.: sie erwiesen sich als ideologisch. Sie waren, wie die Mathematik, wie die Naturwissenschaft, wie der Empirismus, wie der common sense insgesamt, nicht mehr und nicht weniger als ein richtiges Denken im falschen Bewußtsein. Genau das ist es, was Sohn-Rethel als den Kern ideologischen Denkens denunziert: nämlich richtig, d.h. angepaßt an die herrschende Realität zu denken, dies aber in einer völligen Verkennung der nur als barbarisch zu kennzeichnenden Natur dieser Realität.