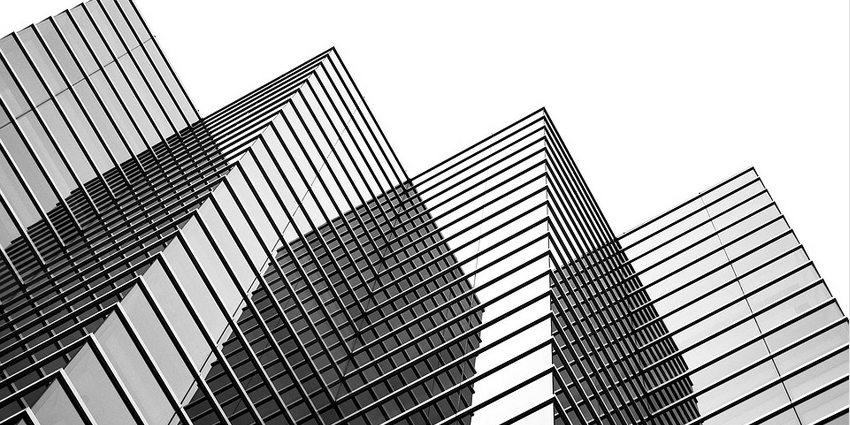Die FAZ macht ihr Feuilleton heute mit einer Schweiz-Schmäh auf: „Die Indianer jodeln in ihrer Alpenfestung“. Im Text heißt es, dass das Verhältnis der Schweiz zu Deutschland auf dem „Nullpunkt“ angelangt ist. An diesem „Punkt“ muß, wie man weiß, die Politik mit anderen Mitteln fortsetzt werden, was heißt, dass die Repräsentation quasi Präsenz zeigen muß. Der FAZ-Autor gibt der Schweiz die Schuld. Der letzte FM-Stammtisch im Café „Jenseits“ machte sich praktische Gedanken, wobei er auch das Gerücht mit einbezog, dass die Georgier in diesem Jahr erneut Südossetien mit einem Erziehungsfeldzug „kritisieren“ wollen:
Die vor kurzem entstandene und noch nicht völlig beseitigte Möglichkeit eines Einfalls in die Schweiz hat verständlicherweise das öffentliche Interesse nicht nur für die Verteidigungskräfte der Gebirgsrepublik, sondern auch für die Kriegführung im Gebirge überhaupt wieder aufleben lassen. Man neigt im allgemeinen dazu, die Schweiz für uneinnehmbar zu halten und eine Invasionsarmee mit jenen römischen Gladiatoren zu vergleichen, deren „Ave, Caesar, morituri te salutant“ („Sei gegrüßt Cäsar, die Todgeweihten begrüßen Dich“) so berühmt geworden ist. Wir erinnern uns an Sempach und Morgarten, an Murten und Grandson, und es heißt, daß es für eine fremde Armee recht leicht sein soll, in die Schweiz einzudringen, daß es aber, wie der Narr des Albrecht von Österreich sagte, schwer sein werde, wieder herauszukommen. Selbst Militärfachleute werden ein Dutzend Namen von Gebirgspässen und Defileen nennen können, wo eine Handvoll Leute leicht und erfolgreich einigen Tausend der besten Soldaten Widerstand leisten kann.
Diese traditionelle Uneinnehmbarkeit der sogenannten Bergfestung Schweiz datiert aus der Zeit der Kriege mit Österreich und Burgund im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert. Damals war die Hauptkraft der Eindringlinge die gepanzerte Kavallerie der Ritter; ihre Stärke lag in dem unwiderstehlichen Ansturm auf Heere, die keine Feuerwaffen besaßen. Aber dieser Ansturm war in einem Lande wie der Schweiz unmöglich, wo Kavallerie selbst jetzt nutzlos ist, außer der ganz leichten, wenn sie in kleiner Zahl eingesetzt wird. Um wieviel nutzloser waren es die Ritter des vierzehnten Jahrhunderts, behindert durch fast einen Zentner Eisen. Sie mußten absitzen und zu Fuß kämpfen; dadurch ging ihr letzter Rest an Beweglichkeit verloren; die Angreifer wurden in die Defensive gezwungen und konnten sich, wenn sie in einem Gebirgspaß abgefaßt wurden, nicht einmal gegen Keulen und Stöcke verteidigen. Während der Burgunderkriege hatte die Infanterie, mit Piken bewaffnet, innerhalb der Armee an Bedeutung gewonnen, auch waren bereits Feuerwaffen eingesetzt worden, aber noch war die Infanterie durch die schwere Schutzausrüstung behindert, die Kanonen waren schwer und Handfeuerwaffen plump und relativ nutzlos. Die ganze Ausrüstung war den Truppen immer noch so hinderlich, daß diese für einen Gebirgskrieg völlig untauglich wurden, besonders zu einer Zeit, wo man kaum davon reden kann, daß Straßen existiert haben. Die Folge war, daß diese wenig beweglichen Armeen steckenblieben, sobald sie in schwierigem Gelände in Kämpfe verwickelt wurden, während die leichtbewaffneten Schweizer Bauern in der Lage waren, offensiv zu kämpfen, den Gegner zu überlisten, zu umzingeln und schließlich zu schlagen.
Nach den Burgunderkriegen wurde die Schweiz drei Jahrhunderte lang niemals ernsthaft angegriffen. Die Überlieferung von der Unbesiegbarkeit der Schweizer wurde eine ehrwürdige Tradition, bis die Französische Revolution, ein Ereignis, das so viele ehrwürdige Traditionen zerschlug, auch diese zerstörte – wenigstens bei denjenigen, welche die Kriegsgeschichte kennen. Die Zeiten hatten sich geändert. Die gepanzerte Kavallerie und die schwerfälligen Pikeniere gehörten der Vergangenheit an, die Taktik war dutzendmal revolutioniert worden; die wichtigste Eigenschaft der Armeen wurde ihre Beweglichkeit; die Lineartaktik von Marlborough, Eugen und Friedrich dem Großen wurde durch die Kolonnen und die Schützenlinien der Revolutionsarmeen über den Haufen geworfen, und seit dem Tag, da General Bonaparte 1796 den Col di Cadibona passierte und sich zwischen die getrennten österreichischen und sardinischen Kolonnen warf, sie frontal schlug, während er ihnen gleichzeitig den Rückzug in die engen Täler der Seealpen abschnitt und den größten Teil seiner Gegner gefangennahm – seit diesem Tag datiert ein neuer wissenschaftlicher Zweig, die Kriegführung im Gebirge, die der Uneinnehmbarkeit der Schweiz ein Ende bereitet hat.
Während der Periode der Lineartaktik, die der modernen Kriegführung unmittelbar vorausging, wurde jedes schwierige Terrain von beiden Seiten sorgsam vermieden. Je ebener das Gelände, desto besser schien es als Schlachtfeld geeignet, wenn es nur einige Hindernisse bot, um einen oder beide Flügel zu decken. Doch mit den französischen Revolutionsarmeen begann ein anderes System. In jeder Defensivstellung wurde nach einem Hindernis vor der Front, das den Schützenketten und ebenso den Reserven Deckung bot, sorgfältig Ausschau gehalten. Überhaupt wurde schwieriges Terrain von den Franzosen vorgezogen; ihre Truppen waren viel beweglicher, und ihre Formierung in geöffneter Ordnung und in Kolonnen erlaubte nicht nur schnelle Bewegungen in jede Richtung, sondern gab ihnen sogar die Möglichkeit, unebenes Gelände zu ihrem Vorteil auszunutzen, während ihre Gegner zur gleichen Zeit in solchem Gelände völlig hilflos waren. In der Tat, der Ausdruck „ungangbares Gelände“ wurde aus der militärischen Terminologie nahezu ausradiert.
Die Schweizer bekamen das 1798 zu spüren, als vier französische Divisionen trotz des hartnäckigen Widerstandes eines Teiles der Bevölkerung und der dreimaligen Erhebung der alten Waldkantone sich zu Herren des Landes machten, das in den folgenden drei Jahren zu einem der wichtigsten Schauplätze des Krieges zwischen der französischen Republik und der Koalition wurde. Wie wenig die Franzosen die unzugänglichen Berge und engen Schluchten der Schweiz fürchteten, zeigten sie schon im März 1798, als Masséna geradeswegs auf Graubünden zu marschierte, den rauhesten und gebirgsreichsten Kanton, der damals von den Österreichern besetzt war. Diese hielten das obere Rheintal. In konzentrisch angesetzten Kolonnen marschierten Massenas Truppen über Gebirgspässe, die für Pferde kaum passierbar waren, in das Tal, besetzten alle Ausgänge und zwangen die Österreicher, nach kurzem Widerstand die Waffen zu strecken. Die Österreicher machten sich diese Lektion sehr bald zunutze; unter Hotze, einem General, der im Gebirgskrieg bedeutende Fertigkeit erlangt hatte, nahmen sie den Kampf wieder auf, wiederholten das gleiche Manöver und trieben die Franzosen hinaus. Darauf folgte der Rückzug Massenas auf die Defensivstellung bei Zürich, wo er Korsakows Russen schlug; dann Suworows Einfall in die Schweiz über den St. Gotthard, sein folgenschwerer Rückzug, und schließlich ein weiterer Angriff der Franzosen durch Graubünden nach Tirol, wo Macdonald im tiefsten Winter drei Gebirgskämme überschritt, die damals selbst im Gänsemarsch kaum für passierbar galten. Die sich daran anschließenden bedeutenden napoleonischen Feldzüge wurden in den großen Flußbecken der Donau und des Po ausgefochten, weil die großartigen strategischen Konzeptionen, auf denen sie fußten, alle darauf gerichtet waren, die feindliche Armee von dem Zentrum ihrer Ressourcen abzuschneiden, die Armee zu vernichten und dann das Zentrum selbst zu besetzen; sie bedingten deshalb ein weniger behindertes Terrain und die Konzentration von Massen für entscheidende Schlachten, die in alpinen Gebieten nicht möglich sind. Die Geschichte der Kriegsereignisse von dem ersten Alpenfeldzug Napoleons 1796, seinem Marsch über die Julischen Alpen nach Wien 1797 bis 1801 beweist jedoch, daß die Gebirgskämme und Täler der Alpen ihren Schrecken für moderne Armeen völlig verloren haben; auch haben die Alpen seither bis 1815 weder Frankreich noch der Koalition irgendwelche nennenswerten Defensivstellungen geboten.
Wenn man durch eine jener Schluchten geht, welche sich längs der Straßen erstrecken, die vorn Nordhang zum Südhang der Alpen führen, findet man an jeder Wegbiegung die denkbar stärksten Verteidigungspositionen. Nehmen wir zum Beispiel die bekannte Viamala. Es gibt keinen Offizier, der uns nicht erklären wird, daß er diesen Engpaß mit einem Bataillon gegen einen Feind halten könne, wenn er sicher wäre, nicht umgangen zu werden. Aber gerade darum handelt es sich. Es gibt auch im höchsten Kamm der Alpen keinen Gebirgspaß, der nicht umgangen werden kann. Napoleons Maxime für den Gebirgskrieg war:
„Wo eine Ziege passieren kann, kann auch ein Mann passieren; wo ein Mann passieren kann, kann es auch ein Bataillon; wo ein Bataillon passieren kann, kann es auch eine Armee.“
Auch Suworow mußte danach handeln, als er im Reußtal fest eingeschlossen war und seine Armee auf Hirtenpfaden führen mußte, wo nur jeweils ein Mann passieren konnte, während ihm Lacourbe, der beste französische General im Gebirgskrieg, auf den Fersen folgte.
Die Stärke von Verteidigungsstellungen – die frontal anzugreifen oft glatter Wahnsinn wäre – wird mehr als aufgewogen durch die Tatsache, daß der Feind leicht umgangen werden kann. Alle Wege zu sichern, durch die eine Stellung umgangen werden kann, würde für die Verteidiger eine solche Zersplitterung der Kräfte bedeuten, daß eine sofortige Niederlage sicher wäre. Die Wege können bestenfalls nur beobachtet werden, und bei der Abwehr des Umgehungsmanövers muß man sich auf den klugen Einsatz der Reserven sowie auf die Entschlußkraft und das rasche Handeln der Befehlshaber einzelner Detachements verlassen; und trotzdem, wenn von drei oder vier Umgehungskolonnen nur eine erfolgreich ist, dann ist die sich verteidigende Seite in der gleichen schlechten Lage, als ob alle erfolgreich gewesen wären. Deshalb ist, vom strategischen Standpunkt aus gesehen, der Angriff im Gebirgskrieg der Verteidigung entschieden überlegen.
Auch vom rein taktischen Gesichtspunkt aus betrachtet ergibt sich dasselbe Bild. Die Verteidigungsstellungen werden immer enge Gebirgsschluchten sein, die von starken Kolonnen im Tal besetzt sind und von Schützen auf den Höhen gedeckt werden. Diese Stellungen können entweder von der Front her durch Gruppen von Schützen umgangen werden, die an den Hängen des Tales hinaufsteigen und die Scharfschützen der Verteidiger umgehen, oder durch Abteilungen, die auf dem Gebirgskamm, wo das möglich ist, bzw. durch ein parallellaufendes Tal marschieren, wobei diese Truppen irgendeinen Paß ausnutzen, um in die Flanke oder in den Rücken der Defensivstellung zu fallen. In all diesen Fällen haben die Truppen, die den Feind umgehen, den Vorteil, daß sie die Lage beherrschen; sie besetzen das höherliegende Gelände und übersehen das von ihren Gegnern besetzte Tal. Sie können Felsbrocken und Bäume auf die Verteidiger hinabwälzen; denn heutzutage ist keine Kolonne so unklug, eine tiefe Schlucht zu besetzen, ehe sie nicht deren Hänge gelichtet hat, so daß sich diese zuerst für die Verteidigung günstige Maßnahme jetzt gegen die Verteidiger selbst wendet. Ein anderer Nachteil der Verteidigung liegt darin, daß der Nutzen der Feuerwaffen, auf die sie sich hauptsächlich stützt, in gebirgigem Gelände sehr gering ist. Die Artillerie ist entweder fast ohne Nutzen, oder sie geht dort, wo sie ernstlich eingesetzt wird, bei einem Rückzug gewöhnlich verloren. Die sogenannte Gebirgsartillerie, leichte Haubitzen, die auf den Rücken von Mauleseln transportiert werden, ist kaum von Nutzen, wie die Erfahrung der Franzosen in Algerien vollauf beweist. Was die Musketen und Büchsen anbetrifft, so beraubt die sich in solchem Gelände überall bietende Deckung die Verteidiger eines großen Vorteils – nämlich den, vor ihrer Stellung ein ungedecktes Gelände zu haben, das der Feind unter Feuer passieren muß. Wir kommen daher auf taktischem ebenso wie auf strategischem Gebiet zu der Schlußfolgerung des Erzherzogs Karl von Österreich, eines der besten Generale im Gebirgskrieg und eines erstklassigen Schriftstellers auf diesem Gebiet, daß bei dieser Art Kriegführung der Angriff der Verteidigung weit überlegen ist.
Ist es also völlig zwecklos, ein gebirgiges Land zu verteidigen? Natürlich nicht. Daraus folgt nur, daß die Verteidigung nicht ausschließlich passiv sein darf, daß sie ihre Stärke in der Beweglichkeit suchen muß und daß sie, wenn immer sich Gelegenheit bietet, offensiv kämpfen muß. In alpinen Ländern kann es kaum zu Schlachten kommen; der ganze Krieg ist eine fortlaufende Kette von kleinen Kämpfen, von Versuchen der Angreifer, einen Keil in die eine oder andere Stelle der feindlichen Position hineinzutreiben und dann nachzudrängen. Beide Armeen sind notwendigerweise zersplittert; beide müssen sich bei jedem Schritt einem für den andern vorteilhaften Angriff aussetzen; beide müssen sich einer Reihe von Zufällen anvertrauen. Der einzige Vorteil, den die sich verteidigende Armee wahrnehmen kann, besteht darin, die schwachen Stellen des Feindes zu suchen und sich selbst zwischen seine getrennten Kolonnen zu werfen. In einem solchen Falle würde eine starke Verteidigungsstellung, auf die sich eine völlig passive Verteidigung ausschließlich stützt, für den Feind zu einer einzigen Falle werden, in die er gelockt werden kann, um ihn dann wie einen Stier bei den Hörnern zu packen. Zur gleichen Zeit werden sich die größten Bemühungen der Verteidiger gegen die Umgehungskolonnen der Angreifer richten, von denen jede selbst umgangen und in dieselbe aussichtslose Lage gebracht werden kann, in die sie die Verteidiger bringen wollte. Es leuchtet jedoch ohne weiteres ein, daß eine solche aktive Verteidigung energische, erfahrene und geschickte Generale voraussetzt, gut disziplinierte, leichtbewegliche Truppen und vor allen Dingen sehr tüchtige und zuverlässige Führer der Brigaden, Bataillone und sogar Kompanien; denn in diesem Falle hängt alles vom schnellen, umsichtigen Handeln der Detachements ab.
Er gibt noch eine andere Form des Defensivkrieges im Gebirge, die in neuester Zeit berühmt geworden ist; das ist die einer nationalen Insurrektion und der Partisanenkrieg, der, zumindest in Europa, unbedingt ein gebirgiges Land erfordert. Wir haben dafür vier Beispiele: den Tiroler Aufstand, den spanischen Guerillakrieg gegen Napoleon, die Insurrektion der karlistischen Basken und den Krieg der kaukasischen Stämme gegen Rußland. Obwohl den Eindringlingen große Schwierigkeiten bereitet worden sind, hat sich keiner der Kämpfe, allein gesehen, als erfolgreich erwiesen. Der Tiroler Aufstand war nur so lange zu fürchten, wie er 1809 durch den Kampf regulärer österreichischer Truppen gestützt wurde. Obwohl die spanischen Guerillas den gewaltigen Vorteil eines sehr ausgedehnten Landes hatten, konnten sie hauptsächlich dank der englisch-portugiesischen Armee ihren Widerstand so lange fortsetzen, denn gegen diese mußten die Franzosen stets ihre Hauptanstrengungen richten. Die lange Dauer des Karlistenkrieges erklärt sich durch den heruntergekommenen Zustand, in den die spanische reguläre Armee damals geraten war, und durch die ständigen Verhandlungen zwischen den Generalen der Karlisten und der Christinos <Anhänger Maria Christinas> und kann deshalb nicht als ein angemessenes Beispiel gelten. Schließlich war im Kampf der Kaukasier, der tapfersten aller Bergbewohner, der relative Erfolg ihrer offensiven Taktik zuzuschreiben, die sie bei der Verteidigung ihres Landes vorwiegend anwandten. Wo immer die Russen – sie und die Briten sind von allen Truppen für den Gebirgskrieg am wenigsten geeignet – die Kaukasier angriffen, wurden letztere gewöhnlich geschlagen, ihre Dörfer zerstört und ihre Gebirgspässe durch russische befestigte Punkte gesichert. Die Stärke der Kaukasier lag jedoch in fortgesetzten Ausfällen von ihren Bergen in die Ebenen, in Überfällen auf russische Standorte oder Vorposten, in schnellen Streifzügen weit im Rücken der vorgeschobenen russischen Linie, in Angriffen aus dem Hinterhalt auf russische Kolonnen, die sich auf dem Marsch befanden. Mit anderen Worten, sie waren leichter und beweglicher als die Russen und machten sich diesen Vorteil zunutze. Bei jedem der Beispiele also, selbst bei vorübergehend erfolgreichen Insurrektionen der Bergbewohner, ist der Erfolg immer durch offensive Aktionen erzielt worden. Darin unterscheiden sich diese Beispiele völlig von den Schweizer Insurrektionen der Jahre 1798 und 1799, wo wir sehen, wie die Aufständischen einige scheinbar starke Verteidigungsstellungen beziehen und die Franzosen erwarten, die die Schweizer in jedem Falle zusammenschlagen.