Wie so vieles sind auch die Verben vom Aussterben bedroht. Mit jeder Maschinisierung einer Tätigkeit sterben zig Tuwörter weg, bei einer Verlagerung der selben hinter den Horizont (bis nach China) sind es sogar hunderte und tausende. Aus wievielen Verben (und Werkzeugen) bestand allein das Küfer-Handwerk? Mit der industriellen Fertigung von Blech- und Plastiktonnen war damit aber Schluß. Im Internet haben wir jetzt das Grimmsche Wörterbuch in dem dieser Vorgang ablesbar ist. Als es gedruckt erschien, widmete Radio Bremen täglich einem ausgestorbenen Verb fünf Minuten. Das hat den historischen Prozeß der Entverbung natürlich nicht aufgehalten – diese allmorgendliche Nostalgiesendung.
Bald geht es uns wie den Affen: Sie haben zwar Werkzeuge, aber keine Tätigkeitswörter dafür. Es geht bei ihnen auch ohne, das gilt jedoch nicht für uns. Die Verben sterben aber nicht nur mit der Maschinisierung von Hand- und Kopfarbeit aus, auch die Anglifizierung macht ihnen zu schaffen, weil es sich dabei um mehr als ihre Übersetzung handelt: „Amerikanischer Film – das ist ein Pleonasmus,“ bemerkte bereits Roland Barthes. Wenn aus „laufen“ „joggen“ wird und das einen ganzen Kleidungswechsel (von Trainingshose und -anzug zu Jogging-Outfit) nach sich zieht, oder wenn aus (Bücher) „lesen“ (im Internet) „surfen“ wird, was ebenfalls einen tiefgehenden Objekteaustausch zur Folge hat, dann wird auch das neue Verb anders ausgelotet (das Grimmsche Wörterbuch hilft da nicht weiter): surf ist gleichbedeutend mit foam – dem Schaum (auf der Welle und dem Capucchino), während lesen auf das germanische Tuwort sammeln zurückgeht. Erinnert sei an das Bild „Die Ährenleserinnen“ von Millet (1857). Zuletzt hat der Schriftsteller Günter Grass im Zusammenhang mit diesem Verbwechsel, der ein ganzer „Lifestyle-Change“ ist, Erhellendes über das Internet beigesteuert: „Ich beherrsche das nicht. Aber ich habe gehört, da soll einiges los sein,“ sagte er.
Heute sieht man fast nur noch Bildschirm-Arbeitsplätze, wenn man durch ehemalige Industrieviertel geht. Als die Computerisierung sich durchzusetzen begann, organisierte die westdeutsche Linke einen „Tunix-Kongress“ – unter dem Motto: „Etwas Besseres als den Tod finden wir überall!“ Das kollektive Auswandern war jedoch 1978 bloß metaphorisch gemeint, es entstanden danach viele lokale „Alternativprojekte“, u.a wurde auf dem Kongreß die Gründung der taz beschlossen. Als Gegenveranstaltung zum anarchistisch-spotaneistischen Tunix-Kongreß organisierte die DKP daraufhin einen „Tuwas“-Kongreß. 30 Jahre später organisiert nun auch die taz einen „Tuwas-Kongreß“. Mit Tunix und Tuwas wurde auf schon fast traditionelle linksradikale Weise auf das Verschwinden der Tuwörter reagiert. Im Grunde war dieses Wortspiel aber bloß eine leere Replik auf Lenins „Was tun?“ und Trotzkis „Was nun?“ Kurz vor ihrem jetzigen „Tuwas-Kongreß“ ließ die taz verlauten, sie sei nun nicht mehr „linksalternativ“, sondern „im Bürgertum“ angekommen – „mainstreamig“ geworden. Neue Verben sind mit einem solchen „Relaunch“ natürlich nicht zu gewinnen, aber vielleicht neue Leser und Geldgeber. Gleichzeitig wurde die online-Ausgabe erweitert und ein „bewegungsmelder.de“ eingerichtet. Vielleicht erhofft man sich darüber neue Tuwörter, es wird wie folgt annonciert: „.Für alle, denen der Mainstream im Netz auf den Keks geht…“ Die jungen online-Redakteure geben sich kämpferischer als die alten Holzjournalisten – aber nur „im Netz“. Daran ist das unselige Single-Point-Erfolg-NGO-Sponsoren-Auftun schuld. Halten wir jedoch fest: „Die Bedeutung der Arbeit nimmt ab, die von Wissen nimmt zu,“ so nennt der Publizist Mathias Greffrath das „Mantra“ des Neoliberalismus, der von einer neuen „Wissensgesellschaft“ spricht. Bei diesem „Wissen“ geht es laut Greffrath um die „Privatisierung von Produktionskenntnissen“. So werden beispielsweise „die an Personen gebundenen Fähigkeiten von Bibliothekaren, Architekten, Bergmeistern, Bootsbauern, von Flugzeugkonstrukteuren, Komponisten, Wissenschaftlern, Feinoptikern und Filmlaboranten sukzessive in Software verwandelt und kapitalisiert.“ Dies gilt nicht nur für die kleinunternehmerischen Existenzen: „Die gentechnische Herstellung von Saatgut gibt der großtechnischen Produktion von Lebensmitteln einen weltweiten Schub und vernichtet auch noch die kleinbäuerlichen Existenzen weltweit.“ Den einen wie den anderen werden quasi die Tätigkeitswörter entrissen – fast kampflos.
Der taz-blogwart Mathias Broeckers hätte den taz-tuwas-kongreß lieber „tunix 2.0“ genannt, aus den o.e. Gründen: weil der erste tuwas-kongreß noch in unangenehmer Erinnerung ist. Immerhin kam es dann auf dem Kongreß wenigstens zu einer kleinen Veranstaltung unter dem Titel, auf der broeckers, lisa schuster und ich uns mit der taz – von tunix bis heute – befaßten, und der ehemalige Holzjournalist und jetzige Multiparteienpolitiker Christian Specht sich für eine „taz-neugründung“ stark machte, weil die alte es nicht mehr bringe, außer Layout-Korrekturen, wie er meinte. Auf der Schlußveranstaltung am Sonntag kam auch Ute Scheub noch einmal auf Tunix zurück. „Wir flaggen unser Schiff – und segeln an den Strand von Tunix“. Sie zitierte einige zentrale Forderungen von damals – fand sie aktueller denn je, und schlug dann einen Bogen zum taz-tuwas-kongreß – und sogar darüberhinaus: auf die „pfingstenausgabe der taz“, in der sie dazu Näheres ausführen will.
Ich bekam eine Mail von Didi aus Djakarta, in der er mir mit Photo die Geburt einer Tochter ankündigte. Das hat insofern etwas mit dem Tunix-Kongreß 1978 zu tun als der damals frischgebackene Biologe (Genetiker) Dieter (Didi) Lotze zusammen mit drei anderen beschloß, die obige Kongreß-Einladungsparole nicht nur metaphorisch (hin) zu nehmen, sondern in die Tat umzusetzen. Auch mich hatte damals das nicht ernst Gemeinte an dem Spruch, laßt uns gemeinsam abhauen/in See stechen, gestört – und ich hatte mich deswegen mit einem Flugblatt dagegen zum Kongreß aufgemacht. Den Druck des Flugblattes hatte mir ein Bauer bezahlt, bei dem ich zu der Zeit gerade arbeitete – in der Wesermarsch. Didi und seine drei Freunde flogen nach dem Kongreß nach Singapur und gaben dort in einer Werft den Bau einer Dschunke in Auftrag. Als das Holzschiff endlich fertig war, die Planken dafür wurden noch per Hand zugesägt, nannten sie es „Tunix. Damit fuhren sie über das Javanische Meer nach Djakarta. Und dort blieben sie hängen. Didi sattelte um zum Photographen und arbeitete für eine Werbeagentur, d.h. er knipste Tourist-Resorts und -Hotspots, einer seiner Freunde wurde Entwicklungshelfer im Holzministerium von Indonesien. Aus den anderen zwei wurde ebenfalls irgendwas.
Aber dann entwickelte sich die Situation in Indonesien ab 1999 mehr und mehr zu einem Bürgerkrieg. Didi zog nach Bremen (zurück). Er hatte in Indonesien eine Dichterin geheiratet, diese war dann aber an Krebs gestorben. In Bremen arbeitete er in einem Wohnungsrenovierungskollektiv. Nachdem der Bürgerkrieg in Indonesien etwas abgeflaut war, flog ich nach Djakarta. Die Weltbank hatte der Stadt Geld gegeben, um den Tourismus wieder anzukurbeln, ich flog mit einer Gruppe lustiger Reisebüromitarbeiter aus Mauritius dorthin. Anschließend hängte ich noch ein paar Tage ran, weil ich bei Didis Freund unterkommen konnte, der immer noch im Holzministerium arbeitete. Er war jedoch gerade dabei, sich mit seiner indonesischen Frau eine eigene Existenz in Norddeutschland aufzubauen – mit Holzmöbel-Importen aus Indonesien.
Nach einigen Tagen hatte ich dort das Gefühl „Djakarta sagt Nein!“
Es gibt im Indonesischen sieben Wörter für „Ja“ – einige schließen ein „Nein“ mit ein. Und es gibt keine Warteschlangen: Da wirkt noch das alte Wissen um den sozialen Rang eines jeden nach. Ansonsten ist das Land aber seit der südostasiatischen Währungskrise von einer ungeheuren Verneinung erfaßt. Die Riots – dort Amok genannt – führten zu immer neuen Massakern: auch ein Wort, das aus dem Indonesischen stammt. Die Sprache ist zugleich Teil einer ideologischen Klammer, die den riesigen Archipel, vormals holländische und portugiesische Kolonien, zusammenhält. Man spürt die Spannung beim ersten Spaziergang durch Jakarta. Nicht nur wegen der Militärposten unter allen Autobahnbrücken und vor öffentlichen Gebäuden. Die postkolonialistische Metropole ist – obwohl Einkaufsmekka bis hin nach Afrika – ganz ungeeignet zum Spazierengehen: Es gibt kaum Bürgersteige. Weiße und Reiche bewegen sich per Taxi von Shoppinginsel zu Shoppinginsel, von Hotelkomplex zu touristischem Hotspot. Darunter z. B. der alte Hafen, wo die Edelholzladung der Segelschiffe noch mühsam per Hand gelöscht wird.
Auch in den Zigarettenfabriken wird per Hand gedreht: Die Maschinen stehen still, um mehr jungen Frauen Arbeit zu geben. Die indonesischen Zigaretten enthalten zumeist Gewürznelken von den Molukken, wo das Nelkenmonopol fast bruchlos von der holländischen Compagnie in den Besitz des Suharto-Clans überging. Seit zwei Jahren sind aber die Preise „freigegeben“ – Anbauer und Händler atmen auf. Die Währungskrise und die darauffolgenden Unruhen hatten ansonsten die neue Mittelschicht beinahe ausgelöscht, u. a. mußten 50 Banken liquidiert werden. In den Amoks, seit dem Mai-Massaker des Militärs 1998, wurden Kaufhäuser und Shoppingcenter, die vermeintlich dem Suharto-Clan oder chinesischen Großunternehmern gehörten, zu Hunderten zerstört, in Jakarta brannte das halbe Chinesenviertel ab, es kam zu Massenvergewaltigungen. Ein irischer Brückenbauingenieur behauptet nun in seinem Buch „Rainboys“, sie seien vom Militär organisiert worden. In den Hauptstadtzeitungen werden statt Mutmaßungen taiwanesische Keuschheitsgürtel aus Leder annonciert: Bei Berührung ruft eine Tonbandstimme laut um „Hilfe“. Ausgehend von den Universitäten, bildeten sich allerorten Frauengruppen. Junge Chinesen, die nicht noch einmal wehrlose Opfer werden wollen, bewaffneten sich, einige chinesische Intellektuelle haben sich via Internet organisiert.
Alles ist in noch immer in Bewegung, und jeder neue „Zusammenstoß“ trägt das Seinige dazu bei. Entlassene Bankangestellte demonstrieren vor den vom Staatsgründer Sukarno einst eigenhändig entworfenen Freiheitsstatuen. In Surabaya streiken die Arbeiter. Nahezu täglich wird irgendwo eine neue Gewerkschaft gegründet. In Solo wurden 1999 sämtliche Supermärkte zerstört, zum Einkaufen müssen die Besserverdienenden immer noch 40 Kilometer weit fahren. Es zirkulieren Riot-Videos, die zeigen, daß nicht so sehr geplündert wurde, sondern verbrannt: Alte Männer mühen sich bis zur Erschöpfung, um aus den Läden nagelneue Motorräder auf die Straße ins Feuer zu zerren. Am Stadtrand wurden Golfplätze besetzt. Das Fernsehen zeigte – freudig – alte Bäuerinnen auf ihren bereits umgegrabenen Beeten. Überhaupt die Pressefreiheit: Was für ein Vergnügen bereitet die allmorgendliche Zeitungslektüre – seit der Abschaffung der Zensur! Jeder zweite Leserbriefschreiber hat eine Idee, wie das Land zu retten ist. Indonesien ist ansonsten mehr ein Rede- als ein Leseland. Die wenigen Buchläden verdienen den Namen kaum, über 2.000 Buchtitel wurden während der Suharto-Ära verboten, und der Hausarrest des berühmtesten Schriftstellers, Pramoedya Ananta Toer, ist erst vor zwei Jahren aufgehoben worden. Auch vier der seit dem antikommunistischen Massaker 1965 inhaftierten Offiziere kamen frei. Außerdem der militärische Führer der Befreiungsorganisation Fretilin in Ost-Timor, Gusmao. Man stellte ihn in Jakarta unter Hausarrest, von wo aus er sofort zum bewaffneten Widerstand aufrief. Zwei Jahre später ist er der erste Präsident eines unabhängigen Ost-Timor. Einige islamische Jugendorganisationen und Mullahs rufen den „Heiligen Krieg“ aus. Ein besonders einpeitschender Prediger – in Jakarta – heißt bei den Ausländern „Goebbels“. Die Landstraßen sind „unsicher“ geworden, fast täglich erschießt die Polizei Straßenräuber, die Zeitungen vermelden es knapp. Ausführlicher berichten sie über das Vorgehen der Regierung gegen Firmen und Immobilien, die der Suharto-Familie gehören. Viele „Reiche“ trauen sich auch mit Auto bei Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus, an den Gartenpforten hängen Schilder mit der Aufschrift: „Einheimische“ (d. h. Nichtchinesen).
Neben Arm gegen Reich entstehen laufend neue blutige Konfliktlinien. Vor allem an den rohstoffreichen, aber dünnbesiedelten Rändern des Inselreiches – noch immer in Ost-Timor, aber auch in Aceh, Ambon, Westkalimantan, Ostkalimantan, Irian Jaya: Dort bekriegt das indonesische Militär nach wie vor die Unabhängigkeitsbewegungen. Und mit Megawati als Präsidentin wird dies sogar wieder zunehmen. Die Studenten verlangen den Rückzug des Militärs aus der Politik. Andere Kämpfe artikulieren sich religiös (Christen gegen Muslime) oder ethnisch (eingeborene Dajaks gegen zugewanderte Maduresen), sie können aber auch eine Branche erfassen: wie auf der friedlich-wohlhabenden Insel Bali, wo die alteingesessenen Straßenhändler gegen die neuen, aus den Unruhegebieten dorthin geflüchteten, rebellierten“. Dazwischen wirken immer noch irgendwelche dunklen Kräfte: vom Militär aufgebaute Milizeinheiten, die durch Terror die Wahlen beeinflussen sollen; Unternehmer, die die „Wut der Straße“ auf Geschäfte ihrer Konkurrenz lenken; Kommandogruppen, die der schwarzen Magie verdächtige Mullahs enthaupten … Hernach konstituieren sich universitäre und internationale Untersuchungskomitees, Runde Tische sowie neue Bevollmächtigte. In den Behörden rotiert das Personalkarussell – man versucht damit den immer wieder neu entstehenden Machtkonstellationen und Korruptionsuntersuchungsergebnissen gerecht zu werden. Intern ergehen Wahlanweisungen an die Mitarbeiter nach unten und weiter oben, zu wem man halten muß. Bei Wahlkampf-Umzügen werden regelmäßig die Büros der gegnerischen Parteien angegriffen.
Obwohl ausländische Wahlhilfe verboten war, stützen japanische Banken, Deutschland und die USA sowie in letzter Minute auch noch die Weltbank zunächst die Golkar-Partei und Habibie, der schließlich Wahid wich und dieser jetzt gerade Megawati. Zu diesem letzten Machtkampf titelte eine deutsche Zeitung: „Jakarta droht Showdown“. Zugleich befürchtete man dort Auschreitungen von Wahids islamischer Massenorganisation, es blieb jedoch weitgehend ruhig, auch wenn es – wie ein belgischer Kaufmann hier meinte – „Tage gibt, da geht man besser nicht in bestimmte Gebiete oder Viertel. Man kann auch nicht mehr einfach durchs Land fahren, nicht mal im Zug – Weiße werden mit Steinen beworfen. Aber das wird sich geben, das Militär greift jetzt sicher bald wieder härter durch“. Bürgerrechtler befürchten, daß das Militär auch die Zensur wieder durchsetzen wird – mit Megawati. Die in den diversen Ministerien eingesetzten europäischen Entwicklungshelfer wünschen sich eine „sanfte Militärdiktatur – für den immer noch andauernden Übergang“. Das wünscht man sich anscheinend auch in der US-Botschaft, die sich in Jakarta regierungsmäßig gleich neben den Präsidentenpalast pompös immobilisiert hat. Den Soldaten, die die Ölfelder von ExxonMobil in Aceh bewachen, wirft man vor, ihre Gefangenen gefoltert zu haben. Ein Bus mit Fußballfans wird statt ins Stadion auf den Campus einer Universität geleitet, die Folge ist eine Massenschlägerei. Regelmäßig kämpfen Highschool-Schüler gegen Schüler einer anderen Schule, einmal sterben dabei zwölf Schüler. In Mitteljava befehden sich Jugendliche „verfeindeter“ Dörfer (32 Verletzte).
Der Bürgerkrieg erfaßt nach und nach alle sozialen Gruppen. Im Athen des Solon war dies sogar Bürgerpflicht: Jeder hatte Partei zu ergreifen – im Konfliktfall. Die malaiisch-javanische Kultur ist bedeutend älter – und hat bisher noch alles aus dem Westen integriert: Hinduismus, Buddhismus, Islam, den calvinistischen und den katholischen Kolonialismus, Kommunismus, ferner Tourismus und Konsumismus … Unterdessen wandelten Plantagenwirtschaft nebst Brandrodung, Bergbau und Industrialisierung ein Dorf nach dem anderen und viele der Ethnien in moderne Manövriermassen. Bei ihrer Entmischung tauchen nun alle alten Rechnungen und Toten wieder auf, es werden Exhumierungskommissionen entsendet und auch die alten Kriegskostüme wieder ausgegraben. Flüchtlingslager organisieren sich als Dauereinrichtungen. Der halbbankrotte Zentralstaat reagiert immer kurzatmiger. Hier verhaftet man die sich an den Supermärkten treffenden und per Handys prostituierenden Teenager. Dort werden die Schwarzschürfer auf den Gold- und Diamantenfeldern der multinationalen Konzerne nicht mehr verfolgt, sie sollen nun sogar über ein Sonderprogramm in Kooperativen „produzieren“. Die Reichen, darunter viele Chinesen, fliehen nach Australien und Singapur, die Ärmeren in die Hafenstädte und nach Jakarta. Die europäischen Revolutionen waren, abgesehen von den feindlichen Weißen Heeren ringsum, vor allem vom bäuerlichen Widerstand – der Vendée und den Kosakenrepubliken -, bedroht: die Partikularität, das war deren Stärke und Schwäche zugleich. Im indonesischen Bürgerkrieg sind jetzt die nationalen Kräfte in der Defensive. Der Staat zerfällt ähnlich wie die Sowjetunion, Jugoslawien und – wohl bald – auch Burma. Statt der monarchischen Zentralperspektive entsteht ein synarchisches Feld. Für die Anhänger umfassender Liberalisierung ist dies ein „schmerzhafter Gesundungsprozeß“, für ehemalige Befreiungstheologen Ausdruck der immer unmenschlicher werdenden „Globalisierung“. Die Beilegung der Machtkämpfe an der Spitze bedeutet hierbei nur eine Atempause – im Rahmen der alten „Kommunikation“. Insofern ist die von westlichen Kommentatoren beschworene Wahl in Indonesien – zwischen „Demokratie“ und „Krise“ – ein und dasselbe.
Von den früher gerne im Planet Hollywood und im Hardrock-Café verkehrenden Künstlern haben nicht wenige sogenannte Zelt-Cafés – in öffentlichen Grünanlagen – eröffnet. Statt Geld auszugeben, müssen sie jetzt was einnehmen. Einige werden bereits wegen ihrer „Küche“ gerühmt – und wegen ihres Informationsgehaltes. Letzte Meldungen: Einem General wurden alle deutschen Schäferhunde aus seinem Zwinger geklaut. Einige Westberater erzählen, ihr Hauspersonal habe sich an der Erstürmung eines Einkaufszentrums beteiligt: „Jetzt haben wir Toilettenpapier und Pampers bis zum Jahr 2005.“ Einige junge Hausbesetzer klagen: „Es gibt zu viele unter uns, die nicht squatten können – und sich bereits von einem Stuhl korrumpieren lassen“.
Im Hafen haben zwei Schiffe mit Seezigeunern angelegt, in Europa bezeichnet man sie als Piraten, die mit NVA-Schiffen ausgerüstete Marine spricht von Verbrechern. Die „Sea-Gypsies“ sind in der Stadt, um eine Handelsgesellschaft zu eröffnen.
So weit meine Eindrücke und Anekdoten aus Djakarta. 2004 oder 05 kehrte Didi wieder nach Indonesien zurück. Überraschend schnell lernte er dort eine sympathische Indonesierin kennen. Die beiden heirateten. Didi ließ sich aus Bremen sein Motorrad kommen, dann fuhren die beiden erst einmal durch Java und Bali damit. Und nun hat seine Frau ein Kind bekommen, das Photo von ihm bekam ich wie gesagt mit Didis Mail geschickt – als „Attachment“, wie man auf Plattdeutsch sagt… Dies als Geschichte über den Tunix-Kongreß und das daraus quasi hervorgegangene Tunix-Schiff von Didi und seinen drei Freunden.
Nun zum taz-tuwas-kongreß. Er fing – für mich – relativ harmlos an, indem ich in die Veranstaltung „Was nützt schon Geschlechterkampf“ ging, weil ich darüber 80 Zeilen schreiben sollte:
Über 7 Brücken kannst Du gehn! So die Ausgangsthese der Soziologin Barbara Keddi, die 7 Jahre lang 127 Frauen (und deren Partner) im Alter zwischen 20 und 27 befragte. Es ging dabei um deren „Lebensthemen“. Diese seien „nicht geschlechtskodiert“ – sie hießen: „Familie“, „Karriere“, „Doppelorientierung“, „eigener Weg“, „Suche nach Orientierung“, „gemeinsamer Weg mit Partner“ und „Lebensbewältigung“. Letzteres sei jedoch laut Keddi kein „Thema“, sondern eher ein dumpfer Kampf ums Dasein. Seltsam, ich wollte im Laufe meines Lebens diese ganze „Vielfalt“ von Geschlechterverhältnissen „verwirklichen“ – und endete beim letzten Thema, das keins sein soll. Die von Keddi befragten Frauen blieben dagegen bei „ihrem“, aber alle mußten es in ihrer Beziehung mühsam und immer wieder aufs Neue aushandeln. Insbesondere beim Thema „Familie“ prallen die noch immer sehr unterschiedliche Vorstellungen von Mann und Frau aufeinander. Am Ende bestätigte sich für die Soziologin eine Weisheit ihrer Oma: „Gleich und gleich gesellt sich gern“.
Das provozierte die Rückfrage: „Aber ist das Gleiche auch das Selbe?“ Und die Psychologin auf dem Podium, Ilka Quindeau, fragte: „Sind Lebensthemen wirklich unabhängig vom Geschlecht?“ Sie riet im übrigen, mehr auf Gemeinsamkeiten als auf Unterschiede zu achten. Während der Jugendforscher Detlef Siegfried aus Kopenhagen meinte, man müsse die Veränderung der Lebensthemen und Konflikte historisch sehen. So hätten die skandinavischen Länder zwar schon lange die Frauenerwerbstätigkeit ökonomisch und politisch forciert, aber in kultureller Hinsicht seien sie weniger erfolgreich gewesen. Die vierte Podiumsteilnehmerin, Barbara Höll, gleichstellungspolitische Sprecherin der Partei „Die Linke“, war jedoch als Ostlerin nicht davon abzubringen, dass man den Frauen vor allem politisch beistehen müsse, um ökonomisch gleich zu ziehen – „alles andere is nischt“. Ich hoffe, sie meinte damit, dass man dieses „Thema“ den Repräsentanten politisch aufzwingen müsse – durch Druck von unten. Der Jugendforscher sprach abschließend von den „Mühen der Ebene“, d.h. die Veränderungen in den Beziehungen müßten von jedem im Alltag durchgesetzt werden. Einer Feministin im Publikum war das alles zu wenig radikal gedacht – zu harmonisch: Man dürfe nicht einfach die unreflektierten Wünsche der jungen Generation tolerieren, sondern müsse auf sie einwirken. Für mich kam diese Mahnung der Bremerin leider viel zu spät.
Ein FAZ-Reporter war etwa zur gleichen Zeit in einem anderen Frauen-Panel, auf dem es allein um das Lebensthema „Karriere“ ging. Er schrieb hernach:
Im Kongresssaal 3 riecht es nach Kaffee, hier soll nun eineinhalb Stunden lang verhandelt werden, so steht es im Programm, wie Unternehmen gestaltet sein müssen, um Frauen gleiche Chancen zu bieten. „Frauen an die Macht!“ heißt die Veranstaltung, es diskutieren vier Gäste, darunter ein Mann. Der redet dann auch am längsten. Und zwar nur über seinen Betrieb, Siemens, und wie der versuche, gerade junge Frauen gezielt anzusprechen und für technische Berufe zu gewinnen.
Auch viel redet eine so genannte Mentorin, die Frauen, wie sie sich ausdrückt, „in den Hintern tritt“, um sie auf diese Weise wohl auf der Karriereleiter nach oben zu schubsen. Beinahe jeden Redebeitrag beginnt sie mit einer weiteren tollen Sache, die sie schon gemacht hat. „Ich war ja gestern im Fernsehen, ich weiß nicht, ob Sie‘s gesehen haben…“, „Ich habe ein erfolgreiches Projekt durchgesetzt…“. Viel Zeit geht auch für ihre Aufzählung ihres beruflichen Werdegangs drauf, „…und dann war ich bei der ,Cosmo‘, wo ich ein tolles Projekt geleitet habe…“, und so bleibt leider nicht viel Zeit für die Frau, die vielleicht am meisten hätte erzählen können über Macht und Ohnmacht von Frauen in Spitzenpositionen: Anke Domscheit, blitzgescheite Managerin in einem IT-Unternehmen, die auf die Frage der Moderatorin, ob sie alleinerziehend sei, die entwaffnende Antwort gibt: „Das wechselt.“
Abends lief der Film „The Yes Men Fix the World“. Dabei handelt es sich um zwei US-Künstler, die mit phantasievollen Aktionen gegen große Schweinekonzerne (Global Player) vorgehen – gegen Dow Chemical z.B., indem sie in ihrem Namen öffentliche Statements abgeben, die so gut eingefädelt werden, dass ihre „Fakes“ (bzw. Hoax) erst einmal für Verwirung sorgen, gleichzeitig aber den von diesen Konzernen zuvor beschissenen Leuten (in Bhopal und New Orleans z.B.) großen Spaß machen. Der Film lief auch schon auf der Berlinale, einer der Künstler, Andy Bichlbaum, war auf dem tuwas-kongreß anwesend. Der Film über seine Gruppe „Yes Mum“ war wunderbar, nur leider wurde an keiner Stelle klar, wie sie ihre sauteuren Aktionen finanzieren. Das ist nun aber mal bei einer Aktionsidee so ziemlich das Entscheidenste. So wie etwa bei den Filmen der lesbischen koreanischen Filmemacherin Young-Yoo Byun über die einst von den Japanern zwangsprostituierten „Comfort-Women“. Diese Filme finanzierte sie dadurch, dass sie Vorträge in Universitäten hielt (allein in Seoul gibt es 60 Unis) und dort dann anschließend Badges verkaufte, die dabei sozusagen als Startmarken für den Film fungierten.
In der Diskussionveranstaltung „Reset Kapitalismus“ auf dem tuwas-kongreß begann es relativ harmlos mit einem längeren Statement von Heiner Flassbeck, einst wirtschaftspolitischer Berater von Oskar Lafontaine. Seine kapitalistischen (sozialstaatlichen) Verbesserungsvorschläge wurden flankiert von den Ausführungen des Theologen Bernhard Emunds. Aber in ihrer Mitte hatten die taz-veranstalter einen regelrechten Kotzbrocken platziert: den Ökonomen Manfred Neumann. Er gab sich derartig arrogant und überheblich, vor allem dem Publikum und dem Theologen gegenüber, dass man ihn fast rausgeschmissen hätte.
Statt sich auf die „Gier“ der Banker einzulassen, kam Flassbeck zur Erklärung der Finanzkrise auf die „neoklassische Ökonomie“ zu sprechen, die heute weltweit dominiert – und die davon ausgeht, dass die Wirtschaftsgesetze so etwas wie Newtons Gravitationsgesetz seien. Selbst die sich auf die „Gier“ (der Banker) kaprizierenden Psychologen hegen den Wahn, dass die Gier naturwissenschaftlich erklärt werden kann: nämlich mit bestimmten genetisch festgelegten Verhaltensweisen. Dabei kommen sie dann zu dem Ergebnis, dass die Banker nicht gieriger sind als normale Menschen auch. Dem Ökonomen Manfred Neumann kommt das gerade recht. Auf die selbstgestellte Frage, wer denn schuld sei an der Krise meinte er: Da müssen sie sich alle selbst an die Nase fassen. Als das Publikum Protest anmeldete, erklärte er ihm: „Wir versuchen das in der Ökonomie wie in der Naturwissenschaft aufzuklären. Da sie im Gegensatz zu mir keine Ökonomen sind, haben sie natürlich Schwierigkeiten, das zu verstehen. [Gelächter!] Sie haben doch keine Ahnung von Naturwissenschaft!“
Wie konnte man eine solche Flachpfeife wie diesen Neumann bloß einladen? fragte ich mich die ganze Zeit. Etwas versöhnlicher gestimmt meinte er dann noch: „Den meisten von ihnen fehlt einfach zu viel Information.“ Und die Krise war für ihn dann auch nur ein „Informationsproblem“. Als der Theologe ansetzen wollte, winkte er ab: „Jetzt hören Sie aber mal auf!“ Und erklärte das damit: „Es geht nicht an, dass hier in laienhafter Weise über Ökonomie gesprochen wird. Sorry!“
Ein anderes Panel „Entwertete Arbeit in einer globalisierten Welt“ thematisierte ebenfalls die Finanzkrise und die Möglichkeiten, etwas gegen die derzeitigen Krisenbewältigungsstrategien der Krisenverursacher zu tun. Hierzu hatte man Richard Sennett und Saskia Sassen eingeladen. Ihre Kongreß-Ideen verpulverten sie jedoch leider schon vorab – im Auto der Moderatorin Gina Bucher, die die beiden vom Flughafen abgeholt hatte:
Sennett, der Gesellschaftshistoriker, der an der Universität New York und der London School of Economics lehrt, sitzt vorne und fragt grinsend nach hinten zu seiner Frau: „Oh, wir werden Themen finden, worüber es sich zu sprechen lohnt, oder?“ Saskia Sassen, von derselben Universität in London und als Lynd Professorin an der Columbia University, lacht und wirft ihr Haar zurück: „Oh, ja“. Das eilige Vorgespräch erübrigt sich – eine Frage genüge, um die beiden ins Gespräch zu führen.
Also: Was können wir denn tun, um die Finanzkrise zu unserem Vorteil zu nutzen? Und: Gibt es rebellische Momente am Küchentisch der beiden Denker? „Ja, die gibt es!“, wirft Sassen sofort ein und wirft überschwänglich beinahe ihr Wasserglas um. „Eine wahre Küchentisch-Situation …“ kommentiert Sennett schmunzelnd das Temperament seiner Frau. Sie beschreiben die Gesellschaft als Architektur mit stabilen und unstabileren Pfeilern. Man müsse die Wirtschaft entern und zu unserer machen, fordert Sassen, die vom „The Winner takes it all“-Markt spricht. Sennett fordert, die Gewerkschaften sollten sich von den Berufsständen loslösen und besser vor Ort organisieren. Lebhaft verfangen sich die beiden in einem Gespräch, das sowohl in eine amerikanische Talkshow als auch an die Uni passen würde. Bildhafte Metaphern von Pferden, Dampfbad und Würmern fallen. „Es gibt Würmer, die sich langsam in die leeren Stellen, die die Wirtschaft hinterlässt, fressen“, meint Sassen und artikuliert damit ihre optimistische Weltsicht.
Auf der Abschlußveranstaltung ging es konkret um „Was tun?“. Dazu hatte man zwei Kader von Attac, einen Tierarzt von Foodwatch, die Journalistin Ute Scheub und Klaus-Werner Lobo (Author & Actor) eingeladen. Svene Giegold fand, die taz sollte den positiven Alternativen mehr Raum geben. Es ginge um den Aufbruch in eine ökologische Gesellschaft, denn ohne sie gäbe es keinen ökonomischen Erfolg. Und der Wiener Lobo meinte, derzeit gäbe es dafür ein „Window of Opportunity“. In diesem Zusammenhang kritisierte er die auch von der taz mitunter propagierte „Konsumenten-Demokratie“ der „Lohas“ – und überhaupt einen gravierenden Utopiemangel bei der Linken. An konkreten Zielen fielen ihm die Abschaffung des Nationalstaats und aller Grenzen ein. „Utopien sind nicht etwas völlig Unrealistisches“. Außerdem müsse man wieder den Konflikt wagen. Die Attac-Jugendvertreterin Julia Lingenfelder beklagte, dass man zwar sehr aktiv auf „Events“ sei, aber die Studenten hätten kaum noch Zeit für so etwas (Politisches), sie seien immer mehr eingebunden und wären gehetzt. Aber bei ihren letzten Attac-Aktivitäten hätten „die jungen Menschen sich verstanden gefühlt“. Es gehe darum, Aktivismus mit Spaß zu verbinden und projektbezogene Aktivitäten sich einfallen zu lassen: online-foren, flashmobs, politclown-konzepte etc..
Sven Giegold ergänzte: „Protest kommt dann in Gang, wenn die Menschen das Gefühl haben, es lohnt sich. Dazu erwähnte er das jüngst errungene Genmais-Anbauverbot. Und plädierte ansonsten aber für Rotrotgrün. Er war gerade von seiner NGO zu den Grünen übergewechselt, nun meinte er – wie weiland alle, die der SED beitraten: „Wir müssen in die Partei[en], dürfen nicht einfach auf Distanz bleiben.“
Lobo dagegen: „Ich vertraue den Repräsentanten nicht mehr. Wir stecken in einer Demokratiekrise.“
Der Moderator Reiner Metzger kam wieder auf konkrete Aktivitäten zurück: „Kann man denn die Studis nach einem Flashmop irgendwie andocken?
Giegold wollte aber noch mal auf seinen Übertritt von NGO zu Partei zurückkommen: „Die NGOs verhalten sich neutral gegenüber Systemfragen. Ihre 1-Punktziele können jedoch keine Antwort auf den Neoliberalismus sein. Aufgabe einer Bewegung muß es sein, sich zu fragen: wie kann man darüberhinaus gehen“. In Lateinamerika gäbe es genügend Beispiele für ein erfolgreiches Zusammengehen von NGOs, Gewerkschaften und Partei. Das gelte auch für hier: „Die Tunix-Utopien – anders leben und wirtschaften – sind jetzt mehrheitsfähig.“
Von den Statements, die dazu anschließend aus dem Publiukum kamen, notierte ich mir nur:
„Ich bin eine ganz normale Supermarktkassiererin“. Sie kam dann tatsächlich auch auf Emily zu sprechen, die der Schweinekonzern Kaiser’s in Berlin entlassen hatte, weil sie angeblich 1 Euro 30 veruntreut hatte. „Und nun stellen Sie das mal in Relation zu den Millionen und Milliarden, die die Banker veruntreut haben und die straffrei ausgehen.“ (Bei Flassbeck und Neumann hatte ich gelernt, dass es sich dabei nur um fiktives Geld handelte – Spielgeld gewissermaßen, weswegen ja die moderne BWL/VWL auch bloß noch mit der Spieltheorie arbeitet!)
Ein anderer Zuhörer meinte am Saalmikrophon „Auch die Fair-Trade-Banane sagt ‚Kauf mich‘!“
Das wars dann. Nach der abschließenden Ehrung der Kongreß-Mitarbeiter gingen wir alle in verschiedene Richtungen auseinander.
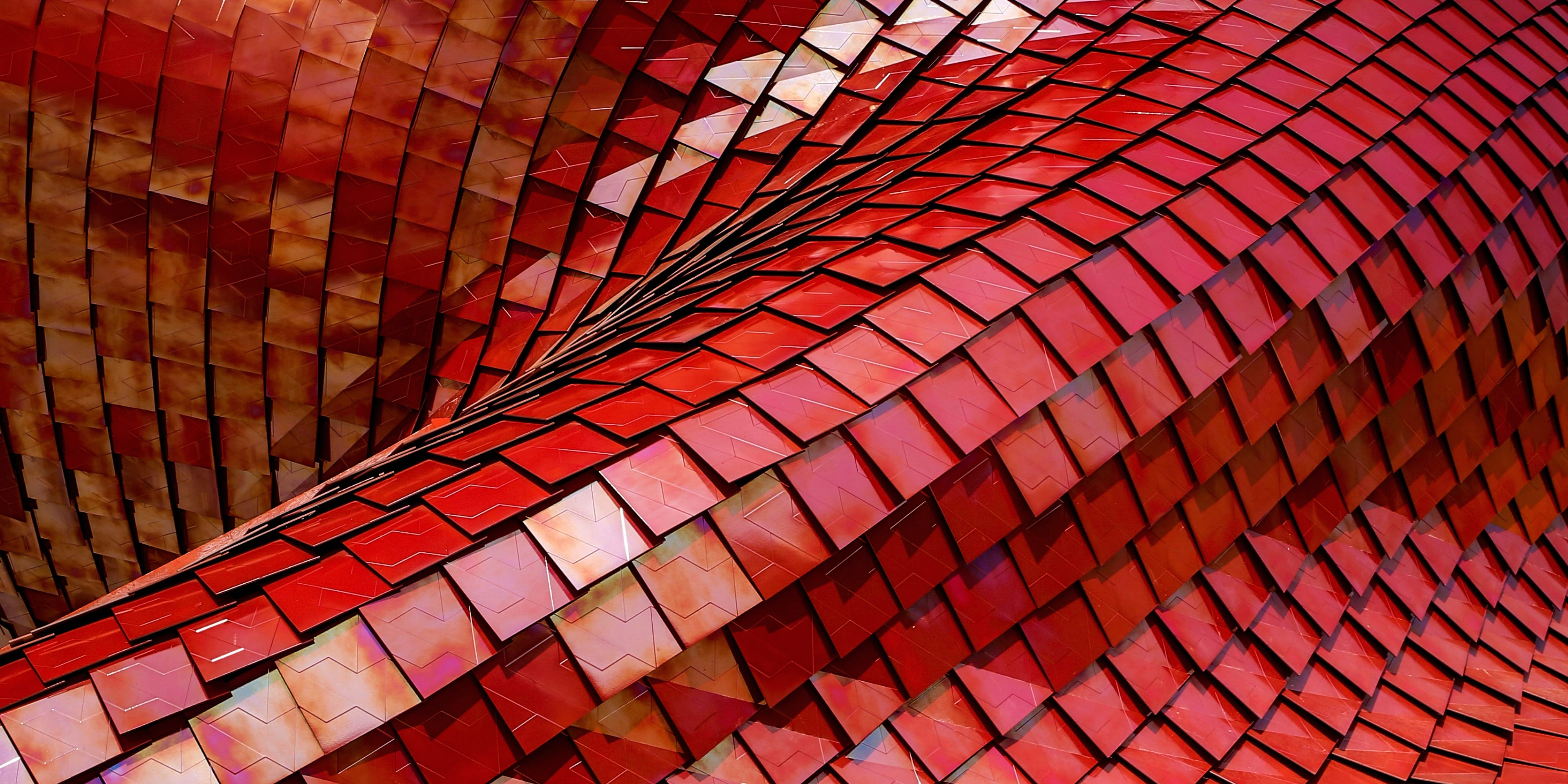



Dirk Weichberger (Husum):
Warum schreibt ihr „Mob“ immer mit „b“ am Ende? Das wort kommt aus dem Englischen und heißt „Mop“ – es ist die Abkürung für „mobile people“. Damit waren die Armen und Besitzlosen in England nach Auflösung der Allmende gemeint, die hilflos herumirrten oder sich in den Slums der Großstädte zusammenballten, wo sie die braven Bürger erschreckten…
Wikipedia schreibt: Der Ausdruck Mob (engl. „mob“ aufgewiegelte Volksmenge; v. lat.: „mobilis“, beweglich) bezeichnet eine Masse aus Personen des einfachen Volkes bzw. eine sich zusammenrottende Menschenmenge mit überwiegend niedrigem Bildungs- und Sozialniveau (abwertend auch gemeines Volk, Pöbel oder Plebs genannt).
Der Ausdruck „Mob vulgaris“ („der gemeine Mob”) wurde von L. Lizerman und A. Freisberg als sarkastische Bezeichnung für untere Gesellschaftsschichten eingeführt. Er wird auch heute noch gelegentlich in polemischer Weise für einen Menschenauflauf benutzt.
Ich meine mich jedoch erinnern zu können, dass man in der Sozialforschung, die mit dem Studium der Unterschicht-Quartiere in London begann, den Pöbel als „mop“ mit „p“ – weil von „mobile people“ abgeleitet, bezeichnete.