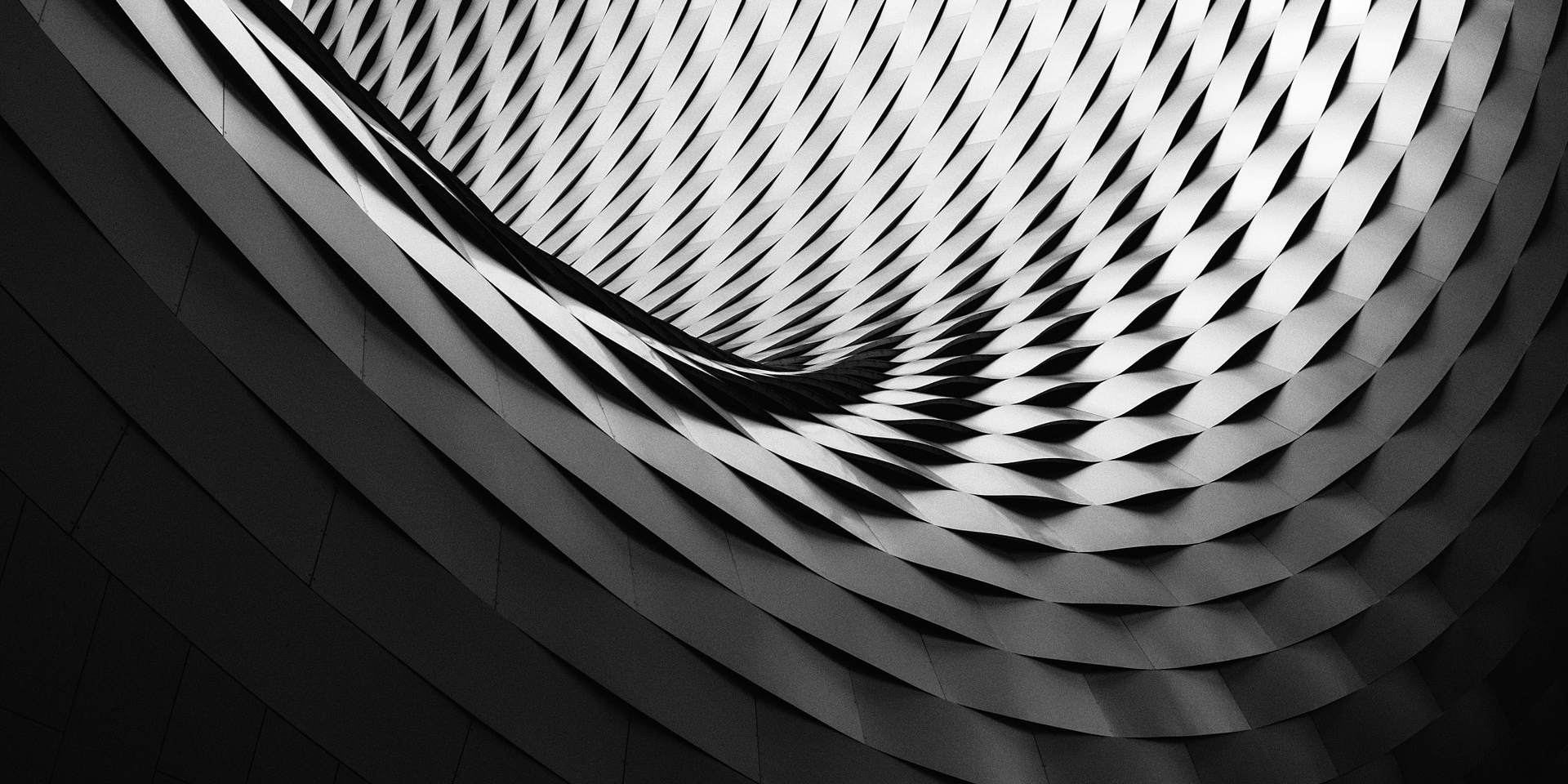Werbung einer schottischen Bank: „Immer eine sichere Anlage!“(*)
Im Folgenden zwei taz-Porträts von Berliner Bankangestellten. (**) Der eine wurde 1943 geboren, die andere 1973. Den ersten interviewte Gabriele Goettle, die zweite ich:
Der Kassierer
Manfred Zauter, Bankkassierer a. D. 1943 in Berlin geboren, Vater war Postbeamter, die Mutter Postangestellte. 1959 starb der Vater, er und seine Schwester wuchsen bei Großmutter und Mutter auf. 1959 Abschluss der Oberschule mit Klasse besonderer pädagogischer Prägung. Ausbildung bei der Bundespost, 1961 Übernahme ins Beamtenverhältnis, wechselte aber, trotz aller Sicherheiten, in die freie Wirtschaft und wurde 1970 bei der Berliner Volksbank als Kassierer eingestellt. Bis 1974 arbeitete er in einer Schöneberger Filiale am Wittenbergplatz. Danach in der Filiale Schlossstraße in Steglitz, wo er Erster Kassierer war, mit eigener Gelddisposition (Sorten-, Devisen- und Edelmetallhandel sowie Reisezahlungsmittel). Ab 2001 erfüllte er zudem Sonderaufgaben, u. a. als Geldwäsche- und Sicherheitsbeauftragter, zum 31. 12. des Jahres bekam er im Rahmen des Personalabbaus seine Kündigung, wurde aber wegen der Umstellung auf den Euro ein Jahr länger beschäftigt. Herr Zauter ist seit 1972 verheiratet und hat eine Tochter. Er ist seit 1960 im Ruderverein, er wandert gern und regelmäßig. Zwei Wochen nach seiner Entlassung in den unfreiwilligen Ruhestand begann er, sich ehrenamtlich über das Berliner Blindenhilfswerk in Steglitz um Blinde zu kümmern, die in einem eigenständigen Haushalt leben.
Werbung einer japanischen Bank: „Sanierungsprobleme? Wir helfen!“
Herrn Zauter kenne ich seit den 70er-Jahren. In seiner Filiale am Wittenbergplatz habe ich damals mein erstes Konto eröffnet, er hat mir in jenem seltsamen Sommer 1974, in dem die Portugiesen und Griechen ihre Militärregierungen zum Teufel gejagt haben, die Escudos und Drachmen für meine ersten Reisen besorgt. Er hat mir fast mein gesamtes Studenten- und Arbeitsleben hindurch meine Ein- und Auszahlungen gemacht und war, auch bei noch so flauem Kontostand, stets von ausgesuchter, aufmunternder Freundlichkeit. Als ich ihn endlich aufgestöbert hatte und um ein Gespräch bat, war er sofort bereit. „Als ich anfing bei der Bank damals, da war noch alles offen, das Geld war noch nicht mal hinterm Tresen gesichert. Und wer ist denn überhaupt zur Bank gegangen? Das waren die Firmen und Handwerksbetriebe, die Geschäftskunden. Und die Volksbank ist ja eine mittelständische Bank. Die Firmen sind zur Bank gegangen, haben vorher angerufen und den Gesamtlohn für ihre Firma geholt. Die Geschäftsleute gingen meist freitagmorgens zur Bank und haben das Geld für die Löhne der Angestellten und Arbeiter abgeholt, passend zur Aufteilung in die Lohntüten. Am Monatsende wurde das Geld für die Gehälter geholt. Und das war es dann. Also die ganze untere Schicht war schon mal ausgeschlossen, Girokonto für jeden, das gab’s nicht, war nicht nötig. Das Geld gab es in der Lohntüte, direkt im Betrieb, für die Arbeiter einmal wöchentlich. Und die Rentner sind zur Post gegangen und haben dort ihre Renten ausgezahlt bekommen, oder sie ist ihnen zugestellt worden, nach Hause, durch den Geldbriefträger. Es war also nur ein bestimmter Kreis, der zur Bank ging und dort ein Konto hatte. Das ging so, bis die Post eines Tages sagte, wir stellen die Rentenauszahlungen ein, die Leute sollen sich ein Post- oder ein Bankkonto einrichten. Dann haben auch gleich die großen und kleinen Firmen nachgezogen.
Das hat viel verändert. Vorher war’s ja so, wer ein Bankkonto hatte, der hatte Geld, der war – ich will mal so sagen – was Besseres. Wenn einer in eine Bank reinging, er die Tür aufmachte, das war eine Stille und eine Eleganz, da hatte jeder Respekt. Die Beamten – man sagte so, obwohl wir Angestellte waren -, die waren anders gekleidet als bei der Post. Das war noch die Zeit, als die Kleiderordnung sehr streng war. Die Frauen durften keine Hosen tragen, nur Kostüm oder Bluse und Rock. Die Männer Sakko und Hose, dunkle Töne, Krawatte. Jeans waren absolut undenkbar! Es durfte im Sommer, egal wie heiß es auch war, niemals das Sakko ausgezogen werden. Und damals gab es noch keine Klimaanlagen. Ja – der Wandel der Zeiten! Und dann hatten wir also plötzlich auch ganz andere Kunden, es kamen alle Gesellschaftsschichten. Die neuen Kunden waren erst mal sehr zurückhaltend, alles war ungewohnt. Früher war es üblich, dass die Rundfunkgelder von der Post kassiert wurden, und die Zeitung, das wurde an der Wohnungstür kassiert und quittiert, Mieter zahlten ihre Miete an den Hauswart, da gab’s die kleinen, grünen Mietbücher zum Quittieren usw. Das wurde alles abgeschafft und musste nun als Dauerauftrag eingerichtet werden. Damals gab’s ja die Computer noch nicht, das wurde alles per Hand von uns gemacht, die Kontostände wurden in Listen gedruckt, da hat man dann erst mal in Büchern geblättert, um zu prüfen: Hat er das Geld überhaupt drauf?
Ich war von Anfang an Kassierer. Das wollte keiner machen, man muss ja die ganze Verantwortung dafür übernehmen, dass das Geld immer stimmt. Und die Kasse ist der zentrale Anlaufpunkt. Als ich anfing, hat man mir gesagt: Der Kassierer ist das Aushängeschild der Filiale. Denken Sie immer daran, Herr Zauter, man schaut Sie als Ersten an, wenn man die Bank betritt! So war die Einteilung der Plätze. Wir hatten damals noch eine 45-Stunden-Woche von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, zweimal die Woche bis 18 Uhr. Wir waren so um 7 Uhr schon da. Es gab ja den Nachttresor noch, der 1995 abgeschafft wurde. Da konnten die Geschäftsleute nach Geschäftsschluss ihre Einnahmen in Geldkassetten einwerfen – das musste morgens ausgezählt werden. Dann habe ich meine Kasse fertig gemacht, seitlich vom Tresen waren die Geldfächer, unten waren die Schubladen für die Geldbündel. Um 9 Uhr war ich fertig und bereit. Mittags hatten wir eine Stunde Pause, die wurde dann auch abgeschafft, später, und danach ging es weiter. Dazu muss ich anmerken, wir bekamen eine Essensmarke – die Bank war damals noch großzügig -, damit konnten wir in den umliegenden Lokalen essen gehen. Der Arbeitstag war noch übersichtlich. An normalen Tagen hatte ich so 120 bis 180 Kunden. Wenn Ultimo war, hatte man 320 bis 340 Kunden. Damals ist man ja als Kunde, oder als Bürger, noch viel sparsamer gewesen. Man ist einmal zur Bank gegangen, im Monat, hat sein Geld abgeholt, vielleicht gesagt, da gehen noch 10 Mark davon aufs Sparbuch, und dann war das erledigt. Die Leute haben ihr Geld mit nach Hause genommen und es sich eingeteilt. Die wussten genau, was sie kaufen konnten, ob das Geld reicht oder nicht. Das kam noch aus der Zeit der Lohntüten, als man zu Hause das Geld auf dem Küchentisch ausgebreitet hat, da wurde dann alles gleich zur Seite gelegt, was für Miete, Licht, Heizmaterial usw. gebraucht wurde, und vom Rest musste man sich ernähren. Kreditkarten waren bei uns kaum verbreitet und nur für Geschäftsleute gedacht. Es war auch nicht so, dass jeder, wenn er ein Konto eröffnete, gleich einen Dispo drin hatte. Der musste erst beantragt werden, ebenso der Kredit, und zuerst mal musste man Mitglied werden, seinen Genossenschaftsanteil an der Bank zeichnen. Das waren damals 200 Mark. Das ist eine Menge Geld. Das wurde verzinst, Dividende gab’s einmal im Jahr. Heute ist man dazu nicht mehr gezwungen, aber es wird natürlich gern von der Bank gesehen.
Die Bank war damals noch eine irgendwie würdige, respektable Stätte. Die Filiale am Wittenbergplatz war, wie ich schon erwähnt habe, anfangs noch ganz offen, also man stand dem Kunden ganz normal gegenüber, nur getrennt durch einen normalen Tresen. Es gab auch noch keine Kamera und nichts, 1970. Aber eines Tages fing das plötzlich an mit Sicherheitsvorkehrungen. Das ging von den Versicherungen aus, da kamen immer neue Auflagen. Da gab’s erst mal diese Scheibe, als Barriere, aber es war noch ein Schalter, man konnte sich noch die Hand reichen. Später kam dann eine halbhohe räumliche Abtrennung durch Panzerglas, aber oben noch offen, das war schon in Steglitz, fragen Sie nicht, wie oft ich da oben drüber gestiegen bin, weil ich durch die Tür gegangen war ohne Schlüssel. Und dann kam immer mehr Panzerglas, bis es 1976 dann ein vollkommen geschlossener Glaskäfig war. Das veränderte schon sehr das Verhältnis zum Kunden. Zuerst war das Panzerglas nur versetzt, dann war es ganz geschlossen. Man hatte einen Trog für das Geld. Wir hatten Mikrofone. Wenn ich daran denke, was ich da plötzlich für eine Technik hatte. 12 bis 15 Lautsprecher waren eingelassen unter dem Tresen, damit die Akustik besser wurde. Aber man konnte trotzdem kaum was verstehen. Mit vielen Kunden hat man ja vorher auch persönliche Worte gewechselt, man kannte sie zum Teil lange. Das war jetzt nicht mehr möglich. Man hat sich zwangsläufig auf den rein sachlichen Geldverkehr beschränkt. Ab 1974 bekam der Kunde ja eine Nummer, die aufgerufen wurde, jetzt wurde die nur noch angezeigt. Und es gab diesen Strich am Boden, zwei Meter Abstand zum Kunden an der Kasse, ,Bitte Diskretion‘, und sogar eine Absperrung mit Ständern und Bändern als Leitweg. Und trotz allem, es hat nicht wirklich abgeschreckt. In meiner Gesamtzeit hatte ich drei Überfälle, den schlimmsten in Steglitz, also in der Zeit, als wir die besten Sicherheits- und Alarmsysteme hatten. Zwei Männer kamen rein mit Masken und Pistolen, einer sprang über den Tresen und hat eine Mitarbeiterin als Geisel genommen, ihr die Pistole an den Kopf gesetzt, damit ich die Tür zum Kassenraum aufmache. Ich habe natürlich geöffnet und getan, was er verlangt hat, habe ihm aber zugeredet, er soll sich doch nicht unglücklich machen. Sie sind entkommen, aber ein Jahr später hat man sie geschnappt. Es gab Kurse zum Verhalten bei Banküberfällen, psychologische Betreuung, aber man ist dann doch ziemlich hilflos und hat einen Schock.
Das war diese Geschichte. Und ansonsten hatte sich im Wandel der Zeiten auch der übrige Raum verändert. Ein riesig langer Tresen wurde geschaffen, mit Kontoführung, Sparabteilung usw. Das waren also plötzlich regelrechte Hierarchien. Was vorher so rundum war, war dann plötzlich irgendwie kastenmäßig ab- und eingeteilt in der Filiale in Steglitz. Sagen wir mal, es war etwas elitär und kälter. Zugleich eröffnete 1976 die Filiale den ersten und einzigen Autoschalter Berlins, nach amerikanischem Vorbild – er ist längst geschlossen -, aber damals war es so, es gab Kunden, die mit ihrem großen Auto vorfuhren und meinten, sie seien was Besseres und müssten sofort bedient werden. Innen standen lange Schlangen, und außen haben sie gehupt. Das war natürlich nicht so schön! Man hat dann auch immer mehr hineinverlegt in den Kassenraum. Zuvor wurde draußen gebucht. Dann bekamen wir unsere eigene Maschine, die gebucht hat. Dadurch hatte man dann wieder weniger mit den Kollegen zu tun. Man war, sagen wir mal, für sich allein. Und wenn die Kasse mal nicht gestimmt hat, dann hat das keinen mehr interessiert. Ich saß da, und habe gezählt und gezählt und gesucht. Jeden Tag wurde ja ein Kassenabschluss gemacht, der Bestand im Keller, alles. Ich hatte über das gesamte Geld im Haus den Überblick, konnte selbst disponieren, habe bestimmt, wie viel abgeliefert wird und wie viel im Haus bleibt.
Ich habe es gezählt und gebündelt, in Papier eingeschlagen die Münzen, oder sie kamen in Jutesäcke rein, die wurden von uns dann vernäht. Sie wurden gewogen, 6 Kilo 5-Pfennig-Stücke waren 100 Mark. Die Geldscheine habe ich alle mit der Hand gezählt. Ein zweiter Mann musste alles noch mal nachzählen, es mussten immer zwei Zeichen auf der Banderole drauf sein. Ich habe ohne Gummifingerling gezählt, nur ein Schwämmchen habe ich benutzt. Das Geld damals hat sich übrigens ganz anders angefasst als das Geld heute. Es ist ja nicht aus Papier, es ist aus reiner Baumwolle. Früher gab’s auch mal dieses Perlongeld, in den 50er-Jahren, dieses Knistergeld, dann wurde auf Baumwolle und Hanf umgestellt, in den 60er-Jahren, glaube ich. Jedenfalls, die D-Mark-Scheine waren beweglicher, der Euro ist zu starr, gar nicht elastisch. Die Scheine damals konnte man viermal falten. Wenn man den Euroschein faltet, muss man hinterher ein Bügeleisen nehmen. Es ist Ihnen sicher aufgefallen, dass heute meist nur ganz neue Geldscheine in Umlauf sind. Von der Bank bekommen Sie nur neue Scheine. Und wissen Sie, warum? Die Geldzählmaschinen und Geldauszahlungsmaschinen können geknickte, leicht gerollte oder eingerissene Scheine nicht lesen. Da verzählen sie sich! Die Zentralbank vernichtet ständig Geld, das durch neues ersetzt wird, das automatentauglich ist. Der Kunde bekommt ja heute sein Geld nicht mehr vorgezählt in der Bank. Für mich war das Geldzählen für den Kunden eine Selbstverständlichkeit. Meist kannte ich die Kunden und ihre Wünsche, ich wusste, wer 100er oder 50er will, wer lieber langsamer vorgezählt bekam und wer es schneller ertrug. Jedenfalls, ich hatte eine unheimliche Routine beim Geldzählen erlangt im Laufe der Zeit. Also ich gehöre noch zu denen, die das Geld angefasst haben. Ich habe fast mein Leben lang Geld in den Händen gehabt, von morgens bis abends. Das sind Summen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, das muss in die Milliarden gehen. So 300.000 die Woche … Es waren Unsummen! Und dazu kamen noch die ausländischen Zahlungsmittel. Ich habe immer günstig eingekauft – An- und Verkauf, wie man so schön sagt. Und ganz nebenbei. Vom Erwirtschaften der Erträge, durch die Disposition, sollte ich möglichst mein Gehalt und das eines anderen herauswirtschaften. Das hat nicht ganz geklappt, ich hatte aber auf jeden Fall das Gehalt für die zweite Person.
Zurück zum Thema Geldzählen, den Dollar konnte ich überhaupt nicht leiden. Wie ein Dreckschwein sah ich hinterher aus. Von allen ausländischen Zahlungsmitteln hat der Dollar am meisten abgefärbt. Und noch was: Alles Geld, das neu war, hat gestunken. Wenn ich den Tresor aufgemacht habe im Keller, buaah! Man sagt ja, Geld stinkt nicht, aber ich weiß es besser. Geld stinkt ganz furchtbar. Da unten drin ist ja alles hermetisch abgeschlossen, keine Luftzirkulation. Morgens, wenn man den Tresor aufmachte, musste man sich ganz schön anstrengen, so stark war der Sog, und wenn die Tür zuging, kam auch immer der Geruch und dieses Geräusch: zzzsch.
Werbung einer italienischen Bank: „Wir helfen. Oggi Qui Subito!“
Fast all das ist heute nur noch romantische Vergangenheit. Die Banken haben immer mehr umgestellt, was ein Riesenproblem für mich war. Ab dem Jahr 2000 wurden die Kassen aufgelöst, die Kassierer quasi abgeschafft. Man hatte die tolle Idee, wir schaffen alle Kompetenzen ab, jeder kann alles! Vorher hatten wir Mitarbeiter, die waren spezialisiert auf Kontoführung, Sparbereich, Neukunden, Kundenberatung, Festgeld, Wertpapiere, Kredite usw. Nun hieß es, jeder macht alles! Wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft, der Kunde bedient sich selbst im ,SB-Bereich‘ an den Maschinen, macht seine Überweisungen selbst, bekommt sein Geld aus dem Automaten. Die Deutsche Bank war der Vorreiter von alldem. Es wurde gesagt, so, jetzt bauen wir die Bank ganz anders auf, das Ergebnis war aber, die Bank als solche gab es nicht mehr. Man hat immer mehr Service und Betreuung für den Kunden abgeschafft und eingespart. Im Grunde hat man den einfachen, normalen Kunden, der vorher mit allem versorgt wurde, einfach weggeschoben. Der musste nun selbst schaun, wie er zurechtkommt. Und für uns Mitarbeiter bedeutete das, jeder muss sich noch mal bei der Volksbank um seine neue Tätigkeit bewerben. Man sagte mir, Sie können machen, was Sie wollen, möchten Sie vielleicht in der Filiale bleiben und als Kundenberater tätig sein? Ich wollte ja nicht in einem Großraumbüro irgendwo sitzen, ich wollte weiterhin den Kontakt zu den Menschen, das war mir wichtig. Also sagte ich, gut, dann werde ich eben Kundenberater.
Und dann ging das los, von einer Schulung zur anderen – ich habe sogar freiwillig Wirtschaftsenglisch gemacht -, ich musste mir eine Menge aneignen, ob das nun Wertpapiersachen waren oder Gesetze. Ich durfte ja vorher keine Wertpapiere verkaufen. Nach dem Wertpapierhandelsgesetz darf nicht jeder einfach verkaufen und Kunden beraten, zuvor muss man eine Prüfung machen. Das habe ich dann auch alles noch gemacht. Freunde haben gesagt, ich bin verrückt, dass ich das mache, denn es war ja klar, dass ich gehen musste. Man hatte bereits beschlossen, Stellen abzubauen, das war nach der Übernahme der notleidenden Grundkreditbank. Weibliche Mitarbeiter ab 55 und männliche ab 58 mussten in den Ruhestand gehen. Bei mir hat sich das dann um ein Jahr verlängert, weil man mich wegen der Währungsumstellung auf den Euro noch brauchte. Ich bin gefragt worden und habe ja gesagt.
Also ich habe diese ganze Zeit noch miterlebt. Die Modernisierungen. Wir standen dann alle plötzlich an so kleinen Stehtischen, jeder für sich, jeder war Kundenberater, und jeder muschelte so vor sich hin. Ganz zuverlässig war das natürlich nicht, was da beraten wurde, keiner war mehr so kompetent wie der Mitarbeiter vorher, der in seinem Metier drin war. Man hat gesagt, wie ein Marktplatz soll das sein, dieses Rund der Serviceplätze, und die einfachen Kunden, wie gesagt, sollen alles am Automaten erledigen und nicht stören. Wir wollen nur noch Geschäft machen. Beratung und Verkauf. Dass alles im Stehen! Ich habe in meiner Kasse auch gestanden, aber das war etwas anderes. Für mich ist das so: Wenn ich ein Geschäft abschließen soll im Stehen, das geht einfach nicht! Das gehört sich nicht, das ist dem Kunden gegenüber unhöflich. Aber man wollte Folgendes vermeiden: Angeblich plaudern sich die Berater mit dem Kunden fest, im Sitzen. Und Zeit ist ja auch Geld. Das alles haben sich Leute am grünen Schreibtisch ausgedacht, die nie etwas mit dem Alltag einer Bank zu tun hatten. Aber diese Modernisierung hat sich nicht so bewährt. Man hat festgestellt, es stehen zu viele Berater rum, und es kommen zu wenige Kunden, es wird also doch nicht so viel Geschäft gemacht wie erwartet. Wir ändern das mal, schaffen wieder mehr Sitzposten. Die Berater, die dann auch wieder kompetenter sein sollen, kommen an Schreibtische im Hintergrund, wo dann auch ein Stuhl ist, auf dem der Kunde sitzen kann. Vorn stehen dann nur noch ein bis zwei Mitarbeiter vielleicht bereit. Die machen dann das, was der Kunde nicht selber kann. Aber der Kunde ist denen meist gar nicht mehr namentlich bekannt, was ja vorher der Fall war. Sie sind doch früher als Kunde reingekommen, Guten Tag! Man hat Sie mit Namen begrüßt. Den hatte ich im Kopf. Das war für mich wichtig, denn es entsteht eine gute, persönliche Stimmung. Jeder freut sich. Ah! Der erinnert sich an mich, der kennt mich, der weiß im Prinzip, was mein Anliegen ist. Denn was nützt es denn, wenn mein Name irgendwo auf einem Schildchen auf der Theke steht, der Kunde spricht mich vielleicht mit meinem Namen an, und ich weiß nicht, wer da vor mir steht? Man hat das sozusagen von sich aus dazugegeben, das war nicht angeordnet, für mich war das selbstverständlich.
Also der Umgang mit dem Kunden hat sich vollkommen geändert, überhaupt haben sich die Banken sehr geändert. Die Volksbank ist ja nicht so von der Bankenkrise betroffen jetzt, es gab nicht die großen Spekulationen im Ausland wie bei den anderen Banken, sie haben keine Auslandsfilialen wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank usw. Die Volksbanken sind bei der Deutschen Genossenschaftsbank in Frankfurt angeschlossen. Da muss alles gleich sein, die müssen als mittelständische Bank auch liquide sein. Das ist also eine saubere Sache. Allerdings gab’s damals auch Probleme, nach der Wende. Da hatten wir bereits den besten Beweis, wie so etwas schiefgeht. Das waren auch Immobilienfonds. Sie sind den Leuten mit großen Versprechungen verkauft worden: Na, wie ist’s denn, lieber Kunde? Du kannst jetzt bei mir einen Fonds kaufen. Für, sagen wir, 10.000 Mark, und dann hast du die Möglichkeit, Steuern zu sparen, durch Mieteinnahmen eine gute Rendite rauszuwirtschaften, deine Altersversorgung zu sichern usw. Und dann plötzlich war da leider nichts, keine Wohnungen wurden vermietet, keine Geschäfte haben eröffnet, alles tote Sachen, keine Rendite, kein gar nichts. Der Kunde hatte sein Geld zum Fenster rausgeschmissen.“ (In den 90er-Jahren wurden im Genossenschaftsverbund der Volks- und Raiffeisenbanken geschlossene Immobilienfonds der DG-Anlagengesellschaft empfohlen und vermittelt, als angeblich sichere Geldanlage mit guten Renditen. Aber die Ostimmobilien waren wenig ertragreich oder standen leer. Viele Anleger verloren ihr Geld, um das sie heute noch kämpfen. Anm. G. G.)
„Heute, da werden von den Banken ja regelrecht Produkte verkauft, Finanzprodukte und Versicherungen, Kredite usw. Und für den Produktverkauf gibt’s Provisionen, die die Bank einnimmt. Die Mitarbeiter sind sozusagen auf Provisionsbasis tätig. Das sind heute die Hauptgeschäfte der Banken. Früher haben sie überwiegend von den Einnahmen gelebt, vom Gewinn aus dem Zinsüberschuss. Dann fing das an in den 90er-Jahren, dass sie mehr und mehr aus Provisionen, aus Vermittlung von Fonds und Versicherungen Einnahmen bezogen haben. Und da fing es dann auch mit den Umstrukturierungen an. Der Kundenberater ist zu einem reinen Verkäufer geworden, der nur noch den Interessen der Bank zu dienen hat. Vorher, ich habe es ja geschildert, war man mehr für den Kunden da, man war auch, ich sage mal, ein Verwalter seiner Interessen. Das kann der Mitarbeiter gar nicht mehr leisten, ob er will oder nicht. Das Reinholen von Provisionen ist zur Hauptsache gemacht worden, und zwangsläufig ist damit natürlich auch der Verkaufsdruck auf die Mitarbeiter gestiegen. Schlimm, diese Zeit!
Das zeigt sich auch im Kleinen. Ich habe jetzt so einen Fall gehabt. Es ging um einen Blinden, den ich betreue. Er war so ein bisschen schwach auf dem Konto, war im Urlaub gewesen, und na ja … Er hatte sein Konto so stark überzogen, dass es noch ein bisschen mit einem Dispo erweitert werden musste. Man hatte ihm dann geraten, einen Kredit aufzunehmen für 3.100 Euro. Ich habe den Ausdruck mit der Berechnung nachher gesehen. Also er hätte erst mal eine Versicherung abschließen müssen, eine sogenannte Restkreditversicherung über 743,13 Euro für den Fall, dass er die Summe nicht zurückzahlen kann. Dann hätte er eine Bearbeitungsgebühr von 115,26 Euro noch zu entrichten gehabt, und 1.396,55 Euro Zinsen, Laufzeit 84 Monate, das sind sieben Jahre. Also vorher wären es 3.100 Euro gewesen, und mit allem, nach 84 Monaten, hätte er dann 5.354,94 zurückzuzahlen gehabt. Das muss man sich mal vorstellen! Ich habe ihm natürlich abgeraten. Die Kollegin bei der Bank war sehr erbost. Ich war bei diesem Gespräch dabei. Das wäre ein Schnäppchen, hat sie noch gemeint. Und ich sagte zu ihr: Also wenn es Schwierigkeiten gibt mit dem Konto von Herrn X, dann machen wir jetzt eine Überweisung, gleich von meinem Konto! Da war sie natürlich noch erboster. Die Dame wollte nur diesen Kreditabschluss und sonst nichts. Ich habe ihr dann gesagt, schaun Sie doch mal rein in sein Konto. Jetzt, am 5., wird ein Vertrag fällig, und das sind 6.000 Euro, die da auf sein Girokonto gehen werden. Damit ist glatt alles ausgeglichen. Das hätte sie sehen müssen. Aber sie wollte es nicht sehen. Wollte nur diesen Kredit verkaufen. Also das ist nicht mehr meine Bank!
Ich bin, ehrlich gesagt, sehr skeptisch geworden. Ich sehe nicht, dass man etwas lernt, dass sich etwas bessert. Im Gegenteil. Und was noch auf uns zukommt, jetzt mit der Krise vielleicht eine Inflation, ich weiß es nicht. Im Grunde genommen hatten wir bereits eine Inflation. Mit der Umstellung von der D-Mark auf den Euro hat die sich ja eingeschlichen. Auch wenn das bestritten wird. Die meisten Preise haben sich verdoppelt. Denn wenn Sie mal schauen, beim Essengehen, da zahlen Sie heute für ein einfaches Gericht so um 12 Euro. Das sind 24 DM, das hat man doch damals nicht für ein Mittagessen ausgegeben! Oder ein Getränk, eine Apfelschorle oder ein Bier, kostet 3,20 Euro, 0,4 Liter! 6,40 Mark für so ein Getränk, oder 2 Mark für eine Kugel Eis, keiner hätte gewagt, das zu verlangen. Also es sind ja die kleinen, alltäglichen Dinge, die uns zu schaffen machen. Ein Ende ist nicht abzusehen.
Werbung der Investment-Bank David Faintich: „Dort könnte auch Ihre Ranch sein!“
Die Bankerin
Ramona Kluge (geboren 1973 in Thüringen) wollte nach Abschluß der 10. Klasse eigentlich Außenhandelskauffrau werden, aber der Außenhandelsbetrieb für Elektrotechnik am Alexanderplatz, bei dem sie bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hatte, ging im Sommer 1990 zu Recht davon aus, dass er nicht mehr lange existieren würde. Deswegen reichte er ihren Namen und ihre Anschrift einfach an die Sparkasse weiter, die sich schräg gegenüber befand. Von dort schrieb man ihr, dass sie vorbeikommen solle, um den Lehrvertrag zu unterschreiben. Und das tat sie dann auch: „Obwohl ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was ich da zu tun hatte. Aber wir haben doch immer gelernt, dass Arbeitslosigkeit das Schlimmste sei“.
Am 1.September fing sie in der Filiale am Alexanderplatz an. „Und da bin ich dann jeden Tag – neun Jahre lang – hingegangen. Zum Schluß war ich allerdings immer öfter krank geschrieben – über jeden Schnupfen habe ich mich gefreut. Es war eine total inhaltsleere Tätigkeit – nur Zeit absitzen, und auf die Uhr kucken und schier verzweifeln, weil die Minuten nicht verstreichen“.
Nach einigen Monaten wurde Ramona in eine Marzahner Filiale versetzt: „Die war noch halb ostisch: es gab nur Giro-, Sparkonten und Ratenkredite“. Zuerst lernte sie dort Auszüge einsortieren und dann Scheckhefte abstempeln. Die Kunden mußte sie an ihre Kolleginnen verweisen, da sie noch zu wenig vom Geschäft verstand. Aber ihre Kolleginnen wußten selber nicht richtig Bescheid – mit der über sie gekommenen kapitalistischen Wirtschaftsweise und der ganzen neuen Produktpalette der Sparkasse, denn im selben Jahr fusionierten die Westberliner mit den Ostberliner Sparkassen – zur Landesbank Berlin, die damit die Begrenzungen des öffentlich-rechtlichen Regionalprinzips der Sparkassenorganisation abstreifte. Außerdem wollte man auch über die Immobilienfinanzierungsgeschäfte hinausgehen und selbst in das Bauträgergeschäft samt Immobilienfonds einsteigen. In der Marzahner Filiale war 1990/91 schwer was los: „Da standen schon morgens um 8 über 100 Leute vor der Tür und warteten darauf, dass wir um 9 aufmachten“.
Zwei mal in der Woche mußte Ramona zur Berufsschule – die bald ebenfalls in den Westen verlegt wurde. Das traf dann auch für Ramona selbst zu, die in eine Kufürstendamm-Filiale versetzt wurde. Dort sortierte sie weiter Kontoauszüge ein. Außerdem fing sie an, sich durch die „Arbeitsanweisungen“, mit denen alle Bankvorgänge bis ins Kleinste geregelt werden, zu lesen: 14 dicke Aktenordner. „Und dann habe ich auch meine ersten Sparverträge – Termingelder, Kontoeröffnungen usw. – verkauft“. Ihre Gruppenleiterin im Servicebereich verbrachte ihre Tage damit, die Termingeldvorgänge zu verwalten: „Ich durfte ihr helfen – indem ich z.B. die Bestätigungsschreiben in Briefumschläge steckte. Weil ich ja noch Auszubildende war, las sie mir die diesbezügliche Arbeitsanweisung in voller Länge vor“.
Ramona hatte sich wunders was gedacht, was sie alles kennen mußte, um den Kunden etwas verkaufen zu können: „Im Prinzip waren es aber immer nur fünf Produkte: Sparkonten, Girokonten, Bausparverträge, Versicherungen und Investmentfonds“. Ihre Sicherheit stieg im Maße sie merkte, dass man gar keine große Ahnung darüber haben mußte. „Stattdessen haben wir manchmal über eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob jemand nun eine EC-Karte kriegt oder nicht“. Einmal kam ein Kunde zu ihr, der sein Konto auflösen wollte. Solche Leute sollte sie immer nach den Gründen fragen. Er sagte: „Sie kennen doch sicher die Sparkassenwerbung, in der ein Discjockey eine Platte auflegt? Darunter steht: ‚Würden Sie ihm etwa Ihre Kreditkarte geben? Wir schon!‘ Dieser Typ, das bin ich. Nur dass die Sparkasse mir nie eine Kreditkarte geben wollte. Deswegen wechsel ich jetzt die Bank“.
Immer wieder bekamen die Angestellten Post von der Personalabteilung: Absender war mal die Sparkasse, mal die Landesbank, mal die Bankgesellschaft Berlin. Ramona weiß bis heute nicht, wer ihr Arbeitgeber war. „Das Problem war auch, dass die Sparkassen eigentlich einen öffentlichen Auftrag hatten und haben: den kleinen Mann zum Sparen zu ermuntern und sein Geld zu verwalten. Indem man aber die Sparkasse mit allen möglichen Kreditinstituten unter einer Holding zusammengepackt und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hatte, waren wir irgendwann auch dazu da, Aktien unserer eigenen Firma anzubieten. Durch diese Fusionen wurde alles immer gewinnorientierter. Girokonten waren nur noch Peanuts. Ich bekam Anschisse, wenn ich einen Kunden, der ein Girokonto eröffnen wollte, eine halbe Stunde lang beraten – und ihm dabei nicht mindestens ein Sparbuch verkauft hatte“.
Werbung der Sparkasse von Arkansas: „Seit 1836 im Dienst unserer Kunden!“
Mit den Investmentfonds, von denen es hunderte gibt, war es folgendermaßen: „Wenn man einmal begriffen hatte, wie die aufgebaut sind und funktionieren, dann hat jeder von uns seine drei oder vier Favoriten im Dauerangebot gehabt, wobei man jedem Kunden das selbe erzählt hat. Man muß sich das so vorstellen, dass jeder Banker drei Platten im Kopf gehabt hat – über Giro- bzw. Sparkonten sowoe über Kredite und Investmentfonds, die er täglich mehrmals abgespult hat“.
Zwar versprach die Sparkasse immer mehr Dienst am Kunden, gleichzeitig wurden jedoch über die Einführung von Bankautomaten, Telefonbanking und Internetbanking – und mittels aggressiver Werbung – die Kunden geradezu genötigt, ihre Bankgeschäfte selbst bzw. zu Hause zu erledigen. Das hatte zur Folge, dass bald niemand mehr in die Filialen kam, „dem wir unsere individuelle Vermögensberatung angedeihen lassen konnten“.
Dagegen wurde jedoch ein tolles Mittel entwickelt: Die Angestellten bekamen Computerlisten aus der Zentrale mit den Daten von hunderten von Kunden – denen sie dann in der einen Woche telefonisch z.B. Bausparverträge verkaufen sollten. In der nächsten Woche war es ein anderes, angeblich wieder besonders auf die jeweiligen Kunden zugeschnittenes Produkt – z.B. Lebensversicherungen. „Mir war das peinlich und unangenehm, diese armen Menschen noch nach Feierabend zu Hause zu belästigen. Deswegen habe ich irgendwann die Listen einfach so ausgefüllt: ‚Kunde will nicht‘ oder ‚Kunde hat schon‘. Irgendwann hatte ich aber so gut wie gar keine realen Kunden mehr – und hatte nichts zu tun“.
Das war schon so in der Sparkassen-Filiale am Rüdesheimer Platz, wohin man Ramona inzwischen versetzt hatte. Sie bewarb sich deswegen für die neue Filiale am Potsdamer Platz in den dortigen „Arcaden“. „Aber da habe ich mich erst recht gelangweilt“. Es gab da die neue Funktion eines Empfangsmanagers: der hatte ein kleines Sitzpult – mit Schildchen und Laptop, auf dem Computerspiele liefen. Er mußte aber die ganze Zeit auf die piepsenden Automaten im Vorraum blicken. Hauptsächlich kamen Touristen rein, die nur mal kucken wollten. Weil die Öffnungszeiten länger als die Arbeitszeit waren, mußten die „Banker“ reihum den Empfangsmanager ablösen: „Das war der entwürdigendste Job, den wir da hatten. Man hatte nichts zu tun und wurde wie ein Affe im Zoo angegafft. Ich habe tatsächlich befürchtet, dass man mir da irgendwann ein Banane zustecken würde und mir deswegen ein Schild „Füttern verboten“ gekauft, das ich ans Stehpult gehängt habe. Mein Chef fand das jedoch nicht so lustig“.
Ramona arbeitete ansonsten im Servicebereich und dort hatten die Mitarbeiter Stehpulte. Wenn wirklich mal ein richtiger Kunde auftauchte, dann stürzten sofort drei oder vier Kollegen in der Hoffnung auf einen Gesprächspartner zu ihm hin. Meistens wurden sie jedoch enttäuscht, weil der Betreffende nur eine Überweisung abgeben wollte. „Meine verantwortungsvolle Aufgabe als Bankkauffrau bestand dann darin, mit diesem gelben Zettel vier Meter nach rechts zu laufen und ihn in den Hauspostkasten zu werfen, um anschließend die vier Meter zurück zu laufen und am Stehpult auf die nächste Überweisung zu warten. Nichts zu tun zu haben am Arbeitsplatz – das ist die Hölle. Viel schlimmer als Arbeitslosigkeit! Das Gehirn schläft ein, man kämpft mit der Müdigkeit und die Zeit steht still. Den ganzen Tag wartet man auf Feierabend. Ich habe in den neun Jahren Sparkasse echt an Wortschatz eingebüßt und vor allem an Lebensfreude“.
Ramona versuchte dagegen an zu gehen, indem sie die wenigen einfachen und doofen Tätigkeiten so gründlich und zeitaufwendig wie möglich erledigte. Einmal sortierte sie aus lauter Verzweiflung tagelang „irgendwelche Listen“ nach ihrem Datum. Das war zwar vorschriftsmäßig, aber völlig unwichtig. „Als ich damit fertig war, bin ich zum Friseur gegangen. Meiner Kollegin habe ich gesagt: ‚Ob ich hier dumm rumsitze oder 50 Meter weiter – das ist doch gehupft wie gesprungen‘.“
Zuletzt am Potsdamer Platz hatte sie gleitende Arbeitszeit, deswegen kam sie immer später. Ein Jahr lang sogar täglich eine Stunde, so daß sie schließlich ein „irres Defizit“ auf ihrem Zeitkonto hatte. Man konnte zwar theoretisch die Unterstunden abends abbauen, indem man länger blieb, aber da es ja nichts zu tun gab, gingen alle immer pünktlich nach Hause. Zunächst hatte es immer nur einen „langen Freitag“ – bis 18 Uhr – gegeben. Um sich diese Qual zu versüßen, feierte die Belegschaft oft anschließend noch ein bißchen. Gegen 22 Uhr wurde es plötzlich ruhig: die Klimaanlage hatte sich ausgeschaltet. „Da merkte man erst mal, in was für einem Lärm wir täglich arbeiten mußten: ein subtiles Dauerrauschen, das jede Gehirntätigkeit lähmte“. Dazu kam noch der Großraumbüro-Geruch: eine stinkige Mischung aus dem Kohlendioyxd-Ausstoß der Leute, ihren Parfüms und Aftershaves, Schweiß und Staub. Außerdem herrschte ein ständiger Sauerstoffmangel, denn man durfte die Fenster nicht öffnen wegen der Klimaanlage und die konnte man wiederum nicht selber einstellen. Im Sommer war sie auf ganz kalt gestellt, um die Kunden mit einer „angenehmen Kühle“ reinzulocken. Aber die Mitarbeiter an ihren Stehpulten mußten sich Strickjacken überziehen und froren trotzdem die ganze Zeit.
Werbung einer schleswig-holsteinischen Bank: „Unsere Mitarbeiter freuen sich über Ihren Besuch“
Einmal in der Woche fand eine Filialmitarbeiter-„Besprechung“ statt, die Ramona fatal an ihre alten Pionierversammlungen erinnerte: „Es wurde da alles besprochen, was jeder schon wußte. Beispielsweise wurden wir darüber belehrt, dass wir ab morgen alle ganz freundlich zu sein hatten – sowohl untereinander als auch zu den Kunden, weil wir nämlich jetzt ein modernes Dienstleistungsunternehmen seien. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man so etwas extra besprechen muß, jeder weiß doch, dass das Leben angenehmer ist, wenn man seinen Mitmenschen freundlich gegenübertritt – ob nun im Bus oder in einer Bank“.
Die Freundlichkeitsschulung mündete in eine regelrechte „Kampagne“ – mit internen Flyern und Infos, in denen die neuen „Leitlinien des Unternehmens Sparkasse“ den Mitarbeitern noch einmal verklickert wurden. Und das half auch: „Am nächsten Tag bemühte sich jeder, besonders freundlich zu sein – ‚Wie gehts?‘ ‚Wie stehts?‘ ‚Kann ich Ihnen irgendwie helfen?‘ Das ist aber schnell wieder eingeschlafen. Es war auch überzogen, wir sind doch vorher schon alle ganz freundlich miteinander umgegangen. Bis hin zu meinem letzten Chef, dem es z.B. fürchterlich leid tat, als er mich wegen meines ständigen Zuspätkommens zur Abmahnung bei der Personalabteilung melden mußte. Fast mußte ich ihn anschließend noch trösten“.
Ramona bekam eine Vorladung, wo man ihre Arbeitseinstellung besprechen wollte. Davon ausgehend, dass die Sparkasse sie nun endlich rausschmeißen würde – und ihr somit eine Abfindung zustehe, bemühte sie außerdem noch einen Vertreter des Personalrates dorthin. Die vier hochbezahlten Damen und Herren erklärten Ramona jedoch nur – mit erhobenem Zeigefinger, dass sie mit ihrem Verhalten den Betriebsablauf störe und dass sich das ändern müsse. Und nun möge sie wieder zurück in ihre Filiale fahren und weiter arbeiten.
„Dieser Gedanke erschreckte mich so, dass ich spontan selber kündigte. Man machte mir daraufhin einen sehr wohlwollenden Auflösungsvertrag – und zwei Tage später war ich endlich frei! Ein ganzes Jahr brauchte ich – in Arbeitslosigkeit – um nach diesen neun Sparkassenjahren wieder einigermaßen zu mir zu kommen, d.h. um die ganze Fremdbestimmtheit los zu werden. Dann immatrikulierte ich mich an einer Schule für Erwachsenenbildung. Hier traf ich einige andere ‚Banker‘, denen die Arbeit ebenfalls zu blöd geworden war. Um meine Ausbildung zu finanzieren, arbeite ich jetzt im Bordell ‚Pssst‘ von Felicitas. Dort prostituiere ich mich jedoch weit weniger als in der Sparkasse.“

Werbung der mongolischen Löwen-Bank: „Auf diese Steine können Sie bauen!“
(*) Die Banken-Werbung-Recherche besorgte Peter Grosse
(**) Das Kassierer-Porträt von Gabriele Goettle ist Teil einer taz-Serie von ihr über „Geld“, die gerade angefangen hat und in eine Buchveröffentlichung münden wird. Das Porträt der Bankerin gehört zu einer Interview-Serie von mir über Prostituierte. Ein erster Teil wurde bereits in dem Buch „WPP – Wölfe Partisanen Prostituierte“ veröffentlicht, ein weiterer kleinerer erscheint demnächst unter dem Titel „Sex und Geld“ in dem von Uli Röhm herausgegebenen Aufsatzband „Das große Buch vom Geld“.