
Diese Pylonen-Treppe dachte sich der Hausmeister der Gesamtschule Dülmen aus.
„Unser ganzer Erkenntnis-Apparat ist ein Abstraktions- und Simplifikations-Apparat – nicht auf Erkenntnis gerichtet, sondern auf Bemächtigung der Dinge …“ (F.Nietzsche)
Der Bremer Vulgärmarxist Gunnar Heinsohn sprach unlängst von einer „Eigentumswirtschaft“: In anderen Systemen, wie Stammesgemeinschaften und Adelsherrschaften, werde zwar auch produziert und konsumiert, aber nicht „gewirtschaftet“. Bildlich könne man sich den Besitz als Acker vorstellen und das Eigentum als den Zaun drum herum: „Allen Wirtschaftssystemen gemeinsam ist, dass in die Erde eingesät und abgeerntet, sprich: produziert wird. Gewirtschaftet aber wird allein mit dem Zaun, dessen Belastung und Verpfändung für Verschuldungszwecke einen späteren Verkauf der Ernte auf dem Markt erst ermöglicht beziehungsweise in den im Falle des Scheiterns vollstreckt wird.“
Ähnlich wie Heinsohn argumentierte dann auch der Fernsehphilosoph Peter Sloterdijk – beginnend mit einem J.J.Rousseau-Zitat: „Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: Das gehört mir!, und der Leute fand, die einfältig (simples) genug waren, ihm zu glauben, ist der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft (société civile).“ Sloterdijk folgerte daraus: „Demnach beginnt, was wir das ‚Wirtschaftsleben‘ nennen, mit der Fähigkeit, einen überzeugenden Zaun zu errichten und das eingehegte Terrain durch einen autoritativen Sprechakt unter die Verfügungsgewalt des Zaun-Herrn zu stellen. Der erste Nehmer ist der erste Unternehmer – der erste Bürger und der erste Dieb. Er wird unvermeidlich begleitet vom ersten Notar. Damit so etwas wie überschussträchtige Bodenbewirtschaftung in Gang kommt, ist eine vorökonomische ‚Tathandlung‘ vorauszusetzen, die in nichts anderem besteht als der rohen Geste der Inbesitznahme. Diese muss aber durch eine nachträgliche Legalisierung konsolidiert werden. Ohne die Zustimmung der ‚Einfältigen‘, die an die Gültigkeit der ersten Nahme glauben, ist ein Besitzrecht auf Dauer nicht zu halten. Was als Besetzung beginnt, wird durch den Grundbucheintrag besiegelt – zuerst die Willkür, dann ihre Absegnung in rechtsförmiger Anerkennung. Das Geheimnis der bürgerlichen Gesellschaft besteht folglich in der nachträglichen Heiligung der gewaltsamen Initiative. Es kommt nur darauf an, als Erster da zu sein, wenn es um den anfänglichen Raub geht, aus dem später der Rechtstitel wird. Wer hierbei zu spät kommt, den bestraft das Leben. Arm bleibt, wer auf der falschen Seite des Zauns existiert.“
Der französische Philosoph Michel Serres behauptet dagegen: „Rousseau irrt sich.“ (Ebenso Heinsohn und Sloterdijk): „Einen imaginären Akt [der Einzäunung] beschreibend, entscheidet Rousseau sich für eine konventionale Grundlage des Eigentumsrechts. Einige Jahrhunderte vor ihm hätte Livius im ersten Buch seiner Römischen Geschichte viel konkreter sagen können: ‚Der Erste, Romulus, der ein Stück Land mit einer Furche umgab, die er mit einer Pflugschar um Rom gezogen hatte und der sagte: Dies gehört mir – fand niemanden, der ihm glaubte, fand dagegen einen Bruder – einen Rivalen, einen Konkurrenten, der denselben Wunsch hegte – um sich ihm entgegenzustellen…Romulus tötete also Remus, der ihm gerade günstig in die Quere kam, und beeilte sich, ihn unter den Mauern der Stadt zu begraben, wodurch er genau deren Gründer, Eigentümer, Herrscher und König wurde.“ Serres sieht in dieser „Handlung“ ein „Naturrecht am Werk, dass dem Positiven Recht oder dem Konventionalrecht vorausgeht“ – denn die Markierung eines Territoriums mit Urin – z.B. durch einen Tiger, oder mit Gesang – z.B. durch eine Nachtigall hat die selbe Bedeutung wie das Einzäunen eines Grundstücks: „Weiß man, dass das Wort Frieden (paix) von dem Wort für Grenzmarkierung stammt, vom Pfahl (pieu), von diesem bestellten Pagus (Acker)?“ fragt er sich – in seinem Aufsatz „Das eigen(tliche) Übel“.
Der Verhaltensforscher Frans de Waal sieht dagegen dieses „Naturrecht“ (auf Aneignung und Eigentum), dessen Befriedung erst durch einen Pakt, den Hobbeschen „Vertrag“, gelingt, nicht hinter, sondern gerade vor uns: das „Gesetz des Dschungels“: Diesen Schluß „scheint die Primatenevolution zuzulassen. Es gab nie irgendein Chaos: Wir begannen mit einer kristallklaren hierarchischen Ordnung und fanden dann Möglichkeiten, sie zu nivellieren. Unsere Spezies hat einen Hang zum Subversiven.“ („Der Affe in uns“, S. 117)
Der holländische Evolutionsanhänger Frans de Waal folgert daraus eine interessante Revolutionstheorie: „Wenn die am unteren Ende der sozialen Leiter kollektiv eine Grenze ziehen und mit ernsthaften Konsequzenzen drohen, falls die am oberen Ende sie überschreiten, haben wir die Anfänge dessen, was in der Juristensprache ‚Verfassung‘ heißt.“ An diesem Punkt spätestens wird aus Natur Kultur, wenn man Thomas Hobbes folgt, der einst, um die englischen Bürgerkriege zu beenden, von der notwendigen Umwandlung der Wildnis in Zivilisation sprach. Dazu dachte er sich einen Nullpunkt aus, an dem die Bürger einen „Gesellschaftsvertrag“ mit dem Souverän eingehen, dem sie das Gewaltmonopol übertragen. Und dieser muß sie dafür schützen.
Einen solchen Nullpunkt gibt es nicht, meint jedoch der Philosoph und Tierrechts-Kämpfer, Mark Rowlands, denn „eine Frage, die sich Hobbes anscheinend nie stellte, ist folgende: „Wie können diejenigen, die wirklich rot an Zähnen und Klauen sind, an den Verhandlungstisch geholt werden?“ Diese Frage stellen sich die Wissenssoziologen mit ihrer „Akteur-Netzwerk-Theorie“ schon seit langem – und sie haben darin auch bereits verschiedene Vorschläge gemacht, Rowlands meint jedoch: Das wird nie geschehen, denn „Verträge können nur zwischen zivilisierten Menschen geschlossen werden. Also kann der Vertrag nicht die Zivilisation bewirkt haben. Am Anfang stand immer Gewalt und Machtkampf.“ Der Philosoph, der mit einem Wolf und zwei Schäferhunden zusammenlebte, ist darüber zu einem Misanthropen geworden. Das hindert ihn jedoch zum Glück nicht, weiter seine „Grundidee“ zu verfolgen, „dass man einen Weg finden müsse, die Tiere in den Gesellschaftsvertrag mit einzubeziehen, indem man den Vertrag fairer gestaltet.“ Für den Harvard-Philosophen John Rawls war die ursprüngliche Vertragsgestaltung bereits dann fair, wenn die Partner nicht mehr wüßten, als dass sie Menschen seien und in der Lage, rational zu denken. Rowlands hielt dem inzwischen verstorbenen Rawls seinerzeit entgegen, „dass auch solche Kenntnisse ausgeschlossen werden müssten, wenn der Vertrag wahrhaft fair sein solle.“ Und sowieso sei „der Vertrag eine Erfindung von Primaten für Primaten.“ Voller Gewinn-und-Verlust-Kalkulationen, falschen Bündnissen und Investitionsüberlegungen.
Der Primaten-Forscher Frans de Waal würde Rowlands da zustimmen, für Bonobos gilt das seiner Meinung aber nicht: Sie „kennen nicht die sich ständig umschichtenden, opportunistischen Allianzen, die ein System aufbrechen können“ – im Gegensatz z.B. zu den Schimpansen, die dafür weitaus unfriedlicher, um nicht zu sagen: unglücklicher, zusammenleben. Insgesamt beobachtete er jedoch im Tierreich – wie vor ihm auch schon Kropotkin – einen durchgehenden Hang zu Kooperation und Empathie. Zwar werde im Abendland „unsere egoistische Seite als irgendwie authentischer als unsere soziale hingestellt,“ aber dem sei nicht so. „Traditionell wird darauf mit einem ‚Vertrag‘ geantwortet“ – also „‚durch eine Übereinkunft‘, die ‚künstlich‘ sei, wie Thomas Hobbes es formulierte, hätten sie ihr Zusammenleben geregelt.“ Dessen Credo „Der Mensch ist des Menschen Wolf“ fasse diese „asoziale Vision“ zusammen. Nicht nur wir werden dadurch „falsch dargestellt, sondern auch einer der geselligsten und loyalsten Kooperateure im Tierreich beleidigt: der Wolf…An Rivalitäten mangelt es ihm nicht, aber Wölfe können es sich nicht leisten, ihnen freien Lauf zu lassen. Loyalität und Vertrauen stehen an erster Stelle.“
Frans de Waal „erkennt daher das Gegenteil des traditionellen Bildes einer Natur, die ‚blutrot an Zähnen und Klauen‘ ist, für die das Individuum zuerst kommt und die Gesellschaft etwas Nachgeordnetes ist. Jedes Tier findet seine eigene Balance zwischen beidem. Einige verhalten sich relativ garstig, andere relativ nett…Die Leute glauben oft, in der Natur bedeutet Schwäche automatisch Eliminierung – ein Prinzip, das zum ‚Gesetz des Dschungels‘ aufgebauscht wird-, in Wirklichkeit aber erfreuen sich soziale Tiere beachtlicher Toleranz und Unterstützung. Was wäre sonst der Sinn des Zusammenlebens?“ Demnach ist alles Vertragsrecht nichts anderes als Dschungelgesetz, das zunehmend dschungeliger wird, während der wirkliche Urwald langsam verschwindet.

New York Pylon
…Oder was wäre sonst der Sinn auch des Zusammenkonferierens? Auf einer Evolutions-Tagung ging es Ende 2008 – in anbetracht des „Darwin-Jahres“ – quasi um Form und Inhalt des selben. Von der dreitägigen Veranstaltung im „Aktionssaal“ des der Kunst überlassenen „Hamburger Bahnhofs“ datenerfasste ich bis jetzt leider nur den ersten Tag:
Donnerstag. Die Kulturwissenschaftlerin und Leiterin des Berliner „Zentrums für Literatur- und Kulturforschung“ Sigrid Weigel gab zu Beginn der ZfL-Jahrestagung „Kultur der Evolution – Evolution der Kultur“ das Stichwort: „Darwin-Industrie“. Kurz vor dem „Darwin-Jahr 2009“ läuft diese Industrie nun auf Hochtouren. Die meisten Bücher sind Darwin-Biographien, der Evolutionsbegriff wird geradezu inflationär verwendet – als identisch mit „Entwicklung“, aber es gibt auch einige kritische Autoren – wie z.B. Joachim Bauers „Abschied von Darwin“.
Hier knüpfte der Botaniker und Wissenschaftshistoriker Ekkehard Höxtermann mit seinem Vortrag an: Das Motiv, der Motor des Fortschritts, war bei Darwin die „Konkurrenz“. Es gibt aber auch noch eine andere Biologie: Sie erforscht die „Zusammenarbeit“ – innerhalb der Art und zwischen den Arten. Diese – Symbioseforschung – begann mit den Botanikern im 19. Jahrhundert und befaßte sich zuvörderst mit den Flechten: einer Symbiose aus Algen und Pilzen. Dem Begriff der „Symbiose“ näherten die Biologen sich über die Kultur-Begriffe Homobium, Mutualismus, Kommensualismus und Genossenschaft. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begriffen russische Botaniker die Symbiontentheorie bereits als „antidarwinistisch“. Es kamen die ersten Hypothesen auf, dass auch einige Teile in den Zellen – Chloroplasten, Mitochondrien und Zellkerne – ursprünglich eigenständige Lebewesen waren, die einverleibt wurden und nun „Organellen“ sind. Die Endosymbiotentheorie geriet ab den Zwanzigerjahren in Vergessenheit. Erst Ende der Sechzigerjahre wurde sie wiederbelebt – als Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft mehrerer Arten. Aber noch in den Siebzigerjahren kam es in der DDR-Biologie, auf Tagungen in Leipzig z.B., zu starken Unmutsäußerungen, wenn jemand das Wort „Symbiose“ ins Spiel brachte. Ob dies mit der Ablehnung der „proletarischen Biologie“ von Mitschurin und Lyssenko durch den ehemaligen Nazi-Eugeniker Hans Stubbe, der es damals zum einflußreichsten DDR-Genetiker gebracht hatte, zusammenhing, blieb unerörtert.
Sigrid Weigel brachte stattdessen in ihrem Beitrag „Epigenetische Herausforderungen an die Evolutionstheorie“ mit dem Begriff „Epigenese“ eine Art von Vermittlung „zwischen Darwinismus und Lamarckismus“ in die Diskussion. Sie knüpfte dabei an eine frühere ZfL-Tagung an, die sich vor allem mit diesem Begriff befaßt hatte. Ihr Thema lautete: „Zwischen Vererbung erworbener Eigenschaften und Epigenetik – Die Renaissance epigenetischer Forschungen in der Biomedizin“. Sie fand 2006 in der Berliner Ruine des „Rudolf-Virchow-Hörsaals“ statt. Die israelische Biologin Eva Jablonka hielt dazu den wichtigsten Vortrag, wobei sie die Ergebnisse ihrer Ratten-Experimente referierte. In der Vorankündigung des ZfL hatte es dazu geheißen:
„Eine der fundamentalen Figurationen der modernen Kultur ist die Unterscheidung zwischen Erworbenem und Ererbtem – eine Unterscheidung, die nicht erst mit der biologischen Kontroverse um vererbte und erworbene Eigenschaften auftrat, sondern schon um 1800 in verschiedenen Wissensgebieten thematisiert wurde. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Differenzierung zwischen erworbenen und vererbten Eigenschaften erstmals systematisch vorgenommen und dominierte seitdem die biologische, soziale und kulturelle Vorstellungswelt – oft schematisch tradiert unter dem Titel eines Streits zwischen Lamarckismus und Darwinismus. Mit dem Verdikt gegen den sogenannten Lamarckismus war die Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften im genetischen Zeitalter weitgehend tabuisiert. Eine erneute Aktualität und Forschungsbrisanz gewann das Thema erst jüngst mit der Wiederentdeckung komplexer ‚epigenetischer Erbprozesse‘ durch die Lebenswissenschaften – d.h. solcher Vererbungsprozesse, die nicht auf die Übertragung von DNA zurückgeführt werden können, sondern dieser nachgelagert sind, also epi-genetische Phänomene betreffen. Die Tagung zielt darauf, die Genese der so eminenten Differenzierung zwischen ‚vererbt‘ und ‚erworben‘ zu erörtern und die Wege, auf denen sie zu einer der zentralen epistemischen Paradigmen des abendländischen Denkens avancierte, zu erkunden.“
Auf der jetzigen Jahrestagung des ZfL bezeichnete Sigrid Weigel einerseits die Epigenetik als „Einfallstor für Kultur“ (also als ein Scharnier zwischen Natur und Kultur). Andererseits sprach sie von einer „Kulturellen Evolution“, in der die Gegenstände wie Arten behandelt werden. Sie beabsichtigte damit, das Dogma Lamarckismus versus Darwinismus in der „postgenetischen Epoche“ zu überwinden. Was sich in der anschließenden Diskussion zu der Vermutung verdichtete: „Wenn Gene nicht mehr ‚en vogue‘ sind, sind es auch Symbiosen nicht mehr.“

Hier versagte die Pylonen-Absperrung trotz Querverbindungen
Dem folgte ein äußerst konservativer Vortrag des Wiener Evolutionsbiologen Franz Wuketits über die bloß vordergründig interessant klingende These: „Es überleben nicht die Tauglichsten oder Tüchtigsten, sondern die Feigsten“. Für die Individuen gelte es, „so lange wie möglich am Leben zu bleiben“ und dazu „verbessert sich die Natur fortlaufend“. Der Fortschritt bestehe darin, dass „daraus immer höhere Lebewesen hervorgehen“ (Wuketits ebenso konservativer Darwinismus-Kollege Richard Dawkins hatte demgegenüber bereits eingewandt: „Spreche in diesem Zusammenhang nie von ‚höher‘ oder ’niedriger‘!“) Wuketits weiter: „Der Wettbewerb ums Dasein ist immer innerartlich – und Feiglinge haben dabei bessere Chancen als die Mutigen.“ Dazu zählte er 8 Strategien auf:
1. Flucht als beste Verteidigung
2. Tarnen
3. Täuschen (so tun als ob)
4. Verstecken
5. Taktiken entwickeln
6. Zur List greifen (der Kriegstheoretiker Clausewitz verglich die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“)
7. Warnen
8. Kooperieren („die innerartliche Kooperation widerspricht keineswegs der Konkurrenz – im Gegenteil,“ so Wuketits, der sich damit wieder im Einklang mit Dawkins‘ „Egoistischem Gen“ befand).
In Summa entwarf er damit jedoch die Eckpunkte eines „Postheroischen Life-Managements“, das eher an ein Bonmot des Soziologen Dirk Baecker erinnerte als an den „Ultradarwinisten“ Dawkins. Diesem fühlte sich dafür der nächste Referent, der Wissenschaftshistoriker Peter Bowler aus Belfast – mit seinem Vortrag „Do we need a Non-Darwinian Industry?“ – um so mehr verpflichtet. Schon allein deswegen, weil er wie Dawkins vor allem gegen die „Kreationisten“ polemisierte, obwohl er ihren Argumenten eigentlich keine Chance gab: „Ihnen fehlt ein Star wie Darwin!“.
Sein Vortrag richtete sich, wie er sagte, „primär an Englisch denkende Wissenschaftler“. Und in der Tat ist der Kreationismus (und ähnliche prä-darwinistische „Cluster“) hierzulande überhaupt kein Thema. Wenn wir hier von „Anti-Darwinismus“ sprechen, und das tat der Kulturwissenschaftler Peter Berz in der anschließenden Diskussion, dann meinen wir damit verstreute, verfemte und unsystematische biologische Forschungen – Nietzsches antidarwinistische Aphorismen, Heideggers Äußerungen über Bienen, Rosa Luxemburgs und Ernst Tollers Studien im Gefängnis über Blaumeisen und Schwalben, Pawel Florenskis Forschungen über Algen, Eckermanns Vogelerfahrungen, Paul Kammerers Salamander- und Grottenolm-Experimente, Roger Caillois‘ Aufsätze über Mimikry und Mimese, Vilem Flussers und Louis Becs Spekulationen über das Weltbild einer Tiefseekrake… aber auch die Erfahrungen von Tierpflegern, Tierzüchtern und Hobby-Aquarianern z.B..
Von solchen anti-darwinistischen Biologien wollte der Referent Bowler jedoch nichts wissen: Sein Vortrag bezog sich nur auf „anti-darwinistische Evolutions-Strategien“. Dazu erwähnte jemand in der Diskussion einen Aufsatz von Gabriel Finkelstein: „Why Darwin was English“. Darüber hatten auch schon Marx und Engels gewitzelt: Mit seinem Konkurrenzbegriff als grundlegendes Prinzip der Evolution habe Darwin bloß das üble Verhalten der englischen Bourgeoisie auf die Natur projiziert (also ihre Vertragsgestaltung naturalisiert gleichsam verschicksalt), meinten sie – und mit ihnen dann auch vor allem russische Wissenschaftler, wie der Biologiehistoriker Torsten Rütting schreibt: „Viele der russischen Intellektuellen verwarfen in Übereinstimmung mit Marx und Engels, aber auch unabhängig von ihnen, die Idee von der Höherentwicklung durch Konkurrenzkampf, die Darwin von dem englischen Nationalökonom Thomas Malthus übernommen hatte“. Malthus glaubte, bewiesen zu haben, dass das rapide Bevölkerungswachstum verbunden mit einem ständig zunehmenden Mangel an Nahrung quasi automatisch eine natürliche Auslese der Besten gewährleiste. Während jedoch Marx und Engels davon ausgingen, dass Darwin Malthus überwunden habe, indem er dessen Gesetz auch in der Tier- und Pflanzenwelt für gültig erklärte, hielt man in Russland das ganze Prinzip der Konkurrenz eher für ein englisches Insel-Phänomen, das in den unterbesiedelten russischen Weiten keine Gültigkeit habe. In dieser Einschätzung war sich noch der revolutionäre Narodnik Michailowski mit dem ultrakonservativen Oberprokuror Pobjedonoszew einig: Beide taten diesen Aspekt des Darwinismus als eine „händlerische Faustregel“ ab, die „unsere [russische] Seele nicht annehmen“ könne.
Anfänglich gab es nebenbeibemerkt auch einen starken Widerstand von englischen Medizinern gegen das von Darwin postulierte Evolutionsprinzip des „Survival of the Fittest“: Sie wollten z.B. das Elend der Armen anders behandelt wissen als den Untergang der Elenden bloß als biologisch notwendig zu begreifen. Das gilt noch heute: „Derzeit laufen viele Untersuchungen, die meisten davon in medizinisch ausgerichteten Labors, in denen die Wissenschaftler nichts mit Evolution zu tun haben. Ich trage vor allem die Befunde zusammen,“ schreibt die US-Mikrobiologin Lynn Margulis in ihrem Buch „Die andere Evolution“, in dem sie vor allem Mikroorganismen und ihre Symbiosen diskutiert. Darüber hielt sie dann auch einen Power-Point-Vortrag auf der ZfL-Tagung im Hamburger Bahnhof. In dem sie einen Bogen schlug – von ihrer jahrzehntelangen Bakterienforschung, die in der Endosymbiontentheorie gipfelte, bis zur Gaia-Hypothese, die von Wechselbeziehungen zwischen allen Lebewesen, dem Planeten Erde und der Sonne als Energiequelle ausgeht. Dabei berührte sie u.a. auch ein Arbeitsergebnis, das auf einem Treffen im Berliner Naturkundemuseum am 1.Mai 2008 zustandegekommen war, an dem neben ihr sowie einigen US-Aidsforschern und Mikrobiologen aus Kanada und Norwegen auch der Geomikrobiologe Wolfgang E. Krumbein von der Universität Oldenburg teilnahmen. Es ging dabei um kugelförmige Cysten (round bodies) von Spirochäten (korkenzieherförmige Bakterien), die in unserem Körper das Immunsystem angreifen und weitgehend resistent gegen Antibiotika sind. Die obigen Autoren machen sie für die Entstehung von Syphilis, Lyme-Borreliose und Aids verantwortlich, wobei sie sich im wesentlichen auf die Forschung der russischen Mikrobiologin Galina Dubinina stützen. (Ein „Positions-Papier“ darüber erschien in der Januar-Ausgabe der Zeitschrift „Symbiosis“, die vom „Teleosis Institute“ in Cambridge, Massachusetts herausgegeben wird, einer Organisation ökologisch orientierter Mediziner). Zuvor hatte Lynn Margulis bereits in der Zeitschrift „Daedalus“ des Massachusetts Institute of Technology – MIT – einen längeren Text dazu veröffentlicht – mit dem Titel: „On Syphilis and Nietzsche’s Madness: Spirochetes Awake!“).

Die Pylonen-Slalomstrecke hinter Dresden
P.S.: Kurz nach dieser Jahrestagung des ZfL verließ der Biosoph Cord Riechelmann grollend das Redaktionstrio für den Sammelband „Anti-Darwin“, um stattdessen alleine ein „Darwin-Buch“ zu veröffentlichen. Der Vorwurf an uns Zurückgebliebene lautete: Wir hätten Darwin nicht gelesen und wenn, dann nicht richtig. Wie im übrigen die meisten, die sich positiv oder negativ auf Darwin beziehen. Sein demnächst im Merve-Verlag erscheinendes Buch heißt dann auch: „Ein Gerücht namens Darwin“. Kürzlich verließ auch noch Peter Berz die Redaktion – und übernahm als Urlaubsvertretung eine Professur in Wien, wo er sich nun mit Jacques Monod befaßt. Was hat es damit nun wieder auf sich?

Pylonenkette auf der Rennstrecke Paris-Texas
Michel Foucault unterschied den „universellen Intellektuellen“, dessen Ursprünge er bei Voltaire ansetzte und der vor allem von gebildeten Jouristen verkörpert wurde, vom „spezifischen Intellektuellen“, der in seiner besonderen Stellung zur Macht, durch seine berufliche Tätigkeit selbst zum moralischen Widerstand gelangt. Das „Scharnier“ zwischen den beiden Intellektuellentypen war für ihn der Atomphysiker Robert Oppenheimer.
Die Rolle eines „Scharniers“ zwischen den im und wegen des Kalten Krieges entwickelten neuen zur Macht drängenden Wissenschafts-Paradigmen in Ost und West spielte dann einige Jahre lang der französische Genetiker und spätere Nobelpreisträger Jacques Monod. Als junger Wissenschaftler am Pariser Pasteur-Institut war er zunächst Mitglied der Kommunistischen Partei und überzeugter Lamarckist gewesen. 1943 kam er mit dem Biologen und Marxisten Marcel Prenant in Kontakt, der damals Leiter der Widerstandsgruppe FTP (Francs-tireurs et partisans) war. Er delegierte Monod zu den Streitkräften des Freien Frankreichs, wo dieser dann im Range eines Majors dem Stab des Generals de Tassigny angehörte. Nach dem Krieg kehrte Monod an das Pariser Institut zurück, wo er sich in der Folgezeit vom „Lamarxismus“ abwandte und mehr und mehr zu einem militanten Neodarwinisten wurde. Die Biologiehistorikerin Lily E. Kay merkt dazu an: „Eine Verbindung mit der KPF, die in den frühen Fünfziger Jahren in Frankreich sehr präsent war, schien eher schädlich für französische Wissenschaftler, die von amerikanischen Behörden unter der Schirmherrschaft des Marshall-Plans unterstützt wurden…Noch nachteiliger war eine solche Verbindung auf dem Höhepunkt der Hexenjagd des McCarthyismus.“ Denn sie erschwerte es z.B. Monod, für Einladungen an amerikanische Forschungsinstitute ein US-Visa zu bekommen.“ Nachdem er sich jedoch vom sowjetischen Lyssenkoismus und der KP distanziert hatte, finanzierte ihm die Rockefeller-Stiftung sogar ein eigenes Labor für Molekularforschung im Pasteur-Institut, woraufhin die von De Gaulle eingerichtete „Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique“ – „eine Institution zur militärischen Mobilmachung der Wissenschaft im Kalten Krieg – die ‚Molekularbiologie‘ als Speerspitze einer künftigen Wissenschaft und Biotechnologie“ anerkannte, wie Lily E. Kay hinzufügt. Frankreich war damit auch in seinem Welt- und Menschenbild in das westliche Verteidigungsbündnis eingebunden, wie es damals hieß. Jacques Monod wurde 1971 zum Direktor des „Institut Pasteur“ berufen. Während dieser Jahre entwickelte er zusammen mit François Jacob das Operon-Modell. Mit diesem wird erklärt, wie die Aktivität von Genen an- oder abgeschaltet werden kann. 1965 erhielt er dafür gemeinsam mit François Jacob und André Lwoff den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Pylonen, die Polizisten den Rücken freihalten
Als Monod 1967 seine Antrittsvorlesung am Collège de France hielt, arbeitete Louis Althusser die darin implizit und explizit enthaltene „Weltanschauung“ in seiner ebenfalls 1967 gehaltenen „Philosophievorlesung für Wissenschaftler“ an der Ecole Normale Supérieure heraus. Diese Vorlesung wurde 1985 auf Deutsch veröffentlicht – unter dem Titel „Philosophie und spontane Philosophie der Wissenschaftler“. Zehn Jahre zuvor hatte Althussers Schüler Dominique Lecourt bereits eine Analyse der proletarischen Biologie und des Scheiterns der Ideen des Präsidenten der Akademie für Landwirtschaften in der UDSSR Trofim Lyssenko veröffentlicht – mit einem Vorwort von Althusser. Lyssenkos Ideengebäude, mit dem er seine durchaus erfolgreichen landwirtschaftlichen „Techniken“ theoretisch begründete, bezeichnete Lecourt darin als „Spontane Philosophie eines Gärtners“.
Über das Weltbild des Lyssenko-Abtrünnigen Monod schrieb Louis Althusser: Zwar habe dieser den „materialistischen Inhalt“ beibehalten, „indem er den Mechanizismus und den Vitalismus ausschaltete, und indem er formulierte, dass es keine ‚belebte Materie‘, sondern nur lebende System gibt und indem er das DNS als den ‚physischen Träger‘ dieser lebenden Systeme kennzeichnete. Aber sobald Monod des Reich der Biologie verläßt, d.h. den Bereich dessen, was er mit einem bereits verdächtigen Begriff als ‚Biosphäre‘ (in der Terminologie Teilhards) bezeichnet, um über das zu sprechen, was er mit einem noch verdächtigeren Begriff als ‚Noospähre‘ (in der Terminologie Teilhards) bezeichnet, verkehrt er die materialistische Tendenz in eine idealistische und sogar spiritualistische“ – indem er die Begriffe und Gesetze seiner „Biosphäre“ mechanistisch auf ein ganz anderes „Realobjekt“ projiziert – „auf die menschlichen Gesellschaften“. Die beiden „Sphären“ stehen für Monod in einer Art Basis-Überbau-Verhältnis, in dem noch die Marxsche Begrifflichkeit von Sein und Bewußtsein mitschwingt. In diesem Zusammenhang wünscht sich Monod „das Kommen eines ganz großen Geistes herbei, ‚der als Gegenstück zum Werk Darwins eine Naturgeschichte der Selektion der Ideen zu schreiben weiß‘.“
Über Monods zentralen Begriff des „Zufalls“ (sein 1972 erschienenes Hauptwerk hieß dann „Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie“) schreibt Althusser: „Innerhalb der Biologie bildet der Zufall für Monod gewissermaßen das genaue Anzeichen für die Bedingungen der Möglichkeit der Emergenz [das Auftreten des Lebens]. Aber wir müssen feststellen, dass Monod denselben Begriff des Zufalls beibehält, wenn er von der Biologie zur Geschichte übergeht, nämlich zur Noosphäre.“

thailändischer Poller-Pylon-Hybrid
Diese „biologistische Theorie der Geschichte“, dieser „Geschichtsdarwinismus“ – ist Ausdruck seiner Kapitulation vor dem (US-)Kapital, das seiner Meinung nach auf dem Feld der „Ideen“ genauso wirkt wie die „natürliche Selektion“. Weil er die „Wahrheit“ nicht als geschichtlich bedingt und zeitgebunden begreift, reduziert sich sein Forschungsideal auf eine „Ethik der Erkenntnis“. Und weil er die auf dem Klassenkampf beruhende „marxistische Moral“ ablehnt, setzt er stattdessen auf eine „subjektive, aristokratisch-intellektuelle Moral“, wobei er zwar die „religiöse Weltanschauung“ bekämpft, sich von der „marxistischen“ jedoch nur abgrenzt – „ohne sie abschaffen zu wollen“. Noch mal: Um der „Entfremdung der modernen Welt“ entgegentreten zu können, setzt Monod statt auf den Klassenkampf als Motor der Geschichte nun auf die „Entwicklung der Erkenntnis“ als „Motor der modernen Geschichte“. Dazu abschließend noch ein Zitat aus seiner Antrittvorlesung: „Das höchste Gut innerhalb der Ethik der Erkenntnis – ist die objektive Erkenntnis selbst“.
In Monods Fach, der Genetik, ist das heute allein die verwertbare, d.h. die profitable, Mehrwert schaffende „Erkenntnis“. „Die Problematik rund um den Ethikbegriff ist jetzt dreissig Jahre nach Monods ‚Zufall und Notwendigkeit‘ aktueller den je,“ schreibt der US-Internetversandhändler „amazon“ über die Neuauflage seines Buches.

süddeutsche Poller-Pylon-Koexistenz

englische Poller-Pylon-Kooperation (bei Regen)

indischer Handmade-Pylon mit Rätselaufgabe.
Alle Photos: Peter Grosse
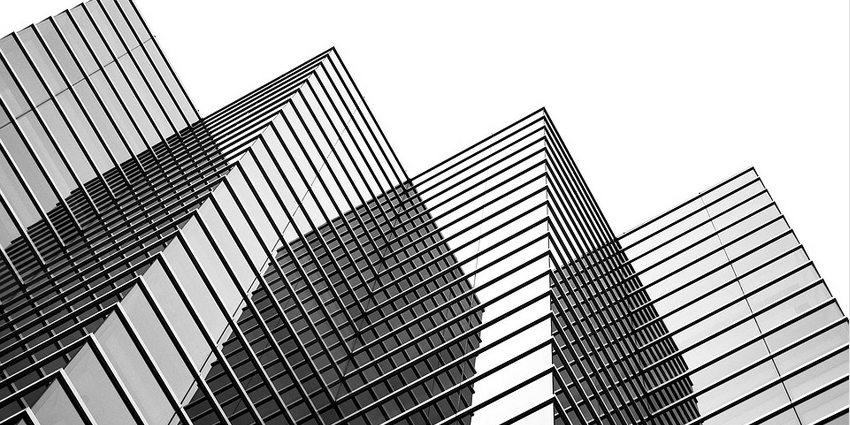



Die „Sloterdijk-Debatte“ geht immer weiter – heute hat sich Thomas Wagner angenehm unaufgeregt auf zwei Seiten mit dem reaktionären Weltbild des TV-Philosophen befaßt. Wagner thematisiert dort u.a. Sloterdijks Verwendung des von Marcel Mauss stammenden Begriffs der Gabe, des Gabentauschs:
Sloterdijks Ur- und Vorbild für eine gelungene Verausgabung der Reichen zugunsten der Armen ist der indianische Potlatsch der amerikanischen Nordwestküste. Dieses rituelle Fest mit Geschenkeverteilung hatte schon der Kritik des französischen Gelehrten Georges Bataille (1897–1962) an der modernen Bourgeoisie Pate gestanden. Er warf ihr vor, sie würden sich ihrer Verpflichtung zur Verausgabung verweigern.
Bataille las vom Potlatsch zuerst bei dem französischen Soziologen Marcel Mauss (1872–1950). Dabei wußte er allerdings nicht, daß es sich bei dem von Mauss in dem berühmten Essay »Die Gabe« (Frankfurt/Main 1990) beschriebenen Modell des Potlatsch um eine bereits durch die Folgen der kolonialen Landnahme, Bevölkerungsschwund durch Krankheiten und Einführung der Geldökonomie konkurrenzökonomisch verzerrte Form einer vergleichsweise egalitären Ursprungsversion dieser Institution handelte.
Noch heute kann bei sogenannten Naturvölkern überall auf dem Globus beobachtet werden, daß die Funktion der Gabe nicht darin besteht, daß die Reichen den Armen etwas abgeben, sondern darin, die Entstehung von dauerhaftem individuellen Reichtum zu verhindern. Ökonomisch Erfolgreiche, die nicht alles teilen, was sie haben, werden in diesen Gesellschaften sozial geächtet.2 Sloterdijk sieht die Bedeutung der durch die Brille von Bataille interpretierten »Gabe« dagegen darin, »den Kapitalismus zu spalten, um den radikalsten Gegensatz zu ihm – und den einzig fruchtbaren – aus ihm selbst zu schaffen, ganz anders, als die klassische, vom Miserabilismus überwältigte Linke es sich träumen ließ« (»Zorn und Zeit«, S. 55).
Warum die Spendentätigkeit der Reichen den Kapitalismus aber »spalten« soll, bleibt Sloterdijks Geheimnis. Denn statt eine Alternative zur Profitakkumulation darzustellen, hat sie diese zur Voraussetzung: Ohne Microsoft ist auch keine Bill & Melinda Gates Foundation vorstellbar. Sloterdijk geht es eben nicht um eine »transkapitalistische Ökonomie« (ebd., S. 52), sondern um eine Privatisierung der Wohlfahrt nach US-amerikanischem Vorbild. Und welche desaströsen Folgen das für die Armen hat, kann am Beispiel der USA ausgiebig studiert werden. Dort war der Ausbau des Stiftungs- und Spendenwesens ja gerade mit einer Schwächung der wohlfahrtsstaatlichen Umverteilung verbunden.