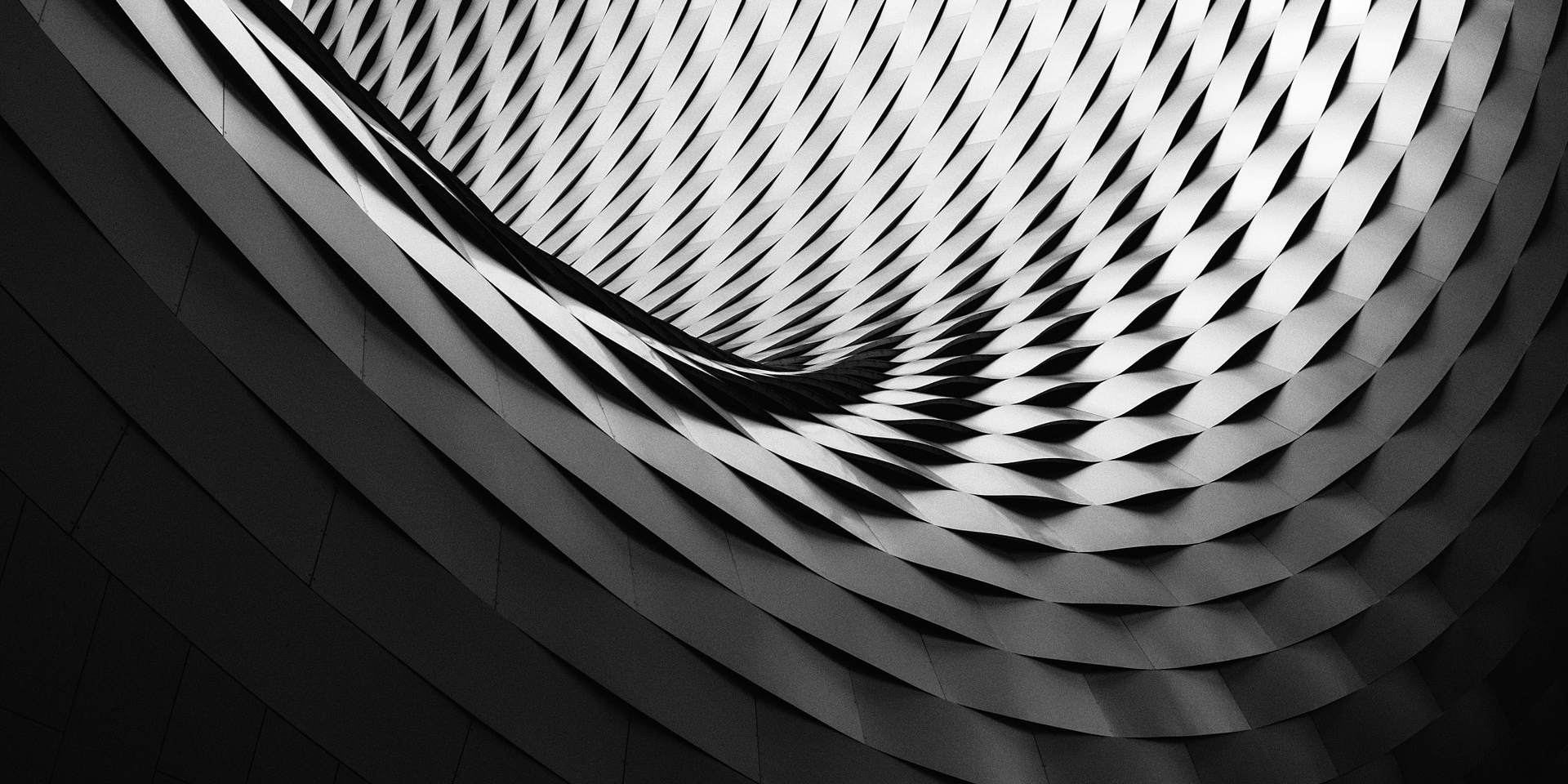Früher gehörte dem die Welt, der ein gutes Pferd und eine Stunde Vorsprung hatte.

Das ist er – Jan Zischka. Das größte Reiterdenkmal der Welt.
Fortsetzung 8. November
Wir müssen die Straße entlang gehen. Bei jedem Auto fuchtele ich erregt mit der Taschenlampe. Eines fährt Leinchen trotzdem beinahe in den Arsch. Das Auto schlenkert und schleudert, die Reifen quietschen, die Straße ist naß. Leinchen geht seelenruhig weiter, während ich neben ihr fast eine Herzattacke bekomme. Wir gehen und gehen und nirgendwo eine Pension oder ein Bauernhof. Ein paar Bauernhöfe, die ich dann endlich finde, haben keinen Platz. Es fängt fürchterlich an zu regnen. Warum sind wir auch noch auf der Straße? Bei einem weiteren Hof frage ich entschiedener, lasse mich nicht so schnell abwimmeln. „Sie können sich doch ausweisen?“ Er will mich also nicht partout abwimmeln. „Ich muß erst meine Frau fragen.“ Die sagt bestimmt nein, denke ich. „Das ist eine Zumutung! sagt meine Frau. Na, kommen sie man mit in den Stall.“
Drinnen im Stall ist er sehr freundlich und wir unterhalten uns noch eine Weile. Er erzählt mir sein großes Problem: Keines von seinen Kindern will den Hof später mal übernehmen. Das macht ihn mutlos. Er geht dann wieder ins Haus zurück. Ich mache dem Pferd und mir ein Strohbett. Sie ist todmüde. Schläft stehenden Hufes ein. Ich sitze auf meinem Strohbett neben ihr und schwitze in dem warmen Stall.
9. November
Jetzt schreibe ich bei Taschenlampenbeleuchtung in einer Scheune, die auf einer Wiese steht, die zu einem Reitstall gehört – gleich bei Remagen, direkt am Rhein. Der Weg bis hierher heute war wieder voller Überraschungen. Morgens bei dem Bauern gut gefrühstückt, ihm beim Ausmisten geholfen, dann los. (Es waren übrigens die ersten Bauern, die ich getroffen habe, die beim Essen gebetet haben.) Wir sind immer auf der Landstraße gegangen – durch Niederbreitbach, einen Umweg über Bad Hönningen. Ich habe mich nicht auf Kompaß und Sonne verlassen, sondern immer die Leute gefragt und prompt haben sie mich auch auf einen Umweg nach Linz geschickt. Von Bad Hönningen nach Linz am Rhein entlang, der Fußweg gleich neben den Eisenbahngleisen, gleich neben den Weinbergen – ein paar Schlösser und Burgruinen. Ansonsten Züge, Lastwagen und Binnenschiffe. In einem kleinen Schrebergarten arbeitet ein alter Mann. Er schaut auf, als wir bei ihm vorbeikommen. Ich sage: „Können Sie mir nicht ein paar Karotten geben für das Pferd?“ Er gibt sie mir. Unwillig.
In einem Vorgarten in Linz spielen zwei Kinder. Das eine schaut auf, kommt an den Zaun gelaufen und sagt: „So was?! Gerade haben wir Pferd gespielt und jetzt kommt eins vorbei.“ Bei der ersten Eisenbahn, die plötzlich neben ihr auftauchte, fielen Leinchen fast die Augen aus dem Kopf, aber dann war auch das klar. Eine neue Erfahrung. Dann die Fähre über den Rhein. Ich bekämpfe Leinchens aufkommende Panik erfolgreich mit Zucker. Der Fährmann unterhält sich mit mir. Ein junger Typ mit Bart. Drüben will ich sofort nach Remagen weiter gehen – zu Heinz Erwer, aber auf der Rheinpromenade entdecke ich eine Reithalle und meine wunden Füße machen sich bemerkbar. Leinchen hält zum ersten Mal besser aus als ich. Überhaupt kommt sie langsam in Wanderlaune.
Der Reitstall ist besetzt, d.h. alle Boxen. Aber ein älterer Mann, der dort arbeitet, zeigt mir eine Weide mit dem besagten Schuppen, in dem ich jetzt liege. Er war bei der Waffen-SS, erzählt er stolz und gibt mir Stroh und Hafer und Wasser. Später nehme ich wieder die Fähre zurück nach Linz. Diesmal ohne das Pferd und ohne Zucker. Wieder ein Gespräch mit dem Fährmann. In Linz stromere ich ein bißchen durch die Gassen. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, in der Fremde zu sein: Tourist im Ausland. Dieses Bilderbuchstädtchen, die warme Luft (wie im Sommer), die vielen Hinweise für Touristen. Endlich Zeitungen unter dem Arm und Hunger auf ein Restaurant-Schnitzel. Das bekomme ich auch, muß aber um acht Uhr das Lokal wieder verlassen, weil eine Gruppe von CDU-Leuten dort eine Versammlung abhält. „Innere Sicherheit“ ist das Thema.
Ich gehe in ein Café und trinke Kaffee. Dann schlendere ich zur Fähre zurück. Unterwegs wieder dieses Gefühl, für einen Terroristen gehalten zu werden, bzw. von den Leuten daraufhin gemustert zu werden. Auf der Fähre setze ich das Gespräch mit dem Fährmann fort. Diesmal ist seine Freundin mit dabei. Sie fährt mit ihm hin und her, „umsonst natürlich“. Auf dem Weg zurück in meine Scheune gehe ich noch einmal kurz in die Bar der Reithalle und unterhalte mich dort mit einer Diplomlandwirtin und einem Biotechniker, der gerade sein Studium geschmissen hat. Die beiden sind verlobt. Sie hat gerade eine Stelle in Köln in einem Hobbyreitstall, der einer reichen Frau gehört, angenommen. Ihre Aufgabe ist es, die drei Pferde zu versorgen und M- und S-fertig zu machen. Sie ist seelig. Das ist das, was sie sich schon immer gewünscht hat. Und gerade richten die beiden sich ihre Wohnung in Köln ein.

Das Bild in der Mitte von den dreien wollte mir mal jemand abkaufen.
10. November
Um acht Uhr weckt mich der Nachtwächter kurz und zackig, ein ehemalige SS-Mann, „Division Brandenburg“, wie er mir stolz erzählt. Ich ziehe mich an, gehe in ein Hotel frühstücken – natürlich wieder mit Schleyer-Paranoia. Ich bin in der Hotelhalle der einzige zwanzig- bis dreißigjährige Typ mit Lederjacke und Jeans, der hier sein Frühstück verdrückt. Danach gehen wir weiter. Es ist sehr warm – zwanzig Grad. Die Sonne scheint und es ist fast wie im Sommer. Nach einem Umweg von mehreren Kilometern finden wir endlich den Hof von Heinz Erwer. Sofort kommt die Einladung, hier bei ihm zu übernachten. Sein junger Mitarbeiter – ehemaliger Kunststudent und jetzt biologisch-dynamischer Gärtner – führt mich herum, wir unterhalten uns. Überall auf dem Gelände stehen Schilder mit Sprüchen von Heinz Erwer: „Der Regenwurm ist mein wichtigster Helfer. Heinz Erwer“. Draußen an der Straße steht ein großes Schild: „Paradies des Diplomlandwirts Heinz Erwer“, etc. Es ist peinlich. Überdies verfestigt es die Meinung der in der Umgebung wohnenden Leute; um so landwirtschaftlich arbeiten zu können, muß man studiert haben oder irgendwie nicht bei Trost. Erwer ist ganz aufmerksam und fragt mich tausend Sachen. Besonders freut es ihn, „dass ich zu Fuß ganz aus Bremen hergekommen bin, um ihn zu besuchen“ – wie er allen Leuten erzählt. Andauernd kommen welche vorbei, um Obst oder Gemüse zu kaufen. Vor allem ältere Leute, pensioniert, reich und gelangweilt und höflich. Aber auch einige junge dynamische Ehepaare: der Mann steht im kreativen Berufsprozeß (fährt Citroen), die Frau bedient ihn nur mit Biologisch-Dynamischem (und fährt VW). Und Heinz Erwer hat für jeden ein paar Sprüche bereit: „Ja, der Kosmos, das ist das Wichtigste!“ „Es gibt keine Schädlinge, alles ist zu was nütze!“, usw..
Ich fahre mit ihm nach Remagen in die Post. Er stellt mir im Auto alle Fragen noch einmal. Ist befriedigt über die Antworten. In der Post „erwischt“ er mich beim Rauchen. Er ist entsetzt. „Bei mir oben wird aber nicht geraucht. Da schmeiß ich jeden raus. Auch meinen besten Freund.“ Ich erwidere ihm, dass ich nur ganz selten rauche, damit er mich wenigstens für ein bißchen „willensstark“ hält. Oben auf seinem Land ist er gleich wieder verschwunden. Ich halte mich an Müller, seinen jungen Mitarbeiter, in dessen Zimmer ich auch schlafen soll. Er ist wirklich nett, wenn auch ein wenig zu sehr nur die kleinere und intellektuellere Ausgabe der großen Dogmatik. Er spricht auch noch nicht in jener Lautstärke wie der Paradiesbesitzer. Bei dem Abendbrot ohne Zucker wieder das Gespräch über Rauchen. „Was, Sie rauchen?“ fragt seine Frau entsetzt. „Das müssen Sie doch nicht. Die schöne Luft verpesten!“ So geht es weiter. Der Müller lenkt ein: „In dem und dem Buch steht aber nichts über die Gefährlichkeit des Rauchens. Und der und der schreibt auch nichts darüber.“ So geht es hin und her. Schließlich wird der Fernseher eingestellt: Musikshow mit James Last. Als ich ankam, diskutierten gerade alle über den Krebs und seine Ursachen. Man war sich einig: nicht- biologisch gezogenes Obst und Gemüse und Rauchen ist die Ursache für Krebs und für alle möglichen anderen Krankheiten. Der Müller macht ketzerische Bemerkungen: „Der James Last, das ist doch Volksverdummung“, etc.. Aber die beiden Alten lassen sich nicht beirren. Ich gehe nach draußen.
Eine warme sternenklare Nacht mit phantastischen Gerüchen. Ich zünde mir erst einmal eine Zigarette an. Herrlich. Dann schaue ich zum Pferd. Es steht in einer Ecke des eingezäunten Grundstücks; um ein paar Bäume habe ich meine ganzen Seile gezogen und so eine kleine Weide gebaut. Unter einer großen Buche stehen etwa vierzig alte Schulbänke und -stühle. Das ist Erwers „Baumschule“. Neben den Bänken auf einem großen Stein die Inschrift: „Vor dem Lohn der Arbeit hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt.“ Erwer doziert gerne. Am liebsten, wenn die Leute auf diesen Schülerbänken sitzen und zu ihm aufblicken. Von Ferne hört man Tag und Nacht die Autobahn und über uns donnern die Düsenjäger. Später in der Nacht gehe ich noch einmal nach draußen. Noch eine Zigarette rauchen. Es ist schön, unter den Obstbäumen spazieren zu gehen, durch die Weinreben und Erdbeerpflanzen. Es wäre alles noch schöner, wäre es nicht so paradiesbelastet.
Morgens werde ich von Müller geweckt. Das Pferd ist ausgebrochen. Seltsamerweise habe ich genau das geträumt – es war kein Angsttraum, nur etwas unbequem. Als ich rauskomme, steht es auf einem Stück Wiese und frißt Gras. Ich bringe es in seine kleine Weide zurück. Es ist mir ein wenig peinlich. Hoffentlich hat es keine Gemüsepflanzen gefressen. Statt eines Guten Morgen sagt Erwer: „Sehen Sie, das Pferd ist klüger als Sie. Daraus kann man lernen: erst die Praxis, dann die Theorie. Dann wäre Ihnen das nicht passiert. Stellen Sie sich vor, das Pferd hätte die Hügelbeete zerstört. Das wäre ein Schaden von mehreren tausend Mark gewesen.“ Der Müller gibt mir zum Abschied noch ein Stück selbstgebackenes Brot und ein Kilo Äpfel. Frau Erwer drückt mir noch einen Stapel Zeitschriften von den „Menschenfreunden“ in die Hand – von einer Sekte von Agrariern in der Nähe von Bordeaux. „Sie nehmen jeden auf, jeder kann dort mitarbeiten. Das ist das Zentrum der Erneuerung. Von dort geht es aus. Wenn Sie dorthin kommen müssen Sie vorbeischauen, dann fragen Sie nach Sowieso. Er kennt mich und sagen Sie ihm, Sie wären bei mir gewesen und grüssen Sie ihn von mir“, sagt der alte Erwer. Ich stecke die Zeitschriften ein und beschließe, einen großen Bogen um diese Gemeinde zu machen.
Am Ortsausgang von Bad Neuenahr stecke ich die Zeitschriften der Menschenfreunde in den Briefkasten eines Nonnenklosters. Die Äpfel essen Leinchen und ich gemeinsam auf. In den Ortschaften bin ich bei jedem Zigarettenautomaten stehengeblieben, um nach Overstolz zu suchen. Leinchen ist vor jeder Marlboro-Reklametafel stehengeblieben und sogar einmal schnurstracks über die Straße auf so ein Ding zugegangen: wegen der darauf abgebildeten Pferde. Vor den großen Schaufensterscheiben bleiben wir beide immer gemeinsam stehen: sie wegen ihres eigenen Spiegelbildes, ich wegen meines Spiegelbildes.
Hinter Bad Neuenahr gehen wir in Richtung Südsüdwesten, d.h. in Richtung Nürburgring, Trier. Ein paar Mal geraten wir in eine Sackgasse: der Weg wird entweder zu steil oder die Bäume stehen zu eng. Danach verlasse ich mich zur Abwechslung mal auf Leinchens Einfälle. Und wir gehen auch nicht schlecht dabei. Wir sind schon fast in der Hohen Eifel. Auf einem Bergpfad, den ich alle 50 Meter von umgestürzten Bäumen freiräumen muß – manchmal benutze ich die Axt dazu, manchmal steigt Leinchen einfach drüber, zu meiner großen Überraschung -, treffen wir auf zwei Mufflons. Sie stoßen spitze Schreie aus und stürmen bergab. Fünf Minuten später sehen wir sie wieder: diesmal über uns. Das geht so eine ganze Weile: sie sind ebenso neugierig, wie die ganzen Kinder, die wir immer in den Dörfern treffen. Ein Stück weiter stoßen wir auf ein Hirschrudel. Der große Hirsch hat es auch nicht eilig. Er schaut uns noch eine ganze Weile nach bis wir um eine Wegbiegung verschwunden sind.
In Cassel – in der Nähe von Kempenich – frage ich nach einem Quartier – bei einer Bauernhof-Pension. Leinchen bekommt den leerstehenden Ponystall zugewiesen, ich das leerstehende Gästehaus. In der Dorfkneipe esse ich erst einmal einen „Strammen Max“, trinke drei Tassen Kaffee mit viel Zucker und blättere in einem Buch über die Eifel. Bald wird sich mir wieder ein anderes Problem stellen: Soll ich wieder auf einem Hof Arbeit suchen, oder erst noch eine Weile in Restaurants und Pensionen das Geld verprassen? Im Moment habe ich keine Lust zum Arbeiten – Urlaubsstimmung stattdessen. In dieser Dorfkneipe hier könnte ich ewig so sitzen, Traubensaft trinken und vor mich hin denken, aber schon macht mich wieder die Sorge um das Pferd nervös. Es steht jetzt allein im Stall und langweilt sich, stellt vielleicht sonst was an.

Erst stand sie da – eine ganze Weile. Dann ist sie um den Laden rum und übers Feld verschwunden.
11. November
Gerade habe ich dem Pferd Gerste und Pellets und Wasser gegeben und danach mich lange mit der jungen Bäuerin unterhalten. Ihr jüngster Sohn, der später mal den Hof übernehmen soll und auch seinen Landwirtschaftsmeister macht, will die Kühe abschaffen und statt dessen Pferde züchten. Sie erzählt, dass sie auch nicht aus der Landwirtschaft kommt. Sie erzählt lachend, wie sie sich das erste Mal angestellt hat, als sie ein Huhn schlachten sollte, wie ihr zu Anfang beim Melken die Hände weh taten, usw.. Es ist ein lustiges Gespräch. Sie fragt mich auch nicht aus, kann überhaupt schlecht zuhören, wartet nur auf ein Stichwort, um selber sofort wieder weiter zu erzählen. Ihr Mann ist weg zum St. Martinszug. Er bläst Trompete. Jetzt redet ihr endlich keiner dazwischen.
Vorhin in der Dorfkneipe stand ein junges Ehepaar an der Theke – sie redeten mit dem Wirt. Immer wenn die Frau ihn was fragte, antwortete der Wirt dem Mann, so als wäre sie überhaupt nicht existent. Es war kaum mitanzuhören. Die Bäuerin erzählt mir, dass es hier so viel Wild noch gibt, weil die Jagd hier von großen Firmen zumeist gepachtet ist – Mannesmann, Mercedes, etc.. Und diese Herren haben kaum noch Zeit zum Jagen, deswegen unterschreiten sie meistens ihr jährliches Soll oder haben sowieso Leute angestellt, die für sie jagen, weil sie nur noch in Afrika auf die Jagd gehen, wenn überhaupt. Besonders die Wildschweine richten viel Schaden auf den Feldern an. Sie gehen im Winter sogar an die Silage hinterm Haus. Die Mufflons soll Göring im Dritten Reich hier ausgesetzt haben. Mit einer Milchkanne führt sie mich dann zum Pensionshaus hinauf – 200 Meter den Berg hoch. Ich bin ganz allein in diesem riesigen Haus. Es ist kalt und draußen pfeift der Wind. Ich habe den Wecker auf sieben Uhr gestellt, um halb Acht will ich dann runter zum frühstücken gehen. Gerade dass ich die Bäuerin noch davon abhalten konnte, mir morgen früh das Frühstück hier raufzubringen.
12. November
Ausgeschlafen ging ich nach unten zum Frühstück. Vorher gab ich dem Pferd noch Gerste und Wasser. Ich frühstückte allein, während die Bauersfamilie am Nebentisch aß. Aber bald unterhielten wir uns schon – über Pferde – und sie setzten sich zu mir an den Tisch. Danach schmierte ich mir noch zwei Brote für unterwegs und nahm noch ein gekochtes Ei mit. Für alles zusammen bezahlte ich 12.50 DM. In der Scheune, während ich in aller Ruhe das Pferd sattelte, unterhielten wir uns noch eine Weile – über die Terroristen. Man vermutete sie in der Eifel. „Rübe ab mit ihnen“, sagte die Bäuerin und lächelte wieder dabei. Als ich dann losging, fuhr draußen auf der Straße gerade ein Polizeiwagen entlang. Meine alte Paranoia. Ich versuchte, nicht von ihnen gesehen zu werden und ging langsam ein Stück die Landstraße entlang, das Pferd hinter mir herziehend, dann bog ich rechts ab – in den Wald, durch ein offenes Wildgatter – auf die „Kohlstraße“: eine ehemalige Römerstraße, die jetzt zu einem Waldweg zugewachsen ist. Immer wieder schaute ich mich um, aber kein Polizeiwagen fuhr hinter mir her. Es regnete in Strömen. Meine frei getexteten Lieder konnten den Regen nur einmal aufhalten. Und das auch nur für wenige Minuten. Nach drei Stunden war ich so durchnäßt, dass ich mit meinen klammen Fingern keine Zigarette mehr drehen konnte.
Dann in der Nähe des Nürburgrings in einem kleinen Ort – Jammelshofen – beschließe ich Rast zu machen in einer Pension. Leinchen bekommt den Rinderstall zugewiesen, ich gehe erst einmal in die Gaststube. Vorher wechsele ich noch Schuhe und Strümpfe. Leinchen bekommt Heu und Rüben und ich in der Küche einen Teller heiße Suppe. Dann an der Theke trinke ich erst einmal drei Tassen Kaffee. Langsam wärmt mich der Kaffee von innen und die Heizung von außen und ich versuche mich an der ersten Zigarette, aber es gelingt noch nicht ganz. Die Pensionswirtin erzählt mir von ihren Gästen: Wenn viele Nürburgringgäste kommen, muß der eine Sohn bei seiner Freundin schlafen, der andere muß im Keller schlafen, ein dritter auf der Couch in der Küche – ihre Zimmer werden vermietet. „Unsere Tochter darf natürlich ihr Zimmer behalten“, fügt sie schelmisch hinzu. Sie erzählt immer weiter: von ihrer Familie, vom Ford Ascona ihres einen Sohnes, von der Sonderschullehrerausbildung ihres anderen, von der Büroarbeit ihrer Tochter in Bad Godesberg (in der Nähe hier gibt es keine Arbeit für sie), von dem Lastwagenfahrerjob ihres Mannes, der dazu noch Arbeitslosengeld bekommt, der dazu noch mit seinem Mähdrescher im Lohndrusch arbeitet, der dazu noch eine kleine Landwirtschaft hat: einige Rinder, Rüben und Getreideanbau. Heute nachmittag wird das einzige Schwein geschlachtet.
Es hat aufgehört zu regnen und klärt sich ein bißchen auf. Ich überlege schon weiterzuziehen. Aber plötzlich setzt wieder der Sturm ein und mit ihm Hagelschauer. Also bleibe ich. Die Sturmböe eben hat das ganze Dach von dem neugebauten Schuppen nebenan weggerissen – im Schneesturm helfe ich der Familie, es wieder hochzutragen und neu anzunageln. Wieder bin ich bis auf die Knochen durchnäßt und wieder gelingt es mir nicht, mir eine Zigarette zu drehen – bei einer Tasse heißer Milch diesmal. Draußen sind sie immer noch dabei, das Dach dicht zu machen. Ich sitze derweil mit einem kleinen schlechten Gewissen in meinem Pensionszimmer – der bisherige Gipfel an Geschmacklosigkeit, was die Einrichtung betrifft, und dabei muß sie ein kleines Vermögen gekostet haben. Mittlerweile habe ich meine Eßvorräte im Stall mit dem Pferd geteilt. Gleich soll das Schwein geschlachtet werden. Ich werde zuschauen und ein wenig mithelfen. Vielleicht kann ich was dabei lernen und sei es auch nur dies: nie wieder beim Schweineschlachten zuzuschauen, weil mir speiübel dabei wird.
So. Jetzt habe ich gut gegessen, das Pferd für die Nacht mit Heu und Rüben und Wasser versorgt, herausbekommen, dass heute Abend niemand nach Adenau in die Diskothek fährt, die Frau geht mit ihren Söhnen und mit ihrer Tochter in die Kirche. Sie sind alle festlich herausgeputzt und frisch gewaschen und gekämmt. Was soll ich machen, wenn das schlechte Wetter mit Sturm, Hagel, Schnee und Regen anhält? An der Mosel soll es weniger kalt sein.

Da oben haben wir uns das erste Mal gestritten. Ich weiß es noch wie heute.
13. November. Sonntag
Um halb Elf los. Ich brauche nicht alles zu zahlen: Essen, usw. erlassen sie mir, weil ich beim Dachreparieren und beim Schweineschlachten geholfen habe. Es ist bitterkalt, als wir losgehen. Über den Nürburgring – eine potthäßliche Gegend: Parkplätze mit den Nummern 86, 84a, 92 usw.. Dazwischen Blechhütten und Reklamewände. Einige Arbeiter fegen die Rennstrecke. Ich gehe auf der Bundesstraße dann. Alle Autofahrer, die mir entgegenkommen oder uns überholen, sind verhinderte Rennfahrer, meistens junge Leute in Mittelklassewagen, die Freundin neben sich. Es ist so bitterkalt, dass mir abwechseln die Hand abfriert, mit der ich jeweils das Tau von Leinchens Halfter halte. Ich fluche die ganze Zeit, zerre und schimpfe mit dem Pferd – sie hat aber Geduld mit mir.
Hinter Kelberg überholt uns ein Wagen und stoppt. Heraus spring ein älterer Mann und spricht uns an. Unheimlich freundlich und ehrlich entzückt über unseren Anblick. „Über meinen Idealismus“. Leinchen frißt derweil. Endlich! Denkt sie. Der Mann ist Besamungstechniker und nebenbei Landwirtschaftsmeister. Er hat einen kleinen Betrieb mit vier Kühen und 8,5 ha Land. Er zeigt mir seine Besamungsausrüstung für die Kühe, die zu Pillen tiefgefrorenen Samenportionen. Er meint traurig, dass er leider Sonntags arbeiten muß. Ich beglückwünsche ihn dazu. Immer wieder kommt er im Gespräch darauf, mich zu sich nach Hause einzuladen – sein Hof liegt in der Nähe von Daun. Er will vorfahren und alles herrichten, für das Pferd hat er in seinem Stall noch Platz. Ich lehne dankend ab – es liegt nicht auf meiner Strecke, sage ich. Als er sich dann traurig von mir verabschiedet, weil ich ihm zuliebe diesen kleinen Umweg nicht machen will, hätte ich am liebsten meine Absage wieder rückgängig gemacht. Keine Sentimentalitäten unter Männern. Scheiße.
Noch mißmutiger setze ich meinen Weg fort. An einer Straßenkreuzung steht ein Bauer. Wir kommen ins Gespräch. „So ein gutes Pferd und so eine gute Ausrüstung und so ein oller Strick“, sagt er. „Ist wohl geklaut …“, sagt er mißtrauisch. Ein Stück weiter – kurz vor Ulmen – hält ein dicker Mercedes, eine goldbehangene Frau kurbelt die Scheibe runter und ihr dicker Mann fragt mich nach dem Woher und Wohin und: „Hast du gewettet?“ „Handelt es sich um eine Wette?“ fragt seine Frau. Ich blicke mich um und sehe hinter mir den Fernsehturm von Cassel. Jetzt sehe ich dieses Ding schon drei Tage lang und habe es immer noch nicht hinter mir gelassen. All das verbessert meine Laune nicht.
Hinter Ulmen biege ich von der fürchterlichen Schnellstraße ab ins Feld. Dann einen Hang runter, über eine Wiese, durch einen Bruch, die Äste kratzen an der Satteltasche, Leinchen geht einfach weiter. Plötzlich hört der Weg auf: Dickicht. Wieder zurück. Ich fluche und schimpfe auf Leinchen, die immer wieder den Kopf senkt, um zu fressen. Nächsten Weg rein. Es läuft ein kleiner Bach quer dazu – dreißíg Zentimeter breit. Leinchen geht nicht drüber. Ich zerre und schimpfe. Aber nichts zu machen: sie geht nicht rüber. Dabei ist es nur ein kleiner Schritt. Also wieder zurück. Nächster Weg. Sie will nicht einmal durch eine Pfütze gehen. Ich schimpfe noch lauter als vorhin und boxe ihr in die Rippen. Es hilft nichts. Wieder zurück. Nächster Weg. Endlich kommen wir aus diesem verdammten kleinen Tal raus auf einen normalen Waldweg. Keine weiteren Hindernisse mehr. Leinchen ist übereifrig und folgt brav. Ich entschuldige mich leise bei ihr für das von vorhin. Ich bin zerknirscht. Sie geht so überaus folgsam mit, sieht keinen Grashalm, nichts, dass ich jetzt ein besonders schlechtes Gewissen ihr gegenüber habe. Wir kommen aus dem Wald raus. Überall sieht man Hufspuren. Dann durchs Dort: Auderath. Ich wollte eigentlich bis Filz heute kommen, entdecke aber im Dorf ein Schild „Reiterhof“. Dort gehe ich hin. Leinchen bekommt sofort einen exquisiten Stall mit Blick auf die anderen Pferde. Ich bekomme an der Theke ein Bier und einen Korn für meine „Story“.
Der Besitzer gibt den Reiterhof am nächsten Tag an einen anderen ab. Er ist einer von diesen jungen dynamischen Typen: krause Haare, Schnurrbart, Jeans und Parka. „Dolle Sache“, sagt er. „Das Pferd kann diese Nacht umsonst bei mir stehen“. (Ich bedanke mich lachend. Ich habe für das Pferd noch nie was zahlen müssen.) „Entschuldige mich bitte jetzt, ich habe da drüben noch Freunde von mir sitzen. Der eine ist der beste Unterwasserfotograf Deutschlands. Aber wir sehen uns ja noch.“ So ein Typ eben. Sein Hotel ist gemütlich aber protzig eingerichtet. So nach und nach trudeln die Gäste vom „Ausritt“ ein: Gymnasiastinnen mit reichen Eltern aus Aachen, junge Progressive aus der Umgebung, die High Society aus dem Dorf. Die Gespräche drehen sich um Pferde, um die Abenteuer beim Ausritt. Morgen werde ich wohl bis an die Mosel kommen und dann dort mir vielleicht doch einen Bauern bzw. einen Winzer suchen, um bei ihm in der Spätlese zu arbeiten und ein wenig über Weinbau zu lernen. Der Besamungstechniker (es tut mir immer noch leid, dass ich seine Einladung nicht angenommen habe) hat mir geraten, mir auch ja den richtigen auszusuchen – einen sympathischen, nicht zu großkotzigen. Dieser Besamungstechniker – ein prima Bauer unter hunderten, den habe ich mir entgehen lassen. Diese Begegnung habe ich auf ein Minimum reduziert. Verdammte Scheiße … und dabei brauche ich solche Begegnungen nötiger denn je. Aber das kommt davon, wenn man den ganzen Tag nur mit verkniffenem Gesicht eine Straßenkurve nach der anderen überwindet. Ich sitze immer noch in diesem stilvollen Reiterclub mit einer dicken Zeche auf dem Deckel und die Gespräche um mich herum interessieren nicht.

Der spinnt! Glaub ihm nicht.
14. November
Als ich um acht Uhr aufwachte und aus dem Fenster schaute, war alles weiß, alles mit Schnee bedeckt. Und das, was ich nachts im Dunkeln als die Lichter einer Stadt im Tal ausgemacht hatte, erwies sich bei Tageslicht als die Grablichteransammlung auf einem Friedhof. Als es auch noch zu stürmen anfing draußen, kroch ich mißmutig wieder unter die Bettdecke. Um neun Uhr frühstückte ich dann ausgiebig mit Hans, einem Mitarbeiter des Besitzers – ein sympathischer arbeitsloser Werbemensch. Zuerst hatte mir die Frau vom Frühdienst ein freudloses kärgliches Frühstück hingestellt. Als er dann kam und sich dazusetzen wollte, ergänzte er es mit Schinken, Käse, Eiern, Orangensaft, Gin etc.. Einige belegte Brote packte ich in meine Satteltasche. Nach dem Frühstück half ich beim Aufräumen des Flaschenkellers. Eine junge Frau aus der Nachbarschaft – die die Tiere versorgte – hatte Leinchen inzwischen mit Hafer und reichlich Heu versorgt. Ich gammelte rum – unschlüssig, ob ich noch einen Tag bleiben sollte oder nicht. Die junge Frau bat mich, noch zu bleiben. Ich stellte in der Bar das Tonband an, trank Kaffee, hörte Musik: die internationalen Hitparaden rauf und raunter. Weil ich ihm geholfen hatte, machte der Besitzer mir einen „Sondertarif“ für die Übernachtung.
Um elf Uhr gehe ich dann doch los. Fürchterlicher Wind aus Westen. Und Regen noch dazu. Wenn ich den Wind fast im rechten Ohr habe, liege ich richtungsmäßig richtig. Den Kompaß kriege ich sowieso nicht aus der Tasche – wegen der Kälte kann ich meine Finger nicht krumm machen und die Sonne sieht man nicht – der ganze Himmel ist grau. Außerdem ist es so neblig, dass man kaum 100 Meter weit sieht. In Lutzerath kommen wir an einer Schule vorbei. Aus allen Fenstern schauen mir die Kinder nach und die Lehrer müssen für einen Moment den Unterricht unterbrechen. Ich habe mir den Schal aus der Tasche geholt und eine dicke Hose und dicke Socken angezogen. Unterwegs sinkt meine Laune nicht unter den Gefrierpunkt. Trotz nasser Füße behalte ich so etwas wie eine grimmige Entschlossenheit bei. Erst als wir vor Bad Bertrich das Elfental verfehlen und in einem Lavabruch uns verirren und Leinchen an nichts anderes als ans Fressen denkt, werde ich langsam sauer und ungeduldig – zerre sie die Lavahaufen rauf und runter, schimpfe laut mit ihr. Schließlich treffe ich im Nebel auf einige Arbeiter, die mir den richtigen Weg nach Bad Bertrich zeigen – wir müssen ein ganzes Stück zurückgehen, wir haben im Nebel die Abzweigung verpaßt. Dann müssen wir ins Tal runter, auf einem Waldweg. Es ist ein tolles Tal und auch der Nebel lichtet sich langsam, aber ich muß Leinchen die ganze Zeit hinter mir her zerren.
Ganz plötzlich ist der Waldweg zu Ende und wir sind in Bad Bertrich – es regnet nicht mehr, kein Wind, kein Nebel hier im Tal. Wir gehen an der Üßbach entlang durch die Stadt: ein protziges Hotel nach dem anderen, dazwischen neugebaute Sanatorien, in denen sich die Arbeiter, die zur Kur hierher geschickt worden sind, langweilen. Sie schlagen ihre Zeit mit Kartenspielen und Biertrinken in diesen trostlosen Tagesräumen tot. Ich beschließe, hier irgendwo zu übernachten – es ist schon 16 Uhr. Aber in Bad Bertrich – in diesen Kurhotels – gibt es natürlich keinen Stall, alles ist für Kurgäste ausgebaut. Man schickt mich drei Kilometer weiter in Richtung Alf, dort soll eine Pension einige Ponies haben. Wegen der nassen Schuhe fällt mir das Gehen immer schwerer. Der Wirt des Ponyhofes hat seine Pension schon geschlossen – Winterpause. Seine Weinstube ist noch geöffnet. Er bietet mir an, Leinchen über Nacht auf der leeren Ponyweide zu lassen. Ich bringe sie rüber und stelle das Gepäck bei ihm unter. Auf der Weide ist auch ein kleiner Unterstellschuppen, wo das Pferd im Trockenen stehen kann, wenn es anfängt zu regnen. Ich bin einigermaßen für diese Übernachtungsmöglichkeit für sie beruhigt, obwohl ich sie eigentlich bei diesem Sauwetter nicht mehr nachts draußen lassen wollte. Und gehe in das Lokal zurück, um Schuhe und Strümpfe zu wechseln, mir die Haare zu trocknen, einen Saft zu trinken und um Zeitung zu lesen. Danach will ich dann die zwei Kilometer zurück nach Bad Bertrich, um dort für mich ein Bett zu suchen. Aber an der Theke treffe ich einige junge Typen, die hier kurz eben ihr Bier trinken. Wir kommen ins Gespräch. Sie sind sehr freundlich. Einer von ihnen sagt mir, seine Eltern haben eine Pension in Alf, dort könnte ich übernachten (also weit weg von Leinchen – das erste Mal). Einer von den Typen bringt mich mit seinem VW sofort nach Alf. Unterwegs verabreden wir uns noch für einige Stunden später in der Diskothek. Zuerst einmal will ich mein neues schreckliches Doppelzimmer begutachten, einige Tassen Kaffee trinken und mir Tempotaschentücher in die schon wieder durchnäßten Schuhe stopfen.
Mit zwei Typen in der Diskothek gesessen, dann mit ihnen zu einer anderen gefahren, diese war aber geschlossen und dann zurückgefahren. Frank Zappa gehört im Autoradio. Sehr laut. Besonders die Leadguitarre. Aber dann die Paranoia durch alle Ebenen hindurch bekommen (wir hatten im Auto Shit geraucht). Ich kann es in der Diskothek nicht mehr aushalten. Der eine Typ fährt mich nach Hause. „Ist doch selbstverständlich“. Aber der Zustand hält an, läßt sich nicht abschütteln – draußen an der frischen Luft. Alles kreist um die Paranoia – alle Gedanken. Ich friere.

Sie müssen sich das so vorstellen: Da oben tauchten bereits die ersten Amerikaner auf. Wir hatten kaum noch Munition und der Nachschub kam nicht mehr über den Fluß rüber.
15. November
Ich muß dann trotz meiner Paranoia eingeschlafen sein, d.h. mit der Angst, die Macht hätte mich umstellt und aus dem Geschriebenen eben und in den Seiten davor werden ihre Vermutungen bestätigt. Meine Hände zittern heute Morgen beim Frühstück. Jetzt beim Durchlesen des nächtlichen schriftlichen Gestammels, verstehe ich einiges nicht mehr, es ist auch nichts weiter als ein krampfhafter Versuch, mich über Wasser zu halten. So hat es angefangen: Ich gehe im Regen von der Pension in den Ort. Unterwegs gehe ich noch in eine Kneipe. Die Gäste dort haben am Tag zuvor einen Film über Nazi- Deutschland gesehen, sie unterhalten sich darüber. Mich mustern sie ab und zu mißtrauisch (dieses ewige Mißtrauen macht mich krank). Der eine sagt: „Die SS hat nie auf die SA geschossen. So etwas gab es damals nicht.“ Eine junge Frau: „Als die SA Karneval gefeiert hat und die haben die alten Lieder gesungen, da ist mir richtig das Herz aufgegangen.“ Eine ältere Frau sagt zu dem Mann: „Doch. Die SS hat in Bad Wiessee auf die SA geschossen, das kannst du nicht leugnen. Ich habe gestern vor dem Fernseher auch stramm gestanden.“ Man streitet sich: „Herz aufgegangen“, „wer hat auf wen geschossen damals?“ Ich verstehe die ganze ziemlich heftige und emotionsgeladene Auseinandersetzung nicht, sie besteht fast nur aus Andeutungen, ab und zu schaut jemand zu mir rüber – sie sitzen zu acht an einem Tisch, dann noch der Wirt, ich sitze an einem Tisch allein, ich bin der einzige ‚Andere‘ im Lokal. Es ist seltsam.
Ich schlinge schnell mein Schnitzel runter und gehe in die Diskothek. Die Typen dort rauchen gerne einen Joint, gehen auf Feten, hören gerne Rock-Musik – nette Typen. In der Disko höre ich Novalis. Der eine Typ ist Drucker in einer Weinfirma, der andere bewirtschaftet mit seiner Mutter einen Weinberg und hat dazu noch einen Imbißstand. Sie trinken oft und gerne Wein hier und alle Eltern haben eigene Weinkeller. Der eine erzählt, eine Zeitlang hat er jeden Morgen – bevor er in den Berg ging zum Arbeiten – erst einmal einen Liter Wein getrunken, das turnt zwar anders als Shit, sei aber der Arbeit im Berg angemessener.
Wir fahren in ein Jugendheim – unterwegs hören wir laut Frank Zappa. Auf einem Parkplatz rauchen wir einige Pfeifen. Das Jugendheim ist geschlossen. Ich bin schon so bekifft, dass mich alles lachen macht. Verkniffen, wie ich feststelle. Damit fängt der Horror an. Zurück in die Diskothek nach Alf. Ich höre den Gesprächen kaum noch zu. Muß unbedingt allein sein oder an die frische Luft – auf den Weg in die Pension. Der eine bringt mich mit seinem Auto dorthin. Im Bett liegend, klopft die Pensionswirtin an die Tür: „Sind Sie da?“ Antwort: „Ja, warum, is was?“ Keine Antwort. Statt dessen geht sie nach unten an die Haustüre – ich höre Polizeistiefel, die eingelassen werden, leise. Und so geht es weiter. Polizisten gehen mit einem Gewehr im Anschlag am Fenster des Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich schreibe im Bett. Das, was ich schreibe, ist verdächtig. Erst recht das, was ich davor alles so geschrieben habe, damit gebe ich ihnen Recht. Am Morgen während des Frühstücks ist die Paranoia noch immer existent, aber auszuhalten – wie die gewöhnliche eben – sie bleibt im Innern eingeschlossen oder draußen ausgeschlossen und brummelt nur ein bißchen vor sich hin.
Jetzt habe ich Zimmer und Frühstück bezahlt und gehe die drei Kilometer zum Pferd zurück. Es ist alles in Ordnung und Leinchen begrüßt mich bereits von weitem. Ich habe ihr Äpfel mitgebracht. Zuerst gehe ich in die gegenüberliegende Weinstube, wo mein Gepäck steht, um mich marschfertig zu machen. Ich bin schon wieder durchnäßt und immer noch leicht lädiert. Der Wirt bietet mir einen Traubensaft an. Plötzlich kommt seine Mutter runter – mit zwei Tellern Suppe und einem Brötchen. Das muß ich essen: „Nicht für Sie, fürs Pferd“, sagt sie, „damit Sie das Pferd sicher dorthin bringen, wo es hin soll.“ Wir unterhalten uns noch eine Weile, während ich meine Suppe löffele. Sie erzählt mir von ihren Gästen im Sommer, und dass es früher alles besser war. Um halb Eins gehe ich mit dem Pferd los in Richtung Süden, in Richtung Kinderbeuren. Dort hat mir der Besitzer des Reiterhofes die Adresse eines Pferdehofes mitgegeben.
Der Weg durch den Wald ist steil und naß. Zweimal müssen wir umkehren, weil dicke, umgefallene Bäume den Weg versperren, wir nehmen einen Seitenpfad. Ein paar Mal muß ich das Beil rausholen, um Äste von umgestürzten Bäumen abzuschlagen, damit Leinchen drübersteigen kann. Jetzt sitze ich in der Dorfkneipe von Hetzdorf – bei Kinderbeuren -, das Pferd ist in einem Pferdestall bei einigen anderen Pferden untergebracht und ich trinke hier Kaffee und höre zum dritten Mal aus der Musikbox „Porqué te vas“. Unterwegs im Wald traf ich einige Waldarbeiter, ich fragte sie nach dem Hof Hetz. Sie verbesserten mich, es heißt Hetzhof und ist ein Dorf. Und den Pferdestallbesitzer Weber kannten sie auch. Sie zeigten mir eine Abkürzung dahin. Und so sitze ich jetzt also in der Dorfkneipe von Hetzhof. Mein Geld ist fast alle. Ich muß einen Hof suchen, auf dem ich arbeiten kann. Warum nicht hier in der Gegend – bei den Moselbauern. Vielleicht sind sie weniger anstrengend als die Westerwaldbauern? In dieser Kneipe frage ich jemanden nach einem Hufschmied. Sie antworten mir mit faulen Witzen. Dann frage ich nach einem Bauern, der eine Arbeitshilfe benötigt. Ein junger Typ springt auf und sagt, er weiß einen. Er fährt mich sofort mit seinem Wagen zu ihm hin – gerade, dass ich die Zigarette noch aufrauchen kann. Der Bauer ist freundlich. Obwohl es schon 22 Uhr ist, arbeitet er noch in seinem Stall. Er will sich bis Morgen entscheiden, sagt er. Ich soll Morgen früh wiederkommen – mit Pferd. Fürs Pferd hat er einen Stall. Zuerst müssen wir mit ihm noch ein Bier und einen Korn trinken. Bevor wir wieder abhauen, helfen wir ihm noch, seine zehn Kühe in einen neuen Laufstall zu treiben. Der Typ, der mich zu dem Bauern hingefahren hat, ist Polizist. Er lädt mich ein, heute Nacht bei ihm zu schlafen, „dann sparst du das Geld für die Pension“, sagt er. Ein Bulle. Zwanzig Stunden nach meiner Bullen-Paranoia jetzt dies.
Der Bauer – Hans Hermann – ist sympathisch. Und das mit dem Hufschmied klappt wohl auch. Der Mann, der die Pferde vom Weber versorgt – ein kleiner Bauer im Dorf – will nächste Woche sowieso den Schmied aus Trier herbestellen, dann kann der Leinchens Vorderhufe gleich mitmachen. Wieder spricht mich einer in der Kneipe an: „Tagebuch führen?“ Ich erzähle ihm meine Geschichte, der Frage damit etwas ausweichend. Er sagt, er kenne den Bauern Hermann gut, und wenn ich bei dem arbeiten kann, dann „Frohes Schaffen, das ist ein ganz guter Bauer“. Das ist ermutigend – immerhin. Hoffentlich klappt es morgen beim Bauern. Sein Hof gefiel mir überhaupt nicht und die soeben fertiggestellten Laufställe (aus Betonrosten und verzinktem Eisen) auch nicht. Und der Bauer war so stolz darauf. Aber ich war auch nicht in Form: kalte Füße, nasse Hose, die Hände in der Hosentasche herumstehend, und dann musste ich noch ein kaltes Bier mittrinken.

Da ganz hinten haben wir dann doch noch einen Platz für unser Zelt gefunden, beim letzten Mal.