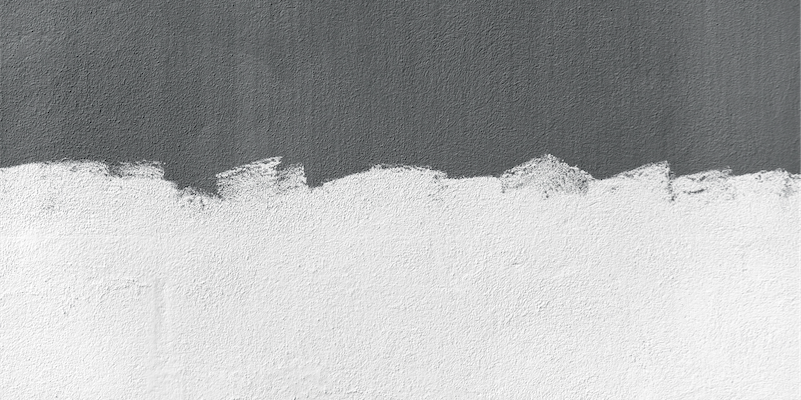Ich wollt vorher noch was sagen!
15.Mai (1966)
Heute habe ich meinen Schreibtisch im Büro des Bremer Tierparks, der dem Inder George Munro gehört, bezogen. Ich soll für ihn übersetzen und seiner Frau helfen, die Korrespondenz zu erledigen. Das ist zwar nicht genau das, was ich mir früher immer vorgestellt hatte – damals wollte ich später Zoologie zu studieren und dann in der Serengeti z.B. arbeiten, aber ich bin umgeben von Großtieren. Das ist schon mal was.
1.Juni
Die tägliche Arbeitsbesprechung findet im Bungalow der Familie Munro statt, wo wir bei Country-Musik morgens zusammen frühstücken. Die drei Kinder gehen danach zur Schule und wir anderen drei durch den Park ins Büro.
4. Juni
Die zwei älteren Töchter spielen nachmittags immer mit einigen ihrer Klassenkameraden auf dem Zoogelände. Wenn ich irgendetwas dort erledigen muß, hilft mir manchmal Jennifer, die jüngere der beiden. Sie kennt sich gut mit Tieren aus, die Familie hat noch eine Tierfarm in Kalkutta und sie ist mit allen möglichen Tieren groß geworden.
20.Juni
Weil kein Geld da ist für den Ausbau des Antilopengeheges schlage ich dem Chef vor, eine Arbeitskolonne aus dem Knast in Oslebshausen anzuheuern. Das klappt auch und ist nicht besonders teuer. Nur dass ich mich ständig darum kümmern muß. Es geht hauptsächlich um Erdarbeiten, anschließend noch um das Aufstellen eines Maschenzaunes. Als Hilfsinspektor bin ich überfordert, deswegen finde ich mich zwischen dem Chef und dem Aufsichtsbeamten wieder, auch eine üble Position. Um sie zu überwinden, versuche ich mit den Gefangenen ins Gespräch zu kommen.
24.Juni
Die letzten Tage war ich vor allem damit beschäftigt, Besorgungen für die Gefangenen zu erledigen – einkaufen, Briefe für sie austragen, Zigaretten besorgen etc. Es nimmt langsam überhand und mein Geld geht zur Neige, denn sie bitten mich immer öfter, ihnen mit Zigaretten und Briefmarken auszuhelfen, letztere besorge ich schon im Zoo-Büro.
29.Juni
Ein Pfleger ist krank, so daß ich Vormittags seine Arbeit mache. Die beginnt erst einmal damit, dass ich die vier kleinen Kragenbären aus ihrem Käfig am Schlafittchen jeweils zu zweit nach draußen ins Freigehege trage, wobei sie die ganze Zeit versuchen, mir die Hand abzubeißen. Anschließend hole ich die zwei halbstarken Orang-Utans aus ihrem Käfig und bringe sie an den See, währenddessen sie mir ständig in die Gummistiefel beißen. Am See steigen wir in ein Schlauchboot und ich ruder sie auf eine kleine Insel, wo ein Häuschen ist, das ihnen bei Regen Unterschlupf bietet.
3.Juli
Nun wohne ich schon im Haus der indischen Tierpfleger auf dem Gelände, allerdings beteilige ich mich nicht an ihren Mahlzeiten – es ist jeden Tag Curry mit Reis, das ganze Haus stinkt danach und alle Klamotten. Sie sprechen weder Deutsch noch Englisch, der einzige, mit dem ich näher zu tun habe, ist Peter, der im Elefantenhaus wohnt, er spricht Englisch. Gestern passierte es mir, als ich die Orangs auf die Insel brachte und ihr Häuschen noch etwas sauber machte, dass die zwei zurück aufs Schlauchboot sprangen und damit sofort auf dem See abtrieben, während ich starr vor Entsetzen auf der Insel zurück blieb. Die beiden lachten sich halb tot über mich und schlugen vor Freude die ganze Zeit auf den Gummiwulst. Zum Glück kam Buddha, der kleine Sohn des Chefs vorbei, krempelte seine Hose hoch, enterte das Boot mit den Affen und befreite mich von der Insel. Während wir schon lange am Ufer waren, freuten die beiden Orangs sich noch immer über meine Blödheit.
5.Juli
Es ist ein Kommen und Gehen bei den Tieren, dies ist eigentlich nur eine Verkaufsstation, die als Zoo firmiert. Am Schlimmsten ist es, Kraniche, Störche und Ähnliches einzufangen. Ihr langer Schnabel ist wie ein scharfeer Dolch und ebenso ihre Krallen bzw. Dornen an den Füßen, und ein Schlag mit den Flügeln tut ebenfalls sehr weh. Man kann aber nicht auf alle drei Waffen zugleich auspassen. Wenn man ihnen den Schnabel festhält und ihre Flügel an sich preßt, dann treten sie einen und das reiß jedesmal einen Dreiangel in die Hose und tiefe Kratzer ins Bein.
10.Juli
Heute kam mit großem Pressetamtam ein kleiner Elefant an, nicht viel größer als ein Überseekoffer, aber sehr viel schwerer. Vor lauter Zuschauern sah man das Tier gar nicht. Als dann aber im Elefantenhaus einer der dort angeketteten Elefanten trompete, lief der kleine sofort dort hin, wobei er die Pfleger an langen Tauen hinter sich herzog. Wir hatten vorher das Elefantenhaus hergerichtet, d.h. von der Sparkasse eine gespendete Riesen-Palme im Topf abgeholt und aufgestellt und ich hatte aus Kükendraht eine große Voliere für die Webervögel gebaut, die vorher unmöglich untergebracht waren, Peter hatte gründlich sauber gemacht – alles für die Medien.
14.Juli
Der kleine Elefant und ich wir haben uns angefreundet, er ist nicht angekettet und wenn ich ihn auf den Arsch haue, dann jagt er mich so lange, bis er mir von hinten mit dem Kopf einen Stoß geben kann. Die Sparkassen-Palme hat er in einer Nacht völlig zerfleddert und kaputt gemacht und die Webervögel-Voliere ebenfalls. Jetzt fliegen hoch oben unterm Dach etwa 100 kleine Vögel herum und einer nach dem anderen fällt tot zu Boden, aus Erschöpfung, Hunger und Durst. Überhaupt wird hier viel gestorben, stets überleben einige Tiere den Transport nicht. Neulich kamen 12 heilige Affen illegal aus Indien an – schöne große Tiere mit goldenem Fell und langem Schwanz. Sie saßen majestätisch nebeneinander auf waagerechten Stämmen und kuckten melancholisch durch die Fenster in das trübe Bremer Wetter. Dann fiel stumm einer nach dem anderen tot um: sie hatten sich auf dem Flug eine Lungenentzündung geholt und starben an TBC. Die indischen Pfleger sind unterbezahlt und ebenfalls unglücklich hier, aber die deutschen Pfleger geben sich große Mühe: die meisten wollen mit Menschen sowieso nichts zu tun haben und wirken auch irgendwie verhaltensgestört, aber mit Tieren kennen sie sich aus, einer war früher sogar Bauer. Oft sieht man sie noch nachts in den Ställen, wenn z.B. eine Antilope kalbt.
17.Juli
Jetzt ist Peter ausgefallen, der Ährenträgerpfau ist ihm auf den Kopf geflogen und hat ihn mit seinem Dorn am Bein empfindlich verletzt, er liegt im Krankenhaus und ich muß seine Tiere mit versorgen.
18.Juli
Am Gefährlichsten schienen mir die Doppelnashornvögel zu sein, aber Jennifer zeigte mir, dass sie ganz friedlich sind, obwohl sie in der Lage wären, einem mit einem Schnabelhieb den halben Kopf zu spalten, wenn man unter den Stangen hindurchgeht, auf denen sie sitzen – und das muß man, um an den Futtertrog zu kommen. Ich habe Unmengen Obstsalat jeden Morgen zuzubereiten für sie und die anderen Vögel sowie auch für die Flughunde, die sich jedesmal wie kleine Kinder laut schreiend in die Obstschalen stürzen und anschließend völlig verschmierte Schnauzen haben. Es sind wunderbare Tiere. Dem Ährenträgerpfau schlug ich jeden morgen als erstes den Besen über den Kopf, woraufhin er rasch in seinem Häuschen verschwand und ich ebenso rasch ihm Futter hinschüttete und Wasser nachfüllte. Heute morgen verfehlte er jedoch die Tür zu seinem Häuschen und lief stattdessen verwirrt auf mich zu, der ich erschrocken zur Seite sprang, woraufhin der Pfau durch die Tür ins Freie entwich – und auf Nimmerwiedersehen in der Luft verschwand. Über 1000 DM gingen auf diese Weise verloren. Der Chef nahm es mir zum Glück nicht besonders übel.
24.Juli
Jennifer hilft mir jetzt fast täglich in den Vogelvolieren, wir küssen uns heimlich im Futtergang und werden immer verliebter. Oft bin ich jetzt auch abends bei ihnen im Bungalow, wo wir Countrymusik hören, Fernsehen und Tee trinken oder irgendwas essen. Fast gehöre ich schon zur Familie und muß z.B. den indischen Botschafter im Auto Bremer Sehenswürdigkeiten zeigen oder irgendwelche Geschäftspartner durch den Zoo führen.
26.Juli
Heute sollte ich das Freigehege mit Wassergraben für vier Geparden leer machen – es befanden sich noch zwölf Schwäne darin, die sollte ich mit dem Schlauchboot an Land drängen und sie dann in einer Ecke des Zauns einer nach dem anderen einfangen und an einen der Seen bringen. Das gelang mir jedoch nicht, weil ich nicht entschlossen genug vorging und die Tiere mir immer wieder entwischten – vom Land ins Wasser und wieder zurück. Schließlich half mir nach Schulschluß endlich Buddha, indem er sich einfach in die Tiermasse warf und den erstbesten Schwan ergriff. Das wollte ich mir nicht zwei mal zeigen lassen und tat es ihm nach. Als ich den ersten Schwan auf dem Arm hielt, wurde er ganz ruhig und kuschelte sich geradezu an mich. Sein Brustgefieder war so weich und er war so leicht und friedlich, dass ich ihn am liebsten den ganzen Tag herumgetragen hätte. Anschließend kamen die vier Geparden in das leere Gehege. Zwei große und zwei kleinere, von den letzteren war der eine völlig zahm, da er in der Wohnung der Munros groß geworden war. Am Nachmittag besuchte ich sie ein paar Mal, sperrte das Gehege auf und blieb in der Tür stehen, sofort kam der zahme an, um mit mir zu spielen und gestreichelt zu werden. Als er merkte, dass ich jedesmal unruhig wurde, wenn die anderen zwei großen wilden sich uns näherten, ließ er von mir ab und verscheuchte sie, kam dann aber wieder zurück zu mir. Ich war schwer beeindruckt von ihm, am Abend schwor ich mir jedoch, dieses Spiel nicht mehr zu wiederholen – es war zu gefährlich. Am Tag zuvor war mir ein Doppelnashornvogel weggeflogen, es gelang den indischen Pflegern aber, ihn am Abend wieder einzufangen. Besonders schön ist es, abends noch durch den Tierpark zu gehen und sich zu überlegen, ob auch alle Tiere richtig versorgt sind, nachzukucken, ob alles stimmt und in Gedanken einige Gehegeverbesserungen sich bei nächster Gelegenheit vorzunehmen.
16.August
Obwohl ich nicht als Tierpfleger eingestellt worden bin, sondern als Übersetzer und Bürohilfe, macht mir die Arbeit im Büro immer weniger Spaß, so oft es geht, verdrücke ich mich nach draußen – und sei es nur, um mit dem VW-Bus irgendetwas auf dem Fruchthof oder sonstwo zu besorgen. Zum Glück gibt es daneben noch genügend Engpässe bei der Arbeit der Tierpfleger, so daß man immer irgendwo einspringen muß und diese oder jene Büroarbeit unerledigt bleibt bzw. von Frau Munro erledigt wird. Abends bin ich meistens zu müde, um noch was zu lesen oder zu schreiben, höchstens, daß ich noch mal rüber in den Chefbungalow gehe und mich zu den beiden Töchtern ins Wohnzimmer setze. Nicht immer schaffen Jennifer und ich es, uns heimlich im Futtergang der Vogelvoliere zu treffen, so bleiben uns dann abends nur einige verstohlen-schmachtende Blicke über den Wohnzimmertisch hinweg, wobei wir auch noch aufpassen müssen, dass ihre ältere Schwester Joy nichts mitbekommt.
1.September
Frau Munro scheint jedoch etwas zu ahnen oder jedenfalls war sie sich plötzlich mit ihrem Mann einig, dass ich statt weiter die Vögel und Flughunde zu füttern unbedingt die beiden Puma-Käfige aus stabilem Rundeisen streichen müsse. Ich machte mich nichtsahnend an die Arbeit – mit Farbe und Pinsel, merkte jedoch schnell, dass ich auf diese Weise monatlang damit beschäftigt wäre – und ewig mit der stinkenden Farbe hantieren müßte. Deswegen besorgte ich mir anderntags gleich eine Spritzpistole von meinem Vater in der Kunsthochschule. Das funktionierte jedoch auch nicht gut, es ging zu viel daneben, vor allen Dingen erboste das den Chef, der immer mal wieder vorbeischaute. Ich griff also wieder zum Pinsel, und zwischendurch mußte ich immer wieder dies und das erledigen oder jemandem helfen, es ging einfach nicht weiter. Jedesmal wenn ich an den halbfertigen Pumakäfigen vorbeikomme, bekomme ich schlechte Laune.
7.September
Zu meinem Glück hat Mister Munro einen der drei schon größeren Elefanten nach Ostberlin verkauft – und ich soll ihn da hinbringen, d.h zusammen mit einem der indischen Pfleger, Cholaf, in einem Güterwaggon begleiten. Munro macht öfter Geschäfte mit dem Osten, das geht über Verrechnungseinheiten – so kostet ein indischer Elefant z.B. zwei sibirische Tiger, die in Leipzig gezüchtet wurden.
26. September
Der Elefant ließ sich willig auf den LKW verladen und anschließend in einen auf dem Bremer Güterbahnhof stehenden geräumigen Waggon führen,, wo man ihn ankettete. Ich einer Ecke wurde Heu und Stroh gestapelt und daneben kam noch ein kleiner Käfig mit Kronenkraniche, die ich morgens noch mit eingefangen hatte, wobei ich wieder mehrmals verletzt wurde. Sie sind ebenfalls für den Ostberliner Tierpark in Friedrichsfelde. Am Güterbahnhof erfahre ich von einem Bahnbeamten, dass die Fahrt mehrere Tage dauert. Zu spät, ich habe nur ein paar Süßigkeiten, eigentlich nur was zum Naschen mit. Der Chef drückte mir ein paar hundert Mark in die Hand – aber wo soll ich die mit dem Güterzug unterwegs ausgeben? Die ganze Familie verabschiedete sich von uns, besonders Jenni, wobei wir uns jedoch alles mit Augenblicken sagen mußten. Der Güterzug hielt alle paar Kilometer, weil er einen Personenzug vorbeilassen mußte oder umgekoppelt wurde. Einige Waggons hängte man ab, andere wurden angekoppelt. Bei jedem Halt versuchte ich mit dem Eimer vor allem erst einmal frisches Wasser für den Elefanten zu besorgen, wobei ich ständig befürchten mußte, meinen Zug zu verlieren – sie sahen für mich alle gleich aus. Als ich dem Zugführer dies sagte, meinte er „Das geht allen so!“ Cholaf blieb im Waggon, diese Arbeitsteilung hatte der Lokführer uns geraten, weil der Inder kein Deutsch oder Englisch sprach und falls er beim Wasserholen verloren ginge, schlecht wieder zurück fände. Noch schwieriger als das Wasserholen gestaltet sich das Essenbesorgen. Wenn der Lokführer und sein Assisstent uns nicht mehrmals mit ihren von zu Hause mitgebrachten Butterbroten ausgeholfen hätten, wären wir fast verhungert.
29.September
Gestern nacht sind wir endlich angekommen. Es war furchtbar anstrengend aber rückblickend auch nicht uninteressant: Auf den unübersichtlichen riesigen Rangierbahnhöfen geriet ich immer wieder in Panik, besonders wenn ich mich immer weiter vom Waggon entfernte. An der DDR-Grenze wechselten die Zugführer. Bevor es weiter ging, besuchten die neuen uns erst einmal im Waggon, wo sie die stoische Ruhe des Elefanten bewunderten. Dann luden sie mich auf ihre Lok ein. Beim nächsten Halt stieg ich zu ihnen. Mit Cholaf konnte ich mich so gut wie gar nicht unterhalten und zu lesen hatte ich auch nichts mitgenommen. Der Lokomotivführer tauschte seine Zigaretten mit mir. Ich rauchte erstmalig Caro-Zigaretten und er Players-. Er erzählte mir lustige DDR- und Reichsbahn- Geschichten, ich ihm traurige Tiergeschichten aus dem Zoo. Die Fahrt zehrte an meinen Nerven, außerdem stellte ich mir unsere Nahrungsmittelversorgung in der DDR noch schwieriger vor als im Westen, nicht einmal Ostgeld besaß ich. Der Lokomotivführer tauschte mir fünfzig DM zum Freundschaftskurs von 1:1 ein, er gab mir auch seine Adresse, falls ich noch einmal – ohne Elefant – in die DDR käme.
Beim nächsten Rangierpunkt wurden noch drei Waggons mit Pferden an unseren Waggon gehängt. Sie waren ebenfalls für den Ostberliner Tierpark bestimmt – für die Raubtiere dort. Der Tierpark in Friedrichsfelde so erfuhr ich, sei der flächenmäßig größte der Welt und das Raubtierhaus, die Alfred- Brehm-Halle, hatte man besonders üppig dimensioniert. Die etwa 60 Pferde, Maultiere und Esel wurden auf ihrer letzten Fahrt von einem alten Mann mit Bart begleitet, der seine Tiere, die er zuvor überall in der DDR eingesammelt hatte, noch einmal ordentlich verwöhnte: sie bekamen Heu und Hafer so viel sie wollten und standen buchstäblich bis zum Bauch im Stroh. Der alte Mann machte diese Arbeit schon seit vielen Jahren. Der Tierpark war 1954 angelegt worden. Unsere Waggons sollten am Bahnhof Lichtenberg ankommen, von dort wollte man uns mit Lastwagen abholen. Kurz vor Berlin gerieten wir jedoch bei einem neuerlichen Rangiervorhaben an die falsche Lok und fuhren in Richtung Rostock gen Norden. In der Nähe von Oranienburg gelang es mir, den Lokomotivführer von der Fehlzusammenstellung seines Zuges zu überzeugen. Beim nächsten Halt wurden Pferde und Elefanten abgekoppelt und wir mußten erneut endlos warten, wieder und wieder wurden wir umrangiert. Dem alten Pferdebegleiter war es egal: „So leben meine Tiere noch eine Weile länger,“ sagte er fröhlich. Schließlich setzte sich der Güterzug aber doch in Richtung Bahnhof Lichtenberg in Bewegung. Ich stieg bei dem bärtigen alten Mann in den Pferde-Waggon. Weil er schon seit Jahren so unterwegs war, hatte er es weitaus gemütlicher als wir in unserem Elefanten-Waggon. Außerdem war es bei den Pferden wärmer und roch besser. Der alte Mann bewirtete mich mit Essen und Trinken und gab mir seine Adresse. Ich sollte ihm Kaffee und Zigaretten schicken – aus dem Westen. Das versprach ich ihm auch.
Er erzählte vor allem Pferdegeschichten – und bedauerte seine Pferde sehr, die Raubkatzen lehnte er dagegen ab: „Die gehören nicht hierher!“ Außerdem hätten sie nicht so ein langes verdienstvolles Arbeitsleben wie die Pferde hinter sich und lägen bloß faul herum. Um sich mit dem Pferdeeinsammler unterhalten zu können, mußte man ständig hinter ihm herlaufen, weil er unentwegt damit beschäftigt war, irgendetwas für seine Tiere zu tun. Dabei redete er die ganze Zeit mit ihnen. Seine drei Waggons hatten aus irgendeinem Grund elektrisches Licht, während es in unserem fast völlig dunkel war, so daß wir die Waggontür immer ein bißchen offen ließen, wodurch jedoch die Kälte hereinkam. Außerdem waren Cholaf und der Elefant so gut wie stumm. Manchmal machten sie den Eindruck, als hätte man gemeinerweise zwei völlig unschuldige Inder auf den Weg nach Sibirien geschickt. Ich war mir ganz sicher, daß die beiden ihr Schicksal inzwischen schwer bedauerten. Cholaf wurde immer dunkelhäutiger im Gesicht und der Elefant immer blasser, permanent wiegte er seinen Kopf fragend hin und her. Wir verstanden uns, konnten aber nur wenig mehr füreinander tun, als weiter höflich und freundlich zueinander zu sein.
In Lichterfelde wurden wir nicht mehr erwartet, als wir endlich ankamen. Ich mußte umständlich im Bahnhof jemanden bitten, beim Tierpark telefonisch unsere Ankunft anzumelden. Aber dann ging alles wie der Blitz. Cholaf und ich wurden ins Gästehaus des Tierparks gebracht, wo wir uns erst einmal waschen und umziehen sollten. Anschließend wartete bereits ein Essen auf uns in einem der Tierpark-Restaurants. Dann zeigte man uns kurz das Gelände. Der Elefant war in der Zwischenzeit bereits ins Elefantenhaus gebracht worden, wo die anderen Elefanten ihn aufgeregt mit ihren Rüsseln begrüßten, abtasteten. Nachdem wir uns von ihm verabschiedet hatten, sanken Cholaf und ich totmüde in die frischen Betten des Gästehauses.
30.September
Heute morgen, als ich den Elefant sozusagen offiziell übergab – im Büro, bot uns die Tierparkleitung an, zwei Tage länger als geplant zu bleiben, damit wir uns richtig erholten könnten. Für den Abend lud uns einer der Elefantenpfleger zu sich nach Hause ein. Es wurde eine kleine Party daraus. Ich unterhielt mich fast die ganze Zeit mit einer jungen Menschenaffenpflegerin, mit der ich schließlich sogar auf dem Wohnzimmerteppich tanzte. Sie lud mich für den nächsten Tag in das Menschenaffenhaus ein.
1. Oktober
Nach dem Frühstück sind Cholaf und ich durch den Zoo spaziert und haben uns noch einmal unseren Elefanten angekuckt – er schien mit seine neuen Mitgefangenen gut auszukommen. Als wir ihn von der Zuschauerseite aus beobachteten, war gerade der Pfleger mit den Elefanten beschäftigt: auch mit ihm schien unser Elefant durchaus zufrieden zu sein. Wenn er auch vielleicht noch ein bißchen zu nervös war, aber das schien uns ganz normal zu sein unter diesen Umständen. Cholaf wollte danach weiter durch den Park spazieren gehen, ich ging zum Menschenaffenhaus, wo mich die Pflegerin bereits erwartete. Wir sahen vom Futtergang aus die Affen hinter Gittern und vor ihnen durch eine Glasscheibe die Zuschauer. Sie schnitten Grimassen oder ruderten mit den Händen. Der Ostberliner Tierpark, so erfuhr ich, sei eine wissenschaftliche Einrichtung und deswegen würden besonders viele Schulklassen täglich dort hinkommen. Ich sah einige Erstklässler, die hingebungsvoll einen alten Schimpansen beobachteten, der gerade gelangweilt eine Banane aß. Vor allem interessierten sie sich jedoch für die Banane, wie ich dann erstaunt feststellte. Schließlich wurde dem Schimpansen dieses Interesse zuwider: Langsam schlenderte er auf die Schüler zu – und zerdrückte plötzlich die Banane vor ihrem Gesicht an der Glasscheibe, von wo aus sie langsam nach unten in das Sägemehl rutschte. Eins der Kinder fing daraufhin an zu weinen, dadurch wurden auch die anderen Kinder auf die zerquetschte Banane im Dreck aufmerksam und im Nu machte die ganze Klasse ein betroffenes Gesicht. Der Lehrer befahl ihnen, sich den anderen Affen in den Nachbarkäfigen zu widmen. Meine Menschenaffenpflegerin bestätigte mir später, als wir zusammen in der Kantine saßen, daß die Südfruchtverschwendung der Menschenaffen ein wirkliches Problem in den DDR-Zoos sei. Langsam wurde sie mir immer sympathischer. Aber am nächsten Tag mußten wir schon wieder zurückfahren, diesmal in einem Personenzug. Die Menschenaffenpflegerin brachte uns zum Bahnhof und gab mir ihre Adresse. Ich versprach, ihr zu schreiben.
12. Oktober
Als wir im Bremer Zoo ankamen, schliefen wir uns erst einmal aus. Auf dem Weg zum Büro erfuhr ich dann von Joy, dass Jenny zu ihrer Tante nach London gefahren sei – und auch dort bleiben werde, weil sie in England zur Schule gehen solle. Das war ein harter Schlag. Am nächsten Tag packte ich meine Sachen und zog wieder in die Wohnung in Utbremen, die leer stand, weil meine Eltern noch auf dem Land waren. Dort überlegte ich mir, was tun? Kam aber zu keinem Schluß, zum Zoo ging ich jedoch auch nicht mehr zurück. Mir war die Lust vergangen. Ich kündigte schriftlich – und bekam dann ein etwas nichtssagendes Arbeitszeugnis von Frau Munro zurück – auf dem komischen Briefpapier, das sie immer benutzte: mit Elefanten und Nashornvögeln drauf.

Sollen wir dort wirklich an Land gehen?
Erst nach 1989 schaffte ich es, noch einmal in den Ostberliner Tierpark zu gehen – und mich nach dem Elefanten zu erkundigen – Anlaß war ein „Schlangenraub“ durch den Westberliner Zoo:
Berlin hat zwei Zoologische Gärten, deren Unterhaltung jährlich mit 30 Millionen DM bezuschußt wird. Der ältere liegt im Westteil mitten in der City. Auf 34 Hektar werden hier 14.000 Tiere gehalten. Er ist eine Aktiengesellschaft. Der Tierpark Friedrichsfelde dagegen war seit seiner Gründung 1954 eine Kultureinrichtung. Auf 160 Hektar werden dort „7361 Individuen in 890 Formen“ gehalten, wie der erste GmbH-Jahresbericht nach der Wende auswies. Ein Rat honoriger West-Beamter beaufsichtigt beide Einrichtungen. Im Zuge ihrer Fusion und unter dem Zwang zum Sparen beschloß dieser Aufsichtsrat, die 17 Aquarien und die Schlangenfarm des Tierparks-Ost zu schließen: Die 104 Fischarten, 161 Schlangen und 42 Schildkrötenarten sollen in den Zoo überführt werden. Das ist die dürre Nachricht. Als ich davon erfuhr, dachte ich: Na ja, vielleicht haben sie es in den bunten West- Aquarien und -Terrarien besser … Doch dann zeigte das Fernsehen weinende Ost- Tierpfleger: „Ich verstehe nicht, wie 32 Jahre Arbeitsergebnisse plötzlich willkürlich zerstört werden.“ Der Leiter der Schlangenfarm, Klaus Dedekind, sagte wütend: „Auf keinen Fall werde ich das Angebot, in den Westen überzuwechseln annehmen.“ Es zeigte auch zum Kampf um den Erhalt des Tierparks wildentschlossene Rentnerinnen aus beiden Stadthälften, die in kürzester Zeit 30.000 Unterschriften sammelten und ein Spendenkonto einrichteten (Kennwort „Rettet die Schlangen“). Als dann auch noch meine PDS-Freundin Angelika mit mir schimpfte – „Du hast ja überhaupt keine Ahnung!“ – obwohl sie so gut wie nie in den Tierpark geht und ich immerhin mal einen Elefanten dorthin begleitet hatte, war ich zu einer gründlichen Meinungsbildung vor Ort bereit.
Der Tierpark Friedrichsfelde war der erste DDR-Betrieb, in dem nach der Wende ein Betriebsrat gewählt wurde. Dieser koordiniert nun den Widerstand gegen die schleichende Abwicklung. Als erstes war 1990 der allseits beliebte Tierpark-Direktor, Heinrich Dathe, Knall auf Fall in den Ruhestand geschickt worden. „Binnen drei Wochen haben Sie Ihre Dienstwohnung zu räumen“. Professor Dathe war im Osten so populär wie im Westen Professor Grzimek. Fünf Tage nach seinem Rausschmiß starb er: genau am Geburtstag des Westberliner Zoodirektors Professor Klös, der heute Aufsichtsratsvorsitzender ist. Die beiden mochten sich nie. „Der Dathe ist dem Klös um so vieles überlegen gewesen“, gibt Jennifer, die Tochter des Großtierhändlers Munro, der mit beiden Zoo-Direktoren Geschäfte machte, zu bedenken. „Klös hätte besser Manager als Zoologe werden sollen“, meint ein ehemaliger Tierpfleger. Zur Verabschiedung Dathes, von der dieser zu dem Zeitpunkt allerdings noch nichts ahnte, hatte Klös im November 1990 eine Rede gehalten. Sie ließ bereits Schlimmes erwarten: „Und wenn ich Ihnen, Herr Kollege, an diesem Ehrentag bekenne, dass vieles im Tierpark Friedrichsfelde mich so begeistert, dass ich es mir auch zwischen Kudamm und Landwehrkanal vorstellen kann, dann werten Sie es bitte als Ausdruck höchsten Respekts“. Professor Dathe verstand ihn sofort. Einer Ost- Journalistin, Gisela Karau, sagte er: „Der Tierpark wird wohl weiterbestehen, aber vielleicht als eine Art Hirschgarten, der keine Konkurrenz für einen Zoo darstellt. Wir waren immer ein Wissenschaftszoo, der Westberliner mehr ein Schauzoo. Und die Wissenschaft muß weg.“
Erst einmal wurden dann rund 170 Mitarbeiter entlassen und für die verbliebenen 286 schwäbische Stechuhren installiert. Die Lehrausbildung der Zoo-Tierpfleger verlagerte man in den Westen. Dann wurden auch die Menschenaffen in den Westen verbracht. Und – wie im Zoo – das Mitbringen von Hunden in den Tierpark verboten. „Das haben wir aber abschmettern können“, so die Betriebsratsvorsitzende Ursula Rahn. Sämtliche gastronomischen Einrichtungen des Tierparks kamen in Treuhand-Verwaltung, die jedoch nichts dafür tat, so daß sie immer mehr herunterkamen. Andererseits wurde aber auch investiert: zum Beispiel 200.000 DM in die Schlangenfarm und 15.000 DM in die Aquarien. Isses die Möglichkeit?! Neuer Tierparkdirektor wurde dann ein Kurator aus dem Zoo, Bernhard Blaszkiewitz. Auch das noch, stöhnte man im Tierpark. Und es gab dann auch einige Kabbeleien. Blaszkiewitz war noch jung und anfangs vielleicht allzu beflügelt von seiner neuer Stellung. „Aber den wollen wir jetzt behalten“, meint die Betriebsratvorsitzende mittlerweile, die im Gegensatz zu den vier unmittelbar betroffenen Tierpflegern optimistisch ist, dass der Beschluß des Aufsichtsrats gekippt werden kann. Notfalls will sie gerichtlich dagegen vorgehen. Ihrer Meinung nach handelt es sich um eine „Betriebsveränderung“ und dabei muß vorher der Betriebsrat gehört werden. Dieser Meinung ist im übrigen auch der Betriebsrat des Zoos, der sich in dieser „brisanten Angelegenheit“ mit seinen Ost-Kollegen solidarisiert hat, wie er dem Berliner Bürgermeister, Eberhard Diepgen, schrieb. Der Regierende ließ daraufhin verlauten, ein Tieraustausch sei zwar Sache der Zoo-Leitungen, aber man müsse bei diesem Thema besondere Rücksicht auf die Befindlichkeiten der betroffenen Menschen im Ostteil nehmen.
Selbst Tierpark-Direktor Blaszkiewitz war durch den „Tausch“-Beschluß brüskiert worden: „Sie haben ihn vor die Tür geschickt und dann wie einem dummen Jungen das Ergebnis verkündet“, weiß eine der Frauen am Tierpark-Lotteriestand. Als Kurator im Zoo war Dr. Blaszkiewitz insbesondere bei den älteren reichen Damen (den sogenannten Wilmersdorfer Witwen, „unseren Gönnern“ im Zoo-Jargon) beliebt gewesen. Von diesen zog er etliche mit in den Tierpark rüber. Eine, Inge Fischer, findet sich schon – mit 35.000 DM – im Tierpark-Jahresbericht 1992 an erster Stelle und mit Foto auf der „Spender“-Liste. Eine andere, Ilona Albert, initiierte nicht nur eine Öffentlichkeitskampagne gegen den Aufsichtsratsbeschluß, sie schrieb auch bitterböse Briefe an alle Verantwortlichen: „Die Ostberliner können nicht verstehen, dass ein Gremium von 13 Westberliner Männern beschließt, die Reptilien zu deportieren. Kein Mensch versteht, warum der kleine Zoo West auch noch diese Tiere haben muß. Umgekehrt wäre es allen Menschen begreiflich, weil der Tierpark Ost sehr groß ist. Ein Gleichnis drängt sich auf: Ein reiches Kind sieht, dass ein armes Kind eine schöne, bunte Murmel hat, und nimmt ihm diese mit der Begründung weg, dass es dafür eine schickere Schachtel hat …“ Das Ehepaar Liebau, „Zoo-/Aquariumsaktionäre und Tierparkspender“, forderte öffentlich die „Abwahl des Aufsichtsrates“ und machte erst mal auf die Geldverschwendung im Zoo aufmerksam: „Erst Renovierung des Dienstwohnhauses vom ehemaligen Revierpfleger Herrn Walther – dann Abriß“ – zum Beispiel.
Im Osten gibt es indes noch weit mehr ältere Besucherinnen des Tierparks, die bereit sind, für seinen Erhalt auf die Barrikaden zu gehen. Zwischen 1955 und 1970 leisteten Tausende von Menschen mehrere Millionen „Aufbaustunden“ für das beliebteste „Nationale Aufbauwerk“ (NAW): die Umwandlung bzw. Erweiterung des ehemaligen Schloßparks Friedrichsfelde zu einem Tierpark. Ganze Betriebe engagierten sich: eine Berliner Bettenfabrik spendete Störche, die Kinderzeitschrift „Bummi“ einen Giraffenbullen (namens „Bummi“), das Ministerium für Staatssicherheit – sinnigerweise – Stachelschweine. Jetzt sammeln Mitglieder des Lichtenberger Tierschutzvereins („Es geht hierbei nicht um artgerechte Haltung, das ist eine Abwicklungsfrage“) und die Bürgerinitiative „Frankfurter Allee Süd e.V.“ Protestunterschriften und Geldspenden „für die Modernisierung der Schlangenfarm in Eigeninitiative“. Eine von ihnen, Kerstin Bodnar, schrieb an Professor Klös: „… dass Sie in Afrika keine Giftschlange biß, liegt sicher nur daran, dass diese nichts von Ihrem Aufsichtsratsbeschluß und der ‚Verschleppung‘ unserer Tierparkschätze in den Zoo wußten … Aber die Protestwelle beweist, dass er falsch war. Alle Berliner hat das zutiefst erschüttert und fassungslos, aber zum Glück nicht handlungsunfähig gemacht.“ Eine andere, Cläre Mausser, schrieb in einem offenen Brief: „Der Schlangenfarm-Pfleger Klaus Dedekind soll vom Zoo (West) übernommen werden. Und er hat abgelehnt mit den Worten: ‚Ich lasse mich nicht kaufen!‘ – Dass es noch solche Menschen gibt!! Dieser einfache Mann sollte vielen ein Vorbild sein. Bei aller Verbitterung, die uns Ossis immer mehr erfüllt, richtet dieser Mann uns auf, und wir sind stolz auf ihn, genauso wie auf die Kalikumpel von Bischofferode …“
Die Aquariumspflegerin Carla Ruß, die den Rotschwanz-Wels „Charly“ aus der Hand füttert, geht noch weiter als Dedekind: „Nie wieder werde ich einen Fuß in das Zoo-Aquarium setzen!“ „Die Zusammenarbeit zwischen Zoo und Tiergarten hat ihren Tiefpunkt erreicht“, berichtete denn auch der Zoo-Betriebsrat dem Bürgermeister, den mittlerweile Protestschreiben vom San Diego Zoo bis zum Potsdamer Universitätsinstitut für Zoologie erreicht hatten. Einer der Wissenschaftler dort, Dr. Weber, hatte sich besonders über eine Radiosendung zum Thema „Schlangenfarm“ geärgert. Die gewachsenen Bindungen des SFB, aber auch des Immobilienhändler-Senders 100,6 (Eigentum verflechtet!) lassen einen guten Überblick auf das Gesamtsendegebiet nicht zu. In diesem Fall gipfelte die journalistische Unbefangenheit in dem Wunsch: „Das ‚olle Schlangenhaus‘ und die Ostberliner Meckerstimmen mögen bald der Zoogeschichte angehören.“ Dr. Weber fand das „makaber“ und gab Nachhilfeunterricht. Die größte Giftschlangenfarm Europas stammt ursprünglich aus einer Serumfabrik bei Dresden. Als diese geschlossen wurde, brachte der „legendäre“ Pfleger, „Vater (Fritz) Kraus“ die Tiere mit in den Tierpark. Sein Nachfolger wurde dann Dr. Petzold und schließlich Klaus Dedekind. Kurator der Farm ist heute der Dahte-Sohn Falk. Früher geschah das „Abmelken“ des Giftes noch coram publicum. Die „Schlupferfolge“ sind bis heute beachtlich. Da man in der Vergangenheit im Westberliner Zoo stets Giftschlangen-Geschenke abgelehnt und laut Betriebsrat auch Angst vor diesem massiven Neuzugang hatte, vermutete Dr. Weber, dass die Reptilien dort „zumindest längere Zeit hinter die Kulissen verschwinden müssen“. Das ist „kein Ruhmesblatt für die Berliner Kulturpolitik“. Die hat damit jedoch nichts zu tun, eher schon der Finanz- und der Gesundheitssenator, deren Vertreter auch im Aufsichtsrat sitzen. Weitere stellt die Commerzbank, die Landesbank, die Oberfinanzdirektion und eine Immobilienfirma. Dass diese Herren der „bedeutenden Berliner Bildungs- und Forschungsstätte“ gewachsen sind, darf bezweifelt werden.
Ihr Problem hängt mit dem unterschiedlichen Charakter der beiden Einrichtungen zusammen: Zoo und Aquarium (sowie Botanischer Garten) entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, etwa zur gleichen Zeit wie das nach englischem Vorbild im Panoptikumsstil erbaute Moabiter Gefängnis und die nach französischem Vorbild konzipierte Irrenanstalt auf dem Gut Dalldorf, später „Bonhoeffer Heilstätten“ genannt. Die Zoo-Anlage wurde vom preußischen General-Gartendirektor Peter Joseph Lenné entworfen, der dann, neben Alexander von Humboldt, auch in der Verwaltungs-Kommission des „Actien- Vereins Zoologischer Garten Berlin“ saß.
Zwar wurden in all diesen fünf Institutionen nicht-ausgereifte, unvernünftige Lebewesen verwahrt, konzentriert und teilweise erforscht, d.h. erst einmal systematisiert, aber es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Gefängnis und Irrenanstalt einerseits und Zoo/Aquarium/Botanischer Garten andererseits: In ersteren geht es vor allem um die Isolierung der Gefangenen – auch voneinander. Im Gefängnis durften die Inhaftierten nicht einmal miteinander reden, außer mit „gesitteten Personen“. Und bis heute dürfen sie sich nicht paaren, während die Tiere und Pflanzen dazu regelrecht gezwungen werden … Während also dort ein Mangel an sittlicher Vernunft weggesperrt wird, herrscht hier quasi ein Überschuß. Da den vor-menschlichen Wesen aber Seele und freier Wille abgesprochen werden, bezieht sich das nicht auf sie – sozusagen persönlich, sondern auf ihren überindividuellen Platz in der ästhetischen und wissenschaftlichen Gesamtanordnung der jeweiligen Anlage. „Artgerechte Haltung“ verkürzt sich dabei auf „Vermehrungsfähigkeit“. „Unterhalb der Schafarten kann man nur noch die Schafe zählen“, meinte Michel Foucault einmal, für den die animalische Liebe ein Fest war, das ihn traurig und glücklich zugleich machte.
In einem Vorschlag zur Abschaffung des Eintrittsgeldes für den Berliner Zoo pries die „Vossische Zeitung“ im 19. Jahrhundert dessen „Gemeinnützigkeit für alle“, seinen „stillen erheiternden Naturgenuß für Arm und Reich“ und „schönen Zweck einer wahren Volksbelehrung“. Dieser „Volksbildungsauftrag“ gilt nahezu unverändert bis heute. Im Osten noch mehr als im Westen. Weswegen es dort eine Vielzahl von Anbindungen an Forschungseinrichtungen gab, und sogar die Pfleger-Ausbildung – erstmalig – wissenschaftlich geregelt wurde. Unterhalb dieses Bildungsauftrags hat sich demgegenüber der Westberliner Zoo, der seit dem Mauerbau immer enger ausgestaltet wurde, mehr und mehr zu einer rohen Volksvergnügungsstätte gewandelt, wo es um Attraktionen und unmittelbares Erstaunen geht. Wegen der Spielplätze und der vielen Besucher auf engem Raum (beide Anlagen verbuchen je eine Million Besucher jährlich) ist es laut und hektisch im Zoo, erst recht im Aquarium. Hinzu kommen noch die allzu vielen Tierplastiken. Anders als beim Tierpark Friedrichsfelde, lange Zeit der flächenmäßig größte der Welt, und beim Botanischen Garten, fühlt man sich nach einem Zoo-/Aquariums-Besuch nicht besser als vorher, im Gegenteil: eher mitschuldig. Im – wohl artgerecht für Pfleger mit Nirosta- Stahl und Kacheln eingerichteten – Menschenaffenhaus fragte ein Gorilla- Junges neulich schon seine Mutter: „Mama, wenn es kein Verbrechen ist, Gorilla zu sein, warum sind wir dann überhaupt eingesperrt?“
P.S.: Die Proteste gegen die Verkleinerung des Tierparks hatten zunächst Erfolg. In den Aufsichtsrat wurde ein Ostler – Lothar de Maiziére – berufen. Außerdem wurde die Schlangenfarm in zwei Bauabschnitten weiter modernisiert. Mit Spenden und aus Landesmitteln. Aber dann – im Jahr 2002 – verkündet der Senat doch, unter Hinweis auf die angespannte Finanzsituation, dem Tierpark alle Mittel zu streichen. Seitdem werden sie alljährlich gekürzt – und die Diskussion um eine Zusammenlegung von Zoo und Tierpark erneut belebt. Einige für Ökologie und Umwelt zuständige Bezirks- und Stadtparlamentarier votieren inzwischen für einen ganz neuen – auf dem Gelände des Flughafens Tempelhofs, wo 2007 der Flugverkehr eingestellt werden soll.

Das ist hier doch ganz eindeutig aus dem Mittelalter. Ach, Unsinn!
2008 führte ich dann noch ein Interview mit einem Elefantenpfleger aus dem Ostberliner Tierpark: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/10/11/
Außerdem korrespondierte ich mit der Tochter des Bremer Tierparkbesitzers George Munro: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2008/07/25/hausmeisterkunst_269/
Interview mit dem Chef-Tierpräparator des Naturkundemuseums: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/08/18/
Anläßlich eines Vortrags über Schwäne, den ich zusammen mit Peter Berz in der Galerie „Morgenvogel Real Estate“ halten sollte, kam ich auch noch mal auf ein Schwanenerlebnis aus dem Bremer Tierpark zurück: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/10/12/die_schwarm-_und_schwanforschungder_stand_der_dinge/
Sind Zootiere eigentlich „Stadttiere“ oder befinden sie sich in einer Art Zwischenraum – zwischen diesen und in der Wildnis lebenden Tieren? Während die Zootiere z.T. mit Fernsehen ruhig gestellt werden (die Gorillas im Pariser Zoo z.B. kucken am Liebsten Western), werden die Stadttiere gerne gefilmt und mehr und mehr spielen sie auch in Filmen und auf Bühnen mit:
Tierfilme erfreuen sich steigender Beliebtheit – und manche Tiere werden regelrechte Stars, mit eigenen Trainern, Betreuern und Managern: das Pferd Fury, der Colly Lassy, der Killerwal Willy, die zwei Toyota-Äffchen, der Kommissarhund Rex usw. Im Berliner Märkischen Viertel eröffnete die ehemalige Chefsekretärin bei Borsig, Rosemarie Fieting, mit einer Lizenz der Bundesanstalt für Arbeit eine Künstleragentur, die auch Tiere vermittelt. Dahin wendet sich nun z.B. eine alte Dame, die ihren Graupapagei für besonders intelligent und witzig hält und ihn ins Fernsehen bringen will. Oder auch eine junge Punkerin – mit ihrer schwarz-weißen Ratte. Wobei aus der Sicht von Rosemarie Fieting die Herrchen oder Frauen meistens „schwieriger“ sind als deren Tiere, weil sie so oft besondere Bedingungen stellen: Bei einer Katze, die für 400 DM in einem Lehrfilm der Freien Universität mitspielen sollte, waren das u.a.: „keine Scheinwerfer, keine Zugluft und keine Straßenszenen“. In der Regel kommen jedoch Leute in die Künstleragentur, die mit ihren Tieren immer wieder auftreten – und schon fast davon leben. Meistens wohnen sie am Stadtrand. Im Westen ist das z.B. Bernd Wilhelm. Er lebt im Schrebergarten-Kleingewerbegebiet in Haselhorst, unweit des Kraftwerks „Ernst-Reuter“. Der gelernte Tierpfleger arbeitete in den Tierversuchslabors der FU. Nach einer Infektion wurde er Frührentner. „Schon immer“ hatte er sich privat Tiere gehalten – die überdies gerne irgendwelche „Dummheiten“ machten. Mit den Jahren entstand daraus eine ebenso eigenwillige wie freundliche Dressurmethode, die sich heute auszahlt, insofern Herr Wilhelm mit seinen Tieren von Film- und Fernsehproduktionen oft und gerne „gebucht“ wird: „Die Tiere arbeiten für ihren Lebensunterhalt.“ Daneben tritt er – mit seinen Eseln, Ponys und Ziegen etwa – auch bei Laubenpieperfesten auf und unternimmt Kutscherfahrten mit spastischen Kindern. Außerdem hält er für Problempferde eine „orthopädische Hufbehandlung“ parat, verbunden mit einer „speziellen Methode: Klebeschuhe aus Plastik“. Alles im erlaubten „Rahmen des 580-Mark- Zugewinns“. Die meisten seiner Tiere landeten nach einer „Leidensgeschichte“ bei ihm, und sie müssen nicht auftreten, wenn sie nicht wollen. Die Perserkatze „Missy“ zum Beispiel „wurde schlecht behandelt“: Jetzt liegt sie die meiste Zeit hinterm Ofen in einem Pappkarton. Benno, der kurzbeinige schwarze Hund, gehörte einer Punkerin, die jetzt in einem Haus der Treberhilfe wohnt: „Aus ihm könnte noch mal was werden.“ „Fuchsy“ wurde angefahren am Straßenrand gefunden. Der Kapuzineraffe „Kingkong“ „arbeitet zwar nicht gerne, ist aber dafür nie böse“. Er mag am liebsten Limonade und Gummibärchen und liegt abends neben der für Kunststücke zu alt gewordenen Schäferhündin Sandra. Alle Tiere, auch die Waschbären, der Nasenbär, die Zwergschweine und die Hühner verstehen sich untereinander: „Das müssen sie auch, sonst geht das gar nicht.“ Herr Wilhelm lehnt Aufträge, bei denen sie „schwierige Sachen“ machen sollen, ab. Neulich buchte die Volksbühne seinen Hengst, damit der auf der Bühne mit herabhängendem Gemächt und von den Schauspielerinnen bewundert, auf und ab gehe. Als das nicht klappte, schlug Wilhelm vor, ihm einen Plastikpenis umzubinden. Das fand Chefdramaturg Lilienthal jedoch allzu unrealistisch, statt dessen schlug er eine „leichte Narkose“ für das Tier vor (dabei hängt das Gemächt unwillkürlich herunter). Wilhelm fand diese Forderung unannehmbar. Auch der Tierschutzverein intervenierte laut B.Z. bei der Volksbühne. Andere Tiere von Wilhelm kamen dagegen ganz gut bei den Bühnenverantwortlichen im Osten an: Der Esel Max spielte wochenlang am Gorki- Theater, seine Ziegenherde wird immer wieder bei Castorfs „Weber“-Inszenierung eingesetzt und die Perlhühner gackern auf der „Rollenden Road-Show“ . Wilhelms Ziegenbock tritt regelmäßig bei „Porgy und Bess“ auf, wenn das US-Musical in Berlin gastiert. Bei den schwarzen Schauspielern machte Wilhelm die Erfahrung, daß die Stars ihn genauso respektvoll behandeln wie die Statisten: Das ist sonst meist nicht so – Dieter Hallervorden und Hape Kerkeling hält er z.B. für „fürchterliche Menschen“. Die größte Schwierigkeit sind sowieso die Schauspieler, „die sich erst an die Tiere gewöhnen müssen“. Insbesondere galt das neulich für einen ORB-Moderator bei Wilhelms zwei Riesenschlangen. Sein Hahn spielte jüngst im Videoclip der Lassie Singers mit: Er mußte auf einer Haltestange in der U-Bahn sitzen. Dabei schiß er der Sängerin auf den Kopf. Einige Kinder, die in der Schrebergartensiedlung wohnen, helfen Bernd Wilhelm gelegentlich beim Füttern und Ausmisten – die Friseuse Manuela schon seit 12 Jahren. Zu Hause hat sie selbst drei Hunde, einige Katzen und Fische. Während ich Bernd Wilhelm interviewte, erlaubte „Kingkong“ mir, auf der Couch Platz zu nehmen. Als Manuela kam, bestand er jedoch darauf, daß ich ihren Stammplatz räumte. Zur Zeit sucht der wenig begüterte Herr Wilhelm einen leerstehenden Resthof im Umland: Haselhorst ist zu eng geworden.
Im Osten gibt es das Ehepaar Ralf und Manuela Grabo – sie leben in Hoppegarten. In ihrer ausgebauten Scheune und in mehreren Volieren im Garten halten sie vier Hühner, drei Greifvögel, einen Kolkraben und zwei Pferde. In zwei Terrarien leben fünf Riesenschlangen und in einem Aquarium etliche Fische. Ralf Grabo war früher Jockey und arbeitete dann im Tierpark (im Raubtierhaus), Manuela Grabo hat, als gelernte Tischlerin, früher nie was mit Tieren zu tun gehabt. Sie fand jedoch Schlangen „schon immer schön, mein Liebling aber ist der Uhu“. Dieser sowie die anderen Greifvögel wurden zu DDR-Zeiten aus Nachzuchten erworben, teilweise über befreundete Falkner. Über den Heimtierpark Thale fanden die Grabos 1995 ihren Kolkraben „Kolja“, der schon seinen Namen sowie „Hollo“ sagt, außerdem kann er bellen und gackern. Ihre Nebelkrähe spielte in einem neudeutschen Film im Knast Rummelsburg mit sowie in einem phantastischen US-Film – auf einem See in der Sächsischen Schweiz, wo sie auf dem Rand eines im Wasser schwimmenden großen Schuhs entlangzugehen hatte: „Die tat das, als hätte sie nie etwas anderes gelernt.“ Auch die Zumutung, mit einem fremden Hund zusammen einen überfahrenen Hasen an der Landstraße zu verspeisen, absolvierte sie mit Bravour: „In die Kamera fliegen mußte sie dann auch noch, und dann hatte die Filmproduktion auch noch nicht mal Geld dafür.“ Das liebe Geld: „Das sind Aufwandsentschädigungen, die nicht einmal den Unterhalt der Tiere decken.“ Eines der Graboschen Hühner spielte – für ein Trinkgeld – in einem Kinderfilm mit: auf einem schwankenden Oderkahn. „Auch das hat gut geklappt, mit der Zeit werden wir ja sowieso alle, wie soll ich sagen: professioneller.“ Neulich brauchte RTL eine Schlange, die sich kurz um einen beleuchteten Globus windet: Grabos Boa schaffte es, ohne daß Styropor-Stückchen als Stützen für sie auf die Kugel geklebt werden mußten. Bei einer anderen Dreharbeit traf Ralf Grabo auf den amerikanischen Vogeltrainer, der einst mit Hitchcocks „Vögeln“ (1 und 2) gearbeitet hatte – er bat ihn sofort um ein Autogramm: „So jemand ist für mich natürlich interessanter als irgendsoein Star.“ Mit Greifvögeln darf man laut des nun auch im Osten geltenden Bundestierschutzgesetzes nur beschränkt kommerziell auftreten. Grabos Bussard trat neulich in einem Volksbühnen-Stück von Johann Kresnik auf: Er saß auf dem ausgestreckten Arm einer schwangeren Schauspielerin. Obwohl der Bussard kaum Probleme mit dieser Rolle hatte, durfte er dann nicht mit auf ein Gastspiel der Volksbühne nach Belgrad: „Die Behörden wollten es nicht genehmigen. Serbien gehöre nicht zur EU und so weiter.“ Wegen dieser Restriktionen nehmen die Filmproduktionen meist gleich einen Falkner in Anspruch oder einen Vogel der Adlerwarte im Teutoburger Wald. Und dann haben die Grabos auch noch zunehmend mit politisch korrekten Jungjournalisten zu kämpfen, die – wie tip-TV jüngst – immer wieder gerne feige-mutige Dumpfreportagen über falschverstandene Tierliebe beim Halten seltener Tiere in urgemütlichen 3-Zimmer-Wohnungen senden: „Solche Tiere gehören in den Urwald!“ Manuela Grabo meint: „Eigentlich haben wir einen ganz schweren Stand in dieser Gesellschaft, wir sind eine Randgruppe. Und wie die Behörden mit uns umgehen, das grenzt mitunter schon an Schikane.“ Mit einigen Schlangen veranstaltet sie regelmäßig „Patientenabende“ in Reha-Kliniken: „Das hat sich so aufgebaut“, wobei sie kein „Zirkusspektakel“ veranstaltet, sondern primär „Aufklärung“ leistet. Auch ihre Schlangen kommen nicht aus dem Urwald, sondern aus der DDR. Eine wirkte neulich in einer TV-Dokumentation über verbotenen Tierhandel mit, wo sie auf dem Schwanebecker Zollhof in einer Voliere eine beschlagnahmte Python zu mimen hatte, die sich auf einem Ast zusammenringelt und noch ganz benommen war von der ganzen Schmuggeltour: Es klappte auf Anhieb.
Schon seit längerem im Geschäft ist Monika: eine an den Stadtrand nach Velten gezogene Fremdsprachensekretärin aus Westberlin. Sie besitzt derzeit sieben Hunde und durchstöbert laufend polnische Tierasyle nach weiteren. Sie wohnt mit den Tieren allein in einem Reihenhäuschen – innen wie außen ist alles geradezu spießig sauber. Monika arbeitet mit den Hunden und kann bereits davon leben: Sie bildet sie für Bühne und Film bzw. Fernsehen aus.
So musste ihr Mischlingsrüde Stepan zum Beispiel gerade für das ZDF mit einem Stück Holz, auf dem eine Krähe saß, über einen Fluss schwimmen. Diese erledigte das ebenso professionell wie der Hund, der gleich anschließend für Pro 7 in einer Verfolgungsszene einen sterbenden Jagdhund mimte – ebenfalls zur Zufriedenheit aller. Oft ist es sogar so, dass die Schauspieler eine Szene öfter wiederholen als Monikas darin mitwirkenden Hunde.
Mehr und mehr müssen auch die noch wilden Tiere in Filmen mitspielen. Wenn z.B. Fernsehteams von ihren Sendern im Winter in den Wald geschickt werden – um in einem bayrischen, polnischen oder kanadischen Wald zu filmen, wie es gerade den Bären, Hirschen, Wölfen, Dachsen etc. dort so geht, dann fällt ihnen dabei unweigerlich das Wort „Überlebenskampf“ ein, manchmal noch mit dem Zusatz „hart“ bzw. „erbarmungslos“. Es ist kalt, die Füße sind vom hohen Schnee naß geworden, das Essen ist Scheiße, das Equipment spinnt, der Kameramann kann vor lauter klammen Fingern nicht mehr richtig drehen, der Kameraassistent steht mit seinen Eisfüßen mehr im Weg als das er hilft und dann sind die ganzen Viecher, auf die sie es abgesehen haben, auch noch so verdammt schwierig zu erwischen. Entweder halten sie sich an unmöglichen Orten auf oder das Licht stimmt nicht…Aber die Redaktionen daheim – im Warmen – drängen unbarmherzig. Das Budget ist bereits „robust überzogen“ (O-Ton Buchhaltung) und dann muß zu allem Überfluß auch noch ein Teil des Tons wiederholt werden…Alles in allem steckt das Filmteam genau in dem „harten Überlebenskampf“, den es in der unbarmherzigen Natur vor sich filmt. Subjekt und Objekt sind nahezu identisch geworden.
Auch wenn die TV-Teams bei ihrer Arbeit auf einen ganzen Tross von (lokalen) Helfern zurückgreifen können – angefangen von der Cateringfirma bis zur Autovermietung und den Wildhütern der Nationalparkverwaltung als Guides sowie den besten für sie reservierten Hotelzimmern in der Nähe ihrer Drehorte. Dafür sind die Objekte der Begierde ihrer Redaktionen – die Tieres des Waldes – Kummer gewohnt, d.h. sie sind überaus erfahren im harten Überlebenskampf – sie verhalten sich dort schon fast instinktmäßig richtig – also „optimal“. Obwohl man off the record natürlich zugeben muß, dass die Tiere im Nationalpark schon lange ganzjährig geschont sind, d.h. nicht gejagt werden dürfen und dazu noch im Winter zugefüttert bekommen, so dass sie immer mehr ihre Scheu verloren haben. Die Füchse kann man schon fast streicheln und die Wildschweine sind so dreist, dass man sich inzwischen umgekehrt – vor ihnen – in acht nehmen muß. Aber auch das gehört ja streng genommen noch zur Unbarmherzigkeit der Natur! Für die Fernsehteams – als Frontschweine ihrer Medienkonzerne – bedeutet das eine zusätzliche Tortur, denn ihre Dreharbeiten laufen dabei immer mehr auf eine Fakeproduktion hinaus – insofern z.B. die Hirsche teilweise über eine Waldlichtung regelrecht gescheucht werden mußten, um kurz vor Sonnenuntergang noch schnell ein paar Bilder von einem flüchtenden Rudel zu bekommen.
Diese werden dann später mit drei über verschneite Äcker laufende Wölfe gegengeschnitten. Die Wölfe hatte die Firma „Action Animals“ angeliefert, für 600 Dollar – pro Stück und Tag. Es handelte sich dabei um besonders filmerfahrene Tiere, die eine regelrechte Ausbildung in der Schweiz genossen hatten. Aber dazu kam dann noch ihre Anlieferung per Flugzeug sowie die Spesen ihrer drei Trainer, ihrer zwei Pfleger und ihres Masseurs. Letzterer war nebenbei und vor Ort auch immer noch für die PR der Firma „Action Animals“ von Gerry Therrien in Vancouver zuständig, weswegen laufend irgendwelche Radio- und Lokalzeitungs-Fritzen an den Drehorten aufkreuzten, wo die drei Wölfe vor der Kamera liefen. Kurzum: Trotz oder gerade wegen der ganzen unbarmherzigen Natur wurde der Dreh zusehends unnatürlicher – und für Außenstehende absurder. Besonders die Wildhüter der Nationalparkverwaltung schienen das ganze mehr und mehr für ein Schwindelunternehmen à la „Borat“ zu halten. Sie standen aber auch als eine Art Doppelagenten den Fernsehleuten gegenüber: Einerseits wurden sie dafür bezahlt, dass sie das Filmteam und die Wolfscrew mit ihren Wölfen zu den optimalen Drehorten führten – und sogar die eine oder andere Tierart aufstöberten bzw. vor die Kamera trieben. Andererseits waren sie aber auch deren Kontrolleure im Auftrag der Parkverwaltung, d.h. sie hatten darauf zu achten, dass das Filmteam nicht einem der 96 Parkverordnungen zuwiderhandelte, dass die Tiere des Waldes nicht „unnötig beunruhigt“ wurden, usw. gleichzeitig waren sie aber auch dafür verantwortlich, dass es dem Filmteam an nichts mangelte und sie den besten Eindruck vom Nationalpark mit nach Hause nahmen. U.a. stellten sie immer wieder ihre leistungsstarken Funkgeräte zur Verfügung, die auch noch da funktionierten, wo die Handys der Filmer wieder mal in ein Funkloch geraten waren – z.B. als es galt, den angemieteten Hubschrauber für die Aufnahmen von oben zum Standort zu lotsen. Am Ende kam dabei ein 22minütiger Film über „Die Tiere des Waldes im Winter“ heraus, der dann lieblos zwischen Weihnachten und Neujahr von einigen Dritten Programmen ausgestrahlt wurde. Die Wildhüter, denen der Sender als Dank eine Kopie geschickt hatte, fassten sich an den Kopf, als sie den Film sahen – ob dieser grotesken Diskrepanz zwischen Aufwand und Wirkung.
Vom Tierfilmer zum Zooeinrichter: „Naturfilmer Prof. Heinz Sielmann stellt Stiftungsprojekt in der Döberitzer Heide vor“, kam es über den Ticker. Die Heinz Sielmann Stiftung, in der Heinz Sielmann federführend ist, hatte hinter Staaken 3.422 Hektar Naturlandschaft erworben, die zuletzt der Roten Armee als Truppenübungsplatz diente. Den dortigen Kasernensozialismus überlebten jedoch selbst seltene Arten wie Ziegenmelker und Fischotter, Sumpfknabenkraut, Lungenenzian und Sonnentau. Nun sollen noch Wisent- und Wildpferdeherden dazu kommen – so will es Heinz Sielmann.
Als wir ankamen, waren wir sofort mit fünf Euro dabei – als „Förderer“ seiner dortigen „naturplanerischen Maßnahmen“, deren erster Teilabschnitt bereits kurz vor dem Abschluss stand, wovon man jedoch quasi naturgemäß wenig sehen konnte. Dafür stand das „Informationszentrum für Besucher“ schon – und aus Anlass des Aktionstages viele weiße Informationszelte am Eingang. Dahin gelangt man über das berühmte Dorf Dallgow-Döberitz. Dahinter kommt dann ein Abzweig ins „Olympische Dorf“, was heute eine moderne rot leuchtende Siedlung für Frischvermählte ist, sowie in die Reichsbahnsiedlung Elstal, wo sich heute die eurasische Missionszentrale der US-Baptisten befindet. Vorher biegt man aber rechts ab über die Bundesstraßenbrücke, die direkt zum Parkplatz der Sielmann’schen Naturlandschaft führt. Von den geplanten Schaugehegen existiert bis jetzt nur eins mit Ziegen, die uns jedoch alle sehr freundlich begrüßten.
Über den Stifter erfuhren wir dann anhand einiger Broschüren und von kundigen Naturfreunden: Der Tierfilmer Heinz Sielmann arbeitete in den 50er-Jahren mit dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz zusammen und unternahm mit Hans Hass eine Schiffsexpedition zu den Galapagos-Inseln, an der sich auch der Lorenz-Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt beteiligte. 1964 gründeten Hass und Eibl-Eibesfeldt ein Privatinstitut für biologische Analysen menschlichen Verhaltens in Liechtenstein, das unter anderem auch Leni Riefenstahl – bei ihrem Unterwasser-Filmprojekt – unterstützte. Sielmann blieb bis 1991 dem NDR verbunden. Seine große Zeit im deutschen Fernsehen waren die 70er-Jahre, wo er langsam den Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek an Beliebtheit übertraf, mit dem zusammen er die Zeitschrift Das Tier herausgab. Sielmanns 170 Sendungen aus der Zeit nannten sich „Expeditionen ins Tierreich“. Er bemerkte jedoch, dass das Genre Tierfilme immer inflationärer wurde. Zusammen mit seinem „Haussender“ widmete er sich in den 80er-Jahren erst filmisch und dann, nach seiner Trennung vom NDR 1991, auch praktisch dem Naturschutz: mit einer Stiftung.
Die 1994 gegründete „Heinz-Sielmann-Stiftung“, in dessen wissenschaftlichen Beirat u. a. Eibl-Eibesfeldt sitzt, kauft und sichert große Flächen vorwiegend in Ostdeutschland, um dort Wild- und Naturlandschafts-Parks einzurichten: 2.742 Hektar Braunkohlefolgelandschaft um Wanninchen bei Luckau, 1.055 Hektar Seenlandschaft bei Groß Schauen, 900 Hektar ehemaliges Grenzgebiet im Eichsfeld, 13 Hektar Stauseelandschaft im Glockengraben bei Teistungen und zuletzt eben die 3.422 Hektar große Döberitzer Heide.
Darüberhinaus beteiligt sich die Stiftung, die ihre Zentrale auf dem Gut Herbigshausen bei Duderstadt eingerichtet hat, auch noch an der „Darwin Forschungsstation“ auf den Galapagos-Inseln, an einigen Vogelschutz- und -pflegestationen in Deutschland und Italien sowie an der russischen Vogelwarte Rybatschi (früher Rossitten) auf der Kurischen Nehrung, wo das Sielmann’sche Naturfilmen kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begann. Wenig später wurde er erst Lehrer in der Funkerausbildung, wo er Joseph Beuys kennen lernte, und dann von der Wehrmacht als Tierfilmer auf Kreta eingesetzt. Dort blieb er bis zum bitteren Ende – und drehte. Die siegreichen Engländer schickten ihn dann samt seinem Filmmaterial nach London, wo er für die BBC drei Tierfilme daraus machte. Über diesen Sender gelangte er schließlich auch wieder zurück nach Deutschland – zum NDR. Das war’s. Aber so viel erfährt man sonst selten bei einem Ausflug in stadtnahe Naturlandschaften. Und weil wir schon mal dort waren, kuckten wir uns auch noch im nahen Dorf Dallgow-Döberitz um.
Es gibt dort inzwischen mehr Pferde als Menschen. „Dallgow is a peaceful place surrounded by meadows of wild flowers, corn fields and forests“, schreiben die drei West-Bauherren des neuen „Parkhotels“ dort. Selten wurde in einem Werbeprospekt dreister gelogen: Die kleine Gemeinde vor dem Olympischen Dorf, in dem sich zuletzt die Garnison Elstal der Roten Armee befand, macht eher den Eindruck, als hätte man dort plötzlich Gold gefunden. An allen Ecken und Enden wird gebaut. Den Anfang machte die Reitschule Dietrichsmeyer, als sie von der Deutschlandhalle nach Dallgow umzog, wo sie sich auf LPG-Land – mit einem „Springreiter“- Casino nebst „Springreiter“- Hotel – erheblich vergrößerte. Es folgten zwei „Polo-Clubs“, ein Ponyhof und die Sattlerei Henning.
Mittlerweile hat sich fast jeder Dallgower Resthof zu einem Reitcenter gemausert, und alte Fachwerkscheunen wurden zu modernen Brainstorming-Büros umgerüstet. Annähernd 400 Pferde gibt es jetzt schon in Dallgow, weitere 250 stehen in zwei nahe gelegenen Dörfern. Auf den von Baufahrzeugen ruinierten Dorfstraßen sieht man alle paar Minuten junge Blondinen aus Charlottenburg hoch zu Roß, es gibt mehr Mercedesse als Fahrräder. Der aus Spandau stammende Bürgermeister holte aber nicht nur jede Menge Pferde nach Dallgow und klatschte das Parkhotel im Landhausstil (Zimmerpreis 175 DM) direkt ins Dorfzentrum neben die alte märkische Kirche, sondern ließ dort die bayrische „Komfort-Haus GmbH Abensberg“ auch noch 286 Eigentumswohnungen bauen – zu 1.100 DM pro Quadratmeter, wie Bauleiter Heinz-Jürgen Zick ausrechnete (verkauft werden sie für 5.800 bis 6.200 DM pro Quadratmeter). Weitere 2.000 Wohneinheiten sind bereits beantragt. Auch die z.T. denkmalgeschützten Häuser des Olympischen Dorfes (Löwen-Kaserne genannt, weil die Sowjets eine Löwen-Plastik vor dem Haupttor aufgestellt hatten, die dann von der Bundeswehr geklaut wurde) will der umtriebige Bürgermeister aus dem Westen „entwickeln“, aber noch blockiert die Bundesfinanzdirektion, die das riesige Areal, zu dem Sportstätten und ein Truppenübungsplatz gehören, verwaltet.
Mehr Glück hatte er mit einem Gewerbegebiet auf der anderen Seite der B 5. Dort steht bereits ein von Lidl und Schwarz errichtetes riesiges Einkaufscenter – „Havel-Park“ genannt, sowie ein „Auto-Center“. Um das Gewerbegebiet mit dem Dorf zu verbinden, wurde extra die B 5 untertunnelt. Dabei stieß man auf eine kleine archäologische Sensation: zwanzig Teerschwelgruben aus dem 7. bis 12. Jahrhundert nebst etlichen Keramikscherben. Die als runde schwarze Flächen im Sand sichtbaren spätslawischen Teer- und Pech-„Fabriken“ wurden von einer darauf spezialisierten Firma aus Dürboslar namens LAND gesichert und dokumentiert. Die Untertunnelungsarbeiten an der B 5 mußten solange ruhen. Der Baufirma arbeiteten die acht brandenburgischen Studenten unter der Leitung einer holländischen Archäologin jedoch nicht schnell genug. Besser klappte die Zusammenarbeit zwischen den Archäologen und der Komfort-Haus GmbH, als auf deren Baustelle im Frühjahr sechs spätslawische Brunnen und mehrere Feuerstellen entdeckt wurden. In Dallgow fanden die Vor- und Frühgeschichtler bereits in den dreißiger Jahren Reste slawischer Besiedlung.
Die heutige Dallgower Dreckarbeit wird übrigens zumeist auch wieder von Spätslawen, aus Polen, erledigt, die dort jedoch nur temporär, in Wohnwagen, leben. „Das Wort ‚Wohnwagen‘ scheint sagen zu wollen, daß die Dialektik des unglücklichen Bewußtseins dabei ist, überholt zu werden, und daß wir dabei sind, glücklich zu werden.“ Dies könnte der Werbespruch eines Wohnwagenhändlers mit Ostabitur sein, den es in Dallgow tatsächlich gibt (im Maschinenschuppen der ehemaligen LPG). Das Zitat stammt aber von dem brasilianisch-französischen Philosophen Vilém Flusser, der leider vor ein paar Jahren nach dem Besuch seiner Heimatstadt Prag von einem LKW überfahren wurde.
In der Masse sind die Stadttiere, genauer gesagt: die Haustiere nicht davor gefeit, an die Zootiere verfüttert zu werden:
Man sagt, angeblich soll sogar das Tierheim Lankwitz ab und an seinen Tierüberschuß auf diese Weise entsorgen. Es war das erste seiner Art in Deutschland, wo die Berliner sich seitdem ihre Haustiere herausadoptieren, es wird gerne gefilmt, ebenso wie der Berliner Hundefriedhof. Für mehr als 35 Millionen Euro ließ die Tierheimleitung in Falkenberg ein neues, attraktiveres Domizil errichten. Der FR-Rezensent spricht von „dorfangerartigen Rondellen, die ringförmig um eine Auslaufarena liegen“. Später sollen noch weitere „Pavillons“ hinzukommen – und „den Zirkelschlag schließen“. Die Berliner haben die öde Betonanlage sofort gut angenommen: Das neue Tierheim erwies sich bereits „als wahres Kupplernest: Seit der ersten Betriebswoche vermittelte es fast drei mal mehr Tiere als das alte“. Das gilt jedoch auch für die großen städtischen Entkupplungsinstitutionen: Zoo und Tierpark, wo immer mehr Leute ihre überflüssigen und überzähligen Kinderzimmertiere abladen.
Am Zoobetriebshof fragt der Pförtner nur noch knapp: „Sie wissen, wo es lang geht?! Vorne links und dann auf die Rampe. Ich rufe durch, damit jemand die Tiere in Empfang nimmt.“ Dabei handelt es sich meistens um Kaninchen, Hamster und Meerschweinchen. Viele Entkupplungsmütter kennen sich bereits: „Na, auch wieder da – um den neuen Wurf zu entsorgen?!“ Die süßen Zwergnager gehören inzwischen zur Grundnahrung der Raubtiere und -vögel des Zoos. Auch die Schlangen und Krokodile greifen gerne auf sie zurück. Die meisten der Kleintiere sind biologisch-dynamisch ernährt, jung und quasi frisch. „Was soll ich machen?“ fragt eine Frau, die „alle sechs bis acht Wochen drei bis vier ,Balkonkaninchen'“ anliefert, „die Kinderbauernhöfe sind rappelvoll, sie beliefern selbst die Zoos, die Tierhandlungen nehmen schon lange keine Zwergnager mehr und sie im Winter auszusetzen, das bringe ich nicht übers Herz, die sind doch mit Zentralheizung groß geworden. Noch scheußlicher ist es, sie durchs Klo zu spülen – das machen auch viele. Diese ganze Qual rührt nur daher, daß meine Tochter sich standhaft weigert, ihren Kaninchenbock endlich kastrieren zu lassen“. Die Zoowärterinnen, die die Tiere auf der Rampe in Empfang nehmen, kennen das Dilemma. Eine meint tröstend, als sie wieder drei Kaninchen in die Box zu den Meerschweinchen sperrt: „Die gewöhnen sich schnell ein“, fügt dann jedoch hinzu: „aber bis sie sich eingelebt haben, sind sie längst weg!“ – verfüttert. Das neue Tierheim in Falkenberg ist von der Ausdehnung her – es erstreckt sich „über 30 Fußballfelder“ – fast ein dritter Zoo. Und tatsächlich tragen auch immer mehr Mütter ihre Kleintierbrut jetzt dort hin. Seitdem die von der „Kommune 1“ einmal propagierte „Dackelverbrennung am Kudamm“ (aus Protest gegen den Vietnamkrieg) beinahe ein Pogrom der „Schultheiß-Berliner“ gegen die „herzlose Linke“ in der Frontstadt zur Folge gehabt hätte, ist die Hundeabteilung des Tierheims besonders üppig dimensioniert. Und es ist schwieriger, dort einen Hund zu adoptieren als z. B. in Vietnam ein Kind zu kaufen.
Auch bei der SFB-Abendschau heißen die Hunde seit 1968 stets „unsere vierbeinigen Lieblinge“. In Falkenberg – „der Stadt der Tiere“ – nehmen die Hundekäfige von daher das Zentrum ein. Links vom Eingang sind die Katzen untergebracht: Sie haben „einen unverstellten Blick auf die Falkenberger Feldflur“. Rechts neben dem „Service-Bereich“ befinden sich die Kleintiere: Meerschweinchen, Ratten, Chinchillas, Kaninchen, Goldhamster, Mäuse usw. Theoretisch könnte man diese nun ständig von hier nach da – das heißt in den Zoo – tragen. Aber das macht man nicht. Kürzlich besichtigte der indische Veterinär Putlab Majid das Falkenberger Tierheim. Dr. Majid leitet ein Altersheim für Tiere bei Bombay. In dieser für Indien nicht unüblichen Anstalt werden neben einer Anzahl alter Rinder und Hunde sowie Esel auch vier Kobras und sogar zwei Skorpionen ihre letzten Lebenstage versüßt. „Unser Haus ist von daher sehr gemütlich. Aber das hier ist natürlich auch sehr beeindruckend – vor allem seine Architektur und seine schiere Größe,“ meinte Dr. Majid nach der Besichtigung. Interessant fand er am Konzept die Umdrehung der Sorge um Tier und Mensch – für letztere hat das neue Tierheim wenig übrig: Die so genannten Beratungsbüros, in denen es um die Vermittlung zwischen dem Tier und seinem neuen Besitzer geht, ähneln kalifornischen Knastzellen, und die Pausenräume, sogar die Bungalows der Bereichsleiter sind fensterlos! Damit habe man doch die Gleichberechtigung weit überschritten, fand Dr.Majid.
Zuerst wurden durch bauliche Verdichtung die Tiere aus der Stadt gedrängt, dann wagten sie sich jedoch zurück und fanden komfortable Nischen: das reicht vom Kfz-Kabelsalat fressenden Marder über die fast zahmen Füchse im Botanischen Garten und die aufdringlichen Wildschweine an der Havelchaussee – bis zum Jogger attackierenden Bussard im Tegeler Forst und der Nachtigall im Finanzamt. Nun geht es diesen urbanen Wildtieren aber erneut an den Kragen. Absurderweise diesmal nicht aus Ignoranz, sondern aus Tierhaltungsliebe. Die Enten im Tiergarten werden zum Beispiel mehr und mehr von Mandarin- und Eiderenten, die sich wahrscheinlich aus den zoologischen Gärten davongeschlichen haben, verdrängt. Auf einigen Rieselfeldern haben Wellensittich-Schwärme sich gegen die Spatzen durchsetzen können. Und auf dem S-Bahn-Gelände zwischen Wedding und Prenzlauer Berg sieht man schon mehr bunte Haus- oder Zwergkaninchen als Wildkaninchen. Sogar auf dem Gelände des am 1. Mai 1987 abgebrannten Kreuzberger Bolle-Supermarktes am Görlitzer Bahnhof haben die süddeutschen Labormäuse zusammen mit den mongolischen Springmäusen die einheimischen grauen Mäuse nahezu vollständig vertrieben. Darüber berichtete ich bereits vor Jahr und Tag. Wie jedoch erst jetzt bekannt wurde, liegt das vor allem daran, dass die umliegenden Wohnungsmieter – bis hinauf in den dritten Stock, die von den grauen Mäusen besonders im Winter massenhaft heimgesucht wurden und werden, irgendwann dazu übergegangen waren, die immer wieder in ihre Lebendfallen reintappernden Nager möglichst weit weg – am Ende des Görlitzer Parks zum Beispiel oder am Ufer des Landwehrkanals – zu entsorgen, das heißt in ihre wohlverdiente Freiheit zu entlassen. Davor hatten sie diese possierlich aussehenden kleinen Schädlinge lange Zeit auf dem Bolle-Gelände ausgesetzt. Von dort fanden die Tiere jedoch schneller wieder in die Wohnküchen zurück als die Menschen. Im Gegensatz zu all den von ihnen ebenfalls dort ausgesetzten edlen Ziermäusen und Laborratten. Was diese stattdessen taten, ist bis heute ungeklärt. Auf alle Fälle behaupteten diese Exoten sich – quasi im Vorgartenbereich. Zumal ihre wilden Verwandten immer nur an ihnen vorbei in die Häuser nach oben stürmten – spätestens wenn die Herbstregentage einsetzten.
Bei den ausgesetzten zahmen Kaninchen kann man den Prozess genauer nachvollziehen – an dessen Ende die letzten wilden die Stadt verlassen haben werden: Überall kaufen die Mütter ihren Kindern ein Zwergkaninchen. Dieses dämmert bald auf dem Balkon vor sich hin. Dann kauft eine Mutter (im Wedding) ein zweites Kaninchen – und als die beiden Junge kriegen, überlässt sie ihnen den ganzen Balkon, den ihre Tochter zu einer wahren Kaninchenburg ausbaut. Schnell kommt es zu einer „unkontrollierten Vermehrung“, wie die Hausverwaltung bemängelt. Allein im Zeitraum von Oktober bis April wächst die Nagerschar auf 34 Tiere an. Schon nehmen die umliegenden Zoohandlungen keine mehr auf, und auch die Kinderbauernhöfe winken alle ab. Also verschenkt ihre Tochter fortan die Kaninchen in der Kita – vorwiegend an solche Kinder, die zu Hause auf dem Balkon schon eins haben: „Das ist dann nicht so allein!“ Schnell wird aus dem niedlichen Geschenk eine wahre Zwergkaninchen-Schwemme – und die wird nun regelmäßig durch Aussetzen wieder abgebaut. Die Theorie geht dahin, dass sie den wilden Kaninchen draußen deswegen überlegen sind, weil sie robuster sind. Die Zwergkaninchen haben schließlich bereits die Kitakinder überlebt, und selbst Blitzstarts auf Dreirädern und tägliche Shampoobäder mit Apfelgeschmack sind scheinbar spurlos an ihnen vorübergegangen.

Da habe ich früher immer mit meinem Hund gespielt.