
Der Weg zur klassenlosen Gesellschaft? Voila!
Lamarxismus
Die 1900 veröffentlichte Evolutionstheorie „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“ von Peter Kropotkin wird immer wieder neu aufgelegt. Sie war gegen Darwin gerichtet, der als Motor der Entwicklung der Arten die Konkurrenz und das „Überleben der Tüchtigsten“ ausgemacht hatte. Nachdem 1859 Darwins Hauptwerk „On the Origin of Species by means of Natural Selection“, erschienen war, hatten bereits Marx und Engels gewitzelt, der Autor habe dabei bloß das üble Verhalten der englischen Bourgeoisie auf die Tier- und Pflanzenwelt projiziert, wobei er sich auch noch von der Begrifflichkeit des unsäglichen Nationalökonomen Malthus leiten ließ. So etwa wie laut Marx umgekehrt „das Geheimnis des Adels die Zoologie“ ist. Kropotkin ging in seiner Darwin-Kritik noch einen russischen Schritt weiter: Dort war Darwin in sozialistischen Kreisen überaus populär, weil es nach ihm kein begründetes Hochwohlgeboren mehr geben konnte, auch dass der Mensch vom Affen abstammen sollte, gefiel den Russen, nichtsdestotrotz akzeptierten sie sein Konkurrenzprinzip nicht: Dies sei bloß englisches Insel- bzw. Händlerdenken, hieß es. Und in der Tat hatte Darwin sein Evolutionsmodell erstmalig auf den Galapagosinseln umrissen, wo die Arten auf kleinstem Raum leben mußten. Ganz anders dagegen in Sibirien, das Kropotkin erforschte, und wo er eher auf Tiere und Pflanzen gestoßen war, die sich in der unendlichen Weite suchten, um gemeinsam leichter zu überleben. „Bei Kropotkin finden wir geradezu paradigmatisch eine Art Umkehreffekt gegenüber dem damaligen Sozialdarwinismus,“ heißt es dazu in einem Beitrag von Reinhard Mocek in einem Buch über Symbiosen, um das es mir hier geht.
Wenn das Zusammenfinden von Individuen der gleichen oder unterschiedlichen Arten zu einer dauerhaften Kooperation führt, spricht man von einer Symbiose. Und die ersten Symbioseforscher waren Russen. Zwar gibt es auch eine Symbioseforschung in den USA – vor allem von der Mikrobiologin Lynn Margulis forciert, aber sie hat selbst vor einigen Jahren das Buch der russischen Wissenschaftshistorikerin Lija Khachina ins Amerikanische übersetzen lassen, das sich mit der (russischen) Geschichte der Theorie von der Symbiogenese beschäftigt, die um 1900 begann – vor allem unter Botanikern, und bis heute dort fortgeführt wird.
Inzwischen vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwo auf der Welt Biologen eine neue Symbiose entdecken. Die russische Forschung richtete sich zunächst auf Flechten, die aus nichts anderem bestehen als aus einem Pilz und einer Alge – die sich zusammengetan haben, um auch noch in der Arktis gedeihen zu können. Andere Pflanzen und Tiere verbünden sich, um in der größten Wüstenhitze zu überleben. Und im nährstoffarmen tropischen Regenwald ist die z.B. Orchidee gleich mehrere Symbiosen mit verschiedenen Kleinstlebewesen und Insekten eingegangen – zur Nahrungsaufnahme sowie zur Fortpflanzung. Die französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari haben daraus ein ganzes postmodernes Beziehungs- und Organisationsmodell gemacht: „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“
Inzwischen ist es schon beinahe unumstritten, dass auch die „Kraftwerke“ in unseren Körperzellen – Mitochondrien genannt, sowie die in den pflanzlichen Zellen – Chloroplasten – einmal als Bakterien dorthin gelangt sind: Statt sie zu verdauen, wurden sie integriert, wobei sie nach und nach ihre genetische Individualität verloren und zu Symbionten wurden – d.h. zu Organellen (Orgänchen). Nicht in einem Wirts-Gast-Verhältnis, sondern als Geber und Nehmer. Die radikalsten Vertreter unter den Symbioseforschern gehen so weit, alle komplexen Organismen als das Werk von symbiosesuchenden Bakterien zu begreifen, die auf diese Weise immer genug Nahrung finden: z.B. die Kolibakterien in unserem Darm, ohne die wir nicht leben können – sie allerdings sehr wohl ohne uns. Einige dieser Symbioseforscher sind darüberhinaus heute Anhänger der „Gaja-Hypothese“ von James Lovelock, die besagt, dass die gesamte Erde einschließlich ihrer Atmosphäre ein einziger großenteils auf Symbiose beruhender Organismus ist.
„Als eigentliche Urheber der Theorie des symbiogenetischen Ursprungs kernhaltiger Zellen gelten heute die russischen Biologen Andrej S. Famincym (1835-1918) und Konstantin S. Mereschkowskij (1855-1921),“ schreiben die deutschen Autoren des 751 Seiten dicken Buches mit dem Titel „Evolution durch Kooperation und Integration“. Ihr Werk läßt diesbezüglich nichts zu wünschen übrig: Es beginnt mit den Originaltexten von Famincym und Mereschkowskij – aus dem „Biologischen Centralblatt“ Erlangen. „Im Verhältnis zur Selektionstheorie Darwins betrachtete Famincyn die Symbiogenesetheorie als eine wesentliche Ergänzung, während Mereschkowskij sie als Alternative verstanden wissen wollte.“ Dem folgen Biographien und Diskussionen einzelner Aspekte der Symbioseforschung – angefangen mit der Entdeckung dieses „biologischen Problems“ bis zur „Mereschkowskij-Rezeption nach 1945“ und einem selbstkritischen Ausblick am Ende: „Zu viel einer guten Idee?“ Auch die Zusammensetzung des Autorenkollektivs ist interessant: Sie kommen etwa zur Hälfte aus den biologischen Forschungsanstalten der DDR und der Sowjetunion sowie zur anderen Hälfte aus der BRD und den USA. Der Herausgeber Armin Geus lehrte in Erlangen und gründete das Biohistoricum in Neuburg sowie den Verlag Basiliskenpresse in Marburg, in dem dieses schöne Buch auch kürzlich erschien – als „Acta Biohistorica Nr. 11“, das selbst die dem Konkurrenzprinzip extrem verpflichtete FAZ über alle Maßen lobte („Erfolgreich leben durch Zusammenarbeit“). Der Mitherausgeber Ekkehard Höxtermann promovierte an der Humboldt-Universität im Bereich Botanik und kam dann über Köln und Jena an die Freie Universität Berlin, wo er Geschichte der Naturwissenschaften lehrt.
„Im Laufe der Evolution wurden Gene des Endosymbionten in das Kern-Genom übernommen,“ heißt es im „Geleitwort“ des Kölner Molekularbiologen Lothar Jaenicke. Durch diese Form einer „friedlichen Übernahme“ entsteht eine Abhängigkeit (z.B. des Mitochonten von der ihn umgebenden Körperzelle), nichtsdestotrotz „ergänzen die miteinander lebenden Wesen sich“, meint Jaenicke, so dass „aus beiden Partnern mehr als ihre Summe wird, wie in einer perfekten Ehe auf Dauer Eigenheiten ablegen und annehmen – bis das der Tod sie scheidet.“ Im klassischen Altertum soll „symbios“ bereits ein Wort für Ehegatte gewesen sein. Im längsten Text des Buches – über die Erforschung der Blaualgen – heißt es dazu ergänzend von Dieter Mollenhauer: „Irgendwie läßt sich immer feststellen, dass es den beiden prospektiven Symbiosepartnern nicht besonders gut gehen darf, wenn das Zusammenspiel erfolgreich etabliert werden soll.“ Außerdem versuchen sie, auch noch mit anderen Lebewesen zu kooperieren: So haben z.B. verschiedene Pilze und Amöben schon früher mit „Entocytobiosepartnern experimentiert und tun dies offenbar auch weiterhin“. Neben einer solchen „Untreue“ gibt es noch eine weitere Parallele zwischen diesen und menschlichen Symbiosen: „Die Grenzen zwischen Beute und Partner sind fließend.“ (Eberhard Schnepf) Die Ursprünge der Symbiose-Theorie – dieser neuen oder anderen Sicht auf das Leben, gehen auf eine kleine Gruppe „russischer ‚Querdenker'“ zurück, heißt es abschließend im „Geleitwort“.
Das Buch reiht sich damit ein in eine ganze Serie von veröffentlichten und noch-nicht-veröffentlichten deutschen Wissenschaftsgeschichten, die sich mit der einstigen russisch-sowjetischen Avantgarde in Kunst, Literatur, Architektur und Wissenschaft beschäftigen. Aber noch sind längst nicht alle „Schätze des Kreml“ gehoben: z.B. die der lamarckistischen Forschungsstation in „Borok“ an der künstlichen Wolgainsel „Darwin“ unter der Leitung von Boris Kusin. Der südfranzösische Zoosystemiker Luis Bec hat die Biologie einmal definiert als den Versuch, transversale Beziehungen zu anderen Arten aufzunehmen. Der sowjetische Psychoanalytiker, Polarforscher und Kosmologe Otto Julewitsch Schmidt ging im revolutionären Schwung so weit, dass er dazu eine Zeitlang auf der neueingerichteten Affenforschungsstation in Suchumi versuchte, Menschen mit Affen zu kreuzen. Auch das Wirken von Schmidt nachdem alle „Säuberungen“ an ihm vorbeigegangen waren, die er indes als Herausgeber der großen „Sowjetischen Enzyklopädie“ genauestens zu registrieren hatte, wäre eines solchen dickleibigen Werkes durchaus würdig.
Der geistige Kern dieser Theorien wurde in Russland mitunter auch als „Lamarxismus“ bezeichnet und kennzeichnete für lange Zeit das Ideengebäude der russischen Intelligenzija. Ich möchte behaupten: bis heute. Auch wenn die Intellektuellen dann von den Bolschewiki als „klassenfremde Elemente“ teils liquidiert und verbannt, teils als Staatsbedienstete korrumpiert wurden – und nach Auflösung der Sowjetunion dort eine nachholende Beschäftigung mit der anglo-amerikanischen Mikrobiologie einsetzte, die sich derzeit jedoch wie oben angedeutet mehr und mehr der früheren russischen Forschung annähert – fast gegen ihren Willen, möchte man meinen. Um diesen langen russischen „Sonderweg“ in der Biologie, der noch gar nicht richtig erfaßt wurde, zu verstehen, muß man auf die besonderen gesellschaftlichen Hintergründe seiner Entstehung eingehen .
Wiewohl man gemeinhin die Herausbildung der Intelligenz als „klagende Klasse“ mit Emile Zola anheben läßt, erreichte sie etwa zur gleichen Zeit im „rückständigen Rußland“, wo sie am konsequentesten die Partei der „Erniedrigten und Beleidigten“ (Dostojewski) ergriff, ihre stärkste moralische Kraft. Nirgendwo sonst auch wurde sie derart verfolgt, wobei – beginnend mit den Dekabristen – Zigtausende nach Sibirien verbannt wurden, emigrierten oder starben. Allein mit den Grabsteinen der „dahingeopferten“ revolutionären Jüdinnen hätte man den langen Weg von Paris nach St. Petersburg säumen können, meinte die marxistische Frauenforscherin Fannina W. Halle 1932. Was sich trotzdem aus diesem Typus in Rußland an Studentenprotest, Frauenbewegung, Kommunen und Terrorismus entwickelte, nahm die westeuropäische 68er-Bewegung und ihren weiteren Verlauf – 100 Jahre vorher bereits – vorweg.
Aus dem Kreis der berühmten „Männer und Frauen der Sechzigerjahre“ die „ins Volk“ gegangen waren, um vor allem auf dem Land die Bauern zu agitieren, bildete sich die Redaktionsgruppe der illegalen Zeitung „Zemlja i Volja“ (Land und Freiheit), in der zunächst noch die unterschiedlichsten revolutionären Ideen koexistierten. Auf einem Treffen in Woronesh kam es 1879 jedoch zu einer Spaltung: Während die einen, um Nikolai Alexandrowitsch Morosow, für den politischen Mord votierten, lehnten die anderen, um Georgi Plechanow und Vera Sassulitsch, Attentate strikt ab. Obgleich letztere 1878 selbst ein kühnes Attentat verübt hatte, indem sie den Stadtkommandanten von St. Petersburg niederschoß, weil der einen ihrer Genossen im Untersuchungsgefängnis wegen mangelnder Ehrerbietigkeit ihm gegenüber auspeitschen ließ – ungeachtet der Gerichtsreform von 1863, mit der Körperstrafen weitgehend verboten worden waren. In einem aufsehenerregenden Gerichtsprozeß (dessen Plädoyers Dostojewski später in seinen Roman „Die Brüder Karamasow“ einarbeitete) wurde Vera Sassulitsch freigesprochen. Das Urteil hob man zwar wenig später wieder auf, aber ihr gelang rechtzeitig die Flucht ins Ausland. Die Tat und der Freispruch machten sie in ganz Europa berühmt, man nannte Vera Sassulitsch „die Mutter des Terrors“, während sie selbst sich im Exil mehr und mehr von jeglichem „Attentismus“ abwandte. Ab 1900 gab sie mit Lenin zusammen die Zeitschrift „Iskra“ (Der Funken) heraus.
Die Militanten von Woronesh hatte ihren Zusammenschluß „Narodnaja Volja“ (Volkswille) genannt, die Gemäßigten für sich den Namen „Cernyi Peredel“ gewählt – schwarze Umverteilung, womit eine gerechte Verteilung des schwarzen, d.h. bewirtschaftbaren Bodens an die Bauern gemeint war. Dabei wollten sie an der altherbebrachten Form der bäuerlichen Selbstbestimmung, der Dorfgemeinschaft (Obschtschina), anknüpfen, die den Gemeinschaftsbesitz an Boden verwaltete. Zunächst studierte diese Gruppe um Plechanow in ihrem Exil jedoch vor allem die Schriften von Marx und Engels, die sie teilweise ins Russische übersetzten. 1881 schrieb Vera Sassulitsch einen Brief an Karl Marx: „Verehrter Bürger!
Sie wissen, daß sich Ihr Werk ‚Das Kapital‘ in Rußland großer Beliebtheit erfreut. Trotz der Konfiszierung der Ausgabe werden die wenigen verbliebenen Exemplare von einer Masse mehr oder weniger gebildeter Leute in unserem Land wieder und wieder gelesen; bedeutende Menschen befassen sich damit. Aber was sie vielleicht nicht wissen, ist, welche Rolle ‚Das Kapital‘ in unseren Diskussionen über die Agrarreform in Rußland und über die ländliche Kommune spielt. Sie wissen besser als jeder andere, wie dringlich diese Frage in Rußland ist. Sie wissen, was Tscherynschewski darüber dachte. Unsere fortschrittliche Literatur wie die [einst von Nekrassow redigierte Zeitschrift] ‚Vaterländische Notizen‘ zum Beispiel, entwickelt seine Ideen weiter fort. Aber diese Frage ist meiner Ansicht nach eine Frage von Leben und Tod…Eines von beidem: Entweder ist diese Landbevölkerung, einmal von den unmäßigen Forderungen des Fiskus, den Zahlungen an die Großgrundbesitzer und von der willkürlichen Verwaltung befreit, fähig, sich in sozialistischer Richtung weiterzuentwickeln, d.h. ihre Produktion und die Verteilung der Güter auf kollektivistischer Basis zu organisieren. In diesem Fall muß der sozialistische Revolutionär all seine Kräfte der Befreiung der Landbevölkerung und ihrer Entwicklung zur Verfügung stellen. Wenn hingegen die ländliche Kommune zum Untergang bestimmt ist, bleibt den Sozialisten nur noch übrig, sich mehr oder weniger gut begründeten Rechnungen hinzugeben, um herauszufinden, in wie vielen Jahrzehnten das Land des russischen Bauern aus seinen Händen in die der Bourgeoisie übergeht…Sie werden dann einzig unter den Arbeitern in den Städten Propaganda machen müssen, die ständig von der Menge der Bauern überschwemmt sein werden…“
Marx gab sich große Mühe bei der Beantwortung des Briefes von Vera Sassulitsch – er lernte sogar Russisch, um dabei einige Originalquellen heranziehen zu können. Schließlich schrieb er ihr – auf Französisch:
In Westeuropa sei die „Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln“, die „Expropriation der Ackerbauern“ ausgehend von England mit „historischer Unvermeidlichkeit“ vollzogen worden, aber in Russland könnte „die Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Russlands“ sein. Nur „müsste man zuerst die zerstörenden Einflüsse, die von allen Seiten auf sie einstürmen, beseitigen“. Der Ackerbaugemeinde wohnt laut Marx ein Dualismus inne, der „sie mit großer Lebenskraft erfüllen kann, denn einerseits festigen das Gemeineigentum und alle sich daraus ergebenden sozialen Beziehungen ihre Grundlage, während gleichzeitig das private Haus, die parzellenweise Bewirtschaftung des Ackerlandes und die private Aneignung der Früchte eine Entwicklung der Persönlichkeit gestatten, die mit den Bedingungen der Urgemeinschaft unvereinbar ist. Aber es ist nicht weniger offensichtlich, dass der gleiche Dualismus mit der Zeit zu einer Quelle der Zersetzung werden kann.“ Neben dem Privateigentum „in Gestalt eines Hauses mit seinem Hof“ könnte sich insbesondere „die parzellierte Arbeit als Quelle der privaten Aneignung“ zersetzend auswirken: „Sie läßt der Akkumulation beweglicher Güter Raum“ und „dieses bewegliche, von der Gemeinde unkontrollierbare Eigentum, Gegenstand individuellen Tausches, wobei List und Zufall leichtes Spiel haben, wird auf die ganze ländliche Ökonomie einen immer größeren Druck ausüben. Das ist das zersetzende Element der ursprünglichen ökonomischen und sozialen Gleichheit. Es führt heterogene Elemente ein, die im Schoße der Gemeinde Interessenkonflikte und Leidenschaften schüren, die geeignet sind, zunächst das Gemeineigentum an Ackerland, dann das an Wäldern, Weiden, Brachland etc. anzugreifen, die, einmal in Gemeindeanhängsel des Privateigentums umgewandelt, ihm schließlich zufallen werden.“

Diese Technik da ist noch aus der DDR, manchmal gibts da jetzt Probleme mit.
Noch vor Vera Sassulitsch hatte auch die Terroristenfraktion der Narodniki, die ebenfalls gemäß ihrer Statuts für den Erhalt der Obschtschina war, Marx, der sie einmal als „Alchimisten der Revolution“ bezeichnet hatte, einen Brief geschrieben. Darin wurde jedoch nur der baldige Besuch eines ihrer Genossen, Lew N. Hartmann, bei ihm in London angekündigt. Juri Trifonow erwähnt dies in seinem Roman über die Gruppe um Morosow: „Die Zeit der Ungeduld“. Der Gutsbesitzersohn Morosow bekam im übrigen nach der Revolution als verdienter Genosse von den Bolschewiki den Gutshof seiner Väter – in Borok – zurück, um daraus eine limnologische Forschungsstation zu machen, die später zur weltweit größten dieser Art wurde – und noch heute existiert. Ihr wissenschaftlicher Leiter war lange Zeit Boris Kusin, der u.a. Ossip Mandelstam zum Lamarckismus „bekehrte“.
Die noch quasi urkommunistisch organisierte Obschtschina auf Basis einer weitgehenden Subsistenzwirtschaft zersetzte sich nicht nur langsam von innen, sondern man versuchte auch – und das bis in die jüngste Zeit – sie immer wieder von oben zu zerschlagen, d.h. von der Zentralmacht aus, weil ihr dieser der Prozeß der inneren Auflösung der Dorfgemeinschaften nicht schnell genug voranschritt. Das geschah einmal mit der Landreform von 1861, nach der die von der Leibeigenschaft „befreiten“ Bauern sich zugleich bei den Gutsbesitzern verschulden und damit verdingen mußten. Dann unter dem Druck der Revolution von 1905/07 mit den Stolypinschen Agrarreformen, die den sozialen Differenzierungsprozeß beschleunigen sollten und es jedem Gemeindemitglied ermöglichten, seinen Landanteil zu verkaufen und wegzuziehen. Schließlich ab 1928 mit der Verstaatlichung des gesamten Landes und der Kollektivierung der armen und Mittelbauern bei gleichzeitiger Liquidierung der als ausbeuterisch klassifizierten Kulaken. Aus der Obschtschina wurden dabei Kolchosen und Sowchosen und aus freien Bauern befehlsempfangende Landarbeiter, denen man ab 1932 sogar den Paß abnahm, ohne den sie ihr Dorf nicht verlassen durften. Unter Chruschtschow faßte man 1956 die Dörfer und Produktionskollektive zu „territorialen Wirtschaftseinheiten“ zusammen. 1970 erfolgte unter Breschnew ihre „Reorganisation“. Und 1986 wurde aus dem alten Wort für „Dorfplatz“ – MIR – eine Weltraumstation. Zur selben Zeit bedauerte nebenbeibemerkt der bayrische Filmemacher Herbert Achternbusch: „Da wo früher Pasing und Starnberg waren, ist nun Welt! – die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“
Zuletzt nach 1990 wurden in Russland insbesondere die wenig produktiven Kolchosen und Sowchosen aufgelöst oder sie zerfielen langsam, andere wurden von ihren Leitungskadern aber auch von reichen Städtern privatisiert, d.h. in GmbHs, Aktiengesellschaften oder ähnliches umgewandelt bzw. zerschlagen. Gleichzeitig entstanden jedoch an vielen Orten auf dem postsowjetischen Territorium auch wieder neue, selbstorganisierte Obschtschinas, nicht selten in Form von Sippenverbänden und Gemeinschaften der einst nach Osten verbannten Kulaken; daneben gab es auch wieder Genossenschaften, Artel, Kommunen. Der Geist der alten Dorfgemeinschaft erfaßte sogar Datschensiedlungen. Die kollektive Wirtschaftsweise und die Obschtschina-Idee sind also auch heute noch nicht tot. Sie hatte, wie bereits Trotzki bemerkte, u.a. in den städtischen Fabriken überlebt, wo einzelne Kollektive sich aus ehemaligen Dorfgemeinschaften zusammensetzten, ähnliches galt sogar für die Arbeitslager, Gefängnisse und die neugebauten Hochhäuser am Stadtrand, in denen man bisweilen „Dorfälteste“ wählte. Überhaupt hat noch jede russische Revolte und Revolution die Obschtschina gestärkt.
Im Jahre 1905 befanden sich 9,5 Millionen Bauernhaushalte in Dorfgemeinschaften, daneben gab es 2,8 Mio Einzelhöfe. Deren Zahl verdoppelte sich in der Folgezeit – bis 1917 sämtliche „Reformbemühungen“ von oben „nahezu zunichte gemacht wurden“, wie der antikommunistische US-Historiker Robert Conquest in seinem Buch über die Kollektivierung „Ernte des Todes“ schreibt. Denn Millionen von Kleinbauern nahmen unter der bolschewistischen Parole „Das Land denen, die es bearbeiten“ den Großgrundbesitzern das Land weg „und schlossen sich verstärkt in Dorfgemeinschaften zusammen“, daneben entstanden eine Unzahl von Kommunen, Artel (Genossenschafen) und „befreite Gebiete“. 1927 bewirtschafteten die Dorfgemeinschaften 95 Prozent des Gutsbesitzes, nur 3,5 Prozent waren noch „eigenständige Höfe vom Stolypin-Typus“.
Auf die in Vera Sassulitschs Brief aus dem Jahr 1881 enthaltene Frage, warum ein revolutionärer Kampf für den Erhalt der russischen Dorfgemeinschaft sinnvoll sein könnte, schrieb Marx: „Ich antworte: Weil in Russland, dank eines einzigartigen Zusammentreffens von Umständen, die noch in nationalem Maßstab vorhandene Dorfgemeinde sich nach und nach von ihren primitiven Wesenszügen befreien und sich unmittelbar als Element der kollektiven Produktion in nationalem Maßstab entwickeln kann.“
Unter Alphabetisierung, Aufklärung und politische Agitation auf dem Land verstand man auch und vor allem die Vermittlung agrarwissenschaftlicher Kenntnisse und Techniken. Dabei bildete das Studium der Schriften von Lamarck und Darwin sozusagen die Grundlage. Letzterer hatte sich nach 1859 immer mehr an die teleologische Evolutionstheorie von Lamarck angenähert, wobei dieser Aspekt in der russischen Rezeption von vorneherein betont worden war. So griff Darwin z.B. bei seiner „Erklärung der Evolution des Menschen und seines Verhaltens“ auf die lamarckistische „Hypothese der Vererbung erworbener Eigenschaften“ zurück, erst recht dann in seiner 1871 erschienenen Schrift „Die Abstammung des Menschen durch natürliche Zuchtwahl“, in der es heißt: „Das höchste Element der menschlichen Natur“ wurde und wird „entweder direkt oder indirekt durch die Folgen von Gewohnheit, Geisteskräften, Belehrung, Religion etc. vorangetrieben, viel mehr als durch die natürliche Auslese“. Dieser „Lamarckismus“ half ihm, wie der Biologiehistoriker Torsten Rüting sagt, „sicher zu stellen, dass der Fortschritt unweigerlich, kontinuierlich und auf einen Zweck gerichtet voranschreitet“ – am Ende also die Tugend triumphiert!
Das mußte auch und gerade der Arbeiterbewegung gefallen: Wenn nicht einmal in der Natur die Dinge mehr ewig und unveränderlich waren, dann erst recht nicht in der Gesellschaft – sie stellten Darwin gewissermaßen vom Kopf auf die Füße. So bestand etwa Moses Hess darauf, „daß auch die selbständige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft den Naturgesetzen der Entwicklung unterworfen ist“. Die Theoretiker der Arbeiterbewegung „trafen sich in diesem Punkt mit jenen bürgerlichen Autoren, die den bestehenden feudalen Strukturen kritisch gegenüberstanden und in der Evolutionstheorie eine weltanschauliche Waffe für ihren Kampf um die Modernisierung und Demokratisierung sahen,“ schreiben Kurt Bayertz und Wolfgang Krohn in einem Aufsatz über Friedrich Engels Schrift „Dialektik der Natur“, weiter heißt es bei ihnen: „…wenngleich jedoch auch für Engels kein Zweifel daran besteht, daß die menschliche Geschichte nur die Fortsetzung der Naturgeschichte ist, so wendet er sich doch energisch gegen die von zahlreichen Theoretikern unternommenenen Versuche, die Mechanismen der organischen Evolution (‚Kampf ums Dasein‘) unmittelbar auf die Gesellschaft zu übertragen, da diese der Spezifik menschlichen Handelns nicht gerecht wird. Die menschliche Gesellschaft unterscheidet sich von der Naturgeschichte dadurch, daß die Menschen ihre Geschichte selbst, mit Bewußtsein, machen…“
Dennoch ist der Unterschied zwischen (Darwinscher) Naturgeschichte und menschlicher Kulturgeschichte für Engels kein absoluter, weil „die unkontrollierten Kräfte“ auch in der menschlichen Geschichte noch immer „weit mächtiger sind als die planmäßig in Bewegung gesetzten…Darwin wußte nicht, welch bittere Satire er auf die Menschen und besonders auf seine Landsleute schrieb, als er nachwies, daß die freie Konkurrenz, der Kampf ums Dasein, den die Ökonomen als höchste geschichtliche Errungenschaft feiern, der Normalzustand des Tierreichs ist.“ Für Engels, ebenso wie auch für August Bebel, hebt deswegen nur eine bewußte, planmäßige Produktion den Menschen aus der Tierwelt heraus: Erst der Sozialismus wird diesem „Kampf“ ein Ende bereiten – und die Menschheit in eine neue Phase eintreten, in der kein Ressourcenmangel mehr herrscht – und ein „neuer Mensch“ auf den Plan getreten ist. – Dessen Anfänge sich natürlich gemäß der 3. Marxschen Feuerbachthese noch selbst „umerziehen“ müssen. Dazu wußte z.B. die Terroristin Vera Figner, die bis zu ihrer Verhaftung im Vorstand der „Narodnaja Wolja“ aktiv war, aus eigener 20jähriger Gefängnis-Erfahrung mitzuteilen: „Ich glaube, es ist unmöglich, in langjähriger absoluter Einzelhaft psychisch intakt zu bleiben, nicht wahnsinnig zu werden. Doch daß man nach einem langjährigen Aufenthalt in einer Gemeinschafts-Zelle seine Seele noch intakt bewahrt, scheint mir einzig und allein mit Hilfe einer großen Selbstdisziplin und Umerziehung möglich…“ Es Vera Figner gleich tuend, nahmen derart viele Russinnen im ausgehenden 19. Jahrhundert ein solches „Projekt“ in Angriff, „dass die Frau in Rußland überhaupt zur Seele der Revolution“ wurde, wie eine ihrer Historikerinnen, Fannina Halle, schrieb. Dem lebenslänglich verbannten Dichter Tschernyschewski kommt dabei der Verdienst zu, mit seinem Roman „Was tun?“, den er 1863 in der Peter-Pauls-Festung verfaßte, eine Antwort darauf gegeben zu haben, wie sich die Frauenfrage aus der Theorie in die Praxis umsetzen ließe. „Wir lasen sein Buch mit gebeugten Knien“, erinnerte sich ein ebenfalls nach Sibirien Verbannter, der sich davon mit etlichen anderen zum Terrorismus hatte inspirieren lassen. In Tschernyschewskis Werk „Was tun?“, geht es darum, dass eine Frau aus dem Familienleben ausbricht, um wirtschaftlich unabhängig zu sein und einen sozialen Wirkungskreis zu haben. Dazu gründet sie einen „auf kaufmännischer Grundlage aufgebauten kommunistischen Artel – als erste Zelle eines zukünftigen sozialistischen Staatsorganismus“. Nach Erscheinen des Buches, das einen „Sturm“ auslöste, befürchteten Eltern und Ehemänner, dass ihnen die Töchter bzw. Ehefrauen weglaufen würden – was tatsächlich hier und da auch geschah, so entstanden an vielen Orten „Arbeitsgenossenschaften“. In der Hauptstadt lebten die Frauen in sogenannten Petersburger Kommunen – zusammen mit Studenten. Hier begannen sie mit der Agitation unter Fabrikarbeitern, wobei einige der Frauen bald, „mit falschen Bauernpässen“ versehen, anfingen, in Textilfabriken zu arbeiten.
Über die damalige Rezeption der Darwinschen Theorie in Russland schreibt der Biologiehistoriker Torsten Rütting: „Während Darwins ‚Origin of Species‘ in der schwerfälligen Übersetzung des Botanikprofessors Sergej Raschinskij mit ihren detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen nur eine kleine Schicht von Gelehrten ansprach“, wurde vor allem eine umfangreiche Interpretation seiner Schriften von Dimitrij Pissarew berühmt, die „unverkennbar den Stempel der radikalen Bewegung“ trug. Der junge Publizist und Narodnikisympathisant schrieb sie während einer mehrmonatigen Festungshaft, wo er in einer Einzelzelle direkt neben Tschernischewski saß, wie Wladimir Nabokov in seiner Biographie über diesen hervorhob. Pissarew veröffentlichte seine Darwin-Interpretation 1864 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Russkoje Slovo“ (Das russische Wort). Laut Torsten Rüters machte er darin jedoch erst recht einen „lamarckistischen Darwinismus in Russland populär“, denn er verfehlte das „essentiell Neue an Darwins Idee – das Ineinandergreifen von Variabilität und Selektion“, indem er die „Zweckmäßigkeit in der Organismenwelt als durch bewußte Zielstrebigkeit und Willensanstrengung erwirkte Umweltanpassung der Organismen“ erklärte. „Seine Ausführungen waren konzipiert als ideologische Waffe in den Auseinandersetzungen der 1860er-Jahre um die Erneuerung der russischen Gesellschaft…“ Und diese Kämpfe reichten bald immer tiefer. So berichtet Maxim Gorkij aus der Zeit seines Wanderlebens in „Meine Universitäten“, wie sie in den ärmlichsten Kellerwohnungen Tschernyschewskis und Pissarews Texte studierten, an den Wänden hingen Bildnisse von Herzen, Darwin und Garibaldi, und ein Tolstoianer fragte sie nach seinen Ausführungen polternd: „Seid ihr also für Christus oder für Darwin?“ In den deutschen Arbeiterbüchereien hatte zur selben Zeit ein Buch mit dem Titel „Moses oder Darwin“ die größte Ausleihquote, wie Eric Hobsbawm in seiner Geschichte des „Imperialen Zeitalters“ erwähnt. Gorkij wurde dann von einem ehemals Verbannten mit weiteren „naturwissenschaftlichen Büchern“ versorgt, wobei der ihm riet: „Sie müssen lernen, aber so, daß das Buch Ihnen die Menschen nicht verdeckt.“
Für die gesamte russische Literatur dieser Epoche war es laut Rosa Luxemburg kennzeichnend gewesen, „daß sie aus Opposition zum herrschenden Regime, aus Kampfgeist geboren wurde“. Ein Jahr bevor Nikolai Tschernyschewski seine Erzählung „Was tun?“ veröffentlichte, erschien im „Russki westnik“ (Russische Nachrichten) Iwan Turgenjews Roman „Väter und Söhne. Er skizzierte darin als erster den „Neuen Menschen“ – den Revolutionär als „Beweger“, wie er bald geradezu massenhaft in Erscheinung treten sollte. Die Handlung spielt Ende der Fünfzigerjahre und die Hauptfigur darin, der Medizinstudent Basarow, gehört noch zur Rasnotschinzengeneration, d.h. zu jener revolutionären Bewegung, die nicht mehr wie die Dekabristen zuvor von Adligen angeführt wurde, sondern von Leuten „unterschiedlichen Ranges“, Kleinbürgern also. Turgenjew nennt sie „Nihilisten“ – und meint damit „Revolutionäre“. Sie scharrten sich in jenen Jahren vor der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 um die Zeitschrift „Russkoje slowo“ und „betrachteten die Aneignung und Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse als einzigen Weg zum Fortschritt Russlands“, wie Klaus Dornbacher im Nachwort zur DDR-Ausgabe von Turgenjews „Väter und Söhne“ schreibt. Weiter heißt es dort: Tschernyschewskis Roman sei dazu sowohl „eine Art Fortsetzung als auch eine indirekte Polemik“. So decken sich Basarows Ansichten über „den bestimmenden Einfluß des sozialen Milieus und der Erziehung auf die Entwicklung des Menschen“ fast wörtlich mit den von Dobroljubow und Tschernyschewski propagierten Ideen. Letztere standen damals an der Spitze des Kampfes für den Sturz des Zarismus durch eine Bauernrevolution und die entschädigungslose Aufteilung des Gutsbesitzes. In Turgenjews Roman diskutieren die „Alten“ und die „Neuen Menschen“ bereits die Frage, ob die „Gemeindeselbstverwaltung“ erhaltenswert sei. Basarow zeichnet sich durch eine unsentimentale, vulgärmaterialistische Haltung gegenüber dem „Leben“ aus. Seine Bemerkungen über das Sezieren von Fröschen, um mehr über das Innere der Menschen zu erfahren, mußten übrigens die russischen Schüler mindestens bis zum Ende der Sowjetunion noch auswendig lernen – und sogar auch in Kleingruppen experimentell nachvollziehen: „Das war besonders eklig!“, so Wladimir Kaminers Kommentar dazu 2006.
Auch Tschernyschewski bediente sich bereits in seinem Buch laut Torsten Rütting eines „neurologischen Vokabulars“, um einerseits die Sexualität und die Beziehungen zwischen den Geschlechtern neu zu verhandeln und andererseits diese mit den damals aktuellen Debatten um die Neuordnung der Gesellschaft zu verbinden. Dergestalt nimmt er die lamarckistischen Naturwissenschaften in den Dienst der Zukunft des Neuen Menschen, der kontrolliert und rational ein moralisches und sinnvolles Leben führt. „Viele der russischen Intellektuellen verwarfen in Übereinstimmung mit Marx und Engels, aber auch unabhängig von ihnen, die Idee von der Höherentwicklung durch Konkurrenzkampf, die Darwin von dem englischen Nationalökonom Thomas Malthus übernommen hatte“. Malthus glaubte, bewiesen zu haben, dass das rapide Bevölkerungswachstum verbunden mit einem ständig zunehmenden Mangel an Nahrung quasi automatisch eine natürliche Auslese der Besten gewährleiste. Während jedoch Marx und Engels davon ausgingen, dass Darwin Malthus überwunden habe, indem er dessen Gesetz auch in der Tier- und Pflanzenwelt für gültig erklärte, hielt man in Russland das ganze Prinzip der Konkurrenz eher für ein englisches Insel-Phänomen, dass in den unterbesiedelten russischen Weiten keine Gültigkeit habe. In dieser Einschätzung war sich noch der revolutionäre Narodnik Michailowski mit dem mächtigen ultrakonservativen Oberprokuror Pobjedonoszew einig: Beide taten diesen Aspekt des Darwinismus als eine „händlerische Faustregel“ ab, die „unsere [russische] Seele nicht annehmen“ könne. Auch der Geograph und Anarchist Pjotr Kropotkin war dieser Meinung und bemühte sich, demgegenüber die „Sittlichung“ der biologischen Gesetze – ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen in Sibirien – heraus zu arbeiten – der konservativen Soziobiologie also eine fortschrittliche (russische) Biosoziologie entgegen zu stellen. Ebenso abgelehnt wurden in Russland dann auch die Experimente von August Weismann zur Widerlegung der Vererbung erworbener Eigenschaften und zur Konstanz des Keimplasmas, die u.a. die Theorie des Neo-Darwinismus begründeten, der in seiner molekularbiologischen Fassung dann von einem – „unbewegten Beweger“ ausging und -geht, wie Max Delbrück das später aristotelisch gestimmt nannte.
Die russische Debatte mußte sich nach der Revolution von 1917 noch zuspitzen, denn nun ging es ja um die planmäßige Gestaltung der gesamten Produktion – und auch die Schaffung des Neuen Menschen konnte jetzt im großen Stil in Angriff genommen werden. Zunächst bekamen dabei anscheinend die Neodarwinisten Oberwasser, indem sie die Eugenik als praktisches Projekt ins Spiel brachten – sie versprachen sozusagen eine flächendeckende Verbesserung des Menschenmaterials. 1920 gründeten sich gleich mehrere „Russische Eugenische Gesellschaften“, und die Akademie der Wissenschaften gab einige Jahre lang eine Zeitschrift mit „Eugenik-Nachrichten“ heraus. Es ging den russischen Eugenikern darum, „das menschliche Wesen zu verbessern“, den „höchsten Typ“ aus der Gattung Mensch herauszumendeln. Weil sie dabei auf das nicht zuletzt finanzielle Wohlwollen der Kommunisten angewiesen waren, sahen sie in ihrer Eugenik auch ein „biosoziales Problem“. So gingen einige z.B. davon aus, dass mit dem Sozialismus die Familie und die Ehe als kleinste Zellen der Gesellschaft absterben werden – und schlugen, um einem daraus ihrer Meinung nach resultierenden Bevölkerungsrückgang zu begegnen – die künstliche Besamung vor, aus Samenbanken mit dem Erbgut der „höchsten Typen“ natürlich. Noch 1935 legte z.B. der amerikanische Drosophilaforscher und spätere Nobelpreisträger Hermann Joseph Muller Stalin einen großen eugenischen Plan vor, den er „Aus dem Dunkel der Nacht“ betitelte: „Viele zukünftige Mütter, befreit vom religiösen Aberglauben, werden stolz sein, ihr Keimplasma mit dem eines Lenin oder Darwin zu mischen, um der Gesellschaft mit einem Kind von ihren biologischen Eigenschaften zu diesen…Echte Eugenik kann nur ein Produkt des Sozialismus sein“. Gegen diese makropolitischen Pläne protestierten nicht nur die Frauenverbände, auch in den Zeitungen wurde gegen solche oder ähnliche Mixturen aus Soziologie und Biologie zur Massenproduktion des Neuen Menschen polemisiert, zumal nachdem ab 1933 das faschistische Deutschland die Rassenverbesserung qua Biopolitik auf seine Fahnen geschrieben hatte und die Eugenik damit für die sozialistische Sowjetunion quasi „verbrannt“ war, wobei das Ziel jedoch nicht in Frage gestellt wurde, das man aber eher durch Pädagogik, Kollektivierung, Arbeit auf den Großbaustellen des Sozialismus, mit Taylorismus, Arbeitswissenschaft und – bis zum Sturz Trotzkis – mit Psychoanalyse erreichen wollte. Immer wieder kam es dabei zu neuen Kampagnen und Komsomolprojekten. Nicht die unwichtigsten waren sicher die Selbstversuche, bei denen Einzelne analog zu den einst „berühmten Männern und Frauen der Sechzigerjahre“ sich selbst zu neuen Menschen erzogen – und gleichzeitig in einem Tagebuch darüber Rechenschaft ablegten. Unmerklich weitete sich dieser eher mikropolitisch zu nennende Ansatz – von oben kontrolliert und gefiltert, indem nun auch eine „Neue Natur“ in den Blick geriet: Alles war machbar und ließ sich bewegen. Auch die Pflanzen und Tiere waren lernfähig, man konnte sie erziehen – verbessern. Ein neues Vokabular entstand (dafür) – schließlich eine ganze „proletarische Biologie“. Diese wurde von Lyssenko entwickelt, der sich dabei auf Mitschurin berief.

Hier stehts doch, du mußt erst den Befehl eingeben.
Bolschewisierte Pomologen
In der DDR gab es noch bis zuletzt Gärtnereigenossenschaften, die „Mitschurin“ hießen. Der Eisenbahner Iwan Wladimirowitsch Mitschurin, geboren 1855 im Oblast Rjasan, züchtete zunächst in seiner Freizeit Obstbäume – und träumte davon, die Obstqualität in seiner Heimat zu verbessern, wobei er u.a. die südlichen Sorten kälteresistenter machen wollte. Dazu gründete er eine Baumschule, die schon gleich nach der Revolution von den Bolschewiki, angefangen mit Lenin, großzügig gefördert wurde. Mitschurins Erfolge insbesondere bei der Pfropfung und Hybridisierung von Obstbäumen wurden bald legendär. In einem später verfilmten Buch über Mitschurin „Die Erde soll blühen“ verglich der Schriftsteller Safronow ihn nacheinander mit Majakowski, Darwin, Puschkin, Pawlow – und bezeichnete seine Züchtungen als Wunder: „Während all dieser Jahre fanden Wallfahrten aus allen Winkeln des Landes zu diesem wunderbaren Garten statt. Tausende von Wissenschaftlern, Agronomen, Gärtnern, Studentengruppen kamen angereist. Aber auch Experimentateure, Arbeiter aus Agrarlaboratorien und einfache Kolchosebauern. Bevor sie eintraten, mußten sie die Bürde ihrer gewohnten Vorstellungen und traditionellen Kenntnisse ablegen wie Regenschirm und Hut in einem Vorzimmer…Die Besucher entdeckten eine bunte Menge unbekannter Pflanzen. Die Zweige von Apfel- und Birnenbäumen konnten kaum das Gewicht der riesigen Früchte tragen. Man sah verschlungene Lianen der fernöstlichen Aktinidie, aber hier trug sie süße, bernsteinfarbige Früchte mit dem Geschmack und dem Duft der Ananas. Ein Mandelbaum trug innerhalb eines Jahres Sprößlinge von über einer Sashen Länge, ein fremdartiger Baum – eine Hybride aus Kirsche und Weichselkirsche – trug Früchte, die Weintrauben ähnelten. Nicht weit davon entfernt bewegten sich im Hauch sanften Windes die Ranken und gezackten Blätter jener launenhaften Pflanze aus dem Süden – der Weinrebe“.
Anfänglich hatte Mitschurin vor allem Erfahrungen aus seiner Praxis in Fachzeitschriften für Gärtner veröffentlicht, mit der Zeit versuchte er jedoch, immer mehr theoretische Schlußfolgerungen aus seinen Züchtungsversuchen zu ziehen. So sprach er z.B. davon, als Selektionär die „Erbanalagen zerbrechen“ bzw. „lockern“ zu müssen, um die Pflanze in die gewünschte Richtung zu „erziehen“. „Wir können von der Natur keine Wohltaten erwarten, unsere Aufgabe ist es, sie ihr abzuringen“. Der französische Marxist Dominique Lecourt bezeichnete die Mitschurinsche Theoriebildung 1976 als „spontane Philosophie eines Gärtners“ – ohne damit jedoch dessen Methoden – der Pfropfung, Hybridisierung und des Mentorverfahrens – abtun zu wollen.
Mit der Durchsetzung der Ideen des Agrartechnikers und späteren Landwirtschaftsministers Trofim Lyssenko, der einen ML-Philosophen, I. Present, an der Seite hatte, wurde die „Mitschurinsche Biologie“ dann zum Ausgangspunkt einer neuen „proletarischen Wissenschaft“ erklärt: Diese geht davon aus, dass „durch das Eingreifen des Menschen die Möglichkeit besteht, jede Form des Tieres oder der Pflanze zu einer schnelleren Veränderung zu zwingen, und zwar in der von den Menschen gewünschten Richtung. Für den Menschen eröffnet sich ein weites Feld nützlichster Betätigung, heißt es bei Lyssenko, und weiter – gegen die damals noch praxisfernen Genetiker gerichtet: „Die Grundthese des Mendelismus-Morganismus, die These von der völligen Unabhängigkeit der Erbanlagen von den Lebensbedingungen der Pflanzen und Tiere wird durch die Mitschurinsche Lehre rundweg abgelehnt“.
In der Praxis ließen sich die „mitschurinschen-lyssenkistischen Techniken“ auf drei Ideen reduzieren: „Jarowisation“ des Getreides, d.h. Vorkeimung des Wintergetreides, um es im Frühjahr aussäen zu können – bis hin nach Sibirien; das Anpflanzen von Kartoffeln im Sommer zu dem selben Zweck und die „vegetative Hybridisierung“. Diesen z.T. wiederentdeckten Praktiken muß man laut Dominique Lecour bis heute eine „reale Effizienz in der Landwirtschaft zugestehen…Und auf genau diesen drei Techniken beruhte auch der Erfolg des Lyssenkismus in den zehn Jahren seines Aufstiegs (1929 – 1940)“, der parallel zur gewaltsamen Kollektivierung und „Entkulakisierung“ der Landwirtschaft, mithin der Verwandlung von Bauern in Landarbeiter, verlief. „Wer hier handelt, das ist die Technik, und es ist der Bauer, auf dessen Rücken gehandelt wird,“ merkte dazu der französische Marxist Charles Bettelheim an. Und es ist die Administration, die in dieser Situation schnelle Erfolge für ihre „technischen Lösungen“ braucht: Das Akademiemitglied Kislowski erklärte 1948 auf einer Tagung „die Stärke von T.D.Lyssenko“ damit, dass er sich „zum ideologischen Führer des in der sozialistischen Landwirtschaft Tätigen machte“ . Die Akademiemitglieder Michalewitsch und Dmitrijew meinten auf der selben Tagung, Mitschurins Theorie sei die Theorie, die unsere besten Praktiker, „die Stoßarbeiter des Kollektivwirtschaften benutzen. Allein der Mitschurinismus könne „Vertrauen in den Kommunismus“ wecken. Auch und zugleich gab sich die „mitschurinsche-lyssenkistische Biologie“ als „direkten Ausfluß der vielhundertjährigen Geschicklichkeit der russischen Bauern“ aus, und „kann sich schmeicheln, ein lebendiges, an die Praxis gebundenes Wissen zu sein.“ In ihrem Mittelpunkt stehe deswegen auch „nicht die Frage der ’natürlichen Zuchtwahl‘, sondern der künstlichen Zuchtwahl“, schreibt Dominique Lecourt – und rettet damit die Praxis aus den Fängen ihrer Theorie.
Mit dem Aufstieg Lyssenkos wuchs auch Mitschurins Ruhm: 1932 benannte man seinen Geburtsort Dolgoje in Mitschrowka um und den Ort seines Wirkens, Koslow, in „Mitschurinsk“. Gleichzeitig wurde seine Baumschule dort „zu einem der größten wissenschaftlichen Forschungszentren für die Umwandlung der lebenden Natur“ ausgebaut. Zu seinem 60. Geburtstag wünschte Stalin ihm aufgrund „seines gedeihlichen Wirkens zum Wohle unseres großen Heimatlandes weiterhin Gesundheit und noch mehr Erfolge bei der Umgestaltung des Obstbaus“.
Die „nachgeholte Modernisierung“ Russlands im Sozialismus mußte sich neben der „Technik“ auch auf den Enthusiasmus der Arbeiter in den Fabriken und Kolchosen stützen, denen dafür derart viele Konzessionen gemacht wurden, dass man am Ende sagen konnte, die UDSSR scheiterte nicht an zu viel Unfreiheit, sondern an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich! Nicht die geringste Konzession des proletarischen Staates war die prospektive Engführung von Hand- und Kopfarbeit – durch Bildung und Qualifizierung der Massen einerseits sowie Proletarisierung von Wissenschaft und Politik andererseits.
In China wurde dann – während der Kulturrevolution – die „Aufhebung der Trennung von Kopf- und Handarbeit“ sogar noch konsequenter und sozusagen flächendeckender in Angriff genommen. Offiziell sollte es dabei für die zu Millionen aufs Land geschickte „gebildete Jugend“ um die „3 Mits“ gehen: „Mit den Bauern arbeiten, leben und von ihnen lernen“. Mao tse Tung machte den Jugendlichen ihre jahrelange Landverschickung mit den Worten schmackhaft: „Je schmutziger ein Bauer, desto reiner seine Seele“. Anschließend hieß es – ebenfalls von offizieller Seite: „Jeder, der zu ihnen kam, spürte in der Einfachheit einen ungeheuren Schwung“. Auch dabei kamen am Ende etliche landwirtschaftliche „Verbesserungen“ heraus – nicht zuletzt im Obstanbau. Erwähnt sei der Mittelschulabsolvent Tscheng You-dschi, dem es gelang, die Erträge der überalterten Birnbäume in den Gärten der Achten Produktionsgruppe in Wentjüantun am Sanggan-Fluß mit zum Teil neuen „Techniken des Obstbaumschnittes, der Pflege sowie der Betreuung“ zu steigern. Solche Beispiele wurden bis 1976 zu Hunderten veröffentlicht.
Der 1935 mit 80 Jahren gestorbene Mitschurin hatte seinerzeit etwa 300 neue Obst- und Beerensorten gezüchtet. In einer Lobrede führte das Akademiemitglied Jakowlew aus: „Dabei wurden „die vielgerühmten Humboltzonen von ihm weit nach Norden vorgeschoben. Wie ein Zauberer aus dem Märchen warf Mitschurin über die unermeßlichen Weiten der Sowjetunion grüne Massive von Obstgärten, die er mit bis dahin nicht gesehenen Sorten schmückte. Das wertvollste Kapital, das der große Umgestalter der Natur geschaffen hat, sind jedoch die Millionen von Mitschurinanhänger…“
Die Begeisterung läßt sich jedoch nicht einpökeln – wie Salzheringe! Und deswegen reduzierten sich schließlich die Erfolge der „Mitschurinschen Biologie“ auf Protokolle von unten über die Erfüllung von Planvorgaben, die durch die Instanzen hoch immer trügerischer, d.h. auch betrügerischer, wurden – und umgekehrt gerieten der Forschung die „konkreten Bedingungen“ der Praxis immer mehr aus dem Blickfeld. So berichtete z.B. der Melker H.P.Hartmann, der 1973 an der LPG-Hochschule in Meißen sein Studium zum Diplom-Agraringenieur abschloß, dass seine Abschlußarbeit aus „Vorschlägen zur Erweiterung und rationelleren Nutzung moderner Milchproduktionsanlagen“ bestand. Um dafür die Note 1 oder 2 zu bekommen, mußte man eine noch nicht ins Deutsche übersetzte sowjetische Arbeit als Quelle benutzt haben, die meist von der „Mitschurinschen Biologie“ beeinflußt war. Hartmann fand eine von Admin und Savzan aus dem Versuchsbetrieb Kutusowska, in der es u.a. darum ging, den Färsen zwei mal täglich die Euter zu massieren: Das würde die Milchleistung später um ca. einen Liter täglich erhöhen. Als „Praktiker“ nahm Hartmann diese Empfehlung jedoch selbst nicht ernst. Ähnlich wurden damals viele lyssenkistische Empfehlungen in der Tier- und Pflanzenproduktion aufgenommen.. „Wer hätte dafür Zeit gehabt, allen Färsen die Euter zu massieren und wieviel das gekostet hätte – dieses zwei mal tägliche Als-Ob-Melken?! Außerdem standen die meisten Färsen in Chrustschowschen Rinder-Offenställen, in denen sie frei herumliefen: Da wäre man gar nicht so einfach an die rangekommen“.
Häufig gerieten die Planvorgaben der Wissenschaftler und ihrer Forschungstationen mit denen der Kolchosen sogar in offenen Widerspruch: So berichtet z.B. der Leiter des Instituts zur Erforschung der Binnengewässer in Borok, Iwan Papanin, dass sie bei ihrem Vorhaben, die Fischzucht und -Fangergebnisse in den Stauseen der Mittleren Wolga zu verbessern, mit den Interessen der dortigen Fischereikolchosen kollidierten, die, um ihren Plan schnell und kräftesparend zu erfüllen, ausgerechnet in der Laichzeit rund um die Uhr, dazu noch mit äußerst engmaschigen Netzen, arbeiteten, was ihnen dann von den Wissenschaftlern verboten wurde: Die Mitarbeiter der Station gingen zur Kontrolle ihrer Anordnungen selbst auf Patrouille.
Ähnlich verhaßt machen sich auch im Westen die Ökologen, wenn sie den Bauern und Fischern aus Umwelt- und Naturschutzgründen immer neue Beschränkungen in ihrer Arbeit auferlegen. In Nordfriesland gibt es nur noch drei Muschelfischer, aber für sie gilt seit Jahren ein strikter „Miesmuschel-Management-Plan“. Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine zunehmende Zahl von wissenschaftlichen Einrichtungen, die als Dienstleister von den Praktikern in Anspruch genommen werden wollen. Erwähnt sei das Obstbau – Forschungs- und Beratungsinstitut im Alten Land, das sogar nachts konsultiert werden kann – besonders bei Frostgefahr während der Blütezeit. Dennoch grenzen sich auch diese Forscher noch von einem Apfelzüchter und Apfelbuchautoren wie Eckart Brand ab – sie nennen ihn einen „Pomologen“, was „Kenner des Obstbaus, bzw. Sortenkundler für Kern-, Stein und Beerenobst“ bedeutet, wobei man noch zwischen Professionellen und Amateuren unterscheidet, letzteres läßt sich vom „amator“ ableiten: „Jemand, der liebt, ohne Gegenliebe zu verlangen“. Die Pomologen sind hierzulande in einem – 1859 gegründeten und 1991 wiederbegründeten – „Deutschen Pomologenverein“ organisiert, und haben einen Geschäftsführer, der früher Atomphysiker war. Nun zieht man ihn u.a. bei Problemen der Sortenbestimmung hinzu. Die Auflösung des Pomologenvereins 1922 erfolgte nach einem Streit zwischen den Erwerbsobstbauern, die sich auf wenige, besonders wirtschaftliche Sorten konzentrieren wollten, und den auf Sortenvielfalt bedachten traditionellen Pomologen mit naturschützerischem Ambitionen. Zwischen beiden stand eine dritte Gruppe: die Kleingärtner. Der Einfluß der „Mitschurinschen Biologie“ macht sich heute noch insofern bemerkbar, als die jetzt führenden Pomologen meist aus der DDR kommen. Erwähnt sei der vortragsreisende Manfred Lindecke aus Werder und der Geschäftsführer des o.e. Vereins Wilfried Müller. Er erinnert sich: „Wir kamen häufig zu Einsätzen, zum Beispiel zu der in der DDR bekannten Lehr- und Leistungsschau der Kleingärtner in Erfurt. Und das hatte den Vorteil, dass wir die eingesandten Früchte von der ganzen DDR, die ganze Sortenvielfalt, kennen lernten.“
Im Alten Land bei Hamburg betreibt der Pomologe Klook eine Baumschule – mit einem beheizten Glashaus, das eine Art Rettungsstation für alte oder seltene Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschsorten ist. Obstbaumbesitzer aus nah und fern schicken ihm kleine Triebe, in einem beiliegenden Brief heißt es dann z.B.: „…hiermit bitten wir Sie um einen Rettungsversuch einer mindestens 60 Jahre alten Süßkirschensorte. Der Baum ist so gut wie tot, und wir übersenden ihnen seine letzten Lebensgeister“. Herr Klook nimmt dann das Süßkirschenzweiglein und pfropft es in seinem Gewächshaus auf ein Süßkirschenbäumchen. Derzeit will er gerade dem Korbiniansapfel zum Durchbruch auf dem Obstmarkt verhelfen: Der wegen „Beleidigung des Führers“ 1934 ins KZ Sachsenhausen eingelieferte Pfarrer Korbinian Aigner hatte im Lager angefangen, Äpfel zu züchten, die er K1, K2, K3, K4 nannte – und auch malte. Seine Apfelbilder wurden vor einiger Zeit in München ausgestellt. Nach seiner Freilassung befand er einzig K3 als gut genug, um weitergezüchtet zu werden. Nach dem Tod des Pfarrers 1960 benannten seine Pomologenfreunde die Sorte in Korbiniansapfel um – er konnte sich jedoch nicht durchsetzen, denn damals wurden gerade mit Hilfe von EG-Prämien in Höhe von 50 Pfennig pro Baum 5 Millionen Apfelbäume gefällt: Den Verantwortlichen schwebte dabei ein EG-weiter „Einheitsapfel“ vor. Mit dem Erstarken der Ökologiebewegung Ende der Siebzigerjahre drehte sich dann aber wieder das Blatt. Heute gibt es in Deutschland erneut rund 2000 Apfelsorten – und immer noch finden die Pomologen weitere. Dafür tun sich nun – in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit – neue Probleme für die Obstanbauer auf, die weniger mit der Trennung von Hand- und Kopfarbeit zusammenhängen als mit dem schon fast verzweifelten Versuch, neue Arbeitsplätze zu schaffen bzw. alte zu erhalten.

Hier baut Gazprom direkt hinter unserem Dorf eine Verdichterstation.
Von der Symbiose-Forschung über den Lyssenkismus zum Survival of the Fittest
Im Darwinjahr 2009 häuften sich auf geradezu unanständige Weise die Darwin-Biographien. Kürzlich fand in Berlin eine Tagung des Zentrums für Literaturforschung (ZfL) über die „Kultur der Evolution“ statt. Die Mehrzahl der eingeladenen Wissenschaftler stammte aus England bzw. Nordamerika und referierte lichtbildgestützt über den „Darwinismus“. Diese „Power-Point-People“ gehörten durchweg zur „Darwin-Industrie“, einer sprach von der „Darwin-Branche“. Bei den Evolutionsbiologen ist überhaupt die Erforschung des Lebens eng mit den Begriffen der Wirtschaftswissenschaften verknüpft. Ständig ist da von „Wettbewerb“, „Konkurrenz“, „Markt“ usw. die Rede.Und wie bei den bürgerlichen Zeitungen üblich folgt auf die Wirtschaftsseite auch bei ihnen sofort die Sportseite, d.h. Begriffe wie „Fitness“, „Sprint“, „Training“ usw..In einer der Diskussionen wurde ein Aufsatz von Gabriel Finkelstein: „Why Darwin was English“ erwähnt. Darüber hatten auch schon Marx und Engels gewitzelt: Mit seinem „Survival of the Fittest“ als grundlegendes Prinzip der Evolution habe Darwin bloß das üble Verhalten der englischen Bourgeoisie auf die gesamte Natur projiziert, meinten sie – und mit ihnen dann auch vor allem russische Wissenschaftler, wie der Biologiehistoriker Torsten Rütting schreibt: „Viele der russischen Intellektuellen verwarfen in Übereinstimmung mit Marx und Engels, aber auch unabhängig von ihnen, die Idee von der Höherentwicklung durch Konkurrenzkampf, die Darwin von dem englischen Nationalökonom Thomas Malthus übernommen hatte“. Malthus glaubte, bewiesen zu haben, dass das rapide Bevölkerungswachstum verbunden mit einem ständig zunehmenden Mangel an Nahrung quasi automatisch eine natürliche Auslese der Besten (der Fittesten) bewirke. Während jedoch Marx und Engels davon ausgingen, dass Darwin Malthus überwunden habe, indem er dessen Gesetz auch in der Tier- und Pflanzenwelt für gültig erklärte, hielt man in Russland das ganze Prinzip der Konkurrenz eher für ein englisches Insel-Phänomen (von Darwin auf den Galapagos-Inseln fundiert), das in den unterbesiedelten russischen Weiten keine Gültigkeit habe.
„In dieser Einschätzung war sich noch der revolutionäre Narodnik Michailowski mit dem ultrakonservativen Oberprokuror Pobjedonoszew einig: Beide taten diesen Aspekt des Darwinismus als eine ‚händlerische Faustregel‘ ab, die ‚unsere [russische] Seele nicht annehmen‘ könne.“ In Russland sah man stattdessen (wieder mit Marx und ebenso unabhängig von ihm) eher das Prinzip der Kooperation am Werk – auch bei Tieren und Pflanzen.
1900 veröffentlichte der Anarchist Fürst Kropotkin dazu sein auf sibirische Expeditionserfahrungen basierendes Werk „Die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt“. Darin prophezeite er, dass man mit der Entwicklung der Mikroskop-Technik noch weit mehr Kooperationen in der Natur entdecken werde. Und in der Tat entstand, zur selben Zeit bereits, unter russischen Botanikern eine eigenständige Symbioseforschung“ – ausgehend von Untersuchungen an Flechten, die nichts anderes sind als eine Alge und ein Pilz, die sich zusammengetan haben, um auch noch an den unwirtlichsten Orten siedeln zu können. Inzwischen wissen wir, dass sich auch unsere Körperzellen mit einem anderen Organismus zusammengetan haben: mit Mitochondrien, die den Sauerstoff in Energie umwandeln. Während die Pflanzenzellen sich mit Chloroplasten verbanden, die ihnen allererst die Photosynthese ermöglichten. Beider „Organellen“ werden als „Energiekraftwerke“ bezeichnet, die von den pflanzlichen und tierischen Zellen einverleibt wurden, es gibt sie jedoch auch als freilebende Individuen. Die „Endosymbiontentheorie“ wurde derart ausgeweitet, dass viele Forscher heute davon ausgehen: Alle Vielzeller sind aus Bakterien entstanden, die kooperierten, um immer komplexere Organismen zu bilden. Umgekehrt kann man auch sagen – wenn man z.B. von unseren Bakterien namens E.coli in unserem Darm ausgeht bzw. von den Mikroorganismen im Pansen der Kuh, in den Verdauungsorganen der Termiten oder in den Wurzeln der Bäume, dass diese sich die Tiere und Pflanzen bloß geschaffen haben, um immer genügend Nahrung zur Verfügung zu haben. Die meisten Erforscher solcher Symbiosen (von denen nun ständig neue entdeckt werden), wollen damit jedoch nicht darauf hinaus, dass es gar keinen „Kampf ums Dasein“ gibt. Sie bleiben brave „Darwinisten“. Mit dem sowjetischen Dichter Ossip Mandelstam sagen sie sich aber vielleicht: „Es ist unmöglich, der Darwinschen Gutmütigkeit zu widerstehen…Doch ist denn die Gutmütigkeit eine Methode schöpferischer Erkenntnis und ein würdiges Verfahren der Wahrnehmung des Lebens?“
Die Begriffe aus Wirtschaft und Sport werden also ständig in der darwinistischen Theoriebildung verwendet – umgekehrt greifen aber auch die Wirtschafts- und Sportwissenschaften zunehmend auf darwinistische Begriffe zurück.Das begann hierzulande spätestens mit der Wende, d.h. mit dem Wirken der unseligen Treuhandanstalt (THA/BfS/BVVG) und eskalierte 2004 in der Open-Air-Party des US-Beratungskonzerns bei Privatisierungen und Filettisierungen „McKinsey“, deretwegen die ganze Gegend zwischen Brandenburger Tor und Berliner Dom polizeilich abgesperrt wurde. Der Politologe Peter Grottian schimpfte: McKinsey sei „in vieler Hinsicht Inspirator und Oberberater der Hartz-Gesetze“ gewesen. „Und nun okkupiert diese exklusive und geschlossene Gesellschaft in einer opulenten und völlig überzogenen Weise die Mitte von Berlin.“ Der unselige Landesbischof Huber richtete im Dom ein Grußwort an die 1800 McKinsey-Beschäftigten, Peter Grottian drohte: „Wir werden Huber daran erinnern, dass die Kirche an die Seite der Schwachen gehört“.
In den 15 Jahren, die zwischen diesen „Events“ lagen, wandelte sich der „Rheinische Kapitalismus“ vollends zum „Schweinesystem“. Der Darwinismus gelangte jedoch nicht über das Schwein, sondern über den Wolf in das Wirtschafts- und Sport-Denken. Wenn das Totemtier des „New Age“ der Delphin war, dann ist es in der „New Economy“ der Wolf. Das begann 2000 – mit dem ersten (dreibeinigen) Wolf, der aus Sibirien über die Oder in den Westen gelangte. Anfangs mobilisierte er noch uralte Bauernängste, aber dann traten immer mehr Natur- und speziell Wolfsschützer auf den Plan und die öffentliche Meinung schwenkte um 180 Grad.
Bereits auf dem letzten „Bauerntag“ der DDR 1990 in Suhl, auf dem der damalige BRD-Bauernpräsident von Heeremann eine Rede hielt, in der er die Auflösung der LPGen empfahl bzw. befahl, war vielen LPG-Vorsitzenden sozusagen schlagartig klar geworden – und sie sagten das auch: „Wir müssen jetzt wie die Wölfe werden!“ Auf einer Betriebsrätekonferenz in der Kongresshalle am Alexanderplatz seufzte wenig später ein Treuhand-Privatisierungsmanager aus Westfalen treuherzig: „Ich muss unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen …“ In der THA/BvS/BVVG arbeiteten im übrigen auffallend viele Manager, die „Wolf“ oder „Fuchs“ hießen (Wolf Schöde, Günter Wolf, Dr. Fuchs und so weiter), während auf der anderen Seite merkwürdig viele Betriebsräte Gottlieb und Lammfromm, einer sogar Feige hießen. Ein Fall von Namensmagie im ausklingenden 20. Jahrhundert?! Einer der THA-Manager, Wolf Klinz, auch Dr. Wolf genannt, wurde später Geschäftsführer einer „Management KG“, die er als Leiter der Treuhand-Abteilung Elektrobetriebe 1994 mitgründen half, um darin unverkäufliche Ost-Betriebe zusammenzufassen und somit zu quasi-privatisieren. Das hat er dann also auch mit sich selbst gemacht. Außerdem war da noch der Vorständler „Wolf von BASF“: Er hat anscheinend dichtgehalten – beim Bischofferöder Kali-Deal. Das ging zuletzt aus den geheimen Tagebuch-Aufzeichnungen des Treuhand-Vorständlers Klaus Schucht hervor: „Wie gut, dass man sich auf solche Leute wie Wolf verlassen kann.“
In Westdeutschland brachen 2004 sechs Wölfe aus einem Tierpark in Simmern im Hunsrück aus. Vier wurden sofort zur Strecke gebracht. Eine Tierschützer-Gruppe stellte daraufhin Strafanzeige wegen „Wolfstötung“. „Werden die Jäger jetzt zu Gejagten?“, fragte die Lokalzeitung entsetzt. Weil die Bevölkerung den Standort der Wölfe sofort der Polizei melden sollte, sprachen die Tierschützer – unter www.tierrechte.de – von einem „Aufruf zum Denunziantentum“.
„Die Weisheit der Wölfe – Wolfsstrategien für Geschäftserfolg, Familie und persönliche Entwicklung,“ so hieß dann ein internationaler Bestseller des Managementberaters Twyman L. Towery. „Heute ist auf der ganzen Welt ein wieder auflebendes Interesse an Wölfen zu beobachten,“ heißt es darin. „Die Sozialordnung des Wolfs ist hoch entwickelt… Das Alphamännchen ist buchstäblich der Rudelführer … Wölfe sind wichtig für die Erhaltung einer gesunden, natürlichen Umwelt… Sie fressen die Schwachen, Kranken und Alten anderer Tierpopulationen … Am allermeisten freilich brauchen wir die Wölfe – für die Gesundheit unseres Geistes. Die Einstellung des Wolfs kann man in wenigen Worten zusammenfassen: Sie besteht in einer ständigen Vergegenwärtigung von Erfolg… Das Wolfsrudel ist zwar möglicherweise die effektivste Jagdmaschine der Natur, aber es hat dennoch eine Misserfolgsrate von annähernd neunzig Prozent … Es gibt deswegen im Leben des Wolfs keinen Ersatz für Beharrlichkeit… Das Naturgesetz vom Überleben des Tauglichsten ist in der Welt des Wolfs weiterhin wirksam.“
US-Psychologinnen rieten in ihren stets sogleich ins Deutsche übersetzten Büchern den Leserinnen, die „Wolfs-Frau“ in sich zu entdecken. „Werdet wie die Wölfinnen!“, riet aber auch die Frauenforscherin Clarissa Pinkola Estes – auf der Webpage zu ihrem Buch „Wolfsfrauen“. Andere Autorinnen verfaßten Ähnliches – z.B. Donna Boyd mit „Das Haus der Wölfe“ und „Die Schneewölfin“ sowie Virginie Despentes mit „Wölfe fangen“ und die „Prix du Suspense“-Preisträgerin Sophie Schallingher mit „Das Schweigen der Wölfin“, aber auch der Modemacher Wolf Joop, der seine Autobiographie „Im Wolfspelz“ nannte und der Feenforscher Wolfgang Müller, der in der taz von der „Faszination Wolf: Ein Mythos kehrt zurück“ sprach.
In Berlin eröffnete der Naturschutzbund (NABU) eine Ausstellung mit dem Titel „Willkommen Wolf“. Die Berliner Zeitung titelte: „Der Trend zum Wolf hält unvermindert an“. In ihrem Artikel ging es um „vulkanische Rockrhythmen“: „Nach Howlin‘ Wolf, Superwolf, Guitar Wolf, We Are Wolves und den Wolf Eyes durften wir nun eine weitere Rock-’n‘-Roll-Band erleben, die ihr musikalisches Schaffen dem Lobpreis der wölfischen Wildheit gewidmet hat.“ Gemeint war damit die kanadische Band „Wolf Parade“ und ihr Konzert in der Arena, auf dem ihr „mehrstimmiges Wolfsgeheul“ von einem Thermenvox herrührte. Dieses Instrument wurde 1920 von dem Russen Leo Thermin erfunden. Heute gibt es weltweit fünf Thermenvox-Spieler, es sind ebenso wie die fünf Wolfsforscher an Oder und Neiße ausschließlich Frauen.
Die französische Pianistin Hélène Grimaud veröffentlichte eine Autobiographie mit dem Titel „Wolfssonate“. Sie besitzt bei New York ein großes Freigehege mit einem Wolfsrudel und hat eine besonders intensive Beziehung zu dem Wolf Alawa, der jedoch Helene Grimauds Freund Jeff nicht mochte, weswegen die Pianistin sich schließlich von diesem trennte. „Mein Gott, was für eine Frau…zugleich Frau am Klavier und Frau mit den Wölfen“, stöhnte die Süddeutsche Zeitung. „Warum Frauen Wölfe lieben?“, fragte sich „Die Welt“: Früher sorgten die „Märchen des Patriarchats“ dafür, dass Frauen besonders große Angst vor Wölfen hatten und „Staat, Kirche und Familienoberhaupt“ vorgaben, sie vor diesen Bestien zu beschützen. Heute sind die Frauen dagegen weitgehend auf sich allein gestellt – und prompt laufen sie den erstbesten Wölfen sozusagen in die Arme. Aber statt sich zu wehren, „verfallen sie ihnen“, wie der „Welt“-Meister Eckhard Fuhr, ein leidenschaftlicher Jäger, in seiner Rezension zweier von Frauen geschriebener Sachbücher über Wölfe sowie der Autobiographie von Hélène Grimaud schrieb. Zur „Schlüsselszene“ hatte Fuhr die Beschreibung des ersten Wolfkontakts von Grimaud gewählt: Nachdem eine zahme Wölfin sich an ihre Handfläche geschmiegt hatte, spürte sie „augenblicklich einen stechenden Funken, eine Entladung im ganzen Körper, der meinen Arm und meine Brust bestrahlte.“ Aus diesem Schauer der Französin schlussfolgert der Rezensent seltsamerweise: „Wölfe sind in Deutschland [!] Frauensache geworden“ – spätestens seit dem Tod des legendären Wolfsforschers Erik Ziemen, für den die Verwandlung des wilden Wolfs in einen zahmen Hund durch Frauen geschah, indem sie sie quasi eigenbrüstig aufzogen. Hier erschien dann auch noch ein Manager-Handbuch der Paderborner Unternehmensberaterin Gertrud Höhler mit dem Titel „Wölfin unter Wölfen“, in dem die Autorin für mehr „Mixed Leadership“ plädierte.
In Brandenburg wurde ein „Wolfwiederansiedlungs-Konzept“ wirksam und dazu ein „Wolf-Management-Plan“ verabschiedet: Dort sind die Wölfe seitdem ganzjährig geschützt, zu DDR-Zeiten durften sie dagegen ganzjährig gejagt werden. Die Leiterin des dafür neu eingerichteten „Kontaktbüros Lausitzer Wölfe“ – Jana Schellenberg – erklärte: „Wir können die Akzeptanz der Wölfe nur fördern, wenn wir ehrlich und sachlich sind.“ In der Zeitschrift „Emma“ wurden Männer, die keine Kinder haben wollen als „einsame Wölfe“ bezeichnet – doch das schade „ihrem Ansehen keinesfalls“. Der Spiegel sprach von einer „Rückkehr des grauen Wanderers“, die FAZ von „der langen Nacht des Wolfs“, und die Berliner Zeitung von der „Zeit des Wolfs“. „Im Osten gedeihen die Wölfe“ titelte die Süddeutsche Zeitung. In der Muskauer Heide fand eine erste internationale „Wolfskonferenz“ statt.
In Erlangen wurde das „NS-Stück ,Die Wölfe'“ – ein „U-Boot-Drama“ – uraufgeführt. Die Studentin Jana meldete aus der Elite-Uni „Viadrina“ in Frankfurt/Oder: „In einem BWL-Seminar sagte der Dozent neulich: ,Wenn man anderen beruflich was Gutes tut, tut man sich selber nichts Gutes. Und das haben alle um mich herum eifrig in ihre Hefte geschrieben“. Der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz referierte im Rahmen einer Ringvorlesung an der Humboldt-Universität über „Heldenkonzepte rechtsextremer Männer“ – in denen das Selbstbild dieser Leute sich heute nicht mehr am Symbol des Löwen orientiere, sondern „an dem des Wolfes, der durch feindliches Gelände marodiere, einsam oder im Rudel, allzeit bereit zu Mord und Totschlag“. Die Bundesregierung ließ daraufhin schon mal prüfen, ob das Internet-Suchwort „Wolf“ nicht verboten gehöre – weil es allzu oft auf Webpages von Neonazis auftaucht. Obendrein wurde der Wolf auch noch zum „Tier des Jahres“ gekürt. Die Bild-Zeitung meldete, dass man jetzt bei einer „Tier-DNA-Datenbank“ prüfen lassen könne: „Wie viel Wolf steckt in meinem Fiffi?“
Europaweit lief dann der spanische Film „El Lobo“ (Der Wolf) an: Um die Terroristen der ETA zur Strecke zu bringen, schleust sich ein Spitzel namens Eguia über das Bett der schönen Kämpferin Amaia in die Organisation ein – und läßt schließlich die ganze ETA-Führung hochgehen. „Jin Roh“ nannte der japanische Zeichentrickfilmer Hiroyuki Okihura seinen auch in Berlin gezeigten Wolfs-Film, in dem sich – laut Berliner Zeitung – „Terror und Gegen-Terror die prekäre Waage halten“. Ein deutscher Regisseur ahnte den Geist der Zeit und verfilmte den Nachkriegsbestseller „So weit die Füße tragen“ neu. Besonders jene Szene, in der die kleine Gruppe deutscher Kriegsgefangener, die 1944 aus einem sibirischen Lager ausbrach und nach Westen flüchtete, von einem Wolfsrudel im winterlichen Wald verfolgt wird, jagte damals Millionen Deutschen wahre Schauer über den Rücken. Das Buch wurde daraufhin als erste Serie für das deutsche Fernsehen verfilmt – und die Serie wiederum wurde zum ersten deutschen „Straßenfeger“. Die Neuverfilmung geschah nun in Original-Sibirien und mit Original-Wölfen. Aus Frankreich kam der Film: „Pakt der Wölfe“. Ein Mix aus Action, Sex, Mystik, edle wilde Wölfe, geldgeile Huren und Ökologie. Dem taz-Rezensenten Detlef Kuhlbrodt gefiel der Film trotzdem: Er sei „pynchonesk“ und „beruhe auf einer wahren Begebenheit – aus dem 18.Jahrhundert“.
Im Internet bewarb sich das saarländische Merzig, Standort eines Fallschirmjäger-Bataillons, als „Stadt der Wölfe“: Der „Einzelkämpfer“-Ausbilder Werner Freund legte dort mit 25 Wölfen ein „Miniaturreservat“ an, das jährlich über 100.000 Menschen besuchen. Er bezeichnet sich als „Oberwolf“. Als experimenteller „Verhaltensforscher“ behauptet er: „Wir sind auch Rudeltiere, nur eben entartete, überzüchtete Supermarktraubtiere.“ Im „Naturbuch-Verlag“ veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel „Wolf unter Wölfen“. Auch der große 1937 erschienene Nachkriegsroman von Hans Fallada hieß schon „Wolf unter Wölfen“. Dies war jedoch eher ein Warn- als ein Sachbuch: „Es handelt von sündigen, sinnlichen, schwachen, irrenden, haltlosen Menschen… in einer zerfallenden, irren, kranken Zeit… in der jeder für sich allein und gegen alle kämpft.“ 1965 verfilmte das DDR-Fernsehen Hans Falladas Roman.
Das seit 1989 stetig anschwellende Wolfsgeheul in Film, Fernsehen, Feuilleton und Freier Wildbahn nahm derartige Formen an, dass es bei den Meinungsbildnern einer Gehirnwäsche gleich kam: Der Tagesspiegel-Autor Matthias Glaubrecht nahm an einer Geschäftsleute-Delegation teil, anschließend schrieb er: „Wir beobachten, wie unsere Chefs mit den uns Unbekannten der anderen Gruppe umgehen und lernen,die interne Rangordnung unserer Gegenüber kennen. Das erspart Zeit und Auseinandersetzungen mit den Ranghohen der Gegenseite“. In seinem Plädoyer für „Alpha-Tiere“ argumentiert der Autor ausschließlich biologisch – vor allem mit der Wölfischen „Rangordnungsstruktur“ (Struktur! wie Komplex das klingt.), die er ob ihrer Effektivität tautologisch als erfolgreiche „evolutionäre Anpassung an die räuberisch-umherschweifende Lebensweise der Wölfe“ bezeichnet.
Zuletzt veröffentlichte der Wirtschaftsberater Johannes Voss zwei „Fachbücher“ – mit den Titeln: „Die Führungsstrategien des Alphawolfs – Ideenpool für Manager“ und „Von Wölfen lernen – effektiv und souverän im Projekt.“ Bei der Vorstellung seines Buches, im Beisein des Landrates vom Main-Tauber-Kreis erklärte der Verleger: „Gerade der hohe Praxisbezug gepaart mit den interessanten und einprägsamen Beschreibungen des Wolfsverhaltens hat uns als Fachbuchverlag dazu bewogen das Buch in unser Programm aufzunehmen.“
Während in den „Chatrooms“ noch junge Wolffans und alte Wolfexperten die persönlichen Eigenschaften jedes hierzulande in Freiheit neugeborenen Wölfchens diskutierten, kam es jedoch spätestens ab 2005 – nach einer Reihe kleinerer Börsen- und Finanzkräche – zu einem gewissen Innehalten: Erst ließ die FAZ für ihr Feuilleton ein nachdenkliches Gedicht des Spaniers Pacheco „In der Republik der Wölfe“ übersetzen, dann warnte sogar der Spiegel vor allzu großer Wolfsverehrung: „Bis vor kurzem wurde die Rückkehr der Wölfe nach Sachsen noch gefeiert. Nach Attacken der Raubtiere haben die Bewohner der Lausitz nun Angst“. Kürzlich rissen nämlich die „grauen Räuber“ in einer Nacht 27 Schafe, dann drei Tage später „sanken sechs Schafe in Müllrose nach einer Blitzattacke tot zu Boden – und die Wölfe berauschten sich erneut am Blut“. In der Schweiz beschloß man, besonders mordlustige Wölfe zu erschießen. Die Jugendministerien der Bundesländer versuchten die Internet-Suchmaschinen-Betreiber dazu zu bewegen, „jugendgefährdende Worte wie etwa Wolfsrudel“ in ihre Induzierungsliste aufzunehmen: „weil die Zeichenkette oft auf rechtsextremen Seiten auftaucht.“ In München demonstrierten einige hundert Menschen gegen die „Grauen Wölfe“ – in Deutschland und der Türkei. Die Polizei startete eine Informations- und Ausklärungskampagne unter der Bezeichnung „Wölfe im Schafspelz“. Und während sich in China das Buch „Wolf Totem“ noch weiter millionenfach verkaufte, interessierte sich für die Bertelsmann-Ausgabe plötzlich kaum jemand. Ja, es erschienen in Deutschland sogar einige Bücher über Wölfe, die den Begriff in antidarwinistischer Absicht – kritisch – verwendeten. Erwähnt sei „Raubtier-Kapitalismus – Globalisierung, psychosoziale Destabilisierung und territoriale Konflikte“ von Peter Jüngst, „Hirten & Wölfe“ – wie Geld- und Machteliten sich die Welt aneignen“ von Hans Jürgen Krysmanski, „Raubtierkapitalismus: Wie Superspekulanten, Finanzjongleure und Firmenjäger eine Weltfinanzkrise provozieren“ von Dieter Balkhausen und „Wohlstand und Gesundheit für alle: Das Ende des Raubtier-Kapitalismus“ von K. Schulze und D. Marc.
Man kann aus diesen zeitlichen Unterschieden in der Theorie- bzw. Wahnbildung Chinas und Deutschlands nur den Cioranschen Schluß ziehen: „Die Stunde des Verbrechens schlägt nicht für alle Völker gleichzeitig – daraus erklärt sich die Kontinuität von Geschichte.“

Ich habe mir die Krim ganz anders vorgestellt: Kuck mal, da vorne ist sogar ein Edekaladen.
Die Sowjetunion als Haupteinwanderungsland
„Eine Utopie von Elektrikern“ (H.G.Wells nach einem Gespräch mit Lenin über dessen Definition von Kommunismus: „Gleich Sowjets plus Elektrifizierung“)
In den Zwanziger- und Dreißigerjahren gehörte die Sowjetunion zu den beliebtesten Auswanderungsländern. Das „Paradies der Werktätigen“ war besonders für Arbeitslose, politisch verfolgte Linke und junge Abeuteurer attraktiv. Die sowjetischen Einwanderungsbehörden ließen vor allem Facharbeiter, oftmals zusammen mit deren Familien, ins Land. Sie bekamen Spitzenlöhne und wurden zusätzlich versorgt. Man setzte sie vor allem beim Aufbau der Schlüsselindustrien ein, u.a. beim gigantischen GOELRO-Projekt zur Elektrifizierung des gesamten Landes. Das größte Kontingent ausländischer Arbeiter kam aus Deutschland, wo es gleichzeitig auch von oben Bemühungen gab, trotz der systematischen Unterdrückung aller Arbeiteraufstände und der Verfolgung der Kommunisten, ein enges Bündnis mit der Sowjetunion einzugehen, um die Isolierung Deutschlands durch die westlichen Siegermächte des Ersten Weltkriegs nach Osten hin zu durchbrechen. Erwähnt seien Walther Rathenau und seine AEG, die bald direkt mit den GOELRO-Planern kooperierte.
Weil die ausländischen Arbeiter und speziell die Deutschen – etwa 11.000, mit Familienangehörigen 17.000 – in der Sowjetunion spätestens ab 1933 vielfältigen Repressionen durch die Sicherheitsorgane der UDSSR ausgesetzt waren, deren Akten jedoch erst seit etwa 1988 zugänglich sind, gibt es nun eine eigene neue Literatur zu diesem Thema – auch in Deutschland, und hier vor allem im Osten, wo man darüber zu DDR-Zeiten nicht einmal reden durfte. Obwohl beispielsweise im Ostberliner Glühlampenkombinat Narva bis zur Wende ein sogenanntes Traditionskabinett existierte, in dem all jene kommunistischen Arbeiter mit Porträtfotos geehrt wurden, die seinerzeit bei Osram erst Industriespionage betrieben hatten und dann in die UDSSR emigriert waren, teilweise unter Mitnahme von Spezialgeräten und Konstruktionszeichnungen, die sie zuvor in ihrem Betrieb entwendet hatten. Umgekehrt hatten zuvor die weltweit in einem Kartell zusammengeschlossenen Elektrokonzerne (General Electric, Siemens, Osram, AEG etc.) die sowjetischen GOELRO-Planer auflaufen lassen, indem sie ihnen erst überteuert Maschinen zur Wolframdraht- und Glühbirnen-Herstellung verkauft, dann jedoch eine „Wolframblockade“ gegenüber der UDSSR verhängt hatten. Daraufhin wandte sich der sowjetische Geheimdienst an die deutschen Kommunisten, und diese konnten unter anderem die Osram-Arbeiter Julius Hoffmann und Emil Deibel zur Mitarbeit bewegen. Die beiden hatten zuvor in der Wolframdraht-Zieherei bereits heimlich Bomben hergestellt. Später emigrierten sie ebenfalls in die Sowjetunion, wo sie Kampfnamen annahmen, wie Schurawlow schreibt. Seine Studie – mit dem russischen Titel „Kleine Leute und die große Geschichte“, erscheint demnächst auf Deutsch.
Bald wieder neu aufgelegt wird eine ähnliche Arbeit des Ostberliner Historikers Gerhard Kaiser über das Schicksal junger thüringischer Arbeiter, vor allem Metallberufler und Glasbläser, die in den Zwanzigerjahren, teilweise mit ihren Familien, in die UDSSR emigriert waren. Zuvor hatten sie – allein in Suhl – mehrere Waggons mit Werkzeug für das „Vaterland aller Werktätigen“ gespendet. Auch die Suhler Unternehmer erhofften sich ihre Rettung durch „Russenaufträge“ – die nach Rapallo dann auch eintrafen: ein Werk lieferte allein 4 Entladungsanlagen nach Murmansk und zwei Entspeicherungskratzer für den Kalibergbau bei Solikamsk. Andere Suhler Betriebe verkauften Jagdwaffen, Porzellan usw. in die Sowjetunion. Nichtsdestotrotz gab es 1931 in Suhl 15.031 Arbeitslose – fast die Hälfte aller arbeitsfähigen Männer. Für die Linken unter ihnen verschärfte sich die Situation 1933 dann noch einmal, so daß mit Hitlers Machtantritt die Sowjetunion, wie die Internationale Rote Hilfe schrieb, „das einzige Land wirklichen Asyls für revolutionäre Emigranten“ wurde.
Besonders engagierte sich die von Kommunisten gegründete Genossenschaft der Thermometermacher in Elgersburg bei Spendensammlungen. Und etliche Genossenschaftler fuhren dann auch in die UDSSR, „um dort am Aufbau einer eigenständigen Thermometerindustrie mitzuwirken“. 1932 produzierte das Moskauer Werk bereits 1,85 Millionen Thermometer – mit 2468 Arbeitskräften. Einer der ersten „Rußlandfahrer“ – Alwin Günther – schrieb 1932 nach Hause: Arbeit gibt es hier „in Hülle und Fülle“. Zu der Zeit arbeiteten bereits 3000 deutsche Facharbeiter im Ural, 2000 in und bei Leningrad, 1600 in Moskau und 800 an der mittleren Wolga. Viele wurden dann ab Mitte der Dreißigerjahre in den „Mühlen des Großen Terrors zermahlen“, wie Gerhard Kaiser sagt – das hieß erschossen, verbannt, in abgelegenen Regionen zwangsangesiedelt oder in Arbeitslagern der Waffenindustrie zusammengefaßt. Etliche wurden auch ausgewiesen bzw. kehrten freiwillig nach Deutschland zurück.
1931 wandte sich Maxim Gorkij öffentlich „An die ausländischen Arbeiter“ – für die Deutschen unter ihnen geschah das in der „Deutschen Zentral-Zeitung“ (DZZ): ursprünglich ein Organ der rußlanddeutschen Siedler. Nachdem diese sich jedoch der Kollektivierung der Landwirtschaft widersetzt und 50.000 von ihnen nach Deutschland reemigriert waren (wo man sie von Kiel aus nach Kanada weiter verschifft hatte) wurde die DZZ für die neu nach Rußland gekommenen deutschen Arbeiter umfunktioniert. Gorkij schrieb dort über sie: Ihr seid hier „auf die Position einer Vortruppe der Weltarmee der Arbeiter und Bauern gestellt…“ So sahen das auch die meisten Rußlandfahrer. In einer – später von der DDR herausgegebenen Broschüre – berichtete z.B. der Duisburger Hüttenarbeiter Theo van Bernum, der in Sibirien Hochöfen baute, daß nach einer Schlägerei in der Werkskantine von Kusnezk – zwischen amerikanischen Köchen und deutschen Arbeitern – ein Gerichtsprozeß stattfand, in dem der zuvor aus Deutschland geflüchtete Partisanenführer Max Hoelz als Ankläger gegen zwei deutsche Arbeiter auftrat, wobei er das unproletarische Verhalten dieser Genossen aufs schärfste verurteilte – und dabei ähnlich wie Gorkij argumentierte. Ansonsten gab man jedoch den Umständen die Schuld – und daß noch zu wenig Kulturarbeit unter den ausländischen Arbeitern geleistet würde. Bald existierten aber neben Zeitungen nicht nur eigene Clubs für sie, die Betriebe errichteten auch spezielle Wohn-„Häuser für ausländische Arbeiter“. Über das des Moskauer Elektrosawod berichtete gerade Wladislaw Hedeler im Ostberliner Weltbühnennachfolge-„Blättchen“ (Nr 1/2002). Außerdem wurden besondere Bildungseinrichtungen gegründet – viele Kinder ausländischer Arbeiter machten ihre Hochschulreife, schulten sich um oder wurden sogar Berufspolitiker.
Dennoch waren oftmals ihre Anfangsschwierigkeiten und -enttäuschungen in Rußland enorm – und sie waren beiliebe keine homogenen „Landsmannschaften“. Im Donbass, wo die dort eingesetzten Ausländer in der Hauptsache Bergarbeiter waren, stellte eine Parteiuntersuchungskommission 1930 fest, daß von den 499 Deutschen (mit Familienangehörigen 807) zuvor 123 in der KPD Mitglied gewesen waren, 30 im Rotfrontkämpferbund, 15 in der SPD und 5 in der NSDAP, die Mehrheit war parteilos. Unter den Arbeitern befanden sich angeblich auch etliche „asoziale Elemente“, was z.T. darauf zurückgeführt wurde, daß die Anwerber in Deutschland oft bloß ihre Quoten erfüllen wollten. Die Kommission wurde eingesetzt, nachdem 20% der Donbass-Arbeiter frustriert wieder nach Deutschland zurückgekehrt waren.
Zwischen den Sowjets und der KPD auf der einen Seite und vor allem der SPD auf der anderen kam es zu regelrechten Propagandaschlachten über das wahre Bild der „Heimat aller Werktätigen“, die vornehmlich mit den Erfahrungsberichten der Rückkehrer bzw. der Dableiber geführt wurde. Eine Umfrage des „Vorwärts“ unter ehemaligen Arbeitern aus dem Elektrosawod konterte man sowjetischerseits z.B. mit der auf deutsch gedruckten Broschüre „Berliner Proleten vom Moskauer Elektrosawod erzählen“, die 1933 von den Arbeitern E.Wittenberg, E.Matte und F.Pose zusammengestellt wurde: „In rosigen Farben schilderten sie (darin) ihr Leben im Betrieb“, schreiben die deutschen und russischen Autoren des Sammelbandes „Verratene Ideale – zur Geschichte deutscher Emigranten in die Sowjetunion“, der 2000 im trafo-Verlag erschien. 1938 wurde der Herausgeber der Broschüre Wittenberg wegen „konterrevolutionärer Tätigkeit“ zu 10 Jahren im Arbeitsbesserungslager Sewostlag verurteilt, wo er noch im selben Jahr starb.
Besonders tragisch war das Schicksal des sich in der Broschüre ebenfalls lobend über die sowjetischen Arbeits- und Lebensbedingungen äußernden Berliner Arbeiters Huth: von seiner siebenköpfigen Familie überlebte nur sein jüngster Sohn Karl den „Großen Terror“. 1938 erfand der NKWD in Moskau sogar einen operativen Vorgang namens „Hitlerjugend“, dem insbesondere junge deutsche Arbeiter zum Opfer fielen: 40 wurden erschossen, 21 kamen in Arbeitslager. Viele Belegschaften großer Betriebe begrüßten nicht nur die in den Schauprozessen ausgesprochenen Todesurteile, sie verlangten laut Gerhard Kaiser sogar noch eine Ausweitung der sogenannten tschistka – Säuberung.
Mit dem Nichtangriffs- und Freundschaftspakt zwischen Hitlerdeutschland und der Sowjetunion wurden etliche Verhaftete vom NKWD auch kurzerhand an die Gestapo ausgeliefert. Der generelle Spionageverdacht gegenüber den deutschen Arbeitern kam von der Parteispitze; bis Ende 1938 waren bereits 842 deutsche Emigranten verhaftet. Einer der in dem Buch „Verratene Ideale“ interviewten SU-Veteranen – Frido Seydewitz – wurde ohne Gerichtsverhandlung zu achtjähriger Zwangsarbeit verurteilt und landete im Gold-Tagebau von Kolyma. Er kam erst 1948 – nach fünfzehn Jahren – wieder frei, nachdem sein Vater, der inzwischen Präsident von Sachsen geworden war, sich für ihn eingesetzt hatte. Sein Bruder kehrte sogar erst 1949 – aus Workuta – wieder nach Deutschland zurück. Rückblickend meint Frido Seydewitz: „Es war nicht der beste Zeitabschnitt unserer Epoche, in der es mir zuteil geworden ist, mein Leben zu verbringen.“ Es war eher eine pathetische Zeit: Der damals 17jährige Herbert Hentschke schrieb seinem NKWD-Verhörbeamten aus dem Moskauer Gefängnis: „…mit dem Komsomolzenwort antworte ich meinem Vater, der jetzt mutig an den Fronten Spaniens kämpft…und meiner Mutter, die im faschistischen Gefängnis sitzt…und ihnen, den ruhmreichen Organen bei der Errichtung des Sozialismus in der UDSSR: ‚Ja, auch ich werde bis zu Ende meine Pflicht als Proletariersohn erfüllen…'“ Er war im Zusammenhang der Vorbereitung des „Hitlerjugend“-Prozesses verhaftet worden, wurde dann jedoch wieder frei gelassen. Anders der wegen rechten Abweichlertums – als „Brandlerist“ – angeklagte Arbeiter aus dem Moskauer Thermometerwerk: Karl Hager aus Elgersburg – er wurde 1940 nach Deutschland ausgeliefert, wo er die Gestapo-Haft überlebte und sich 1945 am Wiederaufbau der Glasindustrie in seinem Heimatort beteiligte. Seine NKWD-Verhörprotokolle veröffentlichte gerade die Historikerin Ulla Plener in der Ostberliner Zeitschrift „Utopie kreativ“ (Nr.119). Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs verließen noch einmal viele deutsche Arbeiter die Sowjetunion – man sprach hier von „Rußlandheimkehrern“. Von den dort Bleibenden wurden dann nicht wenige bei Herannahen der Front nach Kasachstan und Sibirien evakuiert.
In Gerhard Kaisers Emigranten-Studie stehen die Schicksale der „drei Musketiere“ aus dem Thüringer Wald Alwin Günther, Wilhelm Holland und Erich Ripperger im Mittelpunkt. Die Enkel des letzteren – Walerij und Genadij – haben sein Buch dann auch in ihrem Forst-Verlag WAGE vor zwei Jahren herausgegeben. Alwin Günther und Wilhelm Holland machten später Karriere in der Erfurter SED; 1951 verloren sie jedoch nach Parteiüberprüfungen ihre Ämter.
Die größte „Baustelle des Sozialismus“, das war sicherlich Magnitogorsk, wo ebenfalls die Mehrzahl der ausländischen Arbeiter aus Deutschland kam. Hier wurden zusätzlich auch noch viele deutsche Architekten und Ingenieure eingesetzt, u.a. eine Bauhaus-Brigade von Ernst May, der 1933 erst nach Afrika auswanderte und dann in Westdeutschland für die Neue Heimat tätig war. Zwei Familienangehörige aus diesem Kreis, Anna und Meike, die bis heute keine Grund haben, ihre „schönen schweren Jahre in der Sowjetunion“ zu bereuen, hat Gabriele Krone-Schmalz 1999 in einem romanähnlichen Bericht porträtiert. Ihr Buchtitel „Straße der Wölfe“ ist etwas irreführend, ebenso das Coverphoto, das zwei junge Stahlarbeiterinnen zeigt, auch irritiert, daß die Gespräche der beiden jungen Frauen in Magnitogorsk 1932 schon genauso klingen wie die Dialoge alleinerziehender Feministinnen auf Gomera heute. Dennoch kommt das Heroische dieser Epoche darin ganz gut rüber, wie man so sagt.
Damals gab es nicht wenige Spezialisten, die insgeheim als eine Art unbezahlte Nazi-Agenten in der SU unterwegs waren – und anschließend darüber in der Heimat hämisch berichteten:- z.B. daß die Arbeitslosen in Deutschland weitaus besser leben würden als selbst die privilegierten ausländischen Arbeiter in Rußland. Außerdem seien dort alle Entscheidungsgremien „verjudet“ und die Frauen würden im Kommunismus mit jedem schlafen, der ihnen gefalle. All dies schreibt z.B. Rudolf Wolters in seinem 1933 erschienenen Buch „Spezialist in Sibirien“. Der arbeitslose Architekt war in Berlin von einem „Agenten für Rußland“ speziell zum Bau von Bahnhofsempfangsbäuden angeheuert worden – und wurde dann für die Transsib vornehmlich in Nowosibirsk tätig. Kurz vor Ablauf seines Vertrages registrierte er aber schon, daß die Sowjetbehörden sich der vielen antikommunistischen Spezialisten aus dem Westen langsam zu entledigen trachteten: „Engländer, Deutsche und Amerikaner machen den Ingenieuren des Balkan Platz“, schreibt er.
Bleibt noch nachzutragen, daß all diese Formen „deutsch-sowjetischer Beziehungen“ in ihren Grundzügen bis über die Wende fortbestanden: Auf der einen Seite wurden an die in der Sowjetunion arbeitenden DDR-Bürger – z.B. beim Gastrassenbau im Ural und in der Ukraine – besondere kommunistische Anforderungen gestellt, wobei man ihnen proletarischen „Kampfplatz für den Frieden“ jedoch gleichzeitig besonders gut entlohnte („Einmal Trasse – nie mehr arm!“), und zum anderen blieb die Embargopolitik des Westens gegenüber dem Osten stets „flexibel“: So mußte z.B. das Kombinat Narva für eine Glühlampenproduktionsanlage – im Wert von 6 Mio DM, die es bei Osram-Siemens bestellt hatte, was dann über diverse „Zwischenagenten“ – in Ost und West! – abgewickelt wurde, schlußendlich 21 Millionen DM zahlen. Hinzugefügt sei, daß diese Anlage wegen des Zusammenbruchs des Sozialismus nie in Betrieb ging. Das Werk mußte wegen „Patentprobleme“ – von Osram und Philips – schließlich sogar vollständig liquidiert werden. Viele Arbeiter fanden nach und nach Anstellungen bei Osram in Westberlin. „Früher wurden hier von zehn offenen Stellen neun an Türken vergeben“, so berichtete der Osram-Betriebsratsvorsitzende, „jetzt stellt man dafür Ostdeutsche ein“. Darüberhinaus drängen seit der sogenannten Wende auch immer mehr Emigranten bzw. Spätaussiedler aus Rußland auf den deutschen Arbeitsmarkt.
Literatur:
Sergej W. Schurawlow: „Kleine Leute und die große Geschichte: die Ausländer des Moskauer Elektrosawods in der sowjetischen Gesellschaft der Zwanziger- und Dreißigerjahre“, Verlag des Instituts für Russische Geschichte, Moskau 2001, auf Deutsch demnächst im Chr.Links-Verlag Berlin, herausgegeben von Wladislaw Hedeler
Oleg Dehl, Simone Barck, Natalia Mussienko, Ulla Plener: „Verratene Ideale – zur Geschichte deutscher Emigranten in der Sowjetunion in den 30er Jahren“, trafo-Verlag Berlin 2000
Gerhard Kaiser: „Rußlandfahrer – Aus dem Wald in die Welt“, WAGE-Verlag, Tessin (bei Rostock) 2000
Gabriele Krone-Schmalz: „Straße der Wölfe – zwei junge Frauen erleben Rußland in den 30er Jahren“, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1999.
foto
Pavel Florenskis Algenforschung
Der Autor studierte ab 1900 in Moskau Mathematik bei Nikolai Bugajew, Philosophie bei Sergej Trubezkoi und Psychologie bei Lew Lopatin, 1904 kam er in Kontakt mit der literarischen Gruppe der Symbolisten, Andrej Bely legte ihm eine Beschäftigung mit der Anthroposophie nahe, daneben las Florenski Goethe, schließlich wandte er sich einem geistlichen Führer, dem Starez Isidor, zu. 1910 heiratete er die Bauerntochter Anna Michailowna Giazintowa, aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. 1911 wurde er zum Priester geweiht, er lebte jedoch von Veröffentlichungen, Vorträgen und Lehrtätigkeiten.
1920 übernahm er die Leitung der Forschungen zur Anwendung von Kunstharz in der Elektrotechnik in der Moskauer Fabrik „Karbolit“. 1922 erschien sein Buch „Imaginäre Größen in der Geometrie“, an dem er 20 Jahre arbeitete und das u.a. von Ossip Mandelstam, Wsewolod Iwanow, Maxim Gorki, Jewgeni Samjatin und Michail Bulgakow gelobt wurde, die offizielle Kritik monierte dagegen insbesondere das Schlußkapitel, in dem er das Weltbild in Dantes „Göttlicher Komödie“ mit Hilfe der Relativitätstheorie interpretierte.
Dies wird später einer der Anklagepunkte sein, die zu seiner Verhaftung und Inhaftierung führen, obwohl die Zensur etliche Passagen darin vor Drucklegung gestrichen hatte, worüber er sich in einem Brief „An die Politabteilung“ beschwerte.
Von 1925 bis 1933 ist Florenski Leiter der Abteilung für Materialkunde am Staatlichen Forschungsinstitut für Elektrotechnik. 1928 wird er jedoch vorübergehend verhaftet: Man wirft ihm vor, unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Arbeit religiöse Propaganda betrieben zu haben, er wird nach Nishni Nowgorod verbannt, wo er im Radiolaboratorium arbeitet. Gorkis erste Frau, Jekaterina Peschkowa, bemüht sich als Leiterin des Politischen Roten Kreuzes um seine Rückkehr nach Moskau“. Sie hat schließlich Erfolg. 1930 holt man Florenski als stellvertretenden Direktor für Wissenschaft ans Allunionsinstitut für Elektrotechnik in Moskau. Am 25. Februar 1933 wird er jedoch erneut von der GPU verhaftet und schon einige Monate später wegen „Konterrevolutionäre Agitation und organisierte konterrevolutionäre Tätigkeit“ zu zehn Jahren Zwangsarbeit an der Baikal-Amur-Magistrale in Ostsibirien verurteilt, wo man ihn dann der Abteilung für wissenschaftliche Forschung zuteilt. 1934 überführt man ihn ins Amurgebiet, auf eine Versuchsstation zur Erforschung von Dauerfrostböden. In Moskau versucht derweil die Familie, seine Freilassung zu erwirken. Der tschechoslowakische Botschafter in Moskau bietet an, den Verurteilten in seinem Land aufzunehmen, Florenski lehnt jedoch unter Berufung auf den Apostel Paulus (Phil. 4,11) ab: „…ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen“.
Im Herbst 1934 überführt die GPU ihn auf die Solowki-Inseln im Weißen Meer, dem ersten bolschewistischen Straflager. Er soll sich dort mit Meeresalgen befassen und beim Aufbau einer Fabrik zur Gewinnung von Jod und Agar-Agar aus Algen helfen. In den darauffolgenden dreieinhalb Jahren gelingt es ihm, dafür zehn Patente anzumelden. Daneben hält er dort fast täglich wissenschaftliche Vorträge und schreibt Briefe (vier im Monat sind ihm erlaubt) vor allem an seine Kinder, seine Frau und seine Mutter – über 150 insgesamt. Sie wurden auf Deutsch 2001 im Dornacher Anthroposophenverlag Pforte veröffentlicht unter dem Titel „Eis und Algen“, herausgegeben von Fritz und Sieglinde Mierau, die daneben auch für eine zehnbändige Ausgabe seiner Werke im Berliner Kontext-Verlag verantwortlich sind.
In ihrem Vorwort zu dem Band mit „Briefen aus dem Lager“ heißt es an einer Stelle: „Kein Wunder, schreibt Florenski einmal seiner Frau, wenn bei so vielen ein- und ausgehenden Briefen die Zensoren an nervlicher Zerrüttung litten. Und: Eigentlich sei er mit seiner Isolierung auf den Solowki-Inseln am Ziel seiner Wünsche angelangt. Als Jüngling habe er immer davon geträumt, ins Kloster zu gehen, jetzt lebe er im Kloster, nur dass es eben zum Lager gehört. Als Kind sei es sein sehnlichster Wunsch gewesen, auf einer Insel zu wohnen, Ebbe und Flut zu erleben und sich mit Algen zu befassen. ‚Nun bin ich auf einer Insel, hier herrscht Ebbe und Flut, und ich werde bald mit Algen zu tun bekommen‘.“
Nachdem jedoch die Algenerforschung sowie die Jod- und Agar-Agar-Testproduktion auf den Solowki-Inseln erfolgreich verlaufen ist, wird das Projekt aufs Festland verlagert – und Pawel Florenski erschossen: am 8. Dezember 1937. Er wurde 55 Jahre alt. 1959 wird er offiziell rehabilitiert, 1989 wird seiner Familie eine Sterbeurkunde ausgestellt. Inzwischen hat die orthodoxe Kirche ihn heilig gesprochen.
Brief v. 26.11. 1934 (an seinen Sohn Michail)
Lieber Mik…
Es gibt hier viele Algen und wohl auch Muscheln. Die Stürme werfen die Algen (oder „Meerespflanzen“, wie man sie auch nennt) auf den Strand, so daß sich Wälle von mehreren Kilometern Länge, 1 1/2 Metern Höhe und mehreren Metern Breite bilden. Diese Meerespflanzen sind eßbar (giftige gibt es gar nicht), aber ihre Zubereitung ist ziemlich kompliziert. In manchen Ländern werden sie leicht angekocht, dann getrocknet und so gegessen, aber das schmeckt nicht besonders. In Amerika, Japan, China, Indochina, England, Schottland u.a. Ländern werden Algen sehr viel gegessen, man macht die verschiedensten Dinge daraus. Konfekt, Konfitüre, Blancmanger [Mandelpudding], Kissél [Fruchtpudding], Speiseeis, Salate, Soßen, Sauermilchpudding, ich glaube sogar Gebäck. Bei uns sind wir noch nicht soweit, die Algen auf diese Weise zu verwenden, wir stellen aus ihnen nur Jod her. Man kann aus Algen viele verschiedene technisch wichtige Stoffe gewinnen: einen besonderen Klebstoff, das Algin, dann Zellulose, Mannit, verschiedene Lösungsmittel für die Lackindustrie, Kalisalze usw. Vorerst wird aus den Algen aber nur Jod gewonnen; die Algen werden zu Asche verbrannt, dann wird die Asche in Lauge gewaschen und in diesem Wasser das Jod aus dem Kaliumjodid freigesetzt. Die Asche enthält auch noch Chlorkalium, schwefelsaures Kalium, Soda, Bromkalium und andere nützliche Stoffe. Ich küsse Dich innig, lieber Mik. Folge Mamma, sei lieb zu ihr und vergiß Deinen Papa nicht.
Brief v. 3.12. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Die Werkstatt, in der ich arbeite, befindet sich am Ufer ddes Blagopolutschied-Hafens. Es ist eine armselige kleine Werkstatt, an deren Tür das stolze Wort ‚LABORATORIUM‘ prangt. Das steht zwar nur auf dem Schild, aber es ist doch befriedigend, es beim Eintritt zu lesen. Manchmal bin ich aber auch in einem richtigen Laboratorium, es ist klein, aber für die Verhältnisse von Solowki recht anständig. Es liegt zwei Kilometer vom Kreml entfernt im Wald am Ufer eines Sees.
Brief v. 14.12. (an seinen Sohn Kirill)
Lieber Kirill…
– Ich teile Dir eine Beobachtung mit, die ich gemacht habe, ich glaube, sie kommt in der Literatur nicht vor. Sie ist von Bedeutung für die Mineralogie, etwas Analoges zum Alexandrit. Es handelt sich um folgendes: Bei der Jodgewinnung nach dem sog. Bichromatverfahren wird der Extrakt aus Algenasche mit Bichromat und Schwefelsäure behandelt. Diese Lösung zeigt sowohl vor als auch nach der Entfernung des Jods je nach Art der Beleuchtung eine Zweifarbigkeit. Bei abendlicher (künstlicher) Beleuchtung, zum Beispiel bei elektrischem Licht, ist die Lösung von violett-purpurner Farbe, bei Tageslicht dagegen ist sie smaragdgrün. Der Unterschied in der Farbe ist so verblüffend, daß man nicht glaubt, es handle sich um ein und dieselbe Flüssigkeit. Da das Jod hier keine Rolle spielt, zeigt sich vermutlich der Unterschied auch bei einer sehr schwachen Lösung von Bichromat und Schwefelsäure. Man kann aber auch versuchen, Kalium-Jodid hinzuzufügen, das das Bichromat auflöst und zu anderen Chromverbindungen führt. Dieser Versuch ist so schön, daß es sich lohnt, ihn nachzumachen, um das mit eigenen Augen sehen zu können. Vermutlich kann man durch eine Veränderung des Mediums erreichen, daß das Purpurviolett ind Rot übergeht. – Küß Mama und die Kinder und sag ihnen, daß ich ihnen in Kürze einzeln schreiben werde.
Brief v. 14.12. (an seinen Sohn Wassili)
Lieber Wasjetschka…
Im Augenblick denke ich (privat, das gehört nicht zu meinen dienstlichen Aufgaben) über den Aufbau einer komplexen Produktion hier nach, eines ganzen Kombinats zur Gewinnung von Brom aus Meerwasser unter Ausnutzung der Wind- und Gezeitenenergie, über einen wohlabgestimmten Zyklus verschiedener Prozesse und Produkte. Ein schöner Plan, aber ehe ein Projekt daraus wird, ist noch viel Arbeit nötig, leider braucht man auch Bücher, die hier nicht vorhanden sind. Dennoch werde ich mit einigen Spezialisten über die Sache nachdenken. Dann prüfe ich nach und nach verschiedene Varianten der Gewinnung von Jod und anderen Produkten aus Meeresalgen. Die Beschäftigung mit den Algen und dem Brom verspricht interessante Ergebnisse, die in engem Zusammenhang mit meinen Arbeiten über die Elektromaterialien stehen.
Brief v. 21/22 6. 1935 (an seinen Sohn Wassili)
Lieber Wasjutschka…
Im Augenblick studiere ich die Alginate, speziell das Natrium- und Kaliumalganit, die ich aus Algen gewinne. Diese Stoffe können das importierte Tragant und Gummiarabikum sehr gut ersetzen, u.a. in der Textilindustrie beim Stoffdruck u..ä. Ihre Bindekraft ist erstaunlich: Eine 8%ige Alginatlösung hat eine bedeutend höhere Bindekraft als eine 32%ige Gummiarabikumlösung, ist also mehr als 4mal so ergiebig, ganz zu schweigen vom Preisunterschied. Andererseits ist ihre Kapillaritätskonstante nur etwa halb so groß wie die des Gummiarabikums, daher werden selbst schwache Lösungen in bedeutend geringerem Maße aufgesogen, was wiederum von großem Vorteil ist sowohl in bezug auf den Materialverbrauch als auch auf die Druckqualität. Die Messungen der physikalisch-chemischen Konstanten müssen mit improvisierten Geräten vorgenommen werden. Bei meiner mathematischen Bearbeitung der Meßergebnisse habe ich einiges gefunden, was von der Kolloidchemie bisher nicht geleistet worden ist….Ich küsse Dich, mein Lieber
Brief v. 5./6.9. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Im Augenblick arbeite ich in dem neugeschaffenen Konstruktionsbüro; ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, eine Reihe unserer Erfindungen auf dem Gebiet der Algenverarbeitung und der Nutzung von Algin und Alginat zum Patent anzumelden. Außerdem sind ein paar Artikel zu schreiben. Und bald werde ich mich mit dem Projektieren von Chemischen Fabriken zu befassen haben…
Brief v. 24./25. 9. (an seinen Sohn Michail)
Lieber Mik…
Ich lebe hier wie auf Jules Vernes ‚Geheimnisvoller Insel‘ – alles muß selber ausgedacht und aus fast nichts hergestellt werden, nichtsdestoweniger ist dabei etwas herausgekommen. Habt ihr die Natriumalginatblättchen erhalten? Das ist ein Algenprodukt, es läßt sich auf die erstaunlichste Weise verwenden, davon werde ich Dir in den nächsten Briefen erzählen…
Brief v. 15.11. (an seine Mutter)
Liebe Mamotschka…
In letzter Zeit haben mich die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten eines Algenprodukts, nämlich des Algins, beschäftigt. Es sind unzählig viele, ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche, die da in Frage kommen. Vielleicht sind einige der von mir aufgespürten längst bekannt, und da ich keinen Zugang zur Literatur habe, entdecke ich sie noch einmal. Ich stelle Pauspapier her, verschiedene Arten Zeichen- und Malpapier, Packpapier, Papier für Ölmalerei u.ä., dann Farben, Fixative, Leim, Substanzen zum Beschichten verschiedener Oberflächen usw. Insbesondere reparieren wir alte Gummischuhe und gießen Stiefelnähte aus, damit sie wasserdicht sind. Ich habe 4 Artikel für die Zeitschrift des BBK geschrieben, weiß aber nicht, ob sie sie dort drucken können, denn sie sind ziemlich lang. Ich schreibe unzählige Notizen für Wandzeitungen zu verschiedenen technischen Fragen, vor allem im Zusammenhang mit Algen.
Brief v. 16-23.12. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Ich bin gesund, leide an nichts Not, arbeite im Laboratorium mit Algen und Sphagnum und lebe unter erträglichen Bedingungen, halte Vorlesungen über Mathematik, schreibe allerhand technische Notizen, bin den ganzen Tag von morgens bis spät in die Nacht beschäftigt – das ist Pflicht und ist zugleich nützlich für mich, es erstickt die Sehnsucht.
Brief v. 7-11.1. 1936 (an seine Frau)
Liebe Annulja…
Meine Arbeit geht in der gewohnten Richtung weiter, ist aber durch die Ausdehnung der Experimente etwas komplizierter geworden. Wir sind schon halbwegs am Produzieren und rechnen täglich mit 2-3 kg Algin und 2 kg Agar. Schon für diese Menge müssen bedeutende Massen Rohstoff verarbeitet werden und damit große Wasserbottiche vorhanden sein. Der Rohstoff wird in Wasser aufgekocht, dann filtriert, gefroren, wieder aufgetaut, eingedampft und getrocknet, das erfordert Aufmerksamkeit, eine entsprechende Apparatur, die allerdings sehr einfach ist, eine riesige Menge verschiedener Gefäße usw. Da es sich bei diesen Vorgängen um Versuche handelt, muß ständig gewogen, gemessen, protokolliert, gerechnet und analysiert werden. Jede einzelne Operation ist nicht weiter kompliziert, aber im ganzen, wenn man bedenkt, wieviel Vorgänge aufeinander abzustimmen und welch große Mengen Rohstoff zu bewegen sind, ist es schon ein beachtliches Unternehmen. Neben den Versuchen halte ich Vorlesungen – 3mal zwei Stunden die Woche, und einmal muß ich zur Sitzung des BRIS (des Büros für Erfindungen).
Brief v. 7.-13.2. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
In diesen Tagen erblickten wir die Früchte unserer Mühen: Ein Konditor hier hat Marmelade auf der Grundlage von Agar aus unserer Produktion hergestellt und war mit dem Ergebnis höchst zufrieden. Auf die Marmeladenmasse kam 1 1/2% Agar, aber das war schon etwas zu viel, es genügen 1,2%, d.h. es entspricht gutem Auslandsagar. In letzter Zeit war es klar und kalt, genau das Richtige für unsere Versuche….Tag und Nacht wird ununterbrochen gearbeitet, und meine Gehilfen dürfen nicht ohne Aufsicht bleiben, sonst kommt es zu Versäumnissen.
Brief v. 24-25.3. (an seine Tochter Maria-Tinatin)
Liebe Tika…
Heute brachte man mir ganz frische Algen, die man mit einer besonderen Vorrichtung vom Grunde des Meeres unter dem Eis hervorgeholt hat (das Eis ist dieses Jahr nicht dick, 80 cm). Es sind fleischige, elastische große Algen aus der Klasse der Braunalgen, der Ordnung der Laminarien. Sie heiße Laminaria digitata, d.h. Fingerlamelle, weil das ‚Blatt‘ der Alge einer riesigen Hand mit gespreizten Fingern ähnelt. Außerdem gibt es Laminaria saccharina, d.h. Zuckerlamelle, sie ist ziemlich süßt. Ich habe sie gekostet, sie ist recht fest, aber äußerst schmackhaft, leicht salzig, erinnert an Sauerkraut, nur daß sie nicht sauer schmeckt. Die Algen saugen sich (mit ihren Rhizoiden, so etwas wie Wurzeln) an Steinen fest, um sich im Wasser Halt zu verschaffen, ernähren sich aber eigentlich nicht durch die Wurzeln, sondern sie nehmen ihre Nahrung über die ganze Oberfläche direkt aus dem Wasser auf. Von Mitte Juli bis Ende August vermehren sich die Laminarien mittels Sporen. Bei der Saccharina entwickeln sich die Sporen in der Mitte des ‚Blatts‘, bei der Digitata an den Blattenden. Die Sporen zeigen sich als einzelne rote Punkte, etwa wie beim Farn. Ich küsse mein liebes Töchterchen innig und erwarte die Ankunft der Möwen, um von ihnen etwas über mein Töchterchen zu erfahren.
Brief v. 8.-10.4. (an seine Frau Anna)
Liebe Annulja…
Du fragst nach den Algen. Deine Fragen lassen sich nicht mit einem Satz beantworten. (Fort.folgt)

Das ist ein Bild von unserem schlimmsten Arbeitslager im Ural, aber mit der Zeit ist daraus ein richtiger Kurort geworden – mit Skilift, Rodelbahnanlage und allem Drum und Dran. Das Bild hat einer der Schweißer dort gemalt.
Ein großer Iwanfreund
Manchmal kommt man en passant an interessante Bücher: So kaufte ich z.B. mal einem Dichter sein Werk in der U-Bahn ab, ein Taxifahrer verkaufte mir während der Fahrt seine Autobiographie, von einem Chinesen erwarb ich am Reichstag eine Chronik seines Kampfes mit der Bayernhypo und der Ostberliner Althippie Willi verkaufte mir seine Biographie von einer Parkbank in Pankow weg. Neulich lernte ich im Café Burger den Pädagogen Alfons Rujner kennen, der Wladimir Kaminer dort die im Selbstverlag erschienene Geschichte seiner Jugend in russischer Kriegsgefangenschaft: „Mit 17 hinter Stacheldraht“ schenken wollte. Das Stettiner Arbeiterkind war in den letzten Kriegstagen noch eingezogen worden und hatte sich dann den Amis ergeben, die ihn jedoch den Sowjets übergaben, damit er dort – „Back in the USSR“ – beim Wiederaufbau helfe. Der kleine aber sportliche Alfons kam nach einem langen Marsch durch Tschechien und wochenlanger Bahnfahrt in ein Arbeitslager bei einem abgebrannten Dorf in der Nähe von Brjansk, wo sie zunächst in Zelten hausten. Für den Winter bauten die 300 Gefangenen sich dort eine kaputte Scheune aus. Der Verwaltungsangestellten-Lehrling Rujner lernte Mauern, Tischlern und Bäume fällen, wobei man ihren Brigaden „kundige Dorfbewohner als Helfer“ zuteilte. Von ihnen sowie von der Lagerleitung lernt er zu improvisieren: „Den Satz ‚Es geht nicht‘ hatten die Russen aus ihrem Wortschatz gestrichen“. Viele Dörfler bekamen niedrigere Lebensmittelrationen als die deutschen Kriegsgefangenen, die manchmal sogar von hungrigen Kindern angebettelt wurden. Der Autor reifte im Lager langsam zu einem „Iwanfreund“ – und bezog deswegen von einigen „Unverbesserlichen“ Schläge. Nach einem Jahr wagten die Gefangenen ein Flugblatt zu verfassen, in dem sie sich über Verpflegungsmängel beschwerten und das sie am Scheunentor befestigten.
Sie befürchteten, deswegen streng bestraft zu werden, aber das Gegenteil passierte: Der Kulturoffizier fragte sie, ob sie ihre Kritik veröffentlichen würden – und richtete ihnen eine „Wandzeitung“ ein. Der Autor wurde zum Chefredakteur gewählt. Neben Beschwerden z.B. über mangelnde Hygiene veröffentlichte er auch „ausgewählte Nachrichten“ aus Deutschland“. Damals begann er, sich „für das Schreiben zu interessieren“. Es entwickelte sich ein „kulturelles Leben“ im Lager, u.a. veranstaltete der Kulturoffizier eine Dichterlesung, dazu las er aus Heinrich Heines „Deutschland, ein Wintermärchen“, das fast keiner der Landser kannte, anschließend wurde darüber diskutiert. Beim nächsten Mal trug er Heines Gedicht „Loreley“ vor. Dies war zwar vielen bekannt, jedoch nicht, dass es von Heine stammte: In ihren Schulbüchern stand „Verfasser unbekannt“. Mir ging es noch 1998 im sibirischen Irkutsk so, dass eine junge Friseusin, als sie hörte, ich sei Deutscher, sofort „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…“ deklamierte – und hinzufügte: „Geinrich Geine“. Was?! sagte ich, das ist doch nicht von Heine. Erst in der Buchhandlung am Leninplatz, wo sie es mir schwarz auf weiß zeigte, gab ich klein bei. Ab 1947 durften die Gefangenen Briefe schreiben und empfangen – und es gab „mehr Kultur als Fressen“ im Lager. Grujner versuchte – vergeblich – über das Rote Kreuz Kontakt mit seiner vertriebenen Familie aufzunehmen. Der Kulturoffizier gab ihm daraufhin eine DDR-Zeitung und schlug vor, einen Leserbrief aus dem Lager über ihre Wiederaufbau-Arbeit zu verfassen und darin eine Suchmeldung unterzubringen.
„An den paar Sätzen habe ich lange gefeilt,“ schreibt der Autor. Die Zeitung hieß „Start“ und war Vorläufer der „Jungen Welt“. Sie druckte den Brief ab – und tatsächlich erhielt er daraufhin Post von seinem Bruder. Alfons Rujner war überglücklich: seine Familie lebte. Als er 1948 nach Deutschland zurückkehrte, bedankte er sich bei der Zeitung, für die er dann öfter schrieb. Auch in der DDR wurde er noch einige Male als „Iwanfreund“ beschimpft und sogar tätlich angegriffen, wenn er „die Wahrheit“ über seine Zwangsarbeitsjahre in der UDSSR erzählte und dass ihm dort eine jüdisch-russische Ärztin das Leben rettete, was ihm dann hier 2001 anläßlich einer Herzoperation sogar noch einmal passierte. Diese zweite Ärztin gab dann den „Hauptanstoß“, seine Russlanderinnerungen aufzuschreiben: eine schöne Geschichte.
Der meint, wegen der günstigen Rubelkurs könnte er jetzt hier – mitten in der Pampa, äh Taiga- einen Breiten machen.
Das postsowjetische System nichtformeller Einkünfte
Neulich las ich ein Interview mit dem russischen Sozialforscher Alexander Nikulin, der die neuen Formen der Agrarwirtschaft im Gebiet von Nischninowgorod und Saratow sowie im Kreis Krasnodarsk erforscht, u.a. durch intensive Gespräche mit Dorfbewohnern. Dies vor dem Hintergrund der in Russland immer noch anhaltenden Debatte über große Kolchosen (Agrar-industrielle Komplexe – APK) einerseits und kleine bäuerliche Privatlandwirtschaften bzw. Datschen (persönliche ergänzende Wirtschaften – LPCHA) andererseits. Dabei ist etwas „sehr interessantes“ herausgekommen, meint Nikulin, und zitiert den Historiker Karamsin, der einmal einem in Paris lebenden Dichterfreund auf dessen Frage, was in Russland vorgehe, antwortete: „Das ist sehr einfach: Man klaut.“ Zwar wisse auch heute noch jeder darüber bescheid, aber niemand denke darüber nach, was das bedeutet: „Unsere Untersuchungen zeigen, dass in Wirklichkeit in der bäuerlichen Sphäre eine Symbiose zwischen dem Kleinen und dem Großen besteht“ – wobei es um eine „harmonische Koexistenz“ zwischen beiden gehe, was „in den merkwürdigsten Formen des Naturalaustauschs geschieht: Man zahlt seinen Kolchosmitgliedern für ihre Arbeit nichts, dafür nutzen die Kolchosmitglieder illegal die Ressourcen. Dadurch erhält und reproduziert sich das ganze System und fährt fort zu funktionieren. Wenn die Kolchosmitglieder zu viel klauen, dann geht die agrarische Produktionspotenz der Kolchose zugrunde, und sie können nirgendwo Ressourcen hernehmen; dann kehren sie zur Naturalwirtschaft zurück. Das ist schlecht. Wenn sie es andererseits überhaupt nicht schaffen, sich etwas zu nehmen, dann verelenden die Familien. Diese sehr interessante Balance zu erkunden war unsere Aufgabe“.
Dazu haben sich die Agrarforscher erst einmal von dem Begriff des Klauens gelöst: „Sagen wir, es vollzieht sich ein gegenseitiger Diebstahl…Das Problem zeigt sich darin, dass darin auch eine ganze Reihe positiver Aspekte liegt. Wir versuchen deswegen den Begriff des Diebstahls zu ersetzen durch ’nichtformelle Einkünfte‘, weil Diebstahl negative ethische Bewertungen erhält. Man kann dies aber kaum ethisch bewerten. Ein Kolchosnik, den ich darauf ansprach, dass die Gebote fordern ‚Du sollst nicht stehlen‘, antwortete mir: ‚Damals hat es ja auch keine Kolchosen gegeben‘. Obwohl man diesen fortdauernden Kampf zwischen APKs und LPCHAs im Westen nicht kennt, gibt es auch hier zwischen Betrieben und Arbeitnehmern ein Ausbalancieren durch „nichtformelle Einkünfte“. Nikulin knüpft zum Begreifen dessen bei Max Weber an: „Weber sagt, dass der Kapitalismus dort beginnt, wo die Trennung der Familie vom Unternehmen anfängt. In Russland sind sie bis heute miteinander verwachsen. Sie bilden einen gemeinsamen Komplex und darin gibt es eine gigantischen nichtformellen Fluß des Austauschs von Ressourcen zwischen den Familien und den Betrieben, auch in der Industrie, nicht nur in der Landwirtschaft.“
Als der Westen in den Osten eindrang, gab es dagegen immer wieder Versuche, diesen informellen Ressourcenfluß zu stoppen. So erinnere ich mich noch, dass z.B. der PDS-Bürgermeisterkandidat des Prignitz-Dorfes Grabow vor den Märzwahlen 1990 seinen CDU-Herausforderer, den Vorsitzenden der lokalen LPG, dadurch ausbremste, dass er ihn nächtens dabei überraschte, wie er sich mit der Schubkarre an der LPG-Maissilage bediente, um damit seine Privatrinder zu füttern: Der General genannte CDUler mußte daraufhin von seiner Bürgermeister-Kandidatur zurücktreten. Später bekam er von anderer Seite noch eine Strafanzeige wegen Betreibens einer nichtformellen, also illegalen Kneipe. Diesem ehemaligen Kolchosevorsitzenden war anscheinend die o.e. „Balance“ im Sozialismus zur Zweiten Natur geworden. Ähnliches gilt auch für den Berliner Schriftsteller Falko Henning, der einmal seine ganze Ost-Biographie unter dem Aspekt des Klauens und Betrügens aufdröselte – „ohne alle negativen ethischen Bewertungen“. „Alles nur geklaut“ heißt sein mutiger Vorstoß zu einer vorurteilsfreien sozialistischen Existenzsicherung – auch noch im Spätkapitalismus, wo es umgekehrt heißt: „Eigentum ist Diebstahl“.
P.S.: Die Untersuchungen der russischen Agrarforscher hat 2008 der Slawist Peter Lindner resümiert und durch eigene Recherchen ergänzt. Sein Buch darüber heißt: „Der Kolchos-Archipel im Privatisierungsprozess. Wege und Umwege der russischen Landwirtschaft in die globale Marktwirtschaft“.

Diese letzten 300 Vouchers kommen jetzt zur Verlosung. Anschließend gilt unser Kolchoz als privatisiert.
Landwirtschaftskollektive
2006 erschien ein “Roman” über den aktuellen Niedergang eines polnischen Dorfes: “Tartak” (Das Sägewerk). Es geht darin um einzeln vorgestellte Handlungsträger in einem Kolchosendorf mit einer Kolchosensiedlung, aber seit der Wende ohne Kolchose, dafür jedoch mit einem neuen Sägewerk, das der Privatbesitzer (Businessman) am Ende anzündet, damit es nicht seinen Gläubigern in die Hände fällt.
Der Autor des Buches Daniel Odija wurde 1974 in Slupsk geboren, wo er heute noch als Schriftsteller und Fernsehjournalist lebt. Man könnte ihn zu den neuen skeptischen oder pessimistischen “Naturalisten” zählen. Sein Roman könnte denn auch bereits das Drehbuch zum Dokumentarfilm aus dem Jahr 1997 von Ewa Borzecka “Arizona” sein, in dem sich bereits einige identische Szenen finden.
Er handelt ebenfalls von einer Gruppe langzeitarbeitsloser Bauern aus einem Staatsbetrieb, der aufgelöst wurde (bis 1989 wurde 20% der Gesamtfläche von solchen “Kolchosen” bewirtschaftet), das Gutsgebäude kaufte ein Städter. In den Mittelpunkt ihrer Dokumentation stellte die junge Regisseurin Ewa Borzecka den einzigen Lebensmittelhändler des Dorfes. Er fährt einen Mercedes und verkauft den Fertigen zwar in der Not kein Brot mehr, versorgt sie jedoch ohne Ende mit dem Billigwein “Arizona”. Dafür darf er die Sozialhilfe seiner Stammkunden bei der Behörde direkt kassieren. Borzeckas Dokumentationen des Elends – neben “Arizona” ist das noch ein Film über Warschauer Obdachlose, die in der Kanalisation hausen sowie einer über ledige Mütter, die sich durch Beischlafdiebstähle ernähren – bezeichnete die polnische Kritik als “Pornographie”. Es gibt sogar einen “Gegenfilm” dazu: die Komödie “Geld ist nicht alles” (Pieniadze to nie wszystko). Statt sich zu besaufen entführen hier die arbeitslosen Bauern einen Yuppie, statt eines Lösegelds hilft er ihnen, die Kolchose für die Marktwirtschaft fit zu machen.
Odijas Roman “Das Sägewerk” kreist gewissermaßen um den Sägewerksbesitzer Mysliwski, der seinem mißratenen Sohn zuletzt auch noch seinen Mercedes überläßt – und sich ganz dem Alkohol widmet oder ergibt. Ich habe in dieser Dorferzählung, wenn sie die Wirtschaftstopographie thematisiert, den Ort “Osno” im Libuser Land wiedererkannt. Und in dem Politiker, der bei seinem Wahlkampf ins Dorf kommt, den Bauernführer Lepper. Die Halbprostituierte Mariola erinnerte mich an die “zwei Schwestern” in der biographischen und sehr viel genaueren, aber auch dickeren Dorfchronik “Der helle Horizont” des berühmten polnischen Autors Wieslaw Mysliwski. Dass Odijas Hauptfigur ebenfalls Mysliwski heißt, ist vielleicht nicht zufällig.
Mehr als diese ganzen Anspielungen oder Anleihen interessierte mich jedoch bald ein Vergleich dieses neopolnischen Romans aus dem Jahr 2003/06 mit dem 1927/1929 erschienenen russischen Roman der Sowjetschriftstellerin Anna Karawajewa, der ebenfalls “Das Sägewerk” heißt. Er wurde damals auf Deutsch im “Bücherkreis”-Verlag des sozialdemokratischen “Vorwärts” veröffentlicht und behandelt genau im Gegensatz zu Odijas “Sägewerk” den Aufbau eines modernen neuen Dorfes – mit Elektrizität, industriellen Arbeitsplätzen, Wohlstand und Frauenemanzipation. Hier wie dort kommt es dabei zu Toten und Verwundeten und einigen Alkoholismen, aber unter den Kommunisten geht es voran: ein Dorfsowjet wird gewählt und das Proletariat aus der Stadt bringt eine neue Kultur mit aufs Land usw..
Auch hierbei kommt es zu einer Verbrennung des Sägewerks – im Suff, aber der Täter realisiert hier sozusagen im letzten Moment noch, dass er Volkseigentum vernichten würde – und alarmiert die “Feuerwehr”. “Wann werdet ihr endlich begreifen, daß ihr jetzt selber die Herren seid?” hieß es zuvor. Ein etwas später auf Deutsch erschienener und noch agitatorischer angelegter Kolchosenroman aus der Sowjetunion – von Sergej Tretjakow – hieß schon im Titel “Feld-Herren”.
Sowohl in dem Roman von Karawajewa als auch in dem von Odija regnet es viel. Manchmal sitzen die Menschen auch bloß so da, als ob es ihnen auf den Kopf regnen würde. Und hier wie dort geht es um den Aufstieg und Untergang eines gewitzten Kulaken. Was jedoch 1929 eine Befreiung war und Fortschritt bedeutete, auch im Zusammenhang der Schaffung neuer weniger entwürdigenderer Arbeitsplätze sowie auch eines Genossenschaftsladens – statt des wie auch schon wieder bei Ewa Borsecka skrupellosen Einzelhändlers, ist 2003 der Verlust eines Unternehmers, einer letzten Wirtschaftseinheit mit Arbeitsplätzen im Dorf. Zurück blieben “die Leute – als habe man sie “allein ihrem Schicksal überlassen. Nie hatte man ihnen beigebracht, mit sich selber etwas anzufangen. Immer hatte ihnen jemand gesagt, was sie tun sollten. Jetzt sagte ihnen keiner mehr etwas. Sie mußten es sich selber sagen.” (Odija)
Aber das ist rein rhetorisch – denn so weit geht der Autor nicht in seinem polnischen Dorfroman. In der Wüste Gobi bei den mongolischen Viehzüchterinnen habe ich dagegen kürzlich “in echt” mitbekommen, dass und wie sie wieder Kollektive bildeten, um handlungsfähiger zu werden. Auch sie sagten, dass es so aussähe wie die früheren Kollektive – zu Sowjetzeiten, Die Kolchosen wurden 1990 in der Mongolei alle aufgelöst (jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh), aber im Unterschied zu damals würden sie nun in ihren heutigen Kollektiven selbst bestimmen, was sie wie zu tun gedächten und was nicht. Und das teilten sie uns so selbstbewußt und entschieden mit, dass der “Trip” durch die Gobi mir zu einem einzigen Aufbauroman geriet.
Anna Karawajewa, geboren 1893 in Perm, war zunächst Lehrerin und Philologin, und schrieb dann ab den Zwanzigerjahren eine ganze Reihe von Aufbauromanen. Mindestens einer – “Die Fabrik im Wald” wurde von der Trotzki-Übersetzerin Alexandra Ramm ins Deutsche übertragen. Wenn ich nicht irre, emigrierte die Karawajewa 1968 nach Frankreich. Vom wem ihr Hauptwerk “Das Sägewerk” übersetzt wurde, habe ich komischerweise nicht rausbekommen. An einer Stelle heißt es darin – über die renitenten Dörfler:
“Und dann dieser Instinkt der Selbsterhaltung…Dieser wilde Durst, zu atmen, zu schreien, sich zu bewegen, die Sonnenwärme zu spüren, seinen tierischen Zusammenhang mit der Natur zu fühlen…Welch furchtbare Kraft das ist!…Furchtbar – wann? Wenn die Sicherheit fehlt, daß diese süße Gewohnheit nicht plötzlich unterbrochen wird. Diese Sicherheit muß man ihnen geben, unbedingt. Dann wird der Instinkt wieder seinen richtigen Platz einnehmen, dann kriegt jeder halbwegs gute Zug im Menschen wieder sein Gesicht…” Dies sagt der Tschekist Ognew – am Vorabend der Zwangskollektivierung, die 1928/29 anlief.
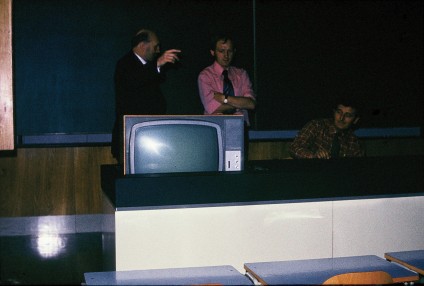
Wenn die ersten kritischen Stimmen von da laut werden, legen Sie das Video ein.
Die Folgen der Kollektivierung
Der ökonomische Hintergrund für die „proletarische Biologie“, auch „Mitschurinismus-Lyssenkismus“ genannt, war tragisch: die Zerschlagung der Dorfgemeinschaften im Zuge der Kollektivierung und die Entkulakisierung der Landwirtschaft. Bereits 1918 gab es den ersten Umschwung in der Politik der Bolschewiki gegenüber den Bauern, indem in der Sowjet-Verfassung von einer neuen Phase beim Aufbau des Sozialismus die Rede war und dabei das Bündnis mit dem Dorf aufgekündigt wurde, um dort fortan nur noch mit dem „Dorfproletariat“ zusammen – gegen den reichen Bauern, den Kulaken – zu kämpfen, während der mittlere Bauer gerade noch geduldet wurde. Conquest schreibt: „Wo Stolypin ‚auf die Starken gesetzt‘ hatte, setzte Lenin auf die Schwachen.“ Diese Einführung einer Nomenklatur zur Forcierung des Klassenkampfs im Dorf führte zu einer Biopolitik, die schließlich die Klassenherkunft wie früher die Stand-, Rang- und Rasseabstammungen handhabte. So müssen z.B. die Arbeiter in dem Roman „Waska in der Metro“ von Sergej Antonow verheimlichen, dass ihre Kollegin ein aus der sibirischen Verbannung geflüchtetes Kulakenmädchen ist. „Soll man sie bei der Miliz anzeigen oder nicht?“ Erst als sie Bestleistungen erbringt, kann sie sich langsam mit Unterstützung ihres Brigadiers von ihrem Geburtsmakel „befreien“.
Zunächst zerstörte jedoch der Bürgerkrieg, bis etwa 1921, tausende von Dorfgemeinschaften und die Erntemengen fielen um die Hälfte. Die bolschewistische Regierung schickte bewaffnete Getreide-Requirierungskommandos in die Dörfer. Um die Landwirtschaft wieder in Schwung zu bringen, ließ der Volkskommissar Trotzki überall Plakate anbringen – mit der Losung: „Proletarier aufs Pferd!“ Zu Zeiten der größten Hungersnöte entsandten u.a. die angloamerikanischen Quäker Hilfsgüter an die Wolga. Einer der ausländischen Helfer, Traugott von Stackelberg, der im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener in Sibirien ein Krankenhaus geleitet hatte, ist erstaunt über den relativen Überfluß an Lebensmitteln in den Städten und erst recht in den Ausländerrestaurants, während gleichzeitig im Süden zigtausende verhungern. Nach einem Gespräch mit dem Polizei- und Staatssicherheitschef Berija notiert Stackelberg: „Die Hungersnot sah er als eine periodisch in Russland eintretende Katastrophe an und fand anscheinend, dass es eine eigentlich recht unnütze Gefühlsduselei sei, nun dieser Erscheinung besondere Beachtung zu schenken.“ Überdies schien es Stackelberg, dass die Moskauer gar nicht wußten, was an der Wolga geschah, „allerdings stand in den Zeitungen auch nie etwas über die Hungergebiete“.
Während der Neuen Ökonomischen Politik (von 1921 bis 1928), als u.a. die Märkte wieder zugelassen wurden, bremste Lenin die Kollektivierung zunächst, als er verkündete, sie sei ein langsamer Prozeß, der auf die Überzeugung und freie Zustimmung der Bauern beruhen müsse. Damit tat sich jedoch laut Conquest ein Widerspruch in der Politik der Partei auf: „Einerseits (auf der wirtschaftlichen Seite) wünschte sie, die landwirtschaftliche Produktion zu ermutigen; dies wiederum hieß, die wirksamen Erzeuger zu ermutigen. Andererseits (auf der politischen und der doktrinären Seite) betrachtete sie diese wirksamen Erzeuger als, letztlich, den Klassenfeind; und sie verließ sich im Prinzip auf die unwirksamen Elemente der Bauernschaft.“ Wobei diese sich, wenn man sie gehörig förderte, auch noch von ihrer Klasse entfernten, d.h. zu „Mittelbauern“ und schließlich sogar zu „Kulaken“ aufstiegen. Der Bolschewik Nikolai Bucharin ging 1925 so weit, den Bauern das zu raten, was 1978 auch der chinesische KP-Chef Deng Xiaoping ihnen sagte: „Bereichert euch!“ Aber bereits 1927 setzte dabei erneut eine „Krise der Getreidewirtschaft“ ein: Die schwachentwickelte Industrie konnte dem Dorf nicht genügend Waren bieten, die Aufkaufpreise für Getreide wurden daraufhin gesenkt, was wiederum das Interesse der Bauern an den Marktbeziehungen erlöschen ließ, mit der Folge, dass sie die Anbauflächen drastisch reduzierten. Auf dem XV. Parteitag im Dezember 1927 wurde deswegen „die allseitige Entfaltung der Kollektivierung der Landwirtschaft“ und gleichzeitig eine Reihe außerordentlicher Maßnahmen gegen „Kulaken und Spekulanten“ beschlossen, wonach Getreideüberschüsse gerichtlich beschlagnahmt werden konnten. In den Dörfern selbst hatte sich jedoch ebenfalls etwas getan: Erst erlangten immer mehr mittlere und reiche Bauern die Kontrolle über die Sowjets – der Vertretung der Regierung auf dem Land, dann ließen sich hier und da auch schon Kulaken zu Kolchosvorsitzenden wählen. Es war so ähnlich wie Solschenizyn es in bezug auf das Verhalten der zaristischen Offiziere 1917 beschrieb: Nach einer Schrecksekunde, da die Soldaten viele mit Schimpf und Schande davongejagt oder sogar erschossen hatten, verstanden sie es immer besser, auf der Revolutionswelle zu surfen – und sich sogar an die Spitze der revolutionären Bewegung zu setzen. Die sowjetischen Verwaltungen nahmen deswegen bei ihrer Klassenanalyse der Dörfer die Herkunft immer wichtiger. 1927 schätzte man, dass es zwischen 4 und 8 Millionen Kulaken gäbe. Auf dem XV. Parteikongreß Ende 1927 sprachen Stalin und Molotow bereits davon, die Kulaken als Klasse zu liquidieren, das Kollektivierungsprogramm sah vor, bis 1933 mindestens 20 Prozent aller rund 25 Millionen Betriebe, die insgesamt 3120 Millionen Hektar bewirtschafteten, zu Kolchosen zusammen zu fassen. Ein Gesetz vom 10. Januar 1928 änderte dazu die Quorum-Regeln für die Versammlungen der Dorfgemeinschaften: Ein Drittel ihrer Mitglieder konnten nun den Rest verpflichten, außerdem waren Landlose abstimmungsberechtigt und der Dorfsowjet überprüfte fortan ihre Entscheidungen, ob sie der sowjetischen Politik entsprachen, zudem wurde die Dorfgemeinschaft für die Abgaben an den Staat verantwortlich gemacht. „Dies war der Anfang vom Ende der Selbständigkeit der Dorfgemeinschaft,“ meint Robert Conquest. Erneut kam es zu Plünderungen von Bauernhöfen durch Beschaffungskommittes. Die Parteibevollmächtigten riefen dazu nun oftmals die Dorfversammlungen zusammen und bedrängten sie, die höheren Ablieferungszahlen zu akzeptieren, wobei als Gegner und Saboteure immer wieder die Kulaken ausgemacht wurden. Die Aktivitäten gegen diese Klasse näherten sich der „Dekulakisierung“. In einem Leitartikel warnte die Prawda, dass die Kulaken den Rest der Bauernschaft auf ihre Seite zögen mit dem Schlagwort von der Gleichheit der Dorfgemeinschaft. Zu dem Zeitpunkt gehörten weniger als 2 Prozent der Haushalte zu einer Kolchose.
Im „Jahr des großen Umschwungs“ 1929 waren „das Getreideproblem und das Bauernproblem immer noch ungelöst,“ schreibt Conquest. In diesem Jahr wurde der erste Fünfjahresplan zur industriellen Entwicklung des Landes verabschiedet, wobei sich die UDSSR zum Haupteinwanderungsland für Arbeitslose, verfolgte Kommunisten und Abtenteurer aus aller Welt entwickelte. Den lokalen Behörden wurde es erlaubt, Kulaken zu enteignen und zu verbannen. Dagegen kam es zu Unruhen, Aufständen und „Terrorismus“. Überall wurde Getreide vergraben und das Vieh notgeschlachtet. Im Sommer 1929 wurden deswegen wieder einmal 100.000 städtische Parteiarbeiter aufs Land geschickt, um bei der Getreideaushebung zu helfen. Gleichzeitig begannen die Initiativen zur Massenkollektivierung. Im Herbst des Jahres erklärte Pjatakow vor dem Rat der Volkskommissare: „Die heroische Periode unseres sozialistischen Aufbaus hat begonnen…Wir sind genötigt, extreme Zuwachsraten bei der Kollektivierung der Landwirtschaft anzusetzen.“ Kurz vor dem entscheidenden Plenum des Zentralkomittees (Mitte November 1929) verkündete Stalin, um den Druck nach unten zu verstärken, „den radikalen Wandel, der in der Entwicklung unserer Landwirtschaft Platz gegriffen hat von kleiner rückständiger Bauernwirtschaft zu großräumiger, fortgeschrittener kollektiver Landwirtschaft…“ In den Getreideerzeutungsgebieten sollte die Kollektivierung bis zum Frühjahr 1932 abgeschlossen sein. Es wurde ein riesiges „Allunions-Volkskommissariat für Landwirtschaft gegründet, das mit weitgehenden Planungsvollmachten ausgestattet war. Stalin verkündete: „Wir sind übergegangen von einer Politik, die Ausbeutertendenzen des Kulaken zu beschränken, zu einer Politik, den Kulaken als Klasse zu liquidieren“. Gegenüber Churchill erwähnte er später einmal die Zahl „10 Millionen“, die davon betroffen waren – also enteignet, erschossen oder verbannt wurden.
„Es war [damals] leicht, einen Menschen ins Gefängnis zu bringen,“ schreibt Wassili Grossmann 1955 in seiner Erzählung „Alles fließt“, die erst 1989 veröffentlicht werden durfte, aber dann sofort vergriffen war, auch in der DDR im Jahr darauf. „Du schreibst eine Denunziation; du brauchtest sie nicht einmal zu unterschreiben. Alles, was du sagen mußtest, war, daß er Leute bezahlt hatte, um für ihn als Tagelöhner zu arbeiten, oder daß er drei Kühe besessen hatte.“ Die Leute betrachteten die so genannten Kulaken „als Vieh…; sie hätten keine Seelen, sie würden stinken…; sie seien Volksfeinde und beuteten die Arbeit anderer aus…Und es gab für sie keine Gnade“, selbst die Kulaken-Kinder waren geringer als eine Laus, schreibt Grossmann.
Dem gegenüber wurden von oben neue antikulakische Helden kreiert: Der berühmteste war Pawel Morosow, der als Kind seinen Vater denunzierte, weil dieser zwei Sack Getreide versteckt hatte. Der Vater wurde daraufhin als Kulak verhaftet und erschossen, seine Nachbarn erschlugen deswegen wenig später den kleinen Pawel – ob seines mangelnden Familiensinns. Die Partei machte ihn dafür zu einem Märtyrer der Revolution: die Jungpioniere der zweiten bzw. dritten Klasse mußten fortan einen „Pawlik-Schwur“ ableisten, vor dem Moskauer Pionierpalast am Moskwaufer wurde ein Morosow-Denkmal aufgestellt, der Ort in dem lebte, wurde in Morosowka umbenannt und man widmete ihm dort ein Museum. Dieses wird heute von der Soros-Foundation unterhalten – und dient der Erforschung der sowjetischen Landwirtschaftspolitik.
Der Stalin-Preisträger Michail Scholochow schrieb bereits 1932 einen Roman über diese heroische Zeit der Kollektivierung: „Neuland unterm Pflug“, dessen erster Teil 1955 veröffentlicht wurde. Er spielt in der Steppe am Don in einem Bezirk, wo die Kollektivierung erst 14,8 Prozent der kosakischen Bauern erfaßt hat und deswegen die Entkulakisierung forciert werden muß. Der Dorfaktivist Andrej Rasmjotnow bekommt dabei irgendwann Skrupel – er sagt: „Ich halte nichts mehr von diesem Kulaken-Brechen.“ Der zum Parteiaufgebot der 25.000 gehörende Proletarier Dawydow, fragt ihn, was er damit meine. „Ich wurde nicht dafür ausgebildet, gegen Kinder zu kämpfen…Was bin ich, ein Henker? Oder ist mein Herz aus Stein?“ Dawydow kann ihn nur mit Mühe wieder auf Parteilinie bringen: „Gewiß, wir jagen die Kulaken fort, schicken sie nach Solowki. Krepieren werden sie aber ganz gewiß nicht…Und haben wir erst einmal unseren Aufbau vollendet, dann werden diese Kinder keine Kulakenkinder mehr sein. Die Arbeiterklasse wird sie inzwischen umerzogen haben.“ In dem Roman verschwören sich die Kulaken, aber auch der eine oder andere Kolchosmitarbeiter, mit den letzten Resten der untergetauchten weißen Offiziere – und scheuen selbst vor Morden nicht zurück. Dawydow versucht derweil die Masse der Dörfler mitsamt ihrem Eigentum in einer Kollektivwirtschaft zusammen zu fassen. Aber ihr Engagement und ihre Arbeitskraft sind sehr unterschiedlich und einigen bricht es schier das Herz, ihr Pferd oder ihre Kuh zu vergesellschaften, d.h. sie in einen Stall der Kolchose zu bringen, wo sie u.U. nicht so gut behandelt und gefüttert werden. Sergej Tretjakow erwähnt in seinem 1968 veröffentlichten Roman „Das Ableben“, der die Geschichte des Kirchdorfes Poshary von 1917 bis in die Chruschtschow-Zeit erzählt, ein Erlebnis des „gescheiterten Bauernführers“ Iwan. [1] Er will einem Kutscherjungen, der gerade mit Pferd und Wagen von der Molkerei gekommen ist, beim Abladen helfen. „Das Pferd war groß, schmutzig, unter dem enthaarten Fell stachen die Rippen hervor, traurig ließ es den Kopf hängen. Als Iwan hinzutrat hob es plötzlich den Kopf, sah ihn mit feuchtem Blick an und begann leise und wehmütig zu wiehern. Er hatte es nicht erkannt, aber das Pferd hatte ihn erkannt…Einer seiner beiden ‚grauen Schwäne‘ [wie er sie früher immer genannt hat] – die Hufe beschädigt, die Fesseln geschwollen, der Bauch schmutzverkrustet, und der feuchte Blick, voller Wehmut und Trauer um das frühere Leben, um die warme Box und die liebevolle Hand des Herrn, die ihm Zuckerstückchen zwischen die samtigen Lippen gesteckt hatte. Er hatte seine Pferde geliebt, war stolz auf sie gewesen…Nie warf er einen Blick in den Pferdestall der Kolchose; wenn er seine Grauen irgendwo unterwegs sah, wandte er sich ab, zu schmerzlich war ihm der Anblick. Und nun stand er einem seiner Pferde Auge in Auge gegenüber, und das Tier hatte ihn zuerst erkannt.“ [2]
Anders sieht es in den Kollektivlandwirtschaften aus, die aus Nichtbauern bestehen, z.B. in der Gorki-Kolonie für kriminell gewordene Jugendliche von A.S. Makarenko, wo jedes neu angeschaffte Nutztier eine große Errungenschaft ist und dementsprechend von allen liebevoll behandelt wird. Allerdings bildet hier die Landwirtschaft nur die ökonomische Basis für die Kolonie, sie ist nicht deren Zweck, der darin besteht, die Kinder zu Neuen Menschen zu erziehen. Aber auch dabei werden „die Kulaken von Tag zu Tag zahlreicher,“ sorgt sich einer der Jugendlichen. Und Makarenko schreibt: „Anfangs [ab 1920] waren wir geneigt, nur die Landwirtschaft als wirtschaftliche Betätigung zu betrachten, und unterwarfen uns blind der alten These, die da behauptet, daß die Natur veredle. Diese These war in den Adelsnestern entwickelt worden, in denen die Natur in erster Linie als ein sehr schöner und gepflegter Ort für Spaziergänge und Turgenjewsche Erlebnisse aufgefaßt wurde…Die Natur aber, die den Gorki-Kolonisten veredeln sollte, schaute ihn mit den Augen der ungepflügten Erde an, des Unkrauts, das ausgerodet werden mußte, des Mistes, der gesammelt, aufs Feld gefahren und dann ausgestreut werden mußte, eines zerbrochenen Fuhrwerks, eines Pferdefußes, der geheilt werden mußte. Was konnte es da schon für eine Veredelung geben!“ Ähnlich ist es dann mit den Gewerken, d.h. mit den Kinderkolonien, „die ihre Motivationsbilanz auf das Handwerk aufbauten“. Makarenko beobachtete dabei stets ein und das selbe Ergebnis: dass die Jugendlichen als angehende Schuster, Tischler, Maurer etc. immer mehr „Elemente des Kleinbürgerlichen“ annahmen. Und diese stehen der Entwicklung eines revolutionären Kollektivs entgegen, wie er es anläßlich des Umzugs der Gorki-Kolonie in eine größere in der Nähe von Charkow sogar an sich selbst bemerkte – nachdem sie ihr knappes Hab und Gut zusammengepackt hatten und dabei eine Menge sauer erworbenes bzw. organisiertes „Eigentum“ zurück ließen: „All diese ungestrichenen Tische und Bänke allerkleinbürgerlichster Art, diese unzähligen Hocker, alten Räder, zerlesenen Bücher, dieser ganze Bodensatz knausriger Seßhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit war eine Beleidigung für unseren heldenhaften Zug…und doch tat es einem leid, diese Dinge fortzuwerfen.“ Oft genug wurde auch bei anderen Kolchosen der widerstreitende Individualegoismus der Bauern bloß durch einen vereinigten neuen Kollektivegoismus ersetzt: Was scheren uns die Nachbar-Kolchosen und -Dörfer, ob sie dort falsch wirtschaften und hungern, Hauptsache unser eigener Betrieb blüht, wächst und gedeiht. Um diese Denkweise auszurotten wurden die Kolchosen zu immer größeren Einheiten zusammengefaßt, bis aus ihnen riesige Agrarkombinate wurden.
In der hitzigen Anfangszeit kollektivierte man hier und da sogar das Geflügel. Scholochow schildert einen erfolgreichen Aufstand der Bäuerinnen gegen diesen revolutionären Rigorismus, den Stalin selbst – Anfang 1930 – in seinem berühmten Artikel „Vor Erfolgen von Schwindel befallen“ kritisierte.
Der heute als der sowjetischste Schriftsteller von allen geltende Andrej Platonow (1899 bis 1951), begab sich nach Erscheinen dieses Artikels – im Auftrag der Zeitschrift „Krasnaja now“ (Rote Neuigkeit) – sofort in sein Heimatgebiet Woronesh, wo er sich zuvor als Ingenieur an der Melioration und Elektrifizierung beteiligt hatte, um diese von Stalin proklamierte Wende in der Kollektivierungspolitik von unten mit zu bekommen. Seine währenddessen entstandene „Armeleutechronik ‚Zu Nutz und Frommen'“ wurde zwar 1931 gedruckt, aber nachdem Stalin eigenhändig „Ubljudok“ (Schweinehund) auf die Ausgabe geschrieben hatte, mußte der Chefredakteur Alexander Fadejew sich von ihr distanzieren. Er bezeichnete sie als „Kulakenchronik“ und den Autor als „Kulakenagent“, der „das wirkliche Bild des Kolchosaufbaus und -kampfes verfälscht“ und „die kommunistischen Leiter und Kader der Kolchosbewegung verleumdet“ habe. Der Erzähler in Platonows „Chronik“ ist eine „dämmernde Seele“, „zerquält von der Sorge um das Gemeinwohl“, der unruhig von einem Kollektiv zum anderen über Land wandert. In all seinen Büchern sind die Leute unterwegs, in der „Chronik“ ist es Platonow selbst, ein „Pilger durchs Kolchosland“ – der das Dorf verstand, wie Viktor Schklowski bereits 1926 feststellte, indem er aktiv an seiner Entwicklung teilnahm, denn „wertvolle Beobachtungen entspringen nur dem Gefühl emsiger Mitarbeit“. Diese Überzeugung teilte Platonow mit Sergej Tretjakow, der sich ebenfalls auf Viktor Schklowski berief, als er meinte, „der Schriftsteller muß in Arbeitskontakt mit der Wirklichkeit treten“. 1930 stellte Tretjakow sich dem nordkaukasischen Kombinat „Herausforderung“, einer Vereinigung von 16 Kolchosen, für Bildungsarbeit zur Verfügung. Anschließend veröffentlichte er das Buch „Feld-Herren“ darüber, das bereits im Jahr darauf auf Deutsch herauskam und hier fast zu einem Bestseller wurde. Es ist jedoch mehr von bolschewistischem Enthusiasmus als von wirklicher Kenntnis des Dorfes und der Landwirtschaft getragen – dazu absolut staatstragend. Der eher anarchistisch inspirierte Platonow ließ dagegen bereits 1928 in seinem Essay „Tsche-tsche-O“ seinen Helden sagen: „Die Kollektive in den Dörfern brauchen wir jetzt mehr als den Dnjeprostroi…Und schon bereitet der Übereifer Sorgen…verschiedene Organe versuchen, beim Kolchosaufbau mitzumischen – alle wollen leiten, hinweisen, abstimmen…“, so zitiert ihn die Platonow-Expertin der DDR Lola Debüser, die darauf hinweist, dass der Autor die Tragik und letztlich das Scheitern der Kollektivierung vor allem im „staatlich-bürokratischen und repressiven Mechanismus“ von oben sah, der den „Garten der Revolution“ mit seinen „kaum erblühten Pflanzen“ zerstampfte. Das Ringen mit dieser „mechanischen Kraft des Sieges“ thematisierte Platonow auch in seinen zwei Romanen aus dem „Jahr des großen Umschwungs“ 1929: „Tschewengur“ und „Die Baugrube“. In diesem läßt er z.B. einen Kulaken sagen: „…ihr macht also aus der ganzen Republik einen Kolchos, und die ganze Republik wird zu einer Einzelwirtschaft…Paßt bloß auf: Heute beseitigt ihr mich, und morgen werdet ihr selber beseitigt. Zu guter Letzt kommt bloß noch euer oberster Mensch im Sozialismus an.“ Daneben ging es Platonow auch um die durch die Mechanik der Macht (wieder) forcierte Trennung von Kopf- und Handarbeit, mit der die ganzheitlichen Maßstäbe und die bewußte Teilnahme des Einzelnen am Aufbau des Sozialismus zerstört werden.
„Der Mensch war [durch die siegreiche Revolution] – so empfand Platonow das zumindestens – aus dem System der sozialen Determiniertheit ‚herausgefallen‘, alles schien möglich und leicht realisierbar,“ schreibt der russische Platonowforscher L. Schubin. Aber diese Möglichkeiten wurden nach und nach von der „Mechanik der Macht“ zurückgedrängt. „Die Technik entscheidet alles,“ verkündete Stalin 1934 und meinte damit nicht nur die Industrialisierung der Landwirtschaft – vom Traktor bis hin zu agronomischen Verfahren, sondern auch die administrativ umgesetzten neuen Erkenntnisse der Wissenschaft – vor allem der „proletarischen Biologie“. Der französische Marxist Charles Bettelheim merkte dazu 1971 an: „Wer hier handelt, das ist die Technik, und es ist der Bauer, auf dessen Rücken gehandelt wird“. In seinen Samisdat-„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“ kam Boris Jampolski 1975 zu einer ähnlichen Einschätzung: „Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer‘, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten‘, so ist das reine Phantasie.“ Für diese Autorin ist Literatur „staatliches Schönschreiben“, könnte man dazu mit Platonow auch sagen. In seinem Roman „Tschewengur“ läßt er einen seiner Helden zu der Erkenntnis kommen: „Hier leben keine Mechanismen, hier leben Menschen, die kann man nicht in Gang setzen, solange sie nicht selbst ihr Leben einrichten. Früher habe ich gedacht, die Revolution ist wie eine Lokomotive. Jetzt aber sehe ich: Nein, jeder Mensch muß seine eigene Dampfmaschine des Lebens besitzen…damit mehr Kraft da ist. Sonst kommt man nicht vom Fleck.“ Auf dem Plenum der KPdSU zur Agrarpolitik am 15. März 1989 formulierte es zuletzt Michail Gorbatschow rückblickend so: „…die Führung des Landes ging [Ende der Zwanzigerjahre] nicht den Weg der Suche nach ökonomischen Methoden, um die Probleme und Widersprüche zu lösen, sondern einen anderen, direkt entgegengesetzten Weg – den Weg des Abbaus der NEP,…der administrativen Kommandomethoden…Die natürliche Unzufriedenheit der Bauern wurde als eine Art Sabotage gedeutet. Und damit wurde die Notwendigkeit repressiver Maßnahmen gerechtfertigt…Im Agrarsektor lebten die Methoden außerökonomischen Zwangs aus den Zeiten des Kriegskommunismus wieder auf“. Hierzulande kennen wir dagegen den „ökonomischen Zwang im Agrarsektor“ nur allzu gut: „Wer nicht wachsen will muß weichen“, sagen die Bauern dazu, d.h. von der EU wird permanent eine Politik der Liquidierung der Dorfärmsten als Klasse betrieben – zugunsten der Kulaken. In Platonows „Armeleutechronik“ sucht der unstete Wanderer demgegenüber einen humanistischen Weg. Im Kolchos „Kulakenfrei“ trifft er auf den Vorsitzenden Senka Kutschum, der eine interessante Kollektivierungspolitik betreibt: … Und im Kolchos des Vorsitzenden Kondrow geht die Kollektivierung so erfolgreich und ohne Überspitzungen voran, , „weil er selbständig denkt und andere zum Mitdenken auffordert, auch weil er sich gegen unqualifizierte Direktiven von oben wehrt. Kondrow ist glücklich, als Stalins Artikel seinen vernünftigen Weg bestätigt. Platonows Erzähler stellt fest: ‚…es gab Orte, die frei blieben von schwindelerregenden Fehlern…Doch leider waren solche Orte nicht allzu zahlreich‘.“ Stattdessen gab es viele Aktivisten, die nur allzu bereit waren, jede Maßnahme der Administration zu exekutieren. In „Die Baugrube“ hat Platonow solch einen porträtiert: „Auch dem Aktivisten war der gelbliche Abendhimmel, diese Begräbnisbeleuchtung, aufgefallen, und er beschloß, gleich morgen früh das Kolchosvolk zu einem Sternmarsch zu formieren, der in die umliegenden Dörfer führen sollte, die sich noch immer ans Einzelbauerntum klammerten…Der Aktivist befand sich noch auf dem Orghof, die vorige Nacht hatte nichts erbracht, keine einzige Direktive war von oben herab auf den Kolchos geflattert, und so mußte er notgedrungen den Gedanken im eigenen Kopf freien Lauf lassen. Doch sie brachten Unterlassungsängste mit sich. Braute sich nicht doch Wohlstand auf den Einzelgehöften zusammen? War ihm in dieser Beziehung etwas entgangen? Andererseits war nichts gefährlicher als Übereifer – deshalb hatte er nur den Pferdebestand vergesellschaftet und grämte sich nun über die vereinsamten Kühe, Schafe und Hühner, denn in der Hand des spontanen Einzelbauern konnte schließlich auch der Ziegenbock zum Hebel des Kapitalismus werden.“
Platonow spielt hier sowohl auf die Parteirechten um Bucharin an, die für eine eher sanfte Kollektivierung plädiert hatten, gegenüber den Linken, die Stalin mit den Trotzkisten aus der Partei ausgeschlossen hatte. Sie befürworteten eine noch radikalere Lösung der Bauernfrage. Später wandte sich Stalin auch gegen die Bucharinisten. In der Kolchose von Gremjatschi Log, deren Entwicklung Scholochow beschreibt, wird der Aktivist Makar Nagulnow wegen seines Kampfes für die „hundertprozentige Kollektivierung“ plötzlich des Trotzkismus verdächtigt. Er verteidigt sich: „Ich bin nicht Trotzki wegen mit den Hühnern nach links geraten. Er wollte nur so schnell wie möglich „den Eigentumsmenschen, den Kleinbürger matt setzen“. Er muß sich jedoch sagen lassen, dass solche linksradikalen „Verzerrungen“ und „ungebührliche Drohungen gegen Bauern“ bei der Kollektivierung laut Stalins Artikel „Vor Erfolgen vom Schwindel befallen“ nur dem Feind nützen – also dem „rechten Opportunismus“. Die Kollektivbauern bekamen daraufhin ihr Kleinvieh und sogar eine Kuh zurück – und Stalin legte genau fest, wieviel Morgen Land jeder in Zukunft privat bewirtschaften durfte. Damit gerieten viele Kolchosen erneut in Schwierigkeiten, denn die Bauern arbeiteten bald lieber auf ihrem kleinen Privathof als in der großen Kollektivwirtschaft. [3]
Anmerkungen:
[1] In dieser 1968 in der Zeitschrift „Nowyi mir“ (Neue Welt) zuerst veröffentlichten Dorfprosa von Tendrjakow geht es zuletzt um einen Generationenkonflikt zwischen dem alten „konservativen“ Funktionär, der sich selbst geschaffen hat, und dem wissenschaftlich ausgebildeten neuen „Fortschrittlern“, wobei dieser „Kampf“ sich u.a. durch die Überwindung der „proletarischen Biologie“ von Lyssenko und Mitschurin artikuliert – indem der Junge sich an der Universität in eine Professorentochter verliebt, die mit der langsam wieder aus dem Untergrund, aus Verbannung und Lager sowie aus deutschem Exil an die Oberfläche dringenden „bürgerlichen Genetik“ vertraut ist. 1961 konnte in Moskau bereits wieder ein Weltkongreß der Genetik stattfinden, Auch Lyssenko nahm daran noch teil. Er trat erst 1964 von seinem Amt als Präsident der Lenin-Landwirtschaftsakademie zurück. Dem jungen Rebell gelingen dann mit den Kenntnissen seiner Freundin einige wichtige „Neuerungen“ auf der Kolchose in Poshary.
Eine ähnliche personelle Konstellation wie diese, die sich jedoch ausschließlich dem Konflikt zwischen Mitschurin-Lyssenkoanhängern und so genannten „Mendelisten-Morganisten“ auf einer agrarbiologischen Forschungsstation widmet, wählte 1978 Wladimir Dudinzew für seinen Roman „Weiße Gewänder“, in dem die Hauptpersonen konkret um die Züchtung einer „Neuen Kartoffelsorte“ ringen. Der Roman war in der Sowjetunion ein großer Erfolg. Zu einer „Abrechnung“ mit den lyssenkistischen Schwindlern und Betrügern geriet dem Biologen Shores A. Medwejew das Buch „Der Fall Lyssenko – Eine Wissenschaft kapituliert“. Seine Faktenprosa konnte jedoch zunächst nur im Untergrund zirkulieren – bis sie dann 1971 mit großem Aplomp „im Westen“ erschienen , wo man das Buch als eine Art „Archipel GULag“ der Biologen und der freien Forschung überhaupt las.
[2] Tendrjakow verschweigt jedoch auch nicht das noch viel härtere Schicksal der als Kulaken klassifizierten: „Auf dem Bahnhofsvorplatz in der Kreisstadt Wochrowo starben aus der Ukraine enteigneten Kulaken. Die Toten dort frühmorgens waren schon ein gewohnter Anblick, ein Leiterwagen fuhr vor, und der Krankenhauskutscher Abram lud die Leichen auf. Nicht alle starben, viele schleppten sich noch mit wassersüchtigen, abgestorbenen blauen Beinen durch die staubigen, häßlichen Straßen und sahen jeden Passanten mit hündisch bettelnden Augen an. Kein Mensch gab ihnen was, die Leute in Wochrowo mußten selbst die ganze Nacht anstellen, um Brot auf Marken zu bekommen. Das Jahr 1933.“ In der Kolchose von Pochary zog zur selben Zeit der Wohlstand ein: Sie verkaufte ihr Getreide direkt an einige Fabriken, die ihr dafür das lieferten, was benötigt wurde: Ziegelsteine, Schuhe, Bekleidung, Nägel, Schmieröl usw. Als Saatgut beschafften sie sich als einzige im Kreis „jarowisiertes Getreide“, ein Verfahren mit dem Lyssenkos Karriere als Chefbiologe der Sowjetunion seinen Anfang nahm. Einen der halbverhungerten Bettler aus Orjol, der sich bis nach Poshary durchgeschlagen hatte, stellte die Kolchose auf Iwans Drängen als ihren ersten Bauarbeiter ein, er wurde später „Brigadier der berühmten Baubrigade, bekam einen Orden und wurde mehrmals in der Zeitung erwähnt: Michailo Tscherednik“. Iwan diente dem Kolchos weiter, „aber im Grunde seines Herzens glaubte er nicht an ihn.“ Die Kolchose wurde immer reicher, „aber von Nächstenliebe keine Spur.“ Wenn es die aber nicht gab, „dann war der Kolchos keine Familie, sondern nur eine staatliche Organisation“.
[3] Einzuarbeiten wären hier noch einige Anekdoten aus der wunderbaren Forschungsarbeit über die Kollektivierung und den bäuerlichen Widerstand dagegen in Weißrussland von der Historikerin Diana Siebert: „Bäuerliche Alltagsstrategien in der Belarussischen SSR (1921-1941). Die Zerstörung patriachalischer Familienwirtschaft“. (1998)

So schön sieht die Brücke über den Ob bei Tag nicht aus.
Natur und Tiere im Krieg
1. Aus sowjetischer Sicht
„Der Tod des einäugigen Löwen Marjan im Zoo der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Tierfreunde in aller Welt erschüttert. Er hatte die Invasion der Sowjetunion, den Bürgerkrieg, die Taliban und zuletzt die US-Bombenangriffe überlebt. Das Tier kam 1974 mit Hilfe des Kölner Zoos nach Kabul. Als vor einiger Zeit ein Taliban-Kämpfer in den Käfig kletterte, um seine Tapferkeit zu beweisen, fraß Marjan ihn. Der Bruder des Taliban warf daraufhin eine Granate auf ihn, weshalb er am Ende halb blind und lahm sein Dasein fristete. Marjan starb am Montag an Nierenversagen.“ (Spiegel, 20.3.2002)
„Zu seiner ausgestopften Giraffe auf der documenta , erklärte der österreichische Künstler Peter Friedl, dass sie in Kalkilia, dem einzigen palästinensischen Zoo tot umgefallen sei, als die israelische Armee dort ein Versteck der Hamas angriff.“ (FAZ v. 8.6.2007)
Der sowjetische Kriegsberichterstatter Wassili Grossman verfaßte fast ausschließlich Kriegsliteratur, dazu die noch während des Zweiten Weltkrieges von ihm mitverantwortete erste umfassende Zusammenstellung von Berichten über die deutschen Lager zur Vernichtung der Juden – das sogenannte Schwarzbuch, das erst vor einigen Jahren veröffentlicht werden konnte. Schnell berühmt wurde sein 928-Seiten-Roman “Wende an der Wolga”, der auf Deutsch 1958 in der DDR erschien, er handelt von der “Schlacht um Stalingrad”, nach der überall in Europa und nicht nur dort die Hoffnung aufkam, das die Deutschen doch besiegt werden könnten. Berühmter noch als dieses Buch wurde dann Grossmans ebenso umfangreicher Roman “Leben und Schicksal”, in dem die “Schlacht um Stalingrad” gleichsam von innen geschildert wird (während er sie in der “Wende an der Wolga” noch quasi von außen, vom linken Wolgaufer aus, beschrieb). Der Roman erschien 1984 in der BRD, in der Sowjetunion durfte das Buch erst nach 1990 veröffentlicht werden – nach einer erneuten “Wende” also.
Der Kriegsberichterstatter Grossman hat sich, ähnlich wie der weißrussische Autor Wassil Bykau Zeit seines Lebens mit dem Krieg und der “Moral des Krieges” beschäftigt sowie mit dem, was man Tapferkeit, Feigheit, Angst nennt. Bykau schrieb fast ausschließlich über den in Weissrussland besonders entwickelten Partisanenkampf, weil, so sagte er, der Einzelne dabei noch Entscheidungen treffen könne und müsse, wohingegen der Soldat eher ein Rädchen in einer Kriegsmaschinerie sei. Grossman hat es jedoch verstanden, auch hierin nach der Persönlichkeit, dem Schicksal von Einzelnen, zu fragen. Seinen Stalingrad-Roman “Leben und Schicksal” hat man mit “Krieg und Frieden”, dem Roman über den ersten “Vaterländischen Krieg” – von Leo Tolstoi, verglichen. Es war auch das einzige Buch, das Grossman im zweiten “Vaterländischen Krieg” – dem “Großen” – las und das gleich zwei mal.
Als er 1964 starb, hinterließ er Tagebuchaufzeichnungen, die für eine ganze Reihe weiterer Kriegsbücher gereicht hätten. Der englische Historiker Antony Beevor hat sie zusammen mit der Journalistin Luby Vinogradova übersetzt und ausgewertet. Ihr Buch “Ein Schriftsteller im Krieg” erschien 2007 auf Deutsch.
Darin wird zum Einen deutlich, wie der Krieg die Menschen und ihre Wahrnehmung verändert und zum Anderen, wie Grossman selbst, der in der Kriegsberichterstattung seine Lebensaufgabe fand, den Krieg mehr und mehr in einer Normalität oder Natürlichkeit wahrnahm, die der im Frieden gleichkommt.
In einem Interview mit dem Infantristen Michail Wassiljewitsch Steklenkow heißt es: “Als wir näher an die Front kamen, habe ich wirklich Angst bekommen. Aber dann im Gefecht wurde es besser. Und jetzt ist es, als ob ich in die Fabrik zur Arbeit gehe.”
Ein anderer Infantrist äußert: “Im Morgengrauen kämpft sich’s gut. Wie wenn man zur Arbeit geht…Im Dorf mußten wir manchmal härter schuften als im Krieg. Im Dorf ist es echt schwerer.”
Grossman bemerkt: “In den Fabriken wird weitergekämpft…Dieser Klang der Zerstörung ähnelt verdächtig dem Geräusch friedlicher Arbeit.”
Die ständige Gefahr, getötet zu werden, bewirkte eine Intensivierung des Lebens und der Wahrnehmung alles Lebendigen. In einem Exposé für eine Erzählung über den Nachrichtenoffizier Jegorow schreibt Grossman: “‘Es stimmt wirklich, Genosse Kommissar’, sagte er, ‘in diesem Krieg bin ich ein neuer Mensch geworden. Erst jetzt sehe ich Russland, wie es ist. Man geht, und um jedes Flüsschen, jedes Wäldchen tut es einem so bitter leid, dass sich das Herz zusammenkrampft…Soll tatsächlich, so denke ich, auch dieses kleine Bäumchen den Deutschen zufallen?’”
Als die Soldaten nachts über die Wolga gebracht werden, “höre ich, wie ein Rotarmist zum anderen sagt: ‘Kumpel, wir müssen jetzt schneller leben’.”
Die Dörflerin Njuschka erzählt: ” ‘Ach, jetzt ist Krieg, ich habe bereits 18 Männer bedient, seit mein Mann weg ist. Eine Kuh halten wir zu dritt, aber nur ich darf sie melken, die beiden anderen akzeptiert sie nicht’. Sie lacht. ‘Ein Weib ist jetzt leichter zu überreden als eine Kuh’. Sie lächelt. Einfach und gutmütig bietet sie ihre Liebe an.”
Im Kampf scheinen Mensch und Material sich immer mehr anzugleichen: “Obergefreiter Melechin, der Geschützführer, ein lustiger, flinker Virtuose dieses Ringens auf Leben und Tod, in dem eine Zehntelsekunde über den Ausgang des Zweikampfs entscheidet, lag schwer verletzt da und starrte mit trübem Blick auf sein Geschütz, das mit den von Splittern zerfetzten Reifen an einen schwer leidenden Menschen erinnerte…”
Der Richtschütze Trofim Karpowitsch Teplenko meint: “Natürlich ist man froh, wenn man einen Panzer erledigt hat…Das war ein Gefecht Auge in Auge.”
“Nach dem Gefecht ist das Geschütz wie ein Mensch, der schwer gelitten hat – die Reifen sind zerfetzt, überall Beulen und von Splittern durchgeschlagene Teile.”
Als die Deutschen erstmalig die neuen Panzer vom Typ “Tiger” einsetzten, passierte laut Grossman folgendes: “Ein Richtschütze feuerte mit der 45-Millimeter-Kanone aus unmittelbarer Nähe auf den ‘Tiger’. Die Geschosse prallten ab. Der Schütze verlor den Verstand und warf sich vor den ‘Tiger’.”
Die Kriegstechnik wird nach ihrer Zerstörung zu entseelter Natur:
“Die Sonne bescheint hunderte Eisenbahngeleise, wo Tankwaggons mit zerfetztem Bauch wie tote Pferde herumliegen, wo hunderte Güterwaggons, von Druckwellen erfaßt, übereinandergetürmt wurden und sich um kalte Lokomotiven drängen wie eine von Entsetzen gepackte Herde um ihr Leittier.”
“Das Schlachtfeld war übersäht mit ausgebrannten Panzern aller Typen. Beobachter meinten, es hätte ausgesehen wie auf einem Elefantenfriedhof.”
Über sich und seine Kollegen, die Kriegsberichterstatter, die immer wieder vom Hinterland an die Front müssen, äußert Grossman: “Der unangenehmste Augenblick ist genau dieser Wechsel von den Nachtigallen zu den Flugzeugen…”
“Die Rotarmisten sind so sehr an die Zerstörung gewöhnt, dass sie sie gar nicht mehr wahrnehmen.” Dafür ist ihnen jedoch das wenige Unzerstörte sogleich beseelt: “Inmitten all der Zerstörung ein Holzhäuschen. ‘Seht nur, das Haus ist noch am Leben,’ sagen sie im Vorübergehen und lächeln.”
Einerseits vertiert der Mensch im Krieg, der Wald wird seine Zuflucht, er verwildert: “Die erbitterten Kämpfe in Kellern, Abwasserkanälen und Ruinen von Wohnhäusern hießen bei den Deutschen bald nur noch ‘Rattenkriege’.”
Ein Pilot erzählt: “Dieses Jagdfieber, das entsteht, als wäre ich ein Falke und kein Mensch. An Humanität denkt man nicht mehr, überhaupt nicht. Wir machen den Weg frei. Es ist ein gutes Gefühl, wenn der Weg frei ist und alles brennt.”
Während des Rückzugs: “Unheimlich sind solche leeren Straßen, die der letzte Mann unserer Truppen bereits passiert hat und wo jeden Augenblick der erste Feind auftauchen kann. Wüstes Niemandsland zwischen unseren und den deutschen Linien. Wir kommen wohlbehalten durch und fahren in den Brjansker Forst wie in unser Vaterhaus.”
In den Ruinen des Warschauer Ghettos notierte sich Grossman: “Begegnung mit Menschen aus dem Keller Seliaznaja 95c. Menschen, die zu Ratten und Affen wurden.”
Andererseits passen sich die Tiere im Krieg den Menschen an, werden ihm gleich:
Eine Division besaß als Maskottchen ein kasachisches Kamel – namens Kusnetschik (Grashüpfer), das dem Artillerieregiment als Zugtier diente. Es zog den ganzen Weg von Stalingrad bis Berlin mit, wo es an den Reichstag spuckte. “Bei Beschuss sucht es Deckung in einem Granaten- oder Bombentrichter. Es hat sich schon drei Tressen für Verwundungen und die Medaille ‘Für die Verteidigung von Stalingrad’ verdient”.
Ein Soldat erzählt: “Wir haben Hunde hier, die Flugzeuge sehr gut auseinanderhalten können. Wenn unsere fliegen, und sei es fast über die Köpfe hinweg, reagieren sie überhaupt nicht. Aber wenn es eine deutsche Maschine ist, bellen und heulen sie sofort und suchen Deckung, selbst wenn sie sehr hoch fliegt.”
In einem Dorf erfährt Grossman: “Als die Deutschen in dem Bauernhaus auftauchten, sind die Katzen daraus verschwunden und haben sich drei Monate lang nicht blicken lassen. Das war nicht nur in diesem Ort so, sondern in allen Dörfern, erzählt man.”
Eine ukrainische Partisanin berichtete, dass ihre kleine Schwester sich mit den Hühnern unterm Bett versteckte, wenn Deutsche das Haus betraten. Die Hühner wußten, dass sie in großer Gefahr waren – und gaben keinen Ton von sich so lange die Deutschen da waren.
“Nächtliches Weinen über eine Kuh, die beim blauen Licht des gelben Mondes in einen Panzergraben gestürzt ist. Die Weiber heulen: ‘Sie lässt vier Kinder zurück’. Als ob sie ihre Mutter verloren hätten.”
Die Mongolei stellte der Roten Armee tausende von Pferde zur Verfügung. Sie waren zwar klein, aber genügsam und kälteunempfindlich. Viele dieser Pferde gelangten bis nach Berlin. Einige Rotarmisten schrieben Briefe in die Mongolei, indem sie sich für die Pferde bedankten und diese lobten: Sie hätten sich besser bewährt als alle Beutepferde.
“Der Kommandeur des Schützenkorps ist General Iwan Rosly. Er hat zwei Dackel, einen Papagei, einen Pfau und ein Perlhuhn, die ihn ständig begleiten.”
Tiere werden aber gleichzeitig auch kriegstechnisch ge- bzw. vernutzt:
“Besonders abgerichtete Hunde werden mit Brandflaschen am Körper auf einen Panzer gehetzt, mit dem sie in Flammen aufgehen.”
“Ein Witz geht um: ‘Wie fängt man einen Deutschen? Man braucht nur irgendwo eine Gans festzubinden, und ein Deutscher wird sie zu greifen versuchen. Die Realität: Rotarmisten haben im Wald Hühner an langen Schnüren festgebunden und sich im Unterholz versteckt. Tatsächlich tauchten Deutsche auf, als sie die Hühner gackern hörten. Sie gingen prompt in die Falle.”
“Ein Erkundungstrupp hat herausgefunden, dass die Deutschen in diesem Frontabschnitt Gänse als Wächter angepflockt hatten, die bei jedem Geräusch Lärm machten.”
In Elista wurde die Stadt von deutschen Motorradfahrern eingenommen, sie “schauten in die Häuser, stahlen dem Popen einen Truthahn, der gerade herausgelaufen war, um im frischen Pferdemist zu scharren.”
Nicht wenige Rotarmisten haben ihre Tiere mit neuer Kriegstechnik vertauscht: “Viele Panzersoldaten kommen aus der Kavallerie. Aber zweitens sind sie auch Artilleristen und drittens müssen sie etwas von Fahrzeugen verstehen. Von der Kavallerie haben sie die Tapferkeit, von der Artillerie die technische Kultur.”
Die noch nicht lange zurückliegenden Klassenkämpfe und die dazugehörige Ideologie tragen im Krieg taktische Früchte. Klassenkampf ist praktizierte Solidarität. Ein Major Fatjanow erzählt: “Unsere Piloten fliegen immer paarweise (sie lassen sogar von einem Opfer ab, um beim Partner zu bleiben). Wichtig ist, dass wir einander vertrauen und uns in der Not helfen… Bei den Deutschen ist der Sinn für Kameradschaft schwach entwickelt. Paare lassen sich leicht trennen und machen sich davon… In der Koordination mit dem Partner liegt der Schlüssel des Erfolgs.”
Der Pilot Boris Nikolajewitsch Jerjomin: “Der wichtigste Grundsatz ist, immer paarweise zu fliegen und Freundschaft zu halten.”
Nicht nur die Kameraden und die Tiere, auch das Wetter kann zum Bündnispartner werden:
“Die Deutschen sind an leichte Siege mithilfe der Technik gewöhnt und geben auf, wenn die Natur nicht mitspielt.” Sie sprechen dann von “Russenwetter”, das sie fürchten. Während die sowjetische Seite umgekehrt ihre Angriffe mehr und mehr davon abhängig macht: “Der Militärrat der Front sorgt sich vor dem Angriff nur noch um das Wetter. Wie gebannt starrte man auf das Barometer. Ein Meteorologieprofessor wurde hinzugezogen. Dazu ein alter Mann, der sich gut mit den örtlichen Witterungsbedingungen auskannte.”
Während die Deutschen im Laufe des Krieges von der Artillerie auf die Infantrie gewissermaßen runterkamen, verlief die Entwicklung bei der Roten Armee umgekehrt: von der Infantrie zur Artillerie. Ihre Kampfeinstellung blieb dennoch gefühlsbetonter als bei den Deutschen. Generalleutnant Tschuikow befand: “Die Leistung der Deutschen ist nicht gerade glänzend. Aber was die Disziplin betrifft…Ein Befehl ist für sie Gesetz.”
Im befreiten Vernichtungslager Treblinka erfährt Grossman: “Wenn die Männer von den Frauen und Kindern getrennt wurden, kam es zu herzzerreißenden Szenen. Die Psychiater des Todes von der SS wissen, dass man diese Gefühle sofort unterdrücken muss. Sie kennen die einfachen Gesetze, die auf allen Schlachthöfen dieser Welt gelten.”
In Berlin dann war Grossman fasziniert davon, “wie sich die geschlagenen Feinde verhielten, wie bereitwillig sie Befehle der neuen Behörden entgegennahmen und dass es – ganz anders als in der Sowjetunion – kaum Widerstand von Partisanen gab.”
Unterwegs notierte sich Grossman: “Noch nie habe ich so viel Musik gehört. Über diesem aufgewühlten Lehm, vermischt mit Kot und Blut, erklingt Musik aus Radios, Grammophonen, von Sängern in Kompanien und Zügen.”
Der Soldat Michail Wassiljewitsch Steklenkow erzählt: “In einem Bauernhaus fragt mich die Frau: ‘Was singen Sie denn dauernd, wir haben Krieg.’ Ich zu ihr: ‘Jetzt muß man erst recht singen.’”
Die Schreibkraft Klawa Kopylowa: “An ruhigen Tagen tanzen und singen wir (’Das blaue Kopftuch’).”
“Und plötzlich begann eine traurige Stimme feierlich zu singen: ‘Vor den Fenstern tobt ein Schneesturm…’ Etwa zehnmal wird die gleiche Zeile wiederholt: ‘Lieber Tod, wir bitten dich/noch vor der Tür zu warten.’ Diese Worte und Beethovens unsterbliche Musik hatten hier eine unbeschreibliche Wirkung. Vielleicht war das eines meiner größten Erlebnisse in diesem Krieg.”
Starobelsk hatten die Italiener eingenommen. Über sie “sagen die Leute, insbesondere die Frauen, nur Gutes. ‘Sie spielen und singen: ‘O mia donna!’ Abscheu hat nur erregt, dass sie Frösche verspeisen.”
Wohingegen “Aussagen von Gefangenen und Briefe, die bei toten Soldaten gefunden wurden, ergeben, dass sich die Deutschen in der Ukraine als Vertreter einer höheren Rasse sahen, die in den Dörfern von Wilden lebten.”
Auf dem Vormarsch bemerkte Grossman: “Alle haben jetzt deutsche Mundharmonikas. Das ist das Instrument der Soldaten, weil man es sogar auf einem schaukelnden Pferdewagen oder LKW spielen kann.”
Generalleutnant Tschuikow urteilte über seine Soldaten, nachdem sie in Deutschland einmarschiert waren: “Sie plündern ein wenig. Da rollt ein Panzer, und auf seinem Kotflügel sitzt ein Ferkel. Wir verpflegen unsere Leute nicht mehr. Unser Essen schmeckt ihnen nicht. Die Fuhrwerkslenker fahren in Kutschen umher und spielen Akkordeon wie bei Machno.”
Berlin ist ganz anders als Grossman sich die Stadt vorgestellt hatte – nämlich als “eine einzige Kaserne”. Stattdessen: “Unmengen von blühenden Gärten, Flieder, Tulpen und Apfelbäumen. Am Himmel donnert die Artillerie. Wenn sie schweigt, hört man die Vögel zwitschern.”
Er geht durch den Tiergarten: “Alle Bäume waren zerschossen.”
Dann durch den Zoologischen Garten: “Hier hat es Kämpfe gegeben. Zerstörte Käfige. Leichen von Affen, tropischen Vögeln und Bären. Die Insel der Paviane, junge Äffchen, die sich mit winzigen Händchen an ihre Mütter klammern. Gespräch mit einem alten Mann, der die Tiere seit 37 Jahren pflegt. Im Käfig ein toter Gorilla. Ich: ‘War er böse?’ Er: ‘Nein, er hat nur laut gebrüllt. Die Menschen sind böser’.”
An einer Ecke zur Leipziger Straße steht ein Kavallerist mit seinen Pferden, Grossman fragt ihn, wie er Berlin findet: “Gestern war hier was los in diesem Berlin. Auf dieser Straße wurde gekämpft. Als eine deutsche Granate direkt neben uns einschlug, scheute ein Pferd und galoppierte los. Der Hengst hier. Er ist jung und ein bisschen wild. Ich bin ihm nachgerannt. Überall hat es geknallt, das Pferd wollte nicht stehenbleiben, und ich immer hinterher. Da habe ich gemerkt, was Berlin ist! Wir sind zwei Stunden lang immer dieselbe Straße entlang gerannt, und sie war noch nicht zu Ende! Da hab ich gedacht: Das also ist Berlin. Aber das Pferd habe ich eingefangen!”

Hier haben wir den Plan geringfügig geändert. Ich gabe Dir nachher einen Durchschlag.
2. Aus deutscher Sicht:
2009 erschien ein weiteres Buch von Wassili Grossman – mit Aufsätzen, „Tiergarten“ betitelt. Der Text, der
für den Buchtitel gewählt wurde – “Tiergarten” – fängt quasi da an, wo sein Buch “Ein Schriftsteller im Krieg” aufhört – nämlich mit seinem und der Roten Armee Einrücken in Berlin. Der Kriegsberichterstatter Grossman wandert durch die zerstörte Stadt, durch den Tiergarten und den Zoologischen Garten, wo er mit einem der Wärter spricht, der den Tod eines Gorillas beklagt. An einer Straßenecke spricht er mit einem Rotarmisten, dem kurz zuvor nach einer Explosion sein Pferd weggelaufen war.
In dem Aufsatz “Tiergarten” kommt er noch einmal auf den Zoo zurück und auch auf den Wärter. Aber nun wird das Einrücken der Roten Armee in die Stadt quasi aus der Sicht der Tiere geschildert:
“Die Bewohner des Berliner Zoologischen Gartens wurden unruhig, als sie das kaum wahrnehmbare dumpfe Getöse der Artillerie hörten. Das war nicht das gewohnte Pfeifen und Krachen der nächtlichen Bomben, nicht das Hämmern der schweren Flaks.
Die wachsamen Ohren der Bären, Elefanten, des Gorillas und des Pavians registrierten sofort, zu einem Zeitpunkt, da die Schlacht noch fern war von den Eisenbahnlinien und Autobahnen rings um Groß-Berlin, das Neue, das die noch kaum auszumachenden Geräusche in sich bargen und das sich von den nächtlichen Bombenangriffen abhob. ”
usw.
Nun zu dem deutschen Buch über den Krieg auf sowjetischem Territorium, in dem viel von Tieren und von der Landwirtschaft die Rede ist. Es ist streckenweise fast aus der Perspektive von Pferden geschrieben: „Stille Erde“ von Ronald Linowski, ein mecklenburgischer Schriftsteller, der in der DDR jedoch fast nichts veröffentlichen konnte und dessen Buch nun im Godewind-Verlag Wismar erschien. Es handelt von einer deutschen Veterinärkompanie, die 1942 das kleine russische Dorf Tichaja Semlja besetzte
Der Autor zeichnet darin sehr schön die Entscheidungszwänge und daraus folgenden Gratwanderungen nach, die nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion – für die Dorfbevölkerung, aber z.T. auch für die Besatzungstruppe – entstanden:
– Beim Herannahen der Wehrmacht: Wer geht in den Wald, wird Partisan und wer bleibt in Tichaja Semlja – auf die Gefahr hin, zum Arbeitsdienst in Deutschland oder zur Kollaboration mit den Deutschen im Dorf gezwungen zu werden?
– Um sich ernähren zu können, müssen die Felder weiter bestellt werden – aber wieviel von der Ernte wird man fürs Dorf beiseite schaffen können, ohne die Partisanen und die Deutschen zu verärgern, die in Flugblättern und mit Plakaten davor warnen, die jeweilige Gegenseite mit Nahrungsmitteln zu unterstützen.
– Ein einzelner Soldat: Er soll gefangene Rotarmisten erschießen – und weigert sich, aber nur für kurze Zeit.
– Als dorffremde Partisanen Lebensmittel requirieren: Soll man versuchen, sie daran zu hindern oder nicht?
– Die Wehrmacht soll die “Sondereinheiten” aktiv unterstützen – beim Erschießen von Juden, Kommunisten, als Partisanen Verdächtige und Geiseln aus der Zivilbevölkerung (Frauen und Kinder). Einige Soldaten sind entsetzt über diesen Befehl.
– Die Veterinärkompanie rückt auf das Dorf Tichaja Semlja vor: Wie soll der Kompaniechef dem dreiköpfigen Ältestenrat des Dorfes entgegentreten – herrisch/gefaßt? Und wie umgekehrt die drei alten Bauern der neuen Macht im Dorf: unterwürfig/selbstbewußt?
– Die Kompanie beschlagnahmt die Weiden für ihre Pferde, die sie fronttauglich machen soll. Die Dorfältesten wollen, dass ihr einziges Pferd mit auf die Weide darf. Statt sie abzuweisen gestattet der Kompaniechef, eine Ecke der Weide für das russische Pferd abzutrennen, denn “auch er liebt Pferde”.
– Die Kompanie braucht für die Soldaten und die Pferde Verpflegung, vor allem für den kommenden Winter. Die zurückgebliebene Dorfbevölkerung ist aber zu alt oder noch zu jung, um dafür eingespannt zu werden. Der Kompaniechef macht den Bauern den Vorschlag: Ackergeräte gegen Kartoffeln und Heu. Die meisten im Dorf Gebliebenen stellen daraufhin den Deutschen ihre Geräte zur Verfügung, einige verstecken sie jedoch – aus Angst vor den Partisanen, aber auch, weil sie nicht glauben, dass die Deutschen ihnen später etwas von der Ernte abgeben werden.
– Der Dorfälteste überlegt – nach der Ernte: Verlieren wir unsere Würde, wenn wir die uns von den Deutschen überlassenen Kartoffeln annehmen? Wenn nicht, werden die Kinder verhungern. “…Dass wir in diese Schande geraten sind!”
– Der Besitzer des einzigen Pferdes im Dorf möchte, dass seine alte klapprige Stute noch einmal gedeckt wird. Dafür stünde jedoch nur ein edler deutscher Hengst der Veterinärkompanie zur Verfügung. Ein Gefreiter erfüllt ihm den Wunsch, bekommt dafür jedoch anschließend einen Rüffel vom Kompaniechef, der anschließend den Hengst kastrieren läßt und ihn als fronttauglich einer Kampfeinheit übergibt.
– In Tichaja Semlja ist Flecktyphus ausgebrochen, die Deutschen werden geimpft, der Dorfälteste bittet um Impfstoff für die bereits erkrankten Kinder. “Geb ich meinen Gefühlen nach, bin ich verloren,” denkt der Kompaniechef, erlaubt dann aber doch, die Impfungen durchzuführen. Dafür sollen die Dörfler die Läuse bekämpfen. Sie bauen eine Sauna, die dann auch von den deutschen Soldaten benutzt wird.
– Das einzige im Dorf zurückgebliebene Mädchen, das etwa 18 Jahre alt ist und sich versteckt hält, hat schon früher eine Gratwanderung machen müssen: “Die Eltern haben sie im Sinne der Sowjetmacht erzogen,” die Großeltern jedoch in alter Frömmigkeit. Eines Tages wird sie von zwei Soldaten entdeckt. Diese beschließen, sie nicht zu melden.
– Etwas abseits des Dorfes, auf der anderen Seite des nahen Flüßchens, wird eine deutsche Partisanenjäger-Einheit in eine Reihe leerer Gebäude einquartiert. Das verschärft fortan die Entscheidungszwänge: “Machen sich die Partisanen bemerkbar, fordern sie die Deutschen heraus” – und das Dorf käme in Verdacht, ihnen zu helfen. Andererseits ist das Dorf aus Partisanensicht eine “Versorgungs- und Ausgangsstellung der Deutschen.” Entweder werden die Dorfbewohner von den Partisanen als Kollaborateure verurteilt – oder sie gelten bei den Deutschen als Unterstützer der Partisanen.
Indem die Partisanen stärker wurden und immer öfter deutsche Truppen angriffen, gaben diese “den Druck” auf die Dörfer weiter. “So machten sie sich bei der russischen Bevölkerung immer unbeliebter und erschwerten den Kollaborateuren das schmutzige Handwerk.”
– Die Partisanen im nahen Wald erreichten es, dass ein russisches Flugzeug das Dorf und die Beutepferde der Deutschen auf der Weide beschoß. Die Deutschen meinten daraufhin: “Jemand aus dem Dorf muß ihnen entsprechende Informationen geliefert haben.”
– Ein 14jähriger Fischerjunge darf als einziger auch weiterhin an den für die Dörfler gesperrten See, um das Dorf mit Fisch zu versorgen. Er legt dort ein Depot und Waffenlager für die Partisanen an und überbringt ihnen auch Nachrichten. Der Dorfälteste mahnt ihn zur Vernunft: “Du forderst die Deutschen ohne Not heraus.”
– Die Partisanenjäger-Einheit, eine Strafkompanie, verdächtigt den Besitzer der Stute und dessen Frau, die Partisanen informiert zu haben. Sie töten sie. Als sie sich auch noch an dem Dorfältesten vergreifen, geht der Chef der Veterinärkompanie dazwischen: Ohne seine Erlaubnis – als Ortskommandant – wird niemand im Dorf gehängt! Der Chef der Partisanenjäger-Einheit beschwert sich daraufhin beim Divisionsstab über ihn.
Die beiden deutschen Vorgesetzten stehen sich im Dorf in einer ähnlichen Position gegenüber wie auf höherer Ebene der SS-Obergruppenführer und General der Polizei Reinhard Heydrich der Oberstleutnant im Generalstab des Heeres Graf von Stauffenberg. Dem Chef der Veterinärkompanie in Tichaja Semlja gibt sein Vorgesetzter bei nächster Gelegenheit zu verstehen, “dass die Zeit, da sich Teile der Wehrmacht ritterlich verhalten konnten, vorbei ist.” Der Kompaniechef spürt danach, “wie er dabei ist, seine Balance zu verlieren.”
– “Krieg ist nichts anderes als konzentrierter Friede” heißt es aus höherer Autorenwarte an einer Stelle.
– Das 18jährige Mädchen des Dorfes verliebt sich in den 14jährigen Fischerjungen. Sie verführt ihn und fühlt sich dabei schlecht. Nach einiger Zeit merkt sie, dass sie schwanger ist. Wenig später töten die Partisanenjäger den Fischerjungen.
– Der Chef der Veterinärkompanie ist Berufsoffizier, sein Bruder, der ebenfalls an der Front steht, ist Christ und Pazifist. Ersterer gerät in immer tiefere Gewissenskonflikte.
– Er bekommt den Befehl, die Pferde zu verladen und mit seinen Leuten den Rückzug anzutreten, das Dorf soll er niederbrennen. Er hat dem Ältestenrat jedoch zugesichert, dass das nicht geschehen wird. Es kommt zu einem Wortgefecht zwischen ihm und dem Chef der Partisanenjäger-Einheit: “Für mich sind Sie kein deutscher Offizier, sondern ein Pferdekutscher,” sagt dieser, “brennt das Dorf morgen nicht, werden meine Männer das erledigen.” Dazu kommt es jedoch nicht mehr, weil schneller als erwartet russische Panzer auftauchen. In dem kurzen Gefecht wird dennoch das halbe Dorf zerstört. Als danach die Partisanen einrücken, um u.a. mit dem Dorfältesten abzurechnen, liegt dieser bereits im Sterben.
– Nachdem die Rote Armee in Ostdeutschland einmarschiert ist und die Verwaltung übernommen hat, kommt es auch hier zu Entscheidungszwängen bei einigen Protagonisten des Romans. Das gilt auch für viele andere Deutsche, “die sich in ihrem Elend nicht um die Strafen kümmern, die ihnen für Diebstahl, Schwarzhandel, Hamsterfahrten und Holzschlagen in den Wäldern angedroht werden” – von den Sowjets.
– Der Chef der Veterinärkompanie ist in russische Gefangenschaft geraten und kommt krank in einem Lager hinter dem Ural an. Hier ist es eine Ärztin, die einen Wachsoldaten zurechtweist, der auf Befehl des Lagerkommandanten die Deutschen drangsaliert, weil sie zu schwach sind, um schneller zu gehen. Der Wachsoldat beschwert sich daraufhin bei seinem Vorgesetzten. Die Ärztin rettet danach dem ehemaligen Chef der Veterinärkompanie noch zwei Mal das Leben, indem sie ihn aus der Arbeitsbrigade herausnimmt und in die Krankenbaracke einweist, wo er wieder zu Kräften kommt.
– Im Lager wird eine Antifa-Gruppe gegründet, daraufhin bildet sich eine Anti-Antifa-Gruppe, mit Spitzeln und Zuträgern, die auch vor Mord nicht zurückschreckt. Viele Gefangene müssen fortan zwischen diesen beiden Gruppen gratwandern. Die Ärztin sorgt dafür, dass der ehemalige Chef der Veterinärkompanie nach zwei Jahren in die Heimat entlassen wird.
– Wieder zu Hause in Mecklenburg empfangen ihn seine Eltern und seine Frau. Nun gerät auch sie in eine Art von Gewissenskonflikt – zwischen Liebe und Mitleid: Ihr Mann verließ sie als strahlender Offizier und siegesgewisser Karrierist – aber als ein Häufchen Elend kehrt er nun zu ihr zurück. Alle weinen. Ihr Mann erfährt, dass sein Bruder 1943 in Russland gefallen ist.
– Hinterher denkt die Frau des Veterinäroffiziers: Alle Welt empört sich zu Recht über die deutschen Konzentrationslager, doch sie sollten sich auch über die Gefangenenlager der Russen empören. Ihr Mann ist “mitunter der Verzweiflung nahe. Ein Leben ohne klare Befehlsketten.” Alle um ihn herum werden laufend “mit den Gräueltaten der Nazis und SS-Schergen konfrontiert. Über die von den Siegern an ihnen begangenen Untaten dürfen sie nicht sprechen.” Zum Glück findet er bald eine Anstellung bei einem Tierarzt. Als er jedoch erfährt, dass sein neuer Chef ihn unterbezahlt, ist er enttäuscht: “Im zivilen Leben gibt es keinen Ehrenkodex, auf den man blind bauen kann,” denkt er.
Und beim Wiederaufbau seiner Heimatstadt Wismar und dem übrigen Land machen seinen Beobachtungen nach “die Kommunisten dort weiter, wo die Nazis aufgehört haben.”
– Seine Frau bekommt ein zweites Kind – er hat sich körperlich erholt und das Haus, in dem sie wohnen, ist auch bald renoviert. Er ist nun “zum ersten Mal Herr in seinen eigenen vier Wänden. Was ist eine Familie schon anderes als eine kleine Militäreinheit?”
– In das russische Dorf Tichaja Semlja ist derweil ein demobilisierter Offizier der Roten Armee zurückgekehrt. Das halbe Dorf gibt es jedoch nicht mehr, dafür ist aus dem einst kleinen Dorffriedhof ein großes “Leichenfeld” geworden. Der Offizier hat 6 Semester Agronomie, vier Jahre Kampferfahrung und ein Jahr als Ortskommandant in Deutschland hinter sich. “Was habe ich in diesem Dorf noch verloren?” fragt er sich.
– Man macht ihn zum Kolchosvorsitzenden. Die wenige Leute, die überlebt haben, plagen sich auf ihren kleinen Privatfeldern, aber für mehr fehlt ihnen die Kraft. Die Kolchose kommt nicht in Schwung. “Von Tag zu Tag wird ihm die Erschöpfung des Dorfes bewusster.” Aber er gibt nicht auf. Und schafft auch manches. Der Parteivorsitzende beschwert sich mehrmals in der Stadt über seine “Eigenmächtigkeiten”.
– Im Frühjahr 1948 werden in Tichaja Semlja immerhin “dreimal so viele Kolchosfelder bestellt wie im Frühjahr 1945.” Aber das nützt dem neuen Kolchosvorsitzenden nichts mehr, er wird zum Leiter der Feldbaubrigade degradiert, weil er wiederholt gegen Direktiven der Partei verstoßen hat. Er heiratet, seine Frau bekommt ein Kind, das sie nach seinem Bruder nennen, der zwar aus deutscher Kriegsgefangenenschaft zurückgekehrt ist, aber dann Selbstmord begangen hat.
Irgendwann sagt sich der abgesetzte Kolchosvorsitzende: Er hat lauter liebe Menschen um sich herum, das Dorf ist auch noch da…Er braucht für sein Leben keine Parteibeschlüsse mehr. “Nur diese Menschen sind wichtig…”
– Nach dem Ende der Sowjetunion kommen wieder einige Deutsche ins Dorf. Einer ist der Sohn eines Soldaten aus der dort einst stationierten Veterinärkompanie. Er fand mit Hilfe der Kriegsgräberfürsorge dorthin, wo sein Vater am Tag des Rückzugs starb und begraben wurde. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat inzwischen die Überreste seines Vaters in einem Massengrab identifiziert und in ein Einzelgrab umgebettet. Sein Sohn hat mittlerweile Landmaschinenschlosser gelernt – und arbeitet in einer LPG. Als er sich von einigen Dörflern verabschiedet, um seine Rückreise nach Deutschland anzutreten, denkt er, “damals sind unsere Soldaten bis hierher marschiert, weil man ihnen erklärt hatte, hier müsse Lebensraum für das deutsche Volk geschaffen werden. Jetzt erklärt man ihnen, sie müssten Freiheit und Demokratie am Hindukusch verteidigen.”
– Und hier – in jenem russischen Dorf: “Nach fast 500 schlimmen und schönen Jahren wird Tichaja Semlja wohl bald unbewohnt sein und verfallen.” Es sind nur noch einige wenige Höfe bewohnt. “Doch die Lerchen werden bleiben.”
– Ihnen, den Lerchen, hatte der Autor bereits am Anfang des Romans ein ganzes Kapitel gewidmet, den Pferden und der Landwirtschaft sogar mehrere.
– In einem Nachwort schreibt der ehemalige Botschafter der Sowjetunion Valentin M. Falin: “Warum sich der Entdecker der ‘Stillen Erde’ auf das Lösen von Rätseln eines fremden Landes konzentriert, ist nicht ganz klar.”
– Mit seiner “Entdeckung” kommt der deutsche Autor Roland Linowski jedenfalls nicht an die sowjetischen Kriegsromane von Wassili Grossman und Wassil Bykau z.B. heran: bei allem Realismus, mit dem er seine Personen schildert, ist er doch – als SPD-Mann und Amtsleiter, der er nach der Wende in Wismar wurde – immer wieder versucht, die Schandtaten auf beiden Seiten, bei Bolschewiki und Nazis, quasi gerecht zu verteilen – und letztlich Hitler und Stalin anzulasten. Dass dabei dennoch keine erzählerisch deduzierte Totalitarismustheorie herausgekommen ist, verdankt der Roman vor allem seinen langen Passagen, in denen es um Landwirtschaft und Pferde geht. Und dass er sich dabei im Wesentlichen auf ein kleines Dorf konzentriert hat.
– Man vermutet einen Agrar-Fachmann oder gar Bauern dahinter, aber Roland Linowski war Schiffsingenieur und fuhr zur See, las gerne Jules Vernes und schrieb auch zunächst kleine Seemansgeschichten. Später interessierten ihn vor allem die Philosophen Nietzsche, Schopenhauer, Scheler und Comte… Nach einem öffentlichen Auftritt in der Rostocker Warnowerft, wo er als Ingenieur arbeitete, wurde er aus der Partei ausgeschlossen – und durfte nicht mehr zur See fahren.
– “Die Wende ist für ihn eine Erlösung,” schreibt der Direktor der Landesbibliothek von Mecklenburg-Vorpommern in einem Porträt über den Autor, das im Internet zu finden ist. Sein Wismarer Verlag bereitet derzeit gerade eine russische Übersetzung vor – und bemüht sich außerdem um eine Verfilmung des “Stoffes”.

Er hat noch betont, um Punkt sieben käme er hier her.
Neurosibirsk
Was für die Intelligenz auf der einen Seite – in Paris etwa – die Angst vor dem weißem Papier ist, wurde auf der anderen Seite zur faszinierenden „weißen Wand“ – Sibirien: als eine riesige Projektionsfläche. Auch „Hollywood heads for Siberia“, vermeldet ein Film-Fachblatt. Während die einen wahre Horror-Szenarien von dort mitbringen: voller Kälte, Entbehrungen, Gulag-Resten, Altkommunisten, Mafiabanden, Umweltkatastrophen und Genozide, preisen die anderen Mensch und Natur, Baikalsee, Behring-Robben und Bodenschätze in den höchsten Tönen. Der Publizist Lothar Baier bedichtet den äußersten sibirischen Norden als „Arktisches Arkadien“, die FAZ titelt: „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft“.
Im Schnittpunkt all dieser Wunsch-Wahrnehmungen und Projektionen: „Neurosibirsk“ – der geographische Mittelpunkt der ehemaligen Sowjetunion! Dieser noch immer real existierende Ort befindet sich westlich des Flusses Jenissei zwischen dem Öl- und Gaszentrum Nischniwartowsk im Südwesten und der Hafenstadt Dudinka im Nordosten. Er liegt am Fluß Tas im Heiligen Hain des kleinen Volkes der Selkupen. Hier beginnt der Film der nenzischen Anthropologin Anastasia Lapsui und des finnischen Försters Markku Lehmuskallio: „Uhri – die Opfergabe“ . Er unterscheidet sich wesentlich von den meisten anderen „Sibiriensia“ – erst einmal dadurch, daß die beiden Filmemacher es augenscheinlich nicht eilig hatten, schnell wieder in ihr gemütliches Zuhause zurückzukehren. Sie haben sich ordentlich Zeit genommen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber (nicht nur in Sibirien) nicht, zudem legt Lapsui auch nach diesem „film about a forest“ noch Wert auf die Feststellung, daß die Taiga – der Wald – für Tundra-Nenzen eigentlich beunruhigend und unheimlich ist. Alle sibirischen Völker glauben an eine beseelte Natur, den Nenzen beispielsweise ist der Wald „zu voll“. Und auch sogar die Taiga-Selkupen am Fluß Tas schützen ihren fest bebauten Sommerplatz mit einem Holzzaun vor Waldgeistern, sie wollen wenigstens temporär „raus“ aus der sibirischen Taiga. Das Reinfinden dauert – und ist darüber hinaus ein dem Auge verborgener Vorgang. Denkbar schwierig für den Filmer also. Auch wenn er, wie Markku Lehmuskallio, weiß: „Wenn ich einen Moment filme, fühle ich, daß ich etwas Unsichtbares festhalte.“ Diese Schußversuche (im Englischen kommt das Filmen – Shooting – aus der Jägersprache) bedeuten, da es sich gezielt um eine Ethnographie von Jägern handelt, daß die Bild- und Tonschützen, die beiden Filmemacher, sich der Erfahrung einer „generationenübergreifenden Kontinuität“ vergewissern. Immer wieder schauen sie dem Jäger und Fallensteller ins Gesicht und gucken, wie er in den Wald guckt, reinhorcht. Und so wie die Selkupen sich an ihren heiligen Plätzen für all das bedanken, was der Wald ihnen „gab“ – Elche, Auerhühner, Bären, Zobel, Hechte und andere Fische, dazu Beeren sowie Feuerholz – so ist auch dieser Film in gewisser Weise das Abtragen einer Dankesschuld: eine Gegen-„Gabe“, dessen einzelne Teile „Platzwechsel“, „Zivilisation“, „Freizeit“, „Eine Tragödie“ usw. heißen. Sie werden von Liedern zusammengehalten. Eins – über das Hosenflicken – singt die Selkupen-Mutter, während sie eine Hose flickt. Es geht so: „Ich lebe mit meinen leisen Liedern/ Mit leisen Liedern flicke ich die zerrissene Hose meines Sohnes/ Mein Sohn, der einem Schwan ähnelt/ Zerreißt immer wieder seine Hose/ So schnell, daß ich keine Worte dafür finde…“ Wir verstehen, was sie singt, aber was das Lied wirklich bedeutet, das wissen nur die Selkupen selbst – meint Markku Lehmuskallio. Ja, es muß noch viel getan werden, um alle sibirischen Geheimnisse – wenigstens der Selkupen in der Mitte – zu verraten!

Wenn das hier aus der Schlaufe läuft, wird eventuell die Kabelummantelung beschädigt, und was machen wir dann?!
Die Schamanen-Trommel rühren
Während der Buddhismus einst von China zur Besänftigung der wilden Nomaden über die Mongolei kam – und seitdem, nicht nur dort, dazu neigt, sich zu einer der üblichen üblen Staatsreligionen aufzuschwingen, kümmert sich der dort „hingehörende“ Schamanismus eher um die privaten bzw. großfamilialen Belange. In Berlin fanden vor einiger Zeit zwei außermongolische Schamanen-Events statt.
Einerseits hat sich die Kunst musikalisch und als Performance mehr und mehr dem Schamanismus zugewandt (siehe Super-Nomad Nr.2), andererseits haben die wiederauferstandenen neuen Schamanen aber auch von Kunst und Kommerz gelernt (siehe Super-Nomad Nr.1). Im Anschluss an das „Festival Traditioneller Musik/Urban und Aboriginal XIII: Polar“ schrieb der Rezensent der Frankfurter Rundschau: Der Schamanismus konnte dank
„hoher Wandlungsfähigkeit“ überleben. Das ist ebenso wurzelkitschig gedacht wie seine „Warnung“ vor Kommerzialisierung – im Zusammenhang der perfekten Vortragskunst von Sainkho Namtschylak, einer am Moskauer Jazz geschulten Schamanensängerin aus Tuwa. Schon in den Sechzigerjahren machte man in Ungarn die Erfahrung, dass zur Sesshaftigkeit gezwungene Zigeuner keine Musik mehr machen. Diese war aber für den Tourismus notwendig, deswegen eröffnete man eine Musikschule für sie – nach Noten. So muß man sich auch die „Neugeburt“ des Schamanismus im Neonomadismus vorstellen – nur umgekehrt: Im sibirischen Burjatien lehrte zum Beispiel die derzeit in Berlin ihre Doktorarbeit über russische Emigranten schreibende Ethnologin Tsypylma Dariewa den burjatischen Kammernjägern im Rahmen ihrer Berufsfortbildung zwei Jahre lang „Schamanismus“. Und am Wannsee ist ein Mongole in derselben Angelegenheit tätig. Den Wannseern sind seine „Schama-Sessions“ inzwischen derart wichtig, dass er davon leben kann.
Vor einiger Zeit traten im „Haus der Kulturen der Welt“ Schamanen aus Kamtschatka auf. Sie tanzten, sangen, stellten Jagd-Szenen dar und dialogisierten mit ihrer „Babuschka“ (Kamtschatka). Als äußerst gelungen wurde dabei ihr „Möventanz“ – inklusive der dazugehörigen Schreie von drei Frauen – angesehen. Er wurde von einem rührenden „Robbenpärchen“ flankiert. Auch das „Robbenspiel“ verdiente alle Achtung. Am besten gefiel mir jedoch ihr aller Impressario, ein schnurrbärtiger Russe in grauem Sakko und blauer Krawatte, der mal am rechten Bühnenrand die Trommel schlug und mal am linken die Aufführung mit seinem Akkordeon begleitete. Er war so dermaßen bei der Sache, dass ich mir sicher war: Er hat nach der Wende – vielleicht als abgewickelter Kamtschatka-Anthropologe – das „Tanztheater“ aufgebaut, hat sich um Vorlagen für die – sehr schönen – Kostüme bemüht, bei der Regionalregierung das Geld für die Schneiderkosten rausgeleiert, Auftritte organisiert, sich um die Presse gekümmert … Und nun tritt seine zehnköpfige Truppe bereits im Ausland – in Berlin – auf.
Sie sind in einem guten Hotel untergebracht, es gibt einen Shuttle-Service zum Auftrittsort, es gibt Dolmetscher, Übungsräume, Lachen, Trinken, im Café Global beim netten Kurden Rumsitzen, es gibt die baumlange Pressesprecherin des Hauses, Anna Jacobi, die sich ebenfalls sehr um sie bemüht, es gibt dort ein etwas unkritisches, aber dafür umso begeistertes Solipublikum … Also eigentlich ist alles gut! Die Zukunft liegt wie ein satter Silberstreif am Horizont. Darauf trinken wir noch einen! Und – warum eigentlich nicht – noch einen. All das sah ich in ihrem „Liebestanz: Morgendämmerung“ zum Beispiel aufscheinen. Und vor so viel Glück traten mir Tränen in die Augen. Neben mir im Zuschauergang saß eine schöne Frau im Rollstuhl: ihr ging es ebenso. Wir lächelten uns einig an. Als alles vorbei war, schlich ich mich aus der Kongresshalle nach draußen ins Dunkle und begann – zuerst im Café Einstein, dann in der Pizzeria Tarantella und zuletzt im Torpedokäfer – mich zügig zu betrinken. Wieder und wieder trank ich auf das Wohl des internationalen Schamanismus. Und mir selbst wurde immer wohler dabei zumute. Allein, die Umstehenden konnten oder wollten mich nicht verstehen. Ich schwärmte von der Wodkazeremonie in den lamaistischen Klöstern Burjatiens und von den vielen Soju-Tents in Seoul und Pusan, die von den dortigen Nachtschwärmern mit schon fast religiöser Inbrunst aufgesucht werden … Ja, der Schamanismus ist eine feine Sache, braucht aber viel Überzeugungskraft.
Was für die Intelligenz auf der einen Seite – in Paris etwa – die Angst vor dem weißem Papier ist, wurde auf der anderen Seite zur faszinierenden „weißen Wand“ – Sibirien: als eine riesige Projektionsfläche. Auch „Hollywood heads for Siberia“, vermeldet ein Film-Fachblatt. Während die einen wahre Horror-Szenarien von dort mitbringen: voller Kälte, Entbehrungen, Gulag-Resten, Altkommunisten, Mafiabanden, Umweltkatastrophen und Genozide, preisen die anderen Mensch und Natur, Baikalsee, Behring-Robben und Bodenschätze in den höchsten Tönen. Der Publizist Lothar Baier bedichtet den äußersten sibirischen Norden als „Arktisches Arkadien“, die FAZ titelt: „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft“.
Im Schnittpunkt all dieser Wunsch-Wahrnehmungen und Projektionen: „Neurosibirsk“ – der geographische Mittelpunkt der ehemaligen Sowjetunion! Dieser noch immer real existierende Ort befindet sich westlich des Flusses Jenissei zwischen dem Öl- und Gaszentrum Nischniwartowsk im Südwesten und der Hafenstadt Dudinka im Nordosten. Er liegt am Fluß Tas im Heiligen Hain des kleinen Volkes der Selkupen. Hier beginnt der Film der nenzischen Anthropologin Anastasia Lapsui und des finnischen Försters Markku Lehmuskallio: „Uhri – die Opfergabe“ . Er unterscheidet sich wesentlich von den meisten anderen „Sibiriensia“ – erst einmal dadurch, daß die beiden Filmemacher es augenscheinlich nicht eilig hatten, schnell wieder in ihr gemütliches Zuhause zurückzukehren. Sie haben sich ordentlich Zeit genommen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber (nicht nur in Sibirien) nicht, zudem legt Lapsui auch nach diesem „film about a forest“ noch Wert auf die Feststellung, daß die Taiga – der Wald – für Tundra-Nenzen eigentlich beunruhigend und unheimlich ist. Alle sibirischen Völker glauben an eine beseelte Natur, den Nenzen beispielsweise ist der Wald „zu voll“. Und auch sogar die Taiga-Selkupen am Fluß Tas schützen ihren fest bebauten Sommerplatz mit einem Holzzaun vor Waldgeistern, sie wollen wenigstens temporär „raus“ aus der sibirischen Taiga.
Das Reinfinden dauert – und ist darüber hinaus ein dem Auge verborgener Vorgang. Denkbar schwierig für den Filmer also. Auch wenn er, wie Markku Lehmuskallio, weiß: „Wenn ich einen Moment filme, fühle ich, daß ich etwas Unsichtbares festhalte.“ Diese Schußversuche (im Englischen kommt das Filmen – Shooting – aus der Jägersprache) bedeuten, da es sich gezielt um eine Ethnographie von Jägern handelt, daß die Bild- und Tonschützen, die beiden Filmemacher, sich der Erfahrung einer „generationenübergreifenden Kontinuität“ vergewissern. Immer wieder schauen sie dem Jäger und Fallensteller ins Gesicht und gucken, wie er in den Wald guckt, reinhorcht. Und so wie die Selkupen sich an ihren heiligen Plätzen für all das bedanken, was der Wald ihnen „gab“ – Elche, Auerhühner, Bären, Zobel, Hechte und andere Fische, dazu Beeren sowie Feuerholz – so ist auch dieser Film in gewisser Weise das Abtragen einer Dankesschuld: eine Gegen-„Gabe“, dessen einzelne Teile „Platzwechsel“, „Zivilisation“, „Freizeit“, „Eine Tragödie“ usw. heißen.
Sie werden von Liedern zusammengehalten. Eins – über das Hosenflicken – singt die Selkupen-Mutter, während sie eine Hose flickt. Es geht so: „Ich lebe mit meinen leisen Liedern/ Mit leisen Liedern flicke ich die zerrissene Hose meines Sohnes/ Mein Sohn, der einem Schwan ähnelt/ Zerreißt immer wieder seine Hose/ So schnell, daß ich keine Worte dafür finde…“ Wir verstehen, was sie singt, aber was das Lied wirklich bedeutet, das wissen nur die Selkupen selbst – meint Markku Lehmuskallio. Ja, es muß noch viel getan werden, um alle sibirischen Geheimnisse – wenigstens der Selkupen in der Mitte – zu verraten!
Sibirien ist eine riesige Zeitreservoir, meinte Heiner Müller, dies gilt anscheinend vor allem für deutsche TV-Programme: Noch jeder Moskau-Korrespondent der ARD hat rechtzeitig vor Weihnachten eine mehrteilige Sendung über oder durch Sibirien produziert, die er anschließend gleich noch als Buch veröffentlichte. Die Amerikanern sind aber genauso fasziniert von Sibirien. Sie gehören zu den Hauptkunden der russischen Veranstalter, die „GULAG Travel Tours“ anbieten. Sogar das französische Arbeitsamt finanzierte einem Arbeitslosen neulich eine filmische Reise von Jakustk nach Kolyma. Aus Deutschland sind außerdem zu jeder Jahreszeit Künstler aus allen Sparten im Kulturauftrag in Sibirien unterwegs. Hier gilt es, den einstigen Horror-Ort systematisch umzudeuten zu einer positiven Utopie. Denn Jahrhunderte gab es dort nur Kälte, zaristische Willkür und kommunistische Schreckensherrschaft. Den Höhepunkt aller Gruselgeschichten von dort bildete in den Sechzigerjahren die TV-Spielfilmserie: „So weit die Füße tragen“ – sie wurde zum ersten deutschen „Straßenfeger“. Den Niedergang erlebte dieses Genre Anfang der Neunzigerjahre mit dem Roman „Siberian Light“, in dem ein Erdölingenieur mithilfe von Greenpeace und Internet einem US-Konzern auf die Spur kommt, der er in den sibirischen GULAG-Resten unverbesserliche US-Gefangene, vornehmlich Schwarze, unterbringt.
Dabei war dieser alte Verbannungsort für die nachkriegsdeutsche Linke fast einmal ein Wallfahrtsort gewesen. Anfang der Siebzigerjahre veröffentlichten u.a. Landolf Scherzer im Osten und im Westen Peter Schütt ihre Sibirienreiseberichte: „Nahaufnahmen“ und „Ab nach Sibirien“. Beide Bücher enden merkwürdigerweise mit einem Gespräch zwischen dem Autor und einem Baikal-Fisch. Damals hatte der „Fischfreund“ Breschnew gerade die ökologische Rettung des Sees verfügt. Der Westrenegat Peter Schütt distanzierte sich jedoch später von seinem Gespräch am Baikal, nachdem Helmut Kohl und Boris Jelzin sich an der selben Stelle getroffen und nach einem Saunabesuch gebadet hatten. Schütt wurde daraufhin Hausdichter des Unternehmerorgans FAZ.

Da oben unterm Dach wohnte einst der Dichter Jessenin.
Experimentelle Ostbesiedlung
„Geh nach Sibirien junger Mann, dort wachsen Dir die Gürkchen ins Maul.“ (Maxim Gorkij)
Das ZDF setzte im Sommer zwei Ehepaare aus Bayern und aus Sachsen auf eine Insel im Baikalsee – in ein Dorf – aus. Sie mußten dort überleben, waren dafür aber gut ausgerüstet worden: von einer Kuh über eine Axt bis zu einem Deutsch-Sibirischen Wörterbuch. Eines der Ehepaare nahm neben seiner Selbstversorgung noch Jobs im Dorf an: Er arbeitete als Schreiner und sie, die gelernte Krankenschwester, veranstaltete für die Kinder Deutschkurse, den Erwachsenen bot sie Massagen an. Die beiden erwiesen sich als Pioniere des neoliberalen Medienzeitalters, wobei herauskam, dass das Sibirienbild hierzulande noch schwankt. Der Spiegel spricht gerne von einem „sterbenden Land“ – in dem alles in Frost, Alkohol und Agonie versinkt, und wo der sibirische „Aluminiumkönig“ ebenso scheiterte – ins Gefängnis geworfen wurde – wie der sibirische Kommunegründer Edward Limonow. Über die Ölfirma Jukos, die in Ewenkien östlich des Jenisseij für Wohlstand sorgte, deren Chef nun aber ebenfalls im Moskauer Gefängnis Matrosenruhe einsitzt, schreibt das Nachrichtenmagazin: Jukos „bestritt zuletzt 80% des ewenkischen Budgets, verteilte Schneemobile unter den Eingeborenen und schickte einen als Schamanen kostümierten Ex-Matrosen aus dem Fernen Osten zu Ausstellungen nach Paris und Genf, damit er von der lebendigen Stammestradition der Ewenken künde.“ Dort im Fernen Osten werde ansonsten die Taiga langsam aber sicher zu „chinesischen Eßstäbchen“ verarbeitet.
Ebenfalls im ZDF hatte zuvor Caroline Schreiber in einer Seniorenquizsendung gerade noch den Namen „Balalaika-See“ durchgehen lassen – als Heimat des stets gutgelaunten Chors der Wodka-Kulaken!?
Am Sibirienbild der Deutschen muß also noch gearbeitet werden. Deswegen rüstete das ZDF 2004 erneut eine Sibirienexpedition aus – und wählte dafür noch einmal aus einigen hundert Ehepaaren zwei – aus Ost- und aus Westdeutschland – aus, die für einige Monate in der Permafrostregion Nordwestsibiriens, auf der Halbinsel Jamal, überleben sollten. Das ZDF hat dazugelernt: Die beiden Ehepaare bleiben nur drei Monate auf Jamal, bekommen mehr Geld und sind sprachkundig. Es handelt sich zum einen um die Familie Rabe aus Schleswig-Holstein: Er ist Arzt, sie Steuerberaterin. Er hat drei Kinder aus erster Ehe, sie zwei. Während er an Rußlandkenntniss nur seine Begeisterung für den Film »Dr. Schiwago« mitbringt, hat sie als DDR-Ökonomin drei Jahre in Kiew studiert. Vom Sibirienabenteuer erhofft sie sich ein »Zusammenwachsen« ihrer Ost-West-«Patchworkfamilie«. Das andere Ehepaar – Stute – stammt aus Sachsen-Anhalt und hat eine Tochter: Er ist Landwirt, sie Arbeitsamts-Sachbearbeiterin (!), beide verstehen ein bißchen Russisch. Den Kindern, die im Dorf Jarssalei, in dem die zwei Familien untergebracht sind, zur Schule gehen müssen, hat das ZDF vorab einen Russischkurs verpaßt. Überdies kümmert sich ein Nenze, Kyril, der eine Fleischvermarktungsfirma hat, um die Familien. Der Abwechslung (und der Bilder) halber fährt er mit ihnen auch zu seinen Verwandten, die als Rentierzüchter in der Tundra leben. Dort müssen die Deutschen in Zelten leben, auf die Jagd gehen und angeln. Der Landwirt arbeitet ansonsten auf der örtlichen Sowchose, seine Frau in einer Kita, der Arzt in der Klinik von Jarssalei, seine russischkundige Frau assistiert. Die Sowchose zahlt so gute Löhne, daß im Sommer Saisonarbeiter aus Moldawien und der Ukraine bei ihr jobben. Die deutschen Ehepaare sind in alten Holzhäusern untergebracht, die allen modernen Komfort bieten: Zentralheizung, Spülklos und Bäder und zwei Nenzen-Familien gehören, die in dieser Zeit bei ihren Rentierherden in der Tundra leben.
Jarssalei, das man per Schiff über den Ob oder per Hubschrauber von Workuta aus erreicht, ist ein reiches, schönes Dorf, in dem es alles gibt, was man braucht. Seine Schule mit Internat (für die Nomadenkinder) ist materiell weitaus besser als viele deutsche Schulen ausgestattet – pädagogisch sowieso. Außerdem scheint es da oben das leidige Alkoholproblem der Nordmeerregionen nicht zu geben. Den Nenzen sieht man an, daß sie sich in der Vergangenheit mit allen möglichen Russen vermählt haben. In der DDR wurden sie bekannt über das »Jamburg-Abkommen«, mit dem, nach dem Röhrenembargo des Westens, die Beteiligung der sozialistischen Bruderländer an einer Erdgastrasse vom Mittleren Ob bis nach Berlin geregelt wurde. Diese Trasse hat man dann bis zum »Jamal-Feld« nach Norden verlängert: Wir kochen hier also alle mit nenzischem Gas. Neuerdings ist das kleine sibirische Volk vor allem durch die Filme der Nenzin Anastasia Lapsui und des Finnen Markku Lehmuskallio bekannt geworden, die jedes Jahr eine neue Dokumentation auf der Berlinale präsentieren. Ende 2005 zeigte das ZDF in einer Art „Best-off“, die sich „Polaris“ nannte, noch einmal die härtesten Situationen im Jahreszyklus der nenzischen Nomaden.
————————————————————————————
Proletarische versus bürgerliche Biologie: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2006/08/03/der-briefverkehr-von-prols-und-contras/
Brecht-Hymne über die Erfolge der proletarischen Biologie in der UDSSR: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2006/08/23/brecht-im-blog/
Die DDR-UDSSR-Kooperation in Kriwoi Rog: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2009/10/22/das_bergbau_und_aufbereitungskombinat_kriwoi_rog/

Die kamen uns gleich soo entgegen.
Donquichotterien
Was im Internet nicht alles als „Donquichotterie“ abgetan wird… Unglaublich! In den „Grundrissen“ schrieb Karl Marx: „Wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft vorfänden, wären alle Sprengversuche Donquichotterie“. Rosa Luxemburg kam später in ihrer Kritik an Eduard Bernsteins Revisionismus noch einmal auf diese Formel zurück: „Da sind wir glücklich bei dem Prinzip der Gerechtigkeit angelangt, bei diesem alten, seit Jahrtausenden von allen Weltverbesserern in Ermangelung sicherer geschichtlicher Beförderungsmittel gerittenen Renner, bei der klapprigen Rosinante, auf der alle Don Quichottes der Geschichte zur großen Weltreform hinausritten, um schließlich nichts andres heimzubringen als ein blaues Auge.“
1977 beging ich einmal mutwillig eine solche „Donquichotterie“, indem ich mich mit einem Pferd plus Satteltasche auf den Weg machte. Jeder hat seine Fluchtlinie, meine war „nach Süden“, wohl wissend, dass auch dort die Revision bzw. Reaktion sich erholte und erhob. Unterwegs arbeitete ich bei einigen Bauern. Als der Arbeitgeberpräsident Schleyer entführt wurde – und die ganze BRD daraufhin von einer Terrorparanoia erfaßt wurde, da erwies sich mein Pferd als ein wahrhaft trojanisches, insofern es mir überall bei den pferdenärrischen Bauern Zutritt verschaffte – und damit Arbeit. Während wir aber so zu zweit auf den Kämmen der Hochgebirge durch den regnerischen Deutschen Herbst dahinstapften – ich ritt nicht, sondern ging neben dem Pferd her, das mein Gepäck trug – da kam ich mir manchmal doch vor wie der Ritter von der traurigen Gestalt und meine junge Hannoveranerstute glich mehr und mehr dem alten Klepper Rosinante. Obwohl ihr das Immer-Geradeaus-Gehen in Richtung Süden eigentlich gut tat und ich sie als Zweibeiner auch kaum überforderte.
In meiner Satteltasche befand sich neben der „Wesentlichen Einsamkeit“ von Maurice Blanchot u.a. das ebenso schmale Bändchen „Legende von der Unruhe“ von Wladimir Kosin. Das eine war kurz zuvor in Westberlin, das andere in Ostberlin erschienen. Kosin hatte sich 1929 zusammen mit vielen anderen Spezialisten und Generalisten als Zoologe am Aufbau des ersten Sowchos in Turkmenien beteiligt: „Scharenweise irrten sie kreuz und quer durch die russischen Lande, hefteten sich dem allgegenwärtigen, ach so rätselhaften Sozialismus an die Fersen.“ Vierzig Jahre später erzählte Kosin die Schaffung einer „Insel des Sozialismus“ in der Wüste Karakum als eine Schöpfungslegende: Die Pioniere sind teils in Lumpen, teils in Lackstiefeln gekleidet, als erstes besetzen sie alle Führungspositionen. Aber dann tritt der sprachmächtige „Ritter der Revolution“, Nomad, und sein tatkräftiger Gefährte Iwan, „der sich stets in die Richtung bewegt, in die er gestossen wird“, auf den Plan – und die Sache kommt in Gang. Irgendwann ist Nomad das Ganze jedoch nicht mehr schwungvoll genug: Er will weiterziehen – mit seinem Gefährten Iwan, der eigentlich lieber im Sowchos geblieben wäre: Man hatte ihn dort gerade vom Pferdeknecht zum Oberstallmeister befördert. “
Aus der Distanz der 60er Jahre lässt Kosin seine ‚legendären‘ Helden in komischen und tragischen Episoden die ‚Schöpfungstage‘ des Sozialismus vorspielen,“ heißt es dazu heute in einem Antiquariatskatalog. Der Hauptkonflikt des Romans – Sozialismus oder rosaroter „Gnomensozialismus“ – liegt in dem Widerstreit zwischen dem revolutionären Geist Nomad, dem ewig jungen und sehnsüchtig Verliebten, der aus der Wüste einen Garten machen will, und Antiochus, dem Symbol selbstgefälligen Funktionärstums, der, ehemals Revolutionär, den Versuchungen der Macht erlegen ist.
Das erinnert an Erwin Strittmatters „Ole Bienkopp“, der seine Kolchose noch vor der Bodenreform gründen wollte – und ebenfalls bei den Funktionären auf heftigen Widerstand stieß. Auch er also ein (gescheiterter) Don Quichotte. 1989 erging es mir ähnlich, da ich als reingeschmeckter Rinderpfleger mithelfen wollte, die LPG Tierproduktion „Florian Geyer“ in Saarmund über die Wende zu retten – vergeblich: Schon eine kleine 12köpfige Demo vor der Schweinemastanlage reichte z.B. aus, damit der Rat des Kreises sie sofort schließen ließ.
Nun ist das Originalepos von Miguel de Cervantes – pünktlich zur Buchmesse – noch einmal neu bearbeitet worden. Eine Journalistin fragte die Übersetzerin Susanne Lange: War das nötig? Und sie antwortete: „Die meisten kennen den Roman nur vom ersten Teil her mit den komischen Episoden, wenn Don Quichote immer wieder Prügel bezieht und immer wieder scheitert oder gegen Windmühlen kämpft usw. Im Grunde sind das aber bloß Episoden am Rande. Der Roman ist eigentlich ein langes Gespräch zwischen zwei Leuten, die die ganze Zeit nebeneinander herreiten. Wie sich diese beiden Figuren anhand dieser Gespräche entwickeln, das ist das Interessante und Spannende. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Sancho Panza ist zunächst der Bauer, der weder lesen noch schreiben kann und der am Anfang als nicht besonders hell bezeichnet wird. Im Gespräch mit Don Quichote entwickelt er sich aber vom ersten Moment an bis zum Ende des Romans immer weiter und Don Quichote übernimmt vieles von Sancho. Das ist eine ganz faszinierende Beziehung zwischen den beiden.“
Eine Herr-Knecht-Dialektik quasi, die zu immer flacheren Hierarchien führt?! Unterwegs im Deutschen Herbst hatte ich mich meist mit dem Pferd unterhalten, das seinerseits nur ab und zu nickte – ansonsten schwieg. Nur wenn wir in die Nähe eines Dorfes kamen, wieherte es laut – worauf alle Pferde im Tal antworteten. In den Städten ging es stattdessen freudig erregt auf jede Marlboro-Reklame zu oder auf sein Spiegelbild in den Schaufenstern.
Kosins „Nomad“ redete dagegen mit allen und ständig, hielt sogar aufmunternde Ansprachen. Nun hat der DDR-Schriftsteller Volker Braun das „Thema“ noch einmal aufgegriffen: Don Quichotte und sein Gefährte Sancho Pansa – ihre Abenteuer unterwegs. Heute. Jetzt helfen die beiden nicht mehr, den Sozialismus mit aufzubauen, sondern eher, ihn abzubauen. Und dabei sind sie mir – als „1-Euro-jobber“ (-päer) – auch wieder mehrmals nahe gekommen. Bei den beiden handelt es sich um den Havariemeister Flick aus Lauchhammer und seinen Enkel Ludwig, einen Heavymetal-Fan. Flick, der einstige Held der Arbeit im Lausitzer Braunkohlekombinat (BKK), wurde nach dessen Privatisierung und Umbenennung in die LAUBAG, die dann von Vattenfall übernommen wurde, in die Arbeitslosigkeit entlassen. Sein Enkel fand keine Lehrstelle – und war somit von Anfang an arbeitslos. Während jedoch Flick so sehr an die Arbeit gewöhnt war, dass er mit seiner vielen „Freizeit“ nichts mehr anfangen kann, ist der Enkel, „das Sorgenkind der Familie“, bereits in der neuen „Spaßgesellschaft“ groß geworden – und dabei „fröhlich verludert“, wie sein Großvater meint. Gemessen an der sozialistischen Utopie des Charles Fourier sind sie beide gescheitert: Dem einen gelang es nicht, alle Arbeit in Lust zu verwandeln und dabei die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufzuheben, der andere war drauf und dran, mit seinen Stöpseln im Ohr unter der Kapuze langsam zu verblöden.
„O Arbeit, besser wärs, du hättest nie begonnen. Einmal begonnen jedoch, solltest du nie mehr enden,“ so lautet das Motto von Volker Brauns 48 Schwänken – „Machwerk“ genannt – basierend auf dem „Schichtbuch des Flick von Lauchhammer“. Der Autor hat selbst einmal, bevor er Philosophie studierte, im Bergbau gearbeitet. Seinen Helden Flick nennt er einen „Durchreißer, wie er im Buche stand“. Dessen neuer „Dispatcher“ nun, die Sachbearbeiterin in der Agentur für Arbeit, Frau Windisch, hat jedoch nur Ersatzarbeitsplätze für ihn parat: „die Vorbereitung von Abfall zur Entsorgung, die Wiedervernässung von Mooren, das Auszählen von Vogelnistplätzen“. Erst einmal muß er aber eine Nummer ziehen: „Stell dich hinten an, wo dein Platz, Genosse, ist“. Und statt einer Komplexbrigade untersteht ihm dann beim Beräumen eines Truppenübungsplatzes der Roten Armee eine „Brigade voller Komplexe“. Früher sprach man von ABM-Kräften, nunmehr von 1-Eurojobbern, u.a. gehört dazu „ein früh berenteter Ökonom aus Karlshorst“. Sie diskutieren erst mal – wollen wohl gleich „zum geselligen Teil übergehn, der alten Mißwirtschaft,“ so verstand Flick das – und brachte sie auf Vordermann.
Auch bei seinem nächsten Einsatz, den das Jobcenter – Frau Windisch – ihm „vermittelte“, setzt er sich gleich an die Spitze der MAE-Brigade. Diese besteht aus zwei lahmärschigen Baumbeschneidern, denen er sofort die Motorsäge entwindet. Am Ende haben die Bewohner der Straße freie Sicht auf den Senftenberger See – den es dort gibt, „seit das Umland devastiert, abgebaggert und geflutet worden war“.
Der Aktionsradius von Flick wird immer größer. In Horno kommt er gerade noch rechtzeitig zum Einsatz, bevor das Dorf ganz verschwunden ist. Dort weigert sich nur noch das alte Gärtnerehepaar Werner und Ursula Domain, dem Braunkohlebagger zu weichen – und sich nach Neu-Horno bei Forst umsiedeln zu lassen. Die Firma Vattenfall beauftragt ungeachtet des noch schwebenden Verfahrens ein Subunternehmen mit dem Fällen der letzten Bäume im Dorf. Auch Flick ist als „1-Europäer“ mit dabei. Im Eifer des Gefechts legt er gleich die Obstbäume von Werner Domain mit um. „Dem war das Herz gebrochen,“ meint Volker Braun. Der Vattenfall-Konzern entschuldigte sich anschließend für das „Versehen“.
„Als es Flick später noch einmal an den Ort seiner Untat trieb, und das unschuldige Luder [Ludwig] durfte ihn begleiten, fanden sie die Stelle [wo Horno stand] gar nicht wieder. So groß und ungeheuer war die Wüstung.“ Die beiden beteiligen sich dort an der Umbettung der Toten auf dem Dorffriedhof – ebenfalls auf 1-Eurobasis. Dazu müssen die Skelettreste zusammengesucht werden. Hier wird Flick erstmals nachdenklich: Er ließ die anderen die „Knochenarbeit machen und gedachte der Seelenarbeit“. Volker Braun tut es ihm nach – ebenfalls mit Blick in die Gräber: „diese eingedeutschten Sorben und gewendeten Deutschen, Ackerbürger und feldgrauen Aktivisten. Ihr Wesen, schwer wie es ist, war wohl tief hineingesunken, und andererseits zu flüchtig, um sich nicht zu erheben! Diesem Elend, den Hoffnungen mußte nachgegraben werden oder anders nachgeblickt. Da war wenig abgegolten.“
Dies lesend fiel mir ein: Was machen eigentlich die Domains jetzt? Lebten sie überhaupt noch? Nachdem sie 2006 doch ihr Gehöft verlassen mußten und dafür 200.000 Euro von Vattenfall bekommen hatten, waren sie in ein schon Jahre zuvor gekauftes Haus nahe Guben gezogen. Seitdem hatte ich nie wieder etwas von ihnen gehört. Der Horno-Aktivist Michael Gromm hatte jedoch kürzlich mit ihnen telefoniert, er beruhigte mich: Es gehe ihnen gut, sie hätten neue Obstbäume gepflanzt und sich aus Teilen des alten Gehöfts einen Anbau fürs neue Haus geleistet. Das hätte der Zimmermann Ralph von den Besetzern der Lakomaer Teiche, die Vattenfall seit 2007 ebenfalls abbaggern darf, erledigt. Werner Domain dachte, er würde aus Solidarität da wochenlang bei ihm arbeiten, und fand dann die Rechnung von Ralph viel zu hoch. Obwohl er doch jetzt mehr als genug Geld hatte. Ich war erfreut, zu hören, dass der alte Domain anscheinend noch immer im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte war.
Auch bei den Lakomaer Teichen war irgendwann Flick mit seinem Neffen aufgekreuzt – anläßlich einer Besetzerdemo. Ludwig hielt dort „die Stellung“ – länger als Flick. Auf dem Alexanderplatz trafen sie dann „Die glücklichen Arbeitslosen“ ,namentlich ihren Gründer Guillaume Paoli, an dem Ludwig sogleich Gefallen fand. In der Volksbühne kam Flick während eines Nichtstücks mit und über 1-Eurojobber von Jürgen Kuttner ins Grübeln – über die richtigen Mittel für den Einsatz im Theater, die er aber nicht besaß (in seinem Werkzeugkasten). Im Kino sahen sie anschließend den Dokumentarfilm „Workingman’s Death“. Flick überlief es dabei heiß und kalt, Schweiß perlte ihm von der Stirn, so dass Ludwig ihn anstieß: „Großvater, come on!“
In Paris hausten sie eine Nacht lang in den „1-Euro-Iglus“ der Obdachlosen an der Seine. Und sogar bis nach Apulien verschlägt es sie, „Flick hielt Fühlung mit der Dispatcherin“, dort müssen sie mit einer polnischen Brigade u.a. Tomaten ernten – und werden dabei von den Wachen des Padrone wie „Sklaven“ behandelt. In einem der Schwänke kommt natürlich auch Flicks Kampf gegen Windkraft-Anlagen (WKA) vor.
„Man muß sich Sysiphos als einen glücklichen Menschen vorstellen!“ Wer hat das gesagt? Egal, diese kurzen MAE- (Mehraufwands-Entschädigungs-) Maßnahmen, das war jedenfalls keine Sysiphosarbeit. Flick wird darüber ganz krank, seine „Maschine“ macht nicht mehr länger mit. Als er aus dem Krankenhaus entlassen wird, baut er mit seinem Neffen ein leichtes Motorrad mit einem Seitenwagen zusammen. In diesen setzt sich Flick, während Ludwig fährt. Der Alte läßt sich chauffieren. Sie kommen ins „Land der Frühaufsteher“. Hier bei Bitterfeld „lag die berüchtigte Grube Gottsche“, sie halten vor dem „Restloch“, Flick findet einen verschwundenen Fluß, kontrolliert den trockenen Lauf, ist sich nicht schlüssig, „ob hier ein Verweis oder die Prämie fällig wäre im Wettbewerb ‚Schöner unsere verschwundenen Dörfer und Städte‘.“ Es findet dort ein Rockkonzert statt. Das ist wieder eher was für Ludwig als für Flick.
Dies sind aber nur einige von 48 „lose zusammengefügten Schwänken“ (Berliner Zeitung), die die beiden durchstehen (müssen), bevor der alte Havariemeister endgültig in die Grube fährt („mit ihm ist eine Zeit zuendegegangen“) – und ein anderer „Experte ‚ganz ruhig‘ die Arbeitsagentur Nord“ betritt und den „Tisch der Sachbearbeiterin mit einem 5-Liter-Kanister Spiritus in Brand“ setzt. Diese „erleidet daraufhin einen Schock; aber auf dieses Mittel setzt Verf. nicht“ – fügt Volker Braun hinzu, vielleicht aus juristischen Erwägungen heraus. Dennoch scheint es ihm manchmal das einzig Sinnvolle zu sein. Die Kapitalmedien im Westen haben ihm das übel genommen: „Man fragt sich, weshalb er aus seinem Flick einen Schwank gemacht hat, wenn er es doch ernst meint…,“ schreibt die FAZ. Die ZDF-„Heute“-Sendung bemühte sich dagegen um sachliche Aufklärung: „Das Kulturinstitut Cervantes ist nach dem berühmten spanischen Autor Don Quichotte benannt.“





По-моему это уже обсуждалось