Am 31. Januar starb Erich Wulff. Der 1926 in Tallin geborene Psychiater wurde nach dem Krieg vom Existentialismus beeinflußt:
„Früh zog es ihn auch nach Paris, wo er in die Atmosphäre des linken, engagierten Existentialismus eintauchte, die sich um Sartre, André Gorz und die Zeitschrift ‚Les Temps Modernes‘ gebildet hatte. Das hatte praktische Folgen für sein Leben. Er ging 1961 nach Vietnam, wo er einen Lehrauftrag an der Universität von Hué wahrnahm und Gründungsdirektor der dortigen psychiatrischen Klinik wurde,“ schreibt die FAZ heute in ihrem Nachruf auf ihn.
Durch seine Kontakte mit dem Westberliner „Argument“-Arbeitskreis um das Ehepaar Haug kam es in deren Verlag zur Publikation seiner „Vietnamesischen Lehrjahre“, die unter dem Pseudonym Georg W. Alsheimer erscheinen. Das war noch während des Vietnahm-Krieges – seine „Lehrjahre“ wurden eines der wichtigsten Bücher in der Auseinandersetzung um diesen Krieg. Erich Wulff engagierte sich auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland noch weiter für den gegen die Amis kämpfenden Vietkong.
Dazu hier ein Text, den ich vor einiger Zeit auf dem „Vietnam-Kongreß“ der Ostberliner Volksbühne hielt:
„Schafft zwei, drei, viele Vietnam!“
Als ich gerade in meiner Funktion als taz-Hausmeister den Keller ausmistete und mich dabei ein Volontär ansprach, der etwas von mir wollte (eine Dienstleistung), lag es mir auf der Zunge zu sagen „Ich bin gerade im Stress“. Das Wort Stress kam mir jedoch nicht über die Lippen – aus moralischen Gründen. Es ist ein rechtes Scheißwort. Der Volontär half mir jedoch aus der Patsche, indem er abwinkte und sagte: „Ich seh schon, du bist gerade im Stress.“ Wenn ich nicht irre, haben wir dieses Wort den Vietnam-Vetranen zu verdanken. Kann sich jemand vorstellen, dass ein Vietkong-Veteran, von denen es in Berlin nicht gerade wenige gibt, jemals sagen würde: „Die Amis haben uns gestresst!“?
Als die US-Soldaten nach dem Vietnamkrieg nach Hause kamen, wurden sie von der kriegsmüden und in der Haltung zum Krieg gespaltenen Bevölkerung nicht gerade freudig empfangen. Sie organisierten sich und gründeten die gewerkschaftsähnliche Organisation der Vietnam Veterans. Mit ihrer Lobbyarbeit gelang ihnen 1980 die Anerkennung und damit Etablierung der PTSD „Post-Traumatic-Stress-Disorder“ (posttraumatischen Belastungsstörung) durch die „American Psychiatric Association“. „Die PTSD-Diagnose bedeutete eine Würdigung ihrer psychologischen Leiden,“ schreibt die Soziologin Eva Illuoz. Von den Vietnam-Vets aus wurde „das PTSD dann auf immer mehr Vorkommnisse und Fälle ausgeweitet, etwa auf Vergewaltigung, terroristische Angriffe, Unfälle, Verbrechen etc..“ Inzwischen sind wir mehr oder weniger und im Zweifelsfall alle gestresst. Der Stress der Vietnam-Vets ist ein Vorläufer der Kriegsneurose, genauer gesagt: ein Nachläufer. PTSD ist die Verlängerung der Kriegsneurose in den Frieden. Sie wird seit dem Ersten Weltkrieg systematisch erforscht und klassifiziert, vorher gab es nur Simulanten.
Dem gegenüber steht die Partisanenkrankheit, die aber auch erst im Frieden ausbricht. Schon gleich nach dem (gewonnenen) Partisanenkrieg in Jugoslawien wurden Spezialkliniken zur Erforschung und Therapie dieser neuen Krankheit, die alle jugoslawischen Partisanen bis auf die slowenischen befallen konnte, eingerichtet. Etliche wissenschaftliche Symposien befaßten sich damit. Der erste, der im deutschen Sprachraum darüber publizierte, war 1948 der slowenische Psychoanayltiker Paul Parin, der zuvor selbst als Arzt bei den Titopartisanen gekämpft hatte. Mit dem heute in der Schweiz lebenden Parin kann man vielleicht sagen: Wenn die Kriegsneurose ausdrückt, nicht mehr zu kämpfen zu wollen, dann bedeutet die Partisanenkrankheit, nicht mit dem Kämpfen aufhören zu können. (1) Beim PTSD wie auch bei der Partisanenkrankheit ging es in Friedenszeiten nicht zuletzt auch um die Rente – insofern war ihre offizielle Anerkennung als Leiden notwendig. Anders gesagt: „Die Klassifizierung von Pathologien entsprang der Tatsache, dass die mentale Gesundheit aufs engste mit der Versicherungsdeckung verknüpft wurde.“ (Eva Illouz)
Das ist noch nicht lange so. Partisanen hat es dagegen schon immer gegeben, so lange wie es Volkskriege und -aufstände gegen innere oder äußere Bedrückungen gab. Und meistens standen sie in einem Zusammenhang mit der Landbevölkerung. Es gibt inzwischen sogar Partisanentheoretiker, wie den BBC-Programmchef Steward Hood, die meinen, dass nunmehr, mit dem Verschwinden der Bauern auch kein Partisanenkampf mehr möglich ist. Sogar Deutschland hat eine ruhmreiche Partisanentradition. Erinnert sei an die germanische Guerilla unter der Führung von Hermann dem Cherusker gegen die römischen Okkupanten unter Varus – 9 nach Christus. Varus hatte zuvor den jüdischen Aufstand in Palästina niedergeschlagen. Nach ihrer dritten Niederlage versuchten die Römer nie wieder, Germanien zu erobern. Hier konnten dann die Friesen am Längsten ihre Unabhängigkeit bewahren, indem sie alle Adelsheere schlugen.
Unter partisanischen Gesichtspunkten sind daneben vor allem die Hussitenkriege, ausgehend von der tschechischen Stadt Tabor, wichtig – 1419-1436. Mehrmals schlugen diese Bauernhaufen ein Kreuzritterheer. Ihrem Anführer Jan Ziska errichtete man später in Prag das größte Reiterdenkmal der Welt. Die protestantischen Hussiten waren wiederum Vorläufer und Vorbild für den deutschen Bauernkrieg 100 Jahre später – unter der Führung von Thomas Müntzer und Martin Luther, die sich jedoch bald gegenseitig bekämpften. Die Niederlage der Bauern in der Schlacht bei Frankenhausen 1525 wirkt bis heute nach – was die politische Einstellung der deutschen Bauern betrifft – und wahrscheinlich überhaupt die relative Unfähigkeit der Deutschen zum Widerstand. Die DDR ließ in Frankenhausen in den Siebzigerjahren ein Bauernkriegsdenkmal errichten: ein Rundbau mit dem größten Panoramabild der Welt – von Werner Tübke. Obwohl es spätestens seit dem „Jüdischen Krieg“ gegen die Truppen des Varus eine Stadtguerilla gibt, blieben die meisten Partisanenkämpfe mit dem Bauerntum verbunden.
Ab 1808 bildete sich ausgehend vom Widerstand gegen Napoleon in Spanien und in Tirol langsam eine Partisanentheorie heraus. Sie wurde von den preußischen Reformern in Angriff genommen, die damit den Partisanenkampf gegen Napoleon in Deutschland befördern wollten. Genannt seien der Freiherr vom Stein, sowie Hardenberg, Scharnhorst und die Militärs Gneisenau und Clausewitz. Weil der preußische König zögerte, den „Volkssturm“ von oben zu entfesseln, traten einige dieser Adligen in russische Dienste. Von dort aus kam es dann ebenfalls zum Partisanenkrieg gegen Napoleon, nachdem dieser Moskau eingenommen hatte. Einer der herausragenden Partisanenführer war der Dichter Denis Dawydow, auch in Deutschland gab es solche Partisanendichter – Ernst Moritz Arndt und Theodor Körner z.B.. Berühmt wurde Heinrich von Kleist – vor allem mit seinem Drama: „Die Hermannschlacht“, das er als Agitationsstück zur Aufnahme des Guerillakampfs gegen die französische Besatzungsmacht verstand, wie Wolf Kittler es 1987 in seiner Kleiststudie „Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie“ detailliert nachwies, der Hermannschlachtforscher Phil Hill würde dagegen umgekehrt bei Kleist von einer Geburt der Partisanenpoesie aus dem Geist des gemanischen Widerstands gegen Rom sprechen. Der partisanische Widerstand in Preußen litt, da er zunächst von Offizieren und Adligen begonnen wurde, unter deren eingefleischten Soldatentum, d.h. als Partisanen- oder Freischarführer tendierten sie dazu, sich den napoleonischen Truppen heldenhaft im offenen Kampf zu stellen, Attacken zu reiten und sich bei Rückzügen zu verschanzen – anstatt sich in Sümpfen und Wäldern zu verstecken und von dort aus Überfälle zu wagen.
Dieses „Umdenken“ fiel auch später noch den Militärs schwer – bis hin zu den Bolschewiki. In der Revolution von 1905 forderte Lenin, der die Schriften von Clausewitz und Gneisenau gründlich studiert hatte, zwar von seiner Partei, sich an die Spitze der Partisanen zu stellen, aber 1917, als überall in Russland quasi von selbst Partisanengruppen entstanden, um die Weißen und die ausländischen Interventen zu bekämpfen, drang er darauf, sich vom Partisanenkampf zu verabschieden und diese chaotischen Gruppen in die neue disziplinierte Rote Armee einzugliedern. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch einmal einige deutsche Partisanentheoretiker: den Schriftsteller Ernst Jünger, den Gründer der Künstlersozialversicherung Rolf Schroers und den faschistischen Staatstheoretiker Carl Schmitt. Letzterer meinte, dass die Bolschewiki das Partisanentum im Gegensatz zu den Chinesen noch relativ schwach entwickelt hätten. Bei Mao Tse Tung, der von einem „lang andauernden Krieg“ ausging, gibt es fast eine Gleichgewichtung des partisanischen und des soldatischen Kampfes. Es kam 1949 tatsächlich auch zu einem „Sieg im Volkskrieg“, dieser dauerte alles in allem 22 Jahre. Anfänglich gab es noch, beeinflußt von den sowjetischen Beratern und deren marxistische Einschätzung des Proletariats als einzige revolutionäre Klasse, eine tragische Fixierung auf Städte und Fabrikarbeiter, deren Aufstände dann allesamt scheiterten. Die Sowjets tendierten sowieso dazu, die Bauern insgesamt gering zu schätzen und als verkleinbürgerlicht abzutun bzw. mit der Kollektivierung abzuschaffen, dieses Vorgehen stand insbesondere in Russland im Gegensatz zu Marx, der einst die Entwicklung des Bauerntums von den Germanen bis zur russischen Dorfgemeinschaft (Obschtschina) studiert hatte – und dabei zu dem Resultat gekommen war, dass die Obschtschina mit ihrem Gemeinschaftseigentum den Kapitalismus quasi überspringen könne…
Ausgehend von den Niederlagen in Shanghai und Kanton 1927, aber auch von den zuvor gescheiterten Aufständen in Reval und Hamburg, machte man sich in der Moskauer Komintern 1928 an die Zusammenstellung eines Lehrbuchs für den Aufstand (es wurde im Zusammenhang der Studentenbewegung 1971 auf Deutsch veröffentlicht). Neben einigen Altbolschewiki und dem General der Roten Armee Tuchatschewski arbeitete auch der deutsche Revolutionär Erich Wollenberg sowie Ho Chi Minh daran mit. Letzterer galt unter den Bolschewiki als ein „Bauernträumer“, sein Text in dem Aufstands-Handbuch, „Die Arbeit unter der Bauernschaft“ betitelt, beginnt mit dem Satz: „Der Sieg der proletarischen Revolution in Agrar- und Halbagrarländern ist undenkbar ohne aktive Unterstützung durch die ausschlaggebenden Massen der Bauernschaft“. Auch das Scheitern der städtischen Aufstände in China führte Ho Chi Minh darauf zurück, dass es z.B. „in den an Kanton grenzenden Gebieten keine starke revolutionäre Bauernbewegung gab“. Und eine der „Hauptvoraussetzungen für einen dauernden Erfolg des Vorgehens bäuerlicher Partisanen“ ist laut Ho Chi Minh „ihre unzertrennliche, lebendige Verbindung mit den breiten Bauernmassen“.
Für die Parteipropaganda bedeutet dies, das sie sofort die Forderungen der Bauern aufgreift: also Landreform, d.h. Neuverteilung des Bodens an die Armen, Vertreibung oder Ermordung der wüstesten Handlanger der Regierung in den Dörfern und Enteignung der Großgrundbesitzer, zumindest der verhassten und derjenigen, die nicht an der Seite der Bauern kämpfen wollten.
Für die organistorische Arbeit auf dem Land geht es darum, eine „einfache und den breiten Massen ebenso verständliche wie geläufige Struktur“ zu finden. Diese beginnt mit dem Aufbau eines „Selbstschutzes“ – also einer Bauernmiliz, die mit ihren Waffen (Sensen, Messer, selbstgebaute Granaten usw.) versucht, das Dorf im gegebenen Falle gegen feindliche Überfälle und vor Plünderungen zu schützen, wobei sie u.a. Fallen und Verstecke anlegt. Als nächstes gilt es, „Partisanenabteilungen nach dem Territorialprinzip“ zu bilden, die im Untergrund arbeiten und Überfälle planen, um dem Gegner z.B. Waffen abzunehmen. Miliz und dörfliche bzw. territoriale Widerstandsgruppen sind während der Aussaat und zur Erntezeit noch Halbzeit- oder Mondscheinpartisanen, d.h. sie sind auch noch als Bauern tätig, je nach Stand der Auseinandersetzungen primär oder nebenbei. Mit der Verschärfung des Klassenkampfes und dem Umschlagen desselben in den offenen Bürgerkrieg müssen die Partisanenzellen laut Ho Chi Minh „zu Abteilungen verschiedener Stärke und nach Gebieten zusammengefaßt werden“. Gleichzeitig muß ihre politische Schulung forciert werden, damit sie ihrer Rolle als „Avantgarde“ der Bauern gerecht werden können. Um eine reguläre Armee in offener Stellung angreifen zu können bedarf es schließlich der Zusammenfassung der Partisanenabteilungen zu einer „Bauernarmee“.
Dieses dreiteilige Entwicklungsschema der Bewegung, wiewohl es so oder so ähnlich für viele Partisanenkriege gilt (z.B. für die Titopartisanen im Zweiten Weltkrieg oder für Budjonnys Kosakenpartisanen im russischen Bürgerkrieg, aus denen dann die berühmte „Reiterarmee“ hervorging), verbirgt ein Problem, das man als Umschlag von der Qualität in die Quantität bezeichnen könnte: Die widerständigen Bauern kompensieren ihre mangelnde Bewaffnung durch List und Tücke sowie durch genaue Kenntnis ihres Territoriums, auf dem sie zu Hause sind – das sozusagen auf ihrer Seite ist und mitkämpft. Dazu gehören auch ihre Tiere, die wilden wie die zahmen, sowie die Pflanzen und Bäume.
Sobald die Partisanengruppen jedoch in die Befreiungsarmee eingereiht werden, unterstehen sie einem Oberkommando, das sie gemäß den Anforderungen der Front mal hier und mal dort einsetzt – auf unbekanntem Territorium. Und ihre Partisanenführer finden sich plötzlich im Hauptquartier bzw. in Stäben wieder, wo sie Entscheidungen nicht mehr aufgrund ihrer Ortskenntnis treffen, sondern auf der Basis eingehender Informationen und anhand von Landkarten, was ganz andere Fähigkeiten verlangt.
In der Sowjetunion gab es im Zweiten Weltkrieg die größten Partisaneneinheiten und von ihnen befreite Gebiete in Weissrussland. Dort entstand später dann auch eine Literatur, vor allem von Ales Adamowitsch und Wassil Bykau, die sich fast ausschließlich mit dem Partisanenkampf befaßte, weil der Einzelne dabei noch moralische Entscheidungen treffen kann und muß, während er in der Armee nur noch ein Rädchen im Getriebe einer gigantischen Militärmaschinerie ist, auch wenn er weiterhin Teilnehmer an einem „gerechten Krieg“ bleibt. Diese daraus entstandene Literatur kann man als „sozialistischen Existentialismus“ bezeichnen. In Frankreich entstand aus dem Partisanenkampf gegen die Deutschen zur selben Zeit explizit ein „Existentialismus“, er ist mit den Résistancekämpfern Sartre und Camus verknüpft. In Italien sprach man von Neoverismus oder Neorealismus, der dann vor allem durch Filme – u.a. von Rossellini – berühmt wurde. Das erste neorealistische Manifest wurde bereits 1943 in einer Partisanenzeitschrift veröffentlicht.
Dieser kulturelle Ausfluß des Partisanenkampfes wirkte noch bis in die westeuropäische Studentenbewegung hinein. Einen Monat nach der so genannten Tet-Offensive der südvietnamesischen Befreiungsbewegung fand in Westberlin im Februar 1968 der „internationale Vietnamkongreß“ statt. Dabei wurde insbesondere eine Parole des vier Monate zuvor ermordeten Partisanenführers Ché Guevara diskutiert: „Schafft zwei, drei, viele Vietnam!“. Die laut Oskar Negt bloß „abstrakte Gegenwart der Dritten Welt in den Metropolen“ geriet in einigen Redebeiträgen zu einer immer größeren Annäherung zwischen Saigon und Berlin: indem die Straßenkämpfe hier immer militanter wurden, indem man statt Geld für Medikamente nun „Waffen für Vietnam“ sammelte und indem sich mit den Worten von Rudi Dutschke bei den Aktivisten langsam das Gefühl verdichtete: „In Vietnam werden auch wir tagtäglich zerschlagen, und das ist nicht ein Bild und ist keine Phrase“.
In den Jahren davor litt man hier geradezu an der allzu „abstrakten Gegenwart“ des vietnamesischen Widerstands: 1968 veröffentlichte der Psychiater Erich Wulff das Buch „Vietnamesische Lehrjahre“, in dem er über seine Arbeit als Arzt in Hué von 1964 bis 1967 berichtete. Zwischendurch mußte er nach Deutschland zurück kehren und wieder in einer Freiburger Ambulanz arbeiten, wo ihn die Beschäftigung mit den psychischen Leiden der Mittelschicht jedoch bald anödete: „In Vietnam hatte ich Krankheit als gewaltsamen Einbruch ins Studium, ins Arbeits- und Privatleben kennengelernt; der Arzt reparierte sie, wenn er konnte…Die Lebensumstände, in die der Entlassene zurückkehrte, waren oft empörend; aber der Arzt konnte dennoch das Gefühl haben, etwas geschafft zu haben, etwas Wirkliches; auch hatte die Überlegung Sinn, wie die Verhältnisse, die ständig Krankheit verursachten, sich ändern ließen. Die Änderung war nicht bloß denkbar, sondern es wurde im Land um sie gekämpft. Ein vielfältiger Prozeß der Veränderung nahm einen auf, bot Möglichkeiten des Eingreifens. Auch in persönlichen Freundschaften war solche Wirklichkeit greifbar: was mich mit Tuan, Mien u.a. verbunden hatte, beruhte vorrangig auf gemeinsame Stellungnahme zu den Ereignissen, war in seinem Kern Politik, Engagement für die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Unsere Freundschaften waren niemals in der Fadheit des bloß Privaten eingeschlossen. Sie waren sozusagen in einem pathetischen Sinne republikanisch. In Vietnam hatte mich gesellschaftliche Wirklichkeit bis in die sogenannte Intimsphäre hinein betroffen und herausgefordert.“
Diese gesellschaftliche Veränderung bis in die Beziehungen hinein vermißte Wulff im allzu friedlichen Freiburg, so daß er bald wieder zurück nach Vietnam ging. Auf dem Vietnamkongreß in Westberlin resultierte daraus u.a. für den Schriftsteller Peter Weiß die Forderung: „Unsere Ansichten müssen praktisch werden, unser Handeln wirksam. Dieses Handeln muß zur Sabotage führen, wo immer sie möglich ist. Dies fordert persönliche Entscheidungen. Dies verändert unser privates, individuelles Leben.“ – Bis schließlich eine gemeinsame „Front“ entsteht.
Die internationale Studentenbewegung mußte dabei einen ähnlichen Weg wie die südvietnamesischen Partisanen vollziehen. So erzählte z.B. Quyet Thang, ein Bauer, der erst Partisanenführer in der Provinz Tay Ninh wurde und dann Regimentskommandeur der regulären Truppen der Befreiungsarmee: „Bis Ende 1959 wurde unsere ‚Linie‘ ausschließlich vom Gedanken eines legalen, politischen Kampfes ohne Gewalt bestimmt“. Aber die südvietnamesischen Truppen terrorisierten die Dörfler dermaßen, dass sie irgendwann vor der Entscheidung standen: „Aufstand oder Tod“. Anfang 1960 unternahmen sie ihre erste „Selbstverteidigungsaktion“: mit einem alten Gewehr, mehreren selbstgebastelten Minen aus Bambusrohre, die sie mit Karbid und Wasser füllten, und einigen Megaphonen überfielen sie nachts einen kleinen Militärstützpunkt der Regierung, nachdem die Frauen auf dem Markt das Gerücht verbreitet hatten, starke Vietkong-Einheiten seien mit schweren Waffen in der Nähe ihres Dorfes gesehen worden. Das gezielt ausgestreute Gerücht im Dienste des Befreiungskampfes kennt man auch aus Weissrussland: Wenn dort ein Partisan durchs Dorf kam, erzählten die Bäuerinnen den Deutschen, es seien tausende gewesen, und wenn es tausende waren, sagten sie, es wären nur zwei, drei gewesen. Im Stützpunkt Phu My Hung funktionierte das Gerücht so gut, dass die Soldaten dort völlig eingeschüchtert waren und beim Angriff keinen einzigen Schuß abgaben. Zur Warnung an die anderen erschossen die Partisanen einen besonders brutalen Distriktchef. Das hatte laut Quyet Tang eine durchschlagende Wirkung: „In allen umliegenden Dörfern stellten sie ihr Treiben ein, und der schlimmste Terror hatte beinahe über Nacht ein Ende gefunden.“ Damit war die Linie der Gewaltlosigkeit verlassen.
Als nächstes bereitete sich diese Partisanengruppe darauf vor, das Fort Tua Hai, in dem 2000 Soldaten stationiert waren, anzugreifen, vor allem um sich dort Waffen zu beschaffen. Für diese Aktion bekamen sie bereits 260 vor allem junge Kämpfer zusammen, die mit insgesamt 170 alten Gewehren und etlichen selbstgebauten Granaten ausgerüstet wurden. Zum Abtransport der Beute wurden 500 Bauern aus entfernt gelegenen Dörfern mobilisiert. Außerdem hatten sie Flugblätter vorbereitet, die mit „Die Selbstverteidigungskräfte des Volkes“ unterschrieben waren. Der Überfall gelang und die Partisanen erbeuteten 1000 z.T. automatische Waffen, außerdem schlossen sich ihnen etliche Soldaten an, die beim Wegtragen der Beute halfen. Zehn Kämpfer fanden bei dieser Aktion den Tod, zwölf wurden verwundet. Auf ähnliche Weise wurden in der Folgezeit dann viele Aktionen durchgeführt. Aber Ende 1961 griffen die USA, unter anderem mit Hubschraubern, in die Kämpfe ein – und es mußten andere Taktiken entwickelt werden.
Den Bericht von Quyet Thang habe ich dem Buch „Partisanen contra Generale“ von Wilfred G. Burchett entnommen, ein australischer Journalist, der ab 1964 Südvietnam bereiste, sein Buch erschien 1967 im Verlag Volk und Welt. Die DDR bildete mit der UDSSR und China eine immer stärkere „Anlehnungsmacht“ für die Nordvietnamesen und die südvietnamesische Befreiungsbewegung – und unternahm enorme Anstrengungen, um sie zu unterstützen. Dazu erschien kürzlich ein Buch von zwei ADN- und N.D.-Korrespondenten in Hanoi zwischen 1967 bis 1970: „Sieg in Saigon“. Die Autoren Irene und Gerhard Feldbauer reden dabei von einer geglückten sozialistischen Wiedervereinigung in Vietnam, die sie in gewisser Weise einer unglücklichen kapitalistischen in Deutschland gegenüberstellen. Dem sozialistischen Block als Anlehnungsmacht traten die USA und u.a. die BRD als Bündnispartner der südvietnamesischen Regierung entgegen. Zuletzt kämpften die Amerikaner jedoch fast alleine gegen den Norden und den Vietkong. Die Guerilla wurde währenddessen mit dem südvietnamesischen Volk fast identisch. Anfänglich war es noch laut Mao Tse Tung darum gegangen, dass der Revolutionär sich in den Volksmassen wie ein Fisch im Wasser bewegen müsse. Die amerikanischen Militärstrategen blieben in diesem Bild und versuchten, „den Teich auszutrocknen, um die Fische darin zu fangen“.
Dazu griffen sie u.a. auf die im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen in Russland erprobten Maßnahmen zurück: auf Wehrdörfer, Tote Zonen, Verbrannte Erde-Aktionen und auf die Rekrutierung z.B. von partisanengeschulten Kosaken, die nun als Partisanenbekämpfungs-Truppen eingesetzt wurden (u.a. die Green Berets). Bald war auch für sie jeder Vietnamese ein Vietkong, was in gewisser Weise sogar eine Erleichterung darstellte, weil es die quälende Unsicherheit der Soldaten im Einsatz beseitigte, wie der amerikanische Autor Jonathan Neale in seinem 2004 veröffentlichten Buch über „Den amerikanischen Krieg in Vietnam“ meint: Wen immer die Soldaten töteten – es war der richtige! Von der anderen Seite aus hat Erich Wulff diese Entwicklung beschrieben: Am Anfang war der „Vietkong“ fast ein Phantom, aber nach und nach nahmen immer mehr Leute aus seiner Umgebung in Hué Kontakt mit der Befreiungsfront auf, die irgendwo „da draußen“ auf dem Land bzw. im Dschungel war. Sie „beschafften Informationen oder transportierten Medikamente ins Maquis“. Die „befreite Zone“ war bald nur noch 10 Kilometer von Hué entfernt. „Das Maquis war nicht mehr, wie 1964, ein Kuriosum, wo man seine Neugierde befriedigte. Es wurde immer mehr zum geistigen, politischen und organisatorischen Zentrum für die Orientierung der Menschen in der Stadt“.
In Vietnam gibt es eine Reihe von kleinen Bergvölkern, die u.a. von der Jagd leben. Sie verließen als erste die ‚Linie‘ der Gewaltlosigkeit, woraufhin die Regierungstruppen sie mit Vernichtungsfeldzügen überzog. Die Dörfler wehrten sich mit alterprobten Mitteln: Bodenfallen, die mit Bambusspießen gespickt waren, Fallstricke, die Steinlawinen auslösten, an Seilen schwingende „Morgensterne“ und vergiftete oder brennende Pfeile, die von einer Armbrust abgeschossen wurden. Auch Bienen kamen zum Einsatz: Dazu wurden einige Stöcke am Wegrand aufgestellt und die Ausflugslöcher mit Papierstückchen zugeklebt, von denen Fäden über den Weg führten. Wurden diese von Soldaten zerrisen, kamen die Bienen frei und stürzten sich wütend auf sie. Daneben lernten die Kämpfer, die Pflanzen, Insekten und Großtiere des Waldes zu Heilzwecken zu nutzen. Zu den aufständischen Bergvölkern gesellten sich die Buddhisten, die ebenfalls von der Regierung verfolgt wurden sowie die Reste einiger Sekten, die untergetaucht waren und sich zu kriminellen Banden gewandelt hatten. Zusammen mit den Partisaneneinheiten bildeten sie bald eine „Nationale Front“, aus den bewaffneten Sekten entstand die Keimform einer „regulären Armee“, die Führung blieb jedoch bei den Bauern, die sich zu wahren Herren auf dem Land aufschwangen – immer mehr Dörfer schlossen sich zu „befreiten Gebieten“ zusammen. Selbst Stützpunkte der Regierung zur Kontrolle bestimmter Abschnitte waren in Wirklichkeit umzingelt vom Vietkong, der darüber entschied, welche Versorgungsgüter zu den Soldaten gelangen durften und welche nicht. Bei den Soldaten handelte es sich zumeist um zum Wehrdienst gezwungene junge Bauern, die die Partisanen auf diese Weise langsam für sich gewinnen wollten, mindestens wollten sie Informationen über bevorstehende Angriffe, Truppenverlegungen usw. von ihnen bekommen. Dies nannte man eine Politik des „Zukorkens“ feindlicher Posten. Ähnlich war es bei den „strategischen Dörfern“, in die man die Bauern reinzwang, vorher wurden ihre alten Dörfer zerstört bzw. zerbombt, ihre Gärten und Reisfelder vergiftet. 16.000 solcher „Wehrdörfer“ wollte die Diem-Regierung errichten, es wurden aber nur einige tausend – und selbst unter diesen befanden sich bald viele in Wahrheit ganz oder zumindestens nachts in den Händen des Vietkong. In den Städten, wo nicht demonstriert werden durfte, benutzten die Propagandatrupps der Nationalen Front Affen, denen sie Hemden überzogen, auf denen Parolen standen. Die so ausstaffierten Tiere, manchmal kamen auch Hunde zum Einsatz, wurden dann auf den Marktplätzen freigelassen.
Immer wieder waren Partisanengruppen gezwungen, buchstäblich in den Untergrund auszuweichen oder sich zumindestens darauf vorzubereiten: Das war im hussitischen Tabor der Fall, aber auch im Zweiten Weltkrieg in Odessa sowie bei den Aufständen in Warschau und Paris. In Vietnam gruben sich die Bauern weitverzweigte „Tunnelsysteme“, mit denen Dörfer und ganze Bezirke verbunden wurden und die teilweise sogar bis unter die Stützpunkte der Regierungstruppen führten. Wie ein Sprecher der Nationalen Befreiungsfront meinte, „war das Land gleich einem an Masern Erkrankten mit Militärstützpunkten und Forts übersät, aber das Regime hatte keinen Stützpunkt im Herzen des Volkes – ganz im Gegensatz zur Befreiungsfront“. Es gibt dafür fast ein Partisanengesetz: „Der Unterschied in der Feuerkraft wird durch den Unterschied in der Moral aufgehoben“.
Die großenteils gepressten Soldaten reagierten darauf, auch in anderen, ähnlichen Volksaufständen war das so, mit „Kriegsneurosen“, d.h. mit so schwerwiegenden Krankheitssymptomen, dass sie von weiteren Fronteinsätzen verschont blieben. Henry Kissinger schreibt in seinen Memoiren, die Antikriegsdemonstrationen und die internationale Solidarität mit den Vietnamesen führten dazu, dass Washington mehr und mehr „den Charakter einer belagerten Stadt“ annahm…“das gesamte Regierungsgefüge fiel auseinander. Die Exekutive litt unter einer Kriegsneurose.“ Ähnliches kann man im übrigen auch von der deutschen Sozialdemokratie sagen: Während der Kanzler Willy Brandt sich weigerte, irgendetwas auch nur Nachdenkliches über Vietnam zu Protokoll zu geben, demonstrierte Gerhard Schröder als Juso „Ho Ho Ho Chi Minh“-rufend auf der Göttinger Roten Straßer rauf und runter, wie einer der vietnamesischen „Boat-People“ noch 2001 in Westberlin auf einer Veranstaltung bitter bemerkte.
Bereits Ende 1964 übte die Befreiungsfront faktisch die Regierungsgewalt in Südvietnam aus: Es gab Ausschüsse für das Gesundheitswesen, Volksbildung, Post- und Fernmeldewesen, für Wirtschafts- und für Auswärtige Angelegenheiten – mit Vertretungen in Havanna, Kairo, Algier, Prag und Ostberlin, und eine eigene Nachrichtenagentur. Dazu kamen bald noch hunderte von Filmteams, die bei fast allen Aktionen dabei waren. Am Ende des Krieges hinterließen sie hunderte von Dokumentarfilme und mehrere Millionen Meter ungeschnittenes Material, das von dem zum vietnamesischen Militär gehörenden Film-Institut verwaltet wird. Neuerdings kooperiert es bei der Auswertung mit der deutschen DEFA-Stiftung.
Ende 1965 befand sich der Psychiater Erich Wulff in Saigon: „Die amerikanischen Beamten, die deutschen Soldaten, die meisten Journalisten, die ich kannte, schwammen während dieser Zeit auf einer Woge von rosigem Optimismus. Sie sahen täglich neue Hubschrauber und neue Soldaten ins Land strömen und waren vom schieren Gewicht und von der augenscheinlichen Perfektion der amerikanischen Militärmaschinerie geradezu hingerissen.“ Sogar die Distrikt- und Provinzchef waren bald Amerikaner. Auch einer der Kommandeure der Befreiungsfront, Truong Ky, bemerkte um diese Zeit: „Jetzt geht die Tendenz dahin, dass die Operationen eine rein amerikanische Angelegenheit werden.“ Er war jedoch ebenfalls optimistisch: „Auch das wird nicht klappen, denn die Amerikaner sind in dem Widerspruch zwischen ihren ‚Vernichtungs-‚ und ‚Befriedigungs‘-Projekten verstrickt, die die beiden Hauptlinien ihrer militärpolitischen Strategie ausmachen“. Hinzu käme noch, laut Truong Ky, dass sie sich sowohl in der Planung als auch im Kampf einem „Subjektivismus“ hingäben, der sie dazu verleite, ihre eigene Stärke ständig zu überschätzen und die der Befreiungsfront zu unterschätzen. Das führte zu immer unwirklicheren Statistiken bzw. Zahlenspielen, „Body-Count“ oder „Kill-Rate“ genannt, und zu absurden Verlautbarungen: So erklärte z.B der diensthabende Offizier eines Einsatzes gegen Ben Tre im Mekongdelta der internationalen Presse: „Um die Stadt zu retten, mussten wir sie zerstören!“
Dann kam im Januar die Tet-Offensive – und es wurde allen klar, dass der amerikanische Krieg in Vietnam nicht mehr zu gewinnen war. Jonathan Neale schreibt: „Dennoch erlitten die Guerillos eine vernichtende Niederlage. Sie hatten erwartet, dass Saigon und Hue sich erhöben. Dazu kam es nicht.“ Der für den kommunistischen Untergrund in Saigon verantwortliche Tran Bach Dong erklärte später, warum: Ihre Mitgliedergewinnung war „wunderbar erfolgreich“ – bei den Intellektuellen, Studenten, Buddhisten, bei allen – nur bei den Arbeitern nicht, wo der Organisationsgrad „schlechter als schlecht“ war. Das lag nicht nur an der Konzentration der Partei auf die Organisierung der Bauern, die die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung bildeten, sondern auch an der amerikanischen Militärstrategie, die mit ihren Bombardements und Entlaubungsaktionen eine wachsende Zahl von Flüchtlingen produzierte, die in die Städte drängten und dort bei den Amerikanern oder in ihren Vergnügungsbezirken Arbeit fanden. Das war auch gewollt: Man sprach in diesem Zusammenhang offziell von einem in Vietnam längst überfälligen „Urbanisierungs-Prozeß“ und hoffte, die Bauern auf diese Weise wenn schon nicht an sich zu binden, dann wenigstens „lumpenproletarisch“ zu neutralisieren. Laut Jonathan Neale gelang dies aber auch deswegen z.T., weil die Befreiungsbewegung die städtischen Arbeiter nur halbherzig gegen ihre Chefs mobilisieren konnten, um nicht die „Unterstützung der Geschäftsleute und Manager dort zu verlieren“. Nichtsdestotrotz: „Während die Guerilleros nach Tet ausbluteten, wurde in Amerika die Entscheidung getroffen, den Krieg zu beenden.“ Insofern war die Tet-Offensive Höhepunkt und damit der Anfang vom Ende des vietnamesischen Befreiungskampfes, der offiziell jedoch erst 1975 mit der Einnahme von Saigon endete. Kurz zuvor hatten die Nordvietnamesen zwei kleinere Offensiven bei Hué eingeleitet, woraufhin den Regierungstruppen befohlen wurde, sich zurückzuziehen. Auf diesem Rückzug brach die südvietnamesische Wehrpflichtigenarmee auseinander – „sie war moralisch am Ende“.
Nach dem Sieg konnten die Kommunisten daran gehen, das Land wieder aufzubauen und vor allem zu industrialisieren. Dies ging jedoch nur auf dem Rücken der Bauern sozusagen, die mit ihren Agrarprodukten eine „ursprüngliche sozialistische Akkumulation“ ermöglichen sollten. Wenn man sie jedoch dafür höher besteuern wollte, reduzierten sie die Anbauflächen. Also versuchte man sie in Kooperativen bzw. Kolchosen zusammen zu fassen, aber sie weigerten sich. Im Dorf Binh My, schreibt Jonathan Neale, „übten die Parteikader unablässig Druck aus. Einige suchten sie 20 mal auf, erzählte ein Kader, so häufig, dass der Haushund sie inzwischen kannte und nicht mehr bellte.“ Im Mekongdelta bei Ben Tre errichteten die Kommunisten eine Vorzeigekooperative, aber die Bauern brannten sie nieder. Im Jahr 1987 gab die Regierung ihre Niederlage zu, es war ihr nicht einmal gelungen, die Kontrolle über den Reishandel zu erlangen. Aufgrund ihres langen Befreiungskampfes, erst gegen die Franzosen, dann gegen die Japaner und schließlich gegen die Amerikaner, waren die vietnamesischen Bauern außerordentlich selbstbewußt geworden. Als dann noch China seine Wirtschaftshilfe einstellte, sowie 1989 auch noch die Sowjetunion, führte die Regierung offiziell den „Neuen Wandel“ – Doi Moi – ein, d.h. die Martkwirtschaft unter ihrer Führung. Vietnam entwickelte sich dabei zum drittgrößten Reisexporteur der Welt. Dies hatte jedoch zur Folge, dass sich immer mehr Bauern verschuldeten, dass die ärmsten ihr Land verkauften. Aus ehemaligen Kooperativvorsitzenden wurden reiche Bauern, die anfingen, Landarbeiter zu beschäftigen. Es begann mithin das, was man in Mitteleuropa bis heute „Bauernlegen“ nennt, also ein Konzentrationsprozeß in der Landwirtschaft, der nun erneut mit einer „Urbanisierung“ einhergeht.
Die Linke hatte sich schon lange vorher, spätestens nach dem Sieg der Befreiungsbewegung in Saigon 1975 von den vietnamesischen Partisanen abgewendet – und diese waren danach ja auch – wenn sie nicht wieder Bauern wurden – Regierungsbeamte bzw. Funktionäre geworden. In Norwegen, wo ebenfalls ein erfolgreicher Partisanenkrieg (gegen die Deutschen) geführt wurde und die Solidarität mit Vietnam sehr verbreitet war, veröffentlichte der Schriftsteller Johan Harstadt 2004 eine Erzählung, die „Vietnam. Donnerstag“ betitelt ist. Darin heißt es an einer Stelle: „Er“ verbindet mit dem Wort Vietnam „Reisfelder, Dschungel, Hubschrauber“. Sie dagegen sagt: „Vietnam steht für alles, was schief gegangen ist“.
1967 wollte Thomas Brasch in der Ostberliner Volksbühne einen „Vietnamkongreß“ veranstalten: „Seht auf dieses Land“, titelte er dafür. Der Kongreß wurde aber nicht erlaubt. 30 Jahre nach Beendigung des Krieges, hat die Volksbühne jedoch seine Idee wieder aufgegriffen – und veranstaltete am 16. Oktober 2005 einen „Vietnam Tag“, wobei sie sich u.a. für die vietnamesischen Opfer des militärischen Einsatzes von Entlaubungsgiften einsetzen will. In den letzten Jahren gab es mehrere Initiativen von Vietnamesen, die durch den Einsatz von Agent Orange bei der Bombardierung ihres Landes gesundheitlich geschädigt wurden. Im Februar 2004 z.B. eine Sammelklage von 100 „Agent Orange“-Opfern gegen 37 US-Firmen, die der Armee das Dioxin geliefert hatten, darunter „Monsanto“ und die US-Tochter von Bayer „Mobay“. Zuvor hatte bereits der US-Anwalt Ed Fagon eine Klage gegen Bayer im Namen einiger südafrikanischer Dioxin-Opfer angestrengt, wobei es zu einem Vergleich gekommen war. Und der US-Anwalt Kenneth Feinberg hatte mehrere Klagen von US-Soldaten betreut, die dem Einsatz von Dioxin im Vietnamkrieg ausgesetzt gewesen waren. Im März 2005 verklagte der Bauingenieur Ngoc einige Dioxin-Hersteller vor dem US-Bundesgericht in Brooklyn: Seine Schwester war verkrüppelt zur Welt gekommen, nachdem ihr Vater mit Agent Orange in Kontakt gekommen war. In der Schweiz unterstützten 49 Parlamentarier diese Klagen, sie verlangten vom Bundesrat, auf die US-Regierung einzuwirken, damit die vietnamesischen Agent-Orange-Opfer endlich entschädigt würden. Nun gibt es eine weitere flankierende Maßnahme dazu – im Internet und aus Vietnam selbst. Sie nennt sich „Justice for Victims of Agent Orange“. Verfaßt wurde sie von Len Aldis – im Namen der „Englisch-Vietnamesischen Freundschaftsgesellschaft“, aber unterschrieben haben bisher vor allem Vietnamesen – bis jetzt 690933. Dahinter steht die Anfang 2004 gegründete Hilfsorganisation VAVA: „Viet Nam’s Association for Victims of Agent Orange“ – und ihr Vorsitzender Dang Vu Hiep. Die VAVA arbeitet mit den US-Veterans for Peace, dem amerikanischen Roten Kreuz und dem „Fund for Reconciliation and Development“ zusammen, um die Lebensbedingungen für Dioxin-Opfer in Vietnam zu verbessern. Die vietnamesische Botschaft in den USA erklärt dazu, dass etwa 3 Millionen Vietnamesen an den Spätfolgen des Agent-Orange-Einsatzes leiden. Zwischen 1961 und 1971 versprühten die Amerikaner 80 Millionen Liter giftige Chemikalien über Vietnam. Noch 1985 hatte der US-Wissenschaftler Alwin Young dazu auf einem „Dioxin-Kongreß“ in Bayreuth erklärt: „Der Dioxin-Einsatz hat niemandem geschadet!“
Nach dem Besuch des „Vietnam-Kongresses“ in der Volksbühne nahmen sich einige Freunde von mir vor: „Nächstes Jahr machen wir in Vietnam Urlaub.“ So hatte man sich die mobilisierende Wirkung dieser Veranstaltung eigentlich nicht vorgestellt! Aber solche Privatinteressen haben jetzt Vorrang. Auf dem 1. Vietnam-Kongreß, der 1968, wenige Wochen nach der Tet-Offensive in Westberlin stattfand, war es noch darum gegangen, zwischen Saigon und Berlin eine Front zu bilden – durch In- und Extensivierung der Kämpfe hier. Dort siegten 1975 zwar die Kommunisten, hier übernahm jedoch 1990 die westdeutsche Treuhandanstalt das Regime, politisch flankiert ausgerechnet von West-„68ern“, die sich dazu allerdings zu Menschenrechtlern, Pluralismusverfechtern und geharnischten Antistalinisten gewendet hatten, und nun von „asymetrischen Kriegen“, „Terror auf beiden Seiten“ und dem „Stalinisten Ho Chi Minh“ sprachen: Auch auf dem Vietnam-Kongreß der Volksbühne. Dieser fand erstmalig unter großer Beteiligung der Vietnamesen selbst statt.
Man hätte also gut und gerne das Problem, dass jetzt statt harter Strategien und Klassenkämpfe eher weiche Diskurse und Kompromisse bevorzugt werden, auch miteinander besprechen können – mindestens im Hinblick darauf, was dies für die Einschätzung des vietnamesischen Befreiungskampfes und seiner Resultate bis heute bedeutet. Und das um so mehr, da es bereits im Vorfeld der Volksbühnenveranstaltung diesbezüglich zu Konflikten gekommen war: Zuerst störten sich einige teilnehmende vietnamesische Initiativen am Blumenarrangement im Foyer, das die nord- und die südvietnamesische Fahne zeigen sollte. Die in West und Ost-Berlin lebenden Vietnamesen sind wahrscheinlich die einzige ausländische Minderheit, die sich 1989 nicht wiedervereinigte: im Westen lebten kurz gesagt die Boat-People (Flüchtlinge) und im Osten der Vietkong (Vertragsarbeiter). Diesen Umstand wollte die Volksbühne „thematisieren“ – natürlich von vietnamesischen Blumenkünstlern gestaltet. Die Gründerin des vietnamesischen Selbsthilfevereins „Reistrommel“ in Marzahn, Tamara Hentschel, zog daraufhin ihre Teilnahme zurück: Das Arrangement sei so geschmacklos, als würde man neben eine BRD-Fahne eine Nazi-Flagge hängen. Die Tanzgruppe ihres Vereins wollte trotzdem mitmachen. Hier waren es dann aber zwei Eltern, die ihren Kindern das verwehrten – vor allem, weil die Volksbühne dann nicht nur die Menschenrechtlerin Kim Phuc einlud (sie war einmal von der Illustrierten stern „gerettet“ worden, nach einem Napalm-Angriff der Amis auf ihr Dorf, bei dem sie schwer verwundet worden war – und ihr Schicksal hatte damals Millionen gerührt, wie man so sagt, nun war sie jedoch, in Kanada lebend, zu einer engagierten Antikommunistin geworden). Daneben wollte man auch noch mit Bui Tin diskutieren, den in Paris lebenden und heute bekanntesten vietnamesischen Regimegegner. Damit machte die Volksbühne der vietnamesischen Botschaft in Berlin keine Freude – und auch vielen in Ostberlin lebenden Vietnamesen nicht, die sogar von Radio Multikulti nichts hören wollen: „Das ist doch der Sender, der Ho Chi Minh so schlecht gemacht hat!“
Nach Bui Tins Auftritt kam es zu Beschimpfungen – zwischen seinen Fans und seinen Gegnern. Ähnliches geschah auch nach Jürgen Kuttners Rederunde, in der die prokommunistischen Ostler sich anschließend mit den antikommunistischen Westlern stritten. So war das auch von Kuttner „angedacht“ worden, der den Dissenz sucht. Den eher nach Harmonie strebenden Vietnamesen stößt eine Inszenierung desselben jedoch eher ab. Vielleicht sollte man beim nächsten Vietnam-Kongreß darauf dringen, dass sie die Formen der Auseinandersetzung planen. Viele der jungen, hier aufgewachsenen Vietnamesen schienen mir jedoch großen Gefallen gerade an dieser „Culture of Clash“ gefunden zu haben – und ihre eigenen Beiträge, z.B. ein Film von und mit einigen Schülerinnen, gehörten dann auch mit zu den besten Programmpunkten der 13stündigen Veranstaltung. Man kommt sich also doch von Mal zu Mal näher – aber nur gleichsam zwangsläufig – über die Generationenfolge. Wie nahe man sich jedoch damals im Kleinkrieg gekommen war, blieb unerörtert.
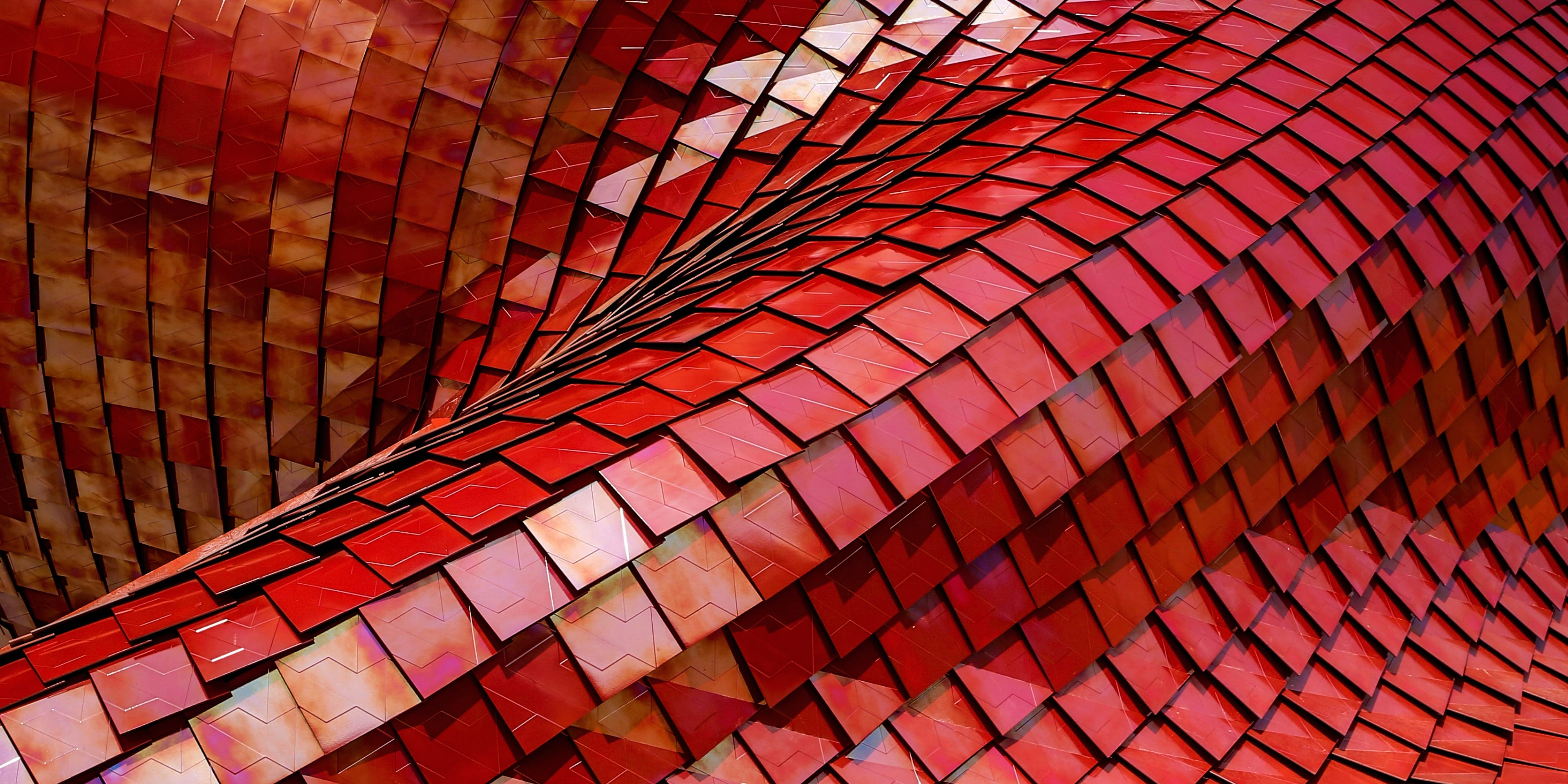



Auf „marx21.de“ fand ich jetzt einen Rückblick auf die vom SDS übernommene Formel aus Lateinamerika: „Schafft 1,2,3, viele Vietnam!“
Der SDS begnügte sich nicht, wie andere Teile der Friedensbewegung, mit der Forderung nach einem „sofortigem Kriegsende“ und dem Abzug der US-Truppen aus Vietnam, sondern unterstützte den Befreiungskampf mit dem Ziel des „Sieges des Vietcong“. In der Schlussresolution des Frankfurter SDS-Kongresses „Vietnam – Analyse eines Exempels“ (Mai 1966) wurde der Krieg gegen die USA in Vietnam als „Befreiungskampf“ und zugleich als „Akt politischer Notwehr“ definiert. In einem möglichen Sieg der FNL sah der Kongress den Beweis für die Befreiungsmöglichkeiten auch anderer Emanzipationsbewegungen. Diese Vorstellung hatte Che Guevara 1966 in der Parole „Schafft zwei, drei … viele Vietnam“ formuliert.
Der SDS bestimmte den abstrakten Aufruf zum „Frieden“ als konkrete, praktische Aufgabe: Der Weg zum Frieden führt über die Niederlage der USA in Vietnam, die vorangebracht wird durch weltweite Erhebungen gegen den Imperialismus, der die Verantwortung trägt für das Elend der Dritten Welt, aber auch für die durch Atomkriege drohende Selbstzerstörung der Menschheit. Die antiimperialistische Orientierung des SDS bedeutete darüber hinaus, dass der Krieg als politischer Ausdruck einer spätkapitalistischen Ökonomie begriffen wurde. Daher wurde die Forderung nach Beendigung des Krieges mit der Perspektive des Sturzes des Kapitalismus verbunden.
Die Dialektik des nationalen Befreiungskampfes der Vietnamesen und der Antikriegsbewegung in den Metropolen war von entscheidender Bedeutung für den weiteren Verlauf des Krieges. In dem Maße, wie die mächtigste Militärmacht der Welt geschwächt wurde und schließlich sogar in Form von Meutereien, Offiziersmorden und massenhafter Desertion Auflösungserscheinungen zeigte, wuchs auch das Selbstbewusstsein der neu entstehenden sozialistischen Bewegung, die eigenen herrschenden Klassen herauszufordern.
Diese Dialektik war auf dem zweiten, vom SDS organisierten Vietnamkongress in Berlin (Februar 1968) offensichtlich geworden. Tariq Ali, damaliger Sprecher der britischen Studentenbewegung, beschreibt die Stimmung des Kongresses in seiner Autobiographie eindrucksvoll: „Die FNL hatte einen neuen Militärangriff in Südvietnam gestartet, um am vietnamesischen Neujahrstag (Tet) ein Zeichen zu setzen. Die Tet-Offensive hatte gerade begonnen, als wir die Eröffnung des Kongresses vorbereiteten. Jeder neue Sieg wurde dem Kongress unter immer stärkerem Beifall gemeldet. Die Vietnamesen führten auf die konkretest vorstellbare Weise vor, dass es möglich war, zu kämpfen und zu siegen. Die Tatsache hatte entscheidende Auswirkungen auf die Bewusstseinsbildung unserer Generation. Wir glaubten, dass eine Änderung nicht nur notwendig, sondern auch möglich war.“ An anderer Stelle schreibt Ali: „Wenn ein überwiegend von der Landwirtschaft geprägtes Land der mächtigsten Nation der Welt Widerstand leisten konnte, dann kann eine entschlossene Arbeiterklasse in Frankreich oder Italien ihre eigene Bourgeoisie aus ihrer Stellung vertreiben.“
Die Dialektik der Befreiungskämpfe bestätigte sich in den nachfolgenden Entwicklungen – vom französischen Mai 1968, über die Zunahme der Klassenkämpfe in vielen Ländern Lateinamerikas und Europas, in den USA in der Radikalisierung der Bewegung der Schwarzen, aber auch der Schwulen, in der Stärkung des Widerstands gegen die Apartheidregime in Afrika, bis zur Loslösung der portugiesischen Kolonien in Afrika und der Aprilrevolution in Portugal selbst.
Zwar gelang es nirgends, „die eigene Bourgeoisie aus der Stellung zu vertreiben“, aber die Herrschenden hatten weltweit zeitweilig die Initiative verloren. Deutlichster Ausdruck war das so genannte „Vietnamsyndrom“ in den USA. Die mächtigste Macht im imperialistischen System war gelähmt. Lange Zeit wagte sie es nicht, direkt militärisch zur Aufrechterhaltung des Einflusses des amerikanischen Kapitals einzugreifen.
Die US-Truppen im Irak und die NATO-Truppen in Afghanistan stecken heute in einer ähnlichen Situation wie die Amerikaner in Vietnam. Sie treffen auf wachsenden bewaffneten Widerstand, der ohne die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung nicht möglich wäre. Die beste Militärtechnologie, mehr Truppen, mehr Bomben, aber auch zivil-militärische Projekte bringen keinen Erfolg. Aller offiziellen Propaganda zum Trotz – diese Interventionskriege sind nicht zu gewinnen. Und die Antwort der Herrschenden bleibt die gleiche wie vor 40 Jahren: verstärkt weiter so.
Trotzdem hat sich die Dialektik der Befreiungskämpfe zwischen dem Widerstand gegen die Besatzung und den Bewegungen in den Metropolen bisher noch nicht entfaltet.
Beim Weltsozialforum 2004 sagte Arundhati Roy, eine bekannte indische Sprecherin der Bewegungen gegen den Neoliberalismus: „Es war herrlich, als am 15. Februar vorigen Jahres (…) zehn Millionen Menschen auf fünf Kontinenten gegen den Krieg in Irak marschierten. Es war wunderbar. Es war nicht genug. Feiertagsproteste stoppen keine Kriege. (…) Wir müssen reale Ziele ins Visier nehmen, direkte Schläge gegen den ökonomischen Unterbau des Imperialismus. (…) Wenn alle von uns wirklich gegen Imperialismus und gegen das Projekt des Neoliberalismus sind, dann lasst uns den Blick auf Irak werfen. Irak ist die unvermeidliche Kulmination von beidem. (…) Wir (die Bewegung gegen den Neoliberalismus) müssen der globale Widerstand gegen die Besatzung werden.“
Roys Forderung nach der Verbindung von anti-imperialistischen und sozialem Widerstand stieß, insbesondere in Deutschland, in der globalisierungskritischen und Anti-Kriegsbewegung auf heftigen Widerspruch. Man könne nicht nach dem Motto handeln „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“.
Die Ablehnung der Solidarität mit dem anti-imperialistischen Widerstand gegen Besatzung kommt auch und gerade von Linken, die vor 40 Jahren den bewaffneten Kampf der vietnamesischen FNL enthusiastisch unterstützt hatten. Das ist nur zu verstehen, wenn man die tiefe Enttäuschung vieler 68er über die Entwicklungen in Vietnam und Kambodscha nach dem Sieg der Befreiungsfront nachvollzieht. Besonders schlimm war die Erfahrung mit dem Pol Pot-Regime in Kambodscha, das Millionen Menschen zu Grunde gehen ließ und ethnische Minderheiten ermordete. Aber auch die Entwicklungen in Vietnam und China enttäuschten die Hoffnungen.
Die Tiefe der Enttäuschung ist eine Reaktion auf eine große Illusion in der 68er Bewegung, die nicht aufgearbeitet wurde: die Überhöhung nationaler Befreiungsbewegungen zur sozialen Revolution. Viele Linke hofften, dass mit dem Sieg der Befreiungsbewegungen Gesellschaften mit einer sozialistischen Demokratie und ohne Ausbeutung entstehen würden. So war Rudi Dutschke überzeugt, dass in China die erkämpfte nationale Unabhängigkeit eine „sozial-ökonomische“ war, „die den Sprung vom Reich der imperialistischen Exploitation ins Reich der sozialistischen Armut“ geschafft habe, und dass „die sozialistische Armut der Ausgangspunkt einer wirklichen Bedürfnisbefriedigung der Massen Chinas“ sei.
Nach dem Sieg der chinesischen Volksbefreiungsarmee und der Befreiung vom japanischen Imperialismus gab es unzweifelhaft Verbesserungen für die Masse der Bevölkerung – sie litt nicht mehr unter immer wiederkehrenden Hungersnöten, Bildung und Gesundheitssorge wurden erstmals für Abermillionen möglich. Das oberste Ziel der kommunistischen Partei war aber, China zu einem mächtigen Industrieland zu entwickeln. Das hieß die nachholende Akkumulation von Reichtum. Der Masse der Bauern musste dafür verschärft das Mehrprodukt abgepresst werden, die Arbeiter mussten verschärft ausgebeutet werden. Das war nicht ohne die Unterdrückung der Produzenten möglich.
Die den nationalen Befreiungskampf anführenden kommunistischen Parteien in China und Vietnam wollten die imperialistische durch die nationale Exploitation ersetzen, nicht den Wunsch der kleinen Bauern nach einer wirklichen Landreform erfüllen und nicht die Selbstbefreiung der Arbeiterklasse fördern. Sie waren nur dem Namen nach kommunistische bzw. sozialistische Organisationen.
Die Enttäuschung über die eigenen Illusionen führte dazu, dass das Kind sprichwörtlich mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Eine verbreitete Schlussfolgerung ist: anti-imperialistische Bewegungen, die nicht von vornherein echte sozialistische Bewegungen sind, nicht unter der „richtigen“ Führung stehen oder gar unter einer Führung, die einer reaktionären Utopie anhängt, verdienen nicht die Solidarität von Menschen, die eine freie, sozial gerechtere Gesellschaft wollen.
Diese Reaktion ist nicht nur überheblich, sie ist auch fatal: Denn damit wird die Erkenntnis des SDS, dass anti-imperialistische Befreiungsbewegungen ein wichtiger Bündnispartner für den Kampf in den Metropolen sein können, verschüttet.
Als Linke sollten wir an der Solidarität mit Bewegungen festhalten, die den Imperialismus der großen Kapitalismen schwächen – ohne Bedingungen zu stellen, wie diese Bewegungen zu sein hätten. Auch eine nicht-sozialistische, aber anti-imperialistische nationale Befreiungsbewegung kann den weltweiten, neoliberalen Kapitalismus schwächen und so die Kampfbedingungen der sozialen Bewegungen in den Metropolen gegen die Angriffe der großen Konzerne und ihrer Regierungen verbessern. Allerdings darf man nicht wieder in kritiklose Solidarität verfallen.
Konkret: Linke sollten entschieden und deutlich dafür eintreten, dass der Widerstand gegen die Besatzer im Irak und in Afghanistan, auch der bewaffnete, ein berechtigter Widerstand ist, selbst wenn er von politischen Kräften organisiert wird, die islamistische Ideologien vertreten.
Wir wissen, dass solche Ideen nicht das Ziel der Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung haben und deshalb ihre Versprechen, die Unterdrückung zu beseitigen, nicht verwirklicht werden. Wir wissen, dass individuelle Menschenrechte gering geschätzt werden, dass es keine Vorstellung von Gewerkschaften als unabhängige Organisationen der Arbeiterklasse gibt und die Klassengegensätze mit religiöser Ideologie gekittet und überdeckt werden sollen. Das entspricht nicht unseren Vorstellungen von einer freien, sozial gerechten, besseren Gesellschaft. Die ‚Heilung‘ der gesellschaftlichen Widersprüche durch Religion ist eine rückwärtsgewandte Utopie.
Doch man muss die Tatsache akzeptieren, dass die Masse der Bevölkerung diejenigen unterstützt, die den Widerstand gegen die brutalen Besatzungsregime im Irak bzw. in Afghanistan organisieren. Das geschieht nicht in erster Linie wegen deren islamistischer Ideologie, sondern weil sie eben den Widerstand praktisch organisieren. Die Mehrheit der Bevölkerung will das Ende der Fremdherrschaft, weil sie sich davon ein freieres und besseres Leben erhofft. Wenn es gelänge, die imperialistischen Truppen zum Rückzug zu zwingen und sich dann herausstellt, dass diese Hoffnungen nicht Realität werden, bleiben die Erfahrungen des gemeinsamen, vielfältigen Kampfes bestehen. Sie könnten die Kraft geben, weiter gegen Ausbeutung und Unterdrückung zu kämpfen, wie es die Bauern im südvietnamesischen Mekong-Delta nach Abzug der US-Truppen getan haben und sich erfolgreich gegen die Zwangskollektivierung gewehrt haben.
Wir sollten für den Sieg der irakischen und der afghanischen Bevölkerung gegen die Besatzungstruppen eintreten – für nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Solidarität mit einem berechtigten Kampf gegen imperialistische Besatzung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, ist eine Voraussetzung, dass linke Ideen, Argumente und Kritik überhaupt gehört werden. Die riesigen Demonstrationen gegen den Angriff auf den Irak 2003 in vielen Ländern Europas und in den USA haben der sehr kleinen Linken in den muslimischen Ländern geholfen. Sie konnten zeigen: der Gegensatz besteht zwischen unten und oben, nicht zwischen christlicher und muslimischer Welt; die Grenzen verlaufen zwischen arm und reich, nicht zwischen armen und reichen Ländern.
Bei der Frage, ob nationale Befreiungsbewegungen zu unterstützen sind oder nicht, kann es nicht das Kriterium sein, ob wir den formulierten politischen Zielen einer Bewegung zustimmen können. Es kann nicht das Kriterium sein, ob der Widerstand gegen die Besatzung zu einer wirklich besseren Gesellschaft führt. Aber auch der berechtigte Wunsch nach Selbstbestimmung allein ist kein ausreichendes Kriterium. Das zeigt das Beispiel Kosovo. Der Ruf der „UCK“ nach NATO-Angriffen auf Serbien hat den westlichen Imperialismus gestärkt, den Nationalismus auf dem Balkan verschärft und den Albanern im Kosovo keine Selbstbestimmung gebracht, sondern kolonialistische Verhältnisse.
Für Sozialisten ist das entscheidende Kriterium der Unterstützung, ob diese Bewegungen das von den stärksten Staaten geführte globale Profitsystem schwächen und der grausamen Gesetzmäßigkeit des Imperialismus Einhalt gebieten.
Zu den Autoren: Stefanie Haenisch war seit 1967 im SDS gegen den Vietnamkrieg aktiv. Heute ist sie Mitglied der LINKEN. Dort arbeitet sie im Koordinierungskreis der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik mit. Marwa Al-Radwany wurde im Irak geboren und ist heute Mitglied von DIE LINKE.SDS in Potsdam.
Die der Partei Die Linke nahestehende Junge Welt geht in dieser Logik so weit, dass sie das Schweineregime von Gaddafi gegen die libyschen Rebellen und vor allem gegen die Nato argumentativ verteidigt sowie auch das Regime Assad gegen die syrischen Aufständischen – weil sie Teil des antiimperialistischen schutzwalls sind, dass es dabei um das Revolutionär-Werden von immer mehr Arabern geht, interessiert sie anscheinend nicht – in ihrem Machtblock-Denken.