
Denkmal in Leeuwarden, der Hauptstadt von Westfriesland: ûs mem (unsere Mutter), Statue von Gerhardus Jan Adema, 1954
„Tod eines Milchbauern“, so heißt der letzte Krimi des Biobauern Thomas B. Morgenstern. Er spielt im Kehdinger Land an der Elbmündung bei Stade und dort hat der Autor auch seinen Demeterbetrieb: „Hofgemeinschaft Aschhorn“. Man erfährt in seinem neuen Roman viel über den Milchbauern-Alltag“, während sein Ermittler, der Milchkontrolleur Allmers, die Spuren des Mörders verfolgt. Morgensterns erster Krimi hieß schlicht: „Der Milchkontrolleur“.
„Alle meine Erzählungen spielen im näheren oder weiteren Umfeld des bäuerlichen Lebens. Da fühle ich mich am sichersten, wenn ich Alltägliches beschreiben will. Ich könnte schwerlich einen Roman verfassen, der im Milieu von Krankenhausärzten oder Piloten spielt,“ sagte Morgenstern in einem Interview, das auf seiner Hof-Webpage zu finden ist.
Das Gebiet zwischen Elbemündung und Oste heißt Kehdinger Land, es bewirbt sich selbst als „Krimiland“, nicht weil dort so viele Milchbauern ermordet werden, sondern weil „nirgendwo in Deutschland mehr Krimis und Krimi-Drehbücher“ geschrieben wurden wie hier. „Hier passieren besonders viele Morde – zumindest in der Phantasie. Der Nebel kriecht über die Elbmarsch, weit und breit nichts, nur ein paar schnurgerade Gräben, ab und an kahle Obstbäume in Reih und Glied. Wie Kreuze auf einem Friedhof. Der Tod wartet,“ schreibt die Nordsee-Zeitung. Auf der „Krimiland“-Webpage werden 20 Autoren aufgezählt, die alle am 2,5 Kilometer langen Rönndeich oder unweit davon leben. Unter der Überschrift „Krimistraße mit starkem Echo“ heißt es dort: Vorläufer des Projekts „Krimiland Kehdingen – Oste“ war eine Website mit dem Titel „Deutsche Krimistraße“ (German Crime-Novel-Route) , die auf die literarische Fruchtbarkeit der Region rund um den Rönndeich in Drochtersen-Hüll aufmerksam machen und für die dort entstandenen Regionalkrimis werben will. Das außergewöhnlich starke überregionale Echo hat dazu ermutigt, das Konzept „Krimiland“ zu entwickeln – eine Chance, den Raum Kehdingen auch wirtschaftlich zu beleben, wie es unter anderem im Landkreis Daun in der Eifel gelungen ist. (Dort lebt und schreibt der Krimiautor Jacques Berndorf dessen neuester Roman „Die Nürburgring-Papiere“ im vorangegangenen blog-eintrag gewürdigt wurde). „Dieses Konzept – das sich auch in Kehdingen und an der Oste bewähren könnte – hat in der Eifel und anderswo bereits voll eingeschlagen: Krimi-Lesungen, Krimi-Preise, Krimi-Wochenenden, Krimi-Wanderungen beleben dort den Tourismus,“ heißt es weiter auf der Webpage des „Krimilands Kehdingen-Oste“.

Europa auf Kuh
Neben Morgenstern möchte ich als Kehdinger Krimiautor auch noch den Rechtsanwalt Wilfried Eggers hier erwähnen, weil mir dessen Bücher ebenfalls gut gefallen haben. „Zwar hat Eggers alle Ortsnamen – aus juristischen Gründen – verfremdet: Aus dem Land Kehdingen wird das Land Kahdingen, aus Drochtersen wird Hollenfleth, aus Krautsand wird Ruthensand. Doch die Schilderung des plattdeutschen Menschenschlages und der Landschaft ist ebenso präzise und authentisch wie die Darstellung der düsteren Vergangenheit, die auch über dieser Region lastet,“ heißt es über ihn und seine Krimis auf der Webpage „Krimiland Kehdingen-Oste“. In mehreren Romanen von dort wird erwähnt, dass der eine oder andere Kehdinger Bauer legal oder illegal einen Türken als Betriebshelfer beschäftigt und wie deren Herr-Knecht-Dialektik sich dabei konkret gestaltet . Der Rechtsanwalt Eggers hat so einen türkischen Knecht in seinem Krimi „Paragraph 301“, der zu einem großen Teil in Anatolien spielt, zur Hauptfigur gemacht.
In Thomas B. Morgensterns Regionalkrimi „Tod eines Milchbauern“ ist ebenfalls von zwei in das Kehdinger Land gezogenen Auswärtigen die Rede: Der eine, ein Bauer, kam aus der Kölner Börde und die andere, eine Bäuerin, „kam von der Geest und fühlte sich im Moor nie richtig heimisch“, beide scheitern in der neuen Umgebung, das aber nur am Rande. Von den Einheimischen erfährt man im Roman viel aus ihrer Geschichte, auch von der üblen Behandlung der Zwangsarbeiterinnen im Dorf während des Krieges. Eine Freundin des Milchkontrolleurs arbeitet an einer „Dorfchronik“ – diesmal ohne schwarze Löcher. Damit fing es vielleicht an – in den Siebzigerjahren, dass pensionierte Lehrer und zugezogene Intellektuelle/Künstler aus der Stadt sich für die Dorfgeschichte zu interessieren begannen. Das war zur Zeit der „Geschichtswerkstätten“, die eine ganze „Geschichtsbewegung“ kurzzeitig entstehen ließen, sie wurden auch „Barfußhistoriker“ genannt. Vor allem wurde damals jedoch die „Region“ in der Anti-AKW-Bewegung, Whyl, Brokdorf, Gorleben wiederentdeckt. Man versuchte, sich untereinander auf Alemannisch oder Okzitanisch zu verständigen – gegen die Bürokraten da oben, die kein Wort verstanden. Und aus dem Sammeln des Regionalen Liedguts entstand schließlich der Regionalkrimi, um es kurz zu machen. Seit einigen Jahren ist von einem Europa der Regionen die Rede, von oben gesagt, gleichzeitig gerieten diese (par la force intern du marché?) in eine unruhige „Standortkonkurrenz“, mindestens in bezug auf ihren Tourismus, von dem immer mehr Regionen leben, was schließlich zu ihrer Logoisierung führte, bei der ihre Natur-Kultur-Landschaft zu einer „Gebietskulisse“ herabkam, die bestimmten Konjunkturen folgend erfolgreich bewirtschaftet werden muß. D.h. es muß aufwärts gehen mit der Region – notfalls auch über Leichen.

Europa neben Kuh (Picasso)
Die Regionalkrimis werden in regionaler Hinsicht immer kleinteiliger – bis dahin, dass mindestens die seriellen in immer dem selben Dorf spielen, was natürlich bei Krimis mit vielen Morden schnell bevölkerungspolitische Probleme aufwirft (bei den Worpswede-Krimis, den Hemmoor-Krimis, aber auch den Ostfriesen-Krimis beispielsweise, deren Region inzwischen schon fast menschenentleert sein müßte).
Dem Kehdinger Krimiautor Thomas B. Morgenstern droht das selbe, wenn er seine Morde weiter wie bisher in der unmittelbaren Umgebung seines Milchkontrolleurs platziert. Aber interessant ist in seinem Fall, er ist von Beruf Biobauer, vielleicht noch die Frage: Fangen jetzt auch immer mehr Nichtjournalisten, Nichtdrehbuchschreiber, Nichtrechtsanwälte usw. an, Krimis zu schreiben, die in ihrem unmittelbaren Lebens- und Arbeits-Umfeld spielen? Das dürfte diesem populären Genre einen enormen Professionalitätsschub geben, denn diese Autoren wüßten, wovon sie reden/schreiben.
Der „Tod eines Milchbauern“ hat die Gefährdung des „bäuerlichen Parzelleneigentums“ zum Hintergrund: Marx gab bereits dem auf die Zerstörung der Allmende in Westeuropa folgenden „bäuerlichen Parzelleneigentum“ keine Chance: Es werde unweigerlich der „von Kapitalisten betriebenen Landwirtschaft“ weichen müssen. Engels zog daraus die praktische Konsequenz: „Es ist unsere Pflicht, den Bauern die absolute Rettungslosigkeit ihrer Lage klar zu machen.“ In der Sowjetunion setzte man dann beim Aufbau einer industriellen Landwirtschaft in Kolchosen auf die „Dorfarmut“. Der antikommunistische Harvard-Historiker Robert Conquest entsetzte sich – in seinem Buch über die Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion „Ernte des Todes“: „Wo [der zaristische Premierminister und Reformer] Stolypin auf die Starken gesetzt hatte, setzte [der Revolutionär] Lenin auf die Schwachen“ . Was für humanistische Trottel – diese Bolschewiki! Die Nazis und nach ihnen die EU-Kommissare taten es dagegen Stolypin nach: Ihre Formel lautete „Wachsen oder Weichen“, d.h. sie förderten stets die dicksten Bauern,damit die ihre Landwirtschaft kapitalistisch organisierten. So wurden z.B. 1938 allein in der Armutsregion Rhön von 13.735 landwirtschaftlichen Betrieben 11.552 als „nicht lebensfähig“ eingestuft und daraufhin über 100.000 Menschen von ihren Äckern in Arbeitslager und an die Kriegsfronten getrieben. Aus den Betrieben, die bleiben durften, machte man überlebensstarke „Erbhöfe“. 2009 meldete dpa: „Tausende Bauern geben auf. Preisverfall bei der Milch trägt zum Höfesterben bei.“ Und kürzlich meldete dpa noch einmal: „Wegen des Preisveralls der Milch haben 2009 erneut viele Milchbauern ihren Betrieb aufgeben müssen. Die Zahl der Milchkuhhalter sank von Mai 2009 bis Mai 2010 um 4 Prozent. 3.934 Höfe stellten ihre Milchviehwirtschaft ein. Die Zahl der Milchhöfe sank in den vergangenen Jahren stetig. Die Zahl der Milchkühe blieb allerdings relativ konstant.“

Eine der zehn berühmtesten Kühe
Etliche Tageszeitungen zwischen dem Allgäu und der Küste dokumentierten daraufhin „Einzelschicksale“: Da gab es z.B. Bauer Jürgen Jacobsen aus Nordfriesland. Er ging wie jeden Morgen in den Stall. Seine Frau war beunruhigt. Sie rief ihn auf dem Handy an: „Ist alles in Ordnung? Er beruhigte sie. Alles bestens. Dann schaltete er die Melkanlage an und erhängte sich.“ Oder Bauer Thomas Schneekloth aus Barsbek: „Bei 200 Kühen dachte ich, jetzt bin ich gut dabei, erzählt er. Bei 300 dachte er, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Jetzt hat er 400 und Existenzangst.“ Oder Bauer Roland Thomsen aus Norstedt: Im Juni holte der Viehhändler seine 53 Kühe ab. „Der NDR war da und filmte das Ende einer Milchbauernexistenz. Filmte, wie der Landwirt die Stalltür ein letztes Mal öffnet, wie die schwarz-weiß gefleckten Holsteiner heraustraben, wie er die Tür hinter ihnen schließt. Filmte auch, wie Thomsen weint.“ Andere drehen eher durch, wenn ihr kleinbäuerlicher Hof zwangsversteigert wird. Der bayrische Schriftsteller und JW-Kolumnist Franz Dobler hat das in seinem Roman „Tollwut“ zum Thema gemacht.
„Der Markt bietet keine Ruhe, er bietet Chancen“, so sieht dagegen das realzynische Schleswig-Holsteiner „Bauernblatt“ die Agrarmisere. Mit den Chancen sind u.a. die „Milchquoten“ gemeint, d.h. die festgelegten Milchmengen, die jeder Kuhhalter produzieren darf. Erhängt er sich oder gibt er seinen Betrieb auf, kann ein anderer seine Quote kaufen. Sie können auch angeheiratet, geleast und gepachtet werden. Heute werden sie dreimal im Jahr an sieben deutschen Milchbörsen gehandelt. Und es ist inzwischen allen klar: So wird man die Milchproduktion nie an den Bedarf anpassen. Deshalb soll die Quote 2015 abgeschafft werden – und allein der Markt das regeln. Das wird dem Höfe- und Bauernsterben wahrscheinlich einen neuen Schub geben, obwohl gleichzeitig mehr und mehr Arbeitslose aus der Stadt sich auf dem Land „Subsistenzwirtschaften“ aufbauen. Die Agrarsoziologin Silvia Pérez-Vitoria meint sogar, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Bauern sein wird. Ähnlich äußert sich auch der französische Bauernaktivist José Bové.
Milchbauern gibt es hierzulande an der Küste ebenso wie in den Alpen – und sie haben sich in den vergangenen Jahren gegen den Verfall der Milchpreise zusammengetan und gewehrt. Dies ist das Thema des „Alpen-Krimis: ‚Mord im Bergwald'“ von Nicola Förg, einer im Ammertal mit vielen Tieren lebenden Reiseschriftstellerin. Ein Bauer will sich dem kollektiven Molkerei-Boykott seiner Kollegen nicht anschließen und wird schließlich ermordet aufgefunden. Kommissarin Irmi Mangold, die selbst auf einem Milchhof lebt und auf der Seite der kämpferischen Bauern steht, muß unter ihnen nach dem Täter fahnden. Es geht in dem Roman von Nicola Förg zugleich auch um das alte Agrarproblem: Moderinisierer versus Traditionalisten, das sich in den landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht selten als ein Generationenkonflikt darstellt: Alte Bauern, die ihre Kühe noch „putzen“ gegen ihre Söhne, die aus der Milchviehzucht ein durchcomputerisiertes Cow-Management machen wollen, wenn nicht noch Schlimmeres: Eine Bisonzucht in diesem Fall.
Der im Savoy lebende Schriftsteller John Berger hat in seinen „Geschichten vom Land: ‚Sau-Erde'“ den Unterschied dieser zwei Denkweisen als einen zwischen der bäuerlichen Perspektive und der von Städtern dargestellt: Für den Bauern ist die Vergangenheit weit und offen und die Zukunft verengt – wie in der Zentralperspektive. Beim Städter ist es dagegen genau umgekehrt: Er sieht in seiner Zukunft immer mehr Chancen und Möglichkeiten. Wenn man Nicola Förgs alpenländischen Beobachtungen folgt, dann stoßen sich diese Gegensätze hart im Raum des Kuhstalls – in dem Moment, da die Kühe nicht mehr benamt und vom Bauern regelmäßig geputzt werden, sondern durchnummeriert und automatisch versorgt bzw. entsorgt werden (sollen).
Der holländische Schriftsteller Geert Mak hat bereits in den Neunzigerjahren diesen „Übergang“ in seiner Studie über das friesische Dorf „Jorwerd“ herausgearbeitet. Sie heißt: „Wie Gott verschwand aus Jorwerd. Der Untergang des Dorfes in Europa“. Für eine darin zu Wort kommende Bäuerin begann dieser Prozeß in dem Moment, da man ihr das Milchgeld auf ein Bankkonto überwies. In Stichworten zusammengefaßt sah die Entwicklung dahin folgendermaßen aus:
Um die Jahrhundertwende wohnten ungefähr 650 Leute in Jorwerd, nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 420, 1995 nur noch 330, wobei die meisten in der Stadt arbeiteten. 1956 schloß das Postamt, 1959 gab der letzte Schuster auf, der Hafen wurde zugeschüttet, die Bäckerei schloß 1970, zwei Jahre später wurde die Buslinie stillgelegt, 1974 gab der letzte Binnenschiffer auf, der Fleischer schloß seinen Laden 1975, der Schmied gab 1986 auf und 1988 machte der letzte Lebensmittelladen dicht, 1994 wurde die Kirche einer Stiftung für Denkmalschutz übergeben. Als ich im Herbst 2000 dort hin kam, hatte nicht einmal mehr die Dorfkneipe „Het Wapen van Baarderadeel“ täglich geöffnet. Ansonsten sah das Dorf aber sehr freundlich und gemütlich aus. Der Autor Geert Mak meint denn auch am Schluß seines Buches – sinngemäß, daß man den Jorwerdern ihr langsames Verschwinden nicht anmerke: wie eh und je feiern sie alljährlich ihr rauschendes Dorffest, die „Merke“ – „So lebt das Dorf weiter, im Traum des Frommen, im langsamen Tanz der Alten, in einer Leichtigkeit, die es früher nicht gekannt hat.“ Immer mehr Menschen erwarben sich ihren Reichtum durch Worte, durch Papier und abstrakte Geschäfte. Dabei schien die Stabilität in der Provinz einer „heimlichen Panik“ zu weichen. Früher wurde man hier umgekehrt wie in der Stadt ausgelacht, wenn man einer Mode folgte. Heute wird auch auf dem Land „ein Projekt nach dem anderen konzipiert – ausgereift und unausgegoren, brauchbar und wahnwitzig, alles durcheinander. Feriendörfer, Yachthafen, Transrapid – es wimmelt von Masterplänen“. So wurde Jorwerd zu einem Global Village. Über die Ursachen aber, wie es dazu gekommen ist, gehen die Meinungen in Jorwerd auseinander. Für die Bäuerin Lies Wiedijk z.B. begann das Unglück damit, daß das Milchgeld, das ihnen jeden Freitag der Molkereifahrer ausgehändigt hatte, plötzlich auf ein Konto überwiesen wurde. Hiermit setzte die schleichende Verwandlung der Produktionsgemeinschaft in eine Konsumgesellschaft im Kleinen ein, wobei die ökonomischen Banden nach und nach durch sportliche und kulturelle ersetzt wurden.

Kontemporäre Kuhkunst – von Christoph Draeger. Er spannt temporäre Zäune auf dem Bauernhof in Form von Labyrinthen. Die weidenden Kühe stören sich nicht daran, sondern fressen sich in aller Seelenruhe durch, bis sie von selbst zum Ausgang kommen. Dadurch entsteht auf der Weide ein Muster von abgefressenem und hohem Gras.
„Milchgeld“ – so heißt auch ein „Allgäu-Krimi“ aus dem Jahr 2007 – von Volker Klüpfel und Michael Kobr. Der erste ist Redakteur bei der Memminger Zeitung, der zweite Realschullehrer für Deutsch und Französisch. Ihr immer wiederkehrender Ermittler ist ein Kommissar der Kemptener Polizei namens Kluftinger. Der Roman „Milchgeld“ spielt in einer Käserei und es geht darin wie schon in „Vom Winde verweht“ um einen alten – noch humanen – Unternehmer gegen seinen Sohn, einen jungen geldgierigen BWL-Schnulli.
Die Leute im Allgäu waren nebenbeibemerkt lange Zeit grottenarm, bis – folgt man der berühmten „Allgäu-Trilogie“ von Peter Dörfler – der dortige Agrarreformer Carl Hirnbeis so weit war: Er studierte in Italien, der Schweiz und in Belgien die Milchwirtschaft und die Käserei und führte selbiges im Allgäu ein – zunächst mit Kühen aus Holland.
Bei Wikipedia heißt es dazu: „Als Produktionsgrundlage führte Hirnbein das damalige Allgäuer Hungerland von der nicht mehr rentablen Flachswirtschaft und Hausweberei zur florierenden Milch- und Käsewirtschaft. Er begründete so den Wandel vom „blauen“ – vom Flachsanbau geprägten – zum „grünen“ Allgäu. Mit 1000 Hektar Landbesitz war er schließlich einer der größten Grundbesitzer im Allgäu.
Hirnbeins Nachfolge in der Agrarreform trat sein Schwiegersohn Josef Widmann (* 1833; † 1899) an, der es bis dahin in seinem eigentlichen Beruf als Tiefbau- und Eisenbahningenieur sowie Flussverbauer bis zum Baurat gebracht hatte.
1852 erbaute Carl Hirnbein mit dem Grüntenhaus das erste Hotel in den Allgäuer Alpen und legte damit den Grundstein für einen weiteren maßgeblichen Wirtschaftsfaktor, die touristische Erschließung des Allgäus (erster Fremdenverkehrsprospekt für das Allgäu). Später gehörte er der zweiten Kammer des bayrischen Landtags an.
In einer zwischen 1934 und 1936 erschienenen Trilogie über Hirnbeins Leben nennt ihn der Priesterdichter Peter Dörfler den Patriarchen des Allgäus, den Notwender, Zwingherr und Alpkönig.
Der zweite – allerdings reichlich verbummfidelte – Regionalkrimi, in dem es um Kühe bzw. um ihren Dung geht, er spielt in einem schwäbischen Dorf, heißt „Kuhdoo“. Der Autor, Sobo Swobodnik, ist Rundfunkredakteur und Filmemacher, aufgewachsen auf der schwäbischen Alb, und lebt jetzt in Berlin. „Kuhdoo“ ist sein „fünfter Krimi um und mit Paul Plotek“, einem arbeitslosen Schauspieler. Dem Roman hat er ein Motto von Richard Huelsenbeck vorangestellt: „So weit ist es nun tatsächlich mit dieser Welt gekommen. Auf den Telegrafenstangen sitzen die Kühe und spielen Schach.“
Leider gibt es noch kein Dorfkrimi in dem eine Kuh ein oder mehrere Verbrechen ermittelt, wohl aber einen in Irland spielenden Schafskrimi „Glenkill“ von Leonie Swann, in dem eine kleine Schafherde den Mörder ihres Schäfers sucht – und findet. Die Autorin hat jetzt einen weiteren Schafskrimi veröffentlicht, wobei sie die Herde nach Frankreich verlegt hat: „Garou“. Dazu sei gesagt: 1. dass es sich bei den Ermittlern nicht um Milchschafe handelt und 2. dass dieses Verfahren, eine kleine Schafherde ermitteln zu lassen, vorbereitet wurde von einer Schafforscherin: der Biologin an der Universität Berkeley Thelma Rowell. Sie lebt jetzt mit einer kleinen Schafherde in Kanada.
Die feministischen US-Anthropologen Shirley C. Strum und Linda M. Fedigan organisierten 1996 im brasilianischen Teresopolis einen Kongreß mit Primatenforschern und Wissenschaftssoziologen. Zu letzteren gehörte u.a. Bruno Latour, zu den ersteren die Schafforscherin Rowell – ihr Vortrag hieß „A Few Peculiar Primates“. Und gemeint waren damit die von ihr untersuchten Schafe, denn – so Rowell – „I tried to give my sheep the opportunity to behave like chimps, not that I believe that they would be like chimps, but because I am sure that if you take sheep for boring sheep by opposition to intelligent chimps they would not have a chance“. In anderen Worten – frei nach der Krimiautorin Leonie Swann: Man kann jedem die Chance geben, in einem Kriminalfall zu ermitteln – selbst einem Schaf oder einem Spatz. Und sind nicht unsere deutschen „Bullen“ bereits das beste Beispiel dafür, dass man wirklich jedem eine Chance geben muß?
Der Vollständigkeit halber sei hier noch der neueste „Allgäu-Krimi“ von Nicola Förg erwähnt: „Kuhhandel“. Es geht darin um eine engagierte Tierärztin, die auf einer Alm Medikamententests an Kühen auf die Spur gekommen war – und daraufhin ermordet wurde.
Ferner ein Krimi der Kölner Journalistin Monika Feth: „Der Erdbeerpflücker“, in dem zwar immer mal wieder von diesen Erntehelfern die Rede ist: „viele aus Polen“, die angeblich eine Art Vagabundenleben führen, aber eigentlich geht es um zwei Mädchen, die sich nacheinander in einen dieser Erdbeerpflücker verlieben.
Polskaweb.news meldet aktuell – aus dem Rhein-Erft-Kreis: „Ohne Polen läuft nichts“ – bei der Erdbeerernte dort. Und das Zentralorgan der Landarbeitergewerkschaft „Der Säemann“klagt: Obstpflücker „bekommen in Sachsen einen Stundenlohn von 3 Euro 27. Da kann man die Verantwortlichen nur fragen: Schämen Sie sich nicht?“
Noch schlimmere Zustände herrschten auf einer bayrischen Erdbeerfarm: Sie gehörte einem vom Dienst freigestellten Polizisten, der seine 118 Erdbeerpflücker aus Rumänien “wie Sklaven” hielt. Die Süddeutsche Zeitung schrieb: “Harte Feldarbeit, Hunger und einen Stundenlohn von 1 Euro 20. Was sich wie Zustände in der Dritten Welt anhört, hat sich tatsächlich auf einer Erdbeerplantage in Donauwörth abgespielt.”
Zu einem noch schrecklicheren Skandal kam es in Griechenland, wo 2500 Saisaonarbeiter auf den Erdbeerfeldern von Nea Manolada nahe Olympia arbeiteten, sie stammten meist aus Bangladesh und Pakistan und wurden dort wie “Sklaven” gehalten. Sie wehrten sich und streikten: Daraufhin wurden sie von bezahlten Schlägertrupps zurück an die Arbeit geprügelt, ein paar kommunistische Gewerkschafter aus Athen schlugen diese gleich mit zusammen. Das war dann doch zu viel – die Presse schaltete sich ein. Die “Erdbeersklaven” setzten schließlich eine Lohnerhöhung von 5 Euro pro Tag und Überstundenzuschläge durch (vorher erhielten sie etwa 23 Euro pro Tag; der Mindestlohn liegt derzeit in Griechenland bei 30 Euro 40).

Us Voorbeeld, Denkmal in Richmond. Photo: Peter Grosse
Eine weitere Erdbeerpflücker-Nachricht kommt aus Österreich:
„St. Pölten. In acht privat betriebenen Erdbeerfeldern in Niederösterreich dürfen Frauen nicht mehr mit Rock bekleidet pflücken. Dies berichtet der österreichische Fernsehsender ‚ORF‘. Aus hygienischen Gründen solle es Frauen nur noch erlaubt sein Erdbeeren zu sammeln, wenn sie Hosen tragen. Stammkunden wären bereits ausgeblieben, weil die Gefahr bestehe, dass Frauen ihre Notdurft auf den Feldern verrichten, so ein Erdbeerfeld-Betreiber. Seit der Einführung des Hosenzwangs laufe das Geschäft wieder, ebenso stoße die ‚Verordnung‘ auf breite Zustimmung. Eine Diskriminierung sei indes nicht gegeben, da man Frauen den Zugang zum Erdbeerfeld nicht gänzlich verbiete.“
Die Saarbrücker Zeitung veröffentlichte dagegen ein geschöntes Erdbeerpflückerinnen-Stimmungsbild:
„Die ersten drei Tage sind die Hölle. Dann hat sich der Rücken dran gewöhnt“, sagt Katharina Bernauer. „Wenn’s klemmt“, ist die Gartenbauingenieurin und Chefin vom Erdbeerland in Holz auch als Pflückerin zur Stelle. Neben den Feldern für Selberpflücker (an der Landstraße 136 zwischen Heusweiler und Holz) werden in Berschweiler weitere Felder für die Belieferung der Verkaufsstände bewirtschaftet. Etwa 20 Pflücker sind hier in der Saison von früh bis spät bei der Arbeit. Sobald es hell wird, also morgens um Fünf, packen sie Kisten und Schalen in die Autos. Mit Gummistiefeln und Regenhosen geht es ins noch nasse Erdbeerfeld. Kleidung für die Sonnenstunden und Proviant gehört ins Tagesgepäck. Persida Chioreu aus Petersdorf bei Hermanstadt in Rumänien ist zum vierten Mal zum Erdbeerpflücken angereist. „Wenn man jung ist, ist es nicht so anstrengend. Kommt auch ganz darauf an, wie viel du pflückst“, sagt sie lachend. Dann erzählt sie, sie habe Soziologie studiert und im letzten August ihr Diplom gemacht. Ihre Nachbarin Daniela Suteu, ebenfalls 24, drückt in Rumänien wieder die Schulbank, denn sie will das Abitur nachmachen. Sie findet die Arbeit in den Erdbeerfeldern „schön, denn erstens macht es Spaß, mit Freunden auf dem Feld zu sein, und zweitens macht das Pflücken Spaß, vor allem, wenn es nicht zu heiß ist.“ „Wir verstehen uns alle gut“, sagt Daniela Suteu. Mit „duschen, essen, reden“ beschreibt sie einen typischen Abend. In Vierergruppen wohnen sie jeweils zusammen in einem Nebengebäude vom Spargelhof. Die meisten Erdbeerpflücker sind zwischen 23 und 27 Jahre jung, und fast alle sind weiblich. „Frauen sind fingerfertiger und flinker“, erläutert Katarina Bernauer. Er paar der Mädels haben Gitarren mit, und so gehört musizieren und singen zu den Freizeitbeschäftigungen. Jozef Jaworski aus Polen ist Vorarbeiter. Schon zum neunten Mal ist der 36-Jährige in Holz. Er ist gelernter Schreiner und hat auch beim Aufbau der Spargel-Halle mitgeholfen. Jozef Jaworski wiegt die Kisten. Am Dienstag zum Beispiel wären es insgesamt 700 Kisten gewesen, erzählt er. Gestern erwartete er weniger. „Testessen“ gehört übrigens auch zu seinem Job. Er kennt die verschiedenen Erdbeersorten und die Felder. „Er weiß, wo, was steht“, sagt seine Chefin und weiter: „Er kennt die Leute, kann erklären.“
Jozef Jaworski ist auch für das wohl der Truppe verantwortlich, passt auf, dass alle genug trinken und Pausen machen. Er sorgt dafür, dass immer genügend Kisten und Kästen da sind. Mit den Ständen steht er telefonisch in Kontakt. Nach der Devise „heute pflücken und verkaufen“ wird nämlich je nach Nachfrage gepflückt. Frisch gepflückte Erdbeeren werden an vielen Ständen verkauft. Auch Selbst-Pflücker kommen noch bis etwa 5. Juli zum Zug. Das Erdbeerland ist Montag bis Samstag von acht bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags bis 19 Uhr, samstags von acht bis um 12 Uhr. Und am Donnerstag öffnete auch das „Himbeer-“ und das „Johannisbeer-Land“.
Es folgt ein Erdbeer-Rezept. Vor dem Abdruck von Zubereitungsrezepten scheuen im übrigen auch viele Regionalkrimi-Autoren nicht mehr zurück.
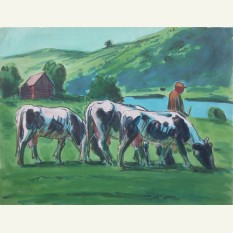
Erich Fraaß. Kuhhirt bei Beronuka. 1944
Horizontales Gewerbe: Saisonarbeiter bei der Gurkenernte. Photo: op-online.de





Das Info „niederelbe.de/ostemarsch“ meldete im Frühjahr:
Fackel-Spalier für Krimiautor
Mit einem Fackelspalier begrüßten die Mitglieder der Projektgruppe Krimiland Kehdingen-Oste der Arbeitsgemeinschaft Osteland e. V. am Wochenende den Krimischriftsteller Thomas B. Morgenstern aus Aschhorn (Kreis Stade).
Vor seiner Lesung im schaurig-schönen Gewölbekeller der Familie Pupke in Neuhaus/Oste gratulierten die Krimi-Fans dem Bio-Landwirt und Autor, dessen Erstling „Der Milchkontrolleur“ mittlerweile der bestverkaufte Regionalkrimi im Sortiment des Buchversenders amazon.de ist und der zur Zeit ins Chinesische übersetzt wird.