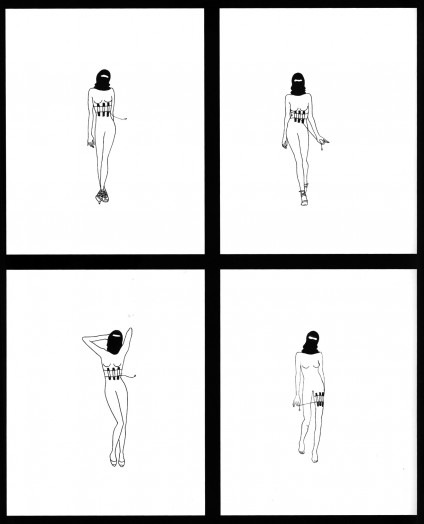
Terroristin. Photo: Katalog der Ausstellung „Global Fight Club – Aspects of Terror in Contemporary Art“ im Kunsthaus Meinblau, Berlin Christinenstraße, erschienen im Verlag Distillery. Die Zeichnungen stammen von der italienischen Künstlerin Ivana Spinelli.
Erwähnt sei ferner der Katalog „Arabic Graffiti“ des libanesischen Typographen Pascal Zoghbi. Es geht darin um die typografische Straßenkultur im mittleren Osten unter besonderer Berücksichtigung der derzeitigen Aufstands-Parolen. Der Katalog war Thema auf dem diesjährigen Typographie-Kongreß im Haus der Kulturen der Welt, der gestern zu Ende ging. Einige Arbeiten werden derzeit noch ausgestellt in der „Common Ground Gallery“ Marienburger Straße. Erwähnt sei ferner, dass das sog. „Kulturkaufhaus Dussmann“ in Berlin als erster Buchladen einen speziellen Tisch mit Arabischer Literatur aufgestellt hat.
Die Wochenend-Zeitungen, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Spiegel, sind heute voll mit Artikeln über den IWF-Chef, der gerade über ein muslimisches Zimmermädchen „stolperte“. Der Spiegel argumentiert wie immer anthropologisch-reaktionär statt klassen-kämpferisch: „Es geht um die Frage, was den Menschen zum Wolf und Männer zum potentiellen Feind der Frau macht.“
„Feind“ – so nennen auch die algerischen Frauen ihren Ehemann, wenn sie unter sich sind, wie die Schriftstellerin Assia Djebar (in: „Weit ist mein Gefängnis“) berichtet. Auch ihre Brüder, die sich als ihre „Beschützer“ aufspielen, sind ihre „Feinde“. Darüberhinaus alle politisch argumentierenden Männer von links bis rechts: So wird z.B. in Marokko „das staatliche Programm der Familienplanung, nach Maßgabe der internationalen Geldgeber (u.a. der IWF), rundweg als ‚imperialistische Machenschaft‘ abgelehnt – von der Linken als ‚konterrevolutionär‘, von der Rechten als ‚Angriff auf den Islam‘,“ wie die marokkanische Soziologin Fatima Mernissi in ihrem Buch „Der Harem ist nicht die Welt“ schreibt, in dem sie Interviews mit Frauen aus allen Schichten der Gesellschaft veröffentlichte. Ungeachtet der Ablehnung der „Familienplanung“ (mittels Verhütungsmittel) durch die männerdominierte Gesellschaft „wird die Geburtenkontrolle von den marokkanischen Frauen tagtäglich praktiziert, zumeist in der Form scheußlicher Abtreibungspraktiken,“ schreibt Mernissi. Auch zu anderen wichtigen Frauenfragen – „wie Polygamie, Verstoßung von Ehefrauen und ihrer Diskriminierung im Erbrecht – schweigt die fortschrittliche Linke, um nicht der Gottlosigkeit bezichtigt zu werden.“
Hinzu kommen noch all die Bücher arabischer Frauen aus der „wohlhabenden Schicht“, die vor allem im Westen für die arabische Literatur und Lebensweise in toto stehen – und es hier mitunter bis in die Bestseller-Listen bringen. Z.B. der Blogger-Roman der saudi-arabischen Autorin Rajaa Alsanea, der sich ausschließlich um das Verlieben, Verloben, Verheiraten ihrer vier Freundinnen dreht – bis zur völligen familialen Verblödung. Ähnlich verhält es sich mit dem Blogger-Roman der in England lebenden Muslimin Shelina Janmohamed „Küß mich, Kismet“ und dem Arab-Softporno von Nedijma: “Die Mandel”.Über diesen unter Pseudonym veröffentlichten Roman einer Marokkanerin schrieb der Spiegel eine ellenlang erigierte Rezension. (*) All diesen arabischen Noras, Anna Kareninas und Madame Bovarys stellt sich das Scheitern in nachholender Modernisierung.
Die Soziologin Fatima Mernissi schreibt: „Glaubt man einer beliebten männlichen Argumentation, die in den marokkanischen Medien immer wieder lautstark zu Gehör gebracht wird, dann dreht sich im Leben der Frauen alles darum, geliebt und begehrt zu werden- von einem Mann natürlich, und zwar von einem, der auch bezahlen kann, der den weiblichen Körper in Gold aufwiegt. Schönheit und Sinnlichkeit – als Mittel der Verführungskunst – gelten als die wichtigsten Ideale im Leben einer Frau. Aber in der Welt der marokkanischen Frauen sind in Wahrheit ganz andere Kämpfe und Probleme entscheidend. Die Mehrheit der Frauen hat um den Arbeitslohn, um das tägliche Brot, um das nackte Überleben zu kämpfen. In ihrer Welt dreht sich alles darum, wie man mit Armut, Arbeitslosigkeit und den Wechselfällen des Lebens fertig wird. Die Frauen begreifen sich deshalb auch selbst vor allem als ‚Wirtschaftsfaktoren‘: als Arbeitskräfte und Einkommensquellen.(…)
In den Berichten der Frauen treten die Männer ganz und gar nicht in der Rolle eines Beschützers gegen die Härten und Wechselfälle im Leben der Frauen auf. Sie erscheinen eher als ‚Anti-Helden‘.“ Als zusätzliche Belastung, die ihnen das Leben schwer macht.“Die Schilderungen der Frauen lassen keinen Zweifel, daß sie sich im Rahmen der Ehegemeinschaft in einer Situation völliger Unterdrückung befinden – von daher erscheint ihnen wirtschaftliche und persönliche Gleichberechtigung, eine ‚partnerschaftliche Ehe‘, als die einzig richtige Lösung. Für die Verwirklichung dieser Idealvorstellung kämpfen sie mit aller Macht.“
Wie im Westen jedoch meist vergeblich! Anders ist es im Aufstand, während einer Revolution. Assia Djebar schildert das während der algerischen Aufstände gegen die Franzosen ab 1960 – allerdings aus der Sicht eines jungen Mannes, eines halben „Helden“ – in ihrem Roman „Das verlorene Wort“. Die libanesische Schriftstellerin Hanan al-Scheich schrieb darüber in ihrem Roman „Sahras Geschichte“, der den libanesischen Bürgerkrieg thematisiert. Ihre Protagonistin Sarah wird durch die Kämpfe quasi „gerettet“. Ihr inneres Chaos harmonisiert sich mit dem äußeren, ihre innere Unruhe, die sich u.a. in schweren Depressionen äußerte, balanciert sich durch die äußere Unruhe aus: „Freiheit heilt!“ Als sie währenddessen schwanger wird, erschießt ihr Liebhaber sie jedoch.
Erwähnt sei hier noch eine Studie der Ethnologin Maryam Taherifard: „Sittlichkeit und Sinnlichkeit – Weibliche Sexualität im Iran“, soeben erschienen im Ulrike Helmer Verlag.
Die Berliner Zeitung berichtete gestern, dass die Frauen im libyschen Aufstand derzeit auf dem Rückzug sind, während die Kleriker an Einfluß gewinnen.
Auf „taz.de“ findet sich heute ein Text aus Libyen von Marc Thörner über das größte Krankenhaus im befreiten Benghasi, wo täglich Frauen eingeliefert werden, die Opfer von Vergewaltigungen wurden, nicht selten sind sie dabei mit Aids infiziert worden:
„Das ist ein Todesurteil
Frauen, die ihre Angehörigen verpflegen wollen, Frauen, deren Taschen von Obst, Sandwichs und hartgekochten Eiern überquellen, unrasierte alte Männer, Ambulanzfahrzeuge von der Front – sie alle müssen an der Schwester vorbei, die in einer Portiersloge am Eingang von Bengasis Jumhurija-Hospital thront.
Nach ein paar Fragen werden die Betreffenden normalerweise durchgewunken. Bei unserem Begehr meint die Diensthabende nicht recht zu hören. Ihre mit Khol umschminkten Augen verengen sich zu Schlitzen: Wie bitte? Was soll es hier geben? – „Eine Station, auf der diejenigen behandelt werden, die vor rund vier Wochen von Gaddafis Truppen vergewaltigt wurden. Es geht darum, mit Ärzten zu sprechen, Zahlen und Fakten zu dokumentieren und …“
Ehe der Satz zu Ende gesprochen ist, winkt sie ab. Ausgeschlossen. Undenkbar. Sie blickt sich um, ob noch andere die Frage gehört haben. „Gehen Sie weg, am besten schnell.“
Seit die Rebellion gegen Gaddafi zu einem Krieg geworden ist, erheben die Aufständischen den Vorwurf organisierter Massenvergewaltigungen. Kämpfer berichten immer wieder, bei Milizionären Viagra gefunden zu haben. Verpackungen des Mittels sind wie Trophäen neben den erbeuteten Waffen auf dem Platz vor dem Gerichtsgebäude von Bengasi ausgestellt. Im Fernsehsender CNN meldete sich exklusiv die Frau zu Wort, die vor einigen Wochen in einem Hotel in Tripolis die internationale Presse alarmierte und erzählte, wie sie von mehreren Gaddafi-Soldaten vergewaltigt worden sei.
Rechtfertigt das alles den Vorwurf, gezielter, organisierter Vergewaltigungen, der Vergewaltigung als Kriegswaffe? Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sammelt zurzeit Beweise. Verwertbare Ergebnisse, heißt es, liegen noch nicht vor. Immer wieder hatten wir versucht, in und um Bengasi Spuren nachzugehen. An Gerüchten herrscht kein Mangel. Sobald man die betroffenen Familien aufsuchen will, heißt es in der Regel: weggezogen.
Vielleicht wohnt noch ein entfernter Onkel, ein Cousin, eine Tante in dem Viertel. Nachbarn wollen von Nachbarn gehört haben. In Krankenhäusern sollen Ärzte etwas erzählt haben. Sie könnten Einzelheiten nennen … Sollten. Müssten. Könnten. Organisierte Massenvergewaltigungen sind ein schwerer Vorwurf, eine der schwersten Anschuldigungen, die im Krieg erhoben werden können.
Uns geht es nur um einen einzigen Fall.
Adschdabija gleicht einer Geisterstadt: Zerstörungen an vielen Häusern, Löcher in den Fassaden, ausgebrannte Fahrzeugwracks, vor den Geschäften an den großen Straßen sind die Läden heruntergelassen. Die Front liegt nur ein paar Kilometer weiter westlich, in der Nachbarstadt Brega. Nur wenige haben sich in ihre Häuser zurückgewagt. Zu ihnen gehört Abdelkrim al-Senoussi. Der 70-Jährige trägt eine blütenweiße Toga. Um seinen Kopf hat er einen Turban geschlungen. Mit steifem Oberkörper sitzt er auf dem Stuhl, beide Fäuste auf den Knauf eines Stocks gestützt. Seine Lider bleiben halb geschlossen. Dass er aufgeregt ist, verrät nur sein hastiger Atem.
Er ist nicht irgendwer, sondern in Adschdabija ein bekannter Mann. Einst Polizeioffizier in Diensten des Regimes. Von seinen 30 Kindern gehörte ein Sohn sogar zu Gaddafis Personenschützern. Wenn sich jemand in der umkämpften Stadt vor den einrückenden Truppen des Machthabers sicher fühlen konnte, dann Abdelkrim al-Senoussi. Dachte er.
Aber an diesem Tag vor etwa acht Wochen, als Gaddafis Söldner die Stadt von den Aufständischen zurückeroberten, brachen sie in sein Haus ein, stahlen sein Geld, nahmen einen erwachsenen Sohn und zwei seiner Töchter mit, die eine, Khadija*, 26, ist verheiratet, hat zwei kleine Kinder und wohnte mit ihrem Ehemann in einem eigenen Bereich des großen Hauses. Die andere Hassana*, 22, noch ledig.
Der Sohn und die jüngere Tochter konnten fliehen und auf Umwegen nach Hause zurückkehren, ins von den Aufständischen zurückeroberte Adschdabija. Die ältere, verheiratete Tochter ist bis heute verschwunden, samt ihrer beiden kleinen Kinder. Was ist mit der Tochter, die zurückkam? „Nicht mehr hier“, sagt Senoussi knapp. „In Bengasi.“ Mehr Einzelheiten möchte er nicht nennen. Jeder in der Stadt weiß ohnehin, was ihm passiert ist, da kommt es nicht mehr darauf an, so hatte er gedacht. Besser sogar, wenn die Presse, wenn die ganze Welt erfährt, was Gaddafi, sein ehemaliger Chef, für eine Art von Mensch ist. Doch jetzt setzt der ehemalige Polizeikommandeur sich wieder auf seinen Stuhl, umfasst den Stock mit beiden Fäusten, lässt den Kopf sinken und fängt an zu weinen, in hohen langgezogenen Tönen wie ein Kind.
Vergewaltigungsopfer – die seien entweder in Bengasi im Jumhurija-Hospital oder in der neuen Klinik, so hatten Kämpfer aus Adschdabija gemeint. Das „1.200-Betten-Hospital“, wie es im Volksmund heißt, ist das größte Krankenhaus der Stadt – nach langer Bauzeit gerade fertig geworden, von französischen Firmen hochgezogen, noch im Auftrag des Gaddafi-Regimes. Zahlreiche Gebäude und Nebengebäude machen die Anlage zu einer eigenen Stadt – einer blitzsauberen, aseptischen Raumstation. Lautlos aufschwingende Türen, Fahrstühle … das Ganze ist so unübersichtlich, dass niemand uns den Einlass verwehrt.
Die erste Schwester, die uns auf dem Flur der Frauenabteilung entgegenkommt, Ende 20, dezent geschminkt, mit Kopftuch, einen Packen Papiere unter dem Arm, kennt Abdelkrim al-Senoussis Tochter. „Fälle wie ihren behalten wir einige Tage hier, manchmal auch Wochen. Wir machen die ersten Untersuchungen und bestätigen aus medizinischer Sicht, was geschehen ist.“
Kann man über Hassanas Fall hinaus etwas über ähnliche Fälle erfahren? Sie überlegt, zögert lange, in ihren Augen spiegelt sich die Angst. Dann stimmt sie zu. Unter der Bedingung, dass die Ärzte nichts davon mitbekommen. „Vergewaltigung“, erläutert sie, während wir zu ihrer Station gehen, „ist in Libyen ein Todesurteil“. Die Frauen können nicht mehr heiraten, sie bleiben allein, ihre Familien müssen aus der Nachbarschaft wegziehen. Für die Gesellschaft spielt es keine Rolle, ob man einverstanden war oder gezwungen wurde. Sobald Ärzte oder Pflegerinnen Auskunft geben, werden sie gleich von zwei Seiten bedroht: von den Familien der Opfer und von den Gaddafi-Spitzeln, die alle Informationen über die Vergewaltigungen unterbinden wollen. Zwei ihrer Patientinnen, die offenbar zu viel von den Einzelheiten erzählt hatten, wurden aus dem Krankenhaus entführt und sind bis jetzt verschwunden.
Die junge Schwester gibt uns Plastiküberzüge für die Haare und die Schuhe und nimmt uns mit in die Abteilung, in der Blutanalysen gemacht werden. „Weiter als bis dahin kann ich Sie nicht bringen.“
Vergewaltigte Frauen werden seit Anfang März in ihre Station eingeliefert, berichtet sie, während wir im Labor zwischen Reagenzgläsern und Retorten stehen; täglich kämen neue Fälle aus dem belagerten Misurata dazu. Aus Adschdabija allein 73.
Im Fall von Hassana al-Senoussi braucht sie keine Karteikarte hervorzuziehen, sie kennt den Fall. „Hassana ist schwanger. Und sie hat auch Aids.“ Ist sie da sicher? Von Aids-Fällen war im Zusammenhang mit den Vergewaltigungen bisher nichts berichtet worden. Die junge Schwester nickt. „Ich bin für die Analysen zuständig, ich nehme eigenhändig die Bluttests vor. Hassana ist nicht die Einzige. Von den rund hundert vergewaltigten Frauen auf dieser Station sind etwa vierzig nach den Übergriffen gegen sie mit Aids infiziert.“
Wie reagieren die Betroffenen und ihre Familien? „Hassana al-Senoussi trifft im Augenblick die Vorkehrungen zur Abtreibung. Ich hoffe, sie wird das Leben durchhalten, das ihr bevorsteht. Ich versuche die Frauen immer zu trösten, ich sage immer: Ihr seid noch jung, die Zukunft wird es richten, aber meistens nützt das nichts.“
Vergewaltigungen im Krieg, erläutert sie, das ist ein Phänomen, mit dem die Gesellschaft im Maghreb bisher nie zu tun gehabt hat. Es gibt keine Konzepte, keine organisierte Hilfe, um die Betroffenen aufzufangen, das Problem ist schlichtweg nicht definiert, es hilft nur das Verschweigen, das Verschwinden oder der Tod. „Deshalb setzt Gaddafi meiner Überzeugung nach dieses Mittel als Kriegswaffe ein. Er weiß, dass er unsere Menschen, unsere Gesellschaft damit tödlich treffen und vernichten kann. Und deshalb“, setzt sie hinzu, „spreche ich zu Ihnen über diese Fälle. Ich will, dass alle erfahren, was hier passiert.“
Hört sie anschließend noch irgendetwas von den Patientinnen? Sie nickt. „Bouchra Bennour* war drei Wochen lang bei uns, bis vor kurzem noch. Ebenso Asa Bousalam* und Hafsa al-Hayett*. Alle drei haben sich nach der Entlassung aufgehängt.“
In der Jungen Welt veröffentlichte Werner Pirker gestern ein langes Interview mit Mohamed Wakid, einem Vertreter der Revolutionären Sozialisten Ägyptens. Die Überschrift lautet:
„Das ist ausgeartet zum Karneval politischer Hochstapler“
Ist den Kindern der Revolution die Revolution wieder abhanden gekommen oder haben sie sich Positionen für künftige Auseinandersetzungen erkämpft?
Die meisten Teilnehmer an der Revolution – ich würde lieber von einem Aufstand sprechen – waren nicht organisiert. Ungefähr 80 Prozent der Demonstranten auf dem Tahrir-Platz sind bis dahin politisch nicht in Erscheinung getreten. Politische Organisationsformen entstanden aus dem Augenblick heraus – in Verteidigung von Räumen, die von Regimeseite angegriffen wurden. Was während der Januar- und Februarereignisse spontan entstanden ist, muß nun weiterentwickelt werden, um im Kampf um die institutionelle Neugestaltung des Staates gegenüber den etablierten Kräften nicht auf verlorenem Posten zu stehen.
Wer sind die etablierten Kräfte, und welche gegenrevolutionäre Strategie verfolgen sie?
Der herrschende Block besteht aus vier Hauptkräften. Die erste ist das alte Regime, das gegenwärtig von der Armee, der alten Staatspartei, dem Sicherheitsapparat und der Polizei repräsentiert wird. Mubaraks »Nationaldemokratische Partei« ist zwar aufgelöst worden, doch wird sie bei den Wahlen in Gestalt »unabhängiger Kandidaten« massiv präsent sein. Die zweite Gruppe sind die ökonomisch Privilegierten, die Business-Community, die großen Kapitalisten also – ebenfalls eine zentrale Größe der Konterrevolution. Als dritte Formation treten die etablierten Kräfte der Opposition, die Liberalen und Moslembrüder in Erscheinung. Sie sind in einigen Punkten Alliierte der Regimekräfte, in anderen sind sie mit ihnen verfeindet. Als vierte Kraft agiert die Fünfte Kolonne der USA und Israels. Die Moslembrüder und die klassische Opposition – ich meine damit bürgerliche Liberale, die in ElBaradai ihre Galionsfigur gefunden haben – können mit den Kollaborateuren nicht kollaborieren, da sie sonst jeden Rückhalt in der Bevölkerung verlieren würden. Denn die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist strikt antiisraelisch eingestellt. Alle vier Kräfte, von denen jede ihre eigene Agenda hat, haben ein gemeinsames Interesse daran, daß die Mehrheit unorganisiert bleibt. Dabei kommt ihnen entgegen, daß sich der Parteibildungsprozeß von unten chaotisch entwickelt und zum Karneval politischer Hochstapler ausgeartet ist.
Ägypten unter Mubarak war neben Saudi-Arabien die wichtigste Bastion der arabischen Reaktion – aufs engste mit dem Imperialismus verbunden und auf einen Ausgleich mit dem zionistischen Staat eingeschworen. Gibt es bereits Anzeichen einer außenpolitischen Neuorientierung?
Wenn überhaupt, dann mehr auf der Ebene von Erklärungen. Der Militärrat und die ihm hörigen politischen Kräfte wollen ihren Aussagen zufolge ein starkes Ägypten Das würde für Israel tatsächlich eine Bedrohung darstellen. Ein starkes und vor allem unabhängiges Ägypten würde eine neue regionale Konstellation bewirken. Es würde mit dem Iran, der Türkei und den revolutionären unter den arabischen Staaten eine Allianz bilden, welche die Vorherrschaft des Westens und Israels ernsthaft herausfordern könnte. Die Türken haben Ägypten bereits unter Mubarak eine enge Kooperation angetragen. Das war jedoch in den Wind gesprochen, weil sich das Mubarak-Regime Israel völlig unterworfen hat. Zwei Tage nach dem Sturz des Diktators war der türkische Präsident in Ägypten, um erneut eine verstärkte Kooperation anzubieten und die Region neu zu ordnen. Doch ist Ägypten auf vielfältige Weise mit Saudi-Arabien verflochten und von diesem weitgehend abhängig. Das Königreich ist Kreditgeber, Absatzmarkt und Arbeitgeber. Ägypten kann Israel Probleme bereiten, aber sich gegenüber den Amerikanern und Saudis behaupten kann es noch nicht. Sollte Kairo das versuchen, würden die Ägypter über Nacht aus Saudi-Arabien hinausgeworfen werden.
Unterhält Saudi-Arabien eine Fünfte Kolonne in Ägypten?
Die saudischen Stützpunkte in Ägypten werden von den Salafisten, das sind reaktionäre Islamisten, gebildet. Sie haben es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, in der Bevölkerung Vorurteile gegen die Schiiten und damit gegen den Iran zu schüren. Das geschieht in Kampagneneinheit mit dem Fernsehsender Al-Dschasira. Dieser spielt seit Beginn der arabischen Revolte eine zunehmend negative Rolle. Nachrichten über Bahrain werden unterdrückt. Positiv wird nur über Revolutionen berichtet, an denen die Moslembrüder führend beteiligt sind und die von den Golfstaaten unterstützt werden. Der Sender folgt voll den Anforderungen, die vom Golfstaaten-Kooperationsrat an ihn gestellt werden: gegen den Iran, die Schiiten und die Aufständischen von Bahrain.
Inwiefern unterscheiden sich die Salafisten von den Moslembrüdern?
Die Moslembrüder sind eine politische Gruppe, die in vielen Fragen rechte Positionen bezieht, in anderen aber linke. Sie verfügen über einen relativ großen Spielraum für eine unabhängige Politik, die Saudis können nicht einfach über sie bestimmen. Die Salafisten hingegen sind deren Marionetten. Besonders deutlich wurde dies bei den Protestaktionen gegen den israelischen Überfall auf den Libanon 2006, die von den Moslembrüdern mitgetragen wurden. Wegen ihrer Unterstützung der Hisbollah wurden sie von den Salafisten als schiitische Agenten beschimpft. Die Salafisten verfügen über das größte religiöse Fernsehnetz der Welt – finanziert vom saudischen Geheimdienst. Sie kontrollieren rund 20 Fernsehstationen, die Revolutionäre vom Tahrir-Platz nicht einen einzigen. Die Medienkontrolle ist zwischen dem Regime und den Islamisten aufgeteilt, wobei die Moslembrüder nur über einen kleinen Anteil verfügen. Die salafistische Medienmacht geht noch auf das Mubarak-Regime zurück. Denn die saudi-arabisch inspirierten Islamisten waren für das Regime und deshalb auch gegen die Volkserhebung. Sie sprachen sich immer bloß für eine moralische Erneuerung aus. Das Regime ist gegangen, die Salafisten und ihr gigantischer Propagandaapparat aber sind geblieben.
Wie stellt sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden wichtigsten islamistischen Gruppieren dar?
Die Bruderschaft hat ungefähr 1,5 Millionen Mitglieder, ihr Einfluß erstreckt sich auf zwei- bis dreimal so viele Menschen. Die Salafisten haben mehr Mitglieder, aber außerhalb ihrer unmittelbaren Anhängerschaft kaum Gewicht. Im Wettbewerb mit ihnen verschiebt sich allerdings der gesellschaftliche Diskurs nach rechts. Vergleicht man die Islamisten mit den Linken, ergibt sich folgendes Bild: Die Linke ist zwar winzig, ihr geistiger Einfluß aber um ein Vielfaches größer. Die Moslembrüder sind zahlenmäßig viel stärker, ihre ideologische Einwirkung hält sich jedoch in Grenzen. Die von den Salafisten ausgehende Wirkung sollte zwar nicht unterschätzt werden, da sie aber den Militärrat unterstützen, befinden sie sich in einem offenen Widerspruch zu dem im Lande vorherrschenden rebellischen Bewußtsein. Was die Moslembrüder betrifft, halte ich einen Vergleich mit der Situation von 1954 für angemessen, als Nasser die Bruderschaft zerschlagen konnte. Nicht weil er ein Militärdespot war, sondern weil er wegen seines Antiimperialismus die Massen auf seiner Seite hatte. Gegenwärtig würde die Bruderschaft der Armee gern die Macht streitig machen, wagt die Kraftprobe aber nicht. Sie beteuert vielmehr, daß die Armee der einzige Garant der Sicherheit sei. Umgekehrt traut die Armee ihnen auch nicht. Sie spielt die Salafisten gegen sie aus, ohne daß sie diesen je erlauben würde, nach der Macht zu greifen. Die Salafisten sind eine an der Basis wirkende rechtsradikale Bewegung.
Vergleichbar mit den nationalistischen »Schwarzhundertern« und ihren antisemitischen Pogromen am Vorabend der russischen Revolution von 1905?
Vielleicht. Mit den Moslembrüdern kann man Gespräche führen, mit den Salafisten nicht. Sie sind auf Pogrome, vor allem gegen Christen, eingeschworen. Man könnte sie auch als die äußerste Reserve der Konterrevolution bzeichnen.
Sprechen die beiden islamistischen Strömungen unterschiedliche soziale Schichten an?
Die Moslembrüder stützen sich auf gebildete, aber ökonomisch benachteiligte, vor allem urban geprägte Schichten. In den Dörfern sind sie kaum verwurzelt – die werden von den Salafisten dominiert. Selbst bei Leuten, die ihnen nicht unbedingt wohlgesonnen sind, verfängt ihre auf rassistische und religiöse Vorurteile zielende Propaganda. Gegenwärtig sind die Christen und die Schiiten ihre Hauptfeinde, obwohl es in Ägypten so gut wie keine Schiiten gibt. Indem sie zum Kampf gegen Minderheiten trommeln, sabotieren die Salafisten ganz im Sinn ihrer saudi-arabischen Auftraggeber den Kampf gegen den Imperialismus. Sie könnten auch den Moslembrüdern Schwierigkeiten bereiten. Das politisch korrekte Europa könnte geneigt sein, von den Salafisten ausgelöste Pogrome dem politischen Islam insgesamt in Rechnung zu stellen.
Bei der Volksabstimmung über Verfassungsänderungen haben sich die etablierten gegen die revolutionären Kräfte durchgesetzt. Eine schwere Niederlage?
Das oppositionelle Lager, das für die Durchführung einer konstituierenden Versammlung vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen eintrat, erhielt 22 Prozent. Das herrschende Lager – Armee, Bruderschaft, Salafisten und Big Business– kam auf 78 Prozent. Viele fürchteten, daß die Armee noch mehrere Jahre an der Macht bleiben würde, sollte zuerst eine verfassungsgebende Versammlung durchgeführt und dann erst gewählt werden. Viele gaben ihr Ja zu den bescheidenen Verfassungsänderungen um der Stabilität willen. Sie meinten, Wahlen würden folgen und dann könne der wirtschaftliche Aufbau beginnen. Viele fürchteten auch, daß in einer neuen Verfassung der Scharia-Bezug wegfallen und die Christen das Land übernehmen könnten. Dabei geht es weniger um eine Frage der Religion als der Identität.
Die Islamisten, auch linke wie die Islamische Arbeiterpartei, werfen der Linken vor, nur deshalb gegen baldige Wahlen zu sein, weil sie sich keine guten Chancen ausrechnen. Außerdem könnte man ja auch nach den Wahlen eine neue Verfassung ausarbeiten.
Wer die Wahlen gewinnt, wird wenig Interesse an einer neuen Verfassung zeigen. Oder die Wahlsieger werden ihre Machtposition dazu nutzen, eine Verfassung nach ihren Vorstellungen auszuarbeiten. Wir meinen aber, daß, auch wenn die Demokraten die Wahlen gewinnen sollten, sie nicht dazu legitimiert wären, im Alleingang eine neue Verfassung zu verabschieden. Das kann nur eine verfassungsgebende Versammlung, an der alle gesellschaftlichen Gruppen, unabhängig davon, ob sie an den Wahlen teilgenommen haben oder nicht, teilhaben sollen: Die Kopten, Frauenorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und Parteien. Die vier Strömungen– Islamisten, Liberale, Sozialisten und Nationalisten – müßten mehr oder weniger gleichberechtigt teilnehmen. Wir wollen eine Verfassung auf Konsensbasis, sie wollen eine Verfassung der Sieger.
Der Kampf um die Ausgestaltung der Demokratie, ob sozial oder oligarchisch, ist also voll entbrannt. Die etablierten Kräfte nutzen ihren Startvorteil. Schlechte Aussichten für die Demokratie?
85 Prozent der Revolutionsteilnehmer sind auf unserer Seite. Aber wie läßt sich das auf der institutionellen Ebene verankern? Um eine Nichtregierungsorganisation ins Leben zu rufen, braucht man sechs bis acht Monate. Zur Gründung einer politischen Partei sind 5000 Gründungsmitglieder erforderlich, deren Namen in den zwei größten ägyptischen Zeitungen – gegen Bezahlung – veröffentlicht werden müssen, was für viele Parteiinitiativen unerschwinglich ist, obwohl sie über die notwendige Mitgliederzahl verfügen. Wie soll man es da mit den etablierten Kräften aufnehmen können? Zur Durchführung fairer Wahlen müßten diese undemokratischen Barrieren beseitigt werden. Und wenn dies, wie zu erwarten, nicht geschieht, meinen wir: Führt die Wahlen so schnell wie möglich durch, gewinnt sie. Gratulation. Aber leitet daraus nicht den Anspruch ab, eine euch genehme Verfassung zu verabschieden.
Sie gehören der Gruppe »Revolutionäre Sozialisten« an. Das ist eine Mitgliedsorganisation der Nationalen Front. Was sind Ihre wichtigsten Zielsetzungen in der gegenwärtigen Phase?
Die Festigung der Demokratie. Das erfordert die Erarbeitung einer Verfassung auf Konsensbasis. Wir sind für eine patriotische, unabhängige Außenpolitik und für soziale Gerechtigkeit. In diesem Zusammenhang treten wir für die uneingeschränkte Anerkennung des Streikrechts ein. Für Sicherheit: Das heißt, wir sind nicht für die Abschaffung der Polizei, sondern für deren Rückkehr auf der Grundlage eines Mandats, das auf der Anerkennung der Rechte des Volkes beruht. Und wir verlangen einen nationalen Dialog.
Arbeitet die Nationale Front mit den während des Aufstandes entstandenen Volkskomitees zusammen?
Es gibt da eine gewisse Arbeitsteilung. Die Volkskomitees sind vor allem auf lokaler Ebene tätig. Sie wollen lokale Machtpositionen erringen, um direkt im Interesse der Volksmassen tätig werden zu können. Wir agieren hingegen auf gesamtnationaler Ebene.Wir sind eine Front, die sich um bestimmte Ziele formiert hat, und bemühen uns, Mitglieder für unsere Organisationen zu gewinnen. Für Islamisten ist es praktisch unmöglich, sich uns anzuschließen, weil wir für eine Demokratie ohne Diskriminierung eintreten. Wenn jemand dagegen ist, daß ein Kopte für das Präsidentenamt kandidiert, ist er bei uns fehl am Platz. Zu unseren Prinzipien gehört auch, daß die Macht vom Volk auszugehen hat. Das widerspricht dem Grundsatz, daß die Scharia die Grundlage der Verfassung sein muß.
In den vorherrschenden Darstellungen in Europa und Nordamerika heißt es, die arabische Revolution folge im wesentlichen der westlichen Demokratie- und Freiheitsagenda, der Antiimperialismus spiele somit keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
Wenn die Abhängigkeit vom Imperialismus anhält, kann sich in diesem Land nichts zum Positiven verändern. Der Imperialismus ist bei uns kein außenpolitisches, sondern ein innenpolitisches Problem. Arabische Solidarität, Solidarität mit den Palästinensern ist nicht auf eine andere Nation bezogen, sondern auf Ägypten selbst. Die Verbindung zwischen den hiesigen Politikern und dem Imperialismus ist ungeheuer stark und muß deshalb gekappt werden. Das ist unsere Position und die der radikalen Linken. Die ägyptische Mainstream-Linke aber ist eine liberale Linke und scheut deshalb den antiimperialistischen Diskurs. Sie folgt dem Slogan: »Ägypten zuerst« und reagiert schon allen auf das Wort Palästina allergisch. Nicht nur unsere antiimperialistische, auch unsere Arbeiteragenda wird von ihnen abgelehnt. In Fragen Antiimperialismus wären eher die Islamisten unsere Verbündeten. Doch die verhalten sich, wie erwähnt, in anderen Fragen konträr zu unseren Standpunkten. Die Mehrheit der Linken ist auf den Säkularismus fixiert, sie sind daher keine Verbündeten im Kampf gegen den Imperialismus. Daß sie von den Islamisten bekämpft werden, ist nicht bloß deren Sektierertum geschuldet, sondern hat reale Gründe. Viele Linke glauben, daß die Islamisten nur im Bündnis mit dem Westen besiegt werden könnten. Auf der anderen Seite sind die Islamisten in gesellschaftspolitischen und auch in sozialen Fragen oft sehr reaktionär eingestellt, vor allem, was das Recht auf sozialen Widerstand betrifft. Das spielt dem Regime und damit auch dem Imperialismus in die Hände. Die Strategie der liberalen Linken, den Kampf um einen säkularen Staat an die erste Stelle zu rücken, aber ist nicht minder katastrophal.
Warum?
Deklariert man sich als Säkularer, wird man in einem Land wie Ägypten keinen Erfolg haben. Etwas anderes wäre es, würde man sagen, wir sind gegen die Islamisten, weil die einen religiösen Staat gründen wollen. Die Furcht vor den Islamisten ist die Glut aller Sammlungsbewegungen. Auch wir wollen nicht, daß die Religiösen die Kontrolle über den Verfassungsprozeß bekommen. Wir haben keine Angst davor, daß sie die Wahlen gewinnen und die Regierung stellen. Aber wir wollen eine Verfassung, die das Recht auf Widerstand enthält.
Soll das neue Ägypten den Friedensvertrag von Camp David (siehe unten) für null und nichtig erklären?
Selbst wir sagen nicht: Hebt das Camp-David-Abkommen als Ganzes auf. Wir zählen vielmehr Punkt für Punkt auf, welche negativen Auswirkungen der Vertrag auf Ägypten hat. Viele Menschen sind der Ansicht, daß ein Rücktritt von diesem Vertrag gleichbedeutend mit einem Krieg wäre. Niemand will einen neuen Krieg. Die ägyptische Unterwürfigkeit gegenüber Israel ist nicht allein dem Friedensvertrag von Camp David geschuldet. Als Ägypten 2007 die Grenze zum Gazastreifen geschlossen hat, behauptete das Regime, daß es laut Friedensvertrag dazu verpflichtet gewesen sei. Doch dem ist nicht so. Wir sind für ein schrittweises Vorgehen: Zuerst Israel boykottieren, alle anderen Verträge für ungültig erklären, und dann eine Allianz mit der Türkei und dem Iran gegen Israel bilden, die es unter Umständen ermöglicht, Camp David zu annullieren. Falsch wäre es dagegen zu sagen: Im Falle eines Wahlsieges würden wir Camp David aufkündigen. Sogar die Bruderschaft hat erklärt, daß sie, sollte sie an die Macht kommen, die bestehenden Verträge akzeptieren würde. Überhaupt befindet sich die Moslembruderschaft in einem Dilemma. Akzeptieren sie Camp David, sind sie weg, verwerfen sie es, ebenso. Daher würden sie sich lieber von der Macht fernhalten, denn die einzige Möglichkeit, aus dem Friedensvertrag mit Israel herauszukommen, wäre eine breite Volksbewegung, die nicht nur Ägypten, sondern die ganze Region umfaßt. Die Bruderschaft aber hat eine reformistische Mentalität, sie wollen dem herrschenden Block angehören, ohne direkt zu herrschen.
Der Begriff »Nationale Front« hat heute in europäischen Ohren einen eher rechten Klang.
In arabischen Ohren nimmt national im Gegensatz zum Wort patriotisch, das auf Ägypten bezogen ist, die Bedeutung panarabisch an.
(Das Abkommen von Camp David datiert vom 17.9.1978. Vermittelt durch US-Präsident James Carter, vereinbarten darin Israels Ministerpräsident Menachem Begin und Ägyptens Präsident Anwar Al-Sadat eine Normalisierung der Beziehungen beider Länder, was im Folgejahr zu einem bilateralen Friedensvertrag führte.)

Zwei Schlagzeilen auf einen Blick. Photo: Antonia Herrscher
Aus Spanien meldet dpa heute Nachmittag:
Die Demonstranten in Spanien wollen ihre Proteste fortsetzen. Die Teilnehmer einer Kundgebung in Madrid entschieden am Sonntag, ihre Protestaktion im Zentrum der spanischen Hauptstadt gegen die Wirtschaftskrise und die hohe Arbeitslosigkeit um wenigstens eine Woche zu verlängern.
In anderen Städten des Landes sollten die Demonstranten im Laufe des Tages auf Vollversammlungen ebenfalls über eine Fortführung der Kundgebungen entscheiden. Nach Medienberichten trat die große Mehrheit für eine Fortsetzung ein. Die Kundgebungen hatten ursprünglich nach den Regional- und Kommunalwahlen am Sonntag zu Ende gehen sollen. Die Wahlen galten als ein wichtiger Test für die in knapp zehn Monaten anstehende Parlamentswahl.
Aus Syrien meldet AP:
Mit den tödlichen Schüssen auf die Teilnehmer eines Trauerzugs ist die Zahl der Todesopfer der Massenproteste gegen das syrische Regime am Wochenende auf mehr als 900 gestiegen. Der Aufstand in Syrien ist damit nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten einer der blutigsten im sogenannten Arabischen Frühling. Die Sicherheitskräfte eröffneten am Samstag das Feuer auf Zehntausende Trauernde und töteten drei Menschen. Zuvor waren am Freitag bei Massenprotesten 44 Menschen ums Leben gekommen.
Einzig in Libyen haben die Gefechte zwischen Aufständischen und Regierungstruppen mehr Opfer gekostet als in Syrien. Während der 18-tägigen Revolte in Ägypten kamen mindestens 846 Menschen ums Leben. In Tunesien wurden 219 Menschen getötet, bevor Präsident Zine El Abidine Ben Ali schließlich im Januar zurücktrat. Im Jemen kamen 150 Regierungsgegner ums Leben, während es in Bahrain, im Oman und anderen Ländern deutlich weniger waren. Die Zahlen aus Syrien basieren auf Schätzungen von Menschenrechtsaktivisten, offizielle Zahlen der Regierung gibt es nicht. Die meisten ausländischen Journalisten wurden des Landes verwiesen.
Am Samstag wollten Zehntausende in der Stadt Homs acht am Vortag getötete Demonstranten zu Grabe tragen. Allein bei landesweiten Demonstrationen am Freitag wurden nach jüngsten Angaben 44 Demonstranten getötet. Die meisten Opfer habe es in der nördlichen Provinz Idlib und in der zentralen Region Homs gegeben, teilte die Nationale Organisation für Menschenrechte in Syrien mit.
Tausende Syrer hatten am Freitag dem harten Vorgehen der Regierung gegen Demonstranten getrotzt und waren auf die Straßen gezogen. Die Behörden reagierten Aktivisten zufolge mit scharfer Munition. Die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA machte für die Gewalt „bewaffnete Banden“ verantwortlich.
Aus dem Irak meldet AFP:
Bei einer Serie von Anschlägen im Irak sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 80 weitere Menschen wurden bei Bombenexplosionen und einem Selbstmordanschlag in Bagdad und der nahe gelegenen Stadt Tadschi am Sonntagmorgen verletzt, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. Mehr als acht Jahre nach dem Einmarsch im Irak zog Großbritannien seine letzten noch im Land verbliebenen Soldaten ab.
Der folgenschwerste Anschlag ereignete sich in Tadschi nördlich von Bagdad: Dort starben mindestens acht Polizisten und vier Zivilisten, als sich ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Die Beamten waren zum Schauplatz eines Autobombenanschlags geeilt, als sich ein Selbstmordattentäter neben ihnen in die Luft sprengte. Während das Innenministerium die Zahl der Opfer in Tadschi mit zwölf Toten und 23 Verletzten angab, sprach ein Vertreter des Verteidigungsministeriums von 14 Toten und 28 Verletzten.
In mehreren Stadtteilen von Bagdad starben den Angaben zufolge sechs Menschen durch zahlreiche Autobomben und Sprengsätze. Es war zunächst unklar, ob es sich bei der Anschlagsserie um eine koordinierte Aktion handelte.
Aus Pakistan meldet Reuters:
Bei einem Bombenanschlag auf einen Nato-Tanklaster in Pakistan sind am Samstag mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Behördenangaben zufolge geriet das Fahrzeug durch eine Bombenexplosion zunächst in Brand. Daraufhin habe sich eine Menschenmenge versammelt, um ausgelaufenes Öl aufzufangen. 16 der Umstehenden seien ums Leben gekommen, als es der Lastwagen von einer zweiten Explosion erschüttert worden sei.
In derselben Region im Nordwesten Pakistans kam es später zu einem weiteren Bombenangriff auf einen Konvoi von 16 Nato-Tanklastern, die sich auf dem Weg nach Afghanistan befanden. Dabei sei allerdings niemand verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden mit.
Seit der Tötung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden Anfang Mai durch ein US-Spezialkommando in Pakistan hat die Gewalt in dem Land zugenommen. Häufig haben sich die radikal-islamischen Taliban zu Anschlägen bekannt.
Anmerkung:
(*) Soziologisch besonders unbedarft ist der Bericht von Hani Yousuf – einer Springerverlags-Stipendiatin aus Pakistan – in der „Welt“: “
Gewiss, die sozioökonomische und soziokulturelle Struktur Pakistans ist sehr kompliziert. Unsere Bildungselite hat eine progressive Einstellung. Ich wurde nicht dazu erzogen, möglichst früh zu heiraten und Kinder zu bekommen. Im Gegenteil. Die größte Angst meines Vaters ist, dass ich einem Mann begegnen und – noch schlimmer – ihn heiraten könnte. Als ich im Winter meine Eltern in Karachi besuchte, erzählte er mir, dass es mit meiner Karriere vorbei wäre, wenn ich vor 35 heiraten würde. Allerdings hat er mich gebeten, meiner Mutter nicht zu erzählen, dass er mir das gesagt hatte. Meine Mutter wiederum hat darauf bestanden, dass meine Schwester und ich eine Universitätsausbildung bekommen. Zwar hätte sie nichts dagegen, wenn ich einen Banker von der Wall Street abschleppe und, hoffentlich, heirate, aber das weiß ich nur, weil ich heimlich ihren Telefongesprächen mit ihren Freundinnen gelauscht habe.
Wie dem auch sei: Die Vorstellung, meine Eltern würden von mir erwarten, einen Mann zu heiraten und mit ihm Kinder zu haben, womöglich einen Mann, den sie für mich aussuchen und den ich gar nicht kenne, ist ein westlicher Mythos. Übrigens sind Zwangsehen auch nicht mehr das, was sie früher waren. Die Eltern arrangieren Treffen, ein bisschen wie das Online-Dating, das im Westen so verbreitet ist, und die Kinder entscheiden dann, ob und wie es weitergeht. Zugegeben, es geht in Südasien zuweilen auch konservativer zu, aber auch da sollte man nicht alles nach westlichen Maßstäben beurteilen. Die Ehe meiner Eltern wurde arrangiert, wie man sagt, und sie lieben sich 29 Jahre später noch immer.
Will ich damit sagen, dass wir keine unterdrückten Frauen hätten, keine ernsten Probleme mit der Ungleichheit der Geschlechter? Natürlich nicht. In Südasien können wir nicht einmal anfangen, über Sexismus oder Lohngleichheit zu reden. Davon sind wir meilenweit entfernt. Was ich aber sagen will, ist, dass Männer in Südasien keine Angst haben vor Frauen in Führungspositionen.“ – Im Gegensatz zu hier, d.h. für die Autorin: im Springerstiefelverlag. Aber auch ihre Erfahrung mit dieser armselig-reaktionären Männertruppe verallgemeinert sie sogleich. Ihr Text heißt „Wo sind denn hier die Frauen?“
Ähnlich soziologisch blind wie Hani Yousuf waren im übrigen auch die beiden afghanischen Frauen-Aktivistinnen auf einer taz-Veranstaltung neulich, die ebenfalls nicht über ihren kleinen Oberschicht-Horizont blicken konnten.

Palästinensische Graffiti. Photo: salem-news.de
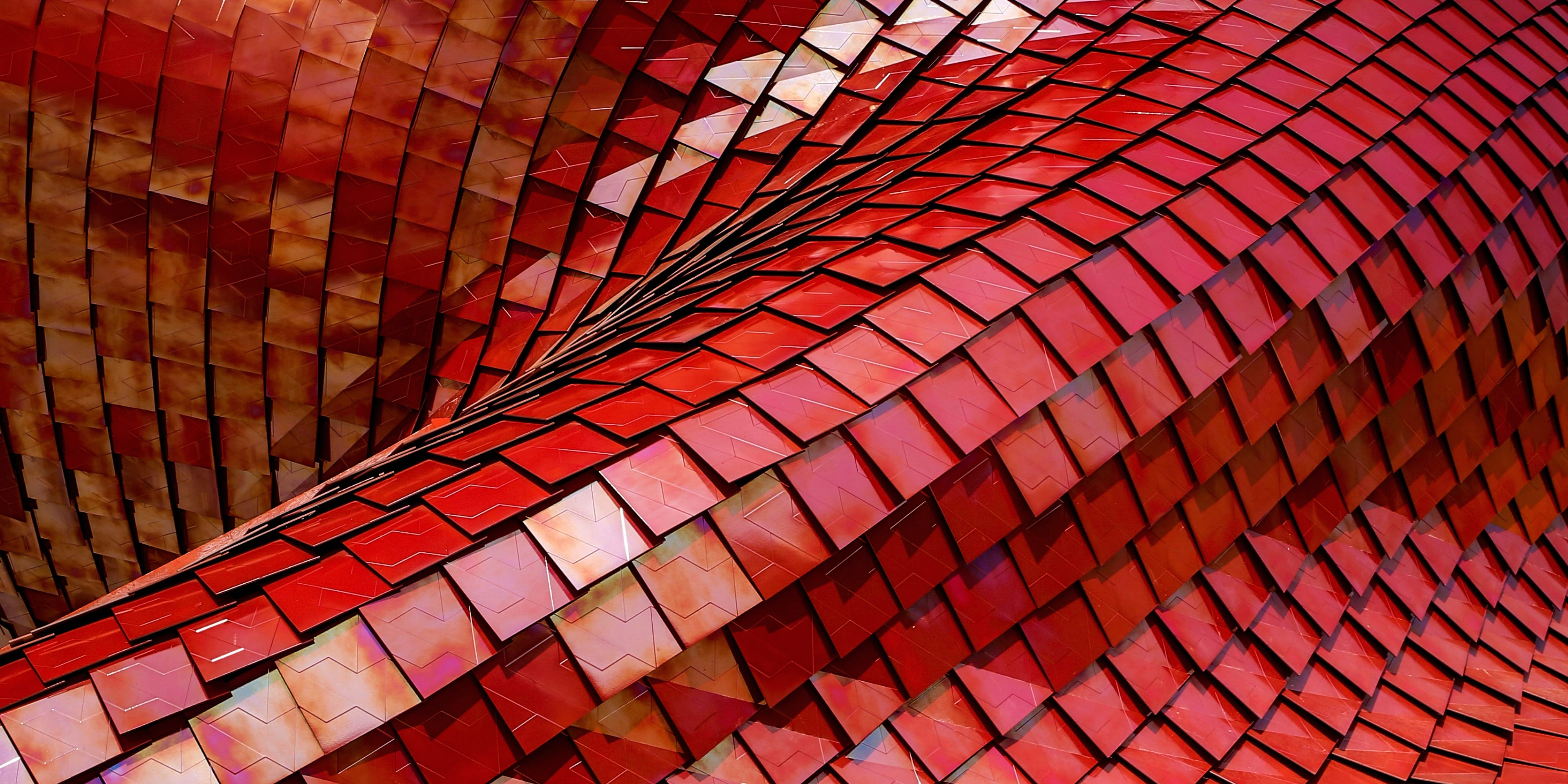



Die Identität der von der Polizei im Jobcenter Gallus/Frankfurt erschossenen Arbeitslosen ist immer noch unklar. Die Behörden wollen nicht sagen, wer sie war und ob es sich dabei vielleicht um eine Muslimin handelte.