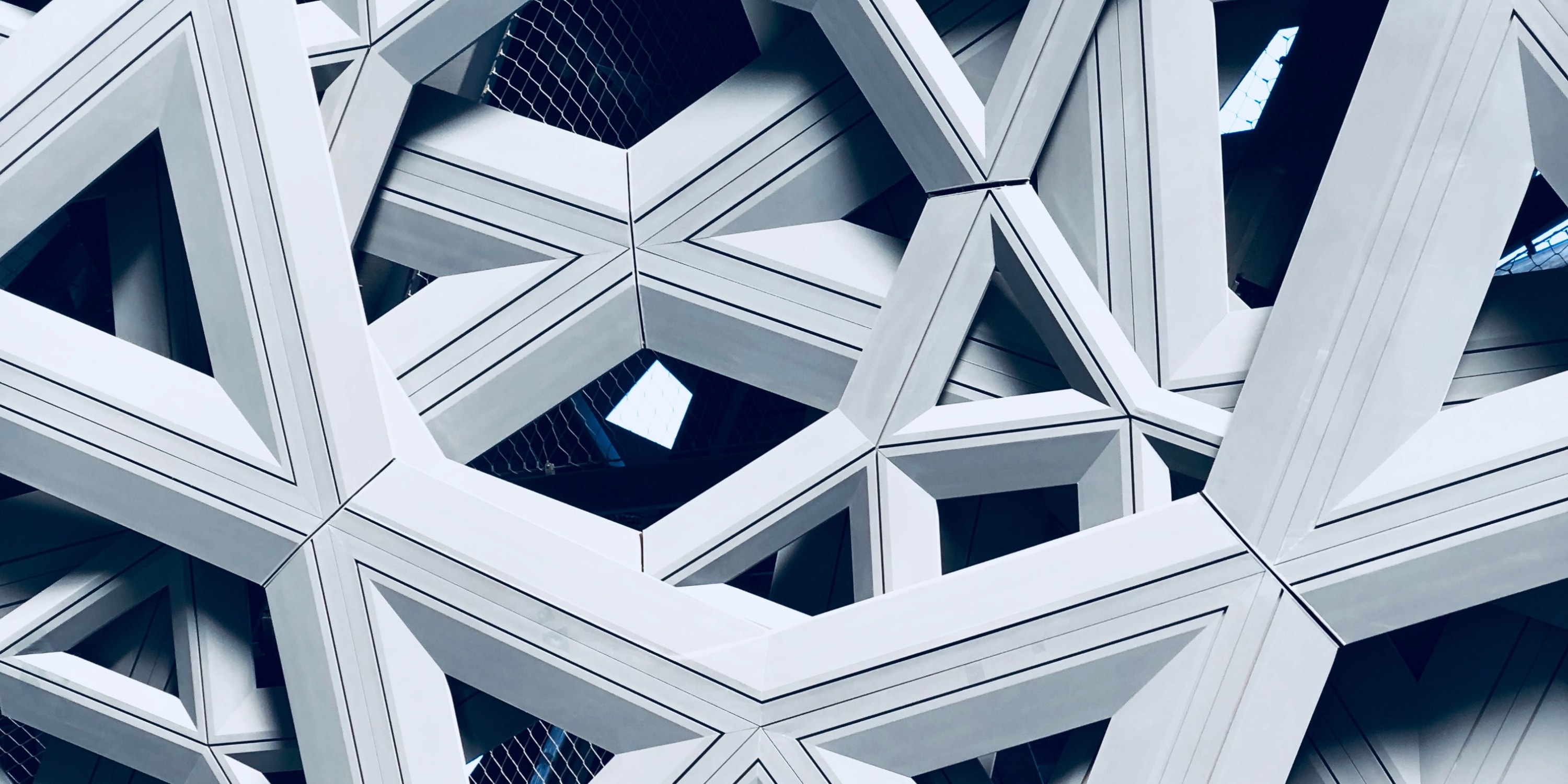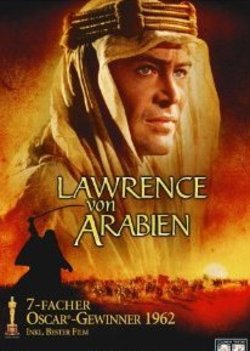
Filmplakat. Photo: de.qantara.de
Wüstenfüchse
Der Besitzer des Hauses, in dem ich wohne, war einst Adjudant von Rommel und der Verwalter sein ehemaliger „Bursche“, von ihnen weiß ich, dass die Soldaten in der Wüste alles andere als „Füchse“ waren – im Gegensatz zu den Beduinen etwa, die sich jedoch im Zweifel eher piratisch bzw. partisanisch als soldatisch organisieren.
Es gibt nicht wenige Partisanentheoretiker, die einen Guerillakrieg in der Wüste eigentlich als ungewinnbar ansehen müßten – der BBC-Programmchef Steward Hood z.B., wenn er in seiner Autobiographie „Carlino“ meint, dass mit dem Verschwinden des Maquis und der Wälder sowie auch der Bauern in Europa kein Partisanenkampf außerhalb der Städte mehr möglich sei. Dabei gilt sein englischer Schriftstellerkollege T.E. Lawrence, der als Geheimdienstoffizier im Ersten Weltkrieg den erfolgreichen Aufstand der Araber mit organisierte, quasi als der Erfinder des Partisanenkampfes in der Wüste – der in diesem Fall gegen das von Deutschen unterstützte türkische Militär ging. Sein Rechenschaftsbericht darüber – „Die Sieben Säulen der Weisheit“ wurde berühmt (und verfilmt), George Bernhard Shaw schrieb nach der Lektüre: „…zu dem Genie von Lawrence gehört auch literarisches Genie.“ Der Titel bezieht sich einen der Sprüche Salomons in der Bibel: „Die Weisheit bauet ihr Haus und hieb sieben Säulen“.
Beim jetzigen „Aufstand der Araber“ gab der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) Uhlau unlängst zu Protokoll: „Tunesien war letztlich eine Überraschung.“ Ähnlich war es auch zu Lawrence‘ Zeiten: „Das Wissen über die Machtverhältnisse der arabischsprachigen Völker und die Landesnatur führte zu der Schlußfolgerung, dass der Ausbruch einer solchen Rebellion begrüßenswert wäre, und bot sogar konkrete Hinweise auf ihre Abläufe und Methode. Gleichwohl kam der Aufstand des Scherifs von Mekka für die meisten mehr oder weniger überraschend.“
Die erste „Umschulung“ – vom Archäologen zum Partisanenführer in der arabischen Wüste – bekam Lawrence von seinem militärischen Mentor Hogarth, der ihm „klar die Kräfte zeigte, „die hinter den verlausten Lumpen und schmierigen Bälgen, was die Araber für uns waren, verborgen waren.“ Im Laufe der Streifzüge mit „seiner“ Kamelreitertruppe sah „Lawrence von Arabien“ dann bald genauso wie sie aus. Er mußte sich damit gegen seine Vorgesetzten in Kairo durchsetzen, die „das Tragen von Eingeborenenkleidung“ nicht „für uns angemessen“ hielten. Ein Stammesführer brachte ihm dann das Reiten auf Kamelen bei, d.h. die „Fähigkeit, die Stammesaraber auf dem Marsch zu begleiten, ohne ihre Ordnung und Stetigkeit zu stören“. Während „seine“ beduinischen Reiter sich von der Gegend um Mekka bis nach Damaskus gewissermaßen durchschlugen, kam ihm „der Gedanke, daß die Erhebung Arabiens gewissermaßen eine Pilgerfahrt in umgekehrter Richtung werden könnte, eine Pilgerfahrt, die dem Norden – Syrien – ein anderes Ideal bringen würde: den Glauben an die Freiheit an Stelle ihres früheren Glaubens an eine Offenbarung.“
Dieser „Freiheit“ setzte jedoch die von den Franzosen und Engländern insgeheim beschlossene Aufteilung des arabischen Territoriums Grenzen – noch bevor die türkische Besatzung daraus vertrieben war. Lawrence spielte also ein doppeltes Spiel, als er die Freiheitskämpfer anführte. Denn einerseits hatte die englische Regierung den Arabern zugesagt, „sie bei der Errichtung selbständiger Regierungen in Syrien und Mesopotamien“ zu unterstützen, andererseits hatte sie mit Frankreich und Rußland insgeheim vereinbart, „einen Teil der den Arabern zugesagten Gebiete zu annektieren“. Und dann hatte man den Juden in Europa auch „noch zweideutige Versprechungen in Hinsicht auf Palästina“ gemacht. Lawrence kam sich deswegen zunehmend als „Verräter“ an der Sache der Araber vor: „Wäre ich ein ehrlicher Ratgeber, so hätte ich den Leuten sagen müssen, nach Hause zu gehen und nicht länger ihr Leben für eine solche Gaukelei aufs Spiel zu setzen“. Seine „Mitschuld an dem Betrug, den wir den Arabern angetan hatten“, nagte an ihm, aber die immer größeren Erfolge seines „Nomadenheeres“ – bei der Einnahme von Garnisonen und der Sprengung von Zugstrecken sowie -Brücken – gaben ihm jedesmal wieder neuen Elan und zwangen ihn „zu der volkstümlichen Haltung natürlichen Vertrauens auf den Aufstand“. An anderer Stelle schreibt er: „Selbst ich, der Außenstehende, der gewissenlose Betrüger, der eine fremde Nationalidee entfachte, fand eine Befreiung vom Selbsthaß und dem ewigen Sich-selber-Erforschen darin, daß ich ihre Bindung an die Idee nachahmte“.
Dennoch mußte er sich eingestehen, daß „für den Vernunftmenschen Nationalitätskriege genau so ein Betrug sind wie Religionskriege“ – und zugeben, dass die Araber ihm mitunter sehr fremd waren: „Vor dem Atem unseres Willens trieben sie dahin wie Spreu im Wind und waren doch nicht Spreu, sondern die Tapfersten, Einfachsten und Lustigsten aller Menschen“. Diese „Krieger“ waren im Gegensatz zu den Europäern der Meinung, „daß der langsamste Tod der mildeste von allen ist, denn ein Zustand, in dem man nichts mehr zu hoffen habe, bewahre einen vor der Bitternis aussichtslosen Widerstands und ermögliche es der Menschenseele, sich ungehemmt auf die Gnade Gotter vorzubereiten“. Gleichzeitig machte „ihr hedonistischer Zug“, dem sie stets nachgaben, „sie zu wehrlosen Sklaven materieller Genüsse“. Und speziell „die Beduinen sind ein eigenartiges Volk. Für den Engländer war es schwer, mit ihnen umzugehen, besaß er nicht eine Geduld, weit und tief wie das Meer. Sie waren völlig Sklaven ihrer Begierden.“ Kam noch hinzu: „Meine Leute waren Blutfeinde aus 30 verschiedenen Stämmen“.
Der „stets glattrasierte“, familienlose und noch auf dem Kamel lesende Lawrence war für sie jedoch ebenfalls sehr fremd: „In der schwachbevölkerten Wüste kannte jeder achtbare Mann den anderen, und an Stelle von Büchern studierte man Familiengeschichten“. Und dann waren sie extrem abergläubisch: Bei Mißerfolgen zu sagen, dass bei diesem Unternehmen nichts glücke, konnte leicht die gefährliche Folge haben, „daß man darauf verfiel, daß einer uns den bösen Blick habe“. Zudem sind sie zwar von „ungewöhnlich schneller Aufffassungsgabe, überschätzen diese Fähigkeit aber – und eine Truppe leidet immer darunter, wenn sie keine Achtung vor dem Feind zu haben vermag“. In Summa: „Hunger, Müdigkeit, Hitze oder Kälte und der teuflische Zwang, unter Arabern leben zu müssen. Das führte zu etwas Unnormalem“. Trotzdem achtete er ihren Stolz und bemühte sich, ihr „Selbstbewußtsein“ zu stärken und sie nicht zu demütigen. Nachdem seine Truppe Dera eingenommen hatte – als die Engländer sich gerade anschickten, das selbe zu tun, und der englische General Barrow glaubte, die Araber „wie ein besiegtes Volk behandeln zu müssen“, erklärte Lawrence ihm „mit ruhiger Entschiedenheit: „er wäre hier mein Gast“. Dem General blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen – das galt sogar für die Pferde seines Stabes: „Er bat mich, neben ihm zu reiten; aber die britischen Pferde konnten mein arabisches Kamel nicht ausstehen, so dass der ganze Stab genötigt war, neben dem Damm zu reiten, während ich stolz mitten auf der Straße dahinzog.“ Währenddessen arbeitete sein Kopf „fieberhaft, um bei dem Zusammentreffen beider Völker [in der eingenommenen Stadt] die unseligen ersten Schritte zu vermeiden, durch die der phantasielose Engländer, bei bestem Willen, gemeinhin die nachgiebigen Eingeborenen der Zucht der Selbstverantwortung beraubt und eine Lage schafft, die wieder gutzumachen es dann Jahre der Werbung und allmählichen Reformen bedarf.“
Dennoch brauchten die Irregulären die Unterstützung der englischen Armee, an der ihm besonders „die Masse Inder“ störte: Sie schienen ihm „wie Schafe dieser Wüste unwürdig“. Er „empfand etwas Kümmerliches und Beengtes an der indischen Soldateska, eine wohlbedachte Unterwürfigkeit, grundverschieden von dem unbefangenen Freimut der Beduinen. Die Art, wie die britischen Offiziere mit ihren Leuten umgingen, entsetzte meine Leibgarde, der persönliche Ungleichheit ein fremder Begriff war.“ Kam noch hinzu, dass die Soldaten uniformiert waren und „diese Livree des Todes war das Zeichen dafür, dass sie sich mit Leib und Seele dem Staat verkauft und sich zu einem Dienst verpflichtet hatten, der deshalb nicht weniger verächtlich war, weil er freiwillig übernommen wurde.“
Obwohl Lawrence sich nicht als „Held“ begriff und als englischer Intellektueller das „Heldentum“ generell ablehnte, akzeptierten die Beduinen seine Führerschaft bald derart, dass sie zu ihm kamen, damit er ihre „Streitigkeiten“ schlichte. Während eines einzigen „sechstägigen Zuges ereigneten sich folgende Zwischenfälle, die beigelegt werden mußten: zwölf bewaffnete Angriffe, vier Kamelentführungen, eine Heirat, zwei Diebstähle, eine Scheidung, vierzehn Blutfehden, zweimal böser Blick und eine Bezauberung“. Und dann mußte er laufend existentielle Entscheidungen für andere treffen: Bei der Frage, ob man z.B. ein Brücke auf den Weg nach Amman sprengen solle, rechnete er: „Das Ganze konnte uns an die 50 Mann kosten, ich schätzte den Wert der Brücke aber für uns auf keine fünf“. (*)
Als er einmal zehn Tage krank im Zelt lag, begann er, seine bisherigen Guerillaerfahrungen zu durchdenken: „Wie meist in solchem Zustand wurde mein Geist klarer, meine Sinne schärften sich; und so begann ich denn zuletzt, methodisch über den arabischen Aufstand nachzudenken…“ Außerdem begann er, „das Problem von dem Ziel im Kriege von allen Seiten zu betrachten…“ Dabei fand er den Anfang einer „brauchbaren Theorie“: Das Kriegsziel der Araber war „geographischer Natur“, d.h. sie wollten die Türken aus allen arabischsprachigen Ländern vertreiben. Im Guerillakrieg gehe es jedoch nicht wie im Staatenkrieg um die „Vernichtung des Gegners“ mit dem Mittel einer „Schlacht“, sondern darum, möglichst wenig Kämpfer zu verlieren: „da die Araber für die Freiheit kämpften, eine Annehmlichkeit, der nur ein Lebender sich erfreuen kann.“ Während bei den Türken „der Mensch weniger hoch eingeschätzt wurde als seine Ausrüstung“. Überhaupt pflegten die Regierungen die Menschen „nur als Masse zu sehen; aber unsere Leute waren als Irreguläre keine festen Formationen, sondern Individuen.“ Später, als die „geschlagene türkische Armee“ sich auf dem Rückzug befand und in „verhungerte, müde, wunde und waffenlose Geschöpfe“ verfiel, weigerten sich die Stammeskrieger, „solcherart Gefangene zu machen“: Sie wurden „den Burschen und Mädchen der Dörfer als Knechte geschenkt“.
Lawrence begriff „seine“ Kamelreiter-Gruppen und -Verbände sowie seine „Leibgarde“ als so etwas wie ein „umherströmendes Gas“, ungreifbar, während „Armeen“ ihm wie „Pflanzen“ vorkamen – „unbeweglich, im Boden wurzelnd.“ Ihre osmanisch-deutschen Gegner schätzte er so ein: „Die Türken waren stumpfsinnig und die Deutschen, die hinter ihnen standen, dogmatisch. Sie würden denken, daß Aufstand genau dasselbe wäre wie Krieg, und ihm nach Analogie des Krieges zu begegnen versuchen.“ Während es für sie nur „Begegnungskriege“ gab, „mußte unser Krieg ein solcher des Ausweichens sein…Unsere Trümpfe waren Schnelligkeit und Zeit, nicht aber Vernichtungsfähigkeit. Die Erfindung der Fleischkonserve brachte uns mehr Vorteil als die Erfindung des Schießpulvers.“
Zwar hatten die Aufständischen Rückendeckung von der englischen Armee, aber diese war so „schwerfällig“, dass es lächerlich war, „anzunehmen, dass sie Schritt halten konnte mit so etwas Flüchtigem und rein Geistigem, wie es die arabische Bewegung war“. Lawrence war zwar von diesem Krieg begeistert, aber nach einem gelungenen Überfall bemerkte er: „Die türkischen Verwundeten blieben draußen liegen und waren am nächsten Tag tot. Das war unentschuldbar wie die ganze Theorie des Krieges“.
Wie die Deutschen heute mit dem islamischen „Aufstandsproblem“ fertig werden wollen, kann man in dem umfangreichen Buwe-Handbuch „Theorie des Irregulären – Partisanen, Guerilla und Terroristen im modernen Kleinkrieg“ von Dirk Freudenberg nachlesen, ich komme darauf zurück. „In den Handbibliotheken von Militärwissenschaftlern und Polemologen sollte das Werk auf keinen Fall fehlen,“ schreibt die Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ). Neben T.E. Lawrence, Carl Schmitt und Herfried Münkler (**) hat Freudenberg vor allem die Kleinkriegs-Klassiker bis hin zu Ché Guevara studiert – um wieder mal auf gut Deutsch ihre Erkenntnisse als Staatssicherheitswissen gegen sie zu wenden. Es ist also ein schweinöses Buch, zum Glück brunzdumm. Mit dem von Lawrence‘ hat es bloß das gemein, dass darin mehrmals – wie auch in „Die sieben Säulen der Weisheit“ – von „Nachhaltigkeit“ die Rede ist. In dem einen geht es dabei jedoch gegen die Türken und Deutschen und in dem anderen von diesen ausgehend nun gegen die Araber (Stichwort: Al Quaida). Es ist sozusagen die lehrbuchhafte Umsetzung der neuen Nato-Verteidigungsstrategie – gegen den militanten Islam (***). Dabei sollen aus Soldaten Partisanen gemacht werden, bloß „stellt der irreguläre Krieg,“ wie bereits Lawrence feststellte, „viel mehr Anforderungen an die Intelligenz als der Angriff einer regulären Armee.“
An einer Stelle seines Rechenschaftsberichts heißt es: „In Um Kes – zwischen Haifa und Dera – ist das alte Gadara, die Geburtsstätte des Menippos und des Meleager, des unsterblichen griechischen Syriers, dessen Schriften den Höhepunkt der syrischen Philosophenschule bedeuten. Der Ort liegt genau oberhalb der Jarmukbrücke, eines stählernen Meisterwerks, dessen Zerstörung meinen Namen rühmlichst in die der Schule von Gadara einreihen wird.“ Was hat die Sprengung einer Brücke mit Philosophie zu tun? Theodor Mommsen urteilte über den Genannten, Menippos von Gadara: In seinen Schriften bewies „er in Exempeln und Schnurren, dass außer dem rechtschaffenen Leben alles auf Erden und im Himmel eitel sei, nichts aber eitler als der Hader der sogenannten Weisen.“ Er war „der echteste literarische Vertreter derjenigen Philosophie, deren Weisheit darin besteht, die Philosophen zu verhöhnen.“ Wer wird da mit der Sprengung einer Brücke verhöhnt? Die westliche Moderne – aus deren technologischem Wissen sie entstand? Lawrence schreibt: Die „Überfälle“ der wilden arabischen Horden, denen es dabei vor allem um Beutemachen ging, „zeigten so recht die Hemmnisse, die sich der neugeschaffenen türkischen Armee mit ihrer komplizierten Organisation nach überwiegend deutschem Muster entgegenstellten.
Seitenlang läßt er sich über die Gängigkeit und Gemüter seiner diversen Kamel-Stuten aus, die er während des Aufstands zuschanden ritt. Sie sind im übrigen die einzigen „Frauen“, die in seinem Bericht vorkommen: „In der ganzen arabischen Bewegung vom Anfang bis zum Schluß gab es nichts Weibliches, außer den Kamelen“. Immerhin haben sie „einen weicheren Gang, sind gutartiger und machen weniger Lärm als die Hengste“. Die arabische Frau „nahm lediglich die körperliche Seite des Mannes in Anspruch, während seine seelische nur unter seinesgleichen sich ausleben konnte.“ Lawrence war homosexuell und damit unter den beduinischen Kämpfern in guter Gesellschaft. Seine „Unschuld“ verlor er allerdings bei einer Vergewaltigung durch türkische Soldaten, nachdem sie ihn gefangen genommen hatten. In einigen Ausgaben seines immer wieder zensiert herausgegebenen Berichts findet sich noch der Hinweis, dass diese brutale Prozedur ihm nicht nur unangenehm war.
In seinen Essays „Der Mensch in der Revolte“ schreibt Albert Camus: In der „Bewegung der Revolte“ werde die Vereinsamung der Individuden überwunden, hinzu komme, dass aus ihr eine „Bewußtwerdung, und sei sie noch so unbestimmt, erwächst. Das Bewußtsein tritt zusammen mit der Revolte an den Tag“. Diese übersteige damit den Einzelnen „in einem fortan gemeinsamen Gut“.
Ähnliches beobachtete T.E. Lawrence bei „seinen“ Leuten: „Als wir so dahinzogen, vom goldenen Sonnenlicht gleichsam miteinander verwoben, hatten wir das seltene Erlebnis, uns als ein Ganzes zu sehen und zu fühlen; wie von selbst wurden wir zu einem Organismus, zu einer ausgeprägten Gemeinschaft, und der Stolz eines jeden hob sich in dem Bewußtsein, ein lebendiger Teil der Gesamtheit zu sein.“ An anderer Stelle schreibt er über seine Leute: „Ihre Stimmung war gelassen, aber vertrauensvoll. Viele, die schon sechs Monate und länger im Dienste Faisals waren, hatten ihren hitzigen Feuereifer verloren, der mir in Hamra so aufgefallen war; dafür aber hatten sie an Erfahrungen gewonnen. Und Ausdauer im Kampf für ihr Ideal war vorteilhafter und wichtiger für uns als ihr früherer Überschwang. Ihre Hingabe war bewußt geworden.“ (Auch wenn sie das Öl auch weiterhin zum Einfetten ihrer Haare benutzten statt zum ölen ihrer Gewehre, wie Lawrence anmerkt.)
Eine ähnliche Entwicklung ließ sich jetzt auch bei den libyschen Rebellen gegen das Gaddafi-Regime beobachten: Ein deutscher Journalist berichtete vor einigen Wochen noch von der Front nahe Benghasi: Ihre schlechter Bewaffnung und mangelnde Kampferfahrung kompensieren die Rebellen mit Mut und Feuereifer – „aber das reicht nicht!“
Wenig später – am 9.3. – berichtet die Nachrichtenagentur AFP aus Benghasi: „Seit dem Beginn der Kämpfe haben sich tausende Libyer – Schätzungen zufolge sind es 6000 bis 8000 – dem Kampf gegen Gaddafi angeschlossen, haben sich mit Militärausrüstung und Fahrzeugen an die Front begeben und sich aus den Militärdepots der Region bedient. Aber Mut hin oder her – die mangelnde Organisation der Rebellen ist allgegenwärtig. Befehle werden über die Lautsprecher von hin- und herfahrenden Jeeps verbreitet. Auch der Übertritt ganzer Armeeeinheiten zu den Rebellen hat an dem Chaos bislang augenscheinlich wenig ändern können.“
Aber bereits am 13.Juni veröffentlichte der französische TV-Philosoph Bernard-Henri Lévy in der FAZ einen Frontbericht aus der umkämpften libyschen Stadt Misrate, in dem es heißt: „Die dritte Lehre schließlich lautet, dass aus der Schlacht um Misrata eine echte Armee hervorgegangen ist – diszipliniert, kriegserfahren, im Straßenkampf erprobt und vor allem furchterregend effizient. An den Fronten der Kyrenaika habe ich tapfere Menschen gesehen. Ich habe unerschrockene Chebabs bewundert, die bereit sind, jede Gefahr auf sich zu nehmen, um den Geist und die Einwohner von Bengasi zu verteidigen.“
Wenn man Lévy glauben darf, dann waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus Partisanen Soldaten geworden – und der Philosoph freut sich darüber ähnlich wie seinerzeit Lenin, der ebenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt die chaotischen Kampfweisen der russischen Partisanen als Hemmnis begriff. Der Partisanenführer und -theoretiker Lawrence versuchte demgegenüber nicht, die beduinischen Kampfformen in soldatische zu transformieren, sondern sie bloß zu „verbessern“ – schon allein um „seine“ Leute zu schonen (mit denen zusammen die englischen Offiziere den Kampf gegen die Türken anfangs erst noch lernen mußten, wobei „unsere Aufständischen kein Kanonenfutter waren, sondern unsere Freunde, die unserer Führung vertrauten“). An anderer Stelle schreibt er: „Als Masse war mit ihnen nicht viel anzufangen, denn sie besaßen keinen Korpsgeist, keine Disziplin und hatten kein Vertrauen zueinander. Je kleiner die Einheit, um so höher war ihre Leistung. Tausende von ihnen waren eine Herde, wirkungslos gegen eine Kompanie geschulter Türken, aber drei oder vier Araber in ihren Bergen konnten ein Dutzend Türken in Schach halten. Napoleon hat von den Mamelucken das gleiche gesagt.“
Wenig später konnte er bereits erfreut feststellen: „die Initiative der Kriegsführung war auf die Araber übergegangen.“ Sie bekamen Unterstützung von englischen Schiffen und Flugzeugen. Dabei „hätten die Araber fast Schiffbruch erlitten durch die Blindheit der europäischen Ratgeber dafür, daß Aufstand und Krieg etwas grundsätzlich Verschiedenes sind; ein Aufstand hat eher noch Merkmale des Friedens an sich – einen nationalen Streik, so könnte man ihn vielleicht nennen.“ Ihr Aufstandsführer Faisal bemerkte ebenfalls – jedoch „mit leichter Trauer: ‚Wir sind jetzt keine Araber mehr, sondern ein Volk‘.“
Die englischen Militärs, an ein strenges Kastensystem gewöhnt, hatten auch deswegen Schwierigkeiten im Wüstenkampf, weil sie einen „engen Zusammenhang zwischen Führer und Mann“ nicht gut aushielten: „Die Araber kannten keine Unterschiede, weder der Geburt noch des Standes, außer der selbstverständlichen Vorherrschaft, die man einem berühmten Scheik kraft seiner natürlichen Überlegenheit einräumte. Sie sagten mir, keiner könnte ihr Führer sein, es wäre denn, er teile ihre Kost, trüge ihre Kleider, lebe in gleicher Weise wie sie und zeige sich dabei noch tüchtiger und fähiger als alle anderen.“ Darum bemühte sich Lawrence denn auch. Obwohl seine „eigne Vorstellung vom Wesen des arabischen Krieges [zunächst] noch unzulänglich war. Ich hatte noch nicht erkannt, daß im Predigen der Sieg lag und Kämpfen nur Blendwerk war.“
Ähnlich wie anfangs beim libyschen Aufstand (im März/April 2010) entwickelte auch der arabische Aufstand einen regelrechten Sog: „Auf der Straße nach Wedsch wimmelte es von Freiwilligen, Gesandtschaften und großen Scheiks, die kamen, um Treue zu schwören,“ schreibt Lawrence. Das wirkte sich wiederum motivierend auf die noch unsicheren Stämme aus. Die ersten Erfolge der Aufständischen im Kampf gegen die Türken motivierte zudem die englische Militärführung, die Araber mit noch mehr Geld und Waffen zu unterstützen. „Die arabische Bewegung wurde im besten Sinne national,“ bemerkt Lawrence, der „sehr auf die Ehre der Araber bedacht war“ – und seinem Oberkommando in Kairo sowie Feisal in Mekka nur noch von der während seiner Krankheit ausgearbeiteten „Strategie und Taktik des irregulären Krieges“ überzeugen mußte: 1. irreguläre Truppen können keine festen Plätze angreifen und von daher keine Entscheidungen erzwingen; 2. sie sind zum Angriff ebenso wie zur Verteidigung von Stellungen ungeeignet; 3. ihr Wert beruht „nicht auf der Stoßkraft ihrer Front, sondern auf ihrer weiten Tiefenausdehnung“…
„Richtig verstanden, war die höchste Unordnung unser Gleichgewicht.“ An anderer Stelle spricht er von einer „Zufallkriegsführung“, zudem „operierten“ sie „nicht in festen Formationen, sondern in kleinen Abteilungen, so daß die türkischen Flugzeuge unsere Stärke nicht feststellen konnten. Auch Spione vermochten das nicht, denn wir hatten nicht einmal selber die geringste Vorstellung, wie stark wir eigentlich von einem Tag zum anderen waren.“ Die „Herren vom englischen Stabe, die das Kriegführen so viel besser als ich verstanden, lehnten es zunächst ab, sich von mir unterrichten zu lassen, unter welchen besonderen Bedingungen die arabischen Irregulären kämpfen mußten.“ Dennoch gab man ihm bald alle „Vollmacht“, die er „in törichter Frönung mißbrauchte“. (****)
Kam noch hinzu, dass die arabische Bewegung, die zunächst „eine einfache klare Sache“ war, solange sie nur auf eigene Faust mit dem Feind zu tun hatte“, irgendwann „an das Waffenglück ihres großen Mitspielers – England – gebunden war“. Und damit stand es plötzlich nicht gut, weil die deutsche Offensive in Frankreich den Abzug von Truppen aus dem Orient erforderte. Aber schließlich war der Sieg doch da – einen Vorgeschmack auf Damaskus bekam er im befreiten Jerusalem: Ausgestattet als Major der englischen Armee mit den Abzeichen seines Range nahm Lawrence an der Einzugszeremonie am Jaffator teil, „dem schönsten Augenblick des Krieges für mich“.
Im Anhang seines Buches findet sich ein 1935 bei der Erstveröffentlichung weggelassenes Einführungskapitel, darin heißt es: „dieses Buch ist nur die Darstellung des Vormarsches der Freiheit in Arabien von Mekka nach Damaskus. Es ist bedabsichtigt, diesen Vormarsch zu rationalisieren, so daß jedermann sehen kann, wie natürlich und unausweichlich der Erfolg war, wie wenig von Führung und Intelligenz und wieviel weniger noch von der Hilfe von außen durch ein paar Briten abhing. Es war ein arabischer Krieg, geführt und gelenkt von Arabern für ein arabisches Ziel in Arabien. Mein eigener Anteil daran war gering…Wir durchlebten viele Leben während dieser verwirrenden Feldzüge und haben uns selbst dabei nie geschont; doch als wir siegten und die neue Welt dämmerte, da kamen wieder die alten Männer und nahmen unseren Sieg, um ihn der früheren Welt anzupassen, die sie kannten. Die Jugend konnte siegen, aber sie hatte nicht gelernt, den Sieg zu bewahren; und sie waren erbärmlich schwach gegenüber dem Alter. Wir dachten, wir hätten für einen neuen Himmel und für eine neue Welt gearbeitet, und die dankten uns freundlich und machten ihren Frieden. “ (*****)
Anmerkungen:
(*) Der Ökonom Rappoport hat am Beispiel der Verdi-Oper „Tosca“ ein ähnliches Kalkül angestellt: Inhaltlich geht es hierbei darum, dass der Polizeichef Scarpia der schönen Tosca verspricht, ihren Geliebten Caravadossi freizulassen, wenn sie mit ihm schläft. Er denkt jedoch gar nicht daran, den Rivalen am Leben zu lassen. Tosca wiederum verspricht, sich Scarpia hinzugeben, um Caravadossi zu retten. Sie will jedoch dessen Freilassung ohne diesen Liebesdienst erreichen. Für den Ökonomen in der Oper ist deswegen klar: „Weder für Scarpia noch für Tosca gibt es ein Argument, dass es besser wäre, den Markt zu respektieren – also ein ehrliches Spiel zu spielen -, als den anderen zu verraten.“ Und nun zur Preisbildung: Ausgehend von einem Gewinn von plus 5, kostet es Tosca minus 5, mit Scarpia zu schlafen, es bringt ihr aber plus 10, Caravadossi das Leben zu retten. Eine Täuschung Scarpias bei gleichbleibenden Preisen brächte ihr jedoch plus 10 ein (plus 10 für Caravadossi und plus 5 dafür, „der Umarmung Scarpias entkommen zu sein“). Der Ökonom schreibt ihr plus 10 an, weil es zwar wirklich unangenehm ist, Scarpia nachzugeben, aber nichts zu tun „ganz einfach gleich 0 ist“ – daher 0 plus 10 und nicht plus 5 plus 10. „Ist diese Wertsetzung gerecht?“ – Eine unbeantwortbare Frage, man kann aber sagen, „dass der Gewinn einer Entscheidung, der mit plus 10 beziffert ist, für Tosca zwar hoch genug ist, um sie zu interessieren, aber noch so niedrig, dass sie zögert: Plus 15 würde zu einer unmittelbaren Entscheidung führen! Auf der anderen Seite ist es die gleiche Gewinnminderung, die Scarpia dazu bringt, Caravadossi zu erschießen, wenn er von Tosca bekommt, was er begehrt.“ Das Ende der Geschichte sprengt jedoch – überraschend – den ganzen Handelsrahmen: Tosca tötet Scarpia!
(**) Herfried Münkler veröffentlicht quasi am laufenden Band Bücher über „Die neuen Kriege“. Der Autor ist seit einigen Jahren Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, davor war er Assistent des Frankfurter Marxforschers Iring Fetscher. Davon merkt man aber nichts mehr. Seitdem er den Gipfel deutscher Wissenschaftlichkeit erreicht hat, veröffentlicht er fast wöchentlich irgendwo einen Text. Seit dem Anschlag auf das World-Trade-Center kommt diesen eine gewisse Aktualität zu, insofern sie meistens Terrorismus, Partisanentum, Bürgerkriege und Staatenkriege thematisieren. Sein neuestes Buch greift all dies noch einmal auf und konzentriert es auf die These, daß „low intensity Konflikte“ – wie etwa die in Afghanistan, im Kongo und in Angola – nicht nur Rückfälle in Barbarei und in gleichsam vormoderne Kriegsführung bedeuten, sondern im Gegenteil auch bereits auf die zukünftig wieder mehr enthegten Kriege neuen Typs hinweisen.
Der deutsche Philosophieprofessor an der Humboldtuniversität analysiert aber die einzelnen „Konfliktherde“ nicht, auch zieht es ihn nicht nach Kabul oder Bosnien – also vor Ort, geschweige denn daß er sich Filmmaterial von dort ansieht oder Beteiligte interviewt. Er studiert vor allem die angesagte Literatur seiner Kollegen aus der Kriegs- bzw. Terrorismusforschung, bucht diesbezügliche Kongresse und verfolgt das Weltgeschehen ansonsten unaufgeregt über die Tagespresse. Das, was er anschließend daraus an eigenen Texten macht, könnte man neubürgerliche Politikwissenschaft nennen. Es ist der alte Versuch, gegenüber den an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten aufeinanderstoßenden Konfliktparteien und ihren Interpretationen des Geschehens und der Gegner so etwas wie eine dritte Position zu gewinnen – mittels eines Apparates aus scheinbar neutralen Begrifflichkeiten – wie etwa: „Asymmetrisierung“, „postheroische Gesellschaften“ und die „Hervorbringung eines zu interessierenden Dritten“. Dabei hebt Münkler immer wieder gerne bei Clausewitz und Carl Schmitt an. Wie sie strebt er eine Politikberatung an, für die er mit seiner Kurztext-Streuung – bis in den „Merkur – der deutschen Zeitschrift für europäisches Denken“ hinein – wirbt. Seine Position ist dabei etwa die eines stets sachlich bleibenden Bellizisten. Der jetzt gegenüber den sich seit dem Zerfall der Sowjetunion privatisierenden Kriegern wieder mehr die Verteidigungsminister ins Spiel bringen möchte, Vorbild dafür sind ihm anscheinend die „Kabinettskriege“. Münklers Bücher sind mithin staatstragende Werke. Sein letztes endet mit dem tiefsinnigen Gedanken: „Bei symmetrischen Konfliktkonstallationen…sind die Chancen von Lernen und Lernverweigerung tendenziell gleichmäßig verteilt; asymmetrische Konstellationen hingegen bringen Ungleichheiten bei Lernvermögen und Lernblockaden mit sich.“
Kurz davor ist auch noch von „Kreativität“ die Rede. Es ist dennoch keine Pisa-Studie (über Krisengebiete), sondern einfach der neueste Output eines Professors – aus dem Politikzentrum Deutschlands, in der Mitte Berlins. Genau so einen Stuß finden wir im alljährlichen Buch des New Yorker Globalisierungskritikers Richard Sennett oder in den Poemen des Charlottenburger Transformationsforschers Karl Schlögel – auf den gekalkten Seiten der Samstags-FAZ. Ohne Sinn und Verstand wird hier von einer höheren Warte aus abgewogen die postsowjetische Welt interpretiert. Der Verfall von Respekt, der osteuropäische Ameisenhandel, die blutigsten Hotspots. Was schert diese abgesicherten Akademiker die Gefahr, daß es immer schon zu viel Deutung gibt und nie genug Fakten – und daß die Akte durch Deutung am gefährlichsten für die Freiheit sind?! Sennett war sogar einmal ein Mitarbeiter und Liebhaber von Michel Foucault. Während Schlögel sich von links nach rechts fortfaselt: vom Maoisten bis zum Sänger der Marktwirtschaft. Münkler schreibt: „Im asymmetrischen Krieg sind die Medien selbst zu einem Mittel der Kriegsführung geworden“. An diesem Punkt wird dann bei den Medienforschern der Humboldtuniversität nebenan weiter gedacht, wo man von Homer bis Paul Virilio alles mitbedenkt („Terrorismus ist Guerillakrieg im Zeitalter der Medien“). Das ganze ist eine Art Ping-Pong-Spiel über Banden. Wobei sich dann aus Talkshows und Expertenrunden immer mal wieder ein „Highfligher in Science“ performatorisch herausmendelt. Aus mir spricht die Enttäuschung – darüber, daß nur wenig mehr dabei herauskommt. Münkler hat diesmal seinen Text sogar noch mit – völlig überflüssigen, geradezu bescheuerten – Photos angereichert.
Er schreibt: „Warlords und Warlordfigurationen“ galten lange Zeit als typisch für stecken gebliebene Modernisierungsprozesse, bei denen der Staat (noch) nicht zum Monopolisten der legitimen physischen Gewalt avanciert ist“, aber jetzt haben „die Warlords ihrerseits einen Modernisierungsprozeß durchlaufen“. In diesem Zusammenhang erwähnt er die Guerillera Kolumbiens, wobei der Gedanke, daß in diesem Land die „Warlords und Warlordfigurationen“ sich aus dem Regierungspersonal, den Killerkommandos der Grundbesitzer und den US-Beratern rekrutieren, bei ihm nicht einmal am Rande aufscheint. Das meinte ich mit „scheinbar neutraler“ Darstellung. Der deutsche Professor ist, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ein Wendehals und seine Publikationen legen Zeugnis von seiner Anpassung an den jeweiligen Diskurs-Mainstream ab, auf etwas vornehmere Art als der Springertiefelverlag, der seinen Mitarbeitern seit dem „11.9.“ eine Demutsadresse gegenüber dem Bündnis mit den Amis abverlangt. Wir gehen „in ausgesprochen unruhige und bewegte Zeiten hinein“, so lautet der allerletzte Satz in Münklers Buch „Die neuen Kriege“, d.h. die „Kriegsunternehmer“ sind wieder unterwegs, und die „Freiwilligen“ kämpfen „in vielen Fällen aus wirtschaftlichen Gründen“. Dies bezieht sich bei ihm konkret auf die serbischen „Tschetniks“, Münkler berichtet jedoch von keinem einzigen Fall – und so schreibt er sich von Krise zu Krise fort, holt mal hier bis zum 30jährigen Krieg aus und zählt dort mal eben alle Söldnerfirmen mit Sitz in London auf. Sind es wirklich nur sechs? wem gehören sie eigentlich? und haben einige vielleicht schon fusioniert? Der Leser erfährt nur: „In Schwarzfafrika ist (darüber) die Meinung verbreitet…“ Dann geht es hastig weiter zu den „Netzwerken der Mudschaheddin“, die ihre Kämpfer ebenfalls sehr „hastig“ rekrutieren. Manchmal hat es den Anschein, als wüßten unsere Terrorismusforscher bald nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht – weil ihr Gegenstand, die Terroristen, auch nicht mehr alle Tassen im Schrank haben…
(***) Auf der Bonner Hardthöhe erläuterte uns 1998 ein Bundeswehr-Major die neue NATO-Verteidigungsdoktrin – die gegen einen solchen oder ähnlichen neuen „Sinnzusammenhang“ (Navid Kermani) gerichtet ist: „Sie ist nicht mehr nach Rußland hin angelegt, die russischen Soldaten haben inzwischen die selbe Einstellung zum Krieg wir wir auch – sie wollen nicht sterben! Außerdem ist die Stationierung von Atomwaffen in Ungarn und Polen z.B. so gut wie gesichert, es geht eigentlich nur noch darum, wie viel wir dafür zahlen müssen. Ganz anders sieht es jedoch bei den Arabern aus, mit dem Islam. Deswegen verläuft die neue Verteidigungslinie jetzt auch“ – Ratsch zog er hinter sich eine neue Landkarte auf – „etwa hier: zwischen Marokko und Afghanistan“.
Derzeit ist der Dramatiker Heinrich von Kleist gerade wieder sehr gefragt – sein Partisanen-Agitationsstück, „Die Herrmannschlacht“, seine Romantik, sein Selbstmord. „Sterben gelingt jedem, aber Eigensinn ist Leistung,“ meinte kürzlich der unermüdliche Kleist-Inszenierer Armin Petras. Der Spiegel interviewte unlängst seinen Nachfahren Ewald von Kleist, ehemals Wehrmachtsoffizier und verhinderter Hitler-Attentäter, jetzt Rentner– über Bundeswehrsoldaten im antiislamistischen Kampf-Einsatz:
…Der Spiegel: Wer könnte einen Atom-Krieg führen? Die Atommächte USA und Russland bemühen sich um Abrüstung. US-Präsident Barack Obama hat sogar das Ziel ‚Global Zero‘, also die weltweite Abrüstung aller Atomwaffen, ausgegeben.
E.v.Kleist: Diese Vorstellung einer atomwaffenfreien Welt von Obama ist Quatsch. Kein Mensch, der bis fünf zählen kann, glaubt daran. Aber die Atomwaffen Russlands und der USA sind auch nicht das Problem.
Der Spiegel: Welche Waffen sind es dann?
E.v.Kleist: Wir sitzen hier und unterhalten uns, weil in der Vergangenheit die großen Atommächte, nämlich Amerika und Russland, die gleiche Einstellung zu Tod und Leben hatten. Beide sagten: Leben ist gut, Tod muss verhindert werden. Das sehen nicht mehr alle Länder so.
Der Spiegel: Wen meinen Sie konkret?
E.v. Kleist: Wir können uns noch alle an die Bilder erinnern, wie die iranischen Kinder mit grünen Bändern um die Stirn in die Maschinengewehrgarben der Iraker liefen. Die Eltern haben das geschehen lassen, weil sie glaubten, ihre Kinder erfüllten den Willen Allahs.
Der Spiegel: Atomwaffen spielten damals keine Rolle…
E.v.Kleist: Nein, aber in dem Wandel der Einstellung zu Leben und Tod liegt ein ganz entscheidender Punkt. Bin Laden hat vor einiger Zeit gesagt: Der Unterschied zwischen uns und euch ist: Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Ich fürchte, er hat recht.
(****) Im Anschluß an T.E.Lawrence lernten die Militärs jedoch dazu, nicht zuletzt wegen seines klugen Buches „Die sieben Säulen der Weisheit“. Im April 1965 veröffentlichte der Spiegel einen langen Artikel über die Bekämpfung von Partisanen in Vietnam und zuvor in Algerien:
…Auf Schleichpfaden im Dschungel, in Sampans auf Flüssen und Kanälen, in Gemüsetransportern und zuweilen Linien-Omnibussen streben die Guerillas nach Norden. Sie sollen sich in der Landesmitte mit jenen aus Nordvietnam eingesickerten Partisanen-Bataillonen vereinen, die seit Anfang Januar im annamitischen Hochland, zwischen Pleiku, Qui Nonh und dem US-Stützpunkt Da Nang operieren. Unbeeindruckt von der amerikanischen Escalation, bereiten sich die gutgerüsteten Einheiten aus dem Norden und die kampferprobten Partisanen aus dem Süden vor, im Bergland zur dritten Phase des Partisanenkrieges überzugehen: zum offenen Kampf in regulären Einheiten gegen die Armee. Die Partisanentaktik erlaubt es den Vietcong, aktive Kämpfer aus dem Delta für einen entscheidenden Schlag abzuziehen, ohne das verlassene Gebiet dein Feind – der Regierung – preiszugeben. Denn nach sechs Jahren Krieg und fast ebensolanger Herrschaft in den Reisdörfern am Mekong haben die Kommunisten das Delta längst mit einem lückenlosen Netz getarnter Guerillas und Funktionäre überzogen.
Die Armee aber hat nicht die Truppen, um loyale Bürger wirksam zu schützen. Dazu würde sie pro Dorf mindestens ein Bataillon brauchen. Diese Besonderheiten der Partisanentaktik haben US-Botschafter Taylor bei seinem letzten Besuch in Washington zu der von vielen Militärs belächelten Forderung veranlaßt, die Armee Südvietnams so lange zu verstärken, bis 25 Soldaten auf einen regulären Vietcong -Krieger kommen. Nur so glaubt der, ehemalige US -Generalstabschef einem Feind beizukommen, der die Taktik des revolutionären Krieges bis ins letzte verfeinert hat: eine Taktik, die es Männern in Räuberzivil mit Maschinenpistolen und Molotow-Cocktails im Atomzeitalter ermöglichte, vielfach überlegene Armeen zu zermürben, Regierungen zu stürzen und neue Staaten zu gründen. Denn Partisanen des Typs, der jetzt in den Dschungeln Indochinas die stärkste Militärmacht der Welt zur größten militärischen Anstrengung seit dem Koreakrieg veranlaßt, haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Welt mehr verändert, als Atomstrategen oder Raketentechniker es vermochten: Partisanen-Armeen eroberten China 1949 für den Kommunismus. Partisanen schlugen Frankreichs Expeditionskorps 1954 im ersten Indochinakrieg. Partisanen befreiten Kuba 1959 von der Batista-Diktatur und Zypern 1960 von britischer Kolonialherrschaft. Partisanen errangen auch für Algerien 1962 die Unabhängigkeit – und sind heute im Begriff, den USA in Südvietnam die erste militärische Niederlage ihrer Geschichte zu bereiten.
Die Partisanen haben die atomaren Barrieren, die den großen Krieg zwischen den Supermächten verhindern, längst mit Karabiner und Handgranate unterlaufen. Sie gaben mit einer Vielzahl von kleinen Kriegen der Welt ein neues Gesicht. Ihr Urahn heißt Karl Marx. Er prägte 1849, als noch Kavallerie-Attacken mit Lanze und Säbel die schlachtentscheidende Waffe waren, den revolutionären Begriff des „Partisanenkrieges“. Mit seiner Hilfe, so erklärte Marx, damals als Kriegsberichterstatter für die „Neue Rheinische Zeitung“ in Italien tätig, könnte sich auch eine kleine Nation, die um ihre Freiheit kämpft, gegen einen überlegenen Gegner behaupten, ja ihn sogar überwältigen. Fast ein Jahrhundert später wurde Chinas KP-Führer Mao Tse-tung, heute 71, zum-Klassiker dieser neuen Kriegsart. In einer schmalen Broschüre legte er 1938 unter dem Titel „Probleme der Strategie des Partisanenkrieges gegen Japan“ jene Grundsätze dar, nach denen er ein Jahrzehnt darauf das kontinentale China eroberte.
Mao prophezeite: „Der Partisanenfeldzug, wie er heute in China geführt wird,hat kein Vorbild in der Geschichte. Sein Einfluß wird sich nicht auf China … beschränken, sondern sich in der ganzen Welt bemerkbar machen.“ Der chinesische Partisanenkrieg -Theoretiker empfahl, den revolutionären Krieg in drei Phasen zu gliedern: Den „defensiven Rückzug“ in sorgfältig gesicherte Basisgebiete, einen Bewegungskrieg kleinster Kampfeinheiten, deren Überfälle und Sabotageakte „Moral, Kampfgeist und das militärische Leistungsvermögen des Gegners brechen“ sollen. – Das „wachsame Ringen“, in dem beide Seiten etwa gleich stark sind. Dazu rät Mao: „Richtig geführt und organisiert können die (zahlenmäßig größer gewordenen) Partisanenstreitkräfte den Gegner ununterbrochen in Atem halten, ihn übermüden und bis zur tödlichen Erschöpfung zermürben.“ – Die „Gegenoffensive“ mit regulären Streitkräften, nachdem der Feind erschöpft ist. Maos Lehre: „Die reguläre Kriegführung ist die hauptsächliche und Partisanenkrieg die untergeordnete Form. Falls wir dies nicht einsehen … falls wir verabsäumen, reguläre Armeen zu bilden, werden wir nicht in der Lage sein, den Feind endgültig zu schlagen.“
Von dem Chinesen, dessen militärische Schriften im Westen lange Zeit unbeachtet blieben, lernte zunächst Stalin. Die sowjetischen Partisanenverbände im Rücken der deutschen Front übernahmen im Zweiten Weltkrieg die von Mao empfohlene Gliederung. „In den vom Feind besetzten Gebieten“, befahl der sowjetische Diktator elf Tage nach dem deutschen Einmarsch im Juni 1941, „müssen Partisanen-Einheiten zu Fuß und zu Pferd … gebildet werden, um den Feind zu bekämpfen, überall den Partisanenkrieg zu entfachen, Brücken und Straßen zu sprengen, Telephon- und Telegraphenleitungen zu zerstören und die Wälder, Vorratslager und Eisenbahnzüge in Brand zu stecken.“ Ein sowjetisches „Handbuch für Partisanen“ erschien 1942, ebenso ein „Agenten-Handbuch“; sie enthielten detaillierte Anweisungen für Kampf und Sabotage hinter den feindlichen Linien. Seit 1944 befaßte sich auch die Felddienstordnung der Roten Armee in Kapitel XVII eingehend mit dem Partisanenkampf. Bei jedem sowjetischen Armee-Oberkommando wurde ein Partisanenstab gebildet; der Partisanen -Zentralstab arbeitete in Moskau. Sowjet-Generalleutnant Ponomarenko schätzt, daß der zweijährige Partisanenkrieg auf russischem Boden die Deutschen über 300 000 Tote gekostet hat. Stalin und Mao Tse-tung betrachteten die Partisanen als eine mächtige, aber keineswegs kriegsentscheidende Waffe, als eine Hilfstruppe für die reguläre Armee, die nach wie vor den endgültigen Sieg erkämpfen muß.
„Die strategische Rolle des Partisanenkrieges ist eine doppelte“, dozierte Mao, „die reguläre Kriegführung zu unterstützen und die eigene Kriegführung in eine reguläre umzuwandeln.“ Das demonstrierte der KP-Stratege im chinesischen Bürgerkrieg (1946 bis 1949). Bei Kriegsbeginn waren die nationalistischen Armeen des Marschalls Tschiang Kai-schek, der etwa vier Millionen Soldaten ins Feld schickte, den Kommunisten zahlenmäßig nahezu fünffach überlegen. Aber Maos Partisanen und quasi-regulären Streitkräfte, zusammen fast 900 000 Mann, kontrollierten bereits sechzehn zumeist über Nordchina verstreute Gebiete mit einer Bevölkerung von 100 Millionen Menschen. Von diesen Basen aus führte Mao pausenlose Angriffe gegen Nachschublinien und isolierte Verteidigungsstellungen der Nationalisten. Dabei drängten seine Partisanen den Gegner in die Defensive, eroberten eine Stadt nach der anderen und erbeuteten große Mengen Kriegsmaterial. Tschiangs schlechtbesoldete Soldaten desertierten; ihre zahlenmäßige Überlegenheit schrumpfte. Aus den kommunistischen Partisanenverbänden war eine reguläre Armee geworden, die Anfang 1949 bereits über 1,6 Millionen Mann zählte, während Tschiang nur noch über 1,5 Millionen verstreut kämpfende Soldaten gebot. Mit einer großangelegten Offensive überwand Mao im April 1949 den Jang tse-kiang und versetzte der Nationalisten-Armee den Todesstoß. Von Maos Sieg, von seiner militärischen Theorie und Praxis, profitierte General Vo Nguyen Giap, 55, ehedem Rechtsanwalt, heute Verteidigungsminister im kommunistischen Nordvietnam und möglicher Nachfolger seines Staatschefs Ho Tschi-minh.
Der erste Indochinakrieg, in dem sich Giap als Meister der Partisanentaktik erwies, begann Ende 1945, als Frankreich sich weigerte, die Unabhängigkeit der von Ho Tschi-minh ausgerufenen Republik Vietnam anzuerkennen Giap eröffnete den Kampf mit 30 000 Partisanen. Als das geschlagene, zeitweise fast 500 000 Mann zählende französische Expeditionskorps 1954 Vietnam verließ, hatte er nahezu 300 000 gut ausgerüstete Soldaten unter Waffen. Giap hielt sich zunächst streng an Maos Kriegsregeln, an die drei Phasen – Selbstbehauptung. Gleichgewicht und Gegenoffensive „Wir bildeten allmählich ein Netz von Paartisanen-Basen“, schreibt der General in seinem 1961 erschienenen Buch „Volkskrieg – Volksarmee“. „Auf der Karte des Kriegsschauplatzes vermehrten sich unaufhörlich die ‚roten Zonen‘ mitten im Herzen des besetzten Gebietes. Der Boden des Vaterlandes wurde Zoll für Zoll unmittelbar hinter den feindlichen Linien befreit.“ Erst im neunten Kriegsjahr gestattete die Partei ihrem Oberbefehlshaber Giap die entscheidende Schlacht. Die französische Kolonialarmee erlitt im Mai 1954 bei Dien-Bien-Phu ihr Stalingrad und verlor 16 000 Mann ihrer Elitetruppen. Die Genfer Indochinakonferenz teilte im gleichen Jahr Vietnam; der Norden wurde kommunistisch.
Giap hatte damit eine glänzendere militärische Leistung vollbracht als selbst Stalin oder Mao; er hatte zum ersten Male eine als selbständige Streitkraft auftretende Partisanenbewegung zum Siege geführt. Das hatte zwei Gründe: Den Vietnamesen war es gelungen, – ihre Partisanen-Gruppen allmählich in eine „reguläre und moderne Armee“ umzuwandeln, die schließlich – dank chinesischer Waffenlieferungen – nicht nur aus Infanterie, sondern auch aus anderen Waffengattungen bestand; „das ganze Volk“, wie es Giap marxistisch formuliert, „in einer festen Nationalen Front zusammenzuschließen, die auf dem Bündnis von Arbeitern und Bauern beruht“. Giap: „Darin liegt der Schlüssel zum Sieg.“ Das bestätigten nicht nur andere Bücher schreibende Praktiker des Partisanenkrieges. Das fanden auch jene französischen Obersten heraus, die in Vietnam gegen Giap fochten. Maos Schriften studierten und seine Lehren später in Algerien anzuwenden suchten. Einer von ihnen, Colonel Gabriel Bonnet, brachte den Partisanenkrieg auf eine quasi-matheimatische Formel. Sie lautet: RK = G + P. Das soll heißen: Revolutionäre Kriegführung ist die Summe von Guerilla-Kampf und psychologisch-politischen Operationen.
Im Guerilla-Kampf soll die zunächst kleine Partisanentruppe zu einer regulären Armee anwachsen, während ihr psychologisch-politische Operationen die Unterstützung des Volkes sichern, damit sich die Partisanen innerhalb der Bevölkerung „wie Fische im Wasser“ (Mao) bewegen können. Wer also, so folgert Bonnet, eine Partisanenbewegung zerschlagen will, muß zweierlei tun: verhindern, daß die Partisanen die Bevölkerung für sich gewinnen, und hart eingreifen, sobald sich aus diesen Partisanen eine reguläre Truppe bildet. Im siebenjährigen Algerienkrieg erprobten Frankreichs Kolonial-Obristen die bei General Giap gelernten Lektionen, von der psychologischen Beeinflussung der Bevölkerung, über die Methodik des Partisanenkampfes bis zur systematischen Anwendung der Folter. In den Jahren 1957 und 1958 säuberte General Massus berühmt-berüchtigte 10. Fallschirmjäger-Division die Stadt Algier Straße für Straße von bombenwerfenden Moslems. In den folgenden Jahren zersprengten Jagdkommandos der französischen Armee in einer Reihe blitzschneller Operationen die Feldtruppen der FLN; 1960 waren alle Einheiten der Algerischen Befreiungsarmee von Bataillonsstärke zerschlagen. Gleichzeitig begannen Indochina-erfahrene französische Offiziere auch den politischen Apparat der FLN aufzubrechen.
Als schließlich das Waffenstillstandsabkommen 1962 in Evian unterzeichnet wurde, zählte die Algerische Befreiungsarmee innerhalb Algeriens nach Ansicht des französischen Oberkommandos nur mehr 4000 Kämpfer, nach dem Urteil liberaler Franzosen etwa 10 000, die von insgesamt 60 000 Mann im Jahre 1959 übriggeblieben waren. Ihre stärksten Kräfte standen in den Nachbarländern Tunesien und Marokko. Wichtigster Arm der algerischen Befreiungsbewegung blieb deshalb ihr politischer Apparat, insbesondere die algerische Exilregierung, die einen unablässigen Druck auf die Weltmeinung ausübte; ihr verdankte sie schließlich den Sieg. Die Franzosen erlebten in Algerien kein Dien-Bien-Phu. Sie wußten zu verhindern, daß der Krieg die entscheidende „dritte Phase“ erreichte: In Algerien kämpfte niemals eine Rebellen -Armee in offener Feldschlacht wie in Vietnam. Aber der Krieg in Nordafrika war politisch und psychologisch nicht zu gewinnen. Frankreichs an Mao und Giap geschulte Obersten vermochten der algerischen Bevölkerung nur blinden Gegenterror, aber keine attraktive politische Alternative zu bieten. Deshalb mußten sie verlieren.
Auf Zypern scheiterten die Briten aus ähnlichen Gründen. Die Eoka-Kämpfer des pensionierten griechischen Obersten Georgios Grivas, genannt „Dighenis“, heute mit 66 Jahren hochdekorierter General und Oberbefehlshaber aller bewaffneten griechisch-zypriotischen Kräfte, brachten ihnen eine „empfindliche moralische Niederlage“ (Grivas) bei. Dabei hatten die zypriotischen Partisanen in den 46 Monaten ihres Kampfes (1955 bis 1959) nie mehr als 100 Maschinenpistolen, 40 Karabiner, 300 Pistolen und einige hundert Jagdwaffen gegen 40 000 Mann gut ausgerüsteter englischer Truppen aufzubieten. Grivas, den 300 britische Geheimagenten vergebens jagten, vermochte zwar mit seinen Untergrundkriegern nie zur offenen Feldschlacht anzutreten, aber er gewann, wie er selbst schreibt, „die vorbehaltlose Hilfe der Mehrheit der Bevölkerung“. „Wenn meine Stimme laut wurde“, berichtet Grivas stolz in seinem Buch über den Eoka-Kampf und Partisanenkrieg, in dessen Anhang nützliche Rezepte für Sprengstoffmischungen und Bombenfabrikation zu finden sind, „standen die Griechen der Insel hinter mir und waren zu jedem Opfer bereit.“ Für Grivas war nicht die physische Wirkung der Waffen entscheidend, sondern die verfeinerte psychologische Kriegführung; mit ihr zwang er England zu politischen Zugeständnissen und schuf die Voraussetzung dafür, daß Zypern 1960 ein unabhängiger Staat wurde.
Während Zyperns Eoka-Kämpfer die Weltöffentlichkeit mit Bombenwürfen und Flugblättern beunruhigten, begann Fidel Castro mit zwölf Verschworenen im Dezember 1956 seinen Partisanenkrieg in der unwegsamen Sierra Maestra auf Kuba. Als Diktator Batista am Neujahrstag 1959 ins Exil floh und tags darauf die ersten Rebellen in Havana einmarschierten, war aus dem Dutzend bärtiger Fidelisten ohne allzuviel Blutvergießen eine Armee geworden. Nur 250 Partisanen fielen für den Sieg Castros, der sich zu einem Meister der politisch-psychologischen Kriegführung entwickelte, zunächst auch die Amerikaner beeindruckte und das gequälte Volk Kubas mit dem Versprechen der Bodenreform für sich gewann. Fünfmal soviel Anhänger des gestürzten Batista-Regimes starben wenig später im Feuer der fidelistischen Exekutionskommandos. An der Seite Castros wurde der argentinische Arzt Dr. Ernesto („Ché“) Guevara, 37, der seinen Mao genau gelesen hatte, zum Experten des Partisanenkrieges.
Heute ist sein 1960 geschriebenes Buch „La Guerra de Guerillas“ – es erschien 1962 unter dem Titel „Der Partisanenkrieg“ auch im Militärverlag der DDR – als Nachschlagewerk für künftige Revolutionäre in Zehntausenden von Exemplaren auf dem südamerikanischen Kontinent verbreitet und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Guevara, zur Zeit Kubas Industrieminister, lehrt den Krieg aus dem Rucksack. Er macht den Partisanen zum ideologischen Wanderprediger, zum „Umgestalter der Gesellschaft“ insbesondere in unterentwickelten landwirtschaftlichen Gebieten, sieht aber wie die großen asiatischen Lehrmeister – den Sieg erst in der Nähe, „wenn die sich ständig vergrößernde Partisanen-Armee den Charakter einer regulären Armee annimmt“. Guevaras Partisanen-Rucksack ist nahezu unerschöpflich. Er birgt Unterwäsche zum Wechseln und wenn möglich ein zweites Paar Schuhe, aber auch Zucker, Salz, Schmalz, Zwiebeln. Knoblauch und Fischkonserven – wegen ihres hohen Nährwertes. Der reinliche Partisan – der auf Kuba ebenso wie im Dschungel Vietnams seine Nächte in einer Hängematte verbringt – packt Seife, Kamm und Zahnbürste hinzu und vergißt auch Penicillin, Aspirin und Malariamittel nicht. Er besitzt das Nötigste zur Waffenpflege, denn „der Lauf seines Gewehres muß spiegelblank sein“. Außerdem stopft ihm Guevara noch Notizbuch, Bleistift, Federhalter, Bindfaden, Nadel, Zwirn. Knöpfe, Streichhölzer und Feuerzeug, Topf, Teller, Löffel und Jagdmesser in sein Gepäck. Auch ein Buch, meint der Guerilla-Autor, sollte im Partisanen-Rucksack nicht fehlen, möglichst die „Biographie eines Volkshelden vergangener Zeit“, damit sich die Partisanen in ihrer reichlichen Freizeit nicht „unwürdigen Beschäftigungen“ hingeben.
Weil aber „all diese Dinge zusammengenommen nicht wenig Gewicht haben“ und außerdem automatische Waffen, Minen, Panzerfäuste und Munition zu schleppen sind, empfiehlt „Ché“, auf je zehn Kampf-Partisanen zwei bis drei unbewaffnete Träger-Partisanen zu beschäftigen. Sein Rat: „Die Bewaffnung des Partisanen soll die gleiche sein wie die des Gegners, um die ihm abgenommene Munition verwenden zu können.“ Von Folter und Terror hält Partisanen-Theoretiker Guevara erstaunlich wenig, es sei denn „in Sonderfällen ein Attentat“ gegen einen hochstehenden „Unterdrücker“. „Einfache Leute“ aus dem gegnerischen Lager dürften auf keinen Fall durch Terror beseitigt werden. Außerdem müßten die Partisanen, so lehrt Guevara, „alles, was die … sympathisierende Bevölkerung an Versorgungsgütern zur Verfügung stellt, voll bezahlen“, und sei es mit „Hoffnungswechseln“ auf den künftigen Sieg. Nur zweimal sind bisher, trotz der Rezepte Maos und seiner Schüler, Partisanenbewegungen nach jahrelangen Kämpfen unterlegen: 1950 in Griechenland und 1960 in Malaya. Ihnen gelang weder die Umwandlung in eine reguläre Armee, noch fanden sie auf die Dauer die Unterstützung der Volksmehrheit. Sechs Jahre brauchte die mit amerikanischer Hilfe nach Kriegsende neu aufgestellte griechische Armee, ehe sie den entscheidenden Sieg über die Partisanen der „Griechischen Volksbefreiungsarmee“ (Elas) errang. Zeitweilig beherrschten die kommunistischen Elas -Verbände, von der Sowjet-Union, Albanien, Bulgarien und – bis 1948 auch von Jugoslawien unterstützt, das ganze Land außerhalb der größeren Städte. Elas drohte auch Athen zu besetzen, hätten nicht britische Truppen eingegriffen und den Vorstoß abgewehrt. Mit zehnfacher zahlenmäßiger Überlegenheit und großzügiger Dollar-Hilfe siegte schließlich Griechenlands Feldmarschall Papagos.
In Malaya vermochten 80 000 Briten, Australier, Neuseeländer und Nepal -Gurkhas sowie 180 000 Mann malaiischer Miliz und Polizei erst nach zwölf Jahren (1948 bis 1960) etwa 8000 kommunistische Partisanen ausschließlich chinesischer Herkunft aufzureiben. Das gelang, weil Malaya keine gemeinsame Grenze mit einem kommunistischen Staat hat, also ausländische Hilfe spärlich floß, und seine zur Hälfte malaiische, zur Hälfte chinesische Bevölkerung den Partisanen schließlich Unterkunft und Verpflegung verweigerte. Englands Erfolge in Malaya suchten die USA in Südvietnam nachzuahmen. Dort hatte der zweite Indochinakrieg, den wiederum General Giap virtuos von Hanoi aus, dirigiert, 1957 mit einigen kleinen Partisanen-Scharmützeln begonnen, als die 1954 auf der Genfer Indochina-Konferenz für Juli 1956 versprochene „Wiedervereinigung durch freie Wahlen“ ausblieb. Die wichtigste Waffe der Vietcong war zunächst der Terror, mit dem sie sich Südvietnams bäuerliche Bevölkerung gefügig machten. Ihm fielen 1957 rund 470 Dorfälteste und örtliche Beamte zum Opfer. 1959 wurden bereits 1600 Dorfälteste ermordet; 1960 waren es 4000; insgesamt wurden etwa 13 000 getötet. Damit entglitt der Regierung in Saigon trotz amerikanischer Hilfe die Herrschaft über die 15 000 Dörfer ihres Landes. Ein Versuch – nach britischem Vorbild in Malaya-, jede Siedlung in ein befestigtes „Wehrdorf“ zu verwandeln, scheiterte 1962. Nur noch die größeren Städte und ihre nähere Umgebung blieben in der Hand des Regimes.
Die regulären Vietcong-Streitkräfte wuchsen von 8000 im Jahre 1960 auf heute 35 000 Mann, die lokalen Partisanen, die sich mit schlechten Waffen und halbem Sold begnügen müssen, auf fast 100 000. Eine Zeitlang versuchten die Amerikaner in Vietnam, die Partisanen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie rieten zur Aufstellung von südvietnamesischen Ranger-Kompanien, die non Amerikanern gedrillt und von US-Helikoptern zum jeweiligen Kampfplatz geflogen wurden. Die Ranger sollten nach Partisanenart kämpfen: den Feind überraschen, ihn nachts überfallen und sich danach blitzschnell zurückziehen. Aber auch die US-gedrillten Vietnam-Ranger schafften es nicht, der Vietcong Herr zu werden. Im Sommer 1964 schienen die USA ein neues Rezept für den Krieg in Vietnam entdeckt zu haben. Henry Cabot Lodge, Sonderbotschafter des amerikanischen Präsidenten, zitierte auf einer Pressekonferenz in Paris das Buch des französischen Obersten Roger Trinquier, das 1961 unter dem Titel „La guerre moderne“ (Der moderne Krieg) erschienen war. Die USA planten, so sagte Cabot Lodge seinen überraschten Zuhörern, in Südvietnam nach denselben Methoden vorzugehen, die Colonel Trinquier ursprünglich für die Bekämpfung der algerischen Rebellen ausgearbeitet habe.
Trinquiers Ideen hätten in Algerien „zu glänzenden Ergebnissen geführt“. Roger Trinquier, heute 57, zunächst Geschichtslehrer, später Offizier der französischen Kolonial-Infanterle, wurde in Indochina zum Experten des Partisanenkrieges, des „modernen Krieges“, wie er ihn nennt. In Algerien diente er als Adjutant General Massus und kommandierte als Oberst das 3. koloniale Fallschirmjäger-Regiment. Von Trinquier stammt der zunächst so erfolgreiche Plan, nach dem die „Paras“ die Kasbah, Algiers winklige Altstadt, Haus für Haus durchkämmten und die FLN-Kämpfer aus ihren Verstecken zerrten. Von ihm wurden auch jene weißen Söldner angeworben und ausgebildet, die 1961 für den Katanga -Präsidenten Moise Tshombé gegen die Uno-Truppen kämpften. Für diese Leistung wurde der Colonel von Tshombé, der inzwischen zum Kongo -Premier avanciert war, Anfang 1964 mit mehreren hunderttausend Franc entschädigt. Trinquiers Gedanken über den Partisanenkrieg, die Cabot Lodge so bemerkenswert fand, sind von brutaler Logik. Der Oberst macht keine geistigen Anleihen bei Mao oder General Giap, er denkt über sie hinaus. „Das Ziel des modernen Krieges“, sagt Trinquier, „ist die Eroberung der Bevölkerung. Der Terror ist dafür die geeignete Waffe.“ Und zwar, wie der Colonel lehrt, nicht nur für die Rebellen, sondern auch für die herrschende Macht, deren Regime gestürzt werden soll.
Trinquiers Analyse: „Wir haben uns im modernen Krieg nicht nur mit einigen bewaffneten Banden herumzuschlagen … sondern mit einer straff organisierten Geheimarmee, deren wichtigste Aufgabe es ist, der Bevölkerung ihren Willen aufzuzwingen.“ Und weiter: „Der Sieg kann nur erreicht werden durch die vollständige Zerstörung dieser (Untergrund-)Organisation.“ Trinquiers Schlußfolgerung: Wenn die revolutionäre Geheimarmee den Terror benutzt, um sich die Massen des Volkes gefügig zu machen, so ist der Gegenterror der Ordnungsmacht das legitime Mittel, um die von den Rebellen „eroberten“ Massen zurückzugewinnen und die Bevölkerung vor den Partisanen zu schützen. Für diesen „modernen Krieg“ entwirft Untergrund-Experte Trinquier ein besonderes Kriegsrecht, das eine Art Chancengleichheit zwischen dem Soldaten herkömmlicher Art und dem modernen Terroristen herstellen soll. Der Soldat erleide auf dem Schlachtfeld Verwundung oder Tod, schreibt der Colonel; der aus dem Hinterhalt operierende Terrorist aber müsse damit rechnen, wenn er gefangen werde, Schmerz oder gar Tod auf der Folterbank zu erdulden. Der Kolonial-Oberst empfiehlt, die schmerzhafte Befragung durch besondere „Spezialisten“ vornehmen zu lassen, die keine überflüssigen Fragen stellen. Meist genüge es, von den Gefangenen die Namen ihrer Vorgesetzten oder ihrer Untergebenen zu erfahren, um die Geheimorganisation aufzubrechen.
Die Bevölkerung aber gedenkt Trinquier durch ein fein verästeltes polizeiliches Kontrollsystem zu schützen. Jeder Bürger wird numeriert, in Karteien festgehalten, von Nachbarn unauffällig überwacht. Jeder bespitzelt jeden, doch der Verlust an Freiheit wird, wie der im Partisanenkrieg erprobte Kolonial -Infanterist meint, durch den Gewinn an Sicherheit reichlich aufgewogen. Kein Partisan könnte sich mehr „wie ein Fisch im Wasser“ (Mao) bewegen; er würde vielmehr zum „Gefangenen des Volkes“. Trinquiers „Dienstanweisung“ für den Partisanenkrieg klingt in sich sehr konsequent, doch konnte sie einer parlamentarischen Demokratie wie den USA kaum als strategische Richtschnur dienen. Überdies war die Chance für einen Sieg nach der Methode Trinquier bereits verpaßt. Amerikas Militär und Geheimdienstagenten hatten im November 1963 zugelassen, daß mit der Ermordung des südvietnamesischen Staatschefs Ngo Dinh Diem die einzige autoritäre Macht zerbrach, die im Kampfe gegen die Vietcong Terror und Folter als Gegenmittel hätte benutzen können.
Noch hat die Führungsmacht der westlichen Welt kein wirksames Mittel gefunden, um die drohende Niederlage in Südostasien abzuwenden. Weder das Studium der Schriften Mao Tse-tungs noch Taylors Ratschläge, noch die Terror-Methoden Trinquiers bieten einen Ausweg. Der Sieg scheint unerreichbar, die Kapitulation undenkbar. Beide Seiten haben sich festgerannt und den Kampf in den Dschungeln Indochinas zur grundsätzlichen Auseinandersetzung zwischen der Strategie der Partisanen und der konventionellen Kriegführung proklamiert. „Wenn wir diese kleine Nation in ihrem Kampf im Stich lassen, welche andere kleine Nation hat dann überhaupt noch eine Chance“, verteidigte Präsident Johnson den verschärften Krieg Amerikas in Vietnam. General Giap aber prophezeite: „Wenn wir die Amerikaner in diesem Krieg schlagen können, dann können wir sie immer und überall schlagen.“
Literatur:
– Mao Tse-tung: „Selected Military Writings“. Foreign Languages Press; Peking 1963.
– Vo Nguyen Giap: „People’s War -Peoplers Army“. Foreign Languages Publishing House. Hanoi 1961.
– Georgios Grivas-Dighenis: „Partisanenkrieg heute“. Bernhard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1964.
– Ernesto Ché Guevara: „Der Partisanenkrieg“. Deutscher Militärverlag. Berlin (Ost) 1962.
– Roger Trinquier: „La guerre moderne“. Editions de la Table Ronde, Paris 1961.
(*****) Der Literaturkritiker Stefan Weidner schreibt im Online-Magazin „de.qantara.de“:
„…Auf eine fast schon militant zu nennende Weise war Lawrence uneitel – nicht unbedingt im persönlichen Umgang, dafür umso stärker gegenüber der anonymen Öffentlichkeit. Dies führte unter anderem dazu, dass er, der ein reicher und von den Frauen umschwärmter Mann hätte sein können, ständige Geldsorgen und Zeit seines Lebens keine erotische Beziehung hatte.
In dieser Verweigerungshaltung gegenüber den Medien und den Versuchungen durch Reichtum und Anerkennung ragt er in das nächste, unser, 21. Jahrhundert hinein. Auf umgekehrte, nicht vorhersehbare Weise vollendet sich heute seine Geschichte: Ausgerechnet sein Anti-Heldentum hat das Potenzial, ihn zu einem richtigen Helden, einem Vorbild zu machen. Sein Vermächtnis ist dabei nicht realer, politischer, historischer Natur.
Von dem, was er, wenn überhaupt, politisch im Nahen Osten bewirkt hat, zunächst im Ersten Weltkrieg als britischer Verbindungsoffizier zur arabischen Rebellenarmee gegen die Türken, dann als Berater des Kolonialministeriums unter Churchill auf den Konferenzen zur Neuordnung des Nahen Ostens nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, ist wenig bis nichts mehr übrig…
Lawrence‘ Mimikry
„Mimikry/Mimese – Gefährlicher Luxus zwischen Natur und Kultur“, so hieß eine Tagung des Graduiertenkollegs „Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung“ der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main am 29.09.2005. Dazu schrieben die Veranstalter:
„Seit den Studien des Biologen Henry Walter Bates bezeichnet man mit dem Terminus Mimikry die Eigenart bestimmter Spezies, Merkmale anderer Arten zu imitieren. Einige Tier und Pflanzenarten täuschen das Erscheinungsbild einer anderen Art vor, indem sie deren ästhetische Merkmale und ihr Verhalten kopieren. Andere, wie das Chamäleon oder das Lebende Blatt, verschmelzen mit dem Hintergrund bzw. mit ihrer Umgebung und werden so unsichtbar – sie betreiben Mimese. Lebendiges gleicht sich Unlebendigem an. Tiere erscheinen pflanzenhaft, Pflanzen erscheinen wie Tiere. Camouflage vollzieht sich, indem der Raum bzw. räumliche Merkmale präpariert und modifiziert werden. Dabei gelingt die Täuschung nur, wenn der Beobachter eine bestimmte Position und Perspektive einnimmt. Die Lebewesen scheinen ihr Beobachtet-Werden mit einzukalkulieren, Sichtbarkeit schreibt sich in die Körper ein.
Andererseits ist der Vollzug der Mimikry/Mimese auch an zeitliche Parameter gebunden, beispielsweise an einen spezifischen Gestus der Bewegung. Der sich Tarnende entschlüpft der Zeit: Unbeobachtbar-Werden/Unerkennbar- Sein heißt zugleich, eine andere Zeitwahrnehmung zu eröffnen, die dem Beobachter nicht erreichbar ist. Verfahren der Mimikry lassen sich nicht ausschließlich mit Überlebenstechniken oder Selektionsmechanismen erklären. Die alleinige Reduktion auf die Anpassungsleistung übersieht, welch schöpferischer Reichtum diesen Erscheinungen zugrunde liegt. Mimikry ist luxuriös. In einigen Fällen wird der vermeintliche Schutzmechanismus sogar zur Gefahr, wie Roger Caillois am Beispiel der Phyllia gezeigt hat. Es ist, als ob die Natur Ähnlichkeiten ungeachtet des Aufwandes und der Nützlichkeit herzustellen ‚versucht‘. Produziert die Natur also Kunst? Das biologische Konzept der Mimikry/Mimese ist immer wieder auch für kulturelle Analysen fruchtbar gemacht worden…“
Die auf der Frankfurter „Mimikry-Tagung“ gehaltenen Referate wurden 2010 als Buch in der „Edition Argus“ veröffentlicht. Ein Text, von Eva Horn – „‚Like actors on a foreign theatre‘ – Kulturelle Mimikry im Great Game“, befaßt sich mit T.E.Lawrence‘ Rollenspiel im Arabischen Aufstand. Mit dem „Great Game“ ist die koloniale Geheimpolitik zwischen 1813 und 1917 gemeint – im geopolitischen Konflikt zwischen den imperialistischen Mächten England und Rußland um die Vorherrschaft in Zentralasien.
In dieser Region finden auch heute noch die Weltmachtkämpfe statt. Das „Great Game“ befindet sich mithin inzwischen in seiner dritten oder vierten Runde – im sogenannten „Postkolonialismus“: „Wer die mittelasiatischen Republiken beherrscht, beherrscht ganz Eurasien,“ meint der ehemalige US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski. Auch für andere neoimperialistische Geopolitiker, wie die Amerikaner Huntington und Kissinger und der Russe Alexander Dugin, ist „Zentralasien“ in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Dahinter stehen die riesigen Ölvorkommen der Region und die Einschätzung, dass China in zehn Jahren voraussichtlich so viel Öl brauchen wird, dass der Preis dafür nur noch von den Ländern bezahlt werden kann, die an diesem Verbrauch mitverdienen. In Washington konstituierte dich dazu die Arbeitsgruppe „Foreign-Oil-Companies“ und in China eine „2 plus 4“-Runde, „The Shanghai Six“ genannt: an der Rußland, China und vier zentralasiatische Republiken teilnehmen. Wer heute „einzige Weltmacht“ wird, ist oder bleibt, entscheidet sich allein in Zentralasien, darüber sind sich die geopolitischen Strategen einig. Die Bekämpfung des Terrorismus in Afghanistan und im Irak ist dafür wohl nur ein Vorwand. Und in diesem Vorwand wird auch jetzt wieder mit (postkolonialer) „Geheimpolitik“ gearbeitet.
Bestes Beispiel: die Zerstörung des World Trade Centers am 11.9. 2001, bei der die CIA bereits am selben Tag den Haupttäter – Osama bin Laden – bekannt gab, der zuvor über beste Beziehungen zur US-Regierung verfügt hatte. Seine vermeintliche Terrororganisation „Al Quaida“ war anfänglich kein US-Partner, sondern ein -Fake, wurde dann jedoch – ähnlich wie der zunächst auf US-Christenkreise gemünzte Begriff „Fundamentalisten“ – auch von radikalen Islamisten für sich benutzt. Bin Laden stand über den pakistanischen Geheimdienst bis zu seiner Ermordung in Kontakt mit der CIA. Bevor dies geschah, mußte die verzweifelte Suche nach ihm und anderen „Al Quaida-“ bzw. „Taliban“-Führern jedoch erst einmal dafür herhalten, Afghanistan zu überfallen. Als diese „Mission“ beendet werden sollte, wurde Bin Laden von den Amis erschossen – und seine Leiche im Meer versenkt. Damit war das US-Missionsziel – Rache für Nine-Eleven – quasi erreicht. Die Bild-Zeitung schrieb: „Die US-Marine betonte, auf muslimische Riten achtgegeben zu haben. Allerdings: Der Islam sei ‚ganz und gar gegen‘ diese Form der Beisetzung, sagte Mahmud Asab, Berater des ägyptischen Religionsführers Ahmed al-Tajeb. Warum diese Eile der US-Marine? Nach islamischem Brauch soll ein Toter innerhalb von 24 Stunden möglichst vor Sonnenuntergang bestattet werden.“ Ach so, alles klar.
Das ganze asisatische „Game“ – einschließlich der vielen Leute, die bei der Zerstörung des World Trade Centers zu Tode kamen, war ein dubioser US-Fake – das legt u.a. auch das neue Buch von Mathias Broeckers und Christian C. Walther „11.9. – zehn Jahre danach: Der Einsturz eines Lügengebäudes“ nahe. Es kommt dieser Tage auf den Markt, bereits im Vorfeld stieß es auf großes Interesse in den staatlichen Funk- und Fernseh-Redaktionen und sogar bei der „America Academy“ in München. Wie das? Die Amis und vor allen Dingen ihre bescheuerten Halbfreien, vorneweg die BRD, haben dieses Attentat „Nine Eleven“ derart gestretched, dass niemand – nicht einmal die „American Academy“ – mehr die US-Täterversion – „Al Quaida“ als ebenso raffiniertes wie globalisiertes islamistisches Terror-Netzwerk – hören will – deswegen müssen nun langsam neue Versionen her. Die von Broeckers vertretene hat inzwischen ebenfalls ein weltweites Netzwerk erschlossen – von Wissenschaftlern und Spezialisten, die laufend weitere Fakten bzw. Gedanken dazu beisteuern – und das schon seit Jahren. Der Nachteil dieser Version ist, dass auch sie dazu beiträgt, „Nine Eleven“ als Motiv für militanten Antiislamismus weiter am Kochen zu halten. Und selbst wenn sich früher oder später herausstellt, dass es wirklich irgendwelche selbständig handelnden und hassenden Arabo-Fundamentalisten waren, die das World Trade Center angriffen, wäre das noch lange kein Grund, uns mit diesem „islamistischen Verbrechen“ zehn Jahre lang zu nerven – nach all den tausend mal gigantischeren Verbrechen der USA nach 1945, als sie ihren letzten „gerechten Krieg“ beendeten. Das ist ungefähr das selbe wie wenn die Deutschen den Engländern ständig Dresden nachtragen würden. Das erste Buch von Mathias Broeckers über „Nine Eleven“ wurde nebenbeibemerkt von der in Wien lehrenden Literaturwissenschaftlerin Eva Horn sehr gelobt – in ihrem Buch: „Der geheime Krieg – Verrat, Spionage und moderne Fiktion“.
Zu ihrem Frankfurter Referat über „Lawrence von Arabien“ – als „mimikritisches Subjekt“ sei zuvor noch angemerkt: Es gibt einen ganzen schwulen „Orientalismus“. Die Schwulen im Westen hat es schon lange in den Orient gezogen. Den „homosexuellen Bohemien“ Arthur Rimbaud erwähnt Eva Horn als einen der ersten „mimikritischen Subjekte“. Zuletzt veröffentlichte Roland Barthes seine „Begebenheiten“ aus Marokko: „Zu den Gründen für Barthes‘ Liebe zu Marokko zählten seine homosexuellen Interessen. Hier fand er anscheinend, was er ‚die wirklich dialektische Form der Liebeszwiesprache‘ nannte,“ schreibt dazu die Wiener Ethnologin und Reiseführerin in arabische Länder Ingrid Thurner.
Die (männlichen) Homosexuellen scheinen Meister in der kulturellen Mimikry zu sein – insofern sie in ihren prüden westlichen Ländern seit Jahrhunderten dazu gezwungen werden – derart, dass sogar Rimbaud in Aden davon träumt, eines Tages eine stinknormale Frau zu heiraten. Das „mimikritische Subjekt“ muß sich in die „indigene Kultur einschmiegen“, schreibt Eva Horn – das gilt nicht nur für Homosexuelle, sondern auch für Spione und – mindestens auf sprachlicher Ebene – für Ethnologen. Gut, wenn sich – wie im Falle von T.E. Lawrence – alle drei in einer Person zusammenfinden. Das hat ihn für viele so interessant gemacht: Während z.B. der Widerstandskämpfer André Malraux, literarisch das französische Pendant zu Hemingway, Lawrence nachgelebt hat, teilte der französische Literaturwissenschaftler Roland Barthes die arabophile sadomasochistische Neigung mit Lawrence. (*) Hier nun ein Kapitel aus Eva Horns Lawrence-Text:
Politik der Mimikry: Lawrence von Arabien. T. E. Lawrence kommt als Erwachsener nach Arabien, nicht als Kind, und nichts an seiner „arabness“, seiner kulturellen Mimikry an die Haschemiten, deren militärischer Berater und informeller Feldherr er wird, ist in irgendeiner Weise naturwüchsig. Seine kulturelle Mimikry ist gleichermaßen hochgradig reflektiert und zutiefst phantasmatisch.“ Lawrence weiß nur allzu genau, „dass er den Arabern gänzlich fremd gegenüber steht. In seiner Autobiographie Seven Pilars of Wisdom, einer umfänglichen, zwischen akkuratem Kriegsbericht und fast unerträglich exhibitionischer Selbstanalyse schwebenden Bericht über seine Operation im Hedjaz von I9I6 bis I9I8, schreibt er: „I was sent to these Arabs as astranger, unable to think their thoughts or subscribe their beliefs [ … ]. I could at least conceal my own, and pass among them without evident fiction, neither a discord nor a critic but an unnoticed influence.“
Für Lawrence ist die kulturelle Mimikry an die Araber zunächst einmal nicht das Annehmen einer neuen Identität, sondern eine Form der Selbstauslöschung, der Reinigung von der eigenen Identität. Damit stellt er eine sehr grundsätzliche Frage in Bezug auf das, was kulturelle Mimikry überhaupt sein kann: Besteht kulturelle Mimikry darin, dass ein Subjekt sich einer fremden Kultur „ähnlich macht“? Dass das Subjekt sich an etwas bereits naturwüchsig Gegebenes anpasst? Und was ist eigentlich der Referent, der Bezugspunkt dieser Mimikry, was ist diese fremde Kultur? Mimikry an etwas ist immer auch eine Interpretation, eine Aussage über das, worauf sich diese Mimikry bezieht, der mimikritische Prozess lässt auch seinen Gegenstand nicht unangetastet. Und nicht zuletzt fragt sich – und Lawrence fragt sich das 500 Seiten lang -, was die tieferliegende phantasmatische Korrespondenz zwischen dem mimikritischen Subjekt und dem ist, dem er sich ähnlich macht.
Was sind die Araber? Genauer: Worin besteht der Wunsch, Araber zu werden? Was Lawrence von klassischen orientalistischen Begehren, ein anderer zu werden in der Anähnlichung an eine ganz fremde, ganz exotische Kultur, trennt, ist die Tatsache, dass er sich vollkommen darüber im Klaren ist, dass die Araber, deren Sprache er lernt, deren Kleider er trägt und deren Krieg er voranbringt, nichts anderes sind als eine phantasmatische Konstruktion seinerseits. Sein militärisch-politischer Auftrag als britischer Agent, die Araber zu einer kohärenten und effizienten Kriegsmacht gegen die Türken zu mobilisieren und seine Phantasie davon, was „Araber-sein“ heißen könnte, verschmelzen hier zu einer ausagierten Phantasie, die den ursprünglichen Auftrag am Ende sogar durchkreuzt. „All men dream: but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to findd that it was vanity: but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes, to make it possible. This I did. I meant to make a new nation, to restore a lost influence, to give twenty millions of Semites the foundations on which to build an inspired dream-palace of their national thoughts.“
Kriegführung und Politik werden so durchsichtig als in die Tat umgesetzte Träume, Träume von einer kulturellen und nationalen Einheit und Identität, die die Araber gerade nicht haben, aber die ihnen eingeflüstert wird, zu der sie inspiriert werden sollen. Denn „die Araber“, niemand weiß das besser als Lawrence, gibt es überhaupt nicht. „A first difficulty of the Arab movement was to say who the Arabs were.“ Sie sind wenig mehr als untereinander gänzlich zerstrittene Stämme, die sich plötzlich einer gemeinsamen Sache verschreiben sollen, „a manufactured people“ – ein konstruiertes Volk, „unstable as water“. Das einzige, was sie verbindet, ist die arabische Sprache und, so Lawrence, ihr Hang zum Abstrakten, der sie die Leere der Wüstenlandschaft ebenso schätzen lässt wie ihre bildlose Religion. „Children of the idea“, nennt Lawrence sie, Asketen, Idealisten ohne Ideal. Wenn so der Referent der Mimikry verschwindet oder jedenfalls in seiner fraglosen Gegebenheit problematisch wird, dann verkompliziert sich das Konzept der kulturellen Mimikry um Einiges. Sie wird zu einem Bezug zwischen zwei in Frage stehenden, an sich instabilen Größen; mit anderen Worten: Es scheint, als verändere sich nicht nur das mimikritische Subjekt, sondern auch das Objekt der Mimikry mit dem Prozess der Anähnlichung an es. Lawrences Mimikry besteht demnach nicht nur in einer Anpassung, auch nicht nur – wie oben zitiert – in einer friktionslosen, fast unbemerkten Einflussnahme, sondern in einer seltsamen Strategie der Überbietung, einer fast theatralischen, ostentativen Vorführung von „arabness“.
Die Mimikry des Europäers, so schreibt er, könne in nichts anderem bestehen als „to imitate them so well that they spuriously imitate him back again“. Kaja Silverman hat diese Strategie eine „double mimesis“ genannt: Lawrence versucht die Einheit – die politische und kulturelle Einheit – der Araber als Araber dadurch zu beflügeln, dass er ihnen überhaupt erst vorführt, was es heißt oder heißen könnte, Araber zu sein. Es ist eine kulturelle Maskerade, die den Anderen „nach-äfft“ (oder besser: „vor-äfft“, um ihm in diesem Spiegel vorzuführen, wer er sein könnte. Es geht dabei nicht um Verkleidung, vor der Lawrence bezeichnenderweise eindringlich warnt. Verkleidung ist der Versuch, als ein Anderer zu erscheinen, eine falsche Identität anzunehmen. Bei Lawrence, der für das Tragen arabischer Kleidung berühmt war, geht es, so betont er, durchaus nicht darum zu verbergen, dass er Brite, dass er Lawrence ist: Es geht nicht um Täuschung. (Als er sich einmal wirklich verkleidet, um die Stadt Deraa auszukundschaften, wird er von den Türken verhaftet. Zu seinem Glück wird er nicht als steckbrieflich gesuchter T. E. Lawrence erkannt, sondern für einen blonden Tscherkessen gehalten. Aber in dieser -lebensrettenden – Rolle eines jungen, unbedarften und verführerisch weißhäutigen Tscherkessen wird er vom türkischen Bey gefoltert und vergewaltigt, eine Demütigung und ein tiefes Trauma, das Lawrence für den Rest seines Lebens prägen wird.)
„Disguise“, schreibt er in einem Manual für Neulinge im Mittleren Osten, das er für den Gebrauch englischer Diplomaten in Arabien verfasst, „is not advisable. [ … ] At the same time if you can wear Arab kit when with the tribes you will acquire their trust and intimacy to a degree impossible in uniform [ … ]. You will be like an actor in a foreign theatre [ … ]. Complete success, which is when the Arabs forget your strangeness [ … ], is perhaps only attainable in character. [ … ] If you wear Arab things wear the best [ … ]. Dress like a Sherif, if they agree to it.“ Lawrence betont die theatrale Seite der Mimikry, wobei er bewusst mit der englischen Doppelbedeutung von „theatre“ als Bühne und Kriegsschauplatz spielt. Diese Theatralität der kulturellen Mimikry besteht in einem method-acting: Es geht um ein verinnerlichendes Aus-Spielen arabischer Identität, in die man sich zunächst ein-fühlen oder die man sich selbst konstruieren muss. Was in diesem Aus-Spielen vorgeführt wird, ist dabei nicht irgendeine Form arabischer Identität, sondern nur die edelste, ranghöchste Seite des Araber-Seins: „Dress like a Sherif“. Denn Lawrence will ja nicht einfach als unauffälliger Spion und Späher durchkommen, sondern diskret, aber effizient eine Führungsrolle unter den Arabern spielen, deren militärischer und politischer Berater er wird.
Aber was noch wichtiger ist: Sie erfordert ganz eindeutig die Einwilligung des so Imitierten in diese Praxis der Mimikry: „Dress like a Sherif, if they agree to it.“ Das heißt: Es geht hier nicht um Täuschung, sondern um eine Form der gegenseitigen Anerkennung. Mehr noch: Das Funktionieren dieser kulturellen Mimikry ist essentiell abhängig von der Anerkennung des Adressaten, der Araber. Aber diese Anerkennung soll dem Objekt der Mimikry, dem Imitierten, überhaupt erst ermöglichen, seine eigene Identität im Spiegel dieser Vorführung wahrzunehmen. Nur im Posieren eines T. E. Lawrence erkennen die Araber, so die Logik dieser Theorie der Mimikry, wer sie kulturell und politisch sein könnten. Die Reflexivität kulturellen Agierens geschieht so auf beiden Seiten: auf der des mimikritischen Subjekts, dessen Performance des Fremden immer schon eine bewusst konstruierte ist, aber auch auf der Seite des imitierten Objekts, das sich selbst über diese Konstruktion bewusst werden soll. Gleichwohl ist Lawrences „doppelte Mimesis“ weder ein Programm post-kolonialer Selbstreflexion des Indigenen noch eine platte Erfüllung des orientalistischen Paradigmas, wie Edward Said glaubt. Es ist vielmehr ein widersprüchliches, paradoxes und hochgradig idiosynkratisches Unternehmen, das seinen kolonialen Auftrag, die Araber erst als nützliche Alliierte gegen die Türken zu gebrauchen, um ihnen am Ende die versprochene Unabhängigkeit doch vorzuenthalten, zugleich erfüllt und unterläuft.
Denn von Anfang an befindet sich Lawrence in einer Zwickmühle der Loyalitäten: Die Engländer wollen, dass er den Aufstand der arabischen Stämme des Hedjaz gegen das osmanische Reich organisiert und den Aufständischen dafür Unabhängigkeit in Aussicht stellt. Aber noch bevor T. E. Lawrence im Oktober I9I6 zu den Arabern stößt, hatten die zwei Kolonialmächte des Nahen Ostens, England und Frankreich, im Mai desselben Jahres das Sykes-Picot Abkommen (benannt nach seinen zwei zentralen Unterhändlern) unterzeichnet, das das befreite Syrien, den Libanon und die Südost-Türkei den Franzosen, den Irak und Jordanien den Engländern zuschlug und Palästina unter internationale Verwaltung stellte – mit den noch heute andauernden Folgen. Die Unabhängigkeit der revoltierenden Araber war somit von Anfang an keinerlei Perspektive für die Engländer, sondern nur eine Lüge, mit der man die arabischen Stämme zur Eigeninitiative gegen die Türken locken wollte. Man muss davon ausgehen, dass Lawrence von Anfang an von diesem Geheimabkommen wusste. Aus dieser Widersprüchlichkeit – oder besser: Verlogenheit – seines Auftrags macht Lawrence, zerquält von Scham und getrieben von seinem Tagtraum eines „Arabiens“, das es noch gar nicht gibt, eine politische Strategie. Denn trotz seines britischen Auftraggebers operiert Lawrence zunehmend im Interesse der Araber, nicht primär der Engländer. Gefangen in seiner Rolle als „successfuI trickster“, entwickelt er eine politische Taktik zum Nutzen derer, die er eigentlich manipulieren und täuschen soll.
Damit stellt sich die Frage nach kultureller Mimikry als politischer Vorgehensweise. Wie kann man etwas imitieren, sich selbst zum Verschwinden bringen – und es zugleich beeinflussen, in eine bestimmte Richtung steuern wollen? Mehr noch: die Rolle des Führers einnehmen? Was Lawrence vorschlägt, ist eine Politik, die noch einmal das Regime der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der kulturellen Mimikry auf das Theater, den Schauplatz der zweischneidigen Kolonialpolitik des Great Game bringt. Als Lawrence im oktober I9I6 als Berater des Foreign office zu den Haschemiten stößt, die unter der Führung des Sharif Hussein, des Statthalters von Mekka, und seiner Söhne die Türken bereits aus Mekka vertrieben haben, akzeptiert er die etablierte Führungsrolle Husseins nicht einfach, sondern sucht eine charismatischere und vor allem jüngere Figur. Er findet sie im zweitältesten Sohn Husseins, Feisal. Feisal wird der Führer des großen Aufstands werden, der ihn schließlich bis nach Damaskus und von dort aus auf die Friedenskonferenz nach Versailles bringen wird. Er wählt Feisal nicht, weil dieser besonderes kriegerisches Talent hätte, sondern vor allem wegen seiner auratischen Schönheit und seines prophetenhaften Charismas. „I feIt at first glance that this was the man who would bring the Arab revolt to full glory. Feisal looked very tall and pillar-like“. Schon seine erste Begegnung mit Feisal nutzt Lawrence, so erzählt er es jedenfalls in den Seven Pillars, um diesem den wichtigsten strategischen Einfall des ganzen Kampfes einzuflüstern: sich nicht nach Jenbo zurückzuziehen oder Medina zu belagern, sondern Damaskus zu erobern und damit einen Herrschaftsanspruch auf Syrien erheben zu können.
Feisal wird so der strahlende Herrscher des Feldzugs, Lawrence sein Berater, Faktotum, Freund und Unterhändler mit den Briten. Das Prinzip einer solchen Politik hat Lawrence in seinem Manual über den Umgang mit Arabern recht kaltschnäuzig beschrieben: „Your ideal position is when you are present and not noticed [ … ] Wave a Sherif in front of you like a banner and hide your own mind and person.“ Feisal ist das Banner, die Instanz der Macht, die Lawrence vor sich her schwenkt, um seine Person und seine Absichten zu verbergen. Lawrences Position ist so die des geheimen Rats, des alteuropäischen Intriganten oder Geheimdiplomaten, ein Stichwortgeber, der selbst nicht in Erscheinung tritt – und genau aufgrund seiner Unsichtbarkeit besonders großen Einfluss ausübt. Was durchaus nicht heißt, dass er diese Macht in irgendeiner Weise unterlaufen oder unterminieren will. Lawrence glaubt an Feisal und ist loyal zu ihm, bis hinein in die für die Araber desaströsen Friedensverhandlungen von Versailles. Ganz in der Tradition des geheimen Beraters sieht er sich in dieser Position als ein „Diener“ der Macht, der dieser Macht besser dient, wenn er ihre Weisungen korrigiert und interpretiert, gelegentlich wohl auch manipuliert. Feisal ist so die Figur des Führers, aber genauer betrachtet heißt dies: Er ist die äußere Gestalt, die Repräsentationsform einer Macht, die eigentlich Lawrence ausübt. Jenseits der „doppelten Mimesis“ oder gegenseitigen Mimikry, in der Lawrence den Arabern vorführt, was es heißt, ein wirklicher Araber zu sein, jenseits des Phantasmas vom geeinten Arabien, ist dies die wohl letzte und subtilste Wendung einer kulturellen Mimikry.
Lawrence träumt nicht nur für die (und anstelle der) Araber den Traum von einer Unabhängigkeit und politischen Souveränität dieser großen Kultur, sondern er organisiert, verhandelt und entscheidet für sie und in ihrem Namen. Seine beste Verkleidung ist damit nicht so sehr das Kleid eines Sherifs, sondern Feisal selbst. Lawrences Mimikry ist so nicht nur reflexiv, nicht nur eine Verkleidung und Transformation seines Körpers – von der gebräunten Hautfarbe über die Kleidung bis zur Sprache -, sondern eine Transformation seiner Position als (politischem) Subjekt. Vom Briten und britischen Berater wird er nicht einfach zum „Araber“, sondern zum britisch-arabischen Grenzgänger, zum Agenten und Geheimpolitiker. Er spielt einen „Araber“, sowohl gegenüber den Arabern wie gegenüber den Engländern, inszeniert die Position der „arabischen Interessen“, noch bevor diese in expliziter Form überhaupt existiert. Damit wird seine Mimikry kreativ: Sie erfindet, in der angeblichen Nachahmung, ein Original, das es noch lange nicht gibt. Lawrence zahlte einen hohen Preis für diese mimikritische Identität und Politik. Denn in genau dem Maße, wie er sich stets klar über die künstliche und phantasmatische Konstruktion seines politischen Traums ist, so ist er sich auch im Klaren über die doppelzüngige Politik, die zu betreiben er gezwungen ist. Er betrügt die Engländer und betrügt Feisal. Sein ausufernder und idiosynkratischer autobiographischer Text Seven Pilars of Wisdom ist darum nicht nur ein Dokument dieser Bewusstheit, sondern vor allem einer geradezu exhibitionistisch vorgetragenen Geste der Scham.
Das mimikritische Subjekt entledigt sich seiner früheren Identität, inszeniert eine andere – aber der reflexive Abstand zwischen beiden erzeugt ein paradoxes double-bind von Theatralität und Verbergen, Ostentation und Scham, eine unerträgliche Spannung, die T. E. Lawrence in seinem Text wie in seiner Person austrug. Scham ist gleichsam die Pointe der Mimikry. Denn Mimikry bedeutet, erblickt zu werden, um unsichtbar zu sein: Sie setzt einen Blick voraus, den sie gerade von sich ablenken will. Das mimikritische Subjekt weiß sich stets beobachtet, es weiß, dass alles, was einmal unwillkürlich, beiläufig, gleichsam naturwüchsig im sozialen Umgang war, nie wieder etwas anderes sein kann als künstlich und absichtlich, theatral und verräterisch. Nur vordergründig geht es also in der Mimikry um Imitation oder Täuschung, um eine Imitation zum Zwecke der Täuschung.
Mimikry ist ein Prozess, der nicht nur die Identität des mimikritischen Subjekts neu und anders entwirft, der eine Selbstabweichung und Neuerflndung des Individuums bewirkt, sondern er affiziert auch das, was das Objekt der Mimikry ist. Denn der Prozess des Ähnlich-Werdens impliziert nicht nur den prüfenden Blick des Beobachters/Feindes auf den Akt des Verschwindens, sondern ist selbst ein Blick: Eine Interpretation dessen, was als Erscheinung des imitierten Objekts wahrgenommen wird. Mimikry wird nicht nur (nicht) gesehen, sondern sieht auch. Sie sieht dabei etwas, was das andere gar nicht ist, sondern zu werden im Begriff ist, werden könnte, werden sollte. Und sie affiziert das Imitierte mit einer Nachahmung, die alles andere als „realistisch“ gemeint ist: Sie ist Forderung, Modellierung, Parodie – vor allem aber, und das ist die Chance wie die Katastrophe aller kulturellen Mimikry, entblößt sie alle kulturelle Identität von jener scheinbaren Naturwüchsigkeit, mit der wir sie einmal, als Kinder, erlernt haben.
(Eine ausführliche Analyse der Texte von Kipling und Lawrence findet sich im Kapitel „The Great Game“ in: Eva Horn: Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion, Frankfurt am Main 2007, 156- 227.)
(*) Bevor ich hier einige Notizen aus dem in Marokko und Paris geschriebenen Tagbuch von Roland Barthes – „Begebenheiten“ – zitiere, möchte ich noch auf eine Lawrence entgegengesetzte Mimikry kurz zu sprechen kommen, die in der Form einer „umgekehrten Ethnographie“ vorliegt: auf den „Roman“ des tunesischen Beduinen Habin Selmi, der als Arabischdozent in Paris lebt und eine mehrjährige Beziehung mit einer bei der Post arbeitenden Französin hatte: „Meine Zeit mit Marie-Claire“. Habin Selmi veröffentlichte seinen Roman 2008 allerdings nicht auf Französisch, sondern auf Arabisch, im Original hat er den Titel „Marie-Claires Düfte“ (Rawa’ih Marie-Claire). Die Übersetzerin Regina Karachouli merkt dazu an: Die Gerüche „assoziieren die vielfältigen Eigenschaften und Wandlungen dieser lebensfrohen, natürlichen Frau. Ihre Konturen zeichnen sich eher indirekt ab, gefiltert durch die Erinnerungen des Ich-Erzählers, so dass diese rawa’ih letztlich mehr über seinen Geruchssinn offenbaren als über Marie-Claires ‚Düfte‘.“
Roland Barthes hat sich in seinen Tagebucheintragungen von der Idee leiten lassen, sich „in die Lage von jemandem zu versetzen, der etwas tut, und nicht mehr in die von jemandem, der über etwas spricht“. Hier einige Eintragungen aus Marokko, wo er sich 1968/69 aufhielt:
„Mustafa hängt sehr an seiner Schirmmütze: ‚Meine Schirmmütze, ich liebe sie.‘ Auch beim Liebemachen will er sie nicht absetzen.“
„Abder – aus religiöser Scheu vor Befleckung möchte er ein sauberes Handtuch haben, das daneben liegen soll, um sich danach von der Liebe zu reinigen.“
„Ein Auftakt wie bei Racine: mit anmutiger Zutraulichkeit: ‚Sie sehen mich? Sie wollen mich anfassen?'“
„Die Schwierigkeit, jenem Knaben, der mich darum gebeten hatte, ein ‚Souvenir‘ aus Paris mitzubringen: wie soll man jemandem eine nette Kleinigkeit schenken, der völlig arm ist? Ein Feuerzeug? Um welche Zigaretten anzuzünden? Ich entscheide mich für das codierte, das heißt völlig nutzlose Andenken, einen Eiffelturm aus Messing.“
„Driss A. weiss nicht, daß der Same eben Same heißt; er nennt ihn Scheiße: ‚Paß auf, die Scheiße kommt!‘ nichts ist verletzender. Ein anderer Slaoui (Mohammed, der Turnlehrer) sagt trocken und genau: ejakulieren: ‚Achtung, jetzt ejakuliere ich.'“
„Ich liebe die Ausdrücke von Amidou: träumen [rèver] und platzen [éclater] für eine Erektion haben [bander] und einen Orgasmus erleben, genießen [jouir]. Platzen ist vegetabilisch, spritzend, zerstäubend, samenstreuend; genießen ist geistig-psychisch, narzißtisch, üppig, zusammenhaltend-verschlossen.“
„Ramadan: Bald wird der Mond aufgehen. Noch eine halbe Stunde muß man mit dem Liedemachen warten: ‚Ich beginne zu träumen. – Ist das denn erlaubt? – Ich weiß nicht.'“
„In der rue Samarine, ich schwimme gegen den Menschenstrom. Ich hatte das (völlig unerotische) Gefühl, daß alle diese Passanten einen Schwanz hatten und alle diese Schwänze, im Rgythmus meiner Schritte, abfielen wie ein Massenprodukt, das sich taktmäßig aus der Gußform löst…“
„Kleiner Lehrer aus Marrakesch: ‚Ich mache alles, was Sie wollen,‘ sagt er mit überströmender Herzlichkeit, Gutmütigkeit und komplizenhaftem Einverständnis in den Augen. Und das soll heißen: Ich werde Sie ficken, und nur das.“
Einige Eintragungen aus Paris – 10 Jahre später: 1979:
„Am Nachmittag ein ganz unterschiedlicher, gleichsam freier und unersättlicher Aufriß: zunächst, in Bad V, nichts: keiner der Araber, die ich kenne, niemand, der mich interessiert, und viele dickbäuchige Europäer; einzige Merkwürdigkeit: ein Araber, nicht jung, aber nicht schlecht, der sich für die Europäer interessiert. Er berührt ihre Schwänze, sichtlich ohne Geld zu verlangen, und geht dann zum nächsten; man weiß nicht, was er will. Reines Paradoxon: ein Araber, für den der Pimmel eines anderen und nicht nur sein eigener existiert (der sein Ego ist).“
„Gehe noch einmal aus, um mir den neuen Porno-Film anzuschauen: wie immer jämmerlich – und diesmal vielleicht noch mehr. Ich mag nicht einmal meinen Nachbarn anmachen, obwohl das zweifellos möglich ist (die idiotische Angst, abgewiesen zu werden). Abstieg in den Darkroom; hinterher bedaure ich diese schäbige Episode immer, der ich jedesmal wieder die Bestätigung meiner Verlassenheit entnehme.“
„Ich wollte – obwohl müde – noch Jungengesichter sehen; aber es standen so viele Burschen da, dass es unangenehm war.“
„Eine Art Verzweiflung überkam mich, mir war zum Weinen zumute. Mit unwiderruflicher Deutlichkeit sah ich, daß ich auf die Knaben verzichten muß, weil sie keinerlei Begierden mehr nach mir empfinden…Wenn ich meine Freunde durchgehe – einmal abgesehen von denen, die nicht mehr jung sind – reiht sich ein Mißerfolg an den anderen. Mir werden nur noch die Strichjungen bleiben.“
(Die koloniale Asymmetrie macht dauergeil. Hierzulande wurde das zuletzt bei den Asymmetrisierern in der Berliner Treuhandanstalt deutlich. Auf einer Betriebsrätekonferenz in der Kongreßhalle am Alexanderplatz meinte z.B. einer ihrer Privatisierungsmanager zu einem anderen: „Ich muß unbedingt mal wieder Ostweiber beschlafen!“ Selbst der Treuhandchef Detlef Rohwedder gab zu: „Die benehmen sich im Osten schlimmer als Kolonialoffiziere.“ Man darf dabei jedoch auch die andere Seite nicht vergessen – so meinte z.B. die Linguistin und Prostituierte Alice Frohnert über die nach der Wende massenhaft in das Berliner “Milieu” einsickernden Osteuropäerinnen: “Die Frauen aus dem Osten waren am Anfang auch geil auf die hiesigen Männer. Deren ‘West-Touch’ machte sie für die Frauen aus dem Osten erotisch. Sie erhoffen sich von denen, daß sie ihnen aus ihrer finanziellen und gesellschaftlichen Misere heraushelfen. Das hat auch was mit den West-Medien zu tun und den Ami-Filmen – angefangen von ‘Dallas’ bis zu ‘Pretty Woman’. Ich bin ja schon lange im Westen, ursprünglich komme ich aus Schlesien. Für mich war seinerzeit noch der französische Film ‘Belle de Jour’ mit Catherine Deneuve wichtig. Solche Verklärungen der Prostitution gehen weiter. Was mit dazu beiträgt, daß der Widerstand gegen unzumutbare Bedingungen unter den Berliner Prostituierten seit der Wende immer minimaler geworden ist.”)
Al Dschasira veröffentlichte gerade einen Aufsatz des „Asien-Experten“ Pepe Escobar:
Hohe Einsätze im eurasischen ‚New Great Game‘
Antonio Gramsci once mused that the old order has died but the new one has not yet been born.
While Washington’s geopolitical/energy focus was on Afghanistan, Pakistan, Iraq and Iran, and to a lesser extent on Central Asia, international politics was already in transition from a unipolar world towards a new, polycentric system.
And then the 2011 Arab Revolt irrupted all across the MENA (Middle East-Northern Africa) chessboard, turning all calculations upside down and reconfiguring the relationship between the US, the main Eurasian nations, and Northern Africa.
Time to recall an ultimate Cold Warrior, Dr Zbigniew Brzezinski, who in 1997, in the article „A Geostrategy for Eurasia“, published by Foreign Affairs, conceptualised that: „Eurasia is the world’s axial supercontinent. A power that dominated Eurasia would exercise decisive influence over two of the world’s three most economically productive regions, Western Europe and East Asia. A glance at the map also suggests that a country dominant in Eurasia would almost automatically control the Middle East and Africa. With Eurasia now serving as the decisive geopolitical chessboard, it no longer suffices to fashion one policy for Europe and another for Asia. What happens with the distribution of power on the Eurasian landmass will be of decisive importance to America’s global primacy and historical legacy.“
Fast forward to the first decade of the 2000s. The George W Bush administration devised a strategy for a Great Central Asia according to which the US would roll back Russia’s traditional and China’s growing influence.
Washington would have New Delhi as the partner of choice in Afghanistan and Central Asia – laying the foundations of a new Silk Road.
And Washington would establish itself not far from Xinjiang, in Western China, and close to Russia’s underbelly. Essentially, that’s how the US would win the New Great Game in Eurasia.
This strategy was inbuilt in the Pentagon’s Long War – codename for the Full Spectrum Dominance doctrine – and its far more important, if half-hidden, twin: the global energy war.
In my 2007 book Globalistan, I branded this process as Liquid War; here we would find „liquidity“ not only in terms of fast-flowing capital and information shaping liquid modernity (a hat tip to Zygmunt Bauman), but also as in oil/gas pipelines crisscrossing an enormous battlefield, what I have called Pipelineistan.
The problems with the Bush administration strategy may have already started way back in 2003, when Turkey – the bridge par excellence between Central Asia and the Mediterranean – decided not to support the war in Iraq.
Since then, Turkey has gotten closer to Russia and, following Foreign Minister Ahmet Davutoglu’s concept, in fact all its neighbors, especially Iran – performing what could be called an „escape from the US“ – and thus denting its role as a NATO base for penetration into Eurasia.
It’s in this context that an Ankara-Tehran-Damascus alliance was solidified (and, incidentally, may now be unraveling). Meanwhile Eurasia as a whole changed at breakneck speed.
Russia was „back“ on a continental and also global scale; China and India emerged geo-economically; the US got bogged down in Afghanistan and Iraq. Soon the US was not the „indispensable nation“ anymore.
Very few former Soviet states were annexed to the US sphere of influence – as it was expected after 9/11. Moreover, Washington’s dream of a line of control stretching from the Mediterranean all the way towards Central Asia, aimed at cutting in two the Eurasian landmass, did not happen.
China and Russia developed a joint Eurasia policy – organised, among other channels, by the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), the Eurasian Economic Community and now increased military cooperation.
In Pipelineistan terms, China didn’t have to send a single soldier (to Iraq) or get bogged down in an infinite quagmire (in Afghanistan); instead it will get plenty of oil from Iraq and much of the natural gas it needs from Turkmenistan.
China is massively investing in a land-based Central Asian energy strategy – a pipeline-driven New Silk Road from the Caspian Sea to China’s Far West in Xinjiang.
The US’s geopolitical perspective is characteristic of a sea power – framing its relationship with other nations from the position of an „island“; the Mediterranean basin and Central Asia are viewed as placed in a so-called „arc of instability“, as defined by Dr Brzezinski.
Over these past few years, in a constantly evolving context, much more than Great Central Asia, what became paramount for Washington was the geopolitical concept of a Great Middle East – expanding on Brzezinski’s „arc of instability“ and running from the Maghreb all the way to Central Asia.
So as much as Brzezinski conceptualised Central Asia as a volatile and unpredictable „Eurasian Balkans“, we had the Bush administration forcefully dreaming of the „birth pangs“ of the Great Middle East. The aim was unmistakable; to cause a lot of trouble to the increasing geopolitical union between China and Russia.
In these past few years, up to the – largely botched – Africom/NATO operation in Libya, the US strategy has been aimed at the militarisation of the entire arc between the Mediterranean and Central Asia.
Africom, the US Africa command implemented in 2008 with a headquarters in Stuttgart, Germany, has now engaged in its first African war, in Libya. Africom aims at rapid intervention all across Africa but also has its sights on the „New“ Middle East and Central Asia.
So now the US strategy can finally be examined in detail as a militarisation of the Mediterranean-Central Asian arch.
That would assure the US a wedge between Southern Europe and Northern Africa; assure military control over Northern Africa and Southwest Asia, with particular emphasis on Turkey, Syria and Iran; and „cut“ Eurasia in two. In sum: divide and rule.
So this geopolitical road map was bound from the start to target Syria (already happening); Iran (a perpetual neo-con dream); and even Erdogan’s Turkey – all useful for a US advance in Eurasia.
Meanwhile Eurasian powers Russia, China and India – all BRICS member countries – not to mention Iran and Turkey themselves, are slowly calibrating their response.
In the midst of this ever-shifting accommodation of tectonic plates, Afghanistan assumes an even more crucial role. It could – and should – recover its status of crossroads/hub bringing Central Asia and South Asia together. Yet that may ultimately happen not under American sponsorship – but under Chinese and Russian partnership.
The Moscow/Beijing counterpunch is to organise the SCO as a rival to NATO in terms of providing security for Central Asia – and for Afghanistan. Wily Hamid Karzai has seen which way the wind is blowing – and he’s all for it.
Moscow and Beijing have decided to enter into „tight cooperation“ (their terminology) not only in Central Asia but in the Middle East and North Africa as well; Chinese Premier Wen Jiabao admitted as much in a recent op-ed piece for the Financial Times newspaper.
The wake-up call was the Western intervention in Libya. The Chinese economic/political/diplomatic push will be organised under the aegis of the BRICS group of emerging powers (Brazil, Russia, India, China, South Africa).
The complex hidden agendas at play in Syria; the unraveling of the Ankara-Tehran-Damascus alliance; the West’s double standards over Bahrain; Washington’s determination to overstay its military presence in Iraq -these developments are all seen by Moscow and Beijing as part of a strategy to perpetuate Western dominance in the Middle East.
So expect even more feverish moves by the angel of history. Eurasian actors Turkey, Iran, Russia and China will be ever more active in the Mediterranean and Central Asia – the key geostrategic battleground in a 21st century New Great Game that might even be pitting Washington against Eurasia itself.