
US-Echtzeitpoller (im Krieg)
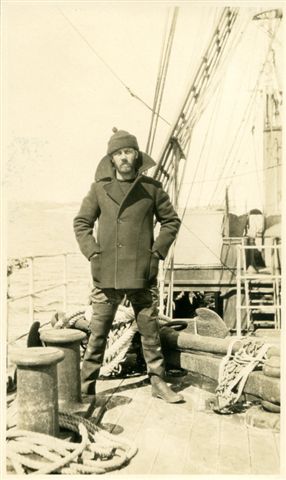
Norw.-Echtzeitpoller (im Frieden)
„Genießt den Krieg, der Friede wird fürchterlich!“ (Curzio Malaparte in Neapel 1944)
Wie in fast allen semilinken Geistesprodukten ist auch in dem folgenden Doppel-Beitrag – aus der aktuellen Le Monde Diplomatique (dt.Ausg.) – von der Flasche die Rede, die aus dem Geist ist – hier bei den Norwegischen Rechten:
Alarmismus und Attentismus an dunklen Fjorden
„Mitunter kann es den Menschen auch in einer schweren Zeit gut gehen. Der Schmerz ist gut, und der Ernst im Gemüt ist ebenso blank wie der dunkle Fjord.“ (Torborg Nedreaas, „In Verdunklungszeiten“)
…Breiviks im Internet veröffentlichte Positionen sind denen der Fortschrittspartei durchaus ähnlich. So hat 2004 deren damaliger Vorsitzender Car Ivar Hagen erklärt, die Muslime hätten „seit Langem klargemacht, wie es auch Hitler getan hat, dass ihr langfristiger Plan darauf zielt, die Welt zu islamisieren […] Sie sind schon tief nach Afrika vorgedrungen und auch in Europa weit vorangekommen – also müssen wir uns wehren.“
Vor den Parlamentswahlen von 2009, bei der die rot-grüne Koalition(2) eine Mehrheit erzielte, die Fortschrittspartei jedoch mit 22,9 Prozent der Stimmen(3) zur zweitstärksten Kraft wurde, warnte der jetzige Vorsitzende Siv Jensen im Wahlkampf vor einer „schleichenden Islamisierung“ des Landes. Und noch im August 2010 hat Christian Tybring-Gjedde, ein Nachwuchspolitiker der Fortschrittspartei, die sozialdemokratische Arbeiterpartei beschuldigt, „der norwegischen Kultur einen Dolchstoß zu versetzen“. Und der Parteisprecher für Einwanderungsfragen twitterte den Satz: „Ich fürchte, ein neuer Kreuzzug ist unausweichlich.“
Als Plattform dienen der Fortschrittspartei vor allem drei Websites. Eine davon, Right.no, erhält Zuschüsse vom Außenministerium. Die Sites deklarieren sich als „islamkritisch“ und proisraelisch, sie verurteilen den Antisemitismus. Einer ihrer wichtigsten Inspiratoren ist ein Blogger namens Fjordman, von dem Breivik gesagt hat, er sei eine Zeit lang sein Vorbild gewesen. Fjordman legte erst nach dem Anschlag seine Identität offen, um nicht mit Breivik in Verbindung gebracht zu werden.
Fjordman heißt in Wirklichkeit Peder Jensen. Der ehemalige Student der Arabistik, heute Hilfspfleger in einer Einrichtung für geistig Behinderte, war 2002 für eine propalästinensische Menschenrechtsorganisation in Hebron tätig. Seitdem steht er auf der Seite Israels, wobei er sich auf die Verschwörungstheorien beruft, die Bat Ye’or in dem Buch „Eurabia“(4) verbreitet hat. Der Autorenname ist ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich Gisèle Littman Orebi, eine aus Ägypten stammende britische Jüdin, die in ihrem Buch verbreitet, die europäischen Regierungen hätten beschlossen, sich mit den Muslimen zu verbünden und die weiße Bevölkerung im Austausch für eine garantierte Erdölversorgung zu verraten.
Diese irrwitzige Theorie macht sich an der Erdölkrise von 1973 fest.(5) Als Beweis für die Verschwörung wird auf die „massive“ Zuwanderung von Bevölkerungsgruppen verwiesen, die angeblich eine besonders hohe Geburtenrate aufweisen. Deshalb befinde sich Europa bereits im Krieg. Mit dieser Ideologie fordern Fjordman und seine Komplizen zum „aktiven Widerstand“ auf, wobei sie ganz unverfroren auf den Widerstand gegen die Besetzung Norwegens durch die Nazis verweisen.
„Das sind nicht die klassischen Neonazis, die auf der Straße Muslime verprügeln“, erklärt der Ethnologieprofessor Thomas Hylland Eriksen, der über Fragen der multikulturellen Gesellschaft forscht. „Das sind nicht die männlichen Arbeitslosen, die auf der Straße stehen, weil ihre Fabrik dichtgemacht wurde. Die gehören zur unteren Mittelschicht, die haben viel gelesen, wenn auch nur äußerst selektiv.“(6)
Gibt es überhaupt ein Einwanderungsproblem in Norwegen? Die Politik der Öffnung für ausländische Arbeitskräfte wurde bereits 1975 beendet. Viele Pakistaner waren ins Land gekommen. Sie bilden heute – in erster und zweiter Generation – die größte ethnische Gruppe aus einem außereuropäischen Land und machen zugleich die Mehrheit der 90 000 Norweger muslimischen Glaubens aus. Wobei daran zu erinnern ist, dass es in Norwegen keine strikte Trennung von Kirche und Staat gibt. Das evangelisch-lutherische Bekenntnis gilt vielmehr als „öffentliche Religion des Staates“, der sich 86 Prozent der 5 Millionen Einwohner zurechnen.7
Die seit 1975 gekommenen Einwanderer waren vor allem EU-Bürger aus Schweden, Polen, Frankreich oder Deutschland, die in der Industrie Arbeit fanden, oder aber Flüchtlinge und Asylbewerber, für die strenge Aufnahmekriterien gelten. Die Einwanderer und ihre Nachkommen sind heute gut integriert. Die Arbeitslosigkeit ist bei ihnen zwar mehr als doppelt so hoch wie im Landesschnitt (7,7 gegenüber 3,3 Prozent); in der zweiten Generation schrumpft die Differenz aber auf 1 Prozentpunkt.(8)
Bestätigt wird diese Integrationsleistung durch eine Umfrage aus dem Jahr 2010, in der 70 Prozent der Norweger von sich sagten, dass sie „die Kultur der Immigranten und ihre Teilnahme am aktiven Leben schätzen“, und der Aussage zustimmten, „dass die eingewanderten Arbeitskräfte aus einem nichtskandinavischen Land positiv für die norwegische Wirtschaft sind“.(9 )
Für Norwegens multikulturelle Gesellschaft ist die Integration also offenbar kein kontroverses Thema. Wie lässt sich dann aber die Islamophobie erklären? Norwegen ist dank seiner Erdölvorkommen und seiner Fischereiindustrie ein reiches Land ohne größere Staatsschulden und war deshalb von der globalen Finanzkrise kaum betroffen. Der Anteil der Berufstätigen an der Bevölkerung ist mit 70 Prozent sehr hoch. Der Wohlfahrtsstaat funktioniert. Es gab keine drastischen Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben (trotz einer Reorganisation, der etliche soziale Einrichtungen zum Opfer fielen). Das Land leistet sich nach wie vor den großzügigsten Sozialstaat der Welt. Seit Jahren bescheinigt der Human Development Report der UN den Norwegern die höchste Lebensqualität in der Welt.
Aber auch ihnen blieben neoliberale „Reformen“ nicht erspart, die von der Arbeiterpartei durchgesetzt wurden. Das lässt sich an den Einkommensunterschieden und der wachsenden sozialen Ungleichheit ablesen. Der linke Thinktank „Manifest senter for samfunnsanalyse“ stellt in einem Report fest: „Seit 1990 ist die Differenz zwischen dem, was die Ein-Prozent-Gruppe der reichsten Norweger verdient, und dem Durchschnittseinkommen deutlich schneller gewachsen als in Großbritannien oder den USA.“(10) Der Anteil der Mittelschichten am Geldvermögen (etwa Bankkonten und Aktien) hat sich zwischen 1984 und 2008 halbiert. Die Einkommen der Reichsten sind stark angestiegen, der Anteil der Löhne am Wertzuwachs dagegen ist gesunken.
Erst das macht verständlich, warum die Einwanderungsfrage zu einem zentralen Thema werden konnte. Die Neoliberalen sind, gestützt auf den arbeitgebernahen Thinktank Civitas, um den Beweis bemüht, dass das skandinavische Modell des Wohlfahrtsstaats nicht mehr funktionieren könne – obwohl die tägliche Realität zeigt, dass Steuereinnahmen und Wachstum das System gut finanzieren können.
Für die angebliche Krise des Sozialstaats machten und machen die Fortschrittspartei und Teile der Partei Høyre (Die Rechte) die Migranten verantwortlich. Im Frühjahr 2011 erschien eine Regierungsenquete zum Thema „Migranten im Arbeitsleben“. Sie wurde von der Rechten sofort dazu benutzt, gegen die Einwanderungsgesellschaft und den Wohlfahrtsstaat zu wettern. Die Botschaft lautete, dass die Gesellschaft durch „die nichtwestlichen Immigranten“ einen „Nettoverlust“ erleide. Die Befunde des Reports waren zwar weit weniger eindeutig, aber allein die Tatsache, dass eine rot-grüne Regierung eine Kommission zu diesem Thema einsetzt, zeugt von einem radikalen Wandel.
Das norwegische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist seit 1998 fast jedes Jahr gewachsen (nur 2009 gab es einen Rückgang), und das BIP pro Kopf ist das drittgrößte in Europa, davor lagen nur die Steueroasen Liechtenstein und Luxemburg. Doch der wachsende Wohlstand hat die Zunahme der sozialen Ungleichheit verschleiert. Und die Frustration der Wähler, die sich benachteiligt fühlen, wird von der populistischen Rechten ausgebeutet. Das gilt vor allem für die Mittelschichten, die seit Anfang der 1990er Jahre immer weiter hinter die Reichen zurückfallen.
So sieht es auch der schwedische Wirtschaftswissenschaftler Ali Esbati, ehemals Vorsitzender der schwedischen Partei Linke Jugend und heute Forscher beim Osloer Thinktank Manifest: „Wenn die politische Diskussion über die Reform des Sozialsystems, die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt oder die notwendigen wirtschaftlichen Maßnahmen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ernsthaft genug geführt wird, rücken andere Themen ins Blickfeld wie zum Beispiel die kulturellen Konflikte.“
Der Ethnologe Eriksen sieht „keinen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen der ökonomischen Stagnation und dem Erstarken einer populistischen Rechten“. Allerdings sympathisierten mit der radikalen islamophoben Rechten viele Bürger, die sich benachteiligt fühlen: „Sie empfinden, dass ihr Lebensstandard stagniert; sie fühlen sich an den Rand gedrängt und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Nach dem 22. Juli gab es viele, die lautstark daran erinnerten, dass man nicht auf sie gehört hätte. Sie betrachten sich als wesentliche Kraft der Nation, können sich aber nicht mehr mit ihr identifizieren, weil sich ein anderes Verständnis der nationalen Gemeinschaft durchgesetzt hat: ein eher kosmopolitisches und egalitäres, das mehr auf die Bürgergesellschaft abhebt als auf die ethnisch-nationale Zugehörigkeit.“
Die populistische Rechte strebt im Grunde danach, diesen „Volkswillen“ zu repräsentieren. Genauer gesagt, den Willen derer, die Ali Esbati so beschreibt: „Sie gehören in bestimmten Bereichen zur Elite und können es nicht ertragen, dass diejenigen, die sie verachten, sich in der Gesellschaft weiter nach vorn schieben und damit sichtbarer werden. Sie hassen die Arbeiterbewegung, die Organisationen für die Befreiung der Frauen und erst recht jene Figuren des akademischen und kulturellen Lebens, die sich für eine andere Gesellschaftsordnung aussprechen.“
Eine Stimme dieser populistischen Rechten ist der „Terrorismusexperte“ Helge Lurås vom renommierten Norwegischen Institut für Internationale Angelegenheiten (Nupi). Er hat noch am Tag des Attentats im russischen Fernsehen (Russia Today) erklärt, die Verantwortung für das Attentat liege bei den Multikulti-Anhängern, weil diese „mit ihrer Immigrationspolitik den Volkswillen erstickt haben“.
Der unvorstellbare Gewaltakt vom 22. Juli 2011 hat zwar in Norwegen stattgefunden, aber die rechte Welle ist keineswegs auf Skandinavien beschränkt. Ihre tieferen Ursachen liegen jenseits von Nordeuropa, meint Ali Esbati: „Im gesamten Westen haben in den letzten Jahrzehnten die gut organisierten Kräfte des Kapitalismus gegen die ökonomische Stagnation gekämpft, indem sie die Ausbeutung verstärkt und die alten Bastionen der Arbeiterbewegung geschleift haben.“ Esbati meint damit vor allem die Angriffe auf die Rentensysteme, das öffentliche Gesundheitswesen und die Rechte der Arbeiter. Daher witterten die rechten Kräfte nicht nur in Skandinavien, sondern überall die Chance, „die allgemeine Angst auszubeuten und eine soziale Landschaft herzustellen, die durch ethnische und religiöse Trennlinien zerklüftet ist“. Rémi Nilsen
(1) Dagsavisen, Oslo, 25. Juli 2011.
(2) Sie besteht aus der Arbeiterpartei, der Sozialistischen Linkspartei und der Zentrumspartei.
(3) Bei den letzten Wahlen im September 2011 erhielt sie nur 11,5 Prozent der Stimmen.
(4) Bat Ye’or, „Eurabia. L’axe euro-arabe“, Paris (Editions Jean-Cyrille Godefroy) 2006.
(5) Andreas Malm, „Hatet mot muslimer“ („Der Hass auf die Muslime“), Stockholm (Atlas) 2011.
(6) Aftenposten, Oslo, 1. August 2011.
(7) In Artikel 2 der norwegischen Verfassung heißt es: „Die evangelisch-lutherische Konfession verbleibt öffentliche Religion des Staates. Die Einwohner, die sich zu ihr bekennen, sind verpflichtet, ihre Kinder in derselben zu erziehen.“
(8) Angaben des Nationalen Amts für Statistik, www.ssb.no.
(9) „Die Immigration und die Immigranten 2010“, Nationales Amt für Statistik, www.ssb.no.
(10) „Das neue Norwegen. Die Konzentration der Wirtschaftsmacht im Zeitraum seit 1990“, Manifest senter for samfunnsanalyse, Oslo 2011.
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Rémi Nilsen ist Journalist und Redakteur der norwegischen Ausgabe von Le Monde diplomatique.
Texmex-Poller
————————————————————————————-
Dunkle Wälder
…Anfang der 1990er Jahre beherrschten ein paar junge Leute aus nicht gerade benachteiligten Milieus die norwegischen Schlagzeilen: Der schwedische Sänger der norwegischen Band Mayhem (Englisch: Chaos, Radau) nahm sich 1991 das Leben. Euronymous, Bandgründer, Komponist und Gitarrist von Mayhem, fotografierte die Leiche für das Cover der nächsten Platte. Ein Jahr später wurden mehrere Kirchen angezündet, und einer dieser Brände schmückte später das Cover eines Albums der Band Burzum. Samoth, Gitarrist der Band Emperor, und Varg Vikernes, Gründer von Burzum und Bassist von Mayhem, wurden wegen Brandstiftung verurteilt, zeitgleich landete Emperor-Schlagzeuger Bård Guldvik Eithun für den Mord an einem Homosexuellen für 9 Jahre ins Gefängnis. 1993 ermordete Vikernes seinen Bandkollegen Euronymous und ging dafür 16 Jahre in den Knast.
Diese jungen Leute, die zu Straftätern und Mördern wurden, erfanden gleichzeitig eine neue Musik – und eine eigene Welt. Sie radikalisierten den aus dem Hardrock hervorgegangen Metal. Dröhnen und Kreischen, erbarmungsloses Schlagzeug, eindringliches Psalmodieren, verzerrte Gitarren: Die Atmosphäre des Black Metal gleicht der einer schwarzen Messe, einer kriegerischen Beschwörung. Die Musik ist eine Art „Kathedralenrock“, wenn man so will, sie bringt Trance und tiefes Unbehagen. Sie wird nicht „gespielt“, sie breitet sich aus und umfängt den Hörer mit ihrer kalten Wut.
Black Metal Bands – der Name geht auf ein Album der britischen Band Venom von 1982 zurück – entstanden überall in Europa. Ihre Bilderwelt ist gotisch, mittelalterlich, satanisch-heidnisch, auf den Bühnen sind Kreuze, dunkle Wälder, Schädel und Skelette zu sehen. Die Musiker selbst sind oft schwarz-weiß geschminkt, sehen aus wie Leichen; angsteinflößend oder wohlige Schauer weckend, je nach dem Blick des Zuschauers.
Die Texte sind nicht explizit politisch, sondern frönen eher einem gewaltverherrlichenden Nihilismus. Im Mayhem-Stück „View from Nihil“ heißt es: „I can see the wreckage floating ashore of the dying culture“ („Ich kann die ans Ufer treibenden Trümmer der sterbenden Kultur sehen“). Oder es wird der Apokalypse, der Zerstörung und dem Tod gehuldigt: „This is War / I lie wounded on wintery ground / With hundred of corpses around“ („Das ist Krieg / verwundet liege ich auf dem eisigen Boden / zwischen hunderten Leichen“), intonierte Burzum-Sänger Vikernes auf dem Album „War“.
Das sind zwar keine Naziparolen, aber durchaus Anlehnungen an die Wurzeln des Nazismus: Hass auf die Gesellschaft, Sehnsucht nach verlorener Reinheit, nach der alten Zeit und der ewigen Natur. Glorifiziert werden ein unklares Heidentum, schrankenlose Gewalt und die reinigende Kraft des Blutes. Black Metal feiert die Auserwählten, deren Hellsicht sie in Verzweiflung stürzt, die ihnen aber auch den Mut verleiht, Krieg gegen die Agenten der menschlichen Verderbnis zu führen.
Man kann die Black-Metal-Jünger natürlich als kleine Sekte spinnender Fans betrachten. Man kann ihre Pseudonyme und Maskeraden belächeln, auch wenn es schwierig ist, gegenüber der Musik gleichgültig zu bleiben. Sie offenbaren jedoch eine tiefe Verbitterung, deren Ausstrahlung nicht unterschätzt werden darf. Und sie verkörpern – je nach Betrachtungsweise – entweder die höchste Vollendung oder die Pervertierung der Metal-Szene.
Zum französischen „Hellfest“, einem dreitätigen Metal-Festival, das seit 2006 im bretonischen Clisson stattfindet und zehntausende Fans aus aller Welt anzieht, kommen auch Bands aus der „NSBM“-Szene („Nationalsozialistischer Black Metal“). Die intonieren Refrains wie „Hitler was a sensitive man“ werden erst dann aus dem Programm gestrichen, wenn es wirklich Proteste hagelt.
Andererseits regen sich rechte politische und religiöse Gruppen regelmäßig über das Hellfest und den „Teufelskult der Langhaarigen“ auf(.2) Und auf den Festivalbühnen treten auch Musiker aus der linken Szene auf. Im Juni 2010 war etwa Jello Biafra dabei, der sich bei den US-amerikanischen Grünen engagiert, oder die altgediente englische Punkband 999. Man kann das Hellfest also nicht unbedingt als Brutstätte rechter Ideologie bezeichnen. Beobachter erklären immer wieder, dass die Fans sich nur für die Musik interessieren und mit den Ideen der Bands gar nichts am Hut hätten.
Extremistische Neigungen in der Musik gibt es nun nicht nur beim Black Metal, das anzunehmen wäre naiv. Wenn man sich den Mörder von Euronymous, Varg Vikernes, ansieht, ist das Klischee allerdings perfekt. Der enigmatische Musiker mit seiner Band Burzum (der Name stammt aus Tolkiens „Herr der Ringe“) trägt seinen Fanatismus offen zur Schau. Auf seiner Website tut er kund: „Wir sind schwach geworden, wir wurden gebrochen und ruiniert“, denn „wir haben die Freiheit geopfert, um uns Sicherheit zu kaufen.“ Schuld daran sind für Vikernes Juden und Freimaurer, die angeblich die Muslime benutzen, um die Nationen zu zerstören. Solche Hirngespinste erinnern auffällig an die Tiraden des Anders Breivik, des Attentäters von Utøya und Oslo. Der hatte sich während seines Prozesses in Oslo als „Tempelritter“ im Kampf gegen einen angeblich selbstmörderischen Multikulturalismus bezeichnet. Vikernes übrigens bedauert, dass Breivik einen Nationalismus ohne Antisemitismus vertrete.
Die paranoide Furcht vor einer „Verunreinigung“ der edlen Gemeinschaft ist kein Alleinstellungsmerkmal der norwegischen Rechten. Anlässlich der Annahme der Minarettinitiative in der Schweiz 2009 schrieb der französischsprachige Autor Maurice G. Dantec auf der Website „Ring“: „Das öko-eugenische / multikulturalistische / sozial-islamisierte IV. Reich, das heute die Verwaltungsagentur des ,Menschenparks‘ darstellt, ist das schlimmste Komplott, das je gegen die Menschheit geschmiedet wurde. Es ist der Feind. Es muss zerstört werden.“ Auch die Schuldigen hat Dantec ausgemacht: „Die Komplizen dieses demokratischen Totalitarismus sind Länderblocks, offizielle politische Parteien, Kommissionen für Menschenrechte, Richter, Gewerkschaftsfunktionäre, ,nichtstaatliche‘ humanitäre Organisationen.“ Um „das zivilisatorische Projekt neu zu begründen, das die Menschheit dreitausend Jahre lang geleitet hat“, geboren aus der „Begegnung von drei Ursprüngen: den keltischen Nationen, der griechisch-römischen Kultur und den germanischen Stämmen“, müsse man „sich von der demokratischen Weltdiktatur befreien“.
Dantec ist belesen, und das führt er auch gern vor. Den Begriff „Menschenpark“ hat er von Peter Sloterdijk übernommen, andere Einflüsse kommen von Léon Bloy und Philip K. Dick. Er ist brillant, dynamisch, spektakulär und atemberaubend romantisch. In seinen Romanen, zwischen Krimi, Science-Fiction und Essay, breitet er seine Weltsicht aus (2009 hat er über 2 Millionen Bücher verkauft). Und er ist eindeutig „Kult“ – auch wenn (oder vor allem wenn) der „futuristische Katholik“ und Rocker peinlich wird.
Richard Millet, Mitglied im Lektoratskomitee des großen französischen Verlags Gallimard und Essay-Preisträger der Académie Française, steht Dantec da nicht nach. Er hält es mit „der alten Weisheit, die darin besteht, die Rassen für das zu lieben, was sie sind, und das in ihrem jeweiligen Territorium“.(3) Und er möchte wissen, „welchen Sinn die Nation und worin ihrer Identität besteht angesichts einer außereuropäischen Immigration, die deren Wert bestreitet und diese, sagen wir es offen, nur zerstören kann. […] Denn ihre Zustimmung zu den Diktaten des internationalen Liberalismus trifft auf eine entsetzliche Sinnmüdigkeit der angestammten Europäer.“(4) Dantec und Millet sehen sich gern als stigmatisierte Herolde der Wahrheit. Aber im literarischen Establishment werden sie gefeiert: Dantec als Dandy-Prophet und selbst proklamierter „christlicher und zionistischer Kämpfer“ und Millet, der Bewahrer der Tradition des klassischen Stilisten, für sein freiwilliges Engagement aufseiten der Christen beim libanesischen Bürgerkrieg der 1970er Jahre.
Vom weitgehend bedeutungslosen, aber zählebigen Black Metal bis zu einer angesagten, etablierten Literatur stellt eine kulturelle Rechte, die so stolz darauf ist, „extrem“ zu sein, gemeinsame Obsessionen zur Schau: Es geht immer um die Kraft, die man zurückerobern müsse, und gegen die Schwäche, die durch eine von unten vereinheitlichte Gesellschaft zum Wert erhoben werde, oder – das ist dieselbe Denkschiene – um die Bewahrung der Reinheit vor der Korruption durch die ausländischen Agenten mit ihrem Gift.
Genau diese Fantasiewelten werden in zahlreichen Bestsellern beschrieben, in denen es entweder um die Apokalypse geht, die das Ende – und die mögliche Auferstehung – des Homo occidentalis bedeutet, oder um die Manipulation der Welt durch dunkle Kräfte, die nur durch auserwählte Helden verhindert werden kann. Man muss sich nur an die kommerziellen Erfolge von Filmen wie „Matrix“ oder Büchern wie „Sakrileg“ (mit weltweit 86 Millionen verkauften Exemplare) erinnern. Bemerkenswert ist auch der sagenhafte Erfolg der Fantasy-Literatur. Die transportiert genau jene paranoide und tief nostalgische Sehnsucht nach einer Zeit, in der der Mutige, der Held sich beweisen muss, und derjenige, der zu den größten Opfern bereit ist, über den schwachen Herdenmenschen siegt.
Die Fantasy-Schwarten spielen in einem fiktiven blutrünstigen Mittelalter. Dort besitzt die Vernunft keine (schwächende) Macht über den Instinkt, die Technik ist wieder Magie, und der Auserwählte beweist sich in Prüfungen, die zugleich Initiations- und Läuterungsriten sind. Was zählt, ist der Kampf gegen das Böse, die Kräfte der Dunkelheit. J. R. R. Tolkiens Trilogie „Der Herr der Ringe“, deren Hauptmotiv die Suche nach dem einzigartigen Ring ist, dessen Besitzer die Welt beherrscht, ist das große Vorbild.
Erst lange nach ihrem Erscheinen 1954 wurde Tolkiens Werk zu einem Riesenerfolg und verkaufte sich 200 Millionen Mal. Die von ihm inspirierten Figuren bevölkern nicht nur Fantasy-Bücher, sie tauchen auch im Metal auf, in Video- und Internet-Rollenspielen und in zahlreichen aufwendig produzierten Spielfilmen. Die Fantasy-Welt zelebriert Anti-Modernität, Anti-Egalitarismus, die Bindung des Individuums an seinen Stamm, die Tugenden einer abgeschlossenen Welt, die Kühnheit und die Einsamkeit des Anführers. Vor einer fantastischen Kulisse werden Figuren erschaffen wie der Barbar oder der Hexer.
Fantasy-Autoren sind zwar keine Kryptofaschisten, aber so etwas wie Aufklärung und Emanzipation scheint ihnen auch nicht unbedingt ein Anliegen zu sein. Die fiktive Vergangenheit mit Burgen und Drachen, das archaische, obskurantistische Universum wird zum verlorenen Paradies, in dem Gesellschaft und Politik hinter dem Triumph eines höheren Individuums verschwinden. So raunt es entsprechend dem Geist der Zeit, dass die Geschichte keinen Sinn habe, ebenso wenig wie Fortschritt oder Demokratie, und dass einzig die Rückkehr zur naturgegebenen Ordnung und zu den Hierarchien unserer Vorfahren der Wahrheit des Menschen angemessen sei. Evelyne Pieiller
(1) Courrier international, Paris, 5. August 2011.
(2) 2010 gab sogar es in der französischen Nationalversammlung heftige Diskussionen.
(3) Richard Millet, „Désenchantement de la littérature“, Paris (Gallimard) 2011.
(4) Richard Millet, „Fatigue du sens“, Paris (Pierre-Guillaume de Roux) 2011.
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
Ebenfalls aus Damaskus meldete die dortige beim syrischen Informationsministerium in Damaskus akkreditierte Junge-Welt-Korrespondentin Karin Leukefeld angesichts des gestrigen Bombenattentats:
“Die syrische Führung sprach von einem »terroristischen Akt«. Der Anschlag bestärke die Armee darin, »das Vaterland von den Resten der terroristischen Banden zu säubern«, teilte das Militär über das Staatsfernsehen mit.”
Tags zuvor hatte Karin Leukefeld von Damaskus aus den kürzlich erschienenen Guardian-Artikel über Who is Who in der “Syrischen Opposition” auf Deutsch für die JW zusammengefaßt:
Wer den Ton angibt
Stichwortgeber syrischer Opposition für westliche Politik sind mit dieser verbandelt. Ein Bericht des britischen Guardian
Wer in der syrischen Opposition den Ton angibt«. So lautet die Überschrift eines lesenswerten Artikels, den die britische Tageszeitung The Guardian am 12. Juli in ihrer Onlineausgabe veröffentlichte. In einer ausführlichen Recherche – die u.a. auf der Wikileaks-Veröffentlichung von E-Mail-Korrespondenzen der US-Botschaft in Damaskus basiert – richtet der Reporter Charlie Skelton das Augenmerk auf Herkunft und Umfeld bekannter Sprecher des Syrischen Nationalrates (SNR). Er schreibt über die »Stichwortgeber« westlicher Politik, die »warnen« und »drängen« und Regierungen und internationale Organisationen »aufrufen zu handeln«. Sie sind es, die die Deutungshoheit über das haben, was in Syrien geschieht, obwohl die meisten von ihnen seit Jahren keinen Fuß mehr auf Boden des Landes gesetzt haben. Ihren Ruf in westlichen und großen arabischen Medien haben diese Personen laut Skelton vor allem ihren guten Beziehungen zum »angloamerikanischen Unternehmen für die Schaffung von Opposition« zu verdanken. Gemeint sind Stiftungen, Medien und Nichtregierungsorganisationen, die vom US-Außenministerium bisher mit mindestens sechs Millionen Dollar finanziert wurden.
Personen wie Bassma Kodmani, Radwan Ziadeh, Osama Monajed oder Najib Ghadbian haben eine zentrale Rolle bei Gründung und Aufbau des SNR sowie von diesem angeschlossenen »Menschenrechtsinstituten« gespielt und wurden dabei von mächtigen Freunden aus Politik und Wirtschaft unterstützt.
Demnach gehen die Wurzeln dieser »syrischen Demokratiebewegung« und ihre Finanzierung zurück auf das Jahr 2005. Damals rief die US-Regierung von George W. Bush ihren Botschafter aus Damaskus zurück. Die Washington Post berichtet, daß gleichzeitig das Geld für syrische Oppositionelle »zu fließen begann«. Bassma Kodmani hatte Anfang 2005 einen Führungsposten in der Ford-Stiftung. Ende des Jahres leitete sie die neu gegründete Arabische Reforminitiative (ARI), ein Studienprogramm, das von der US-Lobbyorganisation »Rat für Auswärtige Beziehungen« (Council on Foreign Relations, CFR) ins Leben gerufen worden war. Die ARI entstammt einer Diskussion im CFR-»Projekt USA – Mittlerer Osten«, in dem hochrangige Diplomaten, Geheimdienstler und Geldgeber permanent mit einer »politischen Analyse« der Region befaßt sind. Geleitet wird der Zirkel vom früheren General Brent Scowcroft. Ein »hochkarätiger Flügel des westlichen Geheimdienst- und Bankenestablishments« habe Bassma Kodmani 2005 ausgewählt, um seine Pläne für den Mittleren Osten umzusetzen, faßt Skelton zusammen. Gleichzeitig wurde mit dem britischen Zentrum für Europäische Reformen (CER) ein weiterer Think Tank finanziell und politisch eingebunden. CER wiederum ist mit dem »Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen« verknüpft, dem neben Bassma Kodmani auch George Soros angehört. Soros finanziert die gemeinnützigen »Stiftungen für eine offene Gesellschaft«. In Frankreich ist Bassma Kodmani Forschungsleiterin an der Internationalen Diplomatischen Akademie, die vom früheren Chef des französischen Auslandsgeheimdienstes, Jean-Claude Cousseran, geleitet wird. Sie sei nicht irgendeine »Demokratieaktivistin«, schreibt Skelton, sie befinde sich inmitten einer Welt der Banken, Diplomatie, Industrie, Geheimdienste und politischer Institutionen und Stiftungen.
Für auswärtige Beziehungen im SNR ist Radwan Ziadeh zuständig. Im Februar 2012 unterschrieb er einen offenen Brief an US-Präsident Barack Obama und forderte diesen auf, eine Intervention in Syrien anzuordnen. Mitunterzeichner waren u.a. James Woolsey (ehemaliger CIA-Direktor), Karl Rove (Berater von Bush junior) und Elizabeth Cheney, die früher das Iran-Syrien-Operationskomitee im Pentagon geleitet hatte.
Ein weiterer im Bunde dieser »Kämpfer für Demokratie in Syrien« ist Osama Monajed, Berater des SNR-Vorsitzenden. Der ehemalige Direktor des US-finanzierten regierungskritischen Barada TV (London) gründete Ende 2010 das Strategische Forschungs- und Kommunikationszentrum (SRCC), das Medien und Politiker mindestens einmal täglich mit »Neuesten Nachrichten von der Syrischen Revolution« versorgt. In der Huffington Post (GB) erklärte Monajed kürzlich, »warum die Welt in Syrien eingreifen muß« und forderte »militärische Unterstützung« und »ausländische Militärhilfe« für die Aufständischen.

Syrien – nach dem Bürgerkrieg

Castrop-Rauxel (lat. für Wanne-Eickel) – Salafisten vor dem Bürgerkrieg

Wanne-Eickel – Anlegestelle
———————————————————————-
So weit der JW-Artikel von Karin Leukefeld, die taz wollte den Guardian-Enthüllungsartikel nicht aufgreifen – ihre Begründung lautete ungefähr so:
Der Arm des syrischen Regimes reicht bis in den Guardian. Das war im Falle Libyens ähnlich, völlig unabhängig von den Infos über die diversen Personen, die mal zutreffen und mal nicht…
Umgekehrt unkte neulich der “Rote Stern” von Kungur über die taz-Wahrnehmung des Geschehens auf dem Territorium der aufgelösten Sowjetunion:
Der Arm der CIA-Menschenrechtskämpfer und -killer reicht eben bis in die taz…
In der Gründungsriege der taz, als dort noch auf Nationalen Plenen politisch um die Berichterstattung gestritten wurde, scheint es dagegen eher eine gesuchte Nähe zum bolschewistischen Geheimdienst gegeben zu haben – das legen eventuell die diesbezüglichen Gauck-Akten nahe, die derzeit daraufhin durchsucht werden.
Zwar bin ich, u.a. zusammen mit Mathias Broeckers, von taz-Redakteuren bei der Stasi als politisch doch mehr als unzuverlässig eingeschätzt worden, aber desungeachtet und da ich das sowieso erst aus den bisher ausgewerteten Gauck-Akten erfahren habe, hätte ich auch nichts gegen einen gelegentlichen “Kontakt” mit den Genossen drüben gehabt. Was natürlich die ostdeutschen Bürgerrechtler ganz schlimm finden.
Einige Newcomer wie Dietmar Dath und Slavoy Zizek finden nun erneut Gefallen an den damaligen “harten Ideologien” – gegenüber den von Baudrillard so genannten “weichen” (wie Menschenrechte, Ökologie, Urban Gardening, etc.): Ersterer gab kürzlich die Schrift “Staat und Revolution” von Lenin neu heraus – weswegen Broeckers ihn sogleich als “Lenin 2.0″ bezeichnete. Letzterer meinte im Französischen Fernsehen, er sei für den “Terror”, nur dieser habe noch eine wirkliche Chance – oder so ähnlich.

Norwegische SF-Poller

Hydraulischer SF-Poller – aus Boston

Englischer Wunder-Pilon. Alle Photos: Peter Loyd Grosse
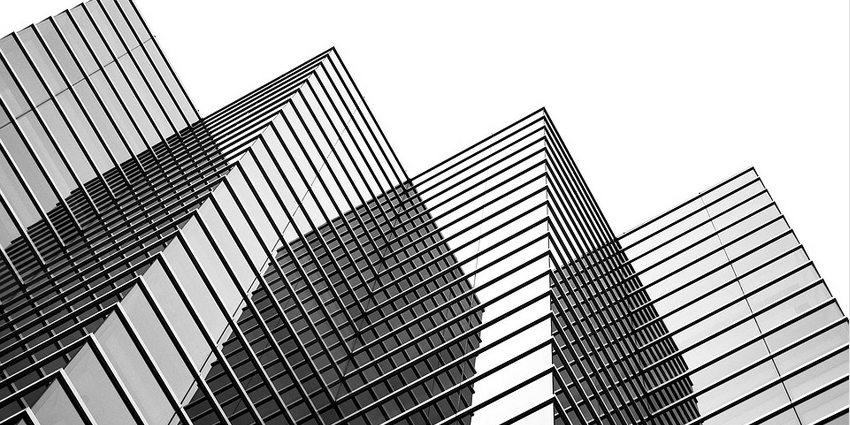












Ist das ein Zeichen der Kapitulation?:
Die Assad-Regierung hat die syrische Jugend aufgefordert, sich mehr als bisher dem Reitsport zu widmen.