
Moby-Dick-Dekoration im Schaufenster des Buchladens „Büchertisch“ am preußischen „Generalszug“ – Gneisenaustraße 7a
Moby Dick zu Weihnachten
Stefan: „Moby Dick – ist das nicht „Amerikka“: der Leviathan oder Behemoth… Den ein fanatischer Verrückter wie Osama bin Laden zur Strecke bringen wollte?“ „Aber nein,“ antwortete seine kleine Schwester Anna und lachte: „So hieß doch der kleine dicke Junge aus der Adalbertstraße, mit dem bin ich im Kinderladen gewesen.“
Man sieht, die Moby-Dick-Rezeption ist noch weit davon entfernt, sich auf einen Nenner bringen zu lassen. In einer solchen Situation hilft es, sich wieder auf den Urtext – den Roman von Herman Melville- zu besinnen. Dort heißt der Verrückte „Kapitän Ahab“. Und so hieß dann auch eine kleine Caféhaus-Kette in Kalifornien, weil deren Besitzer meinte, wie Gregory Peck auszusehen. Sein zunächst expandierendes Unternehmen wurde aber von Käptn Ahabs Gegenspieler auf dem Walfängerschiff, dem vernünftigen Steuermann Starbuck, d.h. von der „Starbucks Coffee Company“, in den Konkurs getrieben.
Inzwischen beweisen weltweit Millionen zufriedene Starbucks-Kunden täglich, dass die Jagd auf den weißen Wal weiter geht – auf vernünftige Weise. Und dass Melville ein großartiger US-Autor ist. Der Berliner Büchertisch in der Gneisenaustrasse 7a hat derzeit sein Schaufenster mit allen deutschen Ausgaben des Romans Moby Dick seit 1927 und aus Ost- und Westdeutschland dekoriert. Zwischendrin hat man etwas verschämt einen opulenten Bildband von Walschützern aufgestellt.
„So lange wie es KZs für Wale gibt, wird es auch welche für Menschen geben,“ hatte der Pariser Anthropologe Claude Lévi-Strauss einst orakelt. Seitdem gibt es mehr Wal- und Delphinschützer auf der Welt als Wale und Delphine. Insbesondere die Schwertwale und die Delphine werden heute weniger gejagt und getötet als „artgerechten“ Intelligenz- und Kommunikations-Tests unterworfen. Im Endeffekt kam dabei bereits heraus, dass für sie – ebenso wie für die höheren Affen – eigentlich längst die Menschenrechte gelten müßten.
Auf der Internetseite der Universität Weimar findet sich der Eintrag: „Heute gilt die Geschichte der Jagd nach dem weißen Wal nicht nur als herausragender Beitrag zur Weltliteratur, sondern als Zeugnis einer geradezu seismographischen kulturellen Selbstbeobachtung des 19. Jhds., die auch an unsere Gegenwart noch entscheidende Fragen stellt.“ Genannt werden:
„Fragen der Geopolitik und Globalisierung, der Versicherung und Technik, der kulturellen Identität und ihrer transnationalen Auflösung, des Kolonialismus und Imperialismus, der Territorialisierung und Deterritorialisierung; Fragen nach den Gegensätzen von Staat und Wirtschaft, von Land und Meer, von Universalismus und Partikularismus, von Macht und Norm, von Geld und Moral.“
An der Uni Weimar traf sich seit 2006 jährlich eine zwölfköpfige Gruppe von Kulturwissenschaftlern – mit dem Ziel, „jedes der 135 Kapitel von ‚Moby Dick‘ samt der Paratexte zu kommentieren. Das Projekt eines ‚historisch-spekulativen‘ Gesamtkommentars fragt dabei nach den Gründen für die enorme Bedeutung von ‚Moby Dick‘ für die Selbstbeschreibungen unserer Kultur und nach den Ambiguitäten und der Zerrissenheit des Symbols in Form eines weißen Wals, den es in allen sieben Weltmeeren zu jagen gilt.“
Heraus kam dabei jetzt eine Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift des Fischer-Verlags „Neue Rundschau“, in der das Weimarer Autorenkollektiv jede Menge neue Fakten um die Fiktion „Moby Dick“ anhäufte.
Zuvor hatten vier aus der Arbeitsgruppe in der „Bauhaus-Universität“ bereits den Aufsatz „Die Hyäne“ von Alfred Brehm literaturwissenschaftlich wiedergekäut. Schon Nietzsche hatte das Wiederkäuen empfohlen – und dabei konkret an Literatur gedacht: „um dergestalt das Lesen als Kunst zu üben, tut eins vor allem not, was heutzutage gerade am besten verlernt worden ist – und darum hat es noch Zeit bis zur »Lesbarkeit« meiner Schriften –, zu dem man beinahe Kuh und jedenfalls nicht »moderner Mensch« sein muß: das Wiederkäuen.“ Die im Kreuzberger Verlag Diaphanes erschienene Weimarer Textsammlung über Alfred Brehms Hyänen-Aufsatz, illustriert mit Photos von Afrikanern mit angeleinten Hyänen, hat den Titel: „Die Hyäne. Lesarten eines politischen Tiers“.
Während der gemeinnützige Buchladen „Büchertisch“ in seiner Berliner Edition inzwischen ein Buch mit Kochrezepten veröffentlichte, „Kreuzberg kocht“, in dem gleichzeitig die zu den Rezepten gehörenden (kochenden) Kollektive und politischen Initiativen des Bezirks vorgestellt werden. Ein weiteres „Kochbuch“ stammt aus dem Bauhaus – von einer Anonyma, die dort einst für die Kommunisten agitierte und ihre subversive Tätigkeit mit Küchenarbeit tarnte: „Die rote Köchin. Geschichte und Kochrezepte einer spartakistischen Zelle im Bauhaus Weimar“, erschienen im Ventil-Verlag. Erwähnt sei schließlich noch die Geschichte einer Partisanin, die ihre subversive Tätigkeit als Wander-Imkerin tarnte: „Jelka. Aus dem Leben einer Kärtner Partisanin“, im Verlag Drava.
———————————————————————————————————————
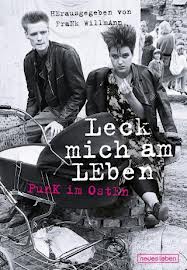
To old to die young: der Ostpunk
Das Wir-Gefühl im Pogoland
Der Anarchodichter Bert Papenfuß sprach in seiner und Mareile Felliens Kulturspelunke „Rumbalotte continua“ von „Saufen, Kotzen, Vögeln“ – als die drei Essentials der ostdeutschen Punkbewegung. Ein viertes wäre ihre fortdauernde künstlerische Existenz über die DDR hinaus:
in Form der Fanzines „Floppy Myriapoda“, „Drecksack“, „Gegner“ und „Konnektör“;
als Interviews in mehr als ein halbes Dutzend Büchern von Frank Willmann über die Punkfußballfans vor allem des Ostberliner Vereins „1. FC Union“;
als groß- und kleinflächige Malereien in regelmäßigen Ausstellungen der „Staatsgalerie“ von Henryk Gericke;
und als Bandformationen – wie „Herbst in Peking“ und „Tarwater“, die zusammen mit einigen Punkdichtern und unter der Regie der norwegischen Anarchistin Tone Avenstroup am 30.11. im AckerStadtPalast ein Aktionstheaterstück aufführen – mit dem Titel: „Nein“!
Die Verherrlichung der DDR-Punkmusik scheint ansonsten in das Ressort des „Fritz“-Wellenleiters Ronald Galenza zu fallen, der ebenfalls bereits ein halbes Dutzend Bücher darüber veröffentlichte. Beginnend mit einem Wälzer über die halbnomadische Punkgruppe „Feeling B“ und deren 2000 gestorbenen Gründer Aljoscha Rompe. Dieser war bereits 1987 zu einer Legende geworden – durch einen Film über die ostdeutsche Rockmusikzene: „Flüstern und Schreien“. Der Regisseur Dieter Schumann hatte darin die Frage „Rufen wir mit dem Film zur Revolution auf?“ mit „Ja!“ beantwortet. Sein Koregisseur Jochen Wisotzki schwärmt noch heute von der ruhelosen Renitenz des Punksängers Rompe, nach dessen Biografie der Punkdichter und IM aller anderen Punkdichter des Prenzlauer Bergs Sascha Anderson sich angeblich immer gesehnt hat.
Während des Kriegsrechts in Polen tourte „Feeling B“ mit einem ausgebauten Kleinbus durchs Land. Beim Mauerfall machten sie von sich reden, indem sie vor laufenden Westkameras den SED/PDS-Vorsitzenden Gregor Gysi bestürmten, die Mauer wieder dicht zu machen – sonst sei alles zu spät. Und Recht hatten sie! Auch mit der Band Feeling B war es danach aus: Die Musiker Flake und Paul Landers gründeten 1993 die Gruppe Rammstein mit, die weltweit Erfolg hatte. Aljoscha wurde über diese Verluste immer stiller – bis er schließlich eines Nachts in seinem Wohnwagen im Prenzlauer Berg erstickte. Die taz titelte: „Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen!“
Das hätte man zuvor auch von dem Punkdichter Mathias Baader Holst sagen können, der 1990 unter eine Straßenbahn geriet und starb. Regelmäßig erinnern uns nun schriftlich und mündlich die Dichter Peter Wawerzinek und Susann Immekeppel an ihn. Letztere hat das auch im soeben erschienenen Buch des Punk-Biographen Frank Willmann wieder getan. Es heißt „Leck mich am Leben. Punk im Osten.“ Davor hatte Willmann ein einfühlsames Porträt des Sängers von „Schleimkeim“ – Otze Ehrlich – veröffentlicht: „Satan, kannst du mir noch mal verzeihen.“ Bei Amazon heißt es dazu: „Schleimkeim waren eine der einflussreichsten Bands der ehemaligen DDR und dies weit über Punk-Kreise hinaus. Die Biographie ihres Sängers liest sich abenteuerlicher als jeder Roman. Sie spiegelt die ganze innere Zerrissenheit eines unangepassten Charakters in einem autoritären Staat wider.“ In eine ähnliche Kerbe haute 2006 der Dokumentarfilm „OstPunk! Too much Future“ von Michael Boehlke und Carsten Fiebeler; einer der Protagonisten des Films ist heute Türsteher des Berghain.
Zu all diesen kreativen DDR-Punks – tot oder lebendig – gehörte auch die Ostberliner Punk-Modeszene. Über sie gab es 2009 eine Ausstellung im Kunstgewerbemuseum „In Grenzen Frei“ und dazu einen anrührenden Dokumentarfilm: „Ein Traum in Erdbeerfolie“. Die darin gezeigten Kleider – aus Duschvorhängen, Abdeckplaste oder Windeln – erwarb das Deutsche Historische Museum.
Die im Kunstgewerbemuseum gezeigten Photos – u.a. von Tina Bara, Sibylle Bergemann, Roger Melis und Helga Paris – findet man jetzt in der großen Ausstellung der Berlinischen Galerie über die „Künstlerische Fotografie in der DDR. Geschlossene Gesellschaft“ wieder. Bis vor kurzem zeigt daneben die „Staatsgalerie“ Fotografien von 1980 bis 1984: „East End. Punk in der DDR“. Dort wurde dann auch das Buch „Leck mich am Leben. Punk im Osten“ vorgestellt.
Trotz all dieser liebevollen Erinnerungen und musealisierten Paraphernalia der einst in der DDR nur widerwillig tolerierten Punks fand Bert Papenfuß, es sei nun an der Zeit, in die Offensive zu gehen – und zwar mit einer „Anti-Lesebühne“ in der Kneipe Rumbalotte: „Traute statt Flaute“ (jeden 2. und 4. Dienstag im Monat).
————————————————————————————————————–

Projekt „Referendum: Für die rechtsgültige Erlaubnis zur Zeugung gemeinsamen Nachwuchses von Menschen und Primaten zur Errichtung einer Fortpflanzungsgemeinschaft“ von Reiner Maria Matysik (http://reinermatysik.de/text/eigenes/moskau-berlin/) – vorgestellt auf der NGBK-Ausstellung „Tier-Werden, Mensch-Werden“. Diese Forpflanzungsgemeinschaft wurde zuletzt in der Sowjetunion angestrebt – zu wissenschaftlichen Zwecken. Seit Mitte der Siebzigerjahre weiß man, das nichts dabei rausgekommen wäre. Mensch und Menschenaffen haben sich zu sehr auseinandergelebt – ähnlich wie der afrikanische und der asiatische Elefant, auch sie können sich nicht mehr paaren. Demnächst wird eine Novellierung des Tierschutzgesetzes in der BRD verabschiedet, die das Gegenteil von Matysik will: die Sodomie verbieten. In der BZ outete sich bereits ein Sodomist, der natürlich gegen das Gesetz ist. Er paart sich jedoch nicht mit einem Menschenaffen, sondern mit einem deutschen Schäferhund – aber nur, wenn der das auch will.
„Kein Wir-Gefühl im Pongoland“
Pongoland – so heißt die im Zuge des Blühende-Landschaften-Versprechens in Leipzig ab 1998 errichtete „weltweit einzigartige Menschenaffenanlage“. Und mit dem „Wir-Gefühl“ der dort zum Wohle der Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie inhaftierten Schimpansen ist die dort vorherrschende These gemeint, dass diese Hominiden bloß einen schwachen Begriff von Altruismus und Empathie haben.
Sie helfen einander nur auf Bitten hin und das auch nur kurzzeitig, gleichsam unwillig – so ungefähr. Der Leipziger Institutsleiter Michael Tomasello stellte bereits 1999 die These auf: „Wir können die Intentionen anderer lesen, beherrschen also Mindreading, die Affen können es nicht.“ Was es dann also zu beweisen galt. Das magere Ergebnis der Leipziger Schimpansenforscher wurde u.a. vom Londoner Professor für Evolutionäre Anthropologie Volker Sommer, der zuletzt ein Buch über die Kultur wild lebender Affen in Nigeria „Schimpansenland“ veröffentlichte, kritisiert, wobei er den o.e. Satz äußerte: „Kein Wir-Gefühl im Pongoland“.
Immerhin bewirkte die Leipziger Bewußtseins-Theorie, dass nahezu weltweit die Primatenforscher anfingen, altruistisches Verhalten zu studieren – sei es im Freiland, im Zoo oder in ihren Laboratorien. Die Leipziger haben quasi alles in einem, wobei ihre Freilandforschung unter wild lebenden Schimpansen im Taï Nationalpark an der Elfenbeinküste stattfindet. Zuletzt kamen von dort so bedeutende Ergebnisse wie: „Leipziger Primatenforscher bestätigen die These: Wer Beute teilt, hat öfter Sex,“ (http://www.l-iz.de/). Was den „Spiegel“ flugs zu dem gewagten Evo-Devo-Rückschluß verleitete: „Käufliche Liebe auch bei Schimpansen“.
Im Pongoland selbst fand zuletzt ein groß angelegter Intelligenztest mit Bananen statt, an der „23 Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans“ beteiligt waren. Die Testergebnisse wurden mit den Ergebnissen ähnlicher (Belohnungs-)Tests an „106 Schimpansen in einer afrikanischen Freiluftstation verglichen“, die von Esther Herrmann in zwei Affen-„Auffangstationen in Uganda und der Republik Kongo“ durchgeführt wurden. Heraus kam dabei: Die meßbare Intelligenz ist individuell unterschiedlich. Für den Leipziger Teamleiter Josep Call folgt daraus: „die geistigen Fähigkeiten der Tiere künftig unter einer erweiterten Perspektive zu studieren,“ (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/1891845/).
Zurück zur menschlichen Fähigkeit, die „Intentionen anderer“ zu verstehen, was der Tempelaffenforscher Volker Sommer auch den Menschenaffen zugesteht. Dazu muß man sich aber erst einmal als Jemand begreifen. Die Kinderpsychologen Charlotte und Karl Bühler prägten in den Zwanzigerjahren bei ihrer Untersuchung, wann und wie dies bei Kindern geschieht, den Begriff des „Schimpansenalters“. Dieser wurde zusammen mit den Schimpansenstudien von Wolfgang Köhler auf Teneriffa, nach dem das Leipziger Max-Planck-Institut benannt wurde, von den Psychiatern Wygotski und Lurija in Rußland aufgegriffen und in Frankreich vom Psychoanalytiker Jacques Lacan. Für Letzteren ist das „Schimpansenalter“ mit dem „Spiegelstadium“ identisch. Es bezeichnet einen Entwicklungsschritt – dahingehend, dass das Kind sich im Spiegel erkennt, wobei sich ihm ein „Gefühl des Verstehens“ und eine „erleuchtete Intuition“ einstellt, die dem Schimpansen verwehrt bleibt.
Inzwischen haben jedoch Primatenforscher längst festgestellt, dass gerade Schimpansen sich ebenfalls im Spiegel erkennen. Sie erleben – in Gefangenschaft bei der Benutzung von Handspiegeln – sogar ständig „erleuchtete Intuitionen“. Jüngst wurde das Sachbuch „Affengesellschaft“ der Leipziger Primatenforscherin Julia Fischer viel gelobt. Es ist eine Art Zusammenfassung der Forschung im Pongoland – ihr Verlag (Suhrkamp) schreibt: „Julia Fischer geht den vielfältigen Formen des Zusammenlebens von Affen nach, untersucht die Ursprünge und Grenzen ihrer Intelligenz und fragt, ob sie so etwas wie eine Sprache besitzen. Durch die Verbindung von Labor- und Feldforschung gelingt es ihr, erstaunliche Gemeinsamkeiten im Sozialverhalten von Mensch und Affe, aber auch die Unterschiede aufzuzeigen, die uns von unseren nächsten Verwandten trennen.“
Das Buch hat jedoch wie alle Publikationen aus Pongoland ein Manko: Es fehlt ihnen an „erleuchteten Intuitionen“. Sie sind allzu sehr vom wissenschaftlichen Brainstream des US-EvoDevo durchdrungen – und meinen, mit Bananen kann man alles erreichen. Dass dies gerade in der Heldenstadt Leipzig geschieht, ist mehr als ein DDR-Witz.
Im Ostberliner Tierpark beobachtete ich einmal einige Erstklässler, die hingebungsvoll einen alten Schimpansen beobachteten, der gerade genüßlich eine Banane aß. Vor allem interessierten sie sich jedoch für die Banane, wie ich dann erstaunt feststellte. Schließlich wurde dem Schimpansen ihr Interesse zuwider: Langsam schlenderte er auf die Schüler zu – und zerdrückte ruckzuck die Banane vor ihrem Gesicht an der Glasscheibe, von wo aus sie langsam nach unten in das Sägemehl rutschte. Eins der Kinder fing daraufhin an zu weinen, dadurch wurden auch die anderen Kinder auf die zerquetschte Banane im Dreck aufmerksam und im Nu machte die ganze Klasse ein trauriges Gesicht. Der Lehrer befahl ihnen, weiter zum nächsten Käfig zu gehen. Eine Affenpflegerin erklärte mir später, daß die Südfruchtverschwendung der Menschenaffen ein wirkliches Problem in den Zoos der DDR sei. Der alte Affe wollte die Banane jedoch den Schülern eher anbieten als sie in den Dreck treten, behauptete sie. Damals waren anscheinend selbst die Schimpansen noch altruistischer als die heutigen – auf dem Territorium der DDR zu leben gezwungenen.
————————————————————————————————————-

Die Mieterinitiative Kotti & Co: „Wir sind Nachbarn aus Kreuzberg, die sich zusammengefunden haben um für ihr Recht auf Stadt zu kämpfen…Seit Ende Mai 2012 sind wir Nachbarinnen und Nachbarn und UnterstützerInnen rund um die Uhr in unserem Protest-Gecekondu am Kottbusser Tor präsent. Wir haben unglaublich viel Solidarität, Zuspruch und Unterstützung erfahren, weil alle wissen, dass unser Protest für bezahlbare Mieten alle etwas angeht – dass es hier nicht nur um Mieten, sondern um die Stadt von Morgen geht. Die hohen Mieten treffen als erstes die Nachbarn mit geringen Einkommen – mittlerweile jedoch auch Teile der Mittelschicht. Selbst viele, die unsere Sorgen nicht direkt teilen müssen, kommen zu uns ans Kottbusser Tor, ans Kotti, trinken einen Tee mit uns, kleben Plakate, übernehmen eine Schicht, kommen auf die Demonstrationen und Veranstaltungen, backen Kuchen oder spenden Geld. Kurz: die Beteiligung am Protest war und ist überwältigend und das Co von Kotti wird immer größer- Mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus.
Sozialschwäche
Das Wort „sozial Schwache“ verdankt sich einer Bedeutungsverdrehung wie zuvor das Wortpaar Arbeitnehmer-Arbeitgeber. Sozial schwach sind die sogenannten Arbeitgeber/Unternehmer/Manager, insofern sie für ihre gesellschaftliche Teilhabe leichten Herzens jeden Preis zahlen können, was den Armen unmöglich ist, die ihre ökonomische Schwäche deswegen mit „sozialer Stärke“ zu kompensieren suchen. In der Presse hört sich das so an: „Sozial schwache Familien sind grundsätzlich kinderreicher als Familien von Intellektuellen.“
Vor allem an der Mittelschicht bemerkt man derzeit, dass sie sozial schwach wird. Man spricht dabei von „Brasilifizierung“ und einem gesellschaftlichen Entsolidarisierungsprozeß, der sich öffentlich in wachsender Ausländerablehnung zeigt, und betriebsintern in der Zunahme von Mobbing. Das wird neuerdings sogar an den Unis gelehrt – bis in den Neodarwinismus der Naturwissenschaften und der Isolation eines „Erfolgs-Gens“ im Labor. So berichtete die Studentin Jana z.B. aus einem BWL-Seminar der Elite-Universität „Viadrina“ in Frankfurt/Slubice „Neulich sagte der Professor zu uns‘,Wenn ich andern Gutes tue, tu ich mir selbst nichts Gutes…‘ Und alle haben das brav mitgeschrieben!“
Sie waren zuvor mit blödsinnig-verschulten Bachelor- und Master-Studiengängen gefügig gemacht worden – und hofften bloß noch, endlich eines dieser albernen schwarzen Hütchen mit Bommel tragen zu dürfen, den sie dann vor lauter Freude kollektiv in die Luft werfen. So werden äußerst sozialschwache „Eliten“ herangezogen.
An Versuchen, die Armen und Verarmten, die Unterschichtsangehörigen, Hartz IVler und Zuverdiener, anders als „Sozial Schwache“ zu bezeichnen, hat es nicht gefehlt. Aber auch das Wort „Bildungsferne Schichten“ führt in die (soziologische) Irre, denn die so Genannten können sich schlicht die meisten Kulturangebote nicht leisten. Es bleibt dabei: „Das war aber eben etwas unsozial,“ wie eine Frau in der U-Bahn zu ihrer Freundin sagte, als diese dem krank aussehenden Motz-Verkäufer weder ein Heft abkaufte noch ihm ein bißchen Kleingeld gab, sondern bloß unwillig den Kopf schüttelte. Sie antwortete: „Es gibt eben Tage, wo ich sozial schwächel. Na und?!“
Das umgekehrte Syndrom läuft auf hypersozial tun hinaus: Auf dem Bahnhof Hackescher Markt begrüßte mich ein Treuhand-Manager, der inzwischen einen gutbezahlten Job in Potsdam hatte und auch dort wohnt. „Ich weiß gar nicht, was Sie gegen die erhöhten Fahrpreise der BVG haben,“ meinte er, obwohl ich nichts Diesbezügliches gesagt hatte. Vielleicht machte er mich für die Kritik an der neoliberalen Verkehrspolitik in den Zeitungen, die auch meine Texte veröffentlichen, mitverantwortlich? Er erklärte mir: „Mein Wagen ist gerade in Reparatur und ich bin heute aunahmsweise mal mit der S- und U-Bahn in die Stadt gefahren. Das war ja soo interessant. Diese ganzen Leute! Dafür hätte ich gut und gerne auch 10 Euro bezahlt.“ Das war in Wirklichkeit äußerst sozial schwach gedacht. Diese Schwäche hat im übrigen bereits eine Hamburger Lehrerin der Bankierstochter und späteren Treuhandchefin Birgit Breuel in der zehnten Klasse vorgeworfen, wie der Spiegel 1991 herausfand.
Von sozial schwächeln redeten auch die ehrenamtlichen „Tafel“-Mitarbeiter im Westen, wenn sie die Mitarbeiter der ostdeutschen „Tafeln“, die „ihre Armen“ ebenfalls mit Essen versorgen, meinten, da diese das nur so lange machen würden – bis ihre ABM-Stelle auslaufe. So charakterisiert man daneben aber auch und vor allem die mit der Staatsverschlankung einhergehenden Gründungen von „Freien Trägern“ für soziale Einrichtungen, denen primär daran gelegen ist, sich erst einmal selbst zu „tragen“. Ähnliches gilt auch für die privatisierten Sozialwohnungs-Baugesellschaften – sie wurden und werden zunehmend asozialer: Kein Tag, an dem nicht irgend ein Teil ihrer Mieter über horrende Mehrkosten klagt, die plötzlich fällig werden.
Im „Gutefrage.Net“ wird behauptet, sozial Schwache, das sei ein politischer Begriff, „finanziell Schwache“ wäre richtiger. Ob die „finanziell Starken“ dafür „sozial schwächer“ als die „finanziell Schwachen“ sind, die jetzt noch als die „sozial Schwachen“ gelten, blieb in diesem Internetforum ungeklärt. Die „finanziell Schwachen“ sind es auch in politischer Hinsicht, da sie dem „Staat, dem kältesten aller kalten Ungeheuer“ laut Nietzsche, nicht nur nichts einbringen, sondern u.U. sogar noch was kosten. Der Umgang mit ihnen in den neoliberal durchseuchten Ämtern und Behörden wird deswegen zunehmend „sozial schwächer“. „Die Konflikte häufen sich,“ wie es in der Presse heißt. In der Weddinger Badstraße, die bereits im deutschen „Monopoly“-Spiel als Einkaufsstraße der Ärmsten fungiert, fragte ich einen der vielen dort bettelnden Roma, ob er nicht in den Flaniermeilen der Reichen, auf dem Kurfürstendamm oder in der Friedrichstraße, mehr Erfolg haben würde. „Da gibt einem doch niemand was. Völlig aussichtslos!“ antwortete er.
Das erinnerte mich an eine Bemerkung des „Anti-Nazi-Activist“ Oskar Huth, der während der Nazizeit 60 in Berlin versteckte Juden mit Lebensmitteln versorgte. In seinem „Überlebenslauf“ schrieb er: „Wer wirklich Leute versteckte, das waren die Proletarier untereinander. Die Ärmsten halfen den Armen. Und die Leute, die wirklich Möglichkeiten hatten – da war nichts, gar nichts.“
Ähnlich drückte sich die Witwe Schickedanz aus, eine der reichsten Frauen Deutschlands, als man sie nach der Entstehung ihres Vermögens fragte: „Wir habbit nich vom Ausjebe, sondern vom Behalte!“ Richtiger wäre gewesen zu erwähnen, dass ihr Vater Gustav Schickedanz sein „Quelle“-Vermögen großenteils durch „Arisierung“ jüdischen Vermögens erwarb.So äußerte z.B. Oskar Rosenfelder, bis 1934 Besitzer der Vereinigten Papierwerke Heroldsberg mit der eingeführten Marke „Tempo“: „Gustav Schickedanz [konnte] die Aktienmajorität völlig unentgeltlich in seinen Besitz bringen, ja darüber hinaus sogar einen erheblichen, seinerzeit sogenannten Arisierungsgewinn erzielen.“ Der „Nazi-Activist“ Schickedanz wurde deswegen Ende 1945 erst einmal mit Berufsverbot belegt und als Hilfsarbeiter zwangsverpflichtet. Er hatte sich vor allem deswegen in der NSDAP engagiert, weil ihn deren „Darwinismus“, der in Eugenik und Euthanasie gipfelte, ansprach.
Darwin hatte in seiner Evolutionstheorie den Populationsbegriff und die Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Evolution von Thomas Malthus übernommen. Der Nationalökonom Malthus hatte berechnet, dass die Bevölkerungszahl exponentiell steige, die Nahrungsmittelproduktion in derselben Zeit aber nur linear. Die erheblichen sozialen Probleme seiner Zeit betrachtete Malthus in erster Linie als Folgen einer zu großen Bevölkerung. Er empfahl, die Armenhilfe einzuschränken, sie sei wider den „Naturgesetzen“ der Ökonomie. Denn direkte Hilfe würde seiner Meinung nach die Armen nur ermutigen, noch mehr Nachkommen zu zeugen – und so neue Armut schaffen. „Damit leitete er einen Wandel in der britischen Armenpolitik ein: weg von Almosen, hin zu Zuchthäusern“ – so das „manager-magazin“, das es im übrigen offen läßt, ob dies nun gut oder schlecht war.
————————————————————————————————————–

Albrecht Dürer: „Der Zeichner der Perspektive/Der Zeichner des liegenden Weibes“
Abstraktions-Vorgänge
In einer Diskussion der Akademie der Wissenschaften in Potsdam über Gemeinsamkeiten zwischen Kunst und Wissenschaft intervenierte eine Physikerin mit dem „Satz der Identität in der Logik – A gleich A“: „Da raus zu kommen“, das sei doch „die wirkliche Aufgabe der Kunst.“ Sie wollte damit sagen, dass Kunst und Wissenschaft ihre Erkenntnisse auf verschiedenen Wegen erreichen – einem der der sinnlichen Intuition nahekommt, und einem, der ihr ferner liegt. Diese Unterscheidung traf bereits Claude Lévi-Strauss in seinem Buch „Das wilde Denken“ – in bezug auf eine indianische „Wissenschaft des Konkreten“ und „unserer Wissenschaft des Abstrakten“.
Für letztere gilt inzwischen als gesichert, dass die Entstehung und Entwicklung der modernen Naturwissenschaft historisch der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zuzuordnen ist. Die moderne Naturwissenschaft bildet die intellektuelle Vorbedingung zur Schaffung der modernen Technik, vornehmlich der Produktionsapparatur. Für den Erkenntnistheoretiker Alfred Sohn-Rethel finden sich die „Vorstadien“ des Frühkapitalismus (im 16. und 17.) schon in der Renaissance: „Gestalten wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer scheinen geradezu auf der Schwelle beider Zeitalter zu stehen. Auf der einen Seite sind sie noch Handwerker und Künstler, die die Natur sinnlich studieren und sinnlich darstellen durch das Geschick ihrer Hände in der Handhabung ihrer Werkzeuge und Materialien; auf der anderen Seite sind die selben Männer konstruktive Ingenieure, die für ihre Aufgaben Lösungen in abstrakten Begriffen und im unsinnlichen Medium der Mathematik suchen. Die Verbindung von Mathematik und Experiment ist hier jedoch noch tastend und wenig wirksam…“
Lévi-Strauss sieht den Gegensatz zwischen einer „wilden“ (konkreten) und einer modernen (abstrakten) „Wissenschaft“ personifiziert im Bastler (Bricolleur) und im Ingenieur. Albrecht Dürer verkörperte noch beides, wollte jedoch die absolute Trennung von Hand- und Kopfarbeitern nicht mitmachen, deswegen verfaßte er für seine Handwerks-Lehrlinge zwei Lehrbücher, in denen er das praktische Wissen und die Mathematik zusammenführte. Sie machen sein eigentliches Genie aus. Aber Dürer scheiterte damit nach zwei Seiten hin: 1. waren seinen Lehrlingen und Gesellen die Berechnungen zu kompliziert, und 2. lobten zwar die italienischen Kollegen von Dürer, Festungsbauer vielfach, seine zwei „Vermessungslehren“ über alle Maßen, mitnichten verrieten sie aber deren Inhalt an die Arbeiter und Handwerker, denn sie wurden fortan für dieses Wissen bezahlt. Weniger genial ist sein Tagebuch, es besteht fast nur aus Ein- und Ausgaben-Verzeichnissen.
In der Renaissance-Kunst selbst bahnte sich damals die Verbindung bzw. der Übergang zur Mathematik an – mit der Zentralperspektive. Dürer hat sie in seinem Holzstich „Der Zeichner der Perspektive/Der Zeichner des liegenden Weibes“ mitsamt den dazugehörigen Arbeitsgeräten zur perspektivischen Aufrasterung (Verpixelung) des Frauenkörpers thematisiert – und in seinem Buch „Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt“ (1525) als Illustration beigefügt.
300 Jahre später wird die künstlerische Zentralperspektive zur Herrschaftsabsicherung in die Stadtplanung überführt – in Form von „Sichtachsen“, die man durch die Pariser Innenstadt schlägt, was dann nach ihrem Planer „Haussmannisierung“ genannt wird, man nennt diese Erleichterung für reguläre Truppen beim Niederschlagen von städtischen Aufständen auch die „Artillerieperspektive“ – ein Begriff aus den Vierzigerjahren, der von Straßenplanungsbehörden noch heute verwendet wird, wenn auch immer öfter kritisch. Schon bei der Entdeckung der Zentralperspektive durch die Renaissancemaler ging es um die Artillerie: um Ballistik und Festungsbauten, die wegen der sich verbessernden Durchschlagskraft der Waffen ständig ausgebaut und verstärkt werden (mußten), was den italienischen Künstlern/Architekten/Ingenieuren/Mathematikern Ruhm und Reichtum auf Dauer einbrachte. Der venezianische Mathematiker Nicolo Tartaglia (1499 -1557) wird als „Vater“ der Ballistik bezeichnet.
In den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts kritisierte der russisch-orthodoxe Priester Pawel Florenski die Zentralperspektive, die er zugunsten der Ikonenmalerei verwarf, weil jene „eine Maschine zur Vernichtung der Wirklichkeit“ sei.
Das könnte auch auf die Politik des Zentralkommittes (der Bolschewiki) gemünzt sein. Dafür spricht, dass Florenski, der als Häftling auf den Solowski-Inseln Algen erforschte – bis er 1937 erschossen wurde, gegen deren (post)monarchistische Zentralperspektive ein „synarchisches Feld“ setzte. Grund für seine „Liquidierung“ war sein 1922 veröffentlichtes Hauptwerk „Imaginäre Größen in der Geometrie“, in dem insbesondere das Schlußkapitel beanstandet wurde, weil er darin Dantes „Göttliche Komödie“ mit Hilfe der Relativitätstheorie interpretiert hatte.
Der Ästhetikprofessor Bazon Brock führte kürzlich auf einer Veranstaltung in der Kreuzberger „Denkerei“ Evolution und Mathematik bis hin zur Quantenphysik evolutionär zusammen: „Der Urknall war physikalisch-chemisch – naturgesetzlich. Erst die Bakterien gehen raus aus Physik und Mathematik – sie emanzipieren sich quasi von den Naturgesetzen. Der Mensch geht dann aber wieder rein – und weitet sie aus: auf eine künstliche Natur. Das beginnt mit Pythagoras [bei dem die Geometrie noch mit der Mystik verbunden war]…Und endet mit 1 Punkt = 1 Pixel. Aber mit der Quantenphysik ändert sich wieder alles.“
Wassili Grossman schrieb 1944 in seinem Kriegstagebuch: „Viele Panzersoldaten kommen aus der Kavallerie. Aber zweitens sind sie auch Artilleristen und drittens müssen sie etwas von Fahrzeugen verstehen. Von der Kavallerie haben sie die Tapferkeit, von der Artillerie die technische Kultur.“
Der Schriftsteller Isaac Babel wunderte sich in seinen 1926 veröffentlichten Erzählungen über die kosakische Reiterarmee von Budjonny, die er auf ihrem Polenfeldzug begleitet hatte, dass deren Angehörige die meiste Zeit des Tages mit der Pflege ihrer Pferdebeziehung beschäftigt waren. Dabei rettet sich der nomadische Krieger in die „revolutionäre Kavallerie“. Die Kosaken waren kein Volksstamm und auch keine Kaste, sondern freie Kriegergemeinschaften in der Funktion von Grenztruppen des russischen Reiches.
Die selbe Pferd-Krieger-Beziehung finden wir in den Ethnographien der amerikanischen Indianer. Nur dass diese zur selben Zeit quasi ausgerottet wurden. Tolstoi, der 1851 als Offizier bei den Kosaken an der Grenze zu Tschetschenien einquartiert war, hat über ihren Kriegerstolz in „Hadschi Murat“ berichtet. Weil er ihre Kämpfe als zivilisierter russischer Adliger zutiefst ablehnte, verließ ihn seine kosakische Geliebte. Bei den partisanischen Kosaken des Bürgerkriegs verändert sich nach ihrer Eingliederung und Einreihung in die Rote Armee noch einmal ihr „ganzer Eros des Krieges“, wie Deleuze/Guattari das nennen: „Der auf das Tier orientierte Eros des Reiters (über den Isaak Babel sich nicht genug verwundern konnte) wird dabei durch einen „homosexuellen Gruppeneros“ ersetzt. D.h. durch die „Kameradschaft“, die unter Unterworfenen stattfindet – durch Staat, Militärthierarchie und Gehorsam vollständig der Selbstbestimmung beraubte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben insbesondere die weißrussischen Schriftsteller Ales Adamowicz und Wassil Bykau sich jahrzehntelang nur mit dem Partisanenkampf und seiner Moral beschäftigt, weil, so sagte Bykau, die Soldaten nur Rädchen in einer Maschine sind, wohingegen die Partisanen noch eigene Entscheidungen treffen können. Kürzlich hatte im Kino der Hackeschen Höfe ein Film Premiere, der auf Bykaus Partisanenstudie „Im Nebel“ basierte. Der Regisseur Sergej Loznitsa meinte anschließend: Es geht um einen weissrussischen Bauern, der von den Deutschen verhaftet und wieder freigelassen in die Ausweglosigkeit des Krieges gerät, aber er bleibt unbeirrt. Er wollte damit zeigen: „Solche Menschen gibt es heute nicht mehr. Sie sind ausgestorben.“
Ebenso wie inzwischen auch viele der „primitiven“ Kriegergesellschaften, die jede Hierarchisierung und Klassenteilung der Gesellschaft ablehnen, das Eigentum so gering wie möglich halten und auf einen „ursprünglichen Individualismus“ bestehen. Einige sterben derzeit aus, indem man den „Kriegern“ vertraglich ermöglicht, ihr Land zu privatisieren.
————————————————————————————————————

Der Autor – eingezwängt zwischen zwei „Health-Officers“ aus Papua-Neuguinea, die sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung in Manila befanden: Sie gewährleisten die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einem lebten auch ihre Eltern als Subsistenzbauern. Ihr Rang war etwas unterhalb von ausgebildeten Krankenschwestern angesiedelt, man könnte sie als “Barfuß-Krankenpfleger” bezeichnen, eingebunden jedoch in ein englisches Gesundheitssystem, das kostenlos war. Einer der beiden “Health-Officer”, er war etwas devoter als der andere, bezeichnete die “Heiler” und “Zauberdoktoren”, die Geld für ihre Behandlung nahmen, als seine “Hauptgegner”, die er bekämpfte, indem er sie als “Betrüger” entlarvte. Während der andere, der souveräner wirkte, bei dem “Hauptproblem” in seiner Region – die Bisse einer bestimmten Giftschlange – sogar die “Heiler” um Unterstützung bat, die in solchen Fällen die Bißstelle mit Lehm und bestimmten Pflanzensäften beschmierten und dazu Zaubersprüche murmelten: “Das hilft fast immer – und ich spare mein teures Serum,” erklärte er. Die beiden Health-Officer nahmen also zwischen dem „wilden“ und dem „rationalen“ Denken unterschiedliche Positionen ein. Wir diskutierten dann jedoch etwas anderes: Die Anthropologie behauptet immer wieder eine Kenntnis des Zusammenhangs zwischen Geschlechtsverkehr, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Das reicht ihnen zufolge weit über die westlichen Gesellschaften hinaus und betrifft eigentlich alle menschlichen Gemeinschaften, ja sogar die vieler Tiere: Wenn z.B. männliche Löwen und Schimpansen als Rudelführer alle nicht von ihnen abstammenden Jungen töten, damit sie schneller – mit ihren Genen versehene – neue Nachkommen zeugen können. Den Gipfel schoß in dieser dumpfdarwinistischen Hinsicht einmal der Tierfilmer Heinz Sielmann ab, als er in seinem Beitrag über das Leben in einem Tümpel, über den ein Mückenschwarm tanzte, raunte: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“
Dem gegenüber stehen die ethnologischen Feldforschungen – beginnend mit denen von Bronislaw Malinowski bei den Trobriandern, deren Inseln zu Papua-Neuguinea gehören: Trotz guter anatomischer Kenntnisse leugnen die Trobriander den Zusammenhang von Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft, dennoch werden unverheiratete Frauen, obwohl sie viel Geschlechtsverkehr haben (können), fast immer erst nach ihrer Heirat schwanger. Erst dann ist ein Vater da, „der das Kind in den Arm nehmen kann“, wie sie sagen. Der Vater ist bei den Trobriandern also keine biologische, sondern eine rein soziale Kategorie. Malinowski: „Da die Zeugungsfunktion des Geschlechtsakts unbekannt ist, weil die Samenflüssigkeit als harmlos gilt, ja als wohltuende Ingredienz, gibt es keinen Grund, ihr Eindringen zu verhindern“ – deswegen kennen die Trobriander auch keine Verhütungsmittel. Dieses „Wissen“ gilt bei ihnen nicht nur für die Menschen, sondern auch für ihre Hausschweine, deren weibliche Tiere, da alle männlichen kastriert werden, sich von männlichen Wildschweinen im nahen Urwald decken lassen, was die Trobriander jedoch heftig bestreiten, zumal sie Wildschweinfleisch verabscheuen und nur das Fleisch von ihren Hausschweinen essen.
Auch etliche andere „primitive“ Völker – bis hin zu vielen „unaufgeklärten“ Teenagern im Westen sehen keinen Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft. Die genverbreitungsversessenen Anthropologen würden dem entgegenhalten: „Sie wissen das nicht, aber sie tun so – als ob“. Aus schierem Antidarwinismus bin ich dem gegenüber – wie die Trobriander – der Meinung, dass der „Vater“ ein rein soziologischer Begriff ist, mit der Zeugung haben die Männer nichts zu tun, die Vaterschaft kann man sich höchstens erarbeiten, sie kostet auch eine Menge – an Zeit und Geld und Nerven. Und eigentlich ist sie sozial sinnvoll nur bei den Bauern und den Unternehmern, die sich als Väter anstrengen müssen, um einen einigermaßen „fitten“ Hof- bzw. Betriebsnachfolger heranzuziehen. Heutzutage, da es hier wie dort nur noch „Manager“ gibt, ist die Vaterschaft bloß noch eine Art „Bürgerschaftliches Engagement“ – wie übrigens die Mutterschaft auch bald. Die beiden Health-Officer aus Papua-Neuguinea, die beide verheiratet waren und Kinder hatten, vertraten, natürlich möchte man fast sagen, die dem entgegengesetzte, die herrschende – angloamerikanisch-biologische – Theorie.

Der Autor auf einem Friedhof in Metro-Manila, wo während des katholischen Feiertags „Allerheiligen“ drei Tage lang der Teufel los ist auf den philipinischen Friedhöfen, weil man dort dann den Seelen seiner Angehörigen am Nächsten ist. Sie erwarten auch, dass man sich an diesen Tagen an ihren Gräbern aufhält – grillt, Guitarre spielt, Fernsehen kuckt, trinkt, lacht, Familienneuigkeiten austauscht usw. Ich warte dort gerade auf den Pizza-Service – und bezweifelte stark, dass deren Bote die drei Gräber mit den gelben Blumen inmitten von etwa 100.000 Menschen auf einem Areal so groß wie der Tiergarten finden würde. Er fand uns aber doch. Dorothee Wenner filmte ihn, als er mit seinem Moped bei „unseren“ Gräbern ankam – für ihre NDR-Reportage „Allerheiligen in Manila“.

Die Friedhofsverwaltungen auf den Philipinen überspannen ihre Gelände vor Allerheiligen kreuz und quer mit elektrischen Leitungen. Wer im Ausland arbeitet oder krank ist und deswegen nicht zu den Gräbern seiner Angehörigen an diesen drei Tagen kommen kann, der ruft bei der Friedhofsverwaltung an und bucht eine Glühbirne, die zu Allerheiligen über das Grab des ihm wichtigen Angehörigen aufgehängt und angeknipst wird. Der Preis richtet sich nach der Wattstärke der Birne. Die Seelen der verstorbenen Philipinos wissen es angeblich zu schätzen, wenn man sich für eine (teure) 100-Wattbirne entscheidet. Sie verstehen das so, dass der Betreffende, der dafür gezahlt hat, ihnen besonders gewogen ist – und das erfüllt sie mit großer Freude. Ob das wirklich so ist, vermag ich nicht zu sagen, obwohl ich es als Glühbirnenforscher eigentlich wissen müßte und mich vor Ort zusammen mit Dorothee auch wirklich bemüht habe, es heraus zu finden. Aber die Seelen der Philipinos und Philipinas sind nicht einfach zu verstehen, noch viel weniger die der toten.
Neue Dorfprosa
Die Dorfsoziologen haben sich vor allem auf bäuerliche Gemeinschaften konzentriert bzw. darauf, wie diese sich langsam von innen und außen asozial zersetzten. Marx hat das am Beispiel der russischen „Obschtschina“ herausgearbeitet. Vor ihm taten das bereits die „hellen Haufen“ im Großen deutschen Bauernkrieg: Eine ihrer Forderungen lautete, alles privatisierte Land wieder in die Allmenden zurückzuführen. In den russischen Volksaufständen und Revolutionen ist das noch jedes Mal geschehen, dass massenhaft Land wiedervergesellschaftet wurde
Der Marxist Alfred Sohn-Rethel schreibt: „Der entscheidende Bruch in der Tradition der archaischen Gesellschaften tritt ein durch die Eisengewinnung und die sich entwickelnde Eisenbearbeitung. Die Verwendung von Eisengerät in der Bodenbearbeitung bringt eine wirtschaftliche Umwälzung in der Agrarproduktion hervor. Sie kann jetzt erfolgreicher als Einzelwirtschaft betrieben werden als in der umständlichen und aufwendigen Art der vorhergehenden kollektiven Aluvialwirtschaft. Mit dem Übergang zur Eisentechnik entsteht die Ökonomie der kleinen Bauernwirtschaften und der unabhängigen Handwerksbetriebe, die beide – nach Marx berühmter Fußnote – ‚die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen in ihrer besten Zeit bilden, nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeinwesen aufgelöst und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft bemächtigt hat.“
Die Missionare und nach ihnen und bis heute gegen sie – die Ethnologen haben sich die letzten Steinzeit-Kulturen vorgenommen, die noch nicht zu Einzelbauern oder Industrieproletariern heruntergekommen sind – wobei ihnen die „Traurigen Tropen“ – so der Titel einer Amazonasindianer-Studie von Claude Lévi-Strauss (1955) – als Leitmotiv dient. Dabei schwingt stets noch der „Edle Wilde“ von Rousseau mit. Das geht bis hin zu Daniel Everett, der als Missionar zu den Pirahas, einem kleinen Amazonas-Stamm kam und sich dort in den Achtzigerjahren zum Ethnologen dieses seiner Meinung nach weltweit „glücklichsten Volkes“ wandelte.
In die entgegengesetzte – hochzivilisierte – Richtung mußten sich zwei junge Frauen wandeln, die als Kind mit ihren Eltern, die Ethnologen bzw. Missionare waren, in Steinzeit-Gemeinschaften aufwuchsen: Zum Einen Catherina Rust, Autorin des Buches „Das Mädchen vom Amazonas: Meine Kindheit bei den Aparai-Wajana-Indianern“ (2011). Und zum Anderen Sabine Kügler, Autorin der Bestseller „Dschungelkind“ (2006), „Ruf des Dschungels“ (2007) und „Jägerin und Gejagte“ (2009). In diesem, ihrem vorerst letzten Buch, schildert sie ihre vergeblichen Versuche, sich im Westen zu integrieren. Aufgewachsen in einer fast totalen Dorf-Gemeinschaft scheiterte sie hier immer wieder am konkurrenten Individualismus.
2011 hat auch noch ihre Mutter, Doris Kügler, die 35 Jahre als Krankenschwester und Ehefrau eines christlichen Missionars in einem Dorf der Fayu lebte, ihre Erlebnisse veröffentlicht: „Dschungeljahre: Mein Leben bei den Ureinwohnern West-Papuas.“
Ihr Verlag schreibt: „Eindrücklich beschreibt Doris Kügler, was eine Mutter empfindet, die ihre Kinder inmitten eines ehemals kannibalischen Volksstammes im Dschungel großzieht. Und was es bedeutet, unter Steinzeit-Bedingungen zu leben. Fesselnd schildert sie auch, wie es den Küglers gelang, den kriegerischen Fayu Begriffe wie Vergebung, Gnade und Liebe zu vermitteln.“
Daneben brachten sie denen aber auch bei, den personengebundenen Gabentausch und damit die Verpflichtung zur Reziprokation zu überwinden zugunsten eines Warentauschs, der durch das Postulat der Äquivalenz gekennzeichnet ist. Das Missionarsehepaar lehrte ihnen also den Wert des Geldes, das Wertgesetz, wobei sie ihnen Mathematik und damit abstraktes Denken beibrachten – und die Fayu-Stämme gleichzeitig mit Eisenwerkzeug ausrüstete. Die kriegerischen Fayu hatten sich in ihren Vendettas schon fast ausgerottet, deswegen nahmen sie die Befriedungsangebote und -versuche der Küglers gerne an – schlimmer konnte es nicht werden. Angeblich spielten die Fayukinder schon lange nicht mehr, sondern hockten nur noch ängstlich unter Bäumen und spähten in den Wald, von wo auch sie jeden Moment weitere tödliche Angriffe (Pfeile) erwarteten.
Anders das Ethnologenpaar Rust, das sich hütete, derart in das Stammesleben der Aparai-Wajana einzugreifen. So wie auch der Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Lévi-Strauss, Philippe Descola, während seiner Feldforschung bei den Jívaro-Indianern, die 2011 unter dem Titel „Leben und Sterben in Amazonien“ auf Deutsch erschien. Im Gegenteil werfen diese Ethnologen den Missionaren genau solche leichtfertigen Eingriffe vor. Es sind gewissermaßen Konkurrenten an den letzten Seelen-Fronten. Catherina Rust wuchs im Bewußtsein auf, dass diese (speziell die evangelisch-fundamentalistischen) Christen ganz besonders von Übel sind. Da es jedoch keine Beobachtung des Sozialen gibt, die diese nicht zugleich auch beeinflußt, verändern eben auch die zurückhaltensten Ethnologen als langjährige Gäste bei steinzeitlichen Stämmen deren Lebensweise, mindestens dass sie deren Seelenleben mit ihrer permanent neugierigen Anwesenheit bereichern.
———————————————————————————————————————-
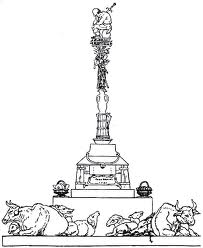
Albrecht Dürer: Entwurf für ein Bauernkriegsdenkmal. Dürers o.e. Lehrbücher gerieten über seine „betenden Hände“ und dem „Hasen“ etc. in Vergessenheit, ebenso, dass er um ein Haar gehängt wurde – als die adlige Reaktion über die „Bauernhaufen“ siegte und Rache für die Revolution nahm. Deutschland sähe heute anders aus, besser, wenn es umgekehrt gekommen wäre, meinte noch der Freiherr von Stein. Ähnlich urteilte dann auch Friedrich Engels. Gelobt seien beide – und erst recht Albrecht Dürer. Was für ein seltsamer Renaissance-Mensch! So recht nach Walter Benjamins Geschmack: während für Karl Marx die Revolutionen noch „Lokomotiven“ waren „um den langsamen Zug der Geschichte zu beschleunigen“, gab Walter Benjamin zu bedenken: „Vielleicht sind sie der Griff des in diesem Zug reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse“.
Dürer hat mit seinen zwei Lehrbüchern die Notbremse ziehen wollen, aber der Zug der Geschichte war nicht mehr aufzuhalten. Inzwischen müssen wir die letzten edlen Wilden schon unter Artenschutz stellen. In seinem Versteck vor dem Wüten der Reaktion hatte Dürer seltsame Träume und entwarf ein Bauernkriegsdenkmal: Ein von hinten erdolchter Bauer auf einer Säule (ähnlich der Siegessäule), zu Füßen der Säule kauern jedoch Rinder, Kühe und Schafe und trauern um den Bauern, dessen Tod tatsächlich zu der Zeit besiegelt wurde: indem man die von ihm noch verkörperte Einheit zwischen Theorie und Praxis zerriss – zentralperspektivisch. Dürer hat auch das gemalt: Wie man einem weiblichen Akt damit zu Leibe rückt. Und dann noch einmal mit einem seiner drei Meisterstiche: „Melencolia I“. Da haben wir auch schon den Benjaminschen Engel der Geschichte. „Die geometrischen Figuren und der Zirkel in der Hand der engelhaften Gestalt sind ein Symbol für die Geometrie und die Mathematik,“ heißt es auf Wikipedia. Vor ihr auf dem Boden liegen einige wie ausrangiert wirkende Werkzeuge – eine zerschlissene Säge, ein alter Hobel, eine Handvoll Nägel.
——————————————————————————————————————————–
Nach der Arbeiter- nun wieder die Bauernfrage
Dass die Pastoren mit und ohne Bart zu den Engagierten in der DDR-„Umweltbewegung“ gehörten, das lehrt die eingewestete Geschichte, neu ist jedoch, dass jetzt allenthalben die Evangelen von der Kanzel herab gegen die „industrielle Landwirtschaft“ anpredigen. Das hat in den protestantischen Gauen Westdeutschlands bereits solche Ausmaße angenommen, dass der niedersächsische Bauernverband meint, gegen diese Öko-Agitatoren endlich vorgehen zu müssen. Der Verband nennt sich „Landvolk“ und erinnert damit bereits an die norddeutsche „Landvolkbewegung“, die Ende der Zwanzigerjahre gegen die Berliner Bauernpolitik protestierte und dabei u.a. Finanzämter in die Luft sprengte. Man kann dort also auch anders. Erst mal beließ es die Landvolk-Führung jedoch bei einem Rundbrief an ihre Mitglieder, in denen sie vor den als schwarze Schafe getarnten Wölfen in den dörflichen Herden warnten, die „ungerechtfertigte und überzogene Kritik“ an den hart arbeitenden – d.h. rationalisierenden und expandierenden – Landwirten ihres Sprengels üben. Diese sollte man flugs mit Namen und Datum versehen dem Verband melden, damit dessen Führung diese priesterlichen Verfehlungen im nächsten Frühjahr deren Führer – dem Landesbischof – in Form einer sachlich fundierten Beschwerde vortragen könne.
Der „Aufruf“ des Großbauernverbandes „zur Denunziation von Pastoren“ wurde sogleich von dessen Konkurrenz , die Arbeitsgemeinschaft (klein)bäuerliche Landwirtschaft“, als Pressemitteilung verbreitet. Woraufhin die Grünen im niedersächsischen Landtag ebenfalls von einem „unerhörten“ Denunziationsaufruf sprachen. Der Referent für Kirche und Landwirtschaft in der Evangelischen Landeskirche teilte danach der Presse schon mal mit, dass dieser landvölkische Einschüchterungsversuch an der lutherisch gefestigten Burg Gottes abprallen werde wie nix Gutes: „Unsere Pastoren sind frei, nach bestem Wissen und Gewissen zu urteilen,“ versicherte er ihnen. Und das scheint auch zu stimmen, in Bremen z.B. kann selbst ein anarchistischer Pfarrer, der reihenweise seine verspießerte Herde in einem proletarischen Reihenhaus-Neubaubauviertel aufs Areligiöseste vor den Kopf stößt, nur von der Gemeinde selbst – also von unten – abgesetzt werden. Diese geschah zuletzt in den Siebzigerjahren – organisiert ausgerechnet von einer Gruppe in der Gemeinde sozial beschäftigter M/Ler, die sich dabei von Lenins Kampf gegen den ukrainischen Anarchoführer Nestor Machno leiten ließ. Kein Witz!
Diesmal kriegt die Kirche es jedoch nicht mit einer Handvoll Post-68er zu tun, sondern mit einem ganzen „Landvolk“-Verband, hinter dem etwa 60.000 Agrarbetriebe stehen, die auch weiterhin auf eine „Steigerung der Arbeitsproduktivität von jährlich über 6 %“ hoffen. Auf der anderen Seite sind es itzo jedoch mehr als bloß ein Pastor – sondern anscheinend so gut wie alle Pastoren. Diese sind auch keine antireligiös eifernden Anarchisten mehr, sondern kreuzbrave Ökos mit Obstgarten und allem drum und dran, die partout die letzten Reste der Schöpfung Gottes außerhalb des Menschenwerks in ihre Fürbitte mit einschließen wollen. Dazu muß die Vielfalt („Bio-Diversity“ auf gutdeutsch) aber erst mal erhalten bleiben – und zwar möglichst „artgerecht“. Die evangelischen Pastoren (die katholischen sind da eher päpstlich-populistisch), haben in ihrem Schöpfungserhaltungswillen jedoch ein Handicap: Da ihr Engagement vor allem mit Worten geschieht, brauchen sie mindestens einen (menschlichen) Zuhörer, den sie in der Kirche „ansprechen“ können und der noch nicht Demenz (Altersmilde gestimmt) ist. Das wird jedoch schwierig, wenn dieser „Andere“ ein Bauer ist, der sich gerade wie verrückt zu einem hightechgestützten Agrarmanager mausert, um noch weit mehr als 120 Menschen (Städter, die keine Ahnung haben!) mit seinen Produkten zu ernähren (1960 waren es noch 10), wobei sich damals in einem Dorf noch 10 Bauern diesen (kleinen Konsumenten-)Kuchen teilten, während dort heute nur noch höchstens einer wie blöd ackert.
Und das ist nämlich er – der Bauer, der sich nun während des Erntedank-Gottesdienstes ausgerechnet von „seinem“ Pastor sagen lassen mußte: Laß es sein. Es ist alles eitel! Und vor allem sind die von dir auf den Super-Markt geworfenen Lebensmittel alle vergiftet, außerdem schmecken sie Scheiße, nach Nichts! Bei seiner Verbandssitzung im Januar 2013 in Uelzen kamen die Sorgen der niedersächsischen Bauern zur Sprache: die Tierschutzpläne, der „Landfraß“ und das Sterben der Dörfer, „demographische Entwicklung“ vom Verband auch genannt. Man war sich einig: Die Grünen wollen die Bauern zwingen „ökologischen Landbau zu betreiben, aber über 80% der Landwirte lehnen das ab. Den „Landvolk“-Klagen hielt der niedersächsische FDP-Politiker Rainer Fabel entgegen: Nie habe die Landwirtschaft bessere Perspektiven gehabt. Nahrungsmittelproduktion, Energiewende, Tourismus – wohin man blicke, Entwicklungsmöglichkeiten im Ländlichen Raum. „Fabelhafte Aussichten“. Sein Optimismus wurde nicht von allen Anwesenden geteilt, zwar liegt diese „unternehmerische Perspektive“ den Bauern näher als die ökologische, in Niedersachsen gilt aber nach wie vor: „Hast du eine Kuh, wählst du CDU.“ Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) meinte dazu: „Das war hier immer so. Der Uelzener geht nicht unter die Kuh.“
Die AbL gehört mit zu den Organisationen und Initiativen, die während der Grünen Woche in Berlin bundesweit zu einer Protestdemonstration gegen die industrielle Landwirtschaft aufgerufen haben. In einer Presseerklärung heißt es:
„…über 35 Trägerorganisationen und 70 weitere Unterstützer rufen zur dritten „Wir haben es satt“-Demonstration auf. Sie fordern die Bundesregierung auf, endlich einen agrarpolitischen Umbruch einzuläuten. Zu der Demonstration anlässlich des „Global Forum for Food and Agriculture“ während der Grünen Woche werden über 50 Traktoren und Imkerfahrzeuge und 15 000 Menschen erwartet.“ Mit dem Wissenssoziologen Bruno Latour gesprochen: „Es gibt keine ökonomische Utopie mehr, nur noch eine ökologische.“
Die letzten Bauern mausern sich desungeachtet zu Agrarmanagern – um „Bauern“ bleiben zu können – und nicht in die Fabrik abgetrieben zu werden, zumal diese ebenso wie die bäuerliche Landwirtschaft langsam verschwindet – und damit auch der Arbeiter selbst. Von den in den USA geschaffenen 15 Millionen neuen Arbeitsplätzen vornehmlich im Dienstleistungsbereich wurden fast 60% von Frauen eingenommen. Und die Deindustrialisierung hält unvermindert an, ebenso wie die Rationalisierung/Computerisierung. Parallel wird Der Doofe Rest der „arbeiterlichen Gesellschaft“ (Wolfgang Engler), der immer rassistischer auf erfolgreiche Zuwanderer reagiert, bereits selbst rassistisch als „Proll“ abgetan und gleichzeitig seine Basis, die „Prollwohnviertel“ und -kneipen, weggentrifiziert (siehe das dazu 1997 im Basisdruck-Verlag erschienene Buch „Prols und Contras“ und zuletzt die englische Studie: „Prolls – Die Dämonisierung der Arbeiterklasse“ im Verlag André Thiele).
Der 1900 im Tal der Ahnungsvollen, in Weimar, gestorbene Philosoph Nietzsche gestand: „Ich interessiere mich nicht für die Arbeiterfrage, weil der Arbeiter selbst nur ein Zwischenakt ist.“ Die Arbeiter seien – im Gegensatz zum Bauern alten Schlages – nur „Schrauben einer Maschine“ und würden „als Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst vernutzt.“ Ebenso lehnte Nietzsche die Gewerkschaftspolitik ab: „Pfui, zu glauben, daß durch höhere Zahlung das Wesentliche des Elends, ich meine, ihre unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könnte!“ Zumal, wenn es wie heute weitaus mehr „außertariflich Beschäftigte“ (900 Millionen weltweit, die von ihrem „Job“ nicht leben können) und „Unbeschäftigte“ (207 Millionen weltweit) gibt – als nach Tarif entlohnte. In seinem letzten Buch über die verschwundene Arbeitswelt „Die Ostdeutschen als Avantgarde“ fragte sich Wolfgang Engler: „Kann man den erzwungenen Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft so gestalten, dass er nicht nur lebbar ist, sondern anziehend wird, zur inneren Alternative der Arbeitsgesellschaft avanciert?“ Vor ihm hatte bereits der französische Marxist André Gorz diese Frage bejaht.
Wenn der Arbeiter nur ein „Zwischenakt“ war – ähnlich einem „Zwischenhoch“ (1), dann fand der anscheinend zwischen bäuerlicher Landwirtschaft und postindustrieller neuer Sinnsuche statt. Dafür sprechen schon die vielen neuen erfolgreichen Zeitschriften, die alle so ähnlich wie „Landlust“ heißen.
Im Moment, da, nach Revolution und Bürgerkrieg, im Zuge der Kollektivierung 1932 in den asiatischen Sowjetrepubliken aus analphabetischen Hirtennomaden alphabetisierte Kolchos-Mitglieder werden und ihre Frauen entschleiert in der Öffentlichkeit auftreten, hat der Psychologe Alexander Lurija in Usbekistan und Kirgisien etliche der Männer und Frauen interviewt und ihre Abstraktionsfähigkeit getestet – wobei er feststellte, dass ein großer Teil von ihnen z.B. konkrete Gebrauchsgegenstände nicht Ordnungsbegriffen wie Baum, Werkzeug etc..zuordnen konnte, was Lurija zufolge eine Frage der Schulbildung war. Allerdings zeigte sich, „dass diejenigen Versuchspersonen, die unbeeinflusst von der wissenschaftlich-technischen Zivilisation waren, auf optische Täuschungen [auf dem Papier] in einem weit geringerem Maße hereinfielen als diejenigen, die sich bereits mit dem Modernisierungsschub auseinandersetzten,“ wie Alexander Métraux im Vorwort zu Lurijas „Expeditionsbericht“ schreibt. Etwa zur selben Zeit veröffentlichte die Wiener Historikerin Fannina W. Halle im Anschluß an ihre große Studie über die Emanzipation „der russischen Frau“ ein Buch über die „Frauen des Osten“, in dem es um die Entwicklung des politischen Bewußtseins bei den Frauen in den islamischen Sowjetrepubliken ging.
Achtzig Jahre später interviewte ich mehrere erneut nomadisch gewordene mongolische Viehzüchterinnen in der Wüste Gobi. 1989 warnen dort alle Kolchosen aufgelöst worden. Jeder Mongole bekam 100 Stück Vieh – egal, ob er als Friseur, Fahrer oder Buchhalter gearbeitet hatte. Viele dieser „Ich-AGs“ gaben bald auf – besonders nach den zwei harten Wintern 1999 und 2000, da Millionen Tiere verhungerten. Etwa zur selben Zeit schlossen sich die Viehzüchter u.a. in der Gobi, die nicht aufgeben wollten, zu Kollektiven – „Communities“ – zusammen. Über 80 Viehzüchter-Kooperativen gibt es inzwischen allein in der Südgobi – mit einer eigenen kleinen Zeitung: dem „Community Info“. Alles Eigentum muß sich bei den Nomaden selber tragen. Da ist Schriftliches eher hinderlich. Deswegen, so versicherte mir eine Gruppe von Frauen, sei das Handy ein wahrer Segen für das Land, während das Internet die Mongolen eher kalt lasse. Früher war es für jeden Viehzüchter Pflicht, ein Radio zu besitzen, und zu Hochzeiten schenkte man gerne Zeitungs-Abonnements. Heute steht an fast jeder Jurte ein kleines chinesisches Solarpanel, mit dem u.a. ein Fernseher betrieben wird. Die Vorsitzende einer Viehzüchter-Genossenschaft berichtete: „Nach 1990 war jede Familie auf sich selbst gestellt, und sie wanderte so gut wie gar nicht. Das konnte nur durch die Communities gelöst werden. Das sind Kollektive wie im Sozialismus, aber diesmal bestimmen wir selbst, was zu tun ist.
Etwas 2000 Viehzüchter haben sich bisher hier zusammengeschlossen. Schon im ersten Jahr 1999 haben wir das Positive daran gemerkt. Nach sieben Jahren können wir nun sagen, dass es richtig war. Wir haben uns kundig gemacht, wie die negative Entwicklung zustande kam. Außerdem haben wir jetzt bessere Möglichkeiten, unsere Produkte zu vermarkten. Wir bekommen bessere Preise für Kaschmirwolle und Leder, die Schafwolle verarbeiten wir selbst. Die Wilderei hat völlig aufgehört und keine Familie sammelt mehr Feuerholz. Wir wissen heute, wie die Natur zu verbessern ist. Außerdem waren wir drei Mal im Ausland, haben viel gesehen und sind auf neue Ideen gekommen. Und wir sind international geworden, so arbeitet z.B. eine Frau in der ‚World Alliance of Mobile Indigenous People‘ mit.“
Eine Viehzüchterin ergänzte: „Es gibt auch große Veränderungen im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Frauen waren vorher immer nur zu Hause mit Kindern, haben wenig untereinander geredet. Und die Männer waren nicht gut genug ausgebildet, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, sie haben viel gegessen und getrunken. Bereits das erste Meeting mit deutschen Beratern, auf dem die Idee des Zusammenschließens begründet wurde, hat uns die Augen geöffnet. Seitdem hat es viele Veränderungen in unserem Leben gegeben. Ich bin selbst ein Beispiel dafür: Obwohl eine einfache Viehzüchterin habe ich mich in den letzten Jahren sehr verändert und mein Leben verbessert. Wir sind 35 Familien, 144 Menschen und haben 7000 Tiere. 1999 ging es nur sechs Familien gut, der Rest war arm. Wir hatten keinen Zugang zu Informationen und waren zerstreut.“
Eine andere Viehzüchterin erinnert sich: „Den Anfang haben fünf Frauen gemacht – sie sind raus aus den Gers [das mongolische Wort für Jurten]. Dann kamen mehr dazu. Wir haben Einfluß auf die Männer genommen. Und mit ganz kleinen Sachen angefangen, uns gegenseitig zu helfen. Das war ein langsamer Prozeß. Wir haben z.B. Zäune gemeinsam repariert, die Weiden von Tierkadavern gesäubert, mit Behörden verhandelt, Kurse im Gemüseanbau für uns organisiert…Dann haben wir im Bag-Center für Geld gearbeitet und den Armen dafür Vieh gekauft. Unser Fähigkeit zu kooperieren hat sich immer mehr verbessert.. Gleichzeitig mußten wir die Balance zwischen Familie und Kollektiv finden.“
Ein älterer Viehzüchter wirft zuletzt ein: „Die Frauen haben die Ideen, die Männer setzen sie um.“
Anmerkung:
(1) Ein Sonntagsdienstler auf der meteorologischen Station der FU in Dahlem verriet mir einmal telefonisch seine „Zwischenhoch“-Findung: „Das ist wahrscheinlich vom Typ des Meteorologen abhängig. Ich zum Beispiel bin optimistischer als meine Kollegen und verwende deswegen öfter diesen Begriff, wenn zwischen einem und dem anderen Tief eine gewisse Lücke klafft.“
—————————————————————————————————————-

A. Dürer: Der verlorene Sohn bei den Schweinen
Das Schweinesystem
„Präsident sollte nur jemand werden, der auch Schweine versteht!“ (Harry S. Truman)
Der westdeutsche Ökologe und Tierfilmer Horst Stern erinnerte sich in einem Interview 1997: „Ich hatte in einem meiner Filme mal gesagt: So sind sie, die Ethologen. Die Südsee ist ihnen nicht tief genug, kein Urwald ist ihnen dicht genug und gefährlich genug. Aber in einen Saustall, da bringt sie niemand hinein.“ Trotz einer Schwemme von „Tierstudien“ und „Human-Animal-Studies“ gilt dies auch heute noch – für Schweine. Immerhin ersetzen gelegentlich engagierte Tierschützer die verbeamteten Tierforscher – in den Schweineställen, indem sie nächtens dort einbrechen und die traurigen Lebensbedingungen für die Tiere dokumentieren. Hier und da wird auch schon mal gegen eine im Bau befindliche Riesenmastanlage demonstriert oder diese sogar in Brand gesteckt.
In unserer mit 8.000 Schweinen noch relativ kleinen Anlage der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, wo ich zuletzt arbeitete, war es laut, heiß und stank, regelmäßig mußte der Tierarzt irgendeinem Tier Antibiotika spritzen und ebenso regelmäßig rückte der Desinfektor an, jeden Morgen musste man ein oder zwei tote Tiere rauskarren und eigentlich waren alle froh, als eine winzige Dorfinitiative, angeführt von der Gemeindeschwester, eine Demonstration mit etwa 20 Leuten vor dem Tor organisierte – woraufhin die Kreisverwaltung in Potsdam die sofortige Schließung der Schweinemast anordnete: und 15 Leute ihren Arbeitsplatz verloren. Damals, im Februar 1990 konnte sich noch niemand vorstellen, dass sie vielleicht nie wieder eine neue Anstellung finden würden.
2006 fand im Schloß Neuhardenberg eine Ausstellung über Schweine statt, in der es u.a. auch um eine ebenfalls nach der Wende abgewickelte Mastanlage ging, in der 800 Beschäftigte 146.000 Tiere jährlich „fett machten“. Dort – im uckermärkischen Haßleben -plante seit 2004 ein holländischer Investor eine neue Anlage – für 67.000 Schweine. Er, Harry van Gennip, betrieb bereits seit 1994 eine für 65.000 Schweine ausgelegte Anlage im altmärkischen Sandbeiendorf. Einer seiner Berater,Helmut Rehhahn, war früher SPD-Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und noch früher Leiter einer Bullenprüfstation in der DDR. „10 000 Mastschweine. Alles andere ist Spielerei,“ erklärte er 2007 dem Spiegel. „‚Haßleben wird noch moderner. Haßleben,‘ sagt er, ‚das kommt. Das kriegen wir hin‘.“ Um den Bau dieser Fleischfabrik – für inzwischen „nur“ noch 37.000 Schweine – wird jedoch noch immer vor Ort gestritten. Auf der einen Seite der Investor mit einer „Pro-Schwein-Haßleben“-Bürgerinitiative, auf der anderen Seite eine „Kontra-Industrieschwein-Haßleben“-Bürgerinitiative und der Deutsche Tierschutzbund. Die Bild-Zeitung spricht von einem „Schweinekrieg“.
Der findet nicht nur in Haßleben statt, denn in Ostdeutschland errichteten und errichten viele Investoren riesige Schweinemastanlagen. Einer verriet dem „Freitag“ freimütig, warum: „Zu Hause in Holland wirst du als Schweinezüchter ständig wie ein Krimineller behandelt. Das ist in Ostdeutschland anders. Hier kannst du noch Unternehmer sein. Umweltkosten spielen keine Rolle.“
Diese Großprojekte für Tierzucht-, -Mast und -Schlachtung stoßen jedoch auf immer mehr Widerstand. Auch im Altmark-Dorf Cobbel gibt es eine Bürgerinitiative gegen eine dort von Harry van Gennip geplante Schweinemastanlage (auf einem ehemaligen sowjetischen Flugplatz). Er „hat vor, hier etwa 97.000 Ferkel zu züchten,“ erfuhr der Freitag-Reporter bei der Bürgermeisterin von Cobbel, „also werden wir dann täglich Dutzende von Transportern mit Tierfutter, Ferkeln und Schweinen durch unser Dorf fahren sehen. Wer bezahlt den Schaden? Eine solche Mast belastet die Umwelt, das heißt, in einem wertvollen Naturschutzgebiet wird Wald mit Ammoniak verseucht, der Grundwasserspiegel sinken und der Boden sauer.“
Ähnlich argumentieren auch die Tierschützer in Haßleben. In einer Stellungnahme des für die Genehmigung der dortigen Schweinemastanlage zuständige Ministeriums in Potsdam hieß es zuletzt – am 18.4.2012: „Der Investor will dem Antrag zufolge die Anzahl der Schweinemastplätze von 35.200 auf 4.400 reduzieren. Ursprünglich handelte es sich um 67.000 Tierstellplätze. Das für das Genehmigungsverfahren zuständige Landesamt muss nunmehr die geänderten Antragsunterlagen erneut prüfen. Dabei wird es insbesondere um die Auswirkungen auf Natur und Umwelt gehen.“
Im Mai 2012 hatte das Bundeskabinet eine Novellierung des Tierschutzgesetzes beschlossen, das nun neben dem Wildtier-Verbot für Zirkusunternehmen, weil diese sie nicht „artgerecht“ halten können, auch einige Restriktionen bei der Massentierhaltung beinhaltet: z.B. den „Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration zum 1. Januar 2017“, wie „agrarheute“ schreibt. Außerdem muß der Tierhalter seine Schweine fürderhin „angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen“ , dazu gehört eine „Förderung des Erkundungsverhaltens der Schweine, die jederzeit Zugang zu veränderbarem Beschäftigungsmaterial haben müssen, das von ihnen untersucht und bewegt werden kann,“ wie das niedersächsische Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die neue Verpflichtung für die Züchter und Mäster erklärt, ihre Schweine nicht nur „verhaltensgerecht“ aufzuziehen, sondern auch noch für ihre „Unterhaltung“ zu sorgen. Nicht nur emsländische Schweinebauern klagen, dass es noch kein brauchbares „Spielzeug für Schweine“ auf dem Markt gibt. Einige behelfen sich einstweilen mit Holzscheite, die sie an Ketten in die Ställe hängen – als eine Art Kauknochen.
Der Kurator der Ausstellung „Arme Schweine“, Thomas Macho, Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität, siedelte die Problemlage erst einmal im Grundsätzlichen an: „Jene Tiere, die seit Jahrtausenden mit den Menschen lebten und arbeiteten – nämlich die Haustiere – wurden aus allen konkreten Lebens- und Arbeitskontexten der Moderne verdrängt. Die Rinder wurden durch Traktoren ersetzt, durch Mähdrescher und andere landwirtschaftliche Maschinen, die Ziegen und Schafe durch die Produktion synthetischer Bekleidung. Die Kavallerie wurde gegen Panzerdivisionen ausgetauscht; und zunehmend wurden die ehemals militärisch idealisierten Pferde zu Zugtieren degradiert, die allenfalls jene Gulaschkanonen schleppen durften, in denen sie bei Bedarf gekocht und an die Soldaten verfüttert werden konnten. Die Kutschen wichen den Eisenbahnen und Automobilen, die Lasttiere den Kränen und Baggern, die Brieftauben den Computern und Telefonen. Wollten wir die Grundtendenz des Modernisierungsprozesses in gebotener Knappheit erfassen, so müßten wir sie als progressive Eliminierung der Haustiere durch Maschinen beschreiben. Diese gesellschaftliche Verdrängung der Haustiere reduzierte die Tiere schlagartig auf eine einzige Funktion, die noch kein Wild- oder Haustier jemals zuvor in vergleichbarer Größenordnung erfüllen mußte: auf die Funktion des Massenschlachtviehs.“
Die Schweine, die zu den am frühesten domestizierten Tieren zählen, waren schon immer Schlachtvieh. Sie lebten jedoch länger und es wurde alles – einschließlich der Innereien – verwendet. Heute sind Schweine in einem Alter von etwa einem halben Jahr und einem Gewicht von rund 110 Kilo schlachtreif. Und es wird sowohl in der Schweine- als auch in der Tierfutter-Forschung ununterbrochen versucht, die Fleischproduktion noch effektiver zu machen. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2008 genau 26.380.900 Schweine in Deutschland gehalten, die meisten davon, etwas über 8 Millionen, in Niedersachsen. 66.400 Betriebe züchteten Schweine. Derzeit gibt es wieder mal eine preisdrückende Überproduktion, die bisher jedoch stets eine vorübergehende war: „Schweinezyklus“ genannt.
An der Mosel bat ich einmal einen Bauern, mir seine neue Mastanlage zu zeigen, er willigte nach langem Zögern ein, öffnete die Tür, machte das Licht an, 4000 Tiere sprange nach und nach auf und schrien, wir gingen den Gang entlang und traten am Ende durch eine andere Tür wieder ins Freie. Nachdem der Bauer das Licht ausgemacht hatte, beruhigten sich die Tiere langsam wieder. „So, sagte er, das kurze Vergnügen hat mich jetzt rund 120 DM gekostet – diese Verzögerung ihrer Gewichtszunahme, dadurch dass wir die Schweine aufgestört haben.“
In der Schweiz, wo man vor einigen Jahren das weitestgehende Tierschutzgesetz verabschiedete und gerade eine Kommission an einem analogen – d.h. auf individuelles Leben zielendes – Pflanzenschutzgesetz arbeitet, macht sich u.a. der „Zürcher Tierschutz“ dafür stark, deutsches Schweinefleisch zu boykottieren: „Die Schweiz importiert jährlich 10 Millionen kg Schweinefleisch aus Deutschland und Italien. Dort werden Mastschweine und Muttersauen eingepfercht gehalten und Ferkel ohne Betäubung kastriert, was äusserst schmerzhaft ist. All dies ist zu Recht in der Schweiz verboten. Die Tatsache, dass Grossverteiler, Gastromärkte, Caterer und Fleischverarbeiter nach wie vor Schweinefleisch aus tierquälerischer Haltung importieren und verkaufen, widerspiegelt unserer Ansicht nach einen bedenklich tiefen ethischen Standard.“
Diesen haben die deutschen Tierschützer unterdes auch in den Schlachthöfen ausgemacht. 2011 wurden in 5100 zugelassenen Betrieben fast 60 Millionen Schweine geschlachtet. 750 Schweine pro Stunde und Betrieb: In Schlachthöfen wird im Sekundentakt gearbeitet. „Darunter leidet der Tierschutz“, wie das Handelsblatt am 21.6.2012 schrieb: „Die Tiere werden automatisch betäubt, zum fachgerechten Töten per ‚Entblutestich‘ sind dann etwa fünf Sekunden Zeit. 12,5 Prozent der Tiere seien jedoch nicht richtig betäubt. Die Grünen fordern härtere Regeln, die Branche wehrt sich.“
Die letzten Aporien des Schweinesystems kommen von österreichischen und taiwanesischen Wissenschaftlern: 1. In Ötztal hat ein zweiwöchiger Tierversuch begonnen, bei dem 29 Schweine lebendig unter einer Lawine begraben werden. Diese Lawine wird simuliert, um durch die toten Schweine mehr Aufschlüsse über die Todesumstände von Lawinenopfern gewinnen zu können. 2. Taiwanesische Forscher haben drei fluoreszierende Schweine gezüchtet, die im Dunkeln grün leuchten. Dafür sei in den Zellkern eines Schweineembryos ein fluoreszierendes Protein injiziert worden, das aus Quallen gewonnen worden sei, erklärte Wu Shinn Chih von der Nationalen Universität Taiwans. Damit sei ein „wichtiger Fortschritt“ bei der Stammzellforschung gelungen, weil Schweine Tiere seien, die dem Menschen besonders nahe sind.
————————————————————————————————————
„Der Vater des heutigen Schloßbesitzers war clever, er wandelte die südliche Hälfte des Schlosses in ein Golfhotel und den hinteren Teil des Schloßparks zu einem Golfplatz um, wovon der Sohn heute gut leben kann, zumal sich Golfplätze nahezu umstandslos in Bauland umwidmen lassen, falls sie sich einmal nicht mehr rechnen sollten.“
Die Besserleger
Ein Bekannter, der früher bei der DDR-Marine war und dann bei einer Versicherung gearbeitet hat, verdient jetzt sein Geld als Golfballtaucher. Nach der Wende wurden in Hauptstadteuphorie und Unternehmensgründungsfieber rund um Berlin 81 Golfplätze projektiert, und beim Potsdamer Umweltministerium zur Genehmigung eingereicht, wie ein ehemaliger leitender Mitarbeiter, Dr. Friedrich von Bismarck, sich erinnert. Genehmigt wurden dann 12. Zu den erfolgreichen Golfplatz-Antragstellern gehörte ein Verwandter von ihm: der Ururenkel des Reichskanzlers, Fürst Ferdinand von Bismarck. Er ist Mitgesellschafter des Golf- und Countryclubs am Seddinsee. Das Clubgelände wurde mit einem Villen- Neubauviertel verbunden, das man „Klein-Dahlem“ nennt, weil es bereits sehr viele reiche Dahlemer aus der Stadt dorthin „ins Grüne“ zog, wo sie sich nun direkt an der Golfanlage ein neues Haus bauen lassen, für das ein renommierter Düsseldorfer Wachdienst fürderhin Rund-um-die-Uhr-Betreuung garantiert. „Die größten Steuerzahler Berlins sind schon hier“, frohlockte bereits nach einem Jahr Geschäftsführer Nicolai A. Siddig – einer der Gesellschafter, neben der bayrischen Hypo-Bank-Tochter Hyporeal. Rechtsanwalt Siddig hält außerdem Anteile am Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, dessen Kuppel an schönen Tagen wie ein riesiger Golfball glänzt. Der Fürst wiederum hat eine Quelle im Sachsenwald, die mit Golfmotiven wirbt.
Die Anlage am Seddinsee umfaßt 230 Hektar und bestand einst aus 164 Grundstücken, die die Investoren mühsam „auf dem Verhandlungswege“ erwerben mußten. Das Land war zuletzt von einer LPG bewirtschaftet worden, die Spargel und Obst anbaute. Ein ehemaliger LPG-Vorsitzender, der jetzt Bürgermeister des Ortes ist, setzte sich sehr für den Golfplatzbau ein. Seiner Gemeinde wurde dafür von den Betreibern der Bau einer Kita und einer Schule mit einer Million Mark „gesponsert“, außerdem stellten sie seinen Sohn, einen gelernten Melker, als Greenkeeper ein. Die Genehmigung für die Golfanlage wurde in den diversen Ämtern und Behörden äußerst kontrovers diskutiert. 1993 entschied das Kabinett schließlich positiv. Golfen sei, ähnlich wie Tennis, ein Volkssport geworden, wurde behauptet.
Ich hatte 1985 noch ein schlechtes Gewissen, einer Einladung auf den ersten deutschen „Volksgolfplatz“ – nahe der oberhessischen Kleinstadt Schotten – zu folgen. Er war von einem Polsterer namens Schlapp gegründet worden, zusammen mit seinem „nie auf Feierabend schielenden“ Platzwart Herrn Turke. Am Anfang bestand die Anlage nur aus steinigen Äckern und Hangweiden: Man spielte ums Viereck und über die Diagonale. Auf die Weise kam man irgendwann zwar auch auf die international üblichen 18 Löcher, aber wegen des rauhen Vogelsberg-Greens erlaubte der Vereinsvorsitzende Schlapp bald das „Besserlegen“: eine neue Regel! Viele Golfspieler der ersten Stunde gewöhnten sich mit der Zeit das Besserlegen derart an, daß diese Regel auf dem Volksgolfplatz quasi bis heute gültig ist – wo das Green längst einwandfrei gestaltet wurde.
Ähnliches galt auch für den innerstädtischen „Volxgolfplatz“ auf dem Gelände des Ulbricht-Stadions in Berlin, dieser mußte dann jedoch dem Neubau des Geheimdienstes (BND) weichen. Die „3-Loch-Driving-Ranch“ wurde seltsamerweise ebenfalls von einem Polsterer, Clemens Bayer, gegründet. Gegenüber vom Potsdamer Platz, wo sich bis zum Mauerfall mehrere merkwürdige „Schäferhundabrichte“ halten konnten, eröffnete dann für einige Jahre die Berliner Firma „Golf Global“ eine „Driving Ranch“. Der Tagesspiegel, der inzwischen mit einer „Golfbeilage“ erscheint, erinnerte bei seiner Schließung 2009 durch den Grundstückseigentümer, die halbprivatisierte Bahn AG, daran, dass der Übungsplatz „vor allem wegen seiner grandiosen Kulisse sehr beliebt war.“
Ähnliches behaupten die Spieler auf dem „Minigolfplatz“ am Landwehrkanal in Kreuzberg auch von ihrer Anlage, die mit einem Biergarten verbunden ist. Für sie gilt jedoch nicht, was die Zeitschrift „Capital“ in einer „Exklusivumfrage“ ermittelte: Zwei Drittel aller EU-Geschäfte ab 154 Millionen Mark Auftragswert laufen über Golfplätze, das heißt, werden beim Golfspiel eingelocht, wobei das golfbedingte Umsatzplus branchenspezifisch differiert: von 28 Prozent (bei Chemie, Computer, Pharma) bis zirka drei Prozent (bei Banken, Versicherungen, Maschinenbau). Um solche „Global Player“ heranzukommen führten die Betreiber des Motzener Clubs (u.a. der Baukonzern Philipp Holzmann) sogar schon Politiker und Industrielle per Sonderluxuszug an ihr Golf- und Wohnobjekt am See heran. Ihre zwischen Eigentumswohnungen dort heißen „VIP-Lounge“ und „18. Loch“. Den Motzener Heimatverein sponserten sie großzügig, die Dorfchronistin Hilde Waßmuth meinte sogar: „Unser ganzer Ort profitiert von den Herren im Club“.
———————————————————————————————————-

Kuh mit Bauer/Bauer mit Kuh
Leitbild Kuh
„Alle guten Dinge haben etwas Lässiges und liegen wie Kühe auf der Wiese,“ meinte der die Kunst des Wiederkäuens predigende Philosoph Nietzsche. „Lässig“ – das ist eine Haltung. Uns wurde sie nach dem verlorenen Krieg von den Amis beigebracht. Damals hielt man in Westberlin in den Hinterhofremisen und Schrebergärten einige tausend Kühe, mitunter sogar im 1.Stock. Nach dem Rückzug der Amis als Besatzungsmacht wurde aus lässig „cool“. Heute leben in ganz Berlin rund 550 Rinder, etwa die Hälfte davon Kühe. Das reicht nicht, um wieder lässig zu werden, denn cool ist keine Haltung mehr, sondern bloß noch eine vage Geschmacksäußerung, eine schnelle Zustimmung.
Once upon a time in America hatte „cool“ die Bedeutung von ängstlich und zurückhaltend, aber in den Dreißigerjahren drehten die US-Schwarzen das Wort um: Cool sein war fortan aufregend und interessant. Erst ab dieser Zeit besaßen die Schwarzen – nebenbei bemerkt – überhaupt Geld. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Wort durch die (schwarzen) Jazzmusiker weiter popularisiert: Cool war nun modisch up to date und schwer angesagt. Chaucer, Shakespeare und Tennyson hatten das Wort „cool“ benutzt im Sinne von „nicht durch Leidenschaften und Emotionen erhitzt“. Diese Bedeutung galt auch weiterhin – im schwarzen Kontext: Cool down, man – heißt: Krieg dich wieder ein. Taking it cool, play it cool – bedeutet: etwas leicht – easy – nehmen, also relaxed. Dass „cool“ heute weltweit vor allem von Jugendlichen verwendet wird, ist ebenfalls den – ins Entertainmentbusiness abgedrängten – US-Schwarzen zu verdanken. Sich den Weißen in der Stadt unterlegen fühlend und diskriminiert, zudem wehrlos, kultivierten sie eine Haltung, einen Auftritt, den wir in Deutschland nach 1945 mit den Amis generell identifizierten: lässig (was im Altdeutschen noch „träge/unfleißig“ meinte) – jetzt bedeutete es so viel wie „scharf/geil“.
Noch 1993 sagte ein Treuhand-Manager zu vier ostdeutschen Betriebsräten, die er in seinem Büro mit den Füßen auf dem Schreibtisch empfing: „Das kennt ihr wohl noch nicht, diesen lockeren Stil, das ist die neue amerikanische Lässigkeit!“ Cool war sein Verhalten jedoch nicht, denn als die Betriebsräte ihn ihrerseits duzten, wurde er sofort zickig. Die schwarze Coolness kann man mit der (Kriegs-)List vergleichen. Für Clausewitz war die List bereits eine Art Witz bzw. Gewitztheit: „So wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen.“ Praktisch also ein „Bluff“ – im Auftreten gegenüber möglicherweise feindlich gesonnenen Weißen. Wie kommen wir nun aber zur „natürlichen“ Lässigkeit der Kühe zurück? Es gibt nicht wenige, die das mit Drogen versuchen. In Mitteleuropa ist das vor allem Alkohol. Als die Aufklärer – Kant, Hegel, Fichte usw. – erkannten, dass der Mann erst durch seine Ehefrau erzogen, d.h. ein das Soziale nicht mehr gefährdendes Individuum wird, fanden sie sogleich einen Ersatz für diese: Wein und Bier – als Vehikel der „Offenherzigkeit“ – vor allem in Männergesellschaften wie Militär und Kloster.
Der Alkohol bewirkt bei Männern, dass „mäßiger Rausch“ sie zu Frauen macht. Sie werden toleranter und liebenswürdiger. Sie sind „keiner Verstellung und Hinterlist“ mehr fähig, kurzum: sie machen „zur Freude der ganzen Welt“ eine Wandlung zum Guten durch. Aber vor allem öffnet der Trunk ihr Herz – „und ergänzt so die weibliche Kardialbelebung durch eine alkholische,“ schreibt der Soziologe Christoph Kulick in einer Studie über „Männlichkeitsdiskurse um 1800“. Der Alkohol wirkt als „Antidot zu den Differenzen der Gesellschaft und den Egoismen der Männer,“ ihre mit Wein verbundene Geselligkeit „ist eine Art konkrete Utopie, die Versöhnung nach Feierabend – indem sie sich beim gemeinsamen Zechen laut dem Populärphilosophen Pockels „untereinander zu einem Geiste der Offenheit bekennen“. Für Kulick „könnte das auch die Beschreibung einer Ehe sein. Und in der Tat entspricht das Trinken bei Pockels genau einem Eheschluß – ohne Frauen. In der Kneipe heiraten Männer. Der Alkohol sorgt dafür, dass Männer miteinander einen ähnlichen Grad an sozialer Kohäsion erreichen wie sonst nur mit ihren Frauen in der Ehe.“ Cool? Kuhl!

Noch eine Kuh mit Bauer: Matthias Stührwoldt
P.S.: Die taz-Hamburg veranstaltet am 13.Dezember einen Leseabend mit Musik: „Der Biobauer und Buchautor Matthias Stührwoldt aus Stolpe wird einige Erlebnisberichte rund um seinen Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein vortragen. Ausgehend von seinen Erfahrungen als Rinderpfleger wird Helmut Höge eine Würdigung der Kuh und ihrer Milchsäurebakterien neben die Erinnerungen eines Rindertransporteurs stellen.“
—————————————————————————————————-
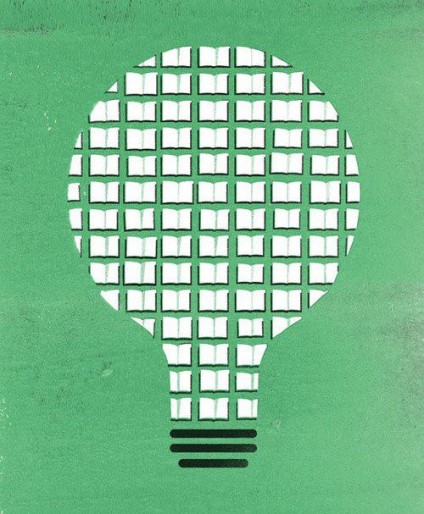
Noch ein Glühbirnensymbol: „Die Alphabetisierung und damit das abstrakte Denken ging mit der Elektrifizierung (GOELRO) einher. Aufklärung und technische Beleuchtung waren eins.“ (A.Lurija)
Ernst Bloch: „Die Glühbirne hat die Anfechtungen des Nachtgrauens weit gründlicher geheilt als etwa Voltaire; denn sie hat das Grauen aus den Schlupfwinkeln der äußeren Dunkelheit selbst vertrieben und nicht nur aus der des Kopfes.“
Nun gibt es zwei Initiativen, die gegen das EU-Glühbirnenverbot aktiv geworden sind: Einmal die Incandescent Light Bulb Alliance und zum Anderen der Verein LICHTZEIT e.V., eine Berliner Ausstellungsgruppe für das UNESCO-„Jahr des Lichts“ 2013. Dazu folgender Text:
Lebenslichter aufsetzen
Der Quantenphysiker Erwin Schrödinger trug 1944 in seinem Essay „Was ist Leben?“ die Idee der Information in die Biologie. U.a. schrieb er: „Für höhere Tiere kennen wir die Art von Ordnung, von welcher sie sich ernähren; es ist der geordnete Zustrand in den Verbindungen, die ihnen als Futter dienen…Pflanzen besitzen ihren stärksten Vorrat an ,negativer Entropie‘ selbstverständlich im Sonnenlicht.“ Der Biophysiker Fritz Albert Popp spricht heute von „Biophotonen“. Jede lebendige Substanz strahlt ein schwaches Licht mit Wellenlängen zwischen 200 und 800 Nanometern ab. Das Forum „gesundheitlicheausklaerung.de“ schreibt: „In jeder Zelle laufen etwa 30.000 bis 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde ab. Im Körper eines Menschen sind das rund eine Trillion Stoffwechselprozesse pro Sekunde. Die Schulmedizin nimmt an, dass diese Abläufe chemisch gesteuert werden. F. A. Popp setzt dagegen, dass allein Photonen – physikalische Einheiten – die nötige Schnelligkeit besitzen, um die erwünschten chemischen Reaktionen präzise auszulösen. Das ,innere Licht‘ – die Biophotonen – hält das Leben in Gang.“ Nachgewiesen wurde die Zellstrahlung erstmals 1922 in Simferopol an Pflanzen (Zwiebeln) vom sowjetischen Biologen Alexander G. Gurwitsch, der sie „Mitogenetische Strahlung“ nannte und dazu „morphische Felder“ postulierte, die gestaltbildend wirken. Zwei abgesandte englische Darwinisten der Zeitschrift „Nature“ kamen jedoch zu dem Schluß: Alles Stuß! Erst der von sowjetischen Atomphysikern für ihre Erforschung der Neutrinos (masselose Teilchen, die schneller als das Licht sind) im Baikalsee angeregte Bau von Photonendetektoren – „Photomultipliern“, was dann in Nowosibirsk geschah, führte zum experimentellen Nachweis der Gurwitschen Zellstrahlung. Nun macht was draus!
In Wien fand am vergangenen Wochenende ein Gurwitsch-Kongreß statt. Der Berliner Kulturwissenschaftler Peter Berz kam dort von dessen „Mitogenetische Strahlung“ u.a. auf die „Biophotonik“ – von Fritz Albert Popp zu sprechen, der laut Spiegel ein privat finanziertes Forschungslabor betreibt, „das bei Neuss in einer Baracke auf dem Gelände einer ehemaligen Nato-Raketenbasis residiert, welches von einem Mäzen zu einem Freigehege für Künstler umgewidmet wurde.“ Dort entwickelte Popp Geräte zur Feststellung von „Lebensmittelqualität“, vor allem befaßt er sich jedoch mit der Analyse von Krebszellen. Vor Popp hatte bereits der kommunistische Psychoanalytiker Wilhelm Reich über diese Zellanomalie geforscht – und dabei eine kosmische Strahlung, die so genannte Orgon-Energie, postuliert, die er mittels eines von ihm konstruierten „Orgon-Akkumulators“ einfangen und zur Krebs-Heilung nutzen wollte. Im Katalog einer Ausstellung im Wiener Jüdischen Museum über Wilhelm Reich äußerte Peter Berz bereits seine Bewunderung für dessen „andere Biologie“. Diese wurde ansonsten – ähnlich wie die Laborarbeiten von Popp – zwischen kreativer Wissenschaft und esoterischer Scharlatanerie angesiedelt. Das gilt auch für einen anderen Gurwitsch-Schüler, den englischen Pflanzenphysiologen Rupert Sheldrake, der seit nunmehr 30 Jahren versucht, die Existenz von „morphogenetischen Feldern“ wissenschaftlich nachzuweisen. Das sind für ihn nicht-materielle Kräfte, die durch die Akkumulation der Leben einer Art das Individuum formen. Den Biologen wirft er dabei vor, nicht so weit wie die Physiker reduziert zu haben, die schon längst immaterielle Wirkkräfte postulieren, sondern diese, immer noch mechanistisch gesonnen, in den Genen der Zellen und Synapsen des Gehirns lokalisieren.
Sheldrakes letztes Buch dazu heißt „Der Wissenschaftswahn: Warum der Materialismus ausgedient hat.“ Der Autor „erregt schon seit langem den Unmut der etablierten Wissenschaft mit seiner Theorie, dass alle Lebewesen und Dinge dank ,morphischer Felder‘ miteinander verbunden sind und mit seiner Betrachtungsweise der Welt als beseeltem Organismus,“ heißt es in einer Rezension des Kulturradios RBB, „Sheldrakes Theorien sind spekulativ, aber er ist Wissenschaftler: Hypothesen müssen in kontrollierten Experimenten überprüft werden. Genau das tut er – mit unglaublichen Ergebnissen.“ Ähnliches könnte man auch über die kürzlich verstorbene Mikrobiologin Lynn Margulis sagen, die ebenfalls eine Anhängerin der „Gaja-Hypothese“ – der „Welt als von Mikroben beseeltem Organismus“ war. Die F.R. schreibt über Sheldrake: „Anders als die meisten Esoteriker ist er ein Freund der wissenschaftlichen Methode.“ Das stimmt nicht: Alle (westliche) Esoterik will sich wissenschaftlich beweisen. Das Problem ist vielmehr, dass die (Lebens)Wissenschaften selbst bloß die abstrakte Negation magischer Praktiken sind, allerdings liefern sie zähl- und meßbare „Daten“ – um damit im Endeffekt neues Leben zu konstruieren. Der mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnete französische Genetiker Francois Jacob sagte es so: Mit Erwin Schröder habe sich die Biologie vom „Leben“ verabschiedet: Heute interessiere man sich nur noch „für die Algorithmen der lebenden Welt.“
—————————————————————————————————–

Ein „Heller Haufen“ aufrührerischer Bauern mit Bundschuhfahne. „Der Bauer ist witzig geworden,“ kommentierte Martin Luther. Kürzlich las Volker Braun aus seinem neuesten Buch „Die hellen Haufen“ vor, in dem es jedoch um die wegen der Privatisierung ihrer Betriebe durch die Treuhandanstalt aufgebrachten Arbeiter im Kalibergbau, bei Leuna und im Mansfeldischen geht. Davor veröffentlichte Volker Braun einen Teil seiner Arbeitsbücher. Im Folgenden einige Zitate daraus…
Von der Vendetta zum Klassenkampf zum Shitstorm
„Der Ethnologe ist oft unerwünscht“ (Philippe Descola)
Hat der Klassenkampf hat sich vom Rassismus abgelöst? fragte die Süddeutsche Zeitung im November 2012 den Autor der US-Serie „The Wire“: „Ja,“ meinte David Simon, „deswegen können wir uns jetzt als Gesellschaft moralisch erst einmal besser fühlen. Oder wie die Republikaner auf ihrem Parteitag auch ein paar braune und schwarze Gesichter um uns scharen und gemeinsam auf die Armen schimpfen: Sind doch selbst schuld an ihrer Arbeitslosigkeit und Kriminalität!“
Etwa zur selben Zeit kam der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auf dem „Wirtschaftsforum“ der „Zeit“ zu der Einschätzung: „Wir stehen vielleicht vor einer Revolution in Europa.“
In seinem Arbeitsbuch „Werktage“ – von 1977 bis 1989 geht es Volker Braun fast durchgehend um die Dialektik von Aufmucken und Kuschen.
Am 25.10.77 notierte er, nachdem ein Handwerker zu ihm in die Wohnung gekommen war: „sobald die anstellung nicht anonym wie im konzern, wie im veb, sondern aug in auf mit dem (bau)herrn, wieder die unterwürfigkeit.“
Am 2.11.77.: „…ich langweile mich. politik wird kitsch in stillstehenden zeiten, das laute nachdenken für die archive der stasi.“
Am 13.1.78 über einen Kollegen: „er wendet engels‘ satz, dass sich die menschheit nur aufgaben stelle, die sie erfüllen kann, ins individuelle und findet haarscharf die themen, die eben den zoll passieren.“
Am 24.1.78: „ich erinnere mich an den facharbeiterlehrgang in schwarze pumpe, neben mir am tisch genosse scheiter, fünfzig, nach dem krieg bürgermeister von annaberg, ein lebenskluger mensch: und er saß vor den formeln 1:1=1; für ihn eine unfaßbare sache, auf die er kopfschüttelnd starrte. er wollte mehrmals kapitulieren, weil er beschämt seine grenzen sah. ich kam von der penne, mit mir hätte man über infinitesimalrechnung reden können. es half nicht, ihm zu helfen. der mann hat gelitten.“
Am 30.8.78: „bei teller in weimar, der die fenster seiner gedanken aufreißt, die der veb goethe bezahlt, aber nicht unbedingt abnimmt. ein aufsatz zur Farbenlehre, über das qualitative weltbild goethes, ,die exakte sinnliche phantasie des realen‘, den versuch einer einheitlichen weltanschauung, die im abstrakten quantifizierenden weltbild der naturwissenschaft verlorengegangen ist. (im wissenschaftsbegriff, seit galilei und aufgekommen mit dem warenbegriff, ist nichts subjektives, keine real sinnliche erkenntnis geduldet, ausdruck der pervertierten arbeitsteilung.)“
Am 2.10.78: „albert wach stürmt aus der ukraine in mein zimmer, beißt mir fast die kinnbacke weg. war dreieinhalb jahre als kaderleiter an der trasse. einst in der schwarzen pumpe kommandierte er die kipper zu neuen siegen, so prinzipiell, daß man ihn fortqualifizieren mußte: das urbild des paul bauch. später fand ich ihn in einem zeitungsbericht wieder: ,baschirew alias albert wach‘, der die mitstudenten auf dem Acker zu Roderekorden trieb. in talnoje die brutale arbeit im schlamm, im frost, zwölf stunden montag bis samstag, die schweißer fallen in die baracke besoffen, aber am morgen stehn sie wieder an den röhren.“
Am 22.10.78 liest Volker Braun Erich Fromm und notiert: „er erklärt die verschiedenen arten der aggression (gutartige: defensive, und bösartige: grausamkeit, destruktivität, nekrophilie) aus ihren verschiedenen sozialen voraussetzungen; die sammler und jäger waren, mit höchster wahrscheinlichkeit, keine mörder.“ Dieses Buch von Fromm „über die menschliche natur“, das auf einen „radikalen humanismus“ hinausläuft, gibt Volker Braun „den wissenschaftlichen beweis, daß kommunismus möglich ist.“
Seinen „Arbeitsbuch“-Eintrag von vor fast 25 Jahren heute lesend, fallen mir drei kürzlich erschienene Bücher über noch lebende indigene „Sammler und Jäger“ ein. Dabei handelt es sich um die „Yanomami“ und die „Jivaro“-Indianer im Amazonasgebiet und die Fayu in West-Papua. Alle drei leben an Flüssen im Dschungel und führen oft und gerne Kriege/Vendettas – auch untereinander. Es sind patriachal-polygam organisierte Krieger-Gesellschaften. Während die Fayu sich dabei fast gegenseitig ausrotteten (siehe dazu u.a. den Missionsbericht von Doris Kuegler: „Dschungeljahre“), wurden die Yanomami am Orinoko vor allem von weißen Amerikanern – Militärs, Mediziner, Missionaren, Ethnologen, Anthropologen, Biologen, Bergwerksingenieuren, Filmern und Journalisten – heimgesucht und dezimiert.
Hintergrund für diesen nur allzu realen „Shitstorm“ war die „Soziobiologie“ des Harvard-Ameisenforschers Edward O.Wilson, die empirisch zu erhärten der Yanomami-Ethnologe Napoleon Chagnon zu seiner Lebensaufgabe machte: Für ihre „Gewalttheorie“ (biologisch mit einem von ihnen postulierten „Führer-Gen“ fundiert) sollte das „grimmigste Volk der Erde“ den lebenden Beweis liefern, „dass sich Mörder erfolgreicher fortpflanzen und aggressive Dörfer schneller als friedliche wachsen. Die Evolution bestraft Passivität und belohnt den Räuber,“ so faßt Patrick Tierney ihre Ausgangsthese zusammen in seinem Buch: „Verrat am Paradies. Journalisten und Wissenschaftler zerstören das Leben am Amazonas“. Der Autor bemüht sich darin seinerseits zu beweisen, dass diese „Serienkiller“-Theorie eine reaktionäre US-Degenenerationsideologie ist. (1)
Der Nachfolger auf dem Lehrstuhl des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola, hat kürzlich eine ethnologische Feldforschung veröffentlicht, die auf Deutsch wie eine Replik auf Chagnon klingt: „Bei den Jivaro-Indianern. Leben und Sterben in Amazonien“. Die halbnomadisch lebenden Jivaro-Jäger, die in großen Abständen voneinander leben, haben mehrere Frauen und rauben gerne noch mehr dazu, woraus u.U. endlose „Vendettas“ bis hin zu kollektiven „Rachefeldzügen“ entstehen. (Folgt man den griechischen Geschichtsmythen bis hin zu den Ethnologien von Lévi-Strauss beginnt Geschichte stets mit einem Frauenraub und Kultur mit Frauentausch.)
Während das „Dasein“ von Descola und seiner Begleiterin bei den Yanomamis „unmerklich ins Bodenlose“ glitt, konnten sie deren kriegerische Lebensweise jedoch immer mehr abgewinnen. Descola begleitete schließlich seine „Informanten“ auf ihren Feldzügen, die nicht unbedingt der Bereicherung dienten: „die Indianer verachten es, sich mit Utensilien zu belasten, die sie dank ihrer Findigkeit und ihrer wenig festgelegten Zeiteinteilung wiederherstellen können, wann immer ein Bedarf besteht.“ Dieses Volk „ursprünglicher Individualisten“ ist überhaupt dem auf Äquivalente beruhenden Warentausch abhold, selbst wertvolle Dinge wie Gewehre und Einbäume fließen in ihre Gabenzirkulation ein, die auf Reziprozität beruht und an Personen gebunden bleibt. Descola meint: „Der Gütertausch und die Vendetta, der Tausch von Toten also, unterliegen denselben Prinzipien.“ Sowohl die Gaben- als auch die Blutschuld sind zwingend. Daneben gibt es – seit den Spaniern schon – den gelegentlichen, für die Indianer meist unvorteilhaften Warentausch. Descola spricht von einer „paradoxen Verbindung von Krieg und Handel“, die im übrigen „in ganz Amazonien bezeugt ist.“ Ähnlich paradox ist die Einstellung des Staates zu „seinen“ Indianern im Dschungel: Sie dürfen untereinander Kriege führen und morden, aber keine Weißen da mit reinziehen.
Während das Ehepaar Kuegler in West-Papua das „Kriegerische“ bei den Fayu fast ein Leben lang missionarisch erfolgreich bekämpfte, wurden die Yanomami von Chagnon mit Tonnen von Stahl-Geschenken (Macheten, Gewehre, Messer) geradezu aufgestachelt – und dann deren Verhalten biologistisch bis zur völligen Datenüberdehnung (-betrug) interpretiert.
Demgegenüber versuchte sich Descola bei den Jivaro-Indianern mit ihrer „Politik im Florentiner Stil“ – ihrer „Heroik: eine Mischung aus gestauter Gewalt und unvergleichlichem Stolz“ – eher pariserisch anzufreunden. Der Reaktionär Chagnon verachtet die französischen „Postmodernen“, wohingegen die christliche Doris Kuegler wahrscheinlich beide Männer-Ethnologien heftig ablehnen würde. Der ebenso wie Chagnon stets bewaffnete Descola bezeichnet sich selbst als leidenschaftlicher Jäger. (2)
Eine Bemerkung von ihm, dass die Jivaro-Krieger weder beim Gabentausch noch wenn sie sich gegenseitig helfen – beim Hausbau und Einbaumtransport etwa – auf Gleichwertigkeit achten, bringt mich zurück zum „Arbeitsbuch“ von Volker Braun – zum
Eintrag am 9.9.79: „finde bei [ernst] bloch eine auslegung des Hans im Glück…’es ist ein märchen von merkwürdigem tauschverkehr, wie man sieht, und von einem dummkopf. aber der bursche ist rührend und grundsympathisch, auch verknäult sich in seinem sturen handel allerlei. wie bei einem kind das brot bei fremden besser schmeckt als zu hause, so gefällt hans allemal mehr, was der andere hat; nicht aus neid, sondern im sinn des traums. ein spatz auf dem dach scheint ihm dann schöner als eine taube in der hand; oder: dort, wo du nicht bist, wohnt das glück. weiter aber klingen in dem geringen verständnis für besitz künftige oder sehr alte zustände an, eigentumslose, hans denkt beim schwein an die würste, bei der gans ans weich gestopfte kopfkissen, er will immer nur haben, was er braucht, er kapitalisiert noch nicht. schließlich ist etwas geheimes in der leichtigkeit seines verlusts, in der tumben, völlig echten freude seines los- und ledigseins. verlaß alles, dann findest du alles, sagt ein alter spruch, ein gefährlicher weiser, für den die zeit noch nicht gekommen ist. jetzt machen mit dem dummen hans andere geschäfte und ziehen vorteil daraus, er behält nichts als seine arbeitskraft und muß diese von neuem verkaufen, aber fallen die ausbeuter weg, dann ist es nicht eben dumm, so leicht und glücklich zu sein wie der dumme hans‘.“ (3)
Es gibt in diesem Glücks-Zusammenhang zwei biographische Berichte – von Weißen, die ihre Kindheit in West-Papua bzw. in Amazonien verbrachten und bei den dortigen Indigenen aufwuchsen, während ihre Eltern als Missionare bzw. Sprachwissenschaftler tätig waren. Beide Autorinnen leben heute im Westen (unter Ausbeutern) und sehnen sich – die eine mehr, die andere weniger – nach ihrem Leben unter den „Wilden“ zurück. Die eine – Sabine Kuegler – unterstützt derweil die Befreiungsbewegung West-Papuas, und die andere – Catherina Rust – studiert Ethnologie. Daneben arbeitet sie die wissenschaftliche Dokumentation ihres Vaters über die Kultur der Aparai-Wajana auf. Ihr Buch „Kindheit bei den Aparai-Wajana-Indianern. Das Mädchen vom Amazonas“ schrieb sie zunächst für ihre Tochter, um der etwas von ihrer ganz anderen Kindheit zu vermitteln.
Patrick Thierney interviewte für sein o.e. Buch noch zwei weitere im Dschungel aufgewachsene Frauen: Zum Einen die Yanomami-Indianerin Yarima. Sie heiratete einen US-Ethnologen und zog mit ihm nach New Jersey, wo sie als Mittelschichts-Hausfrau mit drei Kindern in einem Reihenhaus lebte. Über ihren Ehemann schreibt Tierney: „Durch die Heirat verschaffte Kenneth Good sich einen einzigartigen Zugang zur Gesellschaft der Yanomani, und er übertrug seine Liebe zu Yarima auf die Yanomani-Kultur.“
Seine Frau verließ ihn und ihre Kinder jedoch nach einigen Jahren – und ging zurück an den Orinoko in eine Dorfgemeinschaft der Yanomami. Sie hielt es in Amerika nicht länger aus: „Das einzige, was sie lieben, sind Fernsehen und Einkaufszentren. Das ist doch kein Leben,“ erklärte sie Patrick Tierney – und gestand ihm, dass sie inzwischen sogar das Zählen wieder verlernt habe. Während ihr Mann, der Ethnologe, meint, dass sie ihn zu Hause in New Jersey unter lauter Amerikanern als zu wenig kriegerisch, d.h. als zu kriecherisch, empfand.
Die andere Frau, die Thierney erwähnt, heißt Helena Valero. Sie wurde als Zwölfjährige von den Yanomami entführt und lebt seit über 50 Jahren mit ihnen. „Sie erforschte als erste Weiße unzählige Gegenden, Flüsse und Bergketten, und sprach besser Yanomami als jeder andere Nichtyanomami,“ schreibt Tierney. Ihre auf Portugiesisch veröffentlichte Biographie hat den Titel: „Ich bin die Weiße Frau“. Ein Missionar verglich sie mit Homers Helena.
Am 26.1.79 notierte Volker Braun: „in einem berliner kindergarten: ,müssen wir heute auch wieder spielen, wozu wir lust haben?‘ was für kinder noch echte fragen sind, wird den erwachsenen zum witz, unter den angestellten kursieren ,prinzipien‘:
bei uns kann jeder machen, was er will, ob er will oder nicht.
wir wissen zwar nicht, was wir wollen, aber das mit ganzer kraft.
wer schon die übersicht verloren hat, muß wenigstens den mut zur entscheidung haben.
initiative ist disziplinlosigkeit mit positivem ausgang.
wo wir sind, geht alles durcheinander, aber wir können nicht überall sein.
spare mit jeder sekunde, jedem gramm, jedem pfennig – koste es, was es wolle.
jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, alle machen mit.“
Am 3.10.80 heißt es: „ein pole klagt einem amerikaner: pironnje, unsere arbeiter wollen nicht arbeiten. der amerikaner: damned, bei uns arbeitet die herrschende klasse auch nicht. – japaner werden durch einen betrieb geführt, man erklärt ihnen die organisation, die sicherheit, die überlegenheit. ja, und wo liegen die ursachen für den bummelstreik?“
Am 28.6.81: [heiner] „müller: die literatur muß die wirklichkeit unmöglich machen. hinze würde kühl und froh erwidern: die wirklichkeit macht sich selbst unmöglich.
[walter] kaufmann über die ddr-literatur an der schwelle der achtzigerjahre, ich lese es so:
breite des sujets – aber verengter zugriff auf die gegenwart; neue stimmen, das bedürfni sinnerfüllten lebens – aber nicht mehr durchreißertypen, große helden, die die gesellschaft ändern (balla, ole bienkopp), sondern der autor als leidenschaftliche figur, als der held des texts, der die analyse und den vorgriff leistet; zurücknahme des pathos…“
Volker Brauns Eintrag vom 27.1.81 könnte fast als Beispiel dafür herhalten: „im veb rewatex, betrieb blütenweiß in spindlersfelde, mit der erklärten absicht, anstrengende, schmutzige arbeit zu sehn. natürlich führt man mich in eine moderne abteilung, und ich bin auf den ersten blick (und die ersten beteuerungen der leiter) angenehm enttäuscht. unterhalte mich dann mit den frauen an einer riesigen mangel, die unentwegt schwere feuchte bettbezüge an die maschine reißen, und komme mir in wenigen minuten mit meinen fragen dumm vor; auch diese technisierte arbeit ist plackerei. und die unterhaltung könnte die frauen ablenken, belästigen: sie bestimmen selbst das tempo, und sie müssen exakt anlegen, entdeckte qualitätsmängel führen zu lohnabzug (schließlich wäscht man hier auch für westberlin). sie müssen ,voll dasein‘ für die maschine; und sie sind es in der früh- und der nachtschicht, aber wegen der kinder nicht bereit zur spätschicht, weshalb stärker ,ideologisch zu arbeiten‘ ist. Kapital I, wenig abgewandelt: der betriebsbesitzer als leiter schreitet voran, der betriebsbesitzer als arbeiter folgt ihm; ,der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andere scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene haut‘ in den wettbewerb getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die – auslaugende wäscherei.“
Am 17.11.81: „die graue farblose masse im morgennebel an den kreuzungen. das war einst die deutsche arbeiterklasse. das geht an die maschinen und frißt die fernsehscheiße. die friedensmärsche ziehen durch den westen… aber frieden heißt den staat bekämpfen, frieden heißt: die gesellschaft, die sich selbst bestimmt.“
Am 27.11.81: „kantaten-text ,der frieden‘, ich komme nicht zurand, der frieden, den es jetzt zu erhalten gilt, das ist eine fürchterliche hagere gestalt, die in waffen geht, die uns zu der fortwährenden sinnlosen anstrengung zwingt, sie von allen seiten zu panzern.“
Am 4.1.82: „frau scholz, humboldt-universität, sagte mir, sie dürfe den panzerschrank einsehen, wo etwas von mir läge, weswegen ich wieder nicht lesen dürfe, ich war gespannt! unterdessen sah sie hinein: da war der schrank leer. nanu, magnifizenz…“
Am 21.1.82: „überarbeite die fragmente des Gerichts über Kronstadt (1970 vorspiel zu Lenins Tod). totleben. das ist ein besserer titel. horror vor der puren darstellung, mit der sich der gegenstand erledigt; das gericht zitiert ihn verfremdend. fabel: die ,hungernden‘ müssen zu einem raschen urteil kommen, und der ,hunger‘ spricht grausam recht. der lebensanspruch gegen die ideologie. [peter] weiss: ,von grausigen, fürchterlich lasterhaften beziehungen, daß der körper sich hinwegsetzt über alles, was der intellekt aufgebaut hat, höhnisch die eroberungen des geistes in stücke reißt‘.“
Am 30.1.82: „vor dem flughafen in frankfurt/m wieder 5000 demonstranten, große verbände der polizei zusammengezogen, ,so daß neue ausschreitungen der behörden zu fürchten sind‘ – diese parteiliche berichterstattung, radio ddr, ist doch mal wohltuend.“
Am 10.2.82: „drei gespräche auf ohnehin nüchternen magen. hafranke ,begründet‘ das verbot von Dmitri [ein Manuskript von V.B.] mit dem kriegsrecht.“ (in Polen)
Am 2.2.82: „nachts zwei stunden an der grenze festgehalten: geld im schuh und die geschichte der russischen revolution im ranzen.“
Am 22.2.82: „…,sie können gar nicht anders denken, als daß wir die kurve kratzen.“
Am 23.3.82 notiert er, daß er nach einer Lesung „für den Frieden“ in der Kongreßhalle das Politbüromitglied Kurt Hager auf sein einjähriges Hamburg-Stipendium angesprochen habe, woraufhin dieser erwidert hätte: „das wegbegeben sei doch ,gang und gäbe!“
Am 22.2.82: „sehen die erstaunlichen bilder der heidrun hegewald; nirgends sind die bedrohungen so nackt vor augen geführt, ist die entmenschung so bild geworden wie in diesen menschenbildern.“
Am 28.3.82: „schwerin. totleben. – nachts gegen zwei geraten wir in eine hochzeitsfeier. ich, müde, wäre an dem fenster vorbei, jahnke aber läßt sich hereinbitten (übergeben wie bestellt den nelkenstrauß des intendanten). ärmliches zimmer, die mäntel aufm tisch, bierflaschen auf dem boden. ein zweites brautpaar ist schon auf die reise, ein drittes hat sich den schleier ertanzt fürs nächste jahr, alle aus der selben sozialen schicht: ,facharbeiter für warenbewegung‘ bei der post und ähnlich unterbezahlte berufe. wir werden sofort einbezogen, umgängliche leute, die braut hat schon ein kind (weil den krippenplatz kriegt man ledig leichter) und braucht ein zweites (weil zwei zimmer möchte man haben); jede der personen ein kleiner abgrund. das jüngelchen schon geschieden und will zur bahn, wo er vielleicht noch wieder eine findet; ein stilles mädchen, ich frag ihr kein loch in den dicken bauch; ein debiler dumpf an den tisch gehockt. mit uns ist ein lärmendes paar hereingetanzt, bzw. sie wirft sogleich den mantel ab und tanzt, in einem langen dünnen fähnchen und sich in die hocke grätschend (‚ich war vier mal im westen, deswegen tanze ich so‘??), alle starren wie auf eine erscheinung (und dann ist jahnke mit ihr verhakt und verwirbelt), nach einer halben stunden sitzt sie spack und blaß auf dem sofa, mit verfallnem gesicht: der mann ist hinaus, ,seht ihr, so schnell geht das, zu zweit bin ich gekommen, nun bin ich wieder allein,‘ sie zeigt eine fotografie ihres kindes: ,wenn ich das nicht mehr hab, dann bin ich auch tot‘.“
Am 10.4. 82 notiert Volker Braun: „zu [André] Gorz, abschied vom proletariat
1. wo die massen nur von ihren persönlichen peinigern, aber nicht von deren ,sachlicher macht‘ befreit werden (der archaischen struktur der produktion), findet ihre ,befreiung‘ in der abstraktion statt. das individuum partizipiert an der befreiung in dem maße, wie es ideologisch zu denken vermag, d.h. im bewußtsein, nicht im praktisch-sinnlichen leben.
2. gorz beobachtet mit frommem schauder das verschwinden des arbeiters; die banalisierung der tätigkeiten entzieht diesem ,seine‘ arbeit, die beliebige produktion stößt ihn als notwendige person aus…
3. gorz ,rehabilitiert‘ den Menschen, indem er ihm autonomie gegenüber der (üblen) arbeit zugesteht.
4. gorz ist erleichtert bei dem gedanken, daß die leute in der gesellschaftlich notwendigen arbeit nicht mehr ihre persönliche erfüllung finden können.
5. ,das reich der freiheit beginnt in der tat erst da,‘ schrieb marx: jenseits der materiellen produktion, soll das heißen, daß die ,befreiung‘ auch erst jenseits dieser sphäre zu suchen ist?
6. die freie assoziation ist der verein von produzenten, nicht von ,autonomen‘ wesen.“
In seiner Vorlesung 1976 kam Michel Foucault noch auf eine ganz andere Freiheit zu sprechen: „Die Freiheit, die die germanischen Krieger genießen,“ so sagte er, „ist wesentlich eine egoistische Freiheit, eine der Gier, der Lust auf Schlachten, der Lust auf Eroberung und Raubzüge…Sie ist alles andere als eine Freiheit des Respekts, sie ist eine Freiheit der Wildheit…Und so beginnt dieses berühmte große Porträt vom ‚Barbaren‘, wie man es bis zum Ende des 19.Jahrhunderts und natürlich bei Nietzsche finden wird – den die Nationalsozialisten dann zu ihrem biopolitischen Vordenker erklären“. Wobei ihre „Transformation aus der Absicht der Befreiung die Sorge um [rassische] Reinheit werden läßt.“
An anderer Stelle fragte Foucault sich: „Was gibt es überhaupt in der Geschichte, was nicht Ruf nach oder Angst vor der Revolution wäre?“ Könnte es vielleicht sein, dass solche Begriffe wie Klassenkampf, Generalstreik und Revolution nur die industriell zivilisierten Formen der alten Weisen des Sich-Bekriegens sind? Kriegerische Selbstbestimmung eingebunden in Bündnisse… Diese Frage kam mit dem anarchistischen Ethnologen Pierre Clastres und seinen Forschungen über „staatenlose Gesellschaften“ auf, die in den Siebzigerjahren in der Linken viel diskutiert wurden (s.u.), ähnlich wie die Feldstudien der Schweizer Ethnopychoanalytiker Parin/Morgenthaler bei den Agni und den Dogon und deren fast konträre Sozialisationsformen: „Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst“ und „Die Weissen denken zu viel“.
Kurz nach dem „Bürgerkrieg“ 1998 in Indonesien traf ich in Berlin drei junge Künstler, die ich in Djakarta kennengelernt hatte. Es war der 1.Mai und ich fragte sie, ob sie Lust hätten mit mir nach Kreuzberg zu fahren, wo die alljährliche Mai-Randale stattfinde. Die kannten sie aus dem Fernsehen, und kamen deswegen begeistert mit, Aber als wir uns das Schauspiel ankuckten, waren sie schwer enttäuscht – ernüchtert quasi, denn die TV-Bilder, die sie vielleicht via CNN in Indonesien alljährlich vom 1. Mai in Kreuzberg sahen, hatten ihnen das Gefühl vermittelt: „Die können kämpfen! Während wir in Indonesien doch alle Feiglinge sind.“ Jetzt sahen sie in der „Realität“, dass es genau umgekehrt war: Während z.B. in Djakarta aus den Hubschraubern scharf geschossen wurde auf die Demonstranten, wurden sie hier von den Polizei-Hubschraubern nur gefilmt. Wahrscheinlich, um das Material anschließend an CNN zu verkaufen “ Das ist ja alles nur Kinderspiel“, kritisierten sie (mich).
Am 1.5.82 notierte Volker Braun: „die sicherheit ist gewährleistet, meine und die der leser, und ich kann sagen, sie nimmt weiter zu. zum buchbasar gelange ich, durch einen separaten eingang ohnehin, durch eine doppelte sperre, ein dreiköpfiger posten registriert und gewährt eine arbeitskarte (die nummer des personalausweises ist einzutragen), man erkennt verwundert das vorgedruckte ,volksfest‘.“
25.6.82: „endlich hat der zensor gesprochen; sechs sätze im ,Dmitri‘ sind für den Druck zu ändern:
[u.a.]: es ist verboten, das land zu verlassen
ein lügner, ein dissident mißbraucht den edlen namen ihres sohnes.
den polen ist die freiheit teuer, uns aber die botmäßigkeit.“
4.4.83: „ein winziges interview mit vorgeschriebnen fragen, die junge welt hält es für ,schwer verständlich‘. nun führt der chef selbst die, wieder undruckbare, unterhaltung. ein zungenschlag: wir sollten jetzt in der ernsten situation die kritik einmal gänzlich unterlassen und uns allein dem kampf gegen die hochrüstung der nato widmen.“
24.4.83: „laut meyers großem lexikon, band 1 a-gh, 1982, bin ich 1976 in die bundesrepublik übergesiedelt. andere nachschlagwerke (man wird neugierig) weisen mich als linientreuen propagandisten aus, so muß man sehn wo man bleibt.“
Im Internet finde ich unter dem Stichwort Volker Braun einen vermeintlichen Stasi-Vermerk: „Es besteht der Verdacht, daß es sich bei Volker Braun um einen personellen Stützpunkt des Gegners handelt…“ (Operativer Vorlauf)
15.6.83: „in der sowjetischen presse wird ein ,brigadegesetz‘ diskutiert als ein schritt von der vertreterdemoratie zur unmittelbaren demokratie.“
Eine Broschüre von Jörg Roesler beschäftigte sich 2008 mit der „Brigadebewegung“: In der DDR versuchte man 1950 und dann noch einmal 1960 Produktivität und Produkt-Qualität über die „Brigadebewegung“ und den sogenannten „Engagierten“ zu steigern. Nach einem Kontrollkommissions-Audit wurden an den Arbeitsplätzen Tafeln mit der Anzeige „Ich bin Selbstkontrolleur“ angebracht. Umgekehrt schlossen etliche „Engagierten“-Brigaden bzw. die von ihnen (!) gewählten Brigadiere eigene Verträge mit der Werksleitung ab, in denen die Norm-Vorgaben von oben für einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben wurden, und nur „auf der Grundlage der freiwilligen Erhöhung durch die Brigade“, also von unten (!), verändert werden durften: und zwar durch die Entwicklung neuer Arbeitsmethoden, die den Zeitaufwand verringerten. Die „daraus sich ergebenden überflüssigen Arbeitskräfte“ sollten der Werksleitung „zum anderweitigen Einsatz“ überstellt werden. Mit diesen Selbstverpflichtungs-Verträgen wurden die Rechte der Meister und Abteilungsleiter empfindlich beschnitten. Auf der anderen Seite wurde die Werksleitung damit verpflichtet, „für das erforderliche Material“ und seine rechtzeitige Beschaffung sowie seinen Transport an die Arbeitsplätze zu sorgen. Dieses Mitbestimmungsmodell weitete sich 1951 derart aus, daß man daran dachte (z.B. in der Staatswerft Rothensee), die einzelnen Brigadiere zu sogenannten „Komplexbrigaden“ zusammenzufassen, die wiederum einen Brigadier wählten, dessen Funktion „administrativer Natur“ war.
Im Endeffekt lief dies alles auf eine Doppelherrschaft in den Betrieben hinaus, wobei gewerkschaftlicherseits auch immer mit einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität infolge größerer Rechte der Arbeiter argumentiert wurde: Die Brigademitglieder „gingen mit einem ganz neuen Elan an die Aufgaben heran“, was die Leistung der gesamten Brigade verbesserte, wobei die „besten Arbeiter“ auch noch die anderen zur Qualitätsarbeit anspornten. Im Elektromotorenwerk Wernigerode wurden gar Brigade-Leistungsübersichten ausgehängt, und Minuspunkte für Arbeitsfehler verteilt, die sich „jedoch von Monat zu Monat“ verringerten. Noch bis zum Ende der DDR wehrten sich einzelne Brigaden gegen Lohnabzüge bei verminderten Leistungen aufgrund von Versorgungsmängeln, für die sie nichts konnten: sei es, weil die stetige Materialzufuhr nicht klappte, das gelieferte Rohmaterial schlecht oder ihre Maschinen und Werkzeuge verschlissen waren. Bei Narva wurden z.B. Fließstrecken, die in Japan einschichtig liefen, ständig dreischichtig eingesetzt. Mitte 1951 wurde die „Einführung der wirtschaftlichen Buchführung“ für alle Betriebe obligatorisch, die Werkmeister und Abteilungsleiter erhielten dadurch wieder größere Vollmachten, sie schlugen nun der Werksleitung die von ihnen „entsprechend dem technologischen Prozeß“ zu Brigadieren ernannten zur Bestätigung vor. Es wurde ein „Tag des Meisters“ kreiert. Jörg Roesler meint, daß man damit die zuvor erkämpften „Selbstgestaltungsfreiräume“ so weitgehend reduzierte, „daß im Prinzip das alte Verhältnis Meister-Kolonnenführer wiederhergestellt wurde, wenn auch die Brigade dem Namen nach erhalten blieb“.
Die zweite „Brigadebewegung“ dann – sollte zwar wie von unten aussehen, wurde jedoch 1959 zunächst von oben, durch den FDGB, initiiert – und bekämpfte zum Beispiel über die Selbstorganisation „Arbeitsbummelei“ und „Trinkerei“, beförderte daneben aber auch – über „Brigadenachmittage“ etwa – das soziale Miteinander. In den Leuna-Werken wurde ein „Tag der Verpflichtungskontrolle“ eingeführt. Schon bald war dort aber auch von „Selbstnormung die Rede“. Anderswo wollte man das Material selbständig anfordern – ohne Zustimmung durch den Meister, die ihre Verfügungsgewalt über die Brigaden nach und nach wieder verloren. Im Fahrzeugwerk „Sachsenring“ Zwickau verlangten die Arbeiter sogar die Mitbestimmung bei der Prämien-Verteilung für die Werksleitung.
„Den Brigaden größere Rechte“ hieß ein wichtiger Artikel in der „Tribüne“, verfaßt vom Aktivisten Rudi Rubbel. Mit den darauffolgenden Angriffen gegen seine Positionen beschäftigten sich sogar einige Westgewerkschaften in ihrer Presse. Sein Forderungskatalog sah u.a. vor, daß die Brigaden „selbständig Rationalisierungskredite zur Modernisierung der Arbeitsmittel“ aufnehmen konnten. Walter Ulbricht bremste diese Bewegung Anfang Juni 1960 aus: Das sei „Syndikalismus“ und rieche nach „jugoslawischer Selbstverwaltung“, die DDR brauche jedoch „keine neuen Strukturveränderungen“.
Am 2.7.83 notierte Volker Braun: „gottfried 50. wir brüder treffen uns aus ost und (hartmut) west. gundolg gernot volker…in den politischen diskussionen plötzlich nibelungentreue, gefolgschaft notfalls in den untergang. wo ist der großmut, die herzenskraft der alten degen. noch mit grauen haaren werden wir zum schwert greifen.“
8.7.83: „eine woche in steinbach, nibelungen-werkstatt des regie-instituts im freilichttheater…szenische übungen mit studenten verschiedener kunstschulen und meininger schauspielern…“
29.8.83: „einhorn, der lektor, drängt mich, dem verlangen des verlags nach einem absichernden ,nachweis‘ für Linientreue (in den Hinze-Kunze-Berichten) nachzukommen.“
11.11.83: „in der freundschaftsgesellschaft in athen ein gespräch über leben und literatur in der ddr. es wird sogleich nach dem sozialistischen realismus gefragt, und ich versuche also, realistisch über den sozialismus zu reden. ein älterer mann, hinten im saal, erhebt sich entrüstet: dann habe er umsonst gekämpft, wenn es solche probleme gäbe nach dem ,sieg‘, er habe zehn jahre im gefängnis gesessen, und ich rede von widersprüchen und langen prozessen.“
3.1.84: „ferenc tökei auf einer marx-konferenz in budapest: der heutige sozialismus könne nicht als entwickelt bezeichnet werden. internationalismus bei marx keine politische losung sondern eine fundamentale tatsache, die im weltordnungscharakter des kapitalismus wurzle; der weltmarkt nicht sein äußerer sondern ein innerer faktor. die basis des sozialismus könne nicht enger sein als die des kapitalismus.“
8.2.84: „im schillertheater. irene böhme, die, Die Da Drüben, über uns auskunft gab, über die hüben: sie sei nun eine ,westfrau‘, und es sei nichts anders. kurt sitze zuhause, sie in der dramaturgie; wer drüben veröffentlicht habe, sei auch hier am ball, wer drüben nicht landete, lande auch hier nicht. aber eins habe sich geändert: wofür sie ihre arbeit mache, wisse sie nicht mehr. man werkle elegant ins leere.“
26.5.84: „im zug nach dresden ein korvettenkapitän der volksarmee. ein gemütsmensch in montur. er hält sich fest an den grundsatz des m/l, daß kriege gewinnbar seien; ich sage, der m/l habe überhaupt keine festen sätze, außer dem, daß die wahrheit konkret sei.“
3.8.84: „artikel in der prawda: Ein Irrweg; die ddr öffne sich für den milliardenkredit den reaktionären einmischungen der bundesrepublik. das neue deutschland druckt diesen störtext nicht nach.“
Am 9.9.84 notiert Volker Braun: „am grill des berliner ensembles, während ich meinen schaschlyk fasse, befragt mich der vorsitzende der gewerkschaft kunst, ob ich probleme habe, während ich den heißen schaschlyk koste, ob er etwas für mich tun könne, einen ferienplatz…“
5.2.85: „an den anekdoten fällt mir jetzt auf, dass aus dem ,westen‘ nur schlimmes vermeldet ist, wie in der einäugigen presse. das ist lebensblindheit, man müßte beispiele schönen verhaltens der leute und völker geben, ein mut zum anderssein sollte sichtbar werden.“
15.5.85: „von naumburg nach halle auf der abendlichen schnellstraße, ,grandiose, höllische, schwefelgelbe leuna-fabriklandschaft‘: [anna] seghers 1935 auf dem Pariser Kongreß. sie fragte: ist der schriftsteller ,stolz auf diesen anblick‘? nicht stolz auf das ,nationalgut‘ leuna, aber stolz auf die arbeitskraft von 50.000 Arbeitern, auf die vom mitteldeutschen aufstand durchblutete landschaft und ,auf die zukunft von leuna‘.“
28.1.86: „um den medien in bremen zu entgehen, lasse ich mich von einem fernsehteam in einen betrieb fahren. vorbei an der stillgelegten [werft] weser ag (bremen hat 16% arbeitslose) in die klöckner-werke. ein ingenieur teilt schutzhelme aus; er war zur selben Zeit wie ich in schwarze pumpe, als chef der werksbahn. wir stapfen durch den ruß und lärm des stahlwerks, unter die herabsprühende glut. kein unterschied, für meinen blick, zu hennigsdorf, steuerwarte, stranggußanlage. auf die frage, ob er sich, als arbeitsloser, in die ddr bequemen würde, antwortet ein kollege ruhig: naja man müßte es kennenlernen, der ingenieur, dem ich auf den fersen bleibe, aber hat ,den vergleich‘ drüben? daist die diktatur, nur versammlungen, wo nichts herauskommt, er kenne es, hier wisse jeder, was er zu tun hat, hier sei die arbeit effektiv. ,das schafft ihr nie‘, ist die schließung der werften nicht diktatorisch? nein, das sei natürlich. die risiken, die überraschungen der marktwirtschaft seien natürliche vorgänge, damit komme der mensch zurecht, aber nicht mit der planwirtschaft, der staatlichen willkür, daß die industrie bremerhavens schon ganz der raub der banken ist? irritiert nicht seine religion.“
Der Ingenieur, der beide „Seiten“ kennt, holt hier unverhohlen den Darwinismus in seinen „Systemvergleich“, der ihm zugleich zu einer „Religion“ geworden ist. Drüben ist jedoch auch Christa Wolf nicht davor gefeit, Naturwissenschaft/Technik und Anthropologie ahistorisch zusammen zu denken – nicht zuletzt mit einem unkritischen Porträt des obersten DDR-Genetikers Hans Stubbe in „Sinn und Form“ (sic).
Volker Braun notierte am 3.1.87: „christa umkreist, nach tschernobyl, weiter den blinden fleck, den ihre ,wörter nicht kennen wollen, nicht kennen dürfen’…und der befund wird immer intimer: die menschheit betreffend. der mensch wolle geliebt werden, starke gefühle erleben, und wenn es ihm nicht gelinge oder verwehrt werde, suche er ersatz. welche angst schotte jene jungen männer im kernwaffenlabor livermore [Kalifornien] ab gegen das, was wir leben nennen. ,eine angst, die so immens sein muß, daß sie lieber das atom ,befreien‘ als sich selbst…“
Am 8.11. 89 heißt es: „bei wolfs: wir unterzeichnen den aufruf, im land zu bleiben und die volksressourcen zu schützen…“
Am 9.11.89 [dem sogenannten Tag der Maueröffnung] notiert Volker Braun: „daß wir die Revolution durchlaufen, sieht man auch daran, wie rasch die texte veralten.“
Am 4.12.: „dieter klein bestellt einige intellektuelle in die universität, einen appell an die vernunft zu unterzeichnen und die bürgerinnen und bürger ,um besonnenheit‘ zu bitten, ,die gewalt gegen menschen und öffentliche einrichtungen ausschließt‘, ich fürchte, diese beschwichtigung provoziert erst recht gewalt;…“
Die letzte Eintragung – am 31.12.89 lautet: „nun haben wir eine biographie. aus dem widerstand und der geducktheit tretend, haben wir jeder eine geschichte durchlaufen, unter die ein harter strich gezogen wird. unter die alten wahrheiten, unter die alte zukunft.“

Albrecht Dürer: Bauern im Gespräch

Eugène Laermans: Arbeiter im Gespräch
Anmerkungen:
(1) Von Chagnon liegt auf Deutsch vor: „Die Yanomami: Leben und Sterben der Indianer am Orinoko“. Neben Edward O. Wilson und Richard Dawkins konnte sich Chagnon gut und gerne auch auf Konrad Lorenz und Irenäus Eibl-Eibesfeldt – auf deren Theoriebildung über den Menschen, seine Natur und Kultur, berufen.
(2) Was ist ein leidenschaftlicher Jäger? Die sich tanzend auf einen neuen „Krieg“ einstimmenden jungen Jivaro-Indianer verbinden in ihren Gesängen „den Akt des Tötens mit dem Orgasmus“, schreibt Descola. Der Schweizer Ethnopsychoanalytiker Paul Parin veröffentlichte 2003 ein Buch über „Die Leidenschaft des Jägers“, mit z.T. autobiographischen Erzählungen. Er selbst war ein leidenschaftlicher Jäger und Angler, der bereits als 13jähriger bei seinem ersten tödlichen Schuß auf ein Haselhuhn einen Orgasmus bekam: „Seither gehören für mich Jagd und Sex zusammen“. Dieser Doppelschuß, wenn man so sagen darf, machte ihn zum „Mann: glücklich und gierig“. Vor dem offiziellen Erwachsenenstatus steht aber noch eine sadistische „englische Erziehung“: Bei einer Jagd mit Hunden beging Paul Parin als junger Treiber so viele Fehler, dass sein gutsherrlicher Vater ihn von seinem Förster auspeitschen ließ – „auf den blanken Hintern inmitten der Treiberschar. Diese durfte ihn sich gleich anschließend noch einmal im Keller des Landschlosses vornehmen, dabei zogen sie ihn ganz aus. Sein „Papa stand daneben und genoss das Schauspiel“. Anschließend legte sich einer der Burschen nackt neben ihn, „nahm meinen Pimmel in die Hand, steckte ihn in den Mund und fing an zu saugen und mit der Zunge zu streicheln. ,Er will mich trösten‘, dachte ich und drehte mich so, dass ich seinen Pimmel auch zu fassen kriegte, und steckte ihn meinerseits in den Mund. Es war wirklich ein Trost“.
Das war aber noch nicht die eigentliche „Initiation“. Die kam erst mit 17 – als er seinen ersten Bock schoß. Ein Onkel hatte ihn in seine Jagdhütte eingeladen, als Paul Parin oben ankam, bedrängte dieser gerade mit heruntergelassener Hose seine Haushälterin am Kachelofen. „Komm in zehn Minuten wieder“, rief ihm der Onkel zu, „dann sind wir mit Vögeln fertig. Dann sind auch die Mädels da, die ich gemietet hab. Sie sind scharf auf dich, haben sie gesagt“. Abends erzählt der Onkel Jagdgeschichten, danach geht der Bub mit einem der drei Mädchen auf sein Zimmer. Erst läßt sie sich von ihm mehrmals mit der Hand befriedigen, dann holt sie ihm einen runter. Anschließend schläft sie sofort ein, er kann nicht schlafen, stattdessen zieht er sich wieder an, schnappt sich sein Gewehr und geht in den Wald, wo er dann von einem Hochsitz aus einen „starken Bock“ mit Blattschuß erlegt. Beim Frühstück muß er alle Einzelheiten erzählen. Auch das gehörte zum „Ritual“. Seitdem erfaßte ihn „das Jagdfieber immer wieder mit der gleichen Macht wie sexuelles Begehren“.
Das ging auch seinem Jugendfreund so: „Dulli war Jude und zeitlebens dem Jagdfieber verfallen. Von seinem liebsten Jagdkumpan an die deutsche Besatzungsmacht verraten, wurde er Widerstandskämpfer und in der titoistischen Republik Slowenien Minister für Jagd und Fischerei“. Ein „aufgeklärter Mensch jagt nicht“ und auch ein „Jude jagt nicht“ – das sind „gleichermaßen Gesetze abendländischer Ethik. Ich muss mich zu den Ausnahmen zählen“. Aber Paul Parin hat von sich selber und vielen anderen erfahren: „Wenn mein Vater nicht seine Jagd gehabt hätte, wären wir Kinder in der strengen und sterilen Familienatmosphäre erstickt“. Deswegen kann er jetzt eher genuß- als reuevoll z.B. seine Jagd auf eine Gazelle in der Sahara und das Forellenfischen in Alaska – als Sucht – beschreiben.
„Sucht heißt, dass der narzisstische Genuß am Morden mit der Jagd weltweit einen Freibrief hat“. Am Beispiel von Milovan Djilas, leidenschaftlicher Angler, Mitkämpfer und Vertrauter Titos, gibt er jedoch zu bedenken: „Später, als Dichter, wusste Djilas: Keine Ausübung der Macht über das Volk, über die Schwachen bleibt ohne verbrecherische Taten. Wäre es nicht besser gewesen, der eigenen Leidenschaft Raum zu geben und den flinken Forellen nachzustellen…?“
Im Russischen gibt es ein volkstümliches Wort für Jagd und Lust: Ochota. Parins eigene „Jagdleidenschaft“ erlosch bald nach dem 84. Geburstag seiner Frau Goldy, am 30 Mai 1995: „An diesem Tag habe ich im Fluß Soca in Slowenien die größte Forelle meiner Laufbahn gefangen. Anschließend erzählte er seiner Frau, daß er am Fluß einen jungen verwilderten Mann, der ihn beklauen wollte, fesselte – dann hätte er ihn ausgepeitscht bis zum „Flash“, woraufhin sie beide zum Orgasmus gekommen wären. Während Paul Parin diese Geschichte schließlich als eine „Phantasie“ darstellt, ist die Psychoanalytikerin Goldy sich da „nicht so sicher…Kann es sein, dass du nicht nur die Riesenforelle erwischt hast, sondern auch einen Gayboy aus Kärnten?“ Sie einigen sich darauf: „Es könnte so sein oder auch nicht…Gehen wir schlafen“.
In einer Art Nachwort rühmt Christa Wolf Paul Parins „Lebenskunst und Schreibkunst“, diese im richtigen Augenblick kennengelernt zu haben, hält sie für eine „glückliche Fügung“. Mich hat seine „Kunst“ nun eher verwirrt. Während meiner Arbeit als landwirtschaftlicher Betriebshelfer hatte ich oft mit Bauern zu tun, die Jäger bzw. Treiber waren. Und oftmals kam mir das Dorfleben völlig oversexed vor, voller roher Triebe, die mich erstaunten, aber denen gegenüber ich meine eigenen auch als verzärtelt und allzu harmlos empfand. So erfuhr ich z.B. von einer Melkerin, mit der ich in einer LPG bei Babelsberg arbeitete, dass sie beim letzten Fest mit zwei Kollegen angetrunken aufs Feld gegangen wäre, um mit ihnen zu vögeln. Aber statt über sie, die sich bereits nackt hingelegt hätte, dankbar herzufallen, hätten die beiden Nichtsnutze sie bloß angepisst. Solche Schufte gäbe es. Ich war erstaunt, mit welcher Freimütigkeit sie mir das erzählte. Wollte sie mich bloß schockieren?
Nie hätte ich das sündige Dorfleben aber mit der Jagd in Zusammenhang gebracht, obwohl die Männer andauernd und bis ins hohe Alter den Frauen hinterherjagten, wie sie das selber nannten, und ich dabei selbst auch nicht gerade erfolglos war, obwohl mir weder die Jagd auf Wild noch das Angeln Spaß macht: Das eine bereitet mir hernach schlechte Träume oder ein schlechtes Gewissen, das andere langweilt bzw. ekelt mich – im Anbissfall. Zudem waren und sind die Jagdgesellschaften meistens Männerrunden, mit deren Geschichten und Ritualen ich nichts anfangen kann. Als unnützen „Sport der Reichen und Mächtigen“ lehnten selbst „meine“ Bauern die Jagd ab.
Paul Parin ist 1916 auf einem slowenischen Landschloß geboren. Und in seiner Jugend lagen die Worte für Fleisch (viande), Vergewaltigung (viol) und Gewalt (violence) vielleicht noch enger zusammen als es bis heute im Französischen semantisch der Fall ist. Diesen Einbruch der Natur in die Kultur haben wir inzwischen mit der urbanen Trennung des Tieretötens vom Fleischessen vielfach für uns abblockiert, wobei das Morden – Jagen oder Schlachten – ebenfalls hochkultiviert/industrialisiert wurde. Von hier aus stellt sich mir die Lektüre der Jagd-Erzählungen von Paul Parin wie ein gelungener – weil verstörender – Einbruch in meinen psychischen Haushalt dar. Bisher hatte mich die ganze Jägerei – pro und contra – eher kalt gelassen.
In der Zeitschrift „konkret“ hat Klaus Theweleit unlängst den Aspekt des Lustmordens bei den deutschen Vernichtungsfeldzügen in Osteuropa herausgearbeitet, wobei er von Pasolinis Film „Salo oder die 120 Tage von Sodom“ ausging und diese „Transgressionen ins gesellschaftlich Unerlaubte“ als „Parallelhandlungen zum politischen Ermächtigungsgesetz“ bezeichnete. Demnach wäre die Jagd eine „Transgression des Lustmordens ins gesellschaftlich Erlaubte“.

Albrecht Dürer: Melancholie 1 (Illustration für das Cover seiner 1. „Underweysung“?) 1972 veröffentlichte Wolf Lepenies ein Buch mit dem Titel „Melancholie und Gesellschaft“, selbstverständlich geht es darin auch um eine Deutung des Dürerschen Meisterstichs. Ganz anders als beim israelischen „Velikovskyaner“ Zwi Rix, in dessen Aufsätzen – abgedruckt in „Neues Lotes Folum“ 2/4 – die „Melencholia I“ zentraler Gegestand ist. Das Buch von Lepenies wurde kurz vor der Jahrtausendwende noch einmal veröffentlicht: „Mit einer neuen Einleitung: Das Ende der Utopie und die Wiederkehr der Melancholie.“
(3) Es gibt ein ganzes „primitives Volk“ von Jägern und Sammlern in Amazonien, das angeblich das „glücklichste Volk“ überhaupt ist. Die ganze Welt ist dem Geld und der (Zeit-)Logik unterworfen. Aber nicht dieses kleine Volk in Amazonien, mit kaum 400 Menschen, die standhaft geblieben sind: Es nennt sich „Hiaiti’ihi“ (die Aufrechten), Piraha heißen sie bei den Weißen und Wissenschaftlern. Sie führen ein „Leben ohne Zahl und Zeit“, schreibt der Spiegel. Außerdem kennen sie keinen Gott und keine Götter, haben keine Rituale und keinen Besitz. „Hüter der Glücksformel“ werden sie auch genannt, weil der erste Erforscher ihrer Lebensweise und ihrer komplizierten Sprache, der Linguist Dan Everett, sie als „Das glücklichste Volk“ bezeichnete.
Es hütet jedoch kein Geheimnis, sondern eine einfach strukturierte Sprache – mit dem sich die Piraha viel erzählen. Sie siedeln an einem Seitenarm des Amazonas, jagen und angeln und sind mit ihrem Leben überaus zufrieden. so dass sie sich kaum von irgendetwas affizieren lassen. „Die Piraha reden sehr gern. Kaum etwas anderes fällt Besuchern, die ich zu den Piraha bringe, so stark auf wie ihre Neigung, ständig zu reden und gemeinsam zu lachen,“ schreibt der einstige US-Missionar Everett, der während seiner langjährigen Arbeit umgekehrt von ihnen zum Unglauben bekehrt wurde und nun quasi ihr Stammes-Ethnologe ist. Aber ihre „kulturellen Werte“ schränken die „Themen“ ihrer endlosen Unterhaltungen stark ein, meint er. Mit den „Werten“ ist ihr unbedingter Wille zum Sein in „unbegrenzter Gegenwart“ gemeint. Die Piraha kennen weder Vergangenheit noch Zukunft – und akzptieren sie auch nicht. Everett spricht von ihrem „Prinzip des unmittelbaren Erlebens“, dem er viel abgewinnen konnte, nachdem er ihre Sprache gelernt hatte: „Die Piraha sind ganz und gar dem pragmatischen Konzept der praktischen Relevanz verhaftet. Sie glauben nicht an einen Himmel über uns, an eine Hölle unter uns oder irgendeine abstrakte Sache, für die zu sterben sich lohnt. Damit verschaffen sie uns die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie ein Leben ohne absolute Werte, ohne Rechtschaffenheit, Heiligkeit und Sünde aussehen könnte. Das ist eine reizvolle Vision.“
Und weil es bei den Piraha im Prinzip keine höhere Autorität als den Bericht eines Augenzeugen gibt, stoppten einige ältere Männer, die sich mit dem Autor angefreundet hatten, eines Tages auch dessen Missionstätigkeit: „Die Piraha wollen nicht wie Amerikaner leben,“ sagten sie ihm. „Wir trinken gern. Wir lieben nicht nur eine Frau. Wir wollen Jesus nicht – und auch nichts von ihm hören.“
Nach einer Glaubenskrise reifte in dem sich dann bei Noam Chomsky zum Linguisten umschulenden Autor die Erkenntnis: „Ist es möglich, ein Leben ohne die Krücken von Religion und Wahrheit zu führen? Die Piraha machen es uns vor. Sie stellen das Unmittelbare in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit und damit beseitigen sie mit einem Schlag gewaltige Ursachen von Besorgnis, Angst und Verzweiflung, die so viele Menschen in den westlichen Gesellschaften heimsuchen.“
Die stets gegenwärtig bleibenden Piraha sorgen sich nicht. Dabei gäbe es Gründe genug: Sie sterben früh, u.a. an Tropenparasiten und den Krankheiten der Weißen, haben Jagdunfälle und Streitereien mit Nachbarstämmen. Weil die mit Schiffen gelegentlich bei ihnen anlegenden Händler sie bei Tauschgeschäften oft übervorteilen, wollten sie Zählen und Rechnen lernen, aber ihr transzendentaler Präsens verhinderte auch das Denken mit der Abstraktion Zahl. Die Begriffe für „links“ und „rechts“ kennen sie ebenfalls nicht. Und keine Häuptlinge, Rituale, Initiationen, weder Schwüre noch Schmuck, und keine Diskriminierung von Frauen oder Kindern, wenn man den Berichten glauben darf. Ihre Konzentration auf das Wesentliche könnte man mit Friedrich Engels als urkommunistisch bezeichnen, Everett hält die Piraha-Kultur jedoch mitnichten für „primitiv: Vielleicht machen gerade Ängste und Sorgen eine Kultur primitiv und wenn sie fehlen, ist eine Kultur höher entwickelt. Wenn das stimmt, haben die Piraha eine sehr hoch entwickelte Kultur.“ Außerdem kennen sie nicht weniger Begriffe als wir.
Für den Philosophen der Französischen Revolution Kant war die „transzendentale Gegenwart“ allein Gott vorbehalten, dafür war für ihn die „Zeit“ transzendental – d.h. uns allen innerlich mitgegeben. Inzwischen meinen wir schon, dass es sich dabei um eine „substantielle Größe“ handelt, mit der wir immer ökonomischer umgehen können – um z.B. „Quality-Time“ daraus zu machen. Gleichzeitig bestritt die westliche Moderne ihren globalen Siegeszug mit den Zahlen – über Handel, Technik und Ingenieurwissen bis hin zur Kybernetik. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, dass uns dabei die Gegenwart immer mehr abhanden kommt: Wieviele gegenwärtige Gesprächsrunden werden zerstört durch permanente Handyanrufe aus der Zukunft. Wieviele Sehenswürdigkeiten werden statt sie sich genau anzukucken nur schnell photographiert oder gefilmt – für später. Wieviele Anstrengungen unternehmen wir täglich, um uns die Zukunft zu sichern – und sei es nur den Rest der Woche. Zeit ist Geld, heißt es, und Geld ist Zahl. Aber die Entleerung der Gegenwart geht noch weiter.
In seinem Buch „Geistige und körperliche Arbeit“ schreibt der Sozialphilosoph Alfred Sohn-Rethel: „In der Kybernetik verfällt die Funktion der menschlichen Sinnesorgane und operativen Hirntätigkeit selbst der Vergesellschaftung.“ – Während wir zugleich – beginnend mit der Industriearbeiterschaft – atomisiert werden. In der „Wissensgesellschaft“ angekommen haben wir es bald nur noch mit Algorithmen zu tun. Dafür können wir uns dann z.B. abends mit unserem Waschmaschinen-System unterhalten. Horkheimer und Adorno konnten 1944, als die Kybernetik sich gerade aus der Lenkwaffenforschung „befreite“, noch gnädig sein – in ihrer „Dialektik der Aufklärung“ schrieben sie: Die ganze „Wissenschaft rechnet, rechnen ist nicht Denken. Denken entzündet sich am Widerstand. Systembauen ist die Ausräumung des Widerstands im Denken. Bei Mathematikern, Programmierern und Technikern geht das in Ordnung, bei allen anderen ist es eine höhere Form des Schwachsinns.“ Das Ranking z.B. – heute wird sogar das Schwachsinnigste gerankt. Der zur Frankfurter Schule zählende Alfred Sohn-Rethel war in den Siebzigerjahren radikaler: „Wenn es dem Marxismus nicht gelingt, der zeitlosen Wahrheitstheorie der herrschenden naturwissenschaftlichen Erkenntnislehren den Boden zu entziehen, dann ist die Abdankung des Marxismus als Denkstandpunkt eine bloße Frage der Zeit.“ Jahrzehntelang arbeitete er an seinem o.e. Buch darüber, in dem er nachzuweisen versuchte, dass und wie die naturwissenschaftlichen Begriffe „Realabstraktionen“ sind, die auf dem entwickelten Warentausch basieren.
Die Piraha am Maici-Fluß sind trotz gelegentlichem Handel gegen „Realabstraktionen“ anscheinend resistent. Inzwischen leben sie in einem Reservat und auf jeden Piranha kommen vier Diplomanden, zwei Doktoranden und ein Professor. Auch der Staat Brasilien schickt immer mal wieder Komissionen vorbei. Man hat jeden von ihnen schon x-mal photographiert. Zweidimensionalen Bildern können die Piraha übrigens auch nichts abgewinnen. Schon das Selbe wieder zu erkennen fällt ihnen, die alle paar Jahre ihren eigenen Namen ändern, schwer. Sie sind die ersten und vielleicht letzten großen Verweigerer aller „Realabstraktionen“. Bald werden die Touristen kommen, spätestens dann gilt auch für die Piraha das kapitalistische Wertgesetz. „Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent, indem sie es auf abstrakte Größen reduziert,“ schreiben Adorno/Horkheimer. „Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletzt in der Eins, nicht aufgeht; der moderne Positivismus verweist es in die Dichtung. Einheit bleibt die Losung von Parmenides bis auf Russell. Beharrt wird auf der Zerstörung von Göttern und Qualitäten.“ Die Piraha, die überall nur Qualitäten wahrnehmen und statt Götter höchstens dort gelegentlich Erscheinungen sehen – wo wir noch so genau hinkucken können, sind wahrscheinlich als Ewiggegenwärtige dazu verdammt, in Zukunft nur noch eine romantische Idee aus der Vergangenheit zu sein. Eine Ironie des Realen. In seinem Amazonas-Bericht „Traurige Tropen“ hat der Ethnologe Claude Lévy-Strauss das bereits 1955 befürchtet. Als stets Gegenwärtige wird es den Piraha aber wohl in gewisser Weise am Arsch vorbei gehen. Ihre Population hat sich in letzter Zeit sogar vergrößert. Es kann mithin auch anders kommen, dass sie z.B. an einem Institut für Antiamerikanistik zum Nukleus einer widerständigen Linguistik-Gemeinde werden. Bereits jetzt haben sie die „Universalgrammatik“ von Noam Chomsky, die global und genetisch argumentiert, und für uns alle gelten soll, allein durch ihre extravagante Sprache, die laut Everett „in zahlreichen Punkten extrem ungewöhnlich ist und strukturell massiv von anderen, auch ,exotischen‘, Sprachen abweicht“, quasi listig widerlegt, indem sie die kurzen Sätze ihrer Erlebniserzählungen wie Perlen auf eine Kette reihen.
Aber was immer mit den Piraha passieren wird, sie helfen uns – das zu erfassen, was Rousseau den vielfältigen Ursprung unserer Gesellschaft nennt, „der nicht mehr existiert, vielleicht nie existiert hat und wahrscheinlich auch nie existieren wird und von dem wir dennoch richtige Vorstellungen haben müssen, um unseren gegenwärtigen Zustand beurteilen zu können.“ Der Ursprung mag verschüttet sein, die „Vielfältigkeit“ ist es noch nicht (ganz), aber in der jetzigen „amerikanischen Welt“ wird härter denn je daran gearbeitet.
P.S.: Im brasilianischen Bundesstaat Rondonia wurde vor einiger Zeit ein weiteres kleines Volk entdeckt, das auf ewig „im Jetzt lebt“, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb. „Die 150 noch lebenden Amundawa zählen sich im Gegensatz zu den sich als singulär begreifenden Pirahas zu den (Amazonas-) Indianern. Und wenn sie in den dort von der Regierung gegründeten Schulen Portugiesisch lernen, haben sie auch „keinerlei Probleme mehr, Aussagen über Zeitverläufte zu treffen, ebenso lernen sie dann rechnen. In ihrer Sprache können sie nur bis 4 zählen“.
Rechnen: „Vor drei Jahren, kurz bevor ich 78 Jahre alt war und dachte, ich bin am Ende meines Lebens, bin ich am Herzen operiert worden – und jetzt rechne ich damit, dass ich bis 84 Jahre lebe.“ Ruth Klüger, „Überlebende“.

Albrecht Dürer: Schlachtfeld
(4) Stichwort Vendetta – Blutrache: Das neuzeitliche Vorkommen der Blutrache ist in Europa nicht fest an bestimmte Gebiete gebunden. Blutrache und rechtsstaatliche Gesetzgebung sind nicht vereinbar. Migranten aus den Gebieten, in denen Blutrache vorkommt, bringen mit anderen Sitten immer auch ihre Vorstellung von Ehrgefühl mit, so dass es auch in Westeuropa zu verschiedenen Blutrache-Fällen kam. Westliche Gerichte beurteilen diese Selbstjustiz in der Regel als Mord oder Totschlag. Am 1. Juli 2002 kam es bei Überlingen aufgrund mehrerer unglücklicher Faktoren zu einem Flugzeugabsturz. Der zu jener Zeit diensthabende Fluglotse Peter Nielsen wurde am 24. Februar 2004 von Witali Kalojew, der bei dem Unglück Frau und Kinder verlor, erstochen. Kalojew bezeichnete diesen Mord selbst nicht als Blutrache, sondern lediglich als Bestrafung des Fluglotsen. Jedoch wurde er nach seiner Haft in seiner Heimat Nordossetien als Held der Blutrache gefeiert. Heute ist er stellvertretender Bauminister in Nordossetien. (Wikipedia)
Die Berliner Jahresstatistik sprach im Herbst 2012 von 10547 Fällen schwerer und gefährlicher Körperverletzung in der Stadt, die Polizeigewerkschaft dagegen von 36369 Taten. Ihr Sprecher erklärte die Gründe für diese große Zahl: „Weil kaum ein Mensch mehr an das staatliche Gewaltmonopol und den Rechtsstaat glaubt! So wird Faustrecht produziert!“ „Man ist hier bald seines Lebens nicht mehr sicher,“ gaben daraufhin etliche zumeist ältere Bürger in den Hauptstadtmedien zu Protokoll. Der Innensenator ließ verlauten, mit mehr Sicherheitstechnik und -personal werde der Staat versuchen, präventiv tätig zu werden. Was fehlt – ist indes eine Theorie der Gewalt im Postsozialismus.
Vorarbeiten: Für die Vendetta und den Krieg gibt es drei Diskurse. Sie beziehen sich vor allem auf „primitive Gesellschaften“. In ihnen bekriegt sich laut Thomas Hobbes jeder mit jedem („Homo homini lupus“). Der englische Staatstheoretiker belegte das mit Ethnographien über kriegerische Indianer in Nordamerika. Erst in Verträgen mit dem Staat (der Weißen), dem sie damit das Gewaltmonopol übertragen, würden diese Stämme zivilisiert und zu einer Gesellschaft. Zwar wurden die Verträge dann von den Weissen immer wieder gebrochen und die Indianer großenteils ermordet, aber noch heute verfolgt z.B. der brasilianische Staat die selbe Indianerpolitik: „‚Unsere Indianer,‘ so verkünden die Verantwortlichen, ’sind Menschen wie wir alle. Aber das Leben in der Wildnis, das sie in den Wäldern führen, setzt sie Elend und Leid aus. Es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, sich aus ihrer Zwangslage zu befreien. Sie haben ein Recht darauf, sich in den Stand der Würde eines brasilianischen Staatsbürgers zu erheben, um ganz am Fortkommen der einmheimischen Gesellschaft teilzunehmen, und um in den Genuß von deren Annehmlichkeiten zu kommen.“
Als Bürger werden die Indianer wahrscheinlich eher in Favelas dahinvegetieren oder in Drogenkriegen aufgerieben. Auch diese Politik läuft auf das hinaus, wozu sich der US-General Sherman vor gut 100 Jahren verpflichtete – und was dann von Präsident Roosevelt als ein „gerechter Krieg“ bezeichnet wurde: „1862 gab es noch ungefähr 9,5 Mio Büffel in den Plains zwischen Missouri und den Rocky Mountains. Sie sind alle verschwunden, getötet wegen ihre Fleisches, ihrer Haut, ihrer Knochen…Zur selben Zeit fanden sich ungefähr 165.000 Pawnees, Sioux, Cheyennes, Kiowas und Apache, deren Ernährung auf das ganze Jahr gesehen von diesen Büffeln abhing. Auch sie sind verschwunden und ersetzt worden durch das zweifache oder dreifache an Männern und Frauen von weißer Rasse, durch sie wird diese Erde ein Garten, und man kann sie zählen, Steuern von ihnen erheben, und über sie nach den Regeln der Natur und der Zivilisation regieren. Diese Veränderung war nützlich, und ich werde sie bis an ihr Ende durchführen.“
Der französische Ethnologe Pierre Clastres merkte zu diesem Zitat an: „Der General hatte recht. Die Veränderung wird erst dann an ihr Ende kommen, wenn es nichts mehr zu verändern gibt“ (weil auch die letzten Indianer-Spuren getilgt sind). Zu den Diskursen, mit denen kriegerische Kulturen erklärt werden, gehört laut Clastres:
1. der „naturalistische“. Er reicht vom Ethologen Konrad Lorenz („Das sogenannte Böse“) über den Harvardforscher für staatenbildende Insekten Edward O Wilson, der dabei die Soziologie und Ökonomie in „Biologie“ auflöste, bis zum Entdecker der Yanomami (dem „bösesten Indianerstamm“ überhaupt): Napoleon Chagnon. Dieser ebenfalls biologisch argumentierende US-Ethnologe wurde jedoch der schamlosen Übertreibung und der Lüge überführt. Nichtsdestotrotz begreifen auch heute noch viele US-Anthropologen die Gewalt in den Vorstädten und unter nicht-weißen Jugendlichen gerne als genetisch bedingt.
2. Der „ökonomische Diskurs“: Er spricht von der Unterentwicklung der primitiven Techniken des Jagens und Fischens, beim Früchte sammeln, Tiere hüten und mästen. Diese Gesellschaften ohne Staat, ohne Beherrschende und Beherrschte und ohne Privateigentum, können gerade so viel produzieren, dass sie überleben. „Die primitive Ökonomie ist somit eine Ökonomie des Elends.“ So erklären z.B. die US-Anthropologen D.R. Gross und M. Harris die Heftigkeit der Kriege bei den südamerikanischen Indianern mit dem „Eiweißmangel ihrer Ernährung“.
Was die hiesige und heutige Gewalttätigkeit junger Männer betrifft, argumentiert man jedoch auch gerne mit dem Gegenteil: mit der toleranten, dekadent gewordenen Überflußgesellschaft und der daraus resultierenden Langweile bzw. Unterbeschäftigung, die einen Rückfall in primitive Formen der Auseinandersetzung hervorbringt – nicht zu vergessen: die vielen Gewaltfilme, die sich diese Verrohten laufend „reinziehen“.
3. Der Tausch-Diskurs: Begonnen vom Ethnologen Marcel Mauss und fortgeführt von Claude Lévi-Strauss und seinen Schülern. „Tauschhandlungen sind potentielle Kriege, welche auf friedlichem Wege bereits beschlossen sind, und Kriege sind das Ergebnis mißglückter Transaktionen.“ Für Lévi-Strauss beginnt die Geschichte mit Frauenraub und die Kultur mit Frauentausch. „Die primitive Gesellschaft für Hobbes war der Krieg eines jeden gegen jeden. Der Standpunkt von Lévi-Strauss verhält sich spiegelverkehrt dazu: Bei Hobbes blieb der Tausch unberücksichtigt, bei Lévi-Strauss hingegen der Krieg.“ (Pierre Clastres)
Dabei können die kriegerischen Gesellschaften nur durch Bündnisse existieren und diese werden permanent durch immer neue Tauschakte besiegelt (durch Gaben- und nicht Waren-Tauschakte). Ein Bündnis ist kein Vertrag. „Im Rahmen der Bündnisse erhält der Frauentausch eine offenkundig politische Bedeutung. Man schafft sich Verbündete, indem man versucht, sie zu Schwagern zu machen. Der Kriegszustand zwischen den Gruppen macht die Bemühungen ums Bündnis notwendig, und dieser macht den Frauentausch erforderlich.“
So weit Pierre Clastres, dessen Resümee der drei Diskurse lautet: „Die eigentliche Politische Dimension der kriegerischen Tätigkeit hat weder einen bezug zur zoologischen Besonderheit des Menschen noch zum Kampf ums Dasein der Gemeinschaften und auch nicht zu einer vom Tausch ausgehenden unabänderlichen Bewegung hin zur Abschaffung der Gewalt. Der Krieg fügt sich in den Aufbau der primitiven Gesellschaft als solche (auch darin ist er universell), er ist einer ihrer Funktionsweisen.“
Das mindestens habe Hobbes verstanden: „Der Krieg verhindert den Staat, der Staat verhindert den Krieg.“ Das Glück des Kriegers ist sein autonomes Dasein und die soziale Anerkennung seines Stammes. Sein Unglück besteht darin, dass er in aller Regel nicht alt wird und nicht unverletzt bleibt. Dies führe zur Polygynie, habe jedoch auch – z.B. bei den Stämmen des Chaco, u.a. der Gaicuru – dazu geführt, dass die Frauen ihre Krieger zwar heirateten, aber keine Kinder mit ihnen haben wollten. Um dennoch nicht als Stamm zu verschwinden, „war einer der Zwecke des Krieges, die Kinder von anderen gefangen zu nehmen“ – gerne auch von Weissen.
Bei anderen kriegerischen Stämmen führte der Besitz von Pferden dazu, dass sie irgendwann die Landwirtschaft und die Suche nach neuem Weideland aufgaben – und ihre Kriege mehr und mehr „zu Unternehmungen zum Zweck der Plünderung wurden“.
Bei wieder anderen bildete sich langsam eine Kriegerkaste heraus. „Die übrigen Männer ergaben sich zwar ebenfalls dem Krieg, aber sie töteten die Feinde, ohne sie zu skalpieren, sie strebten also nicht nach dem Titel des Kriegers…Die Männer dieser Gesellschaften machen alle, was sie wollen, und sie wissen genau warum.“
Ein berühmter Schamane, dessen Körper von Narben übersät war, erklärte Pierre Clastres, er habe seine Feinde niemals skalpiert, „weil es zu gefährlich war, ich wollte nicht sterben“ – wie die Skalp-Krieger, die diesen Weg gehen müssen.
Noch im „gerechten Krieg“ der Sowjets zur Verteidigung der Heimat gegen die deutschen Unterdrücker kam es zu solchen Fällen. Immer wieder wurde der zwar heldische aber geradezu verwerfliche, weil überflüssige „Mut“ einzelner Rotamisten, der zu ihrem Tod führte, von Offizieren kritisiert. Allein in Wassili Grossmans „Kriegstagebuch“ werden mehrere zitiert.
Der Philosoph Michel Foucault kam 1976 in seiner Vorlesung auf die „germanischen Krieger“ und deren „Freiheit“ zu sprechen: „Die Freiheit, die die germanischen Krieger genießen,“ so sagte er „ist wesentlich eine egoistische Freiheit, eine der Gier, der Lust auf Schlachten, der Lust auf Eroberung und Raubzüge.Sie ist alles andere als eine Freiheit des Respekts, sie ist eine Freiheit der Wildheit…Und so beginnt dieses berühmte große Porträt vom ‚Barbaren‘, wie man es bis zum Ende des 19.Jahrhunderts und natürlich bei Nietzsche finden wird – den die Nationalsozialisten dann zu ihrem biopolitischen Vordenker erklärten.“ Wobei ihre „Transformation“ aus der „Absicht der Befreiung die Sorge um [rassische] Reinheit werden läßt.“
Man kann nicht autonomer Krieger sein, „ursprünglicher Individualist“, und gleichzeitig einem Staat dienen, erst recht nicht einem Führer Gehorsam geloben. Der Anarchoethnologe Pierre Clastres hat im Wechsel seines Interesses vom Tausch zum Krieg – bei der Erforschung u.a. der Guayaki-Indianer Paraguays – „mit seinem Lehrer Claude Lévi-Strauss gebrochen,“ wie der diaphanes-verlag in dem Aufsatzband von Clastres „Archäologie der Gewalt“ schreibt, „und dann zeitweise eng mit Deleuze und Guattari zusammengearbeitet.“
Diese beiden Theoretiker haben 1972 in ihrem für die linke Bewegung und Organisationsdebatte noch immer wichtigen Buch „Anti-Ödipus“ auch das „Bündnis“-Problem thematisiert – im Rahmen eines politischen Konzepts von Werden: „Das Werden gehört immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Es kommt durch Bündnisse zustande…Werden besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren. Werden ist ein Verb, das eine eigene Konsistenz hat; es läßt sich auf nichts zurückführen und führt uns weder dahin, ‚zu scheinen‘ noch ‚zu sein‘. Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht. So wie beim Vampir– der sich ja auch nicht fortpflanzt, sondern ansteckt.“
Für Deleuze/Guattari „gibt es ebensoviele Geschlechter wie Terme im Bündnis, ebensoviele Differenzen wie Elemente, die bei einem Ansteckungsprozeß mitwirken.“ In diesem Zusammenhang betonen sie, dass es sich beim Werden immer um ein Plural handelt – also um aus Bündnissen hervorgegangene Schwärme, Meuten, Banden. „Das Werden ist eine Metamorphose und keine Metapher!“ Dabei geht es darum, neue Existenzweisen zu erfinden, die geeignet sind, der Macht zu widerstehen und sich ihrem Wissen zu entziehen.

A.Dürer: Ritter, Tod und Teufel




