
Die Zoobühne in Berlin

Der Filmesel „Balthazar“
In der ersten Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift „Tierstudien“ macht sich der Dramaturg Maximilian Haas Gedanken darüber, was das Lachen des Publikums über Tiere auf einer Theaterbühne bedeutet. Er hatte 2011 in Amsterdam zusammen mit dem belgischen Performancekünstler David Weber-Krebs das Stück „Balthazar“ aufgeführt, in dem ein Esel namens Balthazar neben fünf Schauspielern die Hauptrolle spielt. Inspiriert wurde das Projekt von Robert Bressons berühmten Film „Au hasard Balthazar“ (1966), in dem es um das traurige Leben und den einsamen Tod eines Esels geht – eine „schicksalhafte Abwärtsspirale“ laut Maximilian Haas.
Erst bei der Premiere stellte sich heraus, dass sie eine Komödie inszeniert hatten – mit dem völlig untheatralischen Esel. In dem Lachen des Publikums über das Tier lag „gleichermaßen eine Quelle der Lust wie ein Gewaltpotential.“

Theaterschwäne
In Paris hatte Anfang des Jahres das Tanztheaterstück „Cygne“ der Gruppe „Le Guetteur“ Premiere, in dem neun Schwäne, die nach dem Schlüpfen auf den Regisseur Luc Petton geprägt wurden, mitspielten. Danach trat das Ensemble in Düsseldorf auf, wo es die Tierschützer auf den Plan rief.

Schwan auf Bühnennest
In Richard Wagners Oper „Lohengrin“ in der Inszenierung von Frank Hilbrich am Theater Freiburg stand ein lebender Schwan auf der Bühne. In einer Vorstellung flog er davon – und landete im Orchestergraben. Bei dem Schwan handelte es sich um eine Gans, die danach nicht mehr eingesetzt wurde. Es ging dem Regisseur in der Szene um eine „Metapher der Mystik und Hoffnung“, wobei der Schwan/Ganter die „spektakuläre Möglichkeit“ bot, dies darzustellen.

Ein Hengst auf der Volksbühne
Tierschützer klagten, dem Hengst in der Inszenierung „Stadt der Frauen“ (nach dem gleichnamigen Fellini-Film) seien Drogen verabreicht worden, damit ihm sein Gemächt möglichst groß und dekorativ zwischen den Beinen hängt. Im Naturzustand würde ein Pferd nie so aussehen. Die Volksbühne wies das als Quatsch zurück.
Wahr ist jedoch: In der Volksbühne läßt der Intendant Frank Castorp schon lange Tiere mitspielen – allerdings in einer Mischung aus quasi natürlichen Verhalten und andressiertem. Angeliefert werden sie von Bernd Wilhelm, der alle möglichen Tiere auf seinem Hof hält. Die meisten landeten nach einer „Leidensgeschichte“ bei ihm, und sie müssen nicht auftreten, wenn sie nicht wollen. Herr Wilhelm lehnt Aufträge, bei denen sie „schwierige Sachen“ machen sollen, ab. Einmal buchte die Volksbühne seinen Hengst, damit der auf der Bühne mit herabhängendem Gemächt von den Schauspielerinnen bewundert, auf und ab gehe. Als das nicht klappte, schlug Wilhelm vor, ihm einen Plastikpenis umzubinden. Das fand Chefdramaturg Lilienthal jedoch zu unnaturalistisch, er schlug stattdessen eine „leichte Narkose“ vor (dabei hängt das Gemächt unwillkürlich herunter). Bernd Wilhelm fand diese Forderung unannehmbar und lehnte ab. Weniger Probleme gab es mit seinem Esel Max- während dessen wochenlanges Engagement am Gorki-Theater. Wilhelms Ziegen tritt regelmäßig bei „Porgy und Bess“ auf, wenn das US-Musical in Berlin gastiert, daneben aber auch in Castorps „Weber“-Inszenierung. Alle ihre Einsätze werden von Tierschützern vor und hinter der Bühne kritisch verfolgt.

Wolf auf Bühne
In Düsseldorf wurde ein Gastspiel der französischen Choreografin Coraline Lamaison mit lebenden Wölfen nach heftigen Protesten von Tierschützern abgesagt. In dem Stück „Narcisses“ im Tanzhaus NRW sollten zwei Tiere mitwirken. Der Tanzhaus-Intendant Bertram Müller entschied sich nach „gründlicher Prüfung aller rechtlichen, künstlerischen und ethischen Argumente“ gegen den geplanten fünfminütigen Auftritt der dressierten Wölfe. „Auch das Düsseldorfer Veterinäramt habe deutlich gemacht, dass es keine Genehmigung erteilen werde, sagte Müller. Der Tierschutz in Deutschland habe strengere Regeln als in Frankreich, wo Lamaison mit ihren dressierten Wölfen bereits mehrmals aufgetreten ist.“ (Die Welt)

Coyote mit Künstler in Galerie
„Die Aktion von Joseph Beuys ,,Coyote; I like America and America likes me„ fand im Mai 1974 in der New Yorker Galerie René Block statt und dauerte vier Tage. Schon Beuys` Ankunft in Amerika war Teil der Inszenierung: vom New Yorker Flughafen wurde er – komplett in Filz gewickelt – von einem Krankenwagen zur Galerie gefahren. In einem separaten Raum erwartete ihn ,,Little John„, ein waschechter amerikanischer Kojote. Beuys verbrachte drei Tage und drei Nächte mit dem Tier, er ordnete Filzbahnen, stapelte täglich die neueste Ausgabe des Wall Street Journal, war ausgerüstet mit Handschuhen, Spazierstock, und einer Triangel, gelegentlich zerrissen Turbinengeräusche die Stille. Innerhalb dieser 72 Stunden nahm Beuys Kontakt zum Kojoten auf. Anfangs verunsichert und aggressiv, gewöhnte sich das Tier bald an den Künstler, es schlief auf den Filzbahnen, die es zuvor attackiert hatte. Beuys legte sich auf das Strohlager des Präriewolfes. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier wurde immer inniger. Schließlich hieß es Abschied nehmen. Beuys drückte ,,Little John„ zärtlich an sich und verstreute das Stroh im Raum. Die Prozedur des ,,Krankentransportes„ wiederholte sich, so dass Beuys nichts von New York gesehen hatte als eben diesen Raum mit dem Kojoten. Er erläuterte später, er habe sich ganz auf den Kojoten konzentrieren, sich isolieren und nichts von Amerika sehen wollen als das Tier. Über den Präriewolf äußerte er, dieses den Weißen verhasste Tier könne auch wie ein Engel angesehen werden.“ (Tamara Tolnai)

Fräulein Brehm Performance mit ausgestopften Tieren
Worum geht es in diesem Projekt?
Die reizende Protagonistin Fräulein Brehm hat sich das Kostüm der Wissenschaft übergestreift und zeigt als Naturbotschafterin sondergleichen ein lebhaftes und doch fundiertes Theatertreiben zu Erstaunlichkeiten über heimische, Tierarten.
Ihr nächstes Stück soll von Fräuleins König der Tiere, Lumbricus terrestris, dem wilden Regenwurm handeln, der ist maßgeblich für die Gestaltung der Erdoberfläche verantwortlich, ein unterirdischer Kreator der Extraklasse.
In ihren bisherigen Stücken ging es um Wolf, Bär, Luchs und Wildkatze, nun sollen diese Pelzträger ihren Beitrag dazu leisten, die Aufmerksamkeit von Homo sapiens auf die Arten zu lenken, die wir nicht für Kuscheltiere halten, die für unser aller Wohlergehen jedoch ausschlaggebend sind, Regenwurm, Ameise und Wildbiene. Den Anfang macht der Wolf, mit den wirklich exklusiven Dankeschöns für den Regenwurm.
In einer mitreißenden Multimediaaufführung wird Fräulein Brehm von ihren Beobachtungen, Erkenntnissen und Begegnungen in freier Wildregenwurmbahn erzählen.
Fräulein Brehms Tierleben verflechtet handfeste Wissenschaft, praktische Feldforschung und tiefe Einblicke in tierische Zusammenhänge zu einem theatralischen Ganzen. Jedes der Theaterstücke wird mit neuesten Forschungsergebnissen versehen und laufend aktualisiert. Die Schauspielerin und Regisseurin Barbara Geiger wird das Manuskript aus ihren intensiven Recherchen heraus entwickeln. Dafür stattet sie den Tieren selbst so einige Besuche ab, durchstöbert wissensdürstend die naturhistorischen Archive und Bibliotheken, lauscht den Erfahrungsberichten der Feldbiologen, und es hält sich ihre eigene Regenwurmfamilie um daraus bühnenreifen Schlüsse zu ziehen. Aus all den Erkenntnissen wird sie ein Wissenspaket schnüren, das die Muskelprotze von bisher unbekannter Seite zeigt.
Bei Fräulein Brehms Tierleben darf angefasst, geschnuppert, geschmeckt und begriffen werden!
Im neuen Stück treten zum ersten Mal richtige, lebendige Regenwürmer auf, Lumbricus terrestris, live onstage!
Die Vorstellung wird zu einer sinnlichen Reise, zum erlebnisreichen Abenteuer durch die faszinierende Naturgeschichte.
Im Zusammenklang von Theater und Biologie wird Fräulein Brehms Tierleben auf leichtfüßige Art und Weise ein Bewusstsein für unsere Umwelt schaffen. Das Fräulein pflanzt mit der Wahrhaftigkeit ihrer Schilderungen und dem Verständnis für biologische Zusammenhänge den Keim für ein ökologisches Weiterdenken. Alles das unter dem wachsamen Auge der Wissenschaftler, die alle Programme begleiten.
Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
Die großen Ziele sind, jedes Jahr drei Tierarten auf die Bühne zu bringen bis alle zehn Bände Brehms Thierleben geschafft sind – uff und Gloria!
Das nächste Ziel ist, das Verfassen von Lumbricus terrstris – Der Regenwurm zu stemmen, dafür brauchen wir Eure Unterstützung, denn es muß viel geforscht und begriffen werden, bevor wir den Erdwurm auf die Bühne bringen können!
Jede Tierart soll dran kommen, es gibt keine Lieblingstiere beim Fräulein, alle sind fräuleinmalig! Nachdem 2012 Bär, Luchs, Wolf und Wildkatze den Anfang machten, wird 2013 das Trio Infernale: Regenwurm, Ameise und Wildbiene das Fräuleinrepertoire erweitern.
2014 sollen Rauchschwalbe, Schwarzstorch und Rotmilan folgen. Fräulein und ihr Team gehen in die Luft. Und nicht nur das, wir schauen auch genau nach, was, wo und wie Heimat ist. Wo sind Zugvögel zuhause? Wo ist der Mensch daheim? Da geht es ganz klar auch um Evolution und philosophische Fragen. Und wie immer geht das alles nur mit engem Kontakt zu Feldforschern vor Ort. Gut so! Das wird spannend.
Das nächste Tier, um das es gehen wird, ist also Lumbricus Terrestris – Der Regenwurm. Der Regenwurm und seine Kollegen haben maßgeblich zur Gestaltung des Erdreichs beigetragen und wenn wir nicht aufpassen, ist das mit der Erdoberfläche nicht mehr weit her, denn die wird gerade so richtig weggefressen z.B. von industrieller Landwirtschaft. Und wenn Erde erst einmal weg ist, kommt sie auch nicht so schnell wieder, dann gibt es nur noch blanke Felsen oder Wüste! Und was machen wir dann?
Keine Erde, kein Regenwurm, keine Kartoffeln auf dem Teller,… so einfach ist das – gut, so einfach ist das nicht. Aber bitte schön, wer mehr wissen will, kann entweder 2000 Seiten Weltagrarbericht lesen – autsch! – oder ab März 2013 eine Vorstellung von Fräulein Brehms Tierleben Lumbricus Terrestris – Der Regenwurm besuchen.
Nach dem Regenwurm steht als Vertreterin der Wildbienen Die Große Erdhummel – Bombus magnus auf der Fräuleinliste, weil sie wunderschön, geradezu umwerfend barock ist, jeder Balkon, jeder Garten mit vielen Blühpflanzen von ihr kostenlos besucht wird und sie auf der Liste gefährdeter Tierarten steht.
Und weil sie als Wildbiene keine Lobby hat, hält das Fräulein ihr die Fahne hoch.
Dann kommt die Rote Waldameise dran und dann und dann und dann!
Ja, das ist nur der Anfang. Immerhin stehen insgesamt zehn Bände von Brehms Thierleben auf dem Programm.
Im Februar 2013 wird von Barbara Geiger ein Runder Tisch einberufen, zu dem Experten aus den Bereichen Biologie, Agrarökonomie und Umweltschutz geladen sind. Und sie kommen, um Ihr Wissen mit dem Fräulein zu teilen: Benedikt Haerlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Michael Spielmann von der Deutsche Umwelthilfe, Sepp Braun, Biobauer aus Freising und viele mehr. Moderiert wird das Gespräch von Barbara Geiger, Initiatorin des Fräulein-Projekts. Hier sollen die Visionen der Fachleute auf den Tisch kommen, geschützt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um daraus die Essenzen für praktische Lösungen und theatralische Verwerkungen zu ersinnen.
aus: http://www.startnext.de/fraeulein-brehms-tierleben

Schimpanse im Tarzan-Film
In dem Buch „Ich, Cheeta“ von James Lever (2008) geht es um das Leben dieses Filmaffen. Im Zusammenhang mit einer Erwähnung von Jane Goodall erinnert Cheeta/Lever in dieser „Autobiographie“ an eine Hilfsorganisation, die gegen den Mißbrauch von (wilden) Tieren in (Hollywood-) Filmen kämpft: „Vergeßt nicht diese Website: www.noreelapes.irgendwas.“ (Seite 170).
Diese Internetseite postete am 6.12. 2005:
Incredible SHORT Film on Hollywood’s Use of Great Apes in „Entertainment“: No Reel Apes Campaign
This is a great use of technology to provide a glimpse into the use of Great Apes in „entertainment.“ For those who laugh at parading chimps, etc., perhaps you owe it to the truth to at least look into this issue. It’s always amazed me anyway how humans laugh when seeing chimpanzees dressed up, etc. Seems we’d have more sympathy to a very close relative. (Note: those from Kansas or other „creationists“ don’t bother emailing me. I’ve studied biology, anatomy, physiology, chemistry, and physical, cultural anthropology. There’s no doubt that we are VERY closely related to chimpanzees. Don’t be an idiot and deny this. Just take a look at them! If you don’t see shocking similarities, then you’re an idiot. Period.)
More information on this issue can be found through the Chimpanzee Collaboratory at:
www.chimpcollaboratory.org
Read on and visit the movie link. From another group:
With Peter Jackson’s remake of King Kong hitting theaters this month, check
out our spoof of the movie and Hollywood’s use of great apes in
entertainment [www.chimpcollaboratory.org/kk.htm]
It’s part of the No Reel Apes campaign to end the use of great apes in
entertainment. King Kong used no real apes, but most people don’t know the
trauma and mistreatment young chimpanzees and other great apes suffer in
other productions, or that many spend the next 50 or more years in
deplorable conditions.
That’s why animal advocates (Dr. Jane Goodall, the Doris Day Animal
Foundation, The Humane Society of the United States, etc.) and Hollywood
professionals (Pamela Anderson, Daryl Hannah, etc.) are challenging the
Motion Picture Association of America to make great movies without great
apes. Below is a list of others joining our challenge.
Please forward this email on to your friends, colleagues and family, and
visit the No Reel Apes web page at www.noreelapes.org.
Thanks!
Dr. Jane Goodall
Doris Day Animal Foundation
The Humane Society of the United States
Dian Fossey Gorilla Fund
The Center for Captive Chimpanzee Care
Chimpanzee and Human Communication Institute
American Zoo and Aquarium Association
Animal Legal Defense Fund
The Arcus Foundation
Animal Welfare Institute
Born Free USA
Great Ape Project
Lord Stratford, House of Lords
Richard Wrangham, Ph.D., Professor of Biological Anthropology (Harvard
University)
Peter Singer, Ira W. DeCamp Professor of Bioethics (Princeton University)
Daryl Hannah, Actor and activist
Pamela Anderson, Actor
Ed Begley, Jr., Actor
Wendie Malick, Actor and activist
Amy Smart, Actor and activist
Frances Fisher, Actor
Patrick McDonnell, „Mutts“ Comic strip
Tippi Hedren, Actor, President/Founder (The Roar Foundation)
Tony Gardner, Alterian Studios
Debbie Levin
Patie Maloney
Virginia McKenna, Actor, conservationist, campaigner
Rachel Hunter, Actor and model
Bill Jemas, 360ep – Entertainment Property Management
Sarah Baeckler
Coordinator
Chimpanzee Collaboratory
c/o Suite 100
227 Massachusetts Ave NE
Washington, DC 20002
www.chimpcollaboratory.org
sarah@chimpcollaboratory.org
Auf der Website von „chimpcollaboratory“ heißt es:
The Chimpanzee Collaboratory is a collaborative project of attorneys, scientists and public policy experts working to make significant and measurable progress in protecting the lives and establishing the legal rights of chimpanzees.
Please click here to learn more about how great ape „actors“ are treated
and how you can help.
„The trainers physically abuse the chimpanzees for various reasons, but often for no reason at all.“
Der Animal Legal Defense Fund meldete am 16. Dezember 2005:
Next week marks the release of Peter Jackson’s remake of the movie classic „King Kong.“ The Oscar-winning director used no real apes in the production, showing that cutting-edge filmmaking doesn’t involve cruelty to animals.
The Animal Legal Defense Fund and its partners in the Chimpanzee Collaboratory – including Dr. Jane Goodall and the Doris Day Animal Foundation – are working with humane organizations and Hollywood professionals like Pamela Anderson and Daryl Hannah to challenge the Motion Picture Association of America (MPAA) to make great movies without great apes.
ALDF signed on to an open letter sent to MPAA President Dan Glickman on December 5, urging him to call for an end to the use of great apes in movies and entertainment.
Check out this flash film spoof on Hollywood’s use of great apes, part of the “No Reel Apes” campaign to end the use of great apes in entertainment.
Most people don’t know the trauma and mistreatment young chimpanzees and other great apes suffer in the name of entertainment. Apes used in film and television are taken from their mothers when they are just babies, and the developmental damage they suffer is long lasting. By the age of eight, when chimpanzees become stronger and more independent, industry trainers struggle to dominate these natural behaviors, and apes become of no use and are “retired.” Most spend the rest of their lives—50 or more years—in pathetic roadside zoos and other substandard facilities.
What You Can Do
Send a polite letter to MPAA President Dan Glickman asking for an end to the use of great apes in Hollywood. As a leader in the entertainment community, he has the power to help our closest living relatives. Remind him that baby apes are taken from their mothers at an early age, forced to endure brutal training methods, and then often end up in horrible conditions at substandard facilities.
Contact Dan Glickman at:
15503 Ventura Blvd
Encino, CA 91436
818-995-6600
dglickman@mpaa.org

Gorilla mit Grzimek im Fernsehen auf Briefmarke
Einige berühmt gewordene „Tierdarsteller“ haben es in Hollywood bereits zu eigenen Trainern, Psychologen, Entertainern, Diätberatern und Managern gebracht, wobei es daneben auch immer mehr Tierfarmen gibt, die sich auf die Ausbildung seltener oder als besonders intelligent geltender Tiere für Film und Fernsehen spezialisiert haben. Mit einiger Verzögerung gibt es so etwas inzwischen auch in Deutschland. Den Tiertrainern gesellten sich die Vermittlungsagenturen zu.
Den Anfang machte die Borsig-Sekretärin Rosemarie Fieting, indem sie sich 1987 im Märkischen Viertel mit einer Künstleragentur für Look-Alikes und Tiere selbständig machte. Diese war dann die erste mit einer Lizenz der Bundesanstalt für Arbeit. Schon als Fünfjährige sah Rosemarie Fieting Liz Taylor ähnlich, so daß sie oft Liz genannt wurde: „Doppelgängerauftritte waren damals noch neu. Ich habe mir langsam einen Bestand aufgebaut: Mit einem Elvis allein kann man das nicht machen.“ Heute hat sie rund 35 Elvis- Interpreten in ihrer Kartei. Mit unterschiedlichen Tanz- und Gesangsqualitäten. Und dann bestitzt sie mehrere Pudel: „Ohne Mann könnte ich leben, aber nicht ohne Tiere!“ Im Prinzip kann „die Fieting“ inzwischen jeden und alles besorgen: Prinz Charles, Gorbatschow, Humphrey Bogart, Otto, oder eine Giraffe, die jemandem im zweiten Stockwerk durchs Fenster mit einem Blumenstrauß zum Geburtstag gratuliert. Einen Elefanten, der die Leute mit Schaum rasiert: „Das haben sie einem Bürgermeister mal zum Jubiläum geschenkt.“Aber auch einen Mann, der aussieht „wie eine Dogge“.
Manche Aufträge erfordern Erfindergeist: Einmal wurden zum Beispiel zwei Goldfische verlangt, die miteinander reden sollten. Frau Fieting nahm ihre eigenen und trennte sie mit einer Glasscheibe im Becken. Sofort schwammen sie von beiden Seiten gegen die Scheibe, wobei sie ihre Mäuler auf- und zumachten: „Es sah einer Unterhaltung täuschend ähnlich.“ Mitunter rufen auch komische Leute an, die wollen beispielsweise eine Doppelgängerin von ihrer Frau: „So was kann man doch nicht in der Kartei haben. Aus New York kam gerade ein Fax: Die wollten einen ,präzisen BMW-Fahrer‘ für einen Dreh in Polen. Was heißt nun ,präzise‘?“ Eine Firma in Los Angeles verlangte neulich auf die Schnelle einen „Hitler“, meldete sich dann aber nicht wieder. Frau Fieting hat Hitler gleich dreimal im Angebot, aber dafür nur einen Papst. Ihre „Pamela Anderson“, mit der sie gerade auf „Baywatch“-Discotournee ging und die laut Bild dieselben Hobbys wie die echte hat, ist gerade furchtbar verzweifelt, weil sich in Hollywood plötzlich alle Frauen ihre Brüste vergrößern lassen und sie das eigentlich nicht will. Rosemarie Fieting bestärkt sie darin: „Deine Stärke sind die Haare und der Mund, du wirst dir doch nicht deinen schönen Busen aufschneiden lassen, habe ich zu ihr gesagt.“
Die Fietingschen Simulations- Künstler beschränken sich nicht darauf, nur ihr Vorbild zu sein, sie wollen auch von allen anderen als solche behandelt werden: „Anstrengend! Meine ,Queen‘ ging so weit, daß sie einem Bürgermeister nicht die Hand geben wollte: ,Das steht nicht im Protokoll‘, hat sie gesagt. Von den ,Marilyns‘ hat sich eine sogar mal umgebracht – und zwar genauso wie die Monroe.“ Der Erfolg ihrer und ähnlicher Agentur deutet auf ein soziales Phänomen hin – das ist die zunehmende Verbreitung von Doppelgängern, die keineswegs bloß eine Sache gesteigerter Nachfrage ist. Sie scheint mit dem vom englischen Botaniker Rupert Sheldrake medientheoretisch begriffenen „morphogenetischen Feld“ erklärbar zu sein: Immaterielle Strukturen, die bei Lebewesen und sogar bei Kristallen qua Resonanz formbildend wirken. Danach würden die Stars und Prominenten über die Medien in ihrem jeweiligen kulturellen Epizentrum die größte „Wirkung auf Distanz“ erzielen – das heißt, die größte Anzahl von Lookalikes via Massenmedium erzeugen. Und damit wiederum ließen sich – über ihre geographische Verteilung – quasi Zonen medialer Beeinflussung ausmachen, die im „Globalen Dorf“ zwar weit reichen können, aber nicht beliebig sind. Es gibt zum Beispiel vier „Queens“, drei kommen aus London, wo die Königsfamilie anscheinend noch eine starke Vorbildfunktion besitzt.
Rosemarie Fieting hat ferner dreimal „Lady Di“ im Angebot: zwei kommen ebenfalls aus England, eine aus dem englischen Sektor Berlins. „Sie sagt immer: ,Ick bin aus Brighton!'“ Ihre „Marlene Dietrich“ kommt aus Berlin und „George Bush“ aus Amerika, „Linda Evans“ stammt aus Frankfurt- Bockenheim, und ihr äußerst gelungenes Otto-Double – natürlich aus Ostfriesland. Er ist dort Kinovorführer. Bei der steigenden Zahl ihrer Tieraufträge hat Frau Fieting erst einmal mit den „schwierigen“ Besitzern zu tun, die oft besondere Bedingungen stellen. Bei einer Katze, die für 200 Euro im Prenzlauer Berg in einem FU-Lehrfilm mitspielen sollte, waren das zum Beispiel „keine Scheinwerfer, keine Zugluft, keine Straßenszenen“. Alle paar Tage kommt inzwischen jemand mit seinem Tier zu ihr in die Agentur: eine alte Frau mit ihrem Wellensittich, der angeblich „perfekt spricht“, eine Punkerin mit einer weißen Ratte, die „überdurchschnittlich intelligent“ ist oder alleinstehende Männer, deren Hund oder Katze „besonders photogen“ ist bzw. „auch schwierigste Aufgaben bzw. Szenen meistert“.
Nicht selten handelt es sich bei diesen Tierbesitzern um halbe Menschenfeinde, die dafür um so besser mit Tieren umgehen können, zu denen sie eine bisweilen an Sodomie, aber auch an Verhaltensforschung grenzende Beziehung entwickelt haben. Ähnliches gilt für manchen Besitzer von Kakteen oder Bambus, nur dass diese nicht zu Rosemarie Fieting in die Künstleragentur kommen. Dafür hat sie es immer öfter mit Leuten zu tun, die so „medienbewußt“ sind, dass sie ihre Tiere bewußt für den Einsatz in Medien trainieren. Einige leben bereits von solchen Auftritten – drei seien genannt:
Einmal das in Hoppegarten lebende Ehepaar Ralf und Manuela Grabo. In ihrer ausgebauten Scheune und mehreren Volieren im Garten halten sie vier Hühner, drei Greifvögel, einen Kolkraben und zwei Pferde. In zwei Terrarienim Haus leben fünf Riesenschlangen und in einem Aquarium etliche Fische. Ralf Grabo war früher Jockey und arbeitete dann im Tierpark (Abt. Raubtierhaus), Manuela Grabo hat, als gelernte Tischlerin, früher nie was mit Tieren zu tun gehabt. Sie fand jedoch Schlangen „schon immer schön, mein Liebling aber ist der Uhu“. Dieser sowie die anderen Greifvögel wurden zu DDR-Zeiten aus Nachzuchten erworben, teilweise über befreundete Falkner. Über den Heimtierpark Thale fanden die Grabos 1995 ihren Kolkraben „Kolja“, der schon seinen Namen sowie „Hollo“ sagt, außerdem kann er bellen und gackern. Ihre Nebelkrähe spielte in einem neudeutschen Film, der im Knast Rummelsburg gedreht wurde, mit sowie in einem phantastischen US-Film – auf einem See in der Sächsischen Schweiz, wo sie auf dem Rand eines im Wasser schwimmenden großen Schuhs entlangzugehen hatte: „Die tat das, als hätte sie nie etwas anderes gelernt.“ Auch die Zumutung, mit einem fremden Hund zusammen einen überfahrenen Hasen an der Landstraße zu verspeisen, absolvierte sie mit Bravour: „In die Kamera fliegen mußte sie dann auch noch, und dann hatte die Filmproduktion auch noch nicht mal Geld dafür.“
Die ledige Honorarfrage: „Das sind Aufwandsentschädigungen, die nicht einmal den Unterhalt der Tiere decken.“ Eines der Graboschen Hühner spielte – für ein Trinkgeld – in einem Kinderfilm mit: auf einem schwankenden Oderkahn. „Auch das hat gut geklappt, mit der Zeit werden wir ja sowieso alle, wie soll ich sagen: professioneller.“ Neulich brauchte RTL eine Schlange, die sich kurz um einen beleuchteten Globus windet: Grabos Boa schaffte es, ohne daß Styropor-Stückchen als Stützen auf die Kugel geklebt werden mußten. Bei einer anderen Dreharbeit traf Ralf Grabo auf den amerikanischen Vogeltrainer, der einst mit Hitchcocks „Vögeln“ (1 und 2) gearbeitet hatte – er bat ihn sofort um ein Autogramm: „So jemand ist für mich natürlich interessanter als irgendso ein Star.“ Mit Greifvögeln darf man laut des nun auch im Osten geltenden Bundestierschutzgesetzes nur beschränkt kommerziell auftreten. Grabos Bussard trat neulich in einem Stück von Johann Kresnik auf: Er saß auf dem ausgestreckten Arm einer schwangeren Schauspielerin. Obwohl der Bussard kaum Probleme mit dieser Rolle hatte, durfte er dann nicht mit auf ein Gastspiel der Volksbühne nach Belgrad: „Die Behörden wollten es nicht genehmigen. Serbien gehöre nicht zur EU und so weiter.“ Wegen solcher oder ähnlicher Restriktionen nehmen die Filmproduktionen meist gleich einen Falkner vor Ort in Anspruch oder hier einen Vogel der Adlerwarte im Teutoburger Wald.
Und dann haben die Grabos auch noch zunehmend mit politisch korrekten Jungjournalisten zu kämpfen, die – wie tip-TV jüngst – immer wieder gerne Reportagen über falschverstandene Tierliebe beim Halten seltener Tiere in urgemütlichen 3-Zimmer-Wohnungen senden: „Solche Tiere gehören in den Urwald!“ Manuela Grabo meint: „Eigentlich haben wir einen ganz schweren Stand in dieser Gesellschaft, wir sind eine Randgruppe. Und wie die Behörden mit uns umgehen, das grenzt mitunter schon an Schikane.“ Mit einigen Schlangen veranstaltet sie regelmäßig „Patientenabende“ in Reha-Kliniken: „Das hat sich so aufgebaut“, wobei sie kein „Zirkusspektakel“ veranstaltet, sondern primär „Aufklärung“ leistet. Auch ihre Schlangen kommen nicht aus dem Urwald, sondern aus der DDR. Eine wirkte neulich in einer TV-Dokumentation über verbotenen Tierhandel mit, wo sie auf dem Schwanebecker Zollhof in einer Voliere eine beschlagnahmte Python zu mimen hatte, die sich auf einem Ast zusammenringelt und noch ganz benommen ist von der ganzen. Schmuggeltour: Es klappte auf Anhieb.
Die Berliner Volksbühne ist inzwischen bekannt dafür, dass sie in ihren Stücken oft und gerne Tiere einsetzt: Hunde, Pferde und ganze Ziegenherden. Die meisten Tiere engagieren sie von (und mit) Bernd Wilhelm. Bis vor kurzem lebte er in einem Kleingewerbegebiet in Spandau. Der gelernte Tierpfleger arbeitete früher in den Tierversuchslabors der FU. Nach einer Infektion wurde er Frührentner. „Schon immer“ hatte er sich privat Tiere gehalten – die überdies gerne irgendwelche „Dummheiten“ machten. Mit den Jahren entstand daraus eine ebenso eigenwillige wie freundliche Dressurmethode, die sich heute auszahlt, insofern Herr Wilhelm mit seinen Tieren nicht nur von der Volksbühne, sondern auch von Film- und Fernsehproduktionen „gebucht“ wird: „Die Tiere arbeiten für ihren Lebensunterhalt.“ Daneben tritt er – mit seinen Eseln, Ponys und Ziegen etwa – auch bei Laubenpieperfesten auf und unternimmt Kutscherfahrten mit spastischen Kindern. Außerdem hält er für Problempferde eine „orthopädische Hufbehandlung“ parat. Alles im erlaubten „Rahmen des 300-Euro- Zugewinns“. Die meisten seiner Tiere landeten nach einer „Leidensgeschichte“ bei ihm, und sie müssen nicht auftreten, wenn sie nicht wollen.
Die Perserkatze „Missy“ zum Beispiel „wurde schlecht behandelt“: Jetzt liegt sie die meiste Zeit hinterm Ofen in einem Pappkarton. Benno, der kurzbeinige schwarze Hund, gehörte einer Fixerin, die jetzt in einem Haus der Treberhilfe wohnt: „Aus ihm könnte noch mal was werden.“ „Fuchsy“ wurde angefahren am Straßenrand gefunden. Der Kapuzineraffe „Kingkong“ „arbeitet zwar nicht gerne, ist aber dafür nie böse“. Er mag am liebsten Limonade und Gummibärchen und liegt abends neben der für Kunststücke zu alt gewordenen Schäferhündin Sandra. Alle Tiere, auch die Waschbären, der Nasenbär, die Zwergschweine und die Hühner verstehen sich untereinander: „Das müssen sie auch, sonst geht das gar nicht.“ Herr Wilhelm lehnt Aufträge, bei denen sie „schwierige Sachen“ machen sollen, ab.
„Die größte Schwierigkeit sind aber die Schauspieler, die sich erst an die Tiere gewöhnen müssen“. Insbesondere galt das einmal – für einen ORB-Moderator – bei Wilhelms zwei Riesenschlangen. Sein Hahn spielte jüngst im Videoclip der Lassie Singers mit: Er mußte auf einer Haltestange in der U-Bahn sitzen. Dabei schiß er der Sängerin auf den Kopf. Einige Kinder, die in der Schrebergartensiedlung wohnen, helfen Bernd Wilhelm gelegentlich beim Füttern und Ausmisten – die Friseuse Manuela schon seit 12 Jahren. Zu Hause hat sie jetzt selbst drei Hunde, Katzen und Fische. Während ich Bernd Wilhelm interviewte, erlaubte „Kingkong“ mir, auf der Couch Platz zu nehmen. Als Manuela kam, bestand er jedoch darauf, daß ich ihren Stammplatz räumte. Bernd Wilhelm hat inzwischen einen Bauernhof außerhalb der Stadt gepachtet, wo seine Tiere mehr „Freiraum“ haben.
Auf dem Land, bei Oranienburg, lebt auch die Hundetrainerin Sabine Berg, allerdings in einem kleinen Reihenhaus mit einem winzigen Garten. Sie hält derzeit neun Hunde. Trotzdem sieht dort innen wie außen alles blitzblank aus, überall stehen Topfpflanzen und Nippes und selbst auf den Plüschsesseln findet sich kein einziges Hundehaar. Sabine Berg kann sich inzwischen eine Putzfrau leisten, außerdem hat sie aber ihre Tiere auch so gut erzogen, dass sie sich vertragen und nichts kaputt oder schmutzig machen: „In so einer Wohngemeinschaft, wie wir sie hier haben, muß jeder Rücksicht auf den anderen nehmen und sich halbwegs anständig betragen!“ Sabine Bergs letzte Neuanschaffung war ein großer grauer Mischlingshund, den sie sich in einem polnischen Tierasyl beschaffte und erst einmal entwurmte und aufpäppelte. Gleich bei seiner ersten kleinen Rolle erwies er sich als ein „wahres Naturtalent“: Er mußte in einem TV-Krimi neben einem Mann über einen Acker gehen, dieser wurd dann erschossen und der Hund mußte die ganze Zeit traurig neben der Leiche ausharren, die er ab und zu beschnüffelte und anstupste, so als könne er es nicht fassen.“Das hat der so gut gemacht, das ich glaube, aus dem wird noch mal w as.“
Ein interessantes Filmtier-Problem tut sich gerade in Namibia auf. Dort halten eine Reihe von Leute sich neuerdings Wolfshunde. Weil es sich dabei um Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen handeln soll, wird das als nicht ganz ungefährlich angesehen. Nun gibt es aber in Namibia gar keine wild lebenden Wölfe und deswegen gingen einige Forscher dort der Frage nach: Wo dann die Wolfshunde herkommen? Ihre vorläufige Antwort lautet, dass mehrere ausländische Filmteams Außenaufnahmen in Namibia drehten, wobei sie einige mitgebrachte Wölfe frei ließen, um sie zu filmen. Diese Tiere seien nach Drehschluß im Land geblieben und hätten sich dort mit verwilderten Hunden gepaart.

Elefant im Dokumentarfilm
Der Elefant Topsy hatte einen Pfleger im New Yorker Zoo angefallen und sollte erschossen werden. Thomas A. Edison erfuhr davon und bot an, ihn mit Stromstößen zu töten. Das wurde dem Glühbirnenerfinder auch genehmigt, außerdem durfte er die Ermordung des Elefanten mittels Elektrizität filmen – und die Aufnahmen hernach zu Werbezwecken für sein Beleuchtungssystem verwenden.

Nilpferde in ihrer natürlichen Umwelt am Bahnhof Zoo
Der Wurm in den Tränen von Nilpferden
Der 1922 in Stettin geborene ARD-Tierfilmer Horst Stern („Sterns Stunde“) kaufte sich einmal zwei Kolkraben. Hinterher – 1973 – gab er selbstkritisch zu bedenken: „Ich konnte dabei nicht wirklich wissenschaftliche Zwecke für mich in Anspruch nehmen, vielmehr nur meine tiernärrische Neugier auf diese sagenhaften klugen Vögel. Wie ich denn überhaupt sagen muß, dass nicht selten passionierte Tierfreunde, insbesondere Tierfotografen, mehr Schaden in der Tierwelt anrichten als dass ihre Beobachtungen und Bilder ihr nützen.“
1945 kassierten die Engländer das Schiff „Seeteufel“ des Unterwasserfilmpioniers Hans Hass, weil dieser an „Kriegsmittelforschung“ beteiligt war. 1959 stürzte der Sohn des Frankfurter Zoodirektors beim Tiere filmen und zählen in Afrika mit seinem zebragestreiften Flugzeug ab. Sein Vater, der Veterinär Bernhard Grzimek moderierte jahrzehntelang die TV-„Kultsendung ‚Ein Platz für Tiere'“. Im Osten tat es ihm der Berliner Zoologe Heinrich Dathe mit seiner beliebten Sendung „Tierparkteletreff“ nach. In Frankreich entwickelten sich zur gleichen Zeit die TV-Sendungen des Unterwasserfilmers Jacques Cousteau, der mit seiner Yacht „Calypso“ anfangs auch noch für den Geheimdienst tätig war, zu „Straßenfegern“. Seitdem hat sich die Zahl der Tierphotographen und -filmer vertausendfacht. Der berühmteste ist noch immer der dafür inzwischen geadelte BBC-„Wildlife“-Moderator David Attenborough. Auf die Frage eines Interviewers, welche Entdeckungen in der Natur ihn wirklich überrascht hätten, antwortete er: „Wenn man mit der Natur zu tun hat, kann man an jedem einzelnen Wochentag einer Überraschung begegnen. Es gibt deren tausende, zum Beispiel, einen Wurm, der nur in den Tränen von Nilpferden lebt.“
Der 68er-Regisseur Jean-Luc Godard hat sich von Attenborough inspirieren lassen – und will demnächst ebenfalls einen Tierfilm (Arbeitstitel: „Abschied von der Sprache“) drehen. Der Zeit-Filmredakteurin Katja Nikodemus gestand er, dass er weder Internet noch Mobilfunk habe und selten fern sehe: „Nur manchmal Tierfilme auf BBC, in denen Menschen Monate damit verbringen, um einem Käfer oder einer Haselmaus nachzustellen.“ „Was ist Ihr nächstes Filmprojekt?“ „Die Geschichte eines Paares, das sich sehr gut versteht. Und das sich besser versteht, sobald es einen Hund hat.“ „Im Drehbuch sind ja bereits Photos…Und da ist auch ein Hund…“ „Das ist unser Hund.“ „Verstehen auch Sie und Ihre Frau sich besser, seit Sie den Hund haben?“ „Nun, er tut uns gut.“ „Weil sie manchmal über den Hund miteinander kommunizieren?“ „Sehr oft sogar. Sehen Sie, ich brauche wirklich kein Mobiltelefon.“
Die Frankfurter Rundschau fragte kürzlich David Attenborough, ob seine Arbeits-„Methoden“ denen seines Bruders Richard ähneln würden, der ein Spielfilmregisseur ist. Der Tierfilmer, der alle Biotope dieser Welt außer der Wüste Gobi kennt, antwortete, sie seien „vollkommen verschieden. Er erfindet Geschichten, während ich Geschichten filme.“ Meistens läßt David Attenborough jedoch filmen – und beamt sich dann hinterher als Erklärer in den Film rein. 2011 sprach der „Mirror“ von einem „Attenborough-Skandal“: Er hatte in einem Interview 2009 zugegeben, die im Zoo gefilmte Geburt eines Eisbären in eine Sendung eingebaut zu haben, die diese Tiere in der arktischen Wildnis zeigte. Attenborough verteidigte nicht nur seinen „Fake“, sondern gab gleich noch einige weitere zu. Die Tierfilme produzierenden Firmenchefs sprangen ihm bei: Seine „Methode“ entspreche den „Redaktionsanforderungen, sie sei „Standard“ bei der Produktion von „Natural History Programmes“.
Ähnliches galt auch für den ARD -Tierfilmer Heinz Sielmann („Expeditionen ins Tierreich“). Er begann professionell Tiere zu filmen als Soldat für die Wehrmacht auf Kreta, wo er 1945 gefangen genommen und mitsamt seinem Material nach England verschifft wurde. Dort, bei der BBC, entstanden dann auch seine ersten größeren Filme, die bereits Rekordzuschauerzahlen erreichten, später machte er beim NDR weiter – und wurde anscheinend steinreich dabei.
Der Tiergedichtsautor Wiglaf Droste mochte Sielmann nicht. Ich nahm Sielmann insbesondere seinen dumpfdarwinistischen Kommentar zu einem gefilmten Mückenschwarm übel, der im Abendlicht über einem Teich tanzte: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren!“ raunte Sielmann dazu aus dem Off. Quatsch, so ein „Interesse“ gibt es nicht, schon gar nicht bei Mücken, die viel lieber „ohne Folgen“ vögeln würden. Und sowieso: Haben sie etwa ein Verständnis vom Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung? Sehr sachlich wird Sielmann in einem biographischen Aufsatz der Tierfilmerhistoriker Jan Clemens und Arnulf Köhncke behandelt: „Auf Kreta im Sturm und im Regen“. Darin wird u.a. der erste „Tiertonfilm“ von Sielmann erwähnt, den er an der Ostsee drehte: „Vögel über Haff und Wiesen“. Er wurde 1938 auf der Jahrestagung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in Königsberg uraufgeführt. Im Tagungsbericht hieß es: „Der Film ist das Erstlingswerk eines noch sehr jungen Autors, der in Arbeitsdienstuniform zu seinen Bildern vorträgt. Er erntete reichlichen Beifall.“ 1939 wurde Sielmann Funklehrer der Wehrmacht in Posen, wo man dann auch den Königsberger Professor Konrad Lorenz als Mediziner hinversetzte, ebenso Joseph Beuys, der dort Funk-Schüler von Sielmann wurde. 1943 durfte Sielmann dann auf Kreta die Dreharbeiten des dort plötzlich gestorbenen Tierfilmers Horst Siewert fortsetzen – bis die Engländer die Insel einnahmen. In Marcel Beyers Roman „Kaltenburg“, geht es um die Beziehungen zwischen Lorenz, Beuys, Dathe und Sielmann, die real und filmisch auf der Vogelwarte Rossitten hinter Königsberg ihren Ausgang nahmen.
Dieses ornithologische Institut, das seit 1944 Rybatschi heißt, wird noch heute – obwohl in Litauen gelegen – von russischen Wissenschaftlern verwaltet. Ein Großteil seiner Finanzen kommt von der „Heinz Sielmann Stiftung“, die das Vermögen des 2006 gestorbenen TV-Tierfilmers, der aus Königsberg stammt, in tierschützerische Taten umsetzt. Dazu gehört ferner eine „Darwin Forschungsstation“ auf den Galapagos-Inseln, mehrere Vogelschutz- und -pflegestationen in Deutschland und Italien sowie die Stiftungszentrale auf dem Gut Herbigshausen bei Duderstadt. In Berlin haben sich die Naturschützer im „Haus der Stiftungen“ am Check-Point-Charly eingemietet. 2005 hieß es dort auf einer Pressekonferenz, die Sielmann-Stiftung habe den 3.422 Hektar großen sowjetischen Militärübungsplatz „Döberitzer Heide“ bei Staaken erworben, wo seitdem Wisente, Wildpferde, -ziegen und -schafe im unübersichtlichen Gelände grasen. Dann kamen noch 1.055 Hektar Seenlandschaft bei Groß Schauen – inklusive der dort lebenden seltenen Fischotter, Rohrdommel und Trauerseeschwalbe – dazu, sowie 2.742 Hektar Braunkohlefolgelandschaft um Wanninchen bei Luckau, ferner 900 Hektar ehemaliges Grenzgebiet im Eichsfeld und 13 Hektar Stauseelandschaft im Glockengraben bei Teistungen. Auf diesen von den Kommunisten bis 1990 industriell bzw. militärisch genutzten „Ödflächen“ entstehen nun die vom Kapitalismus versprochenen blühenden Landschaften.
So wendet sich das einstige Paradies der Werktätigen zu einem „Naturparadies“, wie der N.D. diese „Projekte“ nennt. Endlich hat ein Tierfilmer auch mal mehr Nutzen für die Natur gebracht, als der Schaden, den seine Beobachtungen und Bilder ausmachen. 2012 nun gab die Stiftung bekannt, dass sie auch noch das 12.000 Hektar große Übungsgelände der Roten Armee in der Kyritz-Ruppiner Heide – „Bombodrom“ genannt, übernähme. Naturschützer und Anwohner hatten jahrelang gegen dessen militärische Nutzung protestiert. „Hier entsteht jetzt eine einzigartige Heide-Naturlandschaft“, erklärte dazu der Geschäftsführer der Stiftung Michael Spielmann vor Ort. „Ein mit Munition hochgradig verseuchtes Gelände soll für die Natur bewahrt werden,“ notierte sich der N.D – und erinnerte zum Einen daran, dass das Areal einst „streckenweise Tag und Nacht unter Dauerbeschuss lag, teilweise wurden heute geächtete Streubomben abgeschossen“ und zum Anderen, dass „nach dem Abzug der Russen die Bundeswehr das Gelände übernehmen wollte, sie scheiterte aber am Widerstand der Bürger.“
Ende gut, alles gut also: Schon seien „seltene Vögel wie Wiedehopf, Steinschmätzer und Bachpieper gesichtet worden, ein Wolf tappt von Zeit zu Zeit in die Fotofalle,“ erzählte der Projektleiter der Sielmann-Stiftung Lothar Lankow. Um das Gelände zu säubern, „muss pro Quadratmeter mit etwa einem Euro Kosten gerechnet werden. Bei vollständiger Räumung von Minen und Munition wären das bis zu 595 Millionen Euro.“ Es gehört nach wie vor der „Bundesanstalt für Immobilienaufgaben“. Um das Areal kümmern sich vier Revierleiter, fünf Waldarbeiter und ein Feuerwerker, deren Arbeitsplätze nun die Sielmann-Stiftung mit 320.000 Euro jährlich finanziert, zudem will sie einen Teil des Waldes „ökologisch umbauen“ und Wildtierarten dort ansiedeln.
Etwa zur gleichen Zeit, da dieses neueste „Projekt“ der Sielmann-Stiftung in Brandenburg verhandelt wurde, gab der französische Wissenssoziologe Bruno Latour in einer Rede vor der Berliner „Unseld-Stiftung“ zu bedenken: „Ökologie ist nicht die Wissenschaft von der Natur, sondern das Nachdenken darüber, wie man an erträglichen Orten zusammenleben kann. Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“ Wie – das müßte mal jemand filmen.
Beliebt: Hai im Film
Unterwasserfilme
Bei der Europremiere des 45 Minuten langen Unterwasserfilms „Sharks 3D“ im Imax am Potsdamer Platz wurden die Zuschauerreihen mit verlosten Karten aufgefüllt. Der anschließende Applaus fiel dennoch mäßig aus: „Zu wenig action!“, bemängelten viele. Da ist der Kinobesitzer „Discovery Channel“ selbst schuld, denn sein Programm ist ansonsten voll mit blutrünstigen Haifilmen, in denen die Kameramänner ständig neue Haischutzvorrichtungen testen. „Sharks 3D“ wurde dagegen ohne Taucherkäfige gedreht; er will „das schlechte Image dieser Tiger der Meere korrigieren“, wie die Filmemacher Jean-Jacques Mantello und Jean-Michel Cousteau, Sohn des Unterwasserfilmers Jacques Cousteau, vorab erklärten. Mit dem 3D-Verfahren präsentierten sie uns diese Fische nun erstmalig zum Greifen nahe: Ich musste ein paarmal sogar den Kopf einziehen, um einer Makrele auszuweichen. Die Haie wurden in ruhigen Einstellungen und von ihrer besten Seite gezeigt, denn die Regisseure gingen davon aus: „Es gehört zu unserer Natur, nur das zu schützen, was wir mögen.“ Der Mitproduzent aus der UN-Umweltschutzbehörde erklärte dazu: „They are not man-eaters. Sharks are there to do their job: cleaning up the ocean!“
Das haben wir vor allem dem „Calypso“-Team von Jacques-Yves Cousteau zu verdanken. Sein Sohn Jean-Michel Cousteau präsentierte nun als Präsident der „Ocean Futures Society“ den Film „Sharks 3D“. In Berlin läuft parallel dazu eine Hai-Komödie über seinen Vater: „Die Tiefseetaucher“ von Wes Anderson, die man sich ebenfalls ansehen sollte. Inhaltlich geht es, wenn man so sagen kann, um das ständige Filmen und Gefilmtwerden, damit man weiter im Geschäft bleibt – und weiter mit der hier „Belafonte“ genannten „Calypso“ über die Meere schippern kann, wobei man auch schon mal die Konkurrenz piratisiert und selbst böse piratisiert wird; zu allem Überfluss meutern irgendwann auch noch die Praktikanten an Deck. Über und unter Wasser nichts als Haie, wobei sich egoistische Leidenschaften gegen alle ökologische Moral stemmen: Auf die Frage, welchem „wissenschaftlichen Zweck“ denn seine „Jagd auf den Jaguarhai“, der seinen besten Freund tötete, diene, antwortet Captain Ahab/Nemo/Bligh/Cousteau/Zissou (gespielt von Bill Murray): „Rache!“
Noch eindeutiger um die ökonomische Verwertung von Fischen kreist „Darwins Albtraum“ von Hubert Sauper und Nick Flynn. Darin geht es um den Nilbarsch im Victoriasee, dessen Filetstücke in die EU exportiert werden, während den Einheimischen nur Kopf und Schwanz bleiben. „Bevor der Barsch im Victoriasee ausgesetzt wurde, gab es hier viele Fischarten. Er fraß sie alle auf. Aber ökonomisch ist das gut“, so beurteilt ein Fischexporteur diese postkoloniale Öko-Katastrophe.
Wer danach noch näher an den Victoriabarsch ranwill, dem sei die Lebensmittelabteilung von KaDeWe und La Fayette sowie das „Nordsee“-Restaurant in Mitte empfohlen. Lebende Haie gibt es schräg gegenüber im „Sea Life Center“ des Aqua-Doms zu sehen, halb lebende in der Disco „Shark-Club“ an der Friedrichstraße. Die kleinen Clownfische aus „Findet Nemo“ schwimmen im Seewasseraquarium der Kantine des Arbeitsgerichts am Lützowplatz sowie auch in mehreren Aquarien der beiden Zoos. Dort leben auch etliche Seeschildkröten. Die von innen leuchtenden Meerestiere aus dem Film „Die Tiefseetaucher“ kann man real, aber nicht legal in einigen Neuköllner Tierhandlungen erwerben: Es sind Zebrafischchen aus dem Labor der taiwanesischen Firma Taikong Corp., denen man das Gen einer Qualle, die fluoreszierendes Protein synthetisiert, auf das Genom pfropfte. Ihre Einfuhr in die EU-Länder ist noch verboten, weswegen es dieses erste transgene Haustier vorerst nur als Bückware gibt – ab 39 Euro. Man kann aber jetzt schon die These wagen: Der Aquariumsboom und die Unterwasserfilmnachfrage scheinen sich gegenseitig hochzuschaukeln.

Krake im Fernsehen
P.S.: Noch kann man nicht entrüstet sagen: „Das ist doch Fernsehen“, so wie man früher sagte: „Das ist doch Theater“ – denn es gibt laut Baudrillard kein referentielles Universum mehr. Noch ist Glaubwürdigkeit also bloß ein Spezialeffekt. Aber es gibt eine Ausnahme: Das ist das Tierfernsehen, d.h. Tierfilme. Die Tiere leben in einem anderen Universum – ohne Repräsentanz und Souveränität (noch). Abgesehen von „Knuth-TV“ erfreuen sich in Berlin vor allem die gefilmten Kraken großer Beliebtheit. Seltsam!
Den Anfang machten der Prager Philosoph Vilem Flusser und der französische Zoosystemiker Louis Bec mit ihrem Buch „Vampyrotheutis infernalis“ – ein maximal fußballgroßes Weichtier, das in 1000 bis 4000 Meter Tiefe lebt – also in ewiger Dunkelheit. Weswegen es neben seinen zwei Augen, die lidbewehrt und mit unseren nahezu identisch sind, auch noch zwei Leuchtorgane, ebenfalls mit Lidern, hat. Darüberhinaus zwei dünne, aber sehr lange Spiralfühler und zwei ohrenartige Flossen. Der kleine achtarmige Tintenfisch hat zwar keine Tinte zum Verspritzen, dafür kann er sich jedoch bei Gefahr mit seinen Häuten zwischen den Fangarmen komplett ummanteln – und ist dann bloß noch eine stachelbewehrte rostrote Kugel mit hellen Flecken, die in der „abyssalen“ (abgründigen) „Sphäre“ im sogenannten Meeresschnee dahintreibt.
Vampyrotheutis infernalis und wir werden uns nie begegnen, denn er implodiert in unserem himmlischen Universum und wir werden in seinem höllischen erdrückt. Er bzw. seine Art ist 250 Millionen Jahre alt und wurde erstmalig 1903 mit einem Vertikalnetz während der deutschen Valdivia-Expedition gefangen – d.h. tot hochgeholt. Der Zeichner des Expeditionsleiters Karl Chun kommentierte damals den Fang: „Man meint, unser Herrgott hat alle Dummheiten, die er gemacht hat, in die Tiefsee verTintenfische live – im Fernsehen, im Naturkundemuseum und im Aquarium: bannt.“
Vilem Flusser starb 2000, vorher hielt er in Berlin noch einen Vortrag über diesen primitiven Cephalopoden. Dazu wurde ein TV-Film gezeigt über eine eine japanischen Biologin, die sich täglich tauchend einem in Flachwasser frei lebenden Kraken näherte, um ihn zu füttern. Dafür wurde sie jedesmal von ihm, der fast so groß war wie sie, mit seinen Tentakeln liebevoll umarmt. Nach dem Vortrag ging man noch in ein koreanisches Restaurant am Kurfürstendamm. Wegen der Berlinale saß u.a. eine hochgeschminkte Schauspielerin mit am Tisch, die die ganze Zeit kleine lebende Kraken in süßsaurer Sauce aß. Obwohl die Weichtiere sich dabei in Todesangst an ihre Zunge und Lippen klammerten, war anschließend die Schminke der Koreanerin nicht ein bißchen verschmiert. Die Drumherumsitzenden waren davon sehr beeindruckt.
Der Veranstaltung folgte 2007 ein langer Abend mit einer italienischen Forscherin und einem TV-Filmausschnitt in der Universität der Künste, der den Kopffüßern gewidmet war, wobei auch das Buch „Der Krake“, gestreift wurde, das für den Autor Roger Caillois ein „Versuch über die Logik des Imaginativen“ war: Für Europäer sind die Riesenkraken furchterregend und gefährlich, für die Japaner dagegen trinkfreudig und sexbesessen. Vilem Flusser hat demgegenüber das Weltbild des kleinen Vampyrotheutis infernalis imaginiert. Beides braucht Wissen (genauer gesagt: Malakologie), aber man muß darüber hinausgehen. Für Louis Bec sind sie, die biologischen Wissenschaften, Versuche, eine „transversale Kommunikation zwischen den Arten“ herzustellen.
Ende 2007 kam dies durch den Kulturwissenschaftler Peter Berz noch einmal im Naturkundemuseum zur Sprache und zum Bild. Für Heidegger war – im Gegensatz zu uns „weltbildenden Menschen“ – das Tier noch „weltarm“. Aber man kann sich gewissermaßen gedanklich zusammentun, um auch ein „Dasein“ des letzteren zu halluzinieren – auf der Basis von Cephalopoden-Wissen und ausgehend u.a. von der Topologie: Vampyrotheutis infernalis ist weich und sackartig, kann sich umstülpen und ist tendenziell spiralisiert (eine „libidinöse Höhle“), wir dagegen sind hart, haben ein Skelett, sind segmentiert und zweiseitig symmetrisch (ein Charakterpanzer?). Und während wir uns aktiv um unsere Nahrung bemühen müssen, treibt diese dem Kraken entgegen. Er muß bloß seine Tentakeln spreizen – wie ein aufgespannter Regenschirm mit dem Schlund in der Mitte. Gibt es schärfere Gegensätze als die zwischen ihm und uns?
Flusser konstruiert für den Kraken eine spiralförmige Existenzweise, ja einen ganzen Neospiralismus. Dieser ist dann aber gar nicht mehr weit vom menschlichen entfernt – wie ihn z.B. der Rote Baron mit seinen sich immer höher schraubenden Flügen ohne Sauerstoff unternahm, wobei seine Notizen zunehmend unlesbarer wurden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „Richthofen-Syndrom“. Darüberhinaus haben beide – Mensch und Vampyrotheutis infernalis – noch dies gemeinsam: „Sie sind Sackgassen der Evolution“ laut Flusser. „Er hat zudem ein Wesen ausgewählt, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, daß es über das verfügt, was unsere Philosophen die Fähigkeit zur Weltanschauung nennen, denn sein tierisches Volumen und jener Teil, der die neuronischen Verknüpfungen beinhaltet, ist groß genug,“ schreibt Abraham Moles in einer Rezension der „Philosophiefiktion von Vilem Flusser“.
Die letzte Veranstaltung über den kleinen Tiefseekraken fand am 24. September statt – ebenfalls im Naturkundemuseum. In dessen Tier-„Filmwelten-Reihe“ las Hans Zischler Passagen aus Flussers „Vampyrotheutis infernalis“ vor und der Kustos für Weichtiere präsentierte zusammen mit dem Kustos für Heuschrecken den japanischen TV-Film „Der Vampir aus der Tiefsee“, nachdem sie zuvor das letzte noch existierende in Alkohol eingelegte und inzwischen stark verschrumpelte, kaum tennisballgroße Exemplar der Valdivia-Expedition herumgezeigt hatten. Der Film verdankt sich einem US-Meeresbiologen, der ein ferngelenktes U-Boot bauen ließ, das er mit Scheinwerfern, Kameras und einer Fangvorrichtung ausrüstete. Damit beobachtete er einen Vampyrotheutis infernalis in großer Tiefe vor der Küste Kaliforniens, einen zweiten fing er ein. Durch das Glas einer speziellen Druckkammer sah man anschließend sein langsames Sterben, das zuletzt gnädig weggeblendet wurde.
Gleich am nächsten Tag ging ich in das Zoo-Aquarium, um mir in der dortigen „Welt im Glase“ einen noch halbwegs lebenden Kraken anzukucken. Aber entweder war auch er schon gestorben oder er hatte sich in einer Höhle verkrochen. Ich konnte ihn jedenfalls nirgendwo entdecken. Auch im „Sea Life Aquarium“ dann hatte ich kein Glück: Im Sommer 2007 sorgte dort noch eine Sonderausstellung „Oktopus – Tinte, Tarnung und Tentakel“ für Besucherrekorde, wobei „ein kluger Krake“ sich zu einem regelrechten „Star“ entwickelte: Er hatte nach einem mehrtägigen Training gelernt, mit seinen Fangarmen den Schraubverschluß von Flaschen zu öffnen, in denen sich Nahrung für ihn befand. Nun war er aber nicht mehr da. Dafür lagen in der Nähe des „Sea Life Aquariums“ vor der dortigen „DDR-Ausstellung“ einige Exemplare der thüringischen Zeitung „Freies Wort“ herum – mit der Schlagzeile: „Der Krake Stasi streckt immer noch seine Tentakel aus“. Das ging mir jedoch zu sehr ins Imaginäre – Metaphorische gar. Außerdem war es ein alter Hut: Immer wieder hat man die Intelligenz- bzw. Geheimdienste mit Kraken in Verbindung gebracht. Umgekehrt hatten 1992 auch einmal zwei Neurobilogen, Graziano Fiorito und Pietro Scotto, die mit in der Bucht von Neapel gefangene Kraken Intelligenztests anstellten, für Schlagzeilen gesorgt, indem sie behaupteten, dass das Gehirn dieser Weichtiere ähnlich „hochdifferenziert wie das von Menschen (Geheimagenten, Octopussys?) sei. Obwohl ganz anders aufgebaut, besitze es ebenfalls die Fähigkeit des „Beobachtungslernens“. Der Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau hatte zuvor basierend auf eigenen Beobachtungen gemeint: „Wenn ein Taucher die Augen eines großen Kraken auf sich gerichtet sieht, empfindet er eine Art Respekt, so als begegne er einem sehr klugen, sehr alten Tier.“
Der Soziologe und Résistancekämpfer Roger Caillois schrieb in seinem bereits erwähnten Buch: „Der Krake scheint aufrecht zu gehen wie ein Mensch. Sein kapuzenförmiger Kopf und die riesigen Augen erinnern an die als sadistisch verschrienen, in Kutten gehüllten Folterer einer geheimnisumwitterten Inquisition. Der Krake, dieses Hirntier, um nicht zu sagen, dieser Intellektuelle, beobachtet immerzu, während er agiert. Diese Besonderheit, die offenbar sein innerstes Wesen zum Ausdruck bringt, läßt sich sogar bei Hokusais wollüstigen Kraken feststellen: Er beugt sich über den Körper der nackten Perlentaucherin, die er in Ekstase versetzt, und läßt sie nicht aus den Augen, als verschaffe es ihm zusätzlichen Genuß, ihre Lust zu beobachten.“
Ich ging nach Hause und beschloß, fortan keine Calamaris mehr zu essen. Mehr konnte ich für die Cephalopoden erst einmal nicht tun.
In der FAZ fand ich später noch einen Artikel von Julia Voss, in dem es um eine Kritik an der „scheußlichen“ Affen-Gehirnforschung der Universität Bremen“ geht. „Das ist der Unterschied zu früher,“ schreibt die Biologiehistorikerin, „der Konflikt ist nicht mehr der zwischen Herz und Verstand – es steht heute Forschung gegen Forschung“. Das spektakulärste Beispiel dafür lieferte ihr zuletzt ein Oktopus: „Wegen seiner dicken Nervenfasern ist er ein klassischer Modellorganismus der Neurobiologen; doch was man sich als vermeintlich einfachen Organismus ins Labor holte, entpuppte sich als intelligentes Lebewesen. Der Oktopus verblüffte die Wissenschaft mit der Fähigkeit, zu beobachten, wie Futter in Marmeladengläsern deponiert wurde. Er sah zu, griff das Glas, schraubte es auf und aß die Garnele“. Da stand also laut Julia Voss „Forschung gegen Forschung“.
Inzwischen schaffte sich das AquaDom einen neuen Oktopus an. Er scheint sich auch schon gut eingelebt zu haben. Mitte Oktober klaute er dem Aquariumspfleger die Taschenlampe. Dazu heißt es in einer Presseerklärung: “ So schnell konnte Martin Hansel, Chefaquarist im AquaDom und Sea Life Berlin gar nicht gucken, als sich plötzlich acht Arme gierig an seine Taschenlampe klammerten. Kein Ziehen und Zerren half, der kleine Krake stülpte sich gleich ganz über das für ihn sehr faszinierende Leuchtmittel und ließ es einfach nicht mehr los. „Unser Oktopus hat sich anscheinend von all den schönen Lichtinstallationen in unserer Stadt inspirieren lassen und gleich mal an seiner eigenen Beckendeko gearbietet“, schmunzelt Martin Hansel und fügt hinzu: „Für Oktopoden sind die gebündelten Lichtstrahlen einer Taschenlampe in keinster Weise gefährlich, deshalb gönnen wir ihm seine Eroberung gerne noch ein bisschen. Denn: Die außergewöhnlichen Tiere brauchen Beschäftigung, damit sie nicht verkümmern.“
So ähnlich sieht das auch der Direktor des Basler Zoos, in dem man neuerdings ebenfalls einen Kraken bestaunen kann, der mit seinen 8 Fangarmen Dosen und Gläser öffnet. Radio Regenbogen berichtete: „Zur Fütterungszeit kann der Oktopus beim Öffnen eines Joghurtglases mit fest sitzendem Plastikdeckel oder einer Konservendose mit Schraubverschluss beobachtet werden. Darin sind Muscheln, Garnelen oder Fische. Das Öffnen der Dosen dient laut einem Sprecher des Zoos als Denksport und soll verhindern, dass sich der zu den intelligentesten Tieren zählende Meeresbewohner langweilt.“ Außerdem ist der kluge Krake eine willkommene Attraktion für den Basler Zoo,freut sich der Direktor.
Weniger erfreut war man dagegen über die Klugheit eines Kraken-Weibchens im Santa Monica Pier Aquarium in Kalifornien, wie apa meldete: „Der Oktopus hatte über Nacht ein Ventil seines Beckens geöffnet und die Einrichtung mit hunderten Litern Salzwasser überschwemmt. Auch die Büros standen unter Wasser, als die Mitarbeiter morgens zur Arbeit erschienen. Als Täterin machten sie rasch ein Oktopus-Weibchen aus, das bereits als neugierig und gesellig galt. Tiere kamen bei der Überschwemmung nicht zu Schaden, wie Aquariums-Sprecher Randi Parent sagte. Allerdings hätten die Wassermassen möglicherweise den neuen Fußboden beschädigt.“
In einem taz-Artikel ging es dann wieder um Krakenforschung auf der alten Subjekt-Objekt-Einwegschiene: „Das größte Auge, das Forscher bislang untersucht haben, gehört einem sogenannten Koloss-Kalmar aus der Tiefsee. Mit 27 Zentimetern Durchmesser ist es deutlich größer als ein Bundesliga-Fußball. „Es ist ein wirklich phänomenales Auge“, berichtete der neuseeländische Kalmar-Experte Steve O’Shea am Mittwoch in Wellington. Es handele sich um das „einzig intakte Auge“ eines Riesen-Kalmars, das je gefunden wurde. O’Sheas Team untersucht am Nationalmuseum Te Papa in Wellington derzeit den Koloss-Kalmar (Mesonychoteuthis hamiltoni), der Fischern im Februar 2007 in der Antarktis ins Netz gegangen war. Der 495 Kilogramm schwere und zehn Meter lange Kopffüßer ist einer der größten je gefangenen Kalmare. Die Fischer auf der Jagd nach Seehechten hatten das Tier zufällig gefangen. Als der riesige Tintenfisch an Bord gehievt wurde, soll das Tier noch gelebt haben. Dabei wurde jedoch das zweite Auge zerstört. Bisher war das Tier eingefroren, seit Montag wird es in einem Chemikalienbad vorsichtig konserviert. Der überaus seltene Fang zieht gleichermaßen die Aufmerksamkeit zahlreicher Forscher und Kamerateams auf sich.
Einige angloamerikanische Verhaltensforscher haben am lebenden Objekt Neues entdeckt – wie Focus berichtete: „Männchen der australischen Riesensepia kommen auf raffinierte Weise bei den Weibchen zum Erfolg. Wie britische und US-Biologen beobachteten, erschleichen sie sich Paarungen, indem sie sich als Weibchen tarnen. Gemeinhin weisen die Tintenfisch-Damen 70 Prozent aller Annäherungsversuche ab. Zudem haben sie meist einen festen Partner, der den Großteil ihrer Eier befruchtet und Rivalen verjagt. Einzelgängerische Männchen färben ihre Haut blitzschnell „weiblich“ und nehmen die Armhaltung Eier legender Weibchen an. Auf diese Art täuschen sie den Wächter, der die sich anschleichenden vermeintlichen Weibchen toleriert. In der Hälfte der Fälle kam es zum Geschlechtsverkehr, aber auch einige Männchen versuchten, sich mit ihren getarnten Geschlechtsgenossen zu paaren.
Weitere Neuigkeiten und Geschichten über Kraken finden sich auf der Webpage des „Octopus News Magazine“ – z.B. diese:
„Two South Wales families who discovered a stranded octopus on a South Wales beach almost certainly saved the creature’s life. Gary Phillips, his wife and daughters were walking at Rest Bay, Porthcawl, with their friends when they came upon the octopus on dry sand. It looked lifeless, but recovered after being put into a rock pool. Experts say that the octopus would not have survived for more than two hours had it not been rescued. Gary, a 30-year-old quantity surveyor was walking with his wife Rebecca, and twin sons, Neurin, and Iestyn, 18 months, and their friends Steve and Louise McCarthy and their twin daughters, Megan and Grace, four. Gary said: „My wife found the octopus and called us over. At first we thought it was dead but we gave it a little prod and found that it was breathing and moving. We took it to shallow water and then put it in a rock pool. It gradually recovered and then swam off gracefully. „It was the first time I had seen a live octopus outside an aquarium. „It’s nice to know that we may have saved its life. Gary did some research after finding the octopus and discovered that it was a Curled Octopus (Eledone Cirrhosa). Octopus expert Andrew Grimmer, from the Blue Reef Aquarium, in Tynemouth, Tyneside, said: „Curled octopus are not uncommon here but they are usually found in lobster pots by fishermen. It is unusual for them to be out of water and very unusual for them to be found on dry sand. It would have survived only a couple of hours. Mr Grimmer said it is currently the breeding season for octopuses, and he suspected that the creature was female and was weak after laying her eggs. It was possible that in its weakened state the octopus had been washed up onto the dry sand.“
Goethe meinte einmal: „Es gibt nichts Schöneres im Leben als morgens eine Lerche zu hören – und abends eine zu essen“. So ähnlich ist es auch mit den Kraken: Die einen sind stolz, einen gerettet zu haben, und die anderen, ihn geschmackvoll zubereiten zu können, woraus sie dann eventuell ein Rezept machen, das sie ins Internet stellen, damit andere das nachmachen können.

Wolfsfilmer
P.P..S.: Mehr und mehr müssen auch die noch wilden Tiere in Filmen regelrecht mitspielen. Wenn z.B. Fernsehteams von ihren Sendern im Winter in den Wald geschickt werden – um in einem bayrischen, polnischen oder kanadischen Wald zu filmen, wie es gerade den Bären, Hirschen, Wölfen, Dachsen etc. dort so geht, dann fällt ihnen dabei unweigerlich das Wort „Überlebenskampf“ ein, manchmal noch mit dem Zusat „hart“ bzw „erbarmungslos“. Es ist kalt, die Füße sind vom hohen Schnee naß geworden, das Essen ist ungenießbar, das Equipment spinnt, der Kameramann kann vor lauter klammen Fingern nicht mehr richtig drehen, der Kameraassistent steht mit seinen Eisfüßen mehr im Weg als das er hilft und dann sind die ganzen Viecher, auf die sie es abgesehen haben, auch noch so verdammt schwierig zu erwischen. Entweder halten sie sich an unmöglichen Orten auf oder das Licht stimmt nicht…Aber die Redaktionen daheim – im Warmen – drängen unbarmherzig. Das Budget ist bereits „robust überzogen“ (O-Ton Buchhaltung) und dann muß zu allem Überfluß auch noch ein Teil des Tons wiederholt werden…Alles in allem steckt das Filmteam genau in dem „harten Überlebenskampf“, den es in der unbarmherzigen Natur vor sich filmt. Subjekt und Objekt sind nahezu identisch geworden.
Auch wenn die TV-Teams bei ihrer Arbeit auf einen ganzen Tross von (lokalen) Helfern zurückgreifen können – angefangen von der Cateringfirma bis zur Autovermietung und den Wildhütern der Nationalparkverwaltung als Guides sowie den besten für sie reservierten Hotelzimmern in der Nähe ihrer Drehorte. Dafür sind die Objekte der Begierde ihrer Redaktionen – die Tieres des Waldes – Kummer gewohnt, d.h. sie sind überaus erfahren im harten Überlebenskampf – sie verhalten sich dort schon fast instinktmäßig richtig – also „optimal“. Obwohl man off the record natürlich zugeben muß, dass die Tiere im Nationalpark schon lange ganzjährig geschont sind, d.h. nicht gejagt werden dürfen und dazu noch im Winter zugefüttert bekommen, so dass sie immer mehr ihre Scheu verloren haben. Die Füchse kann man schon fast streicheln und die Wildschweine sind so dreist, dass man sich inzwischen umgekehrt – vor ihnen – in acht nehmen muß. Aber auch das gehört ja streng genommen noch zur Unbarmherzigkeit der Natur! Für die Fernsehteams – als Frontschweine ihrer Medienkonzerne – bedeutet das eine zusätzliche Tortur, denn ihre Dreharbeiten laufen dabei immer mehr auf eine Fakeproduktion hinaus – insofern z.B. die Hirsche teilweise über eine Waldlichtung regelrecht gescheucht werden mußten, um kurz vor Sonnenuntergang noch schnell ein paar Bilder von einem flüchtenden Rudel zu bekommen. Diese werden dann später mit drei über verschneite Äcker laufende Wölfe gegengeschnitten.
Die Wölfe hatte die Firma „Action Animals“ angeliefert, für 600 Dollar – pro Stück und Tag. Es handelte sich dabei um besonders filmerfahrene Tiere, die eine regelrechte Ausbildung in der Schweiz genossen hatten. Aber dazu kam dann noch ihre Anlieferung per Flugzeug sowie die Spesen ihrer drei Trainer, ihrer zwei Pfleger und ihres Masseurs. Letzterer war nebenbei und vor Ort auch immer noch für die PR der Firma „Action Animals“ von Gerry Therrien in Vancouver zuständig, weswegen laufend irgendwelche Radio- und Lokalzeitungs-Fritzen an den Drehorten aufkreuzten, wo die drei Wölfe vor der Kamera liefen oder schliefen. Kurzum: Trotz oder gerade wegen der ganzen unbarmherzigen Natur wurde der Dreh zusehends unnatürlicher – und für Außenstehende absurder. Besonders die Wildhüter der Nationalparkverwaltung schienen das ganze mehr und mehr für ein Schwindelunternehmen à la „Borat“ zu halten. Sie standen aber auch als eine Art Doppelagenten den Fernsehleuten gegenüber: Einerseits wurden sie dafür bezahlt, dass sie das Filmteam und die Wolfscrew mit deren Wölfen zu den gewünschten Drehorten führten – und sogar die eine oder andere Tierart aufstöberten bzw. vor die Kamera trieben.
Andererseits waren sie aber auch deren Kontrolleure im Auftrag der Parkverwaltung, d.h. sie hatten darauf zu achten, dass das Filmteam nicht einem der 96 Parkverordnungen zuwiderhandelte, dass die Tiere des Waldes nicht „unnötig beunruhigt wurden“, usw. gleichzeitig waren sie aber auch dafür verantwortlich, dass es dem Filmteam an nichts mangelte und sie den besten Eindruck vom Nationalpark mit nach Hause nahmen. U.a. stellten sie immer wieder ihre leistungsstarken Funkgeräte zur Verfügung, die auch noch da funktionierten, wo die Handys der Filmer wieder mal in ein Funkloch geraten waren – z.B. als es galt, den angemieteten Hubschrauber für die Aufnahmen von oben zum Standort zu lotsen. Am Ende kam dabei ein 22minütiger Film über „Die Tiere des Waldes im Winter“ heraus, der dann lieblos zwischen Weihnachten und Neujahr von einigen Dritten Programmen ausgestrahlt wurde. Die Wildhüter, denen der Sender als Dank eine Kopie geschickt hatte, fassten sich an den Kopf, als sie den Film sahen – ob dieser grotesken Diskrepanz zwischen Aufwand und Wirkung.
Ein interessantes Filmtier-Problem tut sich gerade in Namibia auf. Dort halten eine Reihe von Leute sich neuerdings Wolfshunde. Weil es sich dabei um Kreuzungen zwischen Hunden und Wölfen handeln soll, wird das als nicht ganz ungefährlich angesehen. Nun gibt es aber in Namibia gar keine wild lebenden Wölfe und deswegen gingen einige Forscher dort der Frage nach: Wo dann die Wolfshunde herkommen? Ihre vorläufige Antwort lautet, dass mehrere ausländische Filmteams Außenaufnahmen in Namibia drehten, wobei sie einige mitgebrachte Wölfe frei ließen, um sie zu filmen. Diese Tiere seien nach Drehschluß im Land geblieben und hätten sich dort mit verwilderten Hunden gepaart. Eine kühne Abstammungsthese.
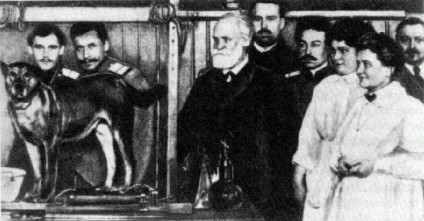
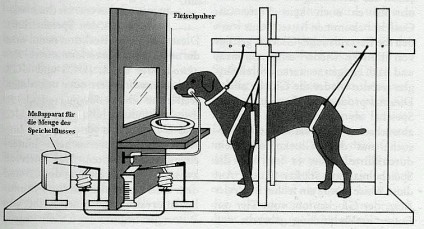
Hund in Pawlows Labor
Tierliebe
„Das Wohl der Tiere hat für die Bundesregierung hohe Priorität“ (Ilse Aigner, Landwirtschaftsministerin)
Kaum wurde bei der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes im Frühjahr den Zirkusunternehmen das Halten und Abrichten von Wildtieren verboten, weil sie diese nicht annähernd „artgerecht“ halten können, steht schon wieder eine Novellierung dieses Gesetzes an: Mit dem selben Begriff „artgerecht“ soll nun der sexuelle Mißbrauch von Tieren explizit unter Strafe gestellt werden. „Damit der Staat mehr Möglichkeiten hat,“ wie eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes erklärte. Implizit war diese „Praxis“ auch schon im alten Tierschutzgesetz bei Strafe verboten, indem es dort heißt, dass Tieren keine „vermeidbaren Leiden“ zugefügt werden dürfen.
Die Tierschützer als Initiatoren der neuen Novelle behaupten jedoch, dass inzwischen gewissermaßen Gefahr im Verzuge sei – dass es nämlich in Deutschland bereits „Kreise organisierter Zoophilie“ gäbe und die Eröffnung von „Tierbordellen“ sozusagen kurz bevorstünde. 2011 hatte ich in einem Reportageband des Stern über Orang Utans auf Borneo gelesen, dass man dort kahlrasierte Weibchen in Bordellen halten würde. Weder die eine noch die andere Geschichte möchte ich glauben.
Wahr ist indes, dass mindestens im Internet sodomistische Pornos stark nachgefragt werden. Meist sind es arme Brasilianerinnen, die sich da in den Videoclips mit allen möglichen Tieren bis hin zu Fischen „befriedigen“. Zudem gibt es eine ganze Reihe deutschsprachiger Internetforen für Zoophile – ohne anrüchiges Bildmaterial. Und kürzlich wagte einer bereits ein „Coming-Out“ – in der BZ, der er gestand, er liebe seinen Schäferhund, auch sexuell, aber nur, wenn der es auch wolle. Auch in der taz sprach der Vorsitzende des Vereins Zeta (Zoophiles Engagement für Toleranz und Aufklärung) kürzlich über seine Beziehung zu seinem Hund.
Die „Konjunktur“ der Zoophilie, wie der Sexualverkehr mit Tieren auch heißt, darf überraschen: Seit dem US-Kinsey-Report in den Sechzigerjahren, in dem festgestellt wurde: „Das ländliche Pendant zur urbanen Masturbation“ sei „die Sodomie“, war man davon ausgegangen, daß diese mit der Verstädterung und Industrialisierung sowie mit der durch die „Pille“ ausgelösten „sexuellen Befreiung“ langsam aussterben würde. Die Sodomie war sozusagen dem Mangel an zum Geschlechtsverkehr bereiten Frauen in Männergesellschaften geschuldet. Für diese These sprachen die wenigen in den letzten Jahrzehnten noch bekannt gewordenen Fälle, die meistens Randgruppen betrafen: Angetrunkene Soldaten, die im Manöver über eine Schafherde herfielen; ein arbeitsloser Hühnerficker, der sich hernach mit dem Argument verteidigte: sein Glied wäre so klein, dass ihm der Geschlechtsverkehr mit Frauen ganz unmöglich sei; Pitbullbesitzer, deren Freundinnen es unter Alkoholeinfluß mit ihren Hunden trieben usw.
Dagegen steht eine Stockholmer Studie aus dem Jahr 2004, die nahelegt, dass in Schweden, wo sämtliche die Gleichheit der Geschlechter verletzende Sexualbeziehungen unter Strafe gestellt wurden, all jene, die trotzdem und weiterhin solche „ungleichen“ suchen, anscheinend auf die Sodomie ausgewichen sind. In Schweden werden jährlich 200-300 Tiere sexuell mißbraucht – Tendenz steigend. Die taz berichtete bisher 150 mal über diese Praxis. In ihrem Feuilleton 1986 machte sie in diesem Zusammenhang eine „Neubesetzung des ‚Hündischen'“ aus, dessen Impuls von den Künstlern ausgehe: In Paris führten zwei hessische Künstler eine Performance vor, in der Eva Braun von Hitler als Schäferhund gevögelt wurde. In Frankfurt stellte der Maler Johannes Beck eine großformatige Bildserie „Schäferhunde und Mösen“ aus . Auch auf der Kölner Kunstmesse hieß des Thema bei den „Heftigen“ „Frau mit Hund“, mit „Schäferhund“ genauer gesagt. Dazu gehörte ein ausgestopfter Schäferhund, die Vorstellung einer neuen Avantgarde-Zeitschrift namens ‚Doggy‘ (hrsg. v. Gregor Pott) und Hundebilder in allen Stilen.
Der ‚Stern‘ zog nach – und veröffentlichte ein Photo von Dera Winger („Staatsanwälte küßt man nicht“) – „in ungewohnter Pose“: wie sie auf einem Schäferhund liegt und ihm den Hals ableckt. Ähnlich zeigte sich dann auch die damals an einem neuen Image arbeitende Sängerin Nena, als sie sich in der Zeitschrift „Tempo“ statt mit ihrem blonden Jüngling mit einem Schäferhund ablichten ließ, der ihr hingebungsvoll den Hals leckte. Das taz-Feuilleton fragte sich damals: „Wird an deutschen Schäferhunden dereinst die Welt gesunden? Und befinden wir uns dann immer noch in der Hegelschen Herr-Hund-Dialektik? Mit der zweiten deutschen Manager- Generation rückte die Domina bereits zum ‚Zeitgeist‘-Thema auf. Tagsüber den ‚Herr‘ (F. J. Raddatz) spielen, abends den Hund rauslassen?“
Die Berliner Zeitung erinnerte nun daran, dass in den Niederlanden 2008 ein Friese, der „dutzendfach ein Pony vergewaltigt hatte“, vor Gericht freigesprochen wurde, weil dieses „Vergehen“ damals nicht strafbar war. Der Tierschützer Henk ten Napel hatte anschließend gemeint: „Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass die Niederlande die zweifelhafte Ehre haben, der größte Produzent von Tierpornos zu sein.“ Auf der anderen Seite arbeitet die Schweiz inzwischen bereits an Individualrechten für Tiere. Und die Tier-Verhaltensforschung legt schon lange nahe, die Menschenrechte mindestens für die „Höheren Affen“ zur Geltung zu bringen.
2009 kam es im Kreuzberger Kunstverein NGBK im Rahmen der Ausstellung „Tier-Werden/Mensch-Werden“ zu einem öffentlichen „Referendum – für die rechtsgültige Erlaubnis zur Zeugung gemeinsamen Nachwuchses von Menschen und Primaten zur Errichtung einer Fortpflanzungsgemeinschaft“… Kurz gesagt: Die Tierliebe ist ein kompliziertes Rechtsgut. Sie in Form der Zoophilie unter Strafe zu stellen – angesichts der zunehmend tierquälerischen Massentierhaltung und -tötung – rückt diesen Gesetzesentwurf in die Nähe jener neoliberalen Parlamentsaktivitäten, die nichts kosten und keine sozialen Verwerfungen mehr angehen, sondern ausschließlich der Bekämpfung nicht-normaler Muster der Lebensführung (Alkohol, Nikotin, Fast Food, Unterschichtfernsehen, Glühbirnen, Kopftuch) dienen.

„Referendum für die rechtsgültige Erlaubnis zur Zeugung…“
Bereits 1927 versuchten der spätere »Held der Sowjetunion« Otto Julewitsch Schmidt und sein Institutsleiter Ilja Iwanowitsch Iwanow auf der von ihnen gegründeten Affenforschungsstation in Suchumi/Abchasien, Menschen mit Affen zu kreuzen – ohne rechtsgültige Erlaubnis. Damit wollten sie antikreationistisch gestimmt die nahe Verwandtschaft von Menschenaffen und Menschen beweisen. Der Versuch mißlang: Zwar gab es etliche experimentierfreudige Frauen, aber nur einen männlichen Schimpansen namens „Tarzan“ und der starb, bevor es zum Äußersten kam. Erst seit 1972 weiß man, daß es nicht funktioniert hätte: Menschen und Menschenaffen haben sich bereits ähnlich wie afrikanische und asiatische Elefanten zu sehr auseinandergelebt.
Vor einigen Jahren kam eine Autorin in der ZDF-Kultursendung »Aspekte« noch einmal auf die Affen-Menschen-Experimente des Doyen der sowjetischen Psychoanalyse Otto Julewitsch Schmidt in Suchumi zurück. Ebenso wie dann auch die Bild-Zeitung war dabei wieder die Rede davon, daß dies geschah, weil Stalin »Untermenschen« bzw. »Arbeitssklaven« züchten wollte.
Zu einem anderen Resultat gelangten dann auch zwei Biologiehistorikerinnen, Julia Voss und Margarete Vöhringer, in einem Aufsatz über das Moskauer »Darwin-Museum«. Voss und Vöhringer zufolge ging es bei den Affenzüchtungsexperimenten in Suchumi um zweckfreie Forschung: »Es scheint, als hätten die Aufklärer in Rußland die Engführung des Vergleichs von Affe und Mensch im Sinn [gehabt]. Nur, zu welchem Zweck? Während es den reaktionären deutschen »Darwinisten« um die nahe Verwandtschaft von »Primitiven und Primaten« gegangen war, die sie z.B. gerne fotografisch durch Gegenüberstellungen von »Negerkindern und Gorillababys« demonstrierten, ging es im revolutionären Rußland in den zwanziger Jahren laut Voss und Vöhringer »um die Schließung des ‚Missing Link‘ zwischen Mensch und Tier«.

Affenversuche im Labor, heimlich photographiert
Im Gegensatz zu René Descartes, der die Tiere als gefühllose „Maschinen“ begriff, hat Michel de Montaigne, die Kluft zwischen Mensch und Tier zu überbrücken versucht. In seinem Essay „Die Tiere entdecken einander ihre Gedanken, so gut als Menschen“ schrieb er 1580: „Wir müssen nur auf die Gleichheit, die zwischen uns und ihnen ist, Achtung geben. Wir verstehen mittelmäßig, was die Tiere haben wollen; und fast eben so gut verstehen auch uns die Tiere. Sie schmeicheln, sie drohen, sie ersuchen uns: und dieses tun wir auch gegen sie. Übrigens sehen wir sehr deutlich, dass unter ihnen ein vollkommenes Verständnis ist; und dass nicht nur diejenigen, die von einerlei Art sind, sondern auch Tiere von verschiedenen Arten, einander verstehen.
„Die unterschiedlichen Tiere, sowohl die zahmen als die wilden, bringen unterschiedene Töne hervor, nachdem entweder Furcht, oder Schmerz, oder Freude in ihnen wirken.“ Lucretius.
Aus einem gewissen Bellen des Hundes erkennt das Pferd, dass er zornig ist; vor einer andern Stimme von ihm entsetzt es sich nicht. Selbst bei denjenigen Tieren, die keine Stimme haben, können wir aus den gegenseitigen Dienstbezeigungen leichtlich schließen, dass sie durch irgend ein anderes Mittel ein Verständnis mit einander unterhalten müssen. Ihre Bewegungen reden.
„Nicht viel anders, als wie das Unvermögen der Zunge die Kinder ihre Zuflucht zu den Gebärden zu nehmen zwingt.“ Lucretius
Warum geht dieses alles nicht eben sowohl an, als dass unsere Stummen mit einander disputieren, Schlüsse machen, und Geschichte durch Zeichen erzählen? Ich habe unterschiedliche gesehen, die hierinnen so geschickt und fertig waren, dass sie sich in der Tat vollkommen verständlich erklären konnten. Die Verliebten zürnen, versöhnen sich wieder, bitten, danken einander, bestellen einander, und sagen einander alles mit den Augen.
„Das Stillschweigen selbst hat seine Sprache. Es kann bitten, und sich verständlich machen.“ Aminta del Tasso. Atto II nel Choro
Was tun wir nicht alles mit den Händen? Wir ersuchen, versprechen, rufen, beurlauben, drohen, bitten, flehen, verneinen, versagen, fragen, bewundern, zählen, bekennen, bereuen, fürchten, schämen, zweifeln, unterweisen, befehlen, reitzen, ermuntern, schwören, bezeugen, beschuldigen, verdammen, sprechen los, schimpfen, verachten, trotzen, zürnen, schmäucheln, loben, segnen, demütigen, spotten, versöhnen, empfehlen, erhöhen, empfangen, erfreuen, beklagen, betrüben, verzweifeln, erstaunen, rufen aus, schweigen stille. Wir verändern und vervielfältigen die Bewegungen derselben so gut, als die Bewegungen der Zunge. Mit dem Kopfe rufen wir, und fertigen auch wieder ab. Mit dem Kopfe bekennen, leugnen, widersprechen, bewillkommen, ehren, verehren, verachten, fordern, verweigern, erfreuen, trauren, liebkosen, schelten, trotzen, ermahnen, drohen, versichern, fragen wir? Was tun wir nicht mit den Augenbrauen? Was nicht mit den Schultern? Alle Bewegungen reden, und zwar eine ohne allen Unterricht verständliche Sprache, eine ganz gemeine Sprache. Hieraus ist zu schliessen, wenn man die Verschiedenheit und den mannigfaltigen Gebrauch der andern Sprachen betrachtet, dass diese hier der menschlichen Natur gemäßer sein muß. Ich übergehe dasjenige, was besonders die Not denenjenigen geschwind davon lehrt, die es brauchen: sowohl als die Fingeralphabete, und Sprachlehren in Gebärden, nebst den Wissenschaften, welche bloß durch dieselbigen ausgeübt und ausgedrückt werden. Ich will auch derjenigen Völker nicht gedenken, von denen Plinius sagt, dass sie gar keine andere Sprache hätten. Als ein Abgesandter der Stadt Abdera lange vor dem Könige zu Sparta, Agis, geredet hatte, und ihn endlich fragte: Nun Herr, was soll ich unsern Bürgern für eine Antwort bringen? so antwortete dieser: Dass ich dich alles, was du gewollt hast, und so lange du gewollt hast, habe sagen lassen, ohne ein einziges Wort zu reden. War dieses nicht ein redendes und sehr verständliches Schweigen?
Zu dem Schweigen sei noch einige Erfahrungen in Meditationszentren hinzugefügt: Dort müssen die Teilnehmer u.U. wochen- und monatelang schweigen. Dabei entwickeln sie ihre nonverbale Kommunikationsfähigkeit; registrieren Unterschiede, die den sprachlichen z.T. genau entgegengesetzt sind: „Mit einigen versteht man sich leicht und gut, mit anderen immer falsch“; brauchen bald nicht einmal mehr Gesten, um sich zu verständigen; und denken irgendwann nicht mehr in Sprache, sondern in Gegenständen und Farben z.B..Umgekehrt hat man z.B. festgestellt, dass Leute, die sich ihre Gesichtshaut mit Botox straffen, immer weniger mit Gesichtsausdrücken kommunizieren, und nicht nur das, sie können bald auch bei Anderen diese nonverbale Kommunikation nicht mehr wahrnehmen.
Noch mal Montaigne: „Tiere folgen ihren Neigungen ebenso frei, als die Menschen
Ich sage also, um wieder auf mein Vorhaben zu kommen, dass man ohne einen wahrscheinlichen Grund annimmt, die Tiere täten eben das aus einer natürlichen und gezwungenen Neigung, was wir aus eigner Wahl und mit Bedachte vornehmen. Wir müssen aus gleichen Wirkungen auf gleiche Kräfte, und aus vollkommeneren Wirkungen auf vollkommenere Kräfte schließen, und folglich bekennen, dass sich eben die Vernunft, und eben die Art zu verfahren, welche wir beobachten, oder vielleicht eine bessere, auch bei den Tieren findet. Warum bilden wir uns diesen natürlichen Zwang bei ihnen ein, da wir doch keine dergleichen Wirkung davon wahrnehmen? Hierzu kommt noch, dass es weit rühmlicher für ein Wesen ist, wenn es durch eine natürliche und unvermeidliche Bestimmung, und welche der Gottheit näher kommt, ordentlich zu handeln geleitet und verbunden wird, als wenn es nach einer vermessenen und unbestimmten Freiheit ordentlich handelt; und dass es ferner sicherer ist, der Natur, als uns, die Zügel bei unserer Aufführung zu lassen. Unser eitler Hochmut macht, dass wir unsere Geschicklichkeit lieber unsern Kräften, als ihrer Freigebigkeit zu danken haben wollen. Wir bereichern die andern Tiere mit natürlichen Gütern, und überlassen sie ihnen, um uns durch erworbene Güter hervor zu tun, und zu adeln. Eine große Einfalt, wie mich dünkt! Denn, ich würde mir doch wenigstens eben so viel auf meine eigentümlichen und natürlichen Reize, als auf die erbettelten und gekünstelten einbilden. Wir können uns keinen schöneren Ruhm, als diesen erwerben, dass uns Gott und die Natur günstig sind.“
Für Montaigne ist die Überheblichkeit des modernen Menschen nichts als „leere Einbildung“, in seiner schieren Umdrehung des abendländischen Natur-Kultur-Verständnisses relativiert er auch gleich unser Verständnis von der Überlegenheit der gesprochenen (und geschriebenen) Sprache gegenüber allen anderen Formen der Kommunikation – der Logik gegenüber dem „Wilden Denken“. Dabei kommt er u.a. auf die Gebärden- bzw. Gehörlosensprache zu sprechen.
Erst 170 Jahre später wurde in Paris die erste öffentliche Schule für taube Kinder eröffnet. In der Folgezeit wurde die „Französische Gebärdensprache“ (LSF) die „Mutter von verschiedenen anderen Gebärdensprachen, so der Österreichischen Gebärdensprache und der American Sign Language (ASL), da die Gebärdensprache erstmals in Frankreich richtig gefördert wurde,“ heißt es bei Wikipedia, aus dem man aber für wissenschaftliche Publikationen (noch) nicht schöpfen darf.
Die amerikanische Biopsychologin Sue Savage-Rumbaugh begann ihre Spracherwerbsforschung mit Schimpansen, indem sie ihnen die ASL beibrachte. Als sie diese Arbeit mit dem Bonobo-Männchen Kanzi fortsetzte, ging sie erst von der Gebärdensprache zu einer Symbolsprache über und verlegte dann ihre Aufmerksamkeit vom Worte lernen auf das Verstehen. Kanzi konnte nicht nur per Tastendruck mit 256 Symbolen kommunizieren, sondern verstand auch das Englisch der Forscher zunehmend besser. Sue Savage-Rumbaugh kommt in ihrem Buch über den Affen zu dem Schluß, „dass Kanzi wie Menschen in der Lage ist, spontan Sprache zu erwerben, eine umfangreiche Verständnisfähigkeit zu entwickeln und eigene grammatikalische Regeln zu erfinden, wie es die Vorfahren der Menschen einst getan haben.“
Zum Ursprung der Sprache schreibt sie, dass „Sprache und manuelle Fähigkeiten“ sich wahrscheinlich „gemeinsam entwickelt haben“. Das klingt nach Friedrich Engels‘ – seine Ausführungen über den „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“ in seinem Werk „Dialektik der Natur“ z.B.. Dort heißt es:
Wenn der aufrechte Gang bei unsern behaarten Vorfahren zuerst Regel und mit der Zeit eine Notwendigkeit werden sollte, so setzt dies voraus, daß den Händen inzwischen mehr und mehr anderweitige Tätigkeiten zufielen. Auch bei den Affen herrscht schon eine gewisse Teilung der Verwendung von Hand und Fuß. Die Hand wird, wie schon erwähnt, beim Klettern in andrer Weise gebraucht als der Fuß. Sie dient vorzugsweise zum Pflücken und Festhalten der Nahrung, wie dies schon bei niederen Säugetieren mit den Vorderpfoten geschieht. Mit ihr bauen sich manche Affen Nester in den Bäumen oder gar, wie der Schimpanse, Dächer zwischen den Zweigen zum Schutz gegen die Witterung. Mit ihr ergreifen sie Knüttel zur Verteidigung gegen Feinde oder bombardieren diese mit Früchten und Steinen. Mit ihr vollziehen sie in der Gefangenschaft eine Anzahl einfacher, den Menschen abgesehener Verrichtungen. Aber grade hier zeigt sich, wie groß der Abstand ist zwischen der unentwickelten Hand selbst der menschenähnlichsten Affen und der durch die Arbeit von Jahrhunderttausenden hoch ausgebildeten Menschenhand. Die Zahl und allgemeine Anordnung der Knochen und Muskeln stimmen bei beiden; aber die Hand des niedrigsten Wilden kann Hunderte von Verrichtungen ausführen, die keine Affenhand ihr nachmacht. Keine Affenhand hat je das rohste Steinmesser verfertigt. Die Verrichtungen, denen unsre Vorfahren im Übergang vom Affen zum Menschen im Lauf vieler Jahrtausende allmählich ihre Hand anpassen lernten, können daher anfangs nur sehr einfache gewesen sein.
Die niedrigsten Wilden, selbst diejenigen, bei denen ein Rückfall in einen mehr tierähnlichen Zustand mit gleichzeitiger körperlicher Rückbildung anzunehmen ist, stehn immer noch weit höher als jene Übergangsgeschöpfe. Bis der erste Kiesel durch Menschenhand zum Messer verarbeitet wurde, darüber mögen Zeiträume verflossen sein, gegen die die uns bekannte geschichtliche Zeit unbedeutend erscheint. Aber der entscheidende Schritt war getan: Die Hand war frei geworden und konnte sich nun immer neue Geschicklichkeiten erwerben, und die damit erworbene größere Biegsamkeit vererbte und vermehrte sich von Geschlecht zu Geschlecht. So ist die Hand nicht nur das Organ der Arbeit, sie ist auch ihr Produkt. Nur durch Arbeit, durch Anpassung an immer neue Verrichtungen, durch Vererbung der dadurch erworbenen besondern Ausbildung der Muskel, Bänder, und in längeren Zeiträumen auch der Knochen, und durch immer erneuerte Anwendung dieser vererbten Verfeinerung auf neue, stets ver- |446| wickeltere Verrichtungen hat die Menschenhand jenen hohen Grad von Vollkommenheit erhalten, auf dem sie Raffaelsche Gemälde, Thorvaldsensche Statuen, Paganinische Musik hervorzaubern konnte. Aber die Hand stand nicht allein. Sie war nur ein einzelnes Glied eines ganzen, höchst zusammengesetzten Organismus. Und was der Hand zugute kam, kam auch dem ganzen Körper zugute, in dessen Dienst sie arbeitete – und zwar doppelter Weise. Zuerst infolge des Gesetzes der Korrelation des Wachstums, wie Darwin es genannt hat. Nach diesem Gesetz sind bestimmte Formen einzelner Teile eines organischen Wesens stets an gewisse Formen andrer Teile geknüpft, die scheinbar gar keinen Zusammenhang mit jenen haben. So haben alle Tiere, welche rote Blutzellen ohne Zellenkern besitzen und deren Hinterkopf mit dem ersten Rückgratswirbel durch zwei Gelenkstellen (Kondylen) verbunden ist, ohne Ausnahme auch Milchdrüsen zum Säugen der Jungen. So sind bei Säugetieren gespaltene Klauen regelmäßig mit dem mehrfachen Magen zum Wiederkäuen verbunden. Änderungen bestimmter Formen ziehn Änderungen der Form andrer Körperteile nach sich, ohne daß wir den Zusammenhang erklären können. Ganz weiße Katzen mit blauen Augen sind immer, oder beinahe immer, taub.
Die allmähliche Verfeinerung der Menschenhand und die mit ihr Schritt haltende Ausbildung des Fußes für den aufrechten Gang hat unzweifelhaft auch durch solche Korrelation auf andre Teile des Organismus rückgewirkt. Doch ist diese Einwirkung noch viel zu wenig untersucht, als daß wir hier mehr tun könnten, als sie allgemein konstatieren. Weit wichtiger ist die direkte, nachweisbare Rückwirkung der Entwicklung der Hand auf den übrigen Organismus. Wie schon gesagt, waren unsre äffischen Vorfahren gesellig; es ist augenscheinlich unmöglich, den Menschen, das geselligste aller Tiere, von einem ungeselligen nächsten Vorfahren abzuleiten. Die mit der Ausbildung der Hand, mit der Arbeit, beginnende Herrschaft über die Natur erweiterte bei jedem neuen Fortschritt den Gesichtskreis des Menschen. An den Naturgegenständen entdeckte er fortwährend neue, bisher unbekannte Eigenschaften. Andrerseits trug die Ausbildung der Arbeit notwendig dazu bei, die Gesellschaftsglieder näher aneinanderzuschließen, indem sie die Fälle gegenseitiger Unterstützung, gemeinsamen Zusammenwirkens vermehrte und das Bewußtsein von der Nützlichkeit dieses Zusammenwirkens für jeden einzelnen klärte. Kurz, die werdenden Menschen kamen dahin, daß sie einander etwas zu sagen hatten. Das Bedürfnis schuf sich sein Organ: Der unentwickelte Kehlkopf des Affen bildete sich langsam aber sicher um, durch Modulation für stets gesteigerte Modulation, und die Organe des Mundes lernten allmählich einen artikulierten Buchstaben nach dem andern aussprechen. Daß diese Erklärung der Entstehung der Sprache aus und mit der Arbeit die einzig richtige ist, beweist der Vergleich mit den Tieren. Das wenige, was diese, selbst die höchstentwickelten, einander mitzuteilen haben, können sie einander auch ohne artikulierte Sprache mitteilen. Im Naturzustand fühlt kein Tier es als einen Mangel, nicht sprechen oder menschliche Sprache nicht verstehn zu können. Ganz anders, wenn es durch Menschen gezähmt ist. Der Hund und das Pferd haben im Umgang mit Menschen ein so gutes Ohr für artikulierte Sprache erhalten, daß sie jede Sprache leicht soweit verstehn lernen, wie ihr Vorstellungskreis reicht. Sie haben sich ferner die Fähigkeit für Empfindungen wie Anhänglichkeit an Menschen, Dankbarkeit usw. erworben, die ihnen früher fremd waren; und wer viel mit solchen Tieren umgegangen ist, wird sich kaum der Überzeugung verschließen können, daß es Fälle genug gibt, wo sie jetzt die Unfähigkeit zu sprechen als einen Mangel empfinden, dem allerdings bei ihren allzusehr in bestimmter Richtung spezialisierten Stimmorganen leider nicht mehr abzuhelfen ist. Wo aber das Organ vorhanden ist, da fällt auch diese Unfähigkeit innerhalb gewisser Grenzen weg.
Die Mundorgane der Vögel sind sicher so verschieden wie nur möglich von denen des Menschen, und doch sind Vögel die einzigen Tiere, die sprechen lernen; und der Vogel mit der abscheulichsten Stimme, der Papagei, spricht am besten. Man sage nicht, er verstehe nicht, was er spricht. Allerdings wird er aus reinem Vergnügen am Sprechen und an der Gesellschaft von Menschen stundenlang seinen ganzen Wortreichtum plappernd wiederholen. Aber soweit sein Vorstellungskreis reicht, soweit kann er auch verstehen lernen, was er sagt. Man lehre einen Papagei Schimpfwörter, so daß er eine Vorstellung von ihrer Bedeutung bekommt (ein Hauptvergnügen aus heißen Ländern zurücksegelnder Matrosen); man reize ihn, und man wird bald finden, daß er seine Schimpfwörter ebenso richtig zu verwerten weiß wie eine Berliner Gemüsehökerin. Ebenso beim Betteln um Leckereien. Arbeit zuerst, nach und dann mit ihr die Sprache – das sind die beiden wesentlichsten Antriebe, unter deren Einfluß das Gehirn eines Affen in das bei aller Ähnlichkeit weit größere und vollkommnere eines Menschen allmählich übergegangen ist. Mit der Fortbildung des Gehirns aber ging Hand in Hand die Fortbildung seiner nächsten Werkzeuge, der Sinnesorgane. Wie schon die Sprache in ihrer allmählichen Ausbildung notwendig begleitet wird von einer entsprechenden Verfeinerung des Gehörorgans, so die Ausbildung des Gehirns überhaupt von der der sämtlichen Sinne. Der Adler sieht viel weiter als der Mensch, aber des Menschen Auge sieht viel mehr an den Dingen als das des Adlers. Der Hund hat eine weit feinere Spürnase als der Mensch, aber er unterscheidet nicht den hundertsten Teil der Gerüche, die für diesen bestimmte Merkmale verschiedner Dinge sind. Und der Tastsinn, der beim Affen kaum in seinen rohsten Anfingen existiert, ist erst mit der Menschenhand selbst, durch die Arbeit, herausgebildet worden. Die Rückwirkung der Entwicklung des Gehirns und seiner dienstbaren Sinne, des sich mehr und mehr klärenden Bewußtseins, Abstraktions- und Schlußvermögens auf Arbeit und Sprache gab beiden immer neuen Anstoß zur Weiterbildung, einer Weiterbildung, die nicht etwa einen Abschluß fand, sobald der Mensch endgültig vom Affen geschieden war, sondern die seitdem bei verschiednen Völkern und zu verschiednen Zeiten verschieden nach Grad und Richtung, stellenweise selbst unterbrochen durch örtlichen und zeitlichen Rückgang, im ganzen und großen gewaltig vorangegangen ist; einerseits mächtig vorangetrieben, andrerseits in bestimmtere Richtungen gelenkt durch ein mit dem Auftreten des fertigen Menschen neu hinzutretendes Element – die Gesellschaft.
Hunderttausende von Jahren – in der Geschichte der Erde nicht mehr als eine Sekunde im Menschenleben – sind sicher vergangen, ehe aus dem Rudel baumkletternder Affen eine Gesellschaft von Menschen hervorgegangen war. Aber schließlich war sie da. Und was finden wir wieder als den bezeichnenden Unterschied zwischen Affenrudel und Menschengesellschaft? Die Arbeit. Das Affenrudel begnügte sich damit, seinen Futterbezirk abzuweiden, der ihm durch die geographische Lage oder durch den Widerstand benachbarter Rudel zugeteilt war; es unternahm Wanderungen und Kämpfe, um neues Futtergebiet zu gewinnen, aber es war unfähig, aus dem Futterbezirk mehr herauszuschlagen, als er von Natur bot, außer daß es ihn unbewußt mit seinen Abfällen düngte. Sobald alle möglichen Futterbezirke besetzt waren, konnte keine Vermehrung der Affenbevölkerung mehr stattfinden; die Zahl der Tiere konnte sich höchstens gleichbleiben. Aber bei allen Tieren findet Nahrungsverschwendung in hohem Grade statt, und daneben Ertötung des Nahrungsnachwuchses im Keime. Der Wolf schont nicht, wie der Jäger, die Rehgeiß, die ihm im nächsten Jahr die Böcklein liefern soll; die Ziegen in Griechenland, die das junge Gestrüpp abweiden, eh‘ es heranwächst, haben alle Berge des Landes kahlgefressen. Dieser »Raubbau« der Tiere spielt bei der allmählichen Umwandlung der Arten eine wichtige Rolle, indem er sie zwingt, andrer als der gewohnten Nahrung sich anzubequemen, wodurch ihr Blut andre chemische Zusammensetzung bekommt und die ganze Körperkonstitution allmählich eine andre wird, während die einmal fixierten Arten absterben. Es ist nicht zu bezweifeln, daß dieser Raubbau mächtig zur Menschwerdung unsrer Vorfahren beigetragen hat. Bei einer Affenrasse, die an Intelligenz und Anpassungsfähigkeit allen andern weit voraus war, mußte er dahin führen, daß die Zahl der Nahrungspflanzen sich mehr und mehr ausdehnte, daß von den Nahrungspflanzen mehr und mehr eßbare Teile zur Verzehrung kamen, kurz, daß die Nahrung immer mannigfacher wurde und mit ihr die in den Körper eingehenden Stoffe, die chemischen Bedingungen der Menschwerdung. Das alles war aber noch keine eigentliche Arbeit. Die Arbeit fängt an mit der Verfertigung von Werkzeugen. Und was sind die ältesten Werkzeuge, die wir vorfinden? Die ältesten, nach den vorgefundenen Erbstücken vorgeschichtlicher Menschen und nach der Lebensweise der frühesten geschichtlichen Völker wie der rohesten jetzigen Wilden zu urteilen? Werkzeuge der Jagd und des Fischfangs, erstere zugleich Waffen. Jagd und Fischfang aber setzen den Übergang von der bloßen Pflanzennahrung zum Mitgenuß des Fleisches voraus, und hier haben wir wieder einen wesentlichen Schritt zur Menschwerdung.
Die Fleischkost enthielt in fast fertigem Zustand die wesentlichsten Stoffe, deren der Körper zu seinem Stoffwechsel bedarf; sie kürzte mit der Verdauung die Zeitdauer der übrigen vegetativen, dem Pflanzenleben entsprechenden Vorgänge im Körper ab und gewann damit mehr Zeit, mehr Stoff und mehr Lust für die Betätigung des eigentlich tierischen (animalischen) Lebens. Und je mehr der werdende Mensch sich von der Pflanze entfernte, desto mehr erhob er sich auch über das Tier. Wie die Gewöhnung an Pflanzennahrung neben dem Fleisch die wilden Katzen und Hunde zu Dienern des Menschen gemacht, so hat die Angewöhnung an die Fleischnahrung neben der Pflanzenkost wesentlich dazu beigetragen, dem werdenden Menschen Körperkraft und Selbständigkeit zu geben. Am wesentlichsten aber war die Wirkung der Fleischnahrung auf das Gehirn, dem nun die zu seiner Ernährung und Entwicklung nötigen Stoffe weit reichlicher zuflossen als vorher, und das sich daher von Geschlecht zu Geschlecht rascher und vollkommener ausbilden konnte. Mit Verlaub der Herren Vegetarianer, der Mensch ist nicht ohne Fleischnahrung zustande gekommen, und wenn die Fleischnahrung auch bei allen uns bekannten Völkern zu irgendeiner Zeit einmal zur Menschenfresserei geführt hat (die Vorfahren der Berliner, die Weletaben oder Wilzen, aßen ihre Eltern noch im 10. Jahrhundert), so kann uns das heute nichts mehr ausmachen.
Die Fleischkost führte zu zwei neuen Fortschritten von entscheidender Bedeutung: zur Dienstbarmachung des Feuers und zur Zähmung von Tieren. Die erstere kürzte den Verdauungsprozeß noch mehr ab, indem sie die Kost schon sozusagen halbverdaut an den Mund brachte, die zweite machte die Fleischkost reichlicher, indem sie neben der Jagd eine neue regelmäßigere Bezugsquelle dafür eröffnete, und lieferte außerdem in der Milch und ihren Produkten ein neues, dem Fleisch an Stoffmischung mindestens gleichwertiges Nahrungsmittel. So wurden beide schon direkt neue Emanzipationsmittel für den Menschen; auf ihre indirekten Wirkungen im einzelnen einzugehn, würde uns hier zu weit führen, von so hoher Wichtigkeit sie auch für die Entwicklung des Menschen und der Gesellschaft gewesen sind. Wie der Mensch alles Eßbare essen lernte, so lernte er auch in jedem Klima leben. Er verbreitete sich über die ganze bewohnbare Erde, er, das einzige Tier, das in sich selbst die Machtvollkommenheit dazu besaß. Die andren Tiere, die sich an alle Klimata gewöhnt haben, haben dies nicht aus sich selbst, nur im Gefolge des Menschen, gelernt: Haustiere und Ungeziefer. Und der Übergang aus dem gleichmäßig heißen Klima der Urheimat in kältere Gegenden, wo das Jahr sich in Winter und Sommer teilte, schuf neue Bedürfnisse: Wohnung und Kleidung zum Schutz gegen Kälte und Nässe, neue Arbeitsgebiete und damit neue Betätigungen, die den Menschen immer weiter vom Tier entfernten. Durch das Zusammenwirken von Hand, Sprachorganen und Gehirn nicht allein bei jedem einzelnen, sondern auch in der Gesellschaft, wurden die Menschen befähigt, immer verwickeltere Verrichtungen auszuführen, immer höhere Ziele sich zu stellen und zu erreichen. Die Arbeit selbst wurde von Geschlecht zu Geschlecht eine andre, vollkommnere, vielseitigere. Zur Jagd und Viehzucht trat der Ackerbau, zu diesem Spinnen und Weben, Verarbeitung der Metalle, Töpferei, Schiffahrt. Neben Handel und Gewerbe trat endlich Kunst und Wissenschaft, aus Stämmen wurden Nationen und Staaten. Recht und Politik entwickelten sich, und mit ihnen das phantastische Spiegelbild der menschlichen Dinge im menschlichen Kopf: die Religion.
Vor allen diesen Gebilden, die zunächst als Produkte des Kopfs sich darstellten und die die menschlichen Gesellschaften zu beherrschen schienen, traten die bescheidneren Erzeugnisse der arbeitenden Hand in den Hintergrund; und zwar um so mehr, als der die Arbeit planende Kopf schon auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe der Gesellschaft (z.B. schon in der einfachen Familie) die geplante Arbeit durch andre Hände ausführen lassen konnte als die seinigen. Dem Kopf, der Entwicklung und Tätigkeit des Gehirns, wurde alles Verdienst an der rasch fortschreitenden Zivilisation zugeschrieben; die Menschen gewöhnten sich daran, ihr Tun aus ihrem Denken zu erklären statt aus ihren Bedürfnissen (die dabei allerdings im Kopf sich widerspiegeln, zum Bewußtsein kommen) – und so entstand mit der Zeit jene idealistische Weltanschauung, die namentlich seit Untergang der antiken Welt die Köpfe beherrscht hat. Sie herrscht noch so sehr, daß selbst die materialistischsten Naturforscher der Darwinschen Schule sich noch keine klare Vorstellung von der Entstehung des Menschen machen können, weil sie unter jenem ideologischen Einfluß die Rolle nicht erkennen, die die Arbeit dabei gespielt hat.
Die Tiere, wie schon angedeutet, verändern durch ihre Tätigkeit die äußere Natur ebensogut, wenn auch nicht in dem Maße wie der Mensch, und diese durch sie vollzogenen Änderungen ihrer Umgebung wirken, wie wir sahen, wieder verändernd auf ihre Urheber zurück. Denn in der Natur geschieht nichts vereinzelt. Jedes wirkt aufs andre und umgekehrt, und es ist meist das Vergessen dieser allseitigen Bewegung und Wechselwirkung, das unsre Naturforscher verhindert, in den einfachsten Dingen klarzusehn. Wir sahen, wie die Ziegen die Wiederbewaldung von Griechenland verhindern; in Sankt Helena haben die von den ersten Anseglern ans Land gesetzten Ziegen und Schweine es fertiggebracht, die alte Vegetation der Insel fast ganz auszurotten, und so den Boden bereitet, auf dem die von späteren Schiffern und Kolonisten zugeführten Pflanzen sich ausbreiten konnten. Aber wenn die Tiere eine dauernde Einwirkung auf ihre Umgebung ausüben, so geschieht dies unabsichtlich und ist, für diese Tiere selbst, etwas Zufälliges. Je mehr die Menschen sich aber vom Tier entfernen, desto mehr nimmt ihre Einwirkung auf die Natur den Charakter vorbedachter, planmäßiger, auf bestimmte, vorher bekannte Ziele gerichteter Handlung an. Das Tier vernichtet die Vegetation eines Landstrichs, ohne zu wissen, was es tut. Der Mensch vernichtet sie, um in den freigewordnen Boden Feldfrüchte zu säen oder Bäume und Reben zu pflanzen, von denen er weiß, daß sie ihm ein Vielfaches der Aussaat einbringen werden. Er versetzt Nutzpflanzen und Haustiere von einem Land ins andre und ändert so die Vegetation und das Tierleben ganzer Weltteile. Noch mehr. Durch künstliche Züchtung werden Pflanzen wie Tiere unter der Hand des Menschen in einer Weise verändert, daß sie nicht wiederzuerkennen sind.
Die wilden Pflanzen, von denen unsre Getreidearten abstammen, werden noch vergebens gesucht. Von welchem wilden Tier unsre Hunde, die selbst unter sich so verschieden sind, oder unsre ebenso zahlreichen Pferderassen abstammen, ist noch immer streitig. Es versteht sich übrigens von selbst, daß es uns nicht einfällt, den Tieren die Fähigkeit planmäßiger, vorbedachter Handlungsweise abzustreiten. Im Gegenteil. Planmäßige Handlungsweise existiert im Keime schon überall, wo Protoplasma, lebendiges Eiweiß existiert und reagiert, d.h. bestimmte, wenn auch noch so einfache Bewegungen als Folge bestimmter Reize von außen vollzieht. Solche Reaktion findet statt, wo noch gar keine Zelle, geschweige eine Nervenzelle, besteht. Die Art, wie insektenfressende Pflanzen ihre Beute abfangen, erscheint ebenfalls in gewisser Beziehung als planmäßig, obwohl vollständig bewußtlos. Bei den Tieren entwickelt sich die Fähigkeit bewußter, planmäßiger Aktion im Verhältnis zur Entwicklung des Nervensystems und erreicht bei den Säugetieren eine schon hohe Stufe.
Auf der englischen Fuchsparforcejagd kann man täglich beobachten, wie genau der Fuchs seine große Ortskenntnis zu verwenden weiß, um seinen Verfolgern zu entgehn, und wie gut er alle Bodenvorteile kennt und benutzt, die die Fährte unterbrechen. Bei unsern im Umgang mit Menschen höher entwickelten Haustieren kann man tagtäglich Streiche der Schlauheit beobachten, die mit denen menschlicher Kinder ganz auf derselben Stufe stehn. Denn wie die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Keims im Mutterleibe nur eine abgekürzte Wiederholung der millionenjährigen körperlichen Entwicklungsgeschichte unsrer tierischen Vorfahren, vom Wurm angefangen, darstellt, so die geistige Entwicklung des menschlichen Kindes eine, nur noch mehr abgekürzte, Wiederholung der intellektuellen Entwicklung derselben Vorfahren, wenigstens der späteren. Aber alle planmäßige Aktion aller Tiere hat es nicht fertiggebracht, der Erde den Stempel ihres Willens aufzudrücken. Dazu gehörte der Mensch. Kurz, das Tier benutzt die äußere Natur bloß und bringt Änderungen in ihr einfach durch seine Anwesenheit zustande; der Mensch macht sie durch seine Änderungen seinen Zwecken dienstbar, beherrscht sie. Und das ist der letzte, wesentliche Unterschied des Menschen von den übrigen Tieren, und es ist wieder die Arbeit, die diesen Unterschied bewirkt.
Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu |453| oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten nicht, daß sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen. Die Italiener der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirgs so sorgsam gehegten Tannenwälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, daß sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem Gebiet die Wurzel abgruben; sie ahnten noch weniger, daß sie dadurch ihren Bergquellen für den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen, damit diese zur Regenzeit um so wütendere Flutströme über die Ebene ergießen könnten. Die Verbreiter der Kartoffel in Europa wußten nicht, daß sie mit den mehligen Knollen zugleich die Skrofelkrankheit verbreiteten.
Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht – sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können. Und in der Tat lernen wir mit jedem Tag ihre Gesetze richtiger verstehn und die näheren und entfernteren Nachwirkungen unsrer Eingriffe in den herkömmlichen Gang der Natur erkennen. Namentlich seit den gewaltigen Fortschritten der Naturwissenschaft in diesem Jahrhundert werden wir mehr und mehr in den Stand gesetzt, auch die entfernteren natürlichen Nachwirkungen wenigstens unsrer gewöhnlichsten Produktionshandlungen kennen und damit beherrschen zu lernen. Je mehr dies aber geschieht, desto mehr werden sich die Menschen wieder als Eins mit der Natur nicht nur fühlen, sondern auch wissen, und je unmöglicher wird jene widersinnige und widernatürliche Vorstellung von einem Gegensatz zwischen Geist und Materie, Mensch und Natur, Seele und Leib, wie sie seit dem Verfall des klassischen Altertums in Europa aufgekommen und im Christentum ihre höchste Ausbildung erhalten hat.
Hat es aber schon die Arbeit von Jahrtausenden erfordert, bis wir einigermaßen lernten, die entferntern natürlichen Wirkungen unsrer auf die Produktion gerichteten Handlungen zu berechnen, so war dies noch weit schwieriger in bezug auf die entfernteren gesellschaftlichen Wirkungen dieser Handlungen. Wir erwähnten die Kartoffel und in ihrem Gefolge die Ausbreitung der Skrofeln. Aber was sind die Skrofeln gegen die Wirkungen, die die Reduktion der Arbeiter auf Kartoffelnahrung auf die Lebenslage der Volksmassen ganzer Länder hatte, gegen die Hungersnot, die 1847 im Gefolge der Kartoffelkrankheit Irland betraf, eine Million kartoffel- und fast nur kartoffelessender Irländer unter die Erde und zwei Millionen über das Meer warf? Als die Araber den Alkohol destillieren lernten, ließen sie sich nicht im Traume einfallen, daß sie damit eins der Hauptwerkzeuge geschaffen, womit die Ureinwohner des damals noch gar nicht entdeckten Amerikas aus der Welt geschafft werden sollten. Und als dann Kolumbus dies Amerika entdeckte, wußte er nicht, daß er damit die in Europa längst überwundne Sklaverei zu neuem Leben erweckte und die Grundlage zum Negerhandel legte. Die Männer, die im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert an der Herstellung der Dampfmaschine arbeiteten, ahnten nicht, daß sie das Werkzeug fertigstellten, das mehr als jedes andre die Gesellschaftszustände der ganzen Welt revolutionieren und namentlich in Europa durch Konzentrierung des Reichtums auf Seite der Minderzahl, und der Besitzlosigkeit auf Seite der ungeheuren Mehrzahl, zuerst der Bourgeoisie die soziale und politische Herrschaft verschaffen, dann aber einen Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat erzeugen sollte, der nur mit dem Sturz der Bourgeoisie und der Abschaffung aller Klassengegensätze endigen kann. – Aber auch auf diesem Gebiet lernen wir allmählich, durch lange, oft harte Erfahrung und durch Zusammenstellung und Untersuchung des geschichtlichen Stoffs, uns über die mittelbaren, entfernteren gesellschaftlichen Wirkungen unsrer produktiven Tätigkeit Klarheit zu verschaffen, und damit wird uns die Möglichkeit gegeben, auch diese Wirkungen zu beherrschen und zu regeln. Um diese Regelung aber durchzuführen, dazu gehört mehr als die bloße Erkenntnis. Dazu gehört eine vollständige Umwälzung unsrer bisherigen Produktionsweise und mit ihr unsrer jetzigen gesamten gesellschaftlichen Ordnung.
Alle bisherigen Produktionsweisen sind nur auf Erzielung des nächsten, unmittelbarsten Nutzeffekts der Arbeit ausgegangen. Die weiteren erst in späterer Zeit eintretenden, durch allmähliche Wiederholung und Anhäufung wirksam werdenden Folgen blieben gänzlich vernachlässigt. Das ursprüngliche gemeinsame Eigentum am Boden entsprach einerseits einem Entwicklungszustand der Menschen, der ihren Gesichtskreis überhaupt auf das Allernächste beschränkte, und setzte andrerseits einen gewissen Überfluß an verfügbarem Boden voraus, der gegenüber den etwaigen schlimmen Folgen dieser waldursprünglichen Wirtschaft einen gewissen Spielraum ließ. Wurde dieser Überschuß von Land erschöpft, so verfiel auch das Gemeineigentum. Alle höheren Formen der Produktion aber sind zur Trennung der Bevölkerung in verschiedne Klassen und damit zum Gegensatz von herrschenden und unterdrückten Klassen vorangegangen; damit aber wurde das Interesse der herrschenden Klasse das treibende Element der Produktion, soweit diese sich nicht auf den notdürftigsten Lebensunterhalt der Unterdrückten beschränkte. Am vollständigsten ist dies in der jetzt in Westeuropa herrschenden kapitalistischen Produktionsweise durchgeführt. Die einzelnen, Produktion und Austausch beherrschenden Kapitalisten können sich nur um den unmittelbarsten Nutzeffekt ihrer Handlungen kümmern. Ja selbst dieser Nutzeffekt – soweit es sich um den Nutzen des erzeugten oder ausgetauschten Artikels handelt – tritt vollständig in den Hintergrund; der beim Verkauf zu erzielende Profit wird die einzige Triebfeder. Die Sozialwissenschaft der Bourgeoisie, die klassische politische Ökonomie, beschäftigt sich vorwiegend nur mit den unmittelbar beabsichtigten gesellschaftlichen Wirkungen der auf Produktion und Austausch gerichteten menschlichen Handlungen. Dies entspricht ganz der gesellschaftlichen Organisation, deren theoretischer Ausdruck sie ist.
Wo einzelne Kapitalisten um des unmittelbaren Profits willen produzieren und austauschen, können in erster Linie nur die nächsten, unmittelbarsten Resultate in Betracht kommen. Wenn der einzelne Fabrikant oder Kaufmann die fabrizierte oder eingekaufte Ware nur mit dem üblichen Profitchen verkauft, so ist er zufrieden, und es kümmert ihn nicht, was nachher aus der Ware und deren Käufer wird. Ebenso mit den natürlichen Wirkungen derselben Handlungen. Die spanischen Pflanzer in Kuba, die die Wälder an den Abhängen niederbrannten und in der Asche Dünger genug für eine Generation höchst rentabler Kaffeebäume vorfanden – was lag ihnen daran, daß nachher die tropischen Regengüsse die nun schutzlose Dammerde herabschwemmten und nur nackten Fels hinterließen? Gegenüber der Natur wie der Gesellschaft kommt bei der heutigen Produktionsweise vorwiegend nur der erste, handgreiflichste Erfolg in Betracht; und dann wundert man sich noch, daß die entfernteren Nachwirkungen der hierauf gerichteten Handlungen ganz andre, meist ganz entgegengesetzte sind, daß die Harmonie von Nachfrage und Angebot in deren polaren Gegensatz umschlägt, wie der Verlauf jedes zehnjährigen industriellen Zyklus ihn vorführt und wie auch Deutschland im »Krach« ein kleines Vorspiel davon erlebt hat; daß das auf eigne Arbeit gegründete Privateigentum sich mit Notwendigkeit fortentwickelt zur Eigentumslosigkeit der Arbeiter, während aller Besitz sich mehr und mehr in den Händen von Nichtarbeitern konzentriert, daß […] Hier bricht das Manuskript ab.“
Engels verfolgt in diesem Text die Entwicklung des Geistes vom ersten Protoplasma bis zur letzten englischen Bourgeoisie. Der „Fortschritt“ darin wird von der Arbeit gewissermaßen angetriebenen – in einem dialektischen Prozeß: „Die Rückwirkung der Entwicklung des Gehirns und seiner dienstbaren Sinne, des sich mehr und mehr klärenden Bewußtseins, Abstraktions- und Schlußvermögens auf Arbeit und Sprache gab beiden immer neuen Anstoß zur Weiterbildung, einer Weiterbildung, die nicht etwa einen Abschluß fand, sobald der Mensch endgültig vom Affen geschieden war“ – sondern sich immer weiter vervollkommnete.
Die logische Entwicklung geht quasi bruchlos von den ersten Handgriffen zur höheren Mathematik über. Der Marxist Alfred Sohn-Rethel hat dem gegenüber auf eine fundamentale Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit hingewiesen, die mit der Einführung des Geldes ihren Anfang nahm – und spätestens in der Renaissance eine Aufspaltung der Handwerker in einige wenige Künstler und Wissenschaftler und immer zu viele Arbeiter bewirkte.
Einen weiteren Aufschluß dieses Abstraktionsvorgangs versprach ich mir von den sowjetischen Psychologen Lew Wygotski und Alexander Lurija. In ihren Schriften wurde ich erneut mit Affen-, Kleinkind- und Naturvölker-Forschung konfrontiert. Auch sie begriffen noch die Entwicklung vom „wilden Denken“ zum „abstrakten Denken“ evolutionär, linear, folgerichtig und als einen Fortschritt. Dem gegenüber noch einmal Sohn-Rethel: „Wenn es dem Marxismus nicht gelingt, der zeitlosen Wahrheitstheorie der herrschenden naturwissenschaftlichen Erkenntnislehren den Boden zu entziehen, dann ist die Abdankung des Marxismus als Denkstandpunkt eine bloße Frage der Zeit.“
Das „ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft“ besteht nach Marx darin, aus Geld mehr Geld zu machen: „In dieser Form prägt sich die bestimmende Seele der kapitalistischen Produktion am reinsten aus.“ Der Produktionsprozeß selbst wird dabei – im Streben nach Maximalprofit – ein „bloßes Mittel zur Verwertung des Kapitalwerts“. Es ist dies ein Abstraktionsvorgang – der rechnerisch funktioniert- indem er aus Qualitäten Quantitäten macht. Marx ging es darum, den Prozeß dieser „Realabstraktion“ darzustellen.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, in einer Rezension des neuen Band der MEGA (Teil 3. Band II/4.3, 1065 Seiten, 168 Euro): „Allein an diesem Bemühen läßt sich verfolgen, wie ernst es Marx war, der Materie mit einer streng wissenschaftlichen Arbeitsweise beizukommen, einer Methodik, die er einesteils von den Naturwissenschaften, andernteils aus einer gewissen Bedingungslosigkeit herzuleiten versuchte.“
Was meint der Rezensent bloß mit „Bedingungslosigkeit“? Die Abstraktionsvorgänge in der Warenproduktion? Im übrigen habe die Marxsche Wertkritik dem Justiz- und Versicherungswesen bereits wichtige Impulse verschafft, deswegen empfehle er die Lektüre auch dieses MEGA-Bandes aufs Wärmste.
In der FAZ hatte zuvor ein anderer Rezensent sich lobend über einen neudeutschen Philosophen geäußert, der kürzlich Marx und Engels als „Theoretiker der Dekadenz“ entlarvte. Zwar benutzten die beiden Theoretiker dieses Wort nie, im Zusammenhang des Kapital-Regimes sprachen sie jedoch wiederholt von „Krise“. Die „Marxsche Ideenwelt als eine Theorie des Zerfalls“ zu lesen, würde zudem derzeit nahe liegen, da die leninsche „Ausprägung gescheitert und die sozialdemokratische „verbürgerlicht“ sei. Sie ähnel nun – „ihrer historisch-revolutionären Perspektive beraubt, altkonservativ getönter Apokalyptik.“ Ein anderer FAZ-Autor hatte zuvor Marx und Engels als „Projektemacher“ dekonstruiert und in der SZ wird ein Engländer mit einer Neuinpterpretation des Kommunistischen Manifests vorgestellt: Die Marxisten haben dieses Pamphlet alles falsch verstanden, „die Wurzeln des Marx’schen Sozialismus liegen gar nicht in der Industrialisierung oder bei den Industriearbeitern,“ sondern bei Hegel, es geht im KM darum, dessen Theorie der bürgerlichen Gesellschaft zu verbessern. Man sieht, der Kreativitätswahn macht auch vor der Marxschen Warenanalyse nicht halt.
Die Zeitschrift „Cicero“ („Marx Stärke lag in der Analyse“) bringt in diesem Ringen einen wissenschaftlichen „Marx-Experten“ bei: „Ein Blick auf das Originalmanuskript von Marx verrät das Unfertige, das Experimentelle dieser Schriften. Außerdem werden Stellen offenkundig, bei denen er selbst auch Probleme und Widersprüchlichkeiten erkannt hat. Wenn man das sieht, dann bekommt man auch ein völlig anderes Verhältnis zu diesen Texten. Vor diesem Hintergrund zerbröckelt der Mythos einer geschlossenen Weltanschauung in der Marx’schen Theorie, der sowohl von der deutschen Sozialdemokratie als auch vom Marxismus-Leninismus getragen wurde, sehr schnell.“
Die für den „Marx-Experten“ immer wiederkehrende Frage lautet: Wie weit war Marx von einer Naturgesetzlichkeit überzeugt? Sein „großes Ideologem“ war aber doch eher, „das diese [kapitalistische] Produktionsweise so tut, als sei sie naturgegeben“…Das, was im ‚Kapital‘ steht, darf zumindest als ein interessantes Angebot verstanden werden. Ob das im Einzelnen noch so nachvollzogen werden kann oder ob das in weiten Strecken revidiert werden muss, ist eine andere Frage. Aber vor allem der Ansatz des Denkens ist nach wie vor interessant. Marx sagt, der Kapitalismus scheitert von vornherein an einem Problem: Er schafft es nicht, die Bewegung des sich verwertenden Wertes mit dem Stoffwechsel in Einklang zu bringen. Beides zusammen geht nicht. Das ist schon ein spannender Ansatz. Da entstehen in der Verwertung des Wertes Selbstbezüglichkeiten in Abkoppelung von materieller Realität. Der durch Arbeit geschaffene Wert, der in jeder Ware enthalten ist, ist im Geld letztlich vollständig unsichtbar.“
Die wertkonservative Springerzeitung „Welt“ fragte desungeachtet, d.h.abgesehen von seiner Werttheorie: Was bleibt von Karl Marx?
Am 5. März 1852 schrieb der Revolutionär aus dem Londoner Exil an Joseph Weydemeyer: „Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. (…) Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist; 2. dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt; 3. dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.“ Darauf nun „Die Welt“: „Wenn je eine Theorie durch die Praxis widerlegt worden ist, dann diese.“
Es kommt aber noch schlimmer: „Marx war der erste Sozialdarwinist. „Sehr bedeutsam ist Darwins Schrift und passt mir als naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfs“, schrieb er an den Sozialisten Ferdinand Lassalle. Dabei hatte Marx, wie so viele Sozialdarwinisten, Darwin gründlich missverstanden. Denn bei Darwin kämpfen weder Klassen noch Rassen noch Arten oder Individuen gegeneinander. Vielmehr geht es darum, wie winzige Mutationen einem Individuum und seinen Nachkommen einen Überlebensvorteil verschaffen, sodass sich die Veränderung über Generationen in einer ganzen Population durchsetzt. Als Marx (immerhin!) erkannte, dass Darwin eben nicht „als naturwissenschaftliche Unterlage“ des Klassenkampfs taugte, war seine Reaktion typisch. Anstatt seine eigenen Thesen zu überprüfen, warf er Darwin vor, Ideologe zu sein: „Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, ‚Erfindungen‘ und Malthus’schem ‚Kampf ums Dasein‘ wiedererkennt“, spottete Marx in einem Brief an Engels.
Noch 150 Jahre später wurde von links- und rechtskonservativer Seite dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins vorgeworfen, sein Buch „Das egoistische Gen“ sei schlicht und einfach eine Rechtfertigungsschrift für den Thatcherismus. Dabei spricht die Tatsache, dass Darwin in der Natur Vorgänge beobachtete, die eher an die Marktwirtschaft erinnern als an eine sozialistische Planwirtschaft, nicht gegen Darwins Theorie, sondern eben für die Marktwirtschaft. Denn tatsächlich wirkt die Konkurrenz auf dem Markt wie der natürliche Evolutionsdruck und erzwingt eine stete Verbesserung der Produkte und der Produktionsmethoden.“
So weit „Die Welt“, die sich mit diesem Analogismus auf die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein Volhard berufen kann, die klar erkannt hat, dass „die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. – Mindestens wenn sie in die Verwertungsmaschine der Unterhaltungsindustrie gerät. Oder in die der Pharma- bzw. Kosmetikindustrie und des Wissenschaftsbetriebs…
Z. B. in Form des „Modelltiers“ Labormaus. In den biologischen Forschungseinrichtungen, die von der Wissenssoziologin Karin Knorr Cetina untersucht wurden, „werden Mäuse als Umwelt ihrer Reproduktionsorgane betrachtet, deren Funktion benötigt wird – zur Herstellung von transgenen Mäusen, mit Hilfe derer die Funktion bestimmter Gene kontrolliert werden kann.“ Die individuelle Maus wird dabei „zur apparativen Komponente“. Ähnliches läßt sich auch von den Nutztieren sagen, die in der industriellen Landwirtschaft zur Produktion von Milch, Fleisch, Eier usw. dienen.

Heimtiermesse Berlin
Die Heimtiermesse in der Treptower „Arena“ am vergangenen Wochenende hatte ein ähnliches Angebot für Tierhalter wie das Sommer-„Event 4 Happy Dogs“ auf der Trabrennbahn in Karlshorst, das vom Hundenahrungshersteller „Happy Dog“ gesponsort wurde. Noch nie sah ich so viel fröhliche Hunde wie dort. Auch auf der Heimtiermesse waren viele Leute mit ihren Hunden erschienen (sie brauchten dafür einen Impfpaß) – die Tiere wirkten jedoch gereizter. Hier war es nicht ein Tag draußen – mit einem Programm nur für sie, sondern eine typische Hallenmesse – für ihre Besitzer. Und dann machten sie vielleicht auch die vielen dort ausgestellten exotischen Tiere nervös.
In einer Hälfte der Arena hatten man lauter Käfigreihen aufgebaut – für Katzen, die dort prämiert wurden. Fast alle schliefen, als ich durch die Reihen ging – und zwar auf ihrer Größe angemessenen kleinen Betten, Sofas und Sesseln. Für drei „sibirische Katzen“ hatte man sogar ein ganzes eingekäfigtes Zimmer in Originalgröße mit allen Einrichtungsgegenständen aufgebaut. Auch sie schliefen. Die Besitzer bzw. Züchter saßen auf Campingstühlen neben den Käfigen und bewachten mit einigem Stolz ihre Lieblinge. „Sind die so ermattet von dem Trubel, dass sie alle schlafen?“ fragte ich ein Ehepaar, das drei fast weiße Angorakatzen ausgestellt hatte. „I wo,“ meinten sie, „die sind das doch gewohnt. Aber das ist jetzt ihre Zeit, die schlafen immer Nachmittags“.
Im Rest der Halle gab es vor allem Stände von Tiernahrungsherstellern. Gleich mehrere Händler bestätigten mir eine These der Biologin Donna Haraway, dass speziell im Marktsegment „Premiumfutter“ (damit ist u.a. Bio- bzw. Öko- und Zusatzfutter gemeint) noch was raus zu holen ist. Daneben gibt es auch immer mehr „Hundeschulen“ und „Hundemasseure“. Einen kleinen „Agility-Parcours“ – wie in Karlshorst gab es in der „Arena“ ebenfalls. Er war dicht umlagert von Messebesuchern. Als ich daran vorbeiging, führte eine junge Frau gerade „Dog-Dancing“ mit ihrem Colliemischling vor – nach einer Melodie von Richard Clayderman. Davor hatte es dort eine „musikalische Hundkür“ vom FSC Hönow gegeben, eine „Hundemodenschau“ und eine „Hundeyoga“-Vorführung sowie eine Einführung in die „Bachblüten-Therapie für Hunde“. Auch das hatte Donna Haraway in ihrem Buch „When Species Meet“ bereits prophezeit: Dass die medizinischen und psychologischen Therapieangebote für Hunde (und Katzen) immer mehr zunehmen.
Daneben gab es auf der Heimtiermesse aber auch noch etliche Stände mit anderen lebenden Tieren und die dafür notwendigen Paraphernalia bzw. Acessoires: Kaninchen, Meerschweinchen, Fische, Eidechsen, Hühner, Frettchen, Papageien, Schildkröten, Gespensterheuschrecken und Wasserpflanzen, sowie Stofftiere, Kratzbäume, Katzenklos, Maulkörbe, Schlafkörbe, Tierärzte, Tierpsychologen, Tierphotographen, Tierschutzvereine, Tiertafeln, Haustier-Krankenversicherungen und -Bestattungsinstitute…
Am meisten beeindruckte – nicht nur mich – ein Stand der „Schlangenzucht Schöneiche“, die etwa 50 „Tupperware“-Boxen mit verschiedenen kleinen Nattern aus eigener Zucht ausgestellt hatte, sowie ein Stand der „Alpakafarm im Havelland“ mit selbsthergestellten Alpaka-Wollprodukten neben dem sich ein Pferch mit vier absolut bezaubernden Alpakas befand: Ein Hengst und eine Stute mit zwei Kälbern. Sie kosteten zwischen 2000 und 10.000 Euro – waren also nicht gerade billig. Aber mein schwäbischer Hausbesitzer hat mir sowieso das Halten von Huftieren in meiner Hinterhofwohnung verboten. Sein türkischer Vorgänger hielt jedoch noch selber regelmäßig auf seinem Balkon im Vorderhaus ein Schaf – für das alljährliche Opferfest.

Heimtiermesse Köln
Katzenbücher – man sagt komischerweise nicht Katzenliteratur. Gemeint sind damit mehr oder weniger reich bebilderte und üppig gestaltete Geschichten über eine oder mehrere Katzen. Nicht selten von Halbprominenten aus dem nicht-schreibenden Gewerbe als eine Art Biographie verfaßt. Bei Amazon liegen davon fast 14.000 Titel auf Lager. Zuletzt erschien: „Der literarische Katzenkalender 2013“ von Julia Bachstein. Aber auch die Katzenfuttermarke „Whiskas“ („Whiskas weiß was Katzen lieben“ – eine Persiflage auf den Slogan eines Waschmaschinenherstellers: „Bauknecht weiß was Frauen lieben“) – des reaktionären US-Süßigkeitenkonzerns „Mars“, dem die „Marke ‚Whiskas'“ inzwischen gehört, hat für das kommende Jahr einen Kalender „Whiskas Katzenleben“ herausgebracht. Erwähnt sei ferner der Sammelband „Weihnachtskatze“, u.a. mit einer Geschichte von Eva Demski.
Der Literaturabend mit Lesungen aus Katzenbüchern, der am 26.November in der Kreuzberger Passionskirche stattfand, wurde von einer Firma „gesponsort“, die u.a. Bio-Katzenfutter herstellt: Gimborn, einst von einem rheinische Apotheker gegründet. Sie war der erste Anbieter von laktose-freier Katzenmilch, heute gehört sie zum Mixkonzern „Penta Investment Prag“. Der Leseabend in der Passionskirche, übrigens die einzige Kirche mit einer Bar, fand im Rahmen der Herbstkampagne des Branchenverbands der deutschen Buchhändler „Stadt Land Buch“ statt. Organisiert wurde er vom Schriftsteller Detlef Bluhm, dessen Kater Paul 2011 mit 10 Jahren starb. Im selben Jahr stellte Bluhm bereits „Das Facebook-Tagebuch Kater Paul“ auf der Leipziger Buchmesse vor, und richtete einen blog „Kater Paul“ ein, in dem er Beiträge zur Kulturgeschichte der Katze veröffentlicht. Auch der Leseabend, der sich 2011 noch auf „Katzenkrimis“ beschränkte, gehört zu Bluhms „Kater Paul“-Aktivitäten. Von Profisprechern vorgetragen wurden heuer klassische Katzengeschichten – u.a. von James Joyce und H.P. Lovecraft, sowie neuere u.a. von Olga und Wladimir Kaminer. Erstere hat ein ganzes „Katzenbuch“ geschrieben – ihre Lebensgeschichte, die bis heute von Katzen quasi getaktet wird. Derzeit kümmert sie sich um zwei Stadt- und vier Landkatzen. Auch ihr Mann hat über diese bereits etliche Geschichten veröffentlicht. Er las jedoch eine über den Kater der Freundin seiner Frau vor.
Unter den Haustieren scheint es vor allem der Hund zu sein, der sich in die menschliche Parallelwelt gedanklich reinversetzt. Bei der Katze ist es umgekehrt der Mensch. Die Jugendbuchverfasserin Sigrun Casper hat das für ihren Roman „Eine andere Katze“ getan, das Tier geriet ihr dabei jedoch zusehens – und trotz der Verwendung neuesten Wissens aus der experimentellen Biologie – ins Unwirkliche. Die Katzengeschichte „Rufus“ von Doris Lessing beschränkt sich dagegen auf geduldige Beobachtungen, wobei auf andere Weise herauskam, dass der ihr einst zugelaufene „Rufus“ zuvor stark von Menschen geprägt wurde. Sie interpretiert dabei dessen Verhalten und Lautäußerungen als „Sprache“. Ähnliches gilt für die kleinen Geschichten in „Doris Lessings Katzenbuch“.
Der Philosoph Jacques Derrida begann sein Buch „Das Tier, das ich also bin“ mit einer kleinen Geschichte über seine Katze, die ihn einmal morgens im Badezimmer überraschte: Da sah er, dass sie sah, dass er nackt war. Die feministische Biologin Donna Haraway hat Derrida daraufhin kritisiert: Statt diese „Begegnung“ real fort zu setzen, habe er sofort angefangen, ins Abschweifige zu räsonieren, von seiner oder einer wirklichen Katze war fortan nicht mehr die Rede. Ähnlich verfuhr Bohumil Hrabal in seinem Buch: „Die Katze Autitschko“, in dem es vornehmlich um die Schuldgefühle des Autors gegenüber seinen Katzen geht, die er gelegentlich vernachlässigte und deren Nachkommen er tötete.
Ganz im Gegensatz dazu steht der große japanische Roman „Ich der Kater“ von Natsume Soseki. Der Autor nahm dieses herrenlose Tier bei sich auf. Als es 1908 starb, veröffentlichte er eine Aufsatzsammlung mit dem Titel: „Das Grab eines Katers“. In „Ich der Kater“ spricht das Tier, es geht dabei jedoch um eine satirische Kritik an der sich um 1900 stürmisch industrialisierenden Gesellschaft Japans. Auch auf dem Leseabend in der Parochialkirche wurde die Geschichte eines Katers mit der „gefährlichen Begabung“, sprechen zu können, vorgelesen, wobei es ebenfalls um so etwas wie eine Gesellschaftskritik ging. Zuvor – 1819 – gab es bereits eine romantisch-satirische Kater-Biographie: die „Lebens-Ansichten des Katers Murr“ von E.T.A. Hoffmann: Der wie ein Mensch sprechende, denkende und gebildete Kater fungiert als Ich-Erzähler und Autobiograph, dessen chronologische Schilderung seiner Erlebnisse von seiner Geburt bis zum Zeitpunkt der Niederschrift zahlreiche ausführliche Kommentare und Reflexionen zur „Bildung des Lesers“ enthält. Indem Murr ein angeblich funktionierendes Rezept dafür liefert, „wie man sich zum großen Kater bilde“, setzt sich der Roman kritisch mit der zeitgenössischen Trivialisierung der Bildungsidee auseinander. Motive und klassische Elemente des Bildungsromans werden parodiert: Murr erlebt eine „lehrreiche“ Jugendfreundschaft (zum Pudel Ponto), eine „persönlichkeitsformende“ Liebe (zur Katze Miesmies), versucht sich in Saufgelagen und Ehrenduellen als „tüchtiger Katzbursch“ und in der „höhern Kultur und Welt“ (der Hunde) als feiner Gesellschafter… Schließlich bildet er sich autodidaktisch zum „homme de lettres“ aus. Selbstbewußt kündigt Murr sein Ziel bereits im Vorwort an: „Mit der Sicherheit und Ruhe, die dem wahren Genie angeboren, übergebe ich der Welt meine Biographie, damit sie lerne, wie man sich zum großen Kater bilde.“
Im Gegensatz zu den meuteliebenden Hunden scheinen es die einzelgängerischen Katzen bis heute dennoch geschafft zu haben, trotz unzähliger solcher Versuche halbwegs autonom zu bleiben. Dafür spricht, dass sie im Gegensatz zu den Hunden weder „Frauen“ noch „Herrchen“ haben. Sich dennoch nie überfressen, weil sie immer guter Hoffnung sind, dass es am nächsten Tag wieder was zu fressen gibt, wie Wladimir Kaminer meinte. Laut Doris Lessing „sprechen“ auch ihre „Freßgewohnheiten eine deutliche Sprache“ – sie drücken „Verdruß oder Freude oder ihre Absicht, zu schmollen, aus.“ Die SZ schreibt: „Von Katzen heißt es, sie hielten sich Menschen, nicht umgekehrt. Mit der gleichen Charakterstärke steuern sie offenbar auch ihre Nahrungsaufnahme. Aus einem Angebot verschiedener Sorten von Feucht- und Trockenfutter trafen die Hauskatzen bei Versuchen immer die richtige Wahl: Ihre Tagesmenüs hatten stets das optimale Mengenverhältnis zwischen den drei Hauptnährstoffgruppen: 52 Prozent Proteine, 36Prozent Fett und zwölf Prozent Kohlenhydrate, berichtet ein internationales Forscherteam im Journal of Comparative Physiology B.“
Man unterscheidet hierzulande bei den Menschen Katzen- und Hunde-Liebhaber als Sozialtypen. Weitaus mehr Frauen als Männer halten Katzen, bei Hunden ist es umgekehrt. Zudem kann man sagen: „Die Sowjetunion war ein Katzenland,“ wie Olga Kaminer schreibt. Deutschland ist dagegen ein „Hundeland“ – und sein Wappentier der Schäferhund – über den Alexander Solschenizyn schrieb, dass man ihn unbedingt in die internationalen Abrüstungsgespräche mit aufnehmen müßte, denn er setze – abgerichtet – den Menschen mehr zu als alle Raketen und Atombomben zusammen. Die weitaus ungefährlichere Aggression der Katzen hat dagegen stets gute Gründe. Vogelliebhaber sehen das natürlich anders.

Don Quichotte Denkmal in Havanna
In seinem Text über „Michel de Montaigne und die anthropologische Differenz“ zitiert Markus Wild einen interessanten Text von Miguel de Cervantes:
„Die Frage nach dem Geist der Tiere und der anthropologischen Differenz machen in der Frühen Neuzeit ebenfalls eine Neuuntersuchung der kognitiven Vermögen fällig und stellen das Verhältnis zwischen rationalen und sinnlichen Vermögen erneut zur Diskussion. Die Frühe Neuzeit verschärft diese Fragen sogar.
Eine Novelle von Miguel CERVANTES veranschaulicht dies auf treffende Weise. Im Coloquio de los perros (1613) beginnen zwei Hunde namens Cipion und Berganza eines Nachts zu sprechen. Sie verständigen sich gleich anfangs über die wundersame Tatsache, daß sie sich sprechend verständigen können und betrachten es als unerhörte Gnade (no vista merced), die die Grenzen der Natur überschreitet (passa de los terminos de naturaleza) und ein Wunder genannt werden muss:
„Cipion: Du hast recht, Berganza, und das Wunder wird noch größer dadurch, daß wir nicht allein sprechen, sondern daß sogar Sinn [discurso] in unserer Rede ist, als seien wir mit Vernunft begabt. Dabei besteht der Unterschied zwischen Mensch und Tier doch gerade darin, daß der Mensch ein vernunftbegabtes Lebewesen ist, das Tier aber nicht [que la diferencia que ay del animal bruto al hombre, esser el hombre animal racional, y el bruto irracional]“
Berganza wundert sich zwar auch, vertritt aber die Ansicht, daß die Redegabe nur als äußerliches Wunder betrachtet werden sollte, denn sie habe schon oft die Behauptung gehört Hunde „hätten eine so klare, lebhafte und scharfe Auffassungsgabe für viele Dinge“ und es fehle nur wenig daran, „um eine Art logischer Denkfähigkeit [capazde discurso] zu besitzen. […] Man sagt ja auch, dass, was Klugheit und Verstand betrifft, der Hund nächst dem Elefanten an erster Stelle steht“. Cipion stimmt zwar ein, beharrt jedoch darauf, daß man bislang weder einen Elefanten noch einen Hund habe sprechen hören. Daraus folgt, daß die plötzliche Redegabe unter jene „Wunderzeichen zu rechnen ist, deren Auftauchen und Erscheinen erfahrungsgemäß eine unheilvolle Drohung für die Menschheit bedeutet“. Berganza erzählt anschließend ihre Lebensgeschichte, die zu einer Kritik an den Menschen gerät und von Cipion immer wieder reflektierend unterbrochen wird.
CERVANTES variiert in dieser Novelle das Muster des Pikaro-Romans, indem er die Figur des sozialen Außenseiters als Tier radikalisiert und indem er die Selbstreflexion des Pikaro auf eine zweite Figur verlegt: Berganza erzählt, Cipion denkt. Er denkt die anthropologische Differenz. Cipion weist zuerst darauf hin, daß die Worte der beiden Gesprächspartner sinnvoll und nicht bloße Geräusche sind. Das heißt, daß die Worte Gedanken ausdrücken und dadurch auf eine Vernunft hinweisen. In diesem Gedankengang spricht Cipion nicht nur sinnvoll, er reflektiert auch über dieses Sprechen und ordnet diese Reflexionen auf eine Folgerung hin. Cipion spricht nicht nur und drückt Gedanken erster Ordnung aus, sondern er folgert und zwar aufgrund von Gedanken zweiter Ordnung. Die Folgerung selbst enthält einen Syllogismus: Ein Wunderzeichen ist eine Drohung für die Menschen; die Redegabe bei Tieren ist ein Wunderzeichen; die Redegabe der Tiere ist eine Drohung für die Menschen. Dieser Gedankengang bringt im Begriff der „Wunderzeichen“ implizit ein bestimmtes kulturelles Wissen und einen theologischen Hintergrund und im Begriff der „unheilvollen Drohung“ darüber hinaus eine moralische Implikation ins Gespräch. Damit hat Cipion die wichtigen Merkmale eines vernunftbegabten Lebewesens ins Spiel gebracht: Sprache, Gedanken, Selbstreflexion, Logik, Wissen, Theologie und Moral.
Man braucht mit Cipion nur etwas weiter zu denken und könnte folgern können, daß der Unterschied zwischen Mensch und Tier anders angesetzt werden muß oder aber, daß es diesen entscheidenden Unterschied tatsächlich nicht gibt. Es ist Michel de Montaigne, der Cipions Gedanken gleichsam aufgreift und sie nicht ruhen lassen will. Dabei verwendet Montaigne intensiv Material aus der antiken, insbesondere skeptischen Philosophie, das er gegen die Befürworter einer anthropologischen Differenz ins Treffen führt.“

Blinder Hund. Photo: Mathias Königschulte
„Nein, ich hasse den Hund gar nicht. Wohl aber eine bestimmte Gattung Mensch, die ihn behandelt wie ein Brigadekommandeur die unterstellte Formation, und die mit ihm herumwirtschaftet, weil auch er aus Deutschland ist,“ schrieb Kurt Tucholsky einst. Inzwischen melden Hundehalter ihre Golden Retriever oder Border Collies bei der „Welpenschule“ an, und gehen zum „Agility Training“ oder zum „Dog Dancing“ mit ihnen. „Die Erziehung hat sich geändert,“ bemerkt dazu die Hundeforscherin Friederike Range, die im „Clever Dog Lab“ der Wiener Universität arbeitet, wo die Hundehalter nun laut Spiegel „in Scharen herbeiströmen“. Auch die Wissenschaftler haben sich geändert: Erforschten sie früher vorwiegend Affen, Tauben, Gänse, Wölfe, wobei sie die Hunde als „verdummte Ex-Wölfe“ weitgehend ignorierten, so avancieren diese inzwischen laut Spiegel zu „Stars der Verhaltensforschung“. Sie lassen sich leicht und billig beobachten, viel mit sich anstellen, können bei ihren Besitzern bleiben, und diese spielen nur allzu gerne mit, weil auch sie mehr über ihre „Companion Species“ wissen wollen. Die Umsichtigkeit vor allem der Frauen, die sich einen Hund zulegten – und ihn gleich in die Welpenschule schleppten, grenzt an die der sogenannten Prenzlauer-Berg-Mütter in bezug auf ihre Kinder. Bei beiden kann man jedenfalls von einem „Projekt“ sprechen. Die Medienforscher Benjamin Bühler und Stefan Rieger bezeichnen den Hund in ihrem „Bestiarium des Wissens“ als eines der „Übertiere“, denen wir das „Wissen vom Leben“ abpressen. Darüberhinaus „erzeugen und stabilisieren Mensch und Hund gleich Herr und Knecht ihre Identität in gegenseitiger Anerkennung.“ Und diese Dialektik ist dynamisch. 1966, noch vor dem Sieg der Vietnamesen im Krieg gegen die Amerikaner, berichtete der deutsche Psychiater Erich Wulff aus Hué: „Ein Gefühl wie Tierliebe war den meisten Vietnamesen fremd. In ihrem Seelenhaushalt gab es keinen offenen Posten dafür…Das Heer der Ammen, Boys und Boyessen okkupierte bei der mandarinalen Oberschicht die Haustierstelle.“
Hierzulande gibt es dagegen schon lange und fast durchgehend statt uns bepflegende Haushaltsangestellte immer pflegebedürftigere Hunde (wahlweise auch Katzen).
Das vornehmlich mit Schimpansen arbeitende Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung in Leipzig konnte in seinen Kognitionsexperimenten nachweisen, „dass Hunde die vermeintlich so klugen Menschenaffen um Längen schlagen, wenn es darum geht, Gesten von Menschen zu deuten,“ und Worte in Beziehung zu den Dingen zu begreifen. Auch den Wölfen gehen derartige „kommunikative Fähigkeiten“ ab. In evolutionärer Hinsicht hat sich diese Fähigkeit der Hunde als die „fittere“ erwiesen: Es gibt heute über 40 Millionen auf der Welt, aber nur noch etwa 40.000 Wölfe, wie der US-Philosoph und Wolfsbesitzer Mark Rowlands darwinistisch vorrechnete.
Aber hat sich die Unterwerfung unter den Menschen – ihre „komplette Verblödung“, wie der Biologe Cord Riechelmann das nennt – auch für den einzelnen Hund gelohnt? Eigentlich schon: 2002 betrug die weltweit für Haustierfutter und -versorgung ausgegebene Summe bereits 46 Milliarden Dollar, Tendenz steigend, vor allem im Marktsegment ‚Premiumfutter‘ Darüberhinaus wird die Medizintechnik für Hunde immer aufwendiger, bis hin zu psychologischen Therapieeinrichtungen und Krankenversicherungen, die für Haustiere zur Normalität werden, wie die US-Biologiund Hundebesitzerin Donna Haraway in ihrem Aufsatz „Hunde mit Mehrwert und lebendiges Kapital“ schreibt. Zum „Premiumfutter“ gehört heute z.B. ein Großteil der in der Mongolei gezüchteten Pferde, die als Dosenfutter für Hunde in Japan enden. Die Hunde wollen von einer solchen dumpfmaterialistischen Erklärung ihrer Unterwerfung natürlich nichts wissen. In den „Forschungen eines Hundes“ hat Franz Kafka 1922 den Ursprung der Nahrung aus der Sicht eines Hundes erzählt, wobei alle Analysen voraussetzen, dass sie von oben – aus der Luft gewissermaßen – kommt. Obwohl die „Forschungen“ also nur angestellt wurden, um den Weg des Hundefutters vom Herrn (Herrchen) zum Knecht (Hund) zu ermitteln, wird jener darin ausgeklammert. Die Analogie zur Religiosität (Alles liegt in Gottes Hand) der einstigen Hausangestellten ist offensichtlich: Auch unsere Haushunde sind gläubig, das legen jedenfalls Kafkas Forschungen nahe. Ebenso scheitern sie auch regelmäßig, „sobald ein wenig Logik ins Spiel kommt,“ wie die Hundepsychologin Britta Osthaus von der Universität Exeter uns versichert: d.h. „noch!“

Crustacea
Die Krebsliebhaberin
Ich traf sie im Naturkundemuseum, wo sie das Trockenpräparat eines Flußkrebses in einer Glasvitrine abzeichnete. Die Romanistin besaß zu Hause ein Aquarium mit amerikanischen Zwergkrebsen in verschiedenen Farben. Ich erfuhr von ihr ferner, dass der Flußkrebs in Deutschland nahezu ausgestorben sei. Weil er lange Zeit zur Hauptspeise der Armen zählte und schließlich die Gewässer immer mehr verdreckt seien. Den Todesstoß verpaßten ihm dann importierte und hier ausgesetzte amerikanische Krebse, die die „Krebspest“ mitbrachten. Diesem Pilz fielen schon bald alle anderen Krebsarten zum Opfer – bis auf die amerikanischen, die immun dagegen wären. Das sei ein ähnlicher Genozid gewesen wie ihn zuvor in umgekehrter Richtung die ersten Europäer mit ihren Viren und Bakterien bei den amerikanischen Ureinwohnern veranstaltet hätten.
Nun versuche man jedoch, diesen sogenannten „Edelkrebs“ wieder überall anzusiedeln. Dazu gäbe es Zucht- und Versuchsanstalten und ökologische Verhaltensforschung. Unter den letzteren besonders viele Frauen – Krebsverhaltensforscherinnen. Sie verdanken allerdings den Krebse haltenden Aquarianern aufgrund ihrer Beobachtungsausdauer und schieren Anzahl wichtiges Krebswissen, wenn sie nicht sowieso selbst zu diesen gehören. Im übrigen verwende man das Wort Krebs-tiere, von denen es etwa 67.000 benamte Arten gäbe. In der Küche spreche man von „Krustentieren“. Viel größer als ihre Bedeutung für die Ernährung sei jedoch die bei der Reinigung unseres Trinkwassers. Die Kleinkrebse (Plankton) z.B. würden Schwebstoffe, Bakterien und Einzeller sowie in diesen gebundene Giftstoffe aus dem Wasser filtern. Bei ihrer Wiederansiedlung käme ihnen hierzulande der verbesserte Gewässerschutz entgegen. So finde man z.B. wieder Flußkrebse im Wannsee. Woanders gäbe es auch einige Arten, die auf dem Land bzw. auf Bäumen leben – wie die Strandkrabbe und der Palmendieb. Auf den Brandenburger Landstraßen sei die geschützte kubanische Landkrabbe unterwegs. Desgleichen ein Fischer, der lebende „Seekrabben“ zu den vietnamesischen Großmärkten bringe, von wo aus sie an Restaurants und Privatküchen verkauft werden.
Zu DDR-Zeiten habe dieser Fischer die vielen Krabben in seinem Netz immer weggeschmissen, weil sie niemand haben wollte. Jetzt seien sie seine Haupteinnahmequelle. „So kann es gehen. Genau!“ fügte die Krebshalterin hinzu. Auch sie profitiere von dieser Krebs-Konjunktur. So habe z.B. eine Romanistik-Kommilitonin gerade eine Seminarbeit über die Namen aller Krebsarten vorgelegt, wobei sie die zoologische Klassifikation aus Grzimeks Tier-Enzyklopädie übernahm und die Namen der Krebstiere der „Nomenclatura Portuguesa de Organismos Aquáticos“ von J.G. Sanchez, in dem die meisten Arten für die Fischereiwirtschaft von Bedeutung seien und neben weltweit bekannten Arten auch solche erwähnt würden, die für Portugal typisch oder von besonderem Interesse wären. Überhaupt hätten die Geistes- und Kulturwissenschaftler schon längst begonnen, so die Krebshalterin, sich der biologischen Begriffe bzw. Metaphern anzunehmen, um das Leben nach dem Dechiffrieren nun zu dekonstruieren. Dazu gehöre u.a. auch die Krebsverhaltensforscherinnen-Forschung.
Ob ich die neue Froschmonographie eines Kulturwissenschaftlers oder den Bericht einer Frau „Mein Leben mit Igor“ – einem Leguan – schon kenne, wollte sie wissen. Das mußte ich verneinen, konnte ihr jedoch immerhin mitteilen, dass ich einmal selbst einen Flußkrebs namens Fritz besaß. Als sie Näheres wissen wollte, erzählte ich ihr, dass ich das Tier in einem Fischgeschäft für 1 DM 50 erwarb – den letzten im Becken. Um ihn hätte sich fortan das wichtige Geschehen in meinem Aquarium abgespielt. Er hockte in einer nach vorne und hinten offenen Steinhöhle in der Mitte des Beckens und wurde mit Leberwurst gefüttert, die er in kleinen Portionen bekam – zusammen mit einem Kieselstein, damit das Fleisch zu Boden sank. Er brauchte nur wenige Sekunden, um den „Braten“, auch wenn der weit weg von ihm auf dem Beckenboden gelandet war, zu riechen. Wenn man mit einem Kescher im Aquarium herumfuchtelte versteckten sich alle Fische hinter ihm, während er vorne tapfer versuchte, den Kescher mit seinen Scheren abzuwehren. Entgegen der Meinung vieler Aquarianer fraß er nicht einmal die kleinsten Fische, sondern beschützte sie eher…
„Ich kenn auch so eine romantische Crustaceen-Geschichte, unterbrach mich die Krebsforscherin, bevor ich ihr noch erzählen konnte, wie Fritz starb, „sie betrifft nicht nur ein Individuum, sondern eine ganze Art: den in Symbiose mit einer Seeanomone lebenden Einsiedlerkrebs. Wenn der ein neues Schneckengehäuse gefunden hat, tickelt er die Annemone auf seinem alten Gehäuse mit den Fühlern und die läßt dieses daraufhin los, woraufhin er sie auf seiner großen Schere zu ihrem neuen Standort trägt.“




