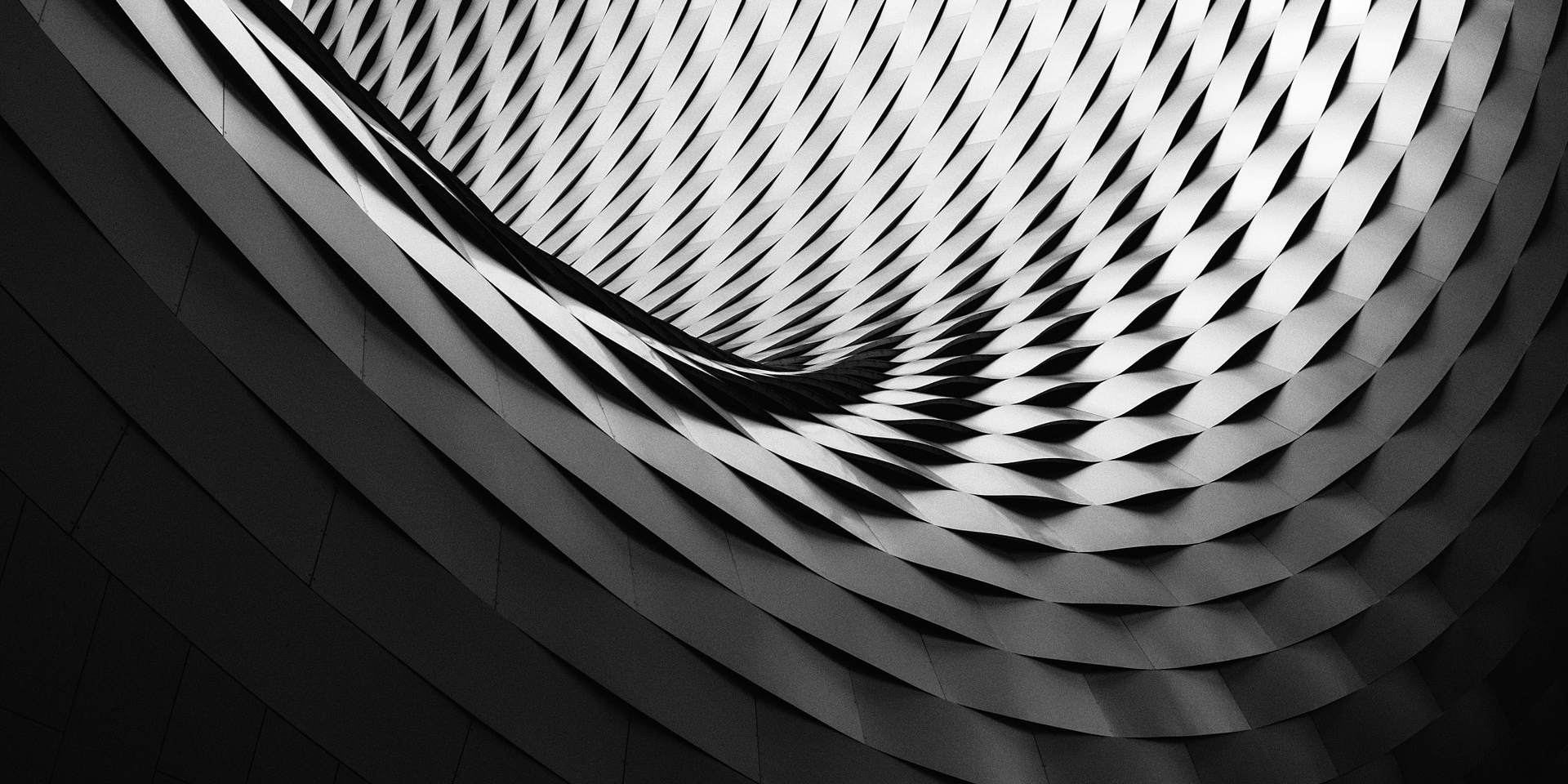Zuletzt vermeldete die Chefredakteurin, es gäbe einen Vogelzugstau – am Rhein: Besonders die Kraniche, Reiher und Störche warten noch ab, bis es auch hinterm Rhein (von Afrika aus gesehen) taut. Aber dann ging es los: Milliarden Blätter und Blüten schossen ans Licht (ich nehme an: auch außerhalb der Großstadt – im Umland, wie man so sagt).
Auch die Rentner suchten sofort das Tageslicht. Hier in den lichtdurchfluteten Wandelgängen eines Altersheims an der Bundesallee

Es ist zwar noch ein bißchen kalt, aber die Familie Dressen wagt sich schon wieder in die Hasenheide.

Jens Meierbuer aus dem Westend hat sein Oldie-Cabrio aus der Garage geholt und promeniert damit die Tiergarten-Magistrale auf und ab.

Mein Lieblingsphoto: Die zwei gutgelaunten Bibliothekarinnen aus Pankow, die bei dem guten Wetter zum Russendenkmal gegangen sind und sich nun in ihrem Lieblingslokal einen Schoppen genehmigen.
.
.
.

In Britz (wo es immer einige Tage früher wärmer wird) blühen schon die ersten Rosen in den Vorgärten, die halbe Hausbewohnerschaft hat sich um sie versammelt – als Zeugen.

Nein, die Entenküken sind in diesem Jahr noch nicht geschlüpft (am Neuen See).
Aber was machen eigentlich die anderen Tiere im Frühling – wo immer sie sind?
Eine Beobachtung der Biologin Sarah Papworth und ihrer Kollegin vom Imperial College in Berkshire: Die beiden erforschten Wollaffen im südamerikanischen Regenwald. Dabei entdeckten sie, dass diese Tiere mittlerweile zwischen Wollaffen-Jägern und Wollaffen-Forschern unterscheiden können: Wenn sie die ersteren sehen, „gefährlich“, verstecken sich die Wollaffen ängstlich und still in den Baumkronen, bei den letzteren bleiben sie dagegen cool – „harmlos“. Die ersteren erkennen sie meist schon an ihren langen Pfeilrohren, die sich mit sich tragen, während letztere mit filmkameras, klemmblocks und Feldstecher ausgerüstet sind. Es kann aber auch sein, dass sie solche Unterscheidung im konkreten Fall noch mit einer zweiten vervollständigt haben: Erstere sind meist dunkelhaarige und -häutige Männer, letztere dagegen hellhaarige und -häutige Frauen. So sehe ich das jedenfalls, nachdem ich mir das Photo der englischen Wollaffenforscherin im Internet angekuckt habe, wobei ich stillschweigend davon ausging, dass ihre unbenamt gebliebene Kollegin nicht viel anders aussieht.

In der privaten Tempelhofer Hundeschule von Sabine Echtern-Waltz lernt „Waldi“ gutes Benehmen – Pfingsten soll er mit nach Bad Gastein zur Schwiegermutter. Namen, außer den das Dackels, darf sie aus Datenschutzgründen nicht nennen.
Eine Nachricht aus einem Frühling des vorletzten Weltkriegs:
Im April 1917 meldete das Berliner Tageblatt des Mosse-Verlags, dass sich – kriegsbedingt – die Schwierigkeit ergab, die für die Zeitungsherstellung „nötigen Papiermassen“ täglich heranzuschaffen, deswegen habe man mit Herrn Hagenbeck ein „Abkommen“ getroffen, „wonach er uns vier seiner Elefanten mit den dazugehörigen indischen Führern zur Verfügung stellt.“ Und das hat dann auch sehr gut geklappt: „Die Elefanten haben ihren Dienst brav und fleißig verrichtet – und mehrere mit Papierrollen hoch bepackte Wagen vom Anhalter Bahnhof zu unserer Druckerei gebracht, was in den Straßen natürlich sehr viel Aufsehen und Interesse erregte.“
Karl Kraus fügte dieser Meldung im nämlichen Monat einen Kommentar hinzu: „Urwälder werden kahl geschlagen, damit der Geist der Menschheit zu Papier werde, und die obdachlosen Elefanten führen es ihr zu. Bei Goethe! Es ist der Augenblick, aus einer Parodie wieder ein großes Gedicht des Abschieds zu machen.“ Kraus bezieht sich dabei auf ein zuvor im „Berliner Tageblatt“ abgedrucktes Kriegsgedicht von Ludwig Riecker (München), das unter dem Titel „Lied des englischen Kapitäns“ den deutschen „U-Boot-Krieg“ thematisierte:
„Unter allen Wassern ist – ‚U‘
Von Englands Flotte spürest du
Kaum einen Hauch…
Mein Schiff ward versenkt, daß es knallte
– Warte nur, balde
Versinkt deins auch!“

Sievers im 3.OG haben mal wieder „Gästebesuch“ aus Westdeutschland bei sich einquartiert: Sie nehmen 40 Euro pro Nacht und Person. Aber noch hat sich niemand beschwert. Meistens sind es Engländer oder Iren. Man kann die schlecht auseinander halten.
Die FAZ interviewte den Vorsitzenden des Berufsverbandes der Hundepsychologen Thomas Riepe:
Es geht darin nur indirekt über die „Frühjahrsmüdigkeit“ – eigentlich um das ebenso ermüdende „Agility“ für Hunde, dieser „US-Import“ bedeutet für den gewieften Hundepsychologen, dass der moderne Stadthund ebenso wie die Kinder von Termin zu Termin gehetzt, „gestresst“, wird, er hat auch einen richtigen „Terminkalender“. Es wäre jedoch besser, so Thomas Riepe, „wenn Hunde einen ganz normalen Tagesablauf hätten. Ich habe Straßenhunde in Indien und Afrika beobachtet, Wölfe und Wildhunde, und die führten eigentlich alle das gleiche Leben…In erster Linie durchwandern die ihr Revier. Sie hetzen nicht herum, wie wir ihnen das aufzwingen, wenn wir sie z.B. ans Fahrrad hängen. Sie schnüffeln. Das Gehirn wird stark angestrengt, gar nicht mal so der Körper….Mit den Hunden Agility machen wir, weil wir uns wohl fühlen wollen auf Kosten des Hundes. Der Hund hat das Problem, dass er bei uns lebt. Wir pushen ihn ständig…Dabei möchte der Hund ein gemütliches Leben haben…“
Interessanter Gedanke! Heißt das doch laut Peter Berz nichts anderes, als das die feministische Biologin, Vordenkerin der Theorie von den „companion species“ und „interspecies communication“, die regelmäßig mit ihrer Hündin „Cheyenne“ Agility-Kurse und -Parcours besucht – und auch darüber schreibt (The Companion Species Manifesto. Dogs, People, and Significant Otherness, 2003), völlig falsch liegt. Berz schlägt dafür die alarmistische Schlagzeile vor: „Amerikanische Philosophin hindert Hunde am Denken“. Die Hundeforscherin Katharina Rutschky hat es in ihrem Buch über ihre Erfahrungen mit insbesondere dem Cocker-Spaniel „Kupfer“ bereits geahnt: „Und wer sagt denn eigentlich, dass der Hund sich auf einer Party langweilt, und nicht vielmehr evolutioniert?“ fragte sie sichbereits 2002 in: „Der Stadthund“.

Die Kleinfamilie Delitzsch aus dem Seitenflügel hat sich zum Frühling neue Tapeten gegönnt. Bei Möbel Höffner.

Für Oma, die im Nebenhaus wohnt, haben sie ein anderes Muster genommen. Aber auch bei Möbel Höffner

Annelotte Piewowski und ihre Mutter sind sich noch unschlüssig. Hier klappern sie gerade die Möbelhäuser zwischen Kurfürstenstraße und Magdeburger Platz ab. Bei Hanns Zischler – in seinem neuen Buch „Berlin ist zu groß für Berlin“ fand ich einige interessante Gedanken über „Plätze“, allerdings nicht über den Magdeburger, wo das Arbeitsgericht situiert wurde, das in der Kantine ein üppiges Salzwasseraquarium hat.
Der Pedologe auf dem taz-Kongreß, der über gute Böden zum Gärtnern und Effektive Mikroorganismen sprach, heißt Haiko Pieplow. Die taz annoncierte ihn als „promovierter Bodenkundler und Klimaretter“. Er „klimagärtnert“, u.a. nach der „Terra Preta“-Methode (Schwarzerde auf brasilianisch)…“Jeder kann dabei“ laut taz „mitmachen, denn der promovierte Bodenkundler Haiko Pieplow hat das Geheimnis der Rezeptur von Terra Petra mit gelüftet.“ Was mit diesem Werbesprech für eine „Talkrunde in Zelt 3 auf dem Dach des HKW“ gemeint ist, will ich dir hier kurz mitteilen:
„Die Zeit berichtete 2011 über diese „Wundererde im Test“: „Als das Besondere der Anbautechnologie gilt die Beimischung zerkleinerter Holzkohle. Die bringe nicht nur dauerhaft CO\u2082 in den Boden, sagt Haiko Pieplow, Bodenkundler im Bundesumweltministerium. Ihre poröse Oberfläche biete auch zahlreichen Mikroorganismen Unterschlupf. Eine spezielle Mischung aus Pilzen und Bakterien, mit der sich die Biokohle der Indios »auflud«, sei das eigentliche Geheimnis der Terra Preta , sagt er. Sie fixiere Nährstoffe, die nicht mehr so leicht weggewaschen werden könnten, und mache sie für Pflanzenwurzeln besser verfügbar.
Franz Makeschin, renommierter Bodenkundler in Dresden , verweist auf Vorkommen ähnlicher – menschengemachter – Schwarzerden in afrikanischen Feuchtgebieten. Sie seien zwar »bekannt, aber bisher kaum beachtet worden«, sagt er. Offenbar haben mehrere Kulturen ähnliche Wege gefunden, ihre Ernährung unter widrigen Umständen zu sichern. Aber kann das Terra-Preta -Prinzip sinnvoll auf andere Weltregionen, Böden und Klimazonen übertragen werden?
Einige Bauern probieren das praktisch aus. Im Rosenheimer Projekt etwa stiegen sie zunächst vom Kompostieren auf die Herstellung sogenannter Bokashi um. Hierbei werden Gülle und Biomasse mithilfe »effektiver Mikroorganismen« (EM) milchsauer vergoren. Bokashi verliere so nicht nur den üblen Fäulnisgeruch, es blieben auch mehr Nährstoffe erhalten, behauptet der bayerische Agrarberater Christoph Fischer, der EM kommerziell vertreibt. Zur Stabilisierung des Effektes setzte sein Bauern-Kreis als nächsten Schritt Holzkohle bei. Sie werde Teil des Dauerhumus und werde nicht abgebaut. Erste Erfahrungen mit dieser Chiemgauer Terra Preta seien vielversprechend, meint Fischer.
Experimentierfreudig ist auch Joachim Böttcher, Landschaftsgärtner und spezialisiert auf Pflanzenkläranlagen. Der Rheinland-Pfälzer glaubt, jenes Verfahren zur Herstellung von Terra Preta gefunden zu haben, mit dem die Biokohle wie bei den Indios durch Besiedlung mit Mikroorganismen aktiviert wird. Böttcher schwärmt von erstaunlichen Erträgen bei Kohl, Kartoffeln oder Sellerie auf seinem Hengstbacherhof. Das Know-how für »Palaterra« will er weltweit vermarkten, um, so sein Werbeslogan, »Boden wieder gut zu machen«.
Allerdings kritisiert nicht nur Haiko Pieplow, dass mit der Patentierung ein Allgemein- und Kulturgut privatisiert werde. Und wissenschaftlich umfassend geklärt ist der Terra-Preta -Effekt ohnehin noch nicht. Bei diesem »heißen Thema« gelte es »Bodenhaftung zu bewahren«, warnt Bodenkundler Franz Makeschin aus Dresden. Böden seien lokal ganz verschieden, und noch müsse untersucht werden: Wo ist es sinnvoll, Terra Preta einzusetzen; wo wäre dieselbe Biomasse besser anders genutzt?
Auch FU-Experte Konstantin Terytze ist skeptisch. Kritisch sieht er die Wirtschaftlichkeit: Die Produktion der Biokohle in Pyrolyse-Anlagen ist teuer, jedenfalls wenn sie dezentral zur Verwertung von Reststoffen eingesetzt und nicht als Massenprodukt vermarktet werden soll. Denn im großen Stil drohe Raubbau im Namen des Klimaschutzes: »Wir dürfen nicht in der Ukraine und anderswo intakte Waldflächen verkoksen, um unsere Böden anzureichern!«, warnt Terytze. Die Sorge ist berechtigt. Simple Holzkohle zum Unterpflügen (Bio Char) wird, besonders in den USA, schon massenhaft als schneller CO\u2082-Speicher propagiert.
Fraglich sei zudem, ob die Terra Preta »auch langfristig wirkungsvoll und wirklich immer besser ist als andere Substrate«. Im Berliner Projekt Terra BoGa soll genau das nun überprüft und zugleich eine Verschwendung im Botanischen Garten beendet werden. Auf dessen Werkhof in Dahlem türmt sich ein lang gezogener, meterhoher Haufen: Blätter, Äste, Grasschnitt und Gartenabfälle aus der Pflege von 22.000 Pflanzenarten. Jährlich 1.500 Kubikmeter Pflanzenreste zerfielen hier bisher zu nutzlosem, teurem Kompost. Weil er voller keimfähiger Samen steckte, musste er entsorgt werden. Gleich daneben lagert in einem Schuppen feinste schwarze Komposterde. Rund 350 Kubikmeter kauft der Botanische Garten jährlich für mehrere Tausend Euro zu – doppelte Verschwendung also von Ressourcen.
Im Keller eines alten Werkstattgebäudes vergleichen die FU-Wissenschaftler nun Terra-Preta -Varianten untereinander und mit diversen Kompostmischungen. Im Frühjahr wollen sie nun auf Versuchsfeldern mit Tabak, Zucchini, Tomaten und anderen Pflanzen erproben: Soll die Terra Preta eher punktförmig ausgebracht werden oder flächig? Wie viel Kohle ist optimal? Welche Nebenwirkungen oder Schädlinge tauchen auf? Wie verändert das Größenwachstum die Qualität der Pflanzen und Früchte? Welche Substratmischung taugt für welche Pflanzen? Finanziert wird das Ganze von der EU und dem Berliner Umweltsenat. Zusätzlich testen Terytzes Mitarbeiter im Sauerland Terra Preta als Hilfe zur Erneuerung von Waldboden, der unter Weihnachtsbaum-Monokulturen und dem Wintersturm Kyrill gelitten hat. Lokale Reststoffe sollen hier die Grundlage für die Power-Erde bilden.
Ein Experiment im brandenburgischen Teltow-Fläming soll außerdem prüfen, ob die erwartete »hohe biologische Aktivität« von Terra Preta die Selbstreinigungskräfte verschmutzter Böden auf ehemaligen Truppenübungsplätzen stärken kann. Beide Fragestellungen werden als Teil des Verbundprojektes La Terra vom Bundesforschungsministerium finanziert. Die größte Zukunftschance sieht Haiko Pieplow aus dem Umweltministerium darin, Terra Preta in geschlossenen Stoffströmen herzustellen, die Abwässer für die Bodenfruchtbarkeit nutzen. Die wertvollen Nährstoffe, die auch in menschlichen Fäkalien enthalten sind, würden derzeit über Schwemmkanalisationen und Müllverbrennung »vollkommen verschwenderisch vernichtet«, sagt Pieplow. Warum nicht Stickstoff, Phosphat und Kalium zurück in den Kreislauf führen?
Im Berliner Botanischen Garten und in einem Hamburger Projekt des Abwasserexperten Ralf Otterpohl prüft man deshalb, wie sich zum Beispiel die Ausscheidungen von Hunderttausenden Besuchern zur Herstellung von Terra Preta nutzen ließen. Falls das gelingt, könnten künftig ähnliche Stoffströme Landwirtschaft und Städte miteinander verbinden. Nicht nur in Deutschland, auch in den Megazentren des Südens. Wie einst bei den Indios.“

Jetzt ist die Zeit der Frühlingsfeste gekommen. Unter den Dächern Berlins wird gefeiert wie verrückt.

Und so mancher wird dabei in flagranti erwischt – „solange das Verbrechen noch brennt“ auf Berlinisch

Elvira und Petra haben noch immer nicht den Osterschmuck abgehängt – vor lauter Feierei und Eierlikör.

Die Ex-Kölnerin Uschi hat noch mal ihre alte Karnevalsmaske rausgeholt, als ihr Deutzer Cousin sich mit ihr photographieren lassen wollte. Sie sieht damit aus, als könnte es ihr im Prenzlauer Berg nur besser gehen, was sie jedoch verneint.
Die taz-Gründerin Ute Scheub, die Haiko Pieplow und seine Pedologischen Ideen auf dem taz-Kongreß am 20. April vorstellte, schrieb zuvor in der taz und in „die graswurzelrevolution“ und dann auch auf deutschlandradio („Mit Schwarzerde die Welt retten“) über Pieplow und seine Boderverbesserungsüberlegungen:
„Schwarzerde hat das Potenzial, mehrere Krisen gleichzeitig zu meistern: die Klimakrise, die Hungerkatastrophe und die Hygienemisere in Slums. Und das alles ohne Großkonzerne, sondern in einer Agrarrevolution von unten. Ute Scheub besuchte einen ihrer Wiederentdecker, den Bodenkundler Haiko Pieplow, am nördlichen Rand von Berlin.
Haiko Pieplow greift in einen seiner Pflanzkübel und lässt die laut Bodenanalysen fruchtbarste Erde der Welt durch die Finger krümeln. Der promovierte Bodenkundler wird dabei malerisch umrahmt von Narzissen und mediterranen Gewächsen, die aus dem Boden seines Wintergartens am Rande von Berlin wachsen. Terra Preta könne Abfälle in Rohstoffe umwandeln und damit eine echte regionale Kreislaufwirtschaft initieren, erläutert der Agraringenieur. Weltweit angewandt, sei sie in der Lage, rund 20 Prozent des Kohlendioxids aus der Luft holen und damit Böden dauerhaft fruchtbar machen. Der Treibgasausstoß würde damit entscheidend verringert und gleichzeitig der Hunger bekämpft. Schwarzerde – hergestellt von Landwirten und Kleinbäuerinnen, Hobbygärtnern und Slumbewohnerinnen – könne eine buchstäbliche Graswurzelrevolution auslösen. Terra Preta do Indio, so lautet der portugiesische Name für die Schwarzerde aus dem Amazonas, die erstmals von früheren Indiokulturen angelegt wurde.
Deutschen Wissenschaftlern, darunter Haiko Pieplow, gelang es ab 2005, ihren Herstellungsprozess experimentell wiederzuentdecken. Im Frühjahr ist in Pieplows Garten und Wintergarten noch nicht viel von den Effekten zu sehen. Aber im Sommer, berichtet der Familienvater, sei hier alles zugewuchert. Hinter der südlichen Glaswand seines raffiniert gebauten und raffiniert belüfteten Passivenergiehauses züchtet er Tomaten, Weintrauben, Guaven, Feigen und Granatäpfel, im Garten gedeihen Obst und Gemüse aus unseren Breitengraden. Ein Hauch von Paradies durchzieht das ganze Grundstück. Wie Pieplow durch das Haus führt und all die Behälter zeigt, in denen Abfälle wiederverwertet werden – Essensreste, Holzspäne, Brauchwasser, Kot, Urin -, da wirkt er wie ein moderner Alchemist, der aus Exkrementen Gold macht – schwarzes Gold.
Alchemie, erster Eimer: Ach du heilige Scheiße
Im holzverkleideten Badezimmer steht neben dem Wasserklosett für die Gäste ein weißer Behälter, daneben ein Pott feine Holzkohle. Die luftdicht verschlossene Trockentrenntoilette. Dass sie nicht stinkt und nicht einmal ansatzweise müffelt, ist der Holzkohle zu verdanken, die das Ehepaar Pieplow nach jeder Benutzung per Schäufelchen drüberstreut. „Wichtig ist, Kot und Urin zu trennen“, erklärt der Hausherr und zeigt zwei Pipi-Behälterchen, die der männlichen und weiblichen Anatomie angepasst sind. Urin enthält sehr viel Stickstoff und wertvollen Phosphor, der sich jedoch bei der Herstellung der Terra Preta negativ auswirkt. Pieplow bewahrt sein „Goldwasser“ auf, es dient ihm zehnfach verdünnt in der Vegetationszeit als „ausgezeichneter Dünger“. Und die Scheiße? Es heiße doch überall, dass es gefährlich sei, menschliche Exkremente auf Äcker aufzubringen? Kot sei ein Wertstoff, klärt er auf. Um dazu zu werden, müsse er jedoch mindestens ein halbes Jahr richtig behandelt werden. Er zitiert den Künstler und Visionär Friedrich Hundertwasser: „Natürlich ist es etwas Ungeheuerliches, wenn der Abfallkübel in den Mittelpunkt unserer Wohnung kommt und die Humustoilette auf den schönsten Platz zum Ehrensitz wird. Das ist jedoch genau die Kehrtwendung, die unserer Gesellschaft, unsere Zivilisation jetzt nehmen muss, wenn sie überleben will.“
Wer Terra Preta produzieren wolle, könne das aber auch ohne Kotverwertung tun, stellt Pieplow klar. Holzkohle, Küchen- oder Gartenabfälle genügten völlig. Doch für die Bewohner von kanalisationslosen Slums in südlichen Ländern sei die neue Toilette perspektivisch ein Segen. „Jeder kann sprichwörtlich sein kleines Geschäft damit machen, Terra Preta herstellen und gleichzeitig teure Abwassergebühren sparen.“ Und er berichtet davon, dass schon die alten Römer Götter der Abfallverwertung angebetet haben: Stercutius, den Gott des Kotes, Crepitus, den Gott des Abwindes, und Cloacina, die Göttin der Abzugskanäle.
Alchemie, zweiter Eimer: Kohl und Kohle
Im Wirtschaftsraum steht ein roter Plastikeimer mit Küchenabfällen und Holzkohle, einige Lagen darunter auch das Kotgemisch. „Sechs Euro hat der gekostet“, sagt Haiko Pieplow und hebt den Deckel hoch. „Riechen Sie was?“ Nein, genauso wenig wie auf dem Örtchen. Die Abfälle, erklärt er, müssten luftdicht abgeschlossen und gepresst werden („Bokashi“), damit die Milchsäurevergärung beginne. Die dafür nötigen Mikroorganismen könne man kaufen, aber im Prinzip seien sie auf Obst und Gemüse ausreichend vorhanden. Auch die – möglichst feine – Holzkohle könne man entweder erstehen oder selbst produzieren. Er selbst stellt eine Dose mit Sägespänen über Nacht in seinen Kamin, am nächsten Morgen sind die Späne geröstet und die Biokohle fertig. „Man kommt von selbst auf die richtigen Ideen, wenn man den ersten Sack Grillkohle zerkleinert hat und schwarz wie ein Schornsteinfeger ist“, sagt er schmunzelnd.
Alchemie, dritter Eimer: Würmer satt
Haiko Pieplow führt in den Garten, dorthin, wo nach etwa einem halben Jahr auch das Bokashi-Gemisch landet: zu den Kompostbehältern. „Erst in den Mägen der Regenwürmer und Kompostbewohner entsteht die Schwarzerde“, erklärt er. Ist Terra Preta also Regenwurm-Sklaverei? „Nein“, lächelt er. „Eher eine Symbiose. Wir füttern sie ja gut. In unserem Kompost gibt es regelrechte Wurm-Nester.“ „Holzkohleverwendung und Milchsäurevergärung sind weltweit bekannte uralte Verfahren, die niemand patentieren kann. Das Neue daran ist, dass man beides zusammenbringt“, erklärt der Agraringenieur. Bisher hätten nur die Indios dieses Geheimnis gekannt. Deshalb kann kein Großkonzern die Herstellung monopolisieren. Einige kleine Firmen, mit denen Haiko Pieplow teilweise zusammenarbeitet, bieten die Zutaten an, aber man kann genauso selbst experimentieren, um Terra Preta herzustellen. Er hofft deshalb auf die weltweite Kreativität von Kleinbauern und Hobbygärtnerinnen, um die Graswurzelrevolution zu starten.
Das ist Tera Preta
Im Jahr 1542 befuhr der spanische Conquistador Francisco de Orellana den Amazonas, um das legendäre El Dorado zu suchen. Er berichtete von riesigen Städten an seinen Ufern, in denen Millionen Indios lebten. Da spätere Expeditionen nichts mehr fanden, glaubte man lange, Orellana habe gelogen. Dem Spanier entging indes, dass er tatsächlich ein El Dorado gefunden hatte: eine Kultur, die auf dem „schwarzen Gold der Erde“ basierte. Das Wissen um die Herstellung der Indianer-Schwarzerde, die anders als der nährstoffarme Regenwaldboden sehr fruchtbar ist, ging jedoch mit der Ausrottung der Ureinwohner verloren und gelangte erst in den 1990er Jahren in den Fokus von Forschern. Die uralten, teilweise meterdicken Schichten am Amazonas bestehen aus einer Mischung von Holzkohle, Exkrementen, Knochen und organischen Abfällen, durchsetzt mit Tonscherben – wahrscheinlich Überreste von riesigen Tongefäßen, in denen Siedlungsabfälle zu fruchtbarem Dauerhumus für Hochbeete umgewandelt wurde. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Milchsäurefermentierung, wie sie seit Jahrtausenden zur Nahrungskonservierung genutzt wird – Beispiel Sauerkraut.
Das kann Terra Preta
Schwarzerde kann Kunstdünger, Pestizide und Gentechnik ersetzen und damit perspektivisch die Macht der Agrokonzerne wie BASF oder Monsanto von unten aushöhlen. Terra-Preta-Böden erschöpfen nicht, sondern können sogar nachwachsen. Sie sind gut durchlüftet, halten das Wasser viel besser, Nährstoffe waschen nicht aus. In Terra Preta wachsen kerngesunde Pflanzen. Warum? Das erste Geheimnis ist Holzkohle. Die schwammartige poröse Struktur der Biokohle speichert Wasser und Nährstoffe. In ihren Hohlräumen – und das ist das zweite Geheimnis – siedeln sich komplexe Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen an. Besonders wichtig sind milchsäurebildende Mikroorganismen. Der Effekt wird in der Landwirtschaft auch durch die aus Japan stammenden „Effektiven Mikroorganismen“ (EM) zur Bodenverbesserung genutzt. Für Terra Preta wird zuerst eine Holzkohlen-Sillage (auf Japanisch „Bokashi“) durch milchsaure Vergärung von organischem Material hergestellt (Küchenabfälle, Stroh, Dung, menschlicher Kot). Die gewonnene Substanz dient als willkommenes Futter für Regenwürmer und anderes Getier, zum Dank scheiden sie schwarze Erde aus. Terra Preta ist im Prinzip auf jedem Balkon, in jedem Kleingarten und in jeder Komposttonne herstellbar. Erwerbslose und Hartz-IV-Empfängerinnen könnten diese Schwarzerde und eigene Lebensmittel erzeugen. Überall, wo Menschen leben, kann Terra Preta die Landnutzung in diesem Jahrhundert revolutionieren.
Hier gibt es Terra Preta
Auf Versuchsböden in Brasilien wuchsen Bananenstauden bis zu fünf Meter pro Jahr, im rheinland-pfälzischen Hengstbacherhof wurden Rote-Beete-Köpfe so groß wie Handbälle. Die Qualität des dort hergestellten Terra-Preta-Substrats stellt nach einer Analyse des Landauer Instituts für Umweltwissenschaften die von Torf und herkömmlichem Kompost weit in den Schatten. In der weltweit ersten Schwarzerde-Herstellungsanlage, die wie ein größeres Gewächshaus aussieht, sollen demnächst jährlich rund 50.000 Kubimeter Terra Preta für Profilandwirte und Hobbygärtner produziert werden. Geschäftsführer Joachim Böttcher aus Hengstbacherhof sieht sich „Fairness, Transparenz und Nachhaltigkeit“ verpflichtet und plant unter anderem die Gründung einer Schwarzerde-Genossenschaft. Die Universitäten von Berlin, Bayreuth und Leipzig, Landwirte im Chiemgau und im österreichischen Kaindorf sowie Biowinzer in der Schweiz experimentieren bereits mit Terra Preta.
Weitere Infos unter triaterra.de oder bei den Chiemgauern.“ Über die EM-Bewegung sei noch hinzugefügt – derlink: http://www.meinbezirk.at/feistritz-am-wechsel/kultur/workshop-effektive-mikroorganismen-em-fuer-neulinge-d518036.html Dort wird ein „Workshop ‚Effektive Mikroorganismen‘ EM für Neulinge“ offeriert…

Auf dem Treptower Rummel war es trotz Sonnenschein doch noch empfindlich kalt, muß man sagen.

Sybille mit Kind und Oma im Tiergehege an der Hasenheide.

Hans-Hermann Wintrup bleibt auch bei schönem Wetter seiner Schöneberger Stammkneipe mit Almhütten-Ambiente treu, aber im Frühjahr schmecke ihm das Bier noch mal so gut, behauptet er.
Im taz-Workshop über fruchtbare Erde war nur wenig von der segensreichen Wirkung der Regenwürmer die Rede.
Deswegen sei hier auf die große Studie von Charles Darwin „Die Intelligenz der Regenwürmer“ verwiesen (im März-Verlag 1984 erschienen). 1881 veröffentlichte Darwin seine Schrift „Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer“. Ein Jahr vor seinem Tod „schloss er damit seine Jahrzehnte währenden Studien über die Wechselbeziehungen zwischen Regenwürmern und Bodenbeschaffenheit sowie über das Verhalten dieser Tiere ab,“ heißt es in einem ausführlichen Wikipedia-Eintrag dazu. Er beschrieb darin u.a. eigene Experimente mit Regenwürmern, die Alfred Brehm in seinem Band über die „Niederen Thiere“ so schilderte: „Sie suchen nach vermoderten Vegetabilien, und wenn sie diese nicht finden, so präpariren sie sich ihren Fraß, indem sie, was ihnen vorkommt, in ihre Löcher hinunterziehen. Jedermann weiß, daß die Strohhalme, Federn, Blätter, Papierstreifen, welche man des Morgens auf den Höfen und in den Gärten in der Erde stecken sieht, als wären sie von Kindern hingepflanzt, während der Nacht von Regenwürmern verschleppt werden. Wenige jedoch werden gesehen haben, wie mit so schwachen Werkzeugen ein Wurm im Stande ist, so große Gegenstände zu überwältigen. Wenn man jedoch den Widerstand erprobt hat, den der Wurm dem entgegensetzt, der ihn aus dem Loche hervorzuziehen versucht, so wird man sich über die Muskelkraft eines nur aus Muskeln und Haut bestehenden Thieres nicht so sehr verwundern. Ein starker Strohhalm wird in der Mitte gefaßt und so scharf angezogen, daß er zusammenknickt, und so ins Loch hinabgezogen; eine breite Hühnerfeder mit der Fahne war ohne Schwierigkeit in ein enges Loch gezerrt; ein an der Spitze gefaßtes grünes Blatt von einer Himbeerstaude wurde abgerissen.“
An anderer Stelle schreibt Brehm: „Der gemeine Regenwurm verlebt den Winter, einzeln oder mit seinesgleichen zu langem Schlafe zusammengeballt, sechs bis acht Fuß unter der Erde. Die Frühlingswärme weckt auch ihn und lockt ihn wieder empor. Er ist des Tages Freund nicht, aber in der Früh- und Abenddämmerung und bis tief in die Nacht hinein, besonders nach warmem, nicht heftigem Regen, verläßt er seinen Schlupfwinkel, theils um seiner Nahrung nachzugehen, theils um mit einem der Freunde und Nachbarn ein intimes Bündnis zu schließen.
Bei dieser Friedfertigkeit und Bescheidenheit lauert tausendfacher Tod auf die armen Regenwürmer. Unterdrückten kann man sie vergleichen, denen man selbst ihre nächtlichen, geräuschlosen Zusammenkünfte nicht gönnt. »Der Regenwurm«, sagt sein Biograph, »gehört zu den Thieren, die den meisten Verfolgungen ausgesetzt sind. Der Mensch vertilgt sie, weil er sie beschuldigt, die jungen Pflanzen unter die Erde zu ziehen. Unter den Vierfüßern sind besonders die Maulwürfe, Spitzmäuse und Igel auf sie angewiesen. Zahllos ist das Heer der Vögel, das auf ihre Vertilgung bedacht ist, da nicht bloß Raub-, Sumpf- und Schwimmvögel, sondern selbst Körnerfresser sie für raren, leckeren Fraß halten. Die Kröten, Salamander und Tritonen lauern ihnen des Nachts auf, und die Fische stellen den Flußufer- und Seeschlammbewohnern nach.
Noch größer ist die Zahl der niederen Thiere, die auf sie angewiesen sind. Die größeren Laufkäfer findet man beständig des Nachts mit der Vertilgung dieser so wehrlosen Thiere beschäftigt, die ihnen und noch mehr ihren Larven eine leichte Beute werden. Ihre erbittertsten Feinde scheinen aber die größeren Arten der Tausendfüßer zu sein. Diesen zu entgehen, sieht man sie oft am hellen Tage aus ihren Löchern entfliehen, von ihrem Feinde gefolgt.“
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang ferner ein Theaterstück von Barbara Geiger aus ihrer Reihe „Fräulein Brehms Tierleben: Lumbricus terrestris – Der Regenwurm“ (ab 8 Jahren)“.
Wo: Natur-Park Schöneberger Südgelände – Berlin
Adresse: Prellerweg , 12157 Berlin (Tempelhof-Schöneberg)
Öffnungszeiten: 14.00 Uhr
Laufzeit: Mi, 01.05.2013 bis zum So, 12.05.2013

Rosemarie hat von ihrem Freund Frühlingsblumen geschenkt bekommen.

Johanna hat von ihren Kindern und Enkeln gleich eine ganze Anrichte voll geschenkt bekommen.
Das Naturkundemuseum teilt heute mit:
„Die Spinne, die vorgestern in Berlin eine Blumenverkäuferin gebissen und für große Aufregung gesorgt hat, wurde heute vom Spinnen-Experten des Berliner Naturkundemuseums, Dr. Jason Dunlop, beurteilt. Es handelt sich nicht (wie ursprünglich gedacht) um eine Riesenkrabbenspinne, sondern höchstwahrscheinlich um einen Vertreter der sogenannten Raubspinnen (Pisauridae). Diese Raubspinnen kommen normalerweise nicht in Deutschland vor so dass die Vermutung nahe liegt, dass es sich hier um eine Tropische Art aus Kenia oder Paraguay handelt, den Ländern, aus denen die Blumen bezogen wurden. Das Tier hat eine Körperlänge von ca. 1,5 cm und eine Beinspanne von ca. 5 cm, also insgesamt einen Durchmesser von 6,5 cm. Weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen werden erfolgen, um das Tier näher zu bestimmen. Weltweit gibt es ca. 500 Arten von Raubspinnen, unter anderem einige Vertreter hier in Deutschland. Obwohl fast alle Spinnen Gift haben, sind Raubspinnen nicht für Menschen gefährlich.“

Ludmilla, Sophie und Annemarie aus Friedenau haben es im kalten Berlin nicht ausgehalten – und sind für drei Wochen nach Teneriffa (Vollpension) geflogen: „Man gönnt sich ja sonst nüscht!“
Frieder vom Kreuzberger Buchladen Schwarze Risse teilte mir mit:
Er habe da ein sonderbares Buch, das mich vielleicht interessiert: Die Biographie einer Weißen, die als Fünfjährige in den amazonischen Dschungel entführt und ausgesetzt wurde. Sie überlebte dank einer Kapuziner-Affen-Horde, der sie sich immer mehr anschloß, auch sprachlich und körperlich, d.h. sie lernte auch, bei Gefahr auf Bäume zu klettern. Einer Indianer-Horde in der Nähe schloß sie sich nicht an. Schließlich landete sie als Putzfrau mit 11 in einem Bordell, geriet dann als Putzfrau in eine Familie und lebte danach als Straßenkind in einer Kleinstadt-Gang. Kam ins Kloster – und von da aus nach Bogota, wo das Buch endet.
Aus den Photos im Buch erkennt man jedoch, dass sie dann einen Engländer heiratete und mit ihm in England zwei Kinder bekam, von denen eins inzwischen selbst ein Kind hat. Ihr jüngste Tochter hat sich ihr Leben auf Tonband sprechen lassen und eine englische Ghostwriterin hat das Material zu einem Buch verarbeitet, das soeben bei Rowohlt erschien. Ein seltsames Buch, um das mindeste zu sagen, ich habe heute gleich drin rumgelesen: Marina Chapman: „Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam. Eine Kindheit unter Affen“.
Auf Youtube gibt es einen 5-Minuten-Clip über sie: „Woman Claims She Was Raised By Monkeys“ Die Huffington Post schreibt: „While the story sounds almost unreal, cases of ‚feral children‘ raised by animals have been reported before with orphan John Ssabunnya claiming he was raised by monkeys in Africa.“
Die FAZ berichtete 2012 über einen anderen Fall von „interspecies communication“ – den „Wolfsmann“ Marcos Pantoja: Er hat als Kind unter Wölfen gelebt, zwölf Jahre lang. Aber später haben ihm die Menschen seine Geschichte nicht geglaubt. Ein Kinofilm sollte ihn rehabilitieren. Spuren lesen, Bienenwaben plündern, Rebhühner fangen – Marcos war als achtjähriger Junge auf sich gestellt, in der Wildnis. Im Spanien der Fünfziger Jahre – unter Diktator Franco – gab es noch die Leibeigenschaft, und teilweise mussten die Eltern ihre Kinder verkaufen. Wie Marcos sollen in Spanien über 100 Kinder aus der Zeit verwildert gewesen sein. Heute ist Marcos 65 und im Sommer ist ein Film über sein Leben erschienen. Weil sie ihm nie geglaubt hatten, haben sich inzwischen einige Nachbarn bei Marcos entschuldigen müssen.
Die Welt läßt ihn selbst zu Wort kommen: „Eines Tages habe ich diesen kleinen Wolf gesehen. Ich näherte mich ihm, weil ich dachte, er sei ein Hund. Ich wollte mit ihm spielen.“ Von da ab wird „Lobito“, der kleine Wolf, Marcos‘ treuester Begleiter. Doch Lobito gehört zu seinem Rudel, und die Mutter wacht über ihr Junges, sie ist eine Gefahr für das Menschenkind. „Ich bin Lobito in eine Höhle gefolgt. Plötzlich kam die Wölfin hinein. Sie schlug mit einer Tatze nach mir, ich flüchtete mich in den hintersten Winkel. Dann kam sie wieder näher, in ihrer Schnauze ein Stück Fleisch, ich hatte riesige Angst. Doch sie ließ die Beute vor mich fallen, ich stopfte mir ein Stück in den Mund. Sie kam noch näher – und plötzlich begann sie, mein Gesicht abzulecken. So war ich mit einem Mal Teil des Wolfsrudels.“ Marcos jagt mit den Wölfen, er teilt das Er jagte mit ihnen, spielt mit ihnen, schläft bei ihnen, heult mit ihnen. „Wenn ich in Gefahr war, kamen sie und holten mich.“ Er stößt dreimal nacheinander ein kurzes, sirenenartiges Wolfsgeheul aus. „Das bedeutet Gefahr“, erklärt er. Angst, sagt er noch einmal, kannte er nicht. „Nur vor dem Wildschwein muss man sich fürchten. Es hat keine Freunde, und darum ist es unberechenbar.“
Mit seinen Wölfen jagt Marcos sogar Rehe und Hirsche. Die Wölfe treiben das Wild auf den Fluss zu, bis das Tier panikartig in das tiefe Wasser springt, wo Marcos darauf wartet, es mit einem Messer zu töten. Aus dem Fell macht sich „El Salvaje de la Sierra Morena“, der „Wilde aus der Sierra Morena“, wie man ihn später nennen wird, Fellumhänge. „Das war auch ein Grund, warum die Wölfe mich akzeptierten: Ich roch nicht mehr wie ein Mensch, in dessen Kleidern der Schweiß hängt.“ Nach so vielen Jahren unter Wölfen, die Haut sonnengegerbt, das Haar bis zu den Hüften und der eigenen Sprache kaum noch mächtig, wusste Marcos selbst nicht mehr, was er war. „Ich wusste nur, dass ich anders war als die Wölfe. Und sie wussten es auch, weil ich Sachen machen konnte, die sie nicht konnten.“ Er war glücklich in der Sierra.
Aber der Guardia Civil, Francos kasernierter Volkspolizei, gefiel der wilde Mann in den Bergen nicht. „Eines Tages, ich hatte gerade gut gegessen, schrien meine Vögel. Das taten sie immer, wenn Gefahr drohte. Ich versuchte wegzulaufen – aber die Polizisten schossen auf mich, schlugen mich nieder. Mit Handschellen, geknebelt, an ein Pferd gefesselt, schleppten die Polizisten mich ins Dorf, nach Fuencaliente.“ Die Leute im Dorf hatten von ihm gehört, ihn jedoch zuvor nie zu Gesicht bekommen. Es war das Jahr 1965, Marcos 19 Jahre alt. Aus der Sierra ging es nach Madrid ins Kloster, dann musste der junge Mann seinen Militärdienst ableisten. Immer wieder flog er wegen Befehlsverweigerung hinaus, vagabundierte durch die Lande, schließlich verschlug es ihn nach Mallorca, wo er sich als Küchenhilfe und Maurer durchschlug.
„Ich konnte gut kochen, aber weil ich weder das Lesen noch das Schreiben beherrschte, bekam ich nie einen richtigen Job.“ Er schaffte die Rückkehr in die Zivilisation nicht, bis heute ist ihm das nicht gelungen. „Ich war immer allein“, sagt Marcos. Er beginnt zu trinken, weiß immer noch nicht mit Geld umzugehen. Er zieht aufs Festland zurück, doch die Rückkehr in die Gesellschaft gelingt ihm nicht, zeitweise lebt er wieder in einer Höhle, in den Bergen nahe Málaga. Auf Mallorca lernte Marcos einen Anthropologen kennen, der seinen Fall aufzeichnete. Jahre später liest der Filmemacher Gerardo Olivares zufällig von Marcos, als die Zeitung „El País“ von Kindern berichtet, die allein in der Wildnis aufwuchsen. Olivares setzt einen Privatdetektiv an, der Marcos nicht wie erwartet in Andalusien, sondern im Nordwesten ausfindig macht. Dort lebt er auf der Finca von Manuel Barandela, in einem Dorf nahe der Stadt Orense in Galicien.
Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er für Manuel, die beiden Männer verbringen viel Zeit zusammen, obwohl Manuel sich lange darüber beschwerte, dass er mit Marcos kein vernünftiges Gespräch führen konnte. „Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass sein Vokabular einfach zu klein ist, er versteht viele Wörter nicht. Aber mittlerweile fragt er mich, wenn er etwas nicht versteht.“ Regisseur Olivares war sofort klar, was er aus Marcos‘ Geschichte machen musste. „Hombre, der Film ist das Beste, was mir im Leben passiert ist“, sagt Marcos mit seinem rauchigen andalusischen Akzent.
Auch deshalb, weil er nach mehr als 40 Jahren wieder Wölfe sehen sollte, bei den Dreharbeiten in den Waldgebieten um Madrid. „Ich bin auf einen Felsen geklettert und habe wie ein Wolf geheult. Sie sind auf mich zugelaufen, da habe ich mich gleich auf den Boden geworfen, Bauch nach oben, Hände im Nacken. Damit sie wissen, dass ich mich unterordne. Dann kam die Wölfin, sie schnupperte an mir, ich habe sie angepustet – und schon hat sie mich abgeleckt.“ Kurz darauf aber kam auch das Männchen, knurrte Marcos zähnefletschend an. „Da habe ich ihm einfach meinen Arm in den Rachen gesteckt. Und ihn gestreichelt. Da waren wir gleich Freunde. Diablos, war das schön!“, freut sich Marcos. Momente des wahren Glücks.“
Diese „Story“ könnte fast den roten Faden vorgegeben haben für die Geschichte von Marina Chapman – „Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam. Eine Kindheit unter Affen“. Ich habe darin leider nicht allzu viel über die Affen erfahren – aber das ist ja immer das Problem bei der allzu teilnehmenden Beobachtung.
.
.
.
.

Familie Russ im Vorderhaus feiert weder das Frühlingsfest noch halten sie überhaupt was von diesem ganzen „Frühlingswahn und dem ganzen Grünzeug“ – sie rauchen einfach weiter wie im Winter.
Die FAZ teilte mit:
Es gibt einen faszinierenden Photoband mit Interviews über die sowjetische Raumfahrt-Architektur (Kosmismus), dieser wird ausführlich besprochen (mit großen Abbildungen), und endet mit dem Satz: Dass dieser Kosmismus eine glänzende kommunistische Zukunft im All versprach, aber was werde nun, nach dem Ende des „Übermenschen“ (Gagarin) für ein neues Heldentum über uns (bzw. die Russen) kommen.
Diese sozialistische Science Fiction fand ihren Höhepunkt mit dem Roman „Der rote Planet“ von Alexander Bogdanow (Verlag Volk und Welt -1984). „Der rote Planet ist eine moderne sozialistische Utopie, in der auch feministische Themen präsent sind. Kim Stanley Robinson ließ sich für seine Novelle Roter Mars durch Bogdanow inspirieren und schuf auch einen ihm ähnlichen Charakter seines Namens. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg schuf Bogdanow mit seiner monumentalen „Tektologie“ eine breit angelegte Theorie der Weltorganisationsdynamik, die zugleich als Systemtheorie, als Krisen- und Katastrophentheorie, als Theorie der Nachhaltigkeit und als globale Kulturtheorie gelten kann. Ein wichtiges Anliegen bestand ihm darin, die Menschheit vor dem Unterschreiten eines kulturellen Standards zu bewahren, zu verhindern, dass es zu einer globalen Nivellierung und Anpassung nach unten kommt. Er befürchtete einen Rückfall der Zivilisationen in die elementare Barbarei.“ (Wikipedia)
1926 gründete er, inzwischen Professor für Politische Ökonomie, ein „Institut für Bluttransfusion“, zwei Jahre später starb er bei einem Selbstversuch. Auf Arte sah ich einen Mars-Invasionsfilm (aus Anlaß der Datenflut vom Mars-Rover „Curiosity“ zeigten sie eine ganze Reihe). In dem, den ich sah, versuchen die mit konventionellen Wafen (inkl.Atombombe) wegen ihres elektromagnetischen Schutzschirms untötbaren Marsianer die Erde zu erobern (ihren roten Planeten haben sie zu Ende ruiniert). Was sie schließlich besiegt, sind „unsere“ Bakterien hier, denen gegenüber sie keine körpereigenen Abwehrkräfte entwickelt haben.
Zuvor las ich in einer Geschichte der südamerikanischen Indianer, dass sie vor allem von den Bakterien und Viren der weißen Europäer ausgerottet wurden – Millionen. Die wenigen, noch heute in Brasilien z.B. lebenden Indianer darf man als Weißer heute nur besuchen, wenn man zuvor in einen mehrmonatigen Quarantäne-Aufenthalt eingewilligt hat.
Vor einigen Monaten machte die NASA mit einer Meldung auf sich aufmerksam, die sich wenig später als falsch erwies: Leben auf dem Mars, Curiosity hatte angeblich Bakterien da oben entdeckt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann waren es Bakterien, die Curiosity aufgrund eines Sterilisationsfehlers an einem Bohrer von der Erde dort mithingeschleppt hatte. Gleichzeitig entstand daraus aber die Frage: Gibt es vielleicht aber doch auch marseigene Bakterien? Wenn, ja… „Über eines sind sich die Strategen bei der Nasa – bislang – im Klaren: bevor der Mars zur Erde gemacht wird, muss Gewissheit herrschen, dass es kein marseigenes Leben gibt, und seien es auch nur Mikrolebewesen. Sie dürften durch das Terraforming (1) nicht in Gefahr geraten. Dies immerhin hat der Mensch, bei allen Parallelen zwischen Amerika und dem Mars, seit der Fahrt des Kolumbus mit ihren schlimmen Konsequenzen für die Indianer gelernt: Leben in Neuen Welten muss geschützt werden.“
„‚Wenn das Curiosity-Team Eis findet, müssen wir erst einmal reden‘, hat die Nasa-Beauftragte für den Schutz fremder Planeten, Catherine Conley, verfügt,“ schrieb die SZ.
Er hat dann Eis gefunden – und blieb kurz davor stehen. Sendepause, sie hält noch immer an. Auf der Suche nach Lebensformen der Erde, die eventuell auch auf dem Mars existieren könnten, hatten US-Forscher aber nun einen wichtigen Anhaltspunkt: Wasser befindet sich auf dem Roten Planeten in gefrorenem Zustand im Boden. Die Permafrostböden der Erde gelten aus diesem Grund als terrestrisches Gegenstück der Marsumgebung.
Die Wissenschaftler untersuchten daher Proben dieses Bodentyps aus dem Nordosten Sibiriens. Nachdem sie im Boden enthaltene Bakterien 28 Tage lang auf einem Nährboden bei normalem Druck und Temperatur wachsen ließen, brachten die Forscher die Kolonien auf neue Nährplatten. Dort wurden sie bei null Grad Celsius und unter verschiedenen Druck- und atmosphärischen Bedingungen 30 Tage lang isoliert. Sechs Bakterienkolonien waren demnach in der Lage, bei null Grad, geringem Druck und einer CO2-reichen Atmosphäre zu gedeihen. DNA-Analysen zeigten, dass die zähen Organismen allesamt zur Gattung Carnobacterium gehören, einer Gruppe der Milchsäurebakterien.
Zwei Wiener Weltraumforscher erklärten der Presse, was das alles bedeute: „Sam, das Messgerät an Bord des Mars-Rovers, hat die Signale von organischen Verbindungen, genauer: Kohlenstoff in Verbindung mit Chlor und Wasserstoff, in Gesteinsproben nachgewiesen. Die Stelle, deren Namen man sich möglicherweise wird merken müssen, heißt „Rocknest“. Ein organisches Molekül, etwa Alkohol oder Formaldehyd, kann ein Hinweis auf ehemaliges mikrobielles Leben auf dem Mars sein, muss aber nicht.“
Anmerkung:
(1) Das was bisher “Kolonisierung”, gewaltsame Eroberung eines Landes hieß, heißt nun Terraforming – ohne Verdrängung derer, die vorher da waren, diesmal: “die Umformung von anderen Planeten in bewohnbare erdähnliche Himmelskörper mittels zukünftiger Techniken. Planeten oder Monde sollen so umgestaltet werden, dass darauf menschliches Leben mit geringem oder ohne zusätzlichen technischen Aufwand möglich wird.” (Wikipedia)

Unter ihnen, beim Ehepaar Degenhart, ist dagegen die Stimmung bombig. Ihre Kinder sind schon seit Jahren aus dem Haus. Man weiß so gut wie nichts über sie.

Das ist Jürgen aus dem Hinterhaus, hier mit seiner kleinen Cousine während eines Frühlingsspaziergangs im Volkspark Rehberge.
Weitere Details aus der wunderbaren Welt der Mikroorganismen:
1. Hier neues über E.coli: Im Online Fachmagazin PNAS berichten britische Mikrobenforscher, dass sie E.Coli-Bakterien derart gentechnisch verändert haben, dass sie freie Fettsäuren als Grundstoff zu den Kohlenwasserstoffen verstoffwechseln aus denen Diesel-Kraftstoff besteht. Dieser ist mit herkömmlichen fossilen Brennstoffen chemisch identisch, so dass man ihn gleich in den Tank kippen kann… „Thomas Howard von der Uni Exeter und Kollegen von der Shell-Forschung schleusten dazu Gene verschiedener Mikroben in das Erbgut der Darmbakterien ein,“ heißt es über diese E.coli-Veränderung heute in der SZ. Der Studienleiter John Love meinte dazu: „Konventionellen Diesel in kommerziellen Mengen durch einen Kohlenstoff-neutralen Biokraftstoff zu ersetzen, wäre ein gewaltiger Schritt in Richtung unsere Ziels, die Treibhausemissionen bis 2050 um 80% zu reduzieren.“
2. Dem sauren Magensaft zum Trotz: Im menschlichen Magen herrscht Bakterienvielfalt. US-Mikrobiologen wiesen nun rund 120 Bakterien in der Magenschleimhaut nach, von denen einige noch unbekannt sind. Das Team um Elisabeth Bik der Stanford University School of Medicine entdeckte u.a. ein Bakterium, dessen nächster Verwandter auch unter extremen Umweltbedingungen bestens gedeiht, so etwa auf radioaktiven Abfallhalden. Ursprünglich gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Mikroorganismen im Magen auf Grund des hohen Säuregehalts nicht überleben würden. Vor rund 20 Jahren entdeckten dann die zwei Australier Barry J. Marshall und J. Robin Warren (Nobelpreisträger 2005) das Heliobacter pylori im Magen, einen potenziellen Erzeuger von Magengeschwüren. Bik und ihr Team analysierten nun Proben der Magenschleimhaut von 23 Probanden. Dabei entdeckten sie mindestens 128 verschiedene Bakterienarten.
3. Auch hier lebt Heliobacter pylori. Prinzipiell ist das Untersuchungs-Verfahren der Forscher von der Universität Tokio bestechend einfach: Entnahme von Gas aus dem Magen oder Zwölffingerdarm und sofortige Analyse im Gaschromatographen. Finden sich Wasserstoff oder Methan ab einer bestimmten Konzentration, ist dies ein äußerst sicherer Hinweis auf die bakterielle Gärungs-Herstellung dieser Gase vor Ort. Das Problem: Bislang gab es nur die Möglichkeit, diese Gase (vor allem Wasserstoff) in der Ausatemluft von Patienten zu bestimmen – ein ziemlich ungenaues Verfahren. Jetzt stehen jedoch neuartige Magenspiegel (Endoskope) zur Verfügung, mit denen eine Gasentnahme während der endoskopischen Untersuchung von Speiseröhre, Magen oder Zwölffingerdarm möglich wird. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass die Gase entnommen werden, bevor das übliche „Aufblasen“ des Magens mit Gas stattfindet.

Janna aus Moabit spinnt: Sie posiert hier mit ihrem Jüngsten und einer Schultüte: „Die Engländer haben die Einschulung zu Ostern hier eingeführt, und dabei bleibe ich auch.
.
.
.

Auch die Rentner können sich nur schwer an die neuen Zeit gewöhnen: Wie eh und je gehen sie am Spätnachmittag zurück in den Osten, obwohl es dafür überhaupt keine Notwendigkeit mehr gibt.

Die neue Zeit sieht eher so aus – interspecies communication ist in: Das Bild zeigt den Zootierpfleger Erwin Krump mit seinem langjährigen „Freund“ Bassu bei einem Ausflug zur Langgraswiese im östlichen Tiergarten. Näheres über diese Spezies und wie sie sich ins Weichbild der Stadt integriert, findet man in dem Roman „Mr Thundermug“ von Cornelius Medvei – über eine Pavian-Familie in einer englischen Kleinstadt und wie sie endete.
Schon bald ist Anbaden – viele tazler gehen gerne zum Schlachtensee. In diesem Jahr jedoch nicht mehr – er ist ihnen unheimlich geworden – wegen der im See lebenden Welse:
Man spricht bereits von „Riesenwelsen“: „In den heimischen Gewässern sind Zwei-Meter-Exemplare keine Seltenheit mehr,“ inzwischen haben die „Riesenwelse den Rhein erobert“. Biologen sprechen von der größten Veränderung der Wasserfauna seit der Eiszeit und rätseln über den Grund dafür, berichtet der Spiegel. Beobachter sind entsetzt über die großen Raubfische, weil sie nicht nur alle anderen Fische fressen, sondern auch schon Wasservögel und größere Nagetiere. In Bayern schreckte ein Zwei-einhalb-Meter-Wels – „Killer-Waller“ dort genannt – nicht einmal vor unserem größten flugfähigen Vogel – einem Schwan – zurück. (1) In einem niederösterreichischen Badesse zog ein solcher Riesenwels sogar eine 14jährige namens „Franziska S.“ unter Wasser. Im Berliner Schlachtensee wurde eine Schwimmerin schmerzhaft gebissen, anschließend zog ein Angler einen 2 Meter 60 langen „Monsterwels“ aus dem See. (2) Das unheimliche, geradezu plötzliche Wachstum des schuppenlosen Schlammfisches „Europäischer Wels“ – um 100% geschieht zusammen mit anderen gravierenden Veränderungen in der Unterwasser-Fauna; einige seien hier genannt:
1. Die Hummer vor der Ostküste der USA vermehren sich wie noch nie und werden immer bunter. Als Ursache wird ebenso wie bei den Welsen die Erwärmung des Wassers vermutet. Die dortigen Hummerfischer sind über ihre zunehmend üppigeren Hummerernten nicht froh, denn das Überangebot macht mehr Arbeit, gleichzeitig verdienen sie jedoch immer weniger, weil die Hummerpreise sinken. Die einstige Armen- und Gefängnis-Kost Hummer ist drauf und dran, wieder zu einer solchen zu werden. Jüngst kam es zu einem Streit zwischen kanadischen und amerikanischen Hummerfischern, weil diese ihre Tiere in Kanada zu Dumpingpreisen verkauften. Daneben müssen sie sich auch noch gegen den wachsenden Einfluß der Tierschützer wehren, die das Zubereiten des Großkrebses – z.B. auf der weltgrößten „Hummerparty“ in Maine – als barbarisch kritisieren: Die Tiere werden dort lebend in riesige Behälter mit kochendem Wasser geworfen. Das rohe Massenvergnügen in der Hummerhauptstadt wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace kritisiert – ausgerechnet in einer Gourmet-Zeitschrift (sein Text heißt auf Deutsch: „Am Beispiel des Hummers“).
2. Die Makrelen wandern neuerdings immer weiter nordwärts – bis nach Island. Dort in der 200 Seemeilen-Fischfangzone werden die Schwärme von isländischen Fischern gefangen, die nun laufend ihre Fangquoten erhöhen. Die Fischer in der EU möchten den Makrelenschwärmen nachfolgen, aber die isländischen Kollegen sind schneller. Die EU droht Island und den Färöer-Inseln in dem Streit nun mit Sanktionen. Der Klimawandel habe das Verbreitungsgebiet der Tiere verändert, verteidigt sich und seine Fischer Islands Fischereiminister Steingrímur Sigfússon: „Große Mengen von Makrelen fallen in unsere Gewässer ein. Das sind gierige Tiere, die auch anderen Arten Futter wegnahmen. Island hat Anspruch auf einen gerechten Anteil von dieser wandernden Art. Das kann niemand bestreiten.“
3. Beim Abwandern eines anderen küstennahen Meerbewohners sorgen sich vor allem die Vogelfreunde: Bei den Sandaalen an der irischen, schottischen und norwegischen Küste, weil sie zur Hauptnahrung der dort brütenden Papageientaucher zählen. Der Biologe Cord Riechelmann fand an der Nordspitze Irlands heraus, dass die dortige Papageientaucher-Kolonie auf der Suche nach neuen Lebensräumen ist. Auf deren Brutfelsen beobachtete er, dass die Papageientaucher kaum noch Jungen großziehen konnten, weil es kaum noch Sandaale in ihren Revieren gibt. Diese seien wegen der Klimaerwärmung in kältere Meereszonen abgewandert.
4. Im Mittelmeer gibt es sogenannte Steckmuscheln, sie leben mit einem winzigen Krebs zusammen der Steckmuschelwächter heißt und sich in ihrem Inneren angesiedelt hat. Er hat Augen und wenn er sieht, dass Eßbares zwischen die Schalen der Muschel geraten ist, zwickt er sie, die sich daraufhin schließt und beide machen sich dann über die Nahrung her. Schon Aristoteles und nach ihm Plutarch und Cicero haben sich mit dieser zu ihrer Zeit gerühmten Symbiose zwischen der Steckmuschel und dem Steckmuschelwächter beschäftigt. Ihr Interesse war jedoch auch ökonomisch motiviert, denn die Steckmuschel hält sich mit sogenannten Byssusfäden am Boden fest. Diese Fäden hat man damals zu einer sehr edlen (und teuren) Seide für Kleidungsstücke verarbeitet. In zwei italienischen Hafenstädten werden die Byssusfäden der Steckmuschel heute noch verarbeitet. Unlängst wurde auch ihr Symbiont, der Steckmuschel-Wächter, zu einem ökonomischen Problem: Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer fanden ihn vor Sylt im Inneren einer Miesmuschel. Sie vermuten, dass die Ursache seines Vordringens in den Norden entweder eine Folge der Meereserwärmung ist oder der Einfuhr von Miesmuscheln aus England, wo er früher jedoch auch so gut wie gar nicht vorkam. Muscheln aus Großbritannien werden trotz Protesten der Naturschützer seit 2006 im Wattenmeer ausgebracht. Und bei Sylt befinden sich Schleswig-Holsteins größte Zuchtflächen für Miesmuscheln. Die Miesmuschelfischer befürchten wegen der Muschelwächter-Fundes bereits eine Verunreinigung ihrer Muschelbänke – und damit Absatzprobleme, denn es sei wenig verkaufsfördernd, wenn Krebse in der Muschel hausten und mitgekocht werden. So könnte dieser tatsächlich zum Wächter der Muscheln werden: Er entwerte sie für die Vermarktung, erklärte der Biologe Rainer Borcherding von der Sylter Schutzstation. Das sei eine „Öko-Lüge“, erwiderte der Geschäftsführer der Firma Royal-Frysk: „Unsere Importe werden von der Fischereiabteilung des Amtes für Ländliche Räume überwacht.“ Den Muschelwächter gebe es überdies bereits seit 25 Jahren im Watt vor der Westküste, sagte er.
In dem vielgelobten Buch „Der innere Sinn. Archäologie eines Gefühls“ des US-Literaturwissenschaftlers Daniel Heller-Roazen findet man ebenfalls eine Geschichte der mittelmeerischen Steckmuschel-Muschelwärter-Beziehung. Der Autor beruft sich dabei auf den schottischen Biologen D’Arcy Thompson. Für diesen bestand deren Symbiose darin, dass der kleine Krebs der Muschel als „Türwächter“ dient – sie also eher beschützt als mit ihr zusammen Nahrung einfängt. Thompson konnte sich dabei auf Cicero und Plutarch berufen, für die der „Wärter“ nicht innerhalb, sondern außerhalb der Muschel angesiedelt ist, d.h. „vor dem Tor der Muschel sitzt und sie bewacht,“ wie Cicero schrieb. Während Plutarch auf ihre Jagdkooperation abhob: Gemeinsam „packen und fressen sie, was ihnen in die Falle gegangen ist.“ Beiden Autoren geht es um eine erfolgreiche „Zusammenarbeit“ am Beispiel von Krebs und Muschel: Dabei muß man sich laut Cicero „verwundert fragen, ob sie durch eine Übereinkunft oder schon seit ihrem Entstehen von der Natur selbst aus zu dieser Verbindung gekommen sind.“ Für die Stoiker war das ein Problem, weil sie davon ausgingen, dass allein der Mensch über „Rationalität“ verfüge, was ihn von anderen Tieren scharf unterscheide. Den einen wie den anderen eigne jedoch so etwas wie „Selbsterhaltung“ bzw. „Selbstbefreundung“ – denn sie hätten ein „Bewußtsein ihrer angeborenen Verfassung“. Das Kind, so erläutert Seneca, wisse zwar nicht, was körperliche Verfassung sei, aber es kenne die seine. Heller-Roazen fügt hinzu: Seneca „zeigt auch keine Scheu, für alle Tiere zu sprechen, wenn er von sich selbst spricht.“ Für die Stoiker gehe es dabei um das „Eigenste in jedem“ – seine „Verfassung“. Der US-Autor kommt abschließend von dieser wieder zurück auf die beispielhafte Muschel-Wächter-Beziehung – jedoch um den Preis ihrer Metaphorisierung: „Jene ‚Verfassung‘ ist das in jedem Tier, was nicht das Tier selbst ist und, insofern sie es nicht ist, ihm ‚von Anbeginn an‘ erlaubt, zu werden. Als Wärter in ständiger Bewegung zwischen dem Außen und Innen der beweglichen Schale des Selbst ist sie dieser kleine Krebs, der die Muschel bewacht und sie von Zeit zu Zeit vorsichtig zwickt, um sie darauf aufmerksam zu machen, das da Nahrung ist.“
Der Schriftsteller Rudolf Kleinpaul blieb dem gegenüber in seinem 1893 veröffentlichten Werk „Das Leben der Sprache und ihre Weltausstellung“ skeptisch: „Die Alten glaubten, diesmal aber irrigerweise, an ein Freundschaftsbündnis zwischen Krebs und Muschel. Die Steckmuschel sollte in ihrer Mantelhöhle einen rundlichen Krebs beherbergen, den sie Wächter nannten.“ Ähnlich heißt es in „Meyers Konversationslexikon“: „Im Altertum sprach man von dem sogen. Muschelwächter, einem Krebs, der seinen Wirt vor Gefahren warnt, dafür aber in ihr wohnen sollte. Letzteres ist richtig, ersteres grundlos.“ Das Internet-Lexikon „arcor.de“ spricht von einer „Parabiose“ (statt von einer Symbiose) zwischen einer Miesmuschel (nicht Steckmuschel!) und dem Krebs: „Der Muschelwächter lebt in der Mantelhöhle einer Miesmuschel, wo er fast sein ganzes Leben verbringt. Er hat nur einen weichen Panzer und ist in der Muschel vor Feinden geschützt. Lediglich zur Paarungszeit verlässt der Muschelwächter die Miesmuschel, da er nur zu dieser Zeit einen festen Panzer besitzt. Er profitiert als Mitesser vom Nahrungs- und Atemstrom der Miesmuschel.“ Im Lexikon „wissen.de“ heißt es dagegen über den Muschelwächter – quasi definitiv: „bis 1,8 cm breite Krabbe aus der Gruppe der Pinnoteridae; lebt frei im Mantelraum verschiedener Muscheln. Zur Paarung verlassen die Tiere ihre Muschel. Danach sterben die Männchen, während die Weibchen wiederum eine Muschel aufsuchen.“ Die Art der Krebs-Muschel-Beziehung bleibt dabei unerörtert, auch, ob der mittelmeerische Muschelwächter wegen der Klimaerwärmung nach Norden zu den Miesmuscheln rübergewandert ist.
Für das unheimliche Wachstum des europäischen Wels haben die Fischforscher und Fischer mehrere Erklärungen: Neben der Klimaerwärmung könnten auch die vielen Rückstände von Medikamenten, u.a. Östrogen, das Wachstum der Raubfische anregen. Eine andere These ist, dass die langsam von Industrieabfällen und Agrarrückständen gesäuberten Gewässer dem Fischbesatz zugute kommt und damit auch ihrem Freßfeind. Genetiker sprechen dagegen von einer spontanen „Mutation“, Mikrobiologen von einem Magen-Darm-Parasiten, der die Verdauung beim Wels anregt, was wiederum zur Nahrungsaufnahme motiviert, die schließlich sein Wachstum beschleunigt: „Das geht aber nicht lange gut!“. Die Eso-Szene vermutet eher Einflüsse des Mondes und der Sonnenprotuberanzen, die seit einigen Jahren zunehmen, während die gläubigen Angler es für ein „Zeichen“ von noch weiter oben halten. Einige Kreuzberger Angler geben dagegen kühn zu bedenken: Im Mekong ist aus industriellen Gründen, wegen Dammbauten etc., gerade der dort heimische „Riesenwels“ am Aussterben, dafür haben wir ihn jetzt hier…“So what?!“ Die vietnamesischen Fischhändler in ihrer Lichtenberger Großmarkthalle versprechen bereits, sich darauf einzustellen. Der Fischforscher Dr. Salm-Schwader gibt jedoch zu bedenken: „Riesenwelse hat es hier schon immer gegeben – das ist ein Anglermythos, der schon seit Hunderten von Jahren durch die seltenen Fänge großer alter Welse genährt wird.“ (3)
Zwei Mitarbeiter des „Instituts für Küstenforschung“ am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht, der Klimaforscher Hans von Storch und der Ethnologe Werner Krauß, haben gerade ein Buch mit dem Titel „Die Klimafalle“ veröffentlicht, darin geht es darum, dass „die Klimaforschung von der Politik gekidnappt wurde, um ihre Entscheidungen als von der Wissenschaft vorgegeben und als alternativlos verkaufen zu können.“ Etwas anders verhält es sich mit den oben erwähnten Veränderungen bei der Unterwasser-Fauna, so weit es die Fisch-, Krebs- und Muschel-Bestände betrifft, die von den immer hochtechnischer gerüsteten Fischern ausgebeutet werden: Hierbei liefert der „Klimawandel“ ihnen eine billige Erklärung für neue Probleme, denen sie machtlos vis à vis stehen.

Ein in der Schweiz geangelter Wels. Photo: www.petri-heil.ch
Anmerkungen:
(1) Der Spiegel berichtete Ende 2012 über die Forschungsergebnisse einiger französischer Ichtylogen, die Welse im Fluss Tarn, der die Regionen Languedoc-Roussillon und Midi-Ryrénées durchfließt und in die Garonne mündet: „Knapp ein bis zwei Meter lang sind die meisten Exemplare, die dort herumschwimmen. Besonders alte Welse sind noch größer, sogar von fünf Meter großen Tieren wird berichtet. Bei dem stattlichen Umfang müssen die Raubfische einiges fressen – u.a haben sie es Tauben abgesehen.“ Europäische Welse (Silurus glanis), daneben gibt es noch den Aristoteles wels (Silurus aristotelis), sind eigentlich nicht in Westeuropa heimisch, sondern in Osteuropa, wo sie sich von der Wolga aus verbreiteten. „Sie wurden erst vor wenigen Jahrzehnten in vielen Gewässern hier angesiedelt – aus ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet gibt es keine Berichte von Tauben fangenden Welsen.“ Die Forscher beobachteten im Fluss Tarn nun, „ dass die Welse in rund 72 Stunden 54 Angriffe unternahmen. 15-mal hatten die Welse Erfolg und tauchten mit einer Taube im Maul wieder ab. In 40 Prozent der Fälle wuchteten die Fische mehr als die Hälfte ihres Körpers aus dem Wasser. Lange blieben sie nicht an Land – nach maximal vier Sekunden befanden sich die Welse wieder in ihrem Element. Mittels einer sogenannten Isotopenanalyse wollten die Forscher klären, welchen Anteil an der Nahrung Tauben bei einzelnen Welsen ausmachten. Dafür nahmen sie kleine Gewebeproben der Raubfische, ihrer typischen Beutetiere im Wasser sowie von Tauben. Das Ergebnis: Der Anteil an Flusskrebsen scheint von Wels zu Wels nicht stark zu variieren, der Fisch- und Taubenanteil dagegen schon. Die Beobachtung zeigte auch, dass die Taubenfänger unter den Welsen im Schnitt kleiner waren als der Durchschnittswels im Tarn. Die größten bei der Taubenjagd beobachteten Welse waren schätzungsweise 1,5 Meter lang. Möglicherweise ist das Stranden für größere Welse zu kräftezehrend oder gefährlich. Vielleicht weichen die kleineren Welse auf die Vogelbeute aus, weil sie da nicht mit größeren Artgenossen um die Beute konkurrieren müssen. Geklärt ist das noch nicht.“
Eine weitere Welsforschung findet in der Maas(Meuse statt, dieser Fluß verbindet Frankreich, Belgien und die Niederlande: „Von Mai bis Dezember 2011 wurde durch Sportvisserij Niederland und Sportvisserij Limburg in Zusammenarbeit mit den Forschungseinrichtungen VisAdvies, INBO (Be) und CEFAS (UK) eine Feldarbeit zur Erforschung des Verhaltes und der Reproduktion des Europäischen Welses in der Maas – nahe Linne und Roermond – durchgeführt. Für diese Forschung wurden einige Welse im Inneren mit einem Funksender und äußerlich (für die optische Erkennung) mit einem “Floy-Tag” ausgestattet. Für das Fangen und Markieren der Welse wurden mehrere Ausnahmegenehmigungen beantragt und erteilt.Die Studie dient dazu, Einblick in das Verhalten und die Populationsdynamik des Europäischen Weleses in den Niederlanden zu erhalten und aufzuzeigen, dass sich der Europäische Wels sich in den Niederlanden wieder ausbreitet.
Momentan steht der Wels in den Niederlanden immer noch unter Artenschutz. Die Ergebnisse dieser Studien sollen dazu beitragen den Wels wieder in das Fischereigesetz aufzunehmen, damit man diesen auch gezielt wieder angeln darf. Aber dennoch gibt es weiterhin die Verpflichtung [für die Welsangler an der Maas und den Maas-Seen]: ‚catch and release!’”
Weitere Wels-Nachrichten: In Sukow bei Schwerin wurde eine Farm mit afrikanischen Welsen errichtet. Die Grenzflüsse zwischen Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg, u.a. Mosel und Sauer, sind derart PCB-belastet, das vor dem Verzehr „großer, fettreicher Fische“ – vor allem Welse – aus diesen Flüssen gewarnt wird. Anfang März 2013 fingen zwei Männer aus Sachsen-Anhalt in der Lombardei einen Riesen-Wels. „Mit einem Gewicht von 122,5 Kilogramm [rund zweieinhalb Zentner] dürfte er der schwerste, je an Land gezogene Waller sein,“ meint die Allgäuer LVZ. Auf „wallerforum.de“ schreibt Eisi: „Ich habe neulich auf DMAX die Folge Flussmonster gesehen, in der der „Extremfischer“ Jeremy Wade auf Waller angelt.
Die Folge heißt europäischer Menschenfresser und darin wird gezeigt, wie gefährlich der europäische Wels nicht sei. Besonders ist mir eine Szene aufgefallen in der Jeremy mit einem Waller im Wasser ist und der Wels sich umdreht. Darauf hin „hechtet“ der Extremfischer aus dem Wasser damit der Waller ihn nicht frisst! Mich hat das irgendwie fürchterlich geärgert, dass er den Waller so schlecht macht…“
Über den Nutzfisch Wels – „Catfish auf Englisch – schreibt das englischsprachige Wikipedia: „Catfish have widely been caught and farmed for food for hundreds of years in Africa, Asia, Europe, and North America. Judgments as to the quality and flavor vary, with some food critics considering catfish as being excellent food, while others dismiss them as watery and lacking in flavor. In Central Europa catfish were often viewed as a delicacy to be enjoyed on feast days and holidays. Migrants from Europe and Africa to the United States brought along this tradition, and in the USA catfish is an extremely popular food. The most commonly eaten species in the United States are the channel catfish and the blue catfihs, both of which are common in the wild and increasingly widely farmed. Farm-raised catfish became such a staple of the diet of the United States that on June 25, 1987, President Ronald Reagan established a ‚National Catfish Day‘ to recognize ‚the value of farm-raised catfish“.“
Über die „Elektrischen Welse“ (Malapteruridae electricus) heißt es auf dem deutschsprachigen Wikipedia: Sie leben in den Süßgewässern des tropischen Afrika und im Nil. Die auch „Zitterwelse“ genannten Tiere können per Elektroplax zur Betäubung ihrer Beute Stromstöße einsetzen. (Der Elektroplax ist ein Organ einiger Fische, das elektrische Spannungen erzeugen kann, die an das Wasser abgegeben werden. Es gibt etwa 250 Fischarten, die den Elektroplax benutzen. Dazu gehören neben den Zitterwelsen, Zitteraale und Zitterrochen. Durch den Elektroplax können Spannungen von bis zu 1.000 V erzeugt werden.)
Alfred Brehm schreibt über den „Elektrischen Wels“ (1884): „Unser Fisch ertheilt, wenn man ihn mit der Hand berührt, willkürlich Schläge, welche denen einer galvanischen Säule ähneln und sehr verschiedene Stärke haben. Während man ihn zuweilen anfassen kann, ohne einen Schlag zu erhalten, empfindet man zu anderen Zeiten bei der geringsten Berührung die Wirkung seines Unwillens; ja, unser Wels läßt sich von einzelnen Personen längere Zeit in der Hand halten und ertheilt dem Nachfolger derselben sofort einen Schlag. Letzterer ist nicht besonders schmerzhaft und kann wohl nur kleinen Thieren gefährlich werden.
Forskal entdeckte den Zitterwels im Nile, Adanson fand ihn im Senegal auf. An einzelnen Orten, das heißt hier und da, ist er nicht selten; auf sandigem Grunde scheint er zu fehlen. Das Fleisch wird gegessen, jedoch nicht besonders geschätzt; dagegen schreibt man dem Zellengewebe, von welchem die elektrische Kraft ausströmt, heilende Eigenschaften zu, verbrennt es auf Kohlen und läßt auf den Kranken das Gas ausströmen, welches beim Verbrennen sich entwickelt.“ In der Zeitschrift „Ethology“ (Vol 73/Issue 3) berichten die Biologen Catharine H. Rankin und Peter Moller über „Social Behavior of the African Electric Catfish, Malapterurus electricus, during Intra- and Interspecific Encounters“.
Das Mississippi Agricultural and Forestry Experiment Station betreibt zusammen mit der Mississippi State University ein „Delta Research and Extension Center“ (DREC), wo man Welsforschung betreibt – zusammen mit dem „Thad Cochran National Warmwater Aquaculture Center located on the DREC campus in Stoneville. Dort gibt es auch eine „Catfish Genetics Research Unit“. Auf der DREC-Internetseite heißt es – über die Bedeutung des Welses für die Delta-Region:
„Mississippi leads the nation in catfish production with about 94,000 water surface acres used in 2006. The state produces about 70 percent of the catfish industry’s fingerlings, making Mississippi the largest supplier of catfish fingerlings [Jungwelse] in the country. Catfish value of production to Mississippi’s economy in 2006 was $273 million. Producers harvest catfish throughout the year with production occuring during the warm months between April and October. Approximately 86 percent of the state’s catfish production occurs in the Delta region of Mississippi. Research areas include pathology, economics, fish behavior, nutrition and water quality.
The rapid growth of the catfish industry in the 1980s and 1990s led it to become one of the most important agricultural activities in states such as Mississippi, Arkansas, Alabama, and Louisiana. The combined production acreage of these four states makes up 94 percent of all catfish production acreage. Mississippi has had more acreage in catfish production than the other three states combined and has held this position since the late 1980s. The catfish industry generates an economic impact of billions of dollars and is the primary source of economic activity and employment in a number of Mississippi counties…Low prices received by producers in 2002 ($0.57/pound) and 2003 ($0.58/pound) have caused economic hardship for Mississippi producers resulting in a decrease of 10,000 acres since 2002. While catfish prices improved in 2004, higher catfish feed prices and increasing fuel prices mostly negated gains. Declining feed prices coupled with fish prices that have returned to the 5-year and 10-year average monthly price ranges could lead to a better financial future for catfish producers.“
Gemäß den Welsforschungen der „Fisheries Research Division“ der „Wildlife Resources Commission“ von North Carolina (NC) werden zwar auch dort die Welse immer größer, die größten jedoch bisher nicht über einen Meter:
„When most anglers consider trophy flathead catfish waters in coastal North Carolina, the Cape Fear and Neuse rivers usually come to mind. However, N.C. Wildlife Resources Commission biologists have found that the Tar River also boasts some hefty flathead catfish.
Biologists have been sampling the Tar River for all species of catfish each summer since 2006. Sampling occurred near Falkland and Old Sparta in 2006 and from Greenville to Grimesland in 2007 and 2008. Catfish were collected using an electrofishing boat, the principal sampling method for coastal rivers.
Flathead catfish in the Tar River are increasing in abundance and size. Every year, flathead catfish comprised a larger portion of the total catfish catch (14 percent in 2006 to 56 percent in 2008). Conversely, the percentage of white catfish in our total catch continued to go down each year (53 percent in 2006 to 32 percent in 2008). Channel catfish were also collected during the past three summers. Most of the white catfish collected were between 12 and 18 inches long, while channel catfish were between 12 and 24 inches long.
A larger size range of flathead catfish was observed, with fish ranging in size from 4 inches to more than 40 inches. In fact, biologists continue to see larger flathead catfish showing up in their samples each year. In 2006, the largest flathead catfish collected was 35 inches long and weighed 25 pounds. The largest one collected in 2007 was 40 inches long and weighed 33 pounds, while the biggest flathead catfish in 2008 was 42 inches long and weighed 51 pounds.“
Über die südamerikanischen Welse berichtet „Science News“ aus Brasilien:
„Peer into any stream in a South American rainforest and you may well see a small shoal of similar-looking miniature catfish. But don’t be fooled into thinking that they are all the same species. An extensive investigation of South American Corydoras catfish, reveals that catfish communities- although containing almost identically coloured and patterned fish, could actually contain three or more different species.
Establishing for the first time that many species are mimetic; that is, they evolve to share the same colour patterns for mutual benefit- the research also established that each individual community of similar looking fish comprised species belonging to different genetic lineages, but still adopting similar colour patterns.
This discovery suggests that in many cases the number of Corydoras catfish species [Panzerwelse] may be higher than previously recognised. This has consequent implications for environmentalists charged with protecting environmental diversity and safeguarding the species.
This increases the challenge of conserving these species at a time when many South American rivers are experiencing large scale development involving damn building, and destruction or contamination of habitats.“
Das Corydorasforum.de, eine Züchterplattform, zählt über 50 Panzerwels-Arten auf. Wikipedia erklärt dazu: „Die zwischen 2 und 10 cm großen Tiere zeichnen sich durch einen charakteristischen Körperbau (Doppelreihe von Knochenplatten, dachziegelartig von vorn nach hinten überlappend: Panzerplatten) und sehr variable Färbung aus. Wichtige Unterscheidungsmerkmale zur Artbestimmung sind die Ausprägung der Zähnung und die Zahl der Pectoralstacheln. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich bei diesen Welsen um Bodenfische, die jedoch als Darmatmer bei mangelndem Sauerstoffgehalt im Wasser in regelmäßigen Abständen an die Wasseroberfläche schwimmen können, um dort atmosphärischen Sauerstoff aufzunehmen und am Boden zu veratmen. Das Phänomen der Darmatmung ist auch unter optimalen Haltungsbedingungen zu beobachten, wenngleich seltener.“
Speziell über „Corydoras sterbai“ heißt es auf „Aqua-Szene.de“: „Seit etwa 1960 bevölkert einer der schönsten Panzerwelse die Aquarien Deutschlands. Mit seinen feinen Punkt- oder Linienmuster und den orangegelben Brustflossen zählt Corydoras sterbai zu den farbenprächtigsten Panzerwelsen im Aquarium. Seine natürliche Heimat befindet sich in Brasilien im Einzugsgebiet des oberen Rio Guaporé. Der Namensgeber Günther Sterba war der bedeutendste Ichthyologe der ehemaligen DDR und er ist ein international anerkannter Zoologe. Sterbas Panzerwelse sind sehr gesellige Tiere. Ihr Gruppenzusammenhalt ist sogar etwas stärker ausgeprägt als bei anderen Arten der Gattung. Deshalb sollten sie immer in Gruppen von wenigstens 5 Tieren gehalten werden.“ Sie sind dann ein wahrer „Hingucker im Gesellschaftsaquarium“. Allein von den Corydoras, die in nahezu allen Flüssen Lateinamerikas vorkommen, gibt es 140 Arten.
„Crazy About Corydoras“ schreibt Paul Schumann auf der Internetseite der Honolulu Aquarium Society: „Corydoras are one of the most popular, if not the most popular group of aquarium catfish. Their small size and gentle nature has made them popular with aquarists for over a hundred years. They were first introduced to the hobby in Europe during the 1880s, and their popularity has continued to grow. They won’t bother the smallest, most delicate species, and have armor plates on their body and stiff spines to ward off more aggressive fishes. They can be kept with most fish, except the most aggressive ones.“
(2) Der Journalist Jürn Kruse berichtete bereits am 11.8.2008 in der taz über den „Monster-Wels vom Schlachtensee“ und seine absurden Folgen: „Das tiefe Abtauchen, sich treiben lassen, allein sein. Leif-Hermann Kroll genießt sein Dasein als Sporttaucher. Doch er hat ein Problem: Seit kurzem ist verboten, was schon vorher nicht erlaubt war: Tauchen in Berliner Gewässern. „Schuld ist dieses unsägliche Monster“, klagt Kroll.
Dieses unsägliche Monster ist ein großer Wels. Ein sehr großer Wels. Nachdem im Juli 2007 ein Angler ein 1,70 Meter großes Exemplar aus dem Schlachtensee gezogen hatte, wurde der bärtige Fisch in diesem Sommer wieder zum Ereignis. Ein Riesenwels soll eine Schwimmerin im selben See gebissen haben. „Der Monster-Wels beißt nur Frauen“, titelte die Boulevardzeitung „BZ“.Der Beweis war erbracht, dass kolossale Fische im Schlachtensee hausen. Hobbytaucher pilgerten herbei, ein Tauchtourismus setzte ein. Angler beschwerten sich. Das wurde Kroll und den anderen Sporttauchern in der Hauptstadt zum Verhängnis.
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wollte sich des überholten Images entledigen, dass die bürokratischen Mühlen langsam mahlen – und handelte blitzartig: Das Sporttauchen in Schlachtensee und Krummer Lanke wurde nicht einmal einen Monat nach dem Biss verboten. So vermeldet im Amtsblatt vom 11. Juli. Grund: die vermeintliche Zerstörung der Flora und Fauna durch die Taucher.
Norbert Schmidt, Sport-Bezirksstadtrat, begründet das Vorgehen: „Nachdem wir unser Ungeheuer von Loch Ness, den Wels, hatten, war täglich die dreifache Menge an Tauchern im Schlachtensee.“ Vorher drei bis vier, später zwölf. Das Umweltamt wurde aktiv und fand heraus: Das Tauchen mit Gerät war schon vorher nicht erlaubt. „Das haben wir nur noch einmal im Amtsblatt veröffentlicht – nun ist es verboten.“ Für Schmidt, der die derzeit im Urlaub weilende Umweltstadträtin Anke Otto vertritt, ein ganz normaler Vorgang.
Aber wie zerstören die Taucher die Flora und Fauna? „In jedem See lagern sich Schadstoffe auf dem Grund ab“, erklärt Schmidt, „und die werden von den Tauchern aufgewirbelt – das lässt sich überhaupt nicht vermeiden.“ Deswegen seien die vielen Badegäste an Schlachtensee und Krummer Lanke auch weniger umweltbelastend. Die tiefen Ablagerungen erreichen sie nicht. Außerdem werde ja nur ein geringer Teil des Sees von Schwimmern genutzt. Die Sporttaucher dagegen würden den See in seiner ganzen Tiefe und Breite durchqueren.
Für Kroll ist die Begründung des Bezirks absurd: „Phosphate, die gefährlich sein könnten, liegen so tief im Sediment. Da buddelt doch keiner!“ Durch die Flossenbewegungen würden zwar Sand und Schlamm aufgewirbelt, aber nur sehr wenig. Und nur von den obersten Schichten. „Der Taucher ist doch von Natur aus bemüht, nichts aufzuwirbeln, er sieht dann schließlich nichts“, erklärt Kroll. „Das führt doch seinen Tauchgang ad absurdum.“
Rechtsanwalt Kroll hat Widerspruch eingelegt. Zunächst gegen die sofortige Vollziehung des Verbots und darüber hinaus gegen die Untersagung generell. Er pocht auf das Gewohnheitsrecht: „Seit Jahrzehnten wird in Berliner Seen getaucht, keiner wusste, dass das verboten ist.“ Es gebe sogar einen Tauchreiseführer für Berlin. Alle, die wie Kroll Widerspruch eingelegt haben, dürfen erstmal weiter auf Tauchstation gehen, die anderen nicht. Auch das ist für Kroll „absurd“.
Für ihn sind die Angler am plötzlichen Vollzug des Verbots schuld. „Angler verhalten sich zu Tauchern wie Manta- zu GTI-Fahrern“, scherzt Kroll. Freundschaft ausgeschlossen. Dabei hatten die Sporttaucher in den vergangenen Jahren zusammen mit den Anglern den Schlachtensee von Gerümpel gereinigt. Bei einem generellen Tauchverbot fiele das künftig aus.
Die Gefahr sieht auch Schmidt: „Vielleicht sagen die Taucher bei der nächsten Anfrage, dass ihr Bezirkspolitiker mal schön selbst die Fahrräder rausholen könnt.“ Er will vermitteln – und Kroll weiter tauchen. Er darf ja. Er hat Widerspruch eingelegt.“
(3) Dazu erhielt die taz am 15.April 1013 einen Kommentar in Form eines Zitats: „Der Mindelsee bei Radolfzell – Monographie eines Naturschutzgebietes auf dem Bodanrück, Karlsruhe 1983. Herbert Berner: 7. Fischerei und Fischfang, S.62: Es ist so, dass „….der erste Bericht über den Fang eines unbekannten gewaltigen Fisches als spektakuläres Ereignis seit rund 700 Jahren die allgemeine Vorstellung von Fischen und Fischerei im Mindelsee bis heute prägt, unterstützt durch gelegentliche Veröffentlichungen über den Fang von Welsen in neuester [ vor 1983] Zeit. Es dürfte kaum eine Beschreibung des Mindelsees geben ohne Wiedergabe oder wenigstens einer Erwähnung jenes von dem Konstanzer Chronisten Christian Schulthaiss (1512 – 1584) in seinen historischen Collectaneen überlieferten Fanges vom 1.Juli 1299: an jenem Tage: ‚ ward ein unbekannter Visch im Mündlisee bei Mekingen gefangen, der war also groß, daß hielandt kein grösser Visch nie gesehen ist worden. Herr Hans von Bodman schickt den Kopf von demselben Visch herrn Rudolffen von Höwen Thumdechan zu Costenz. Uss demselbigen Kopf wurden gemacht 46 Stück, gar gross, dass alweg zwei stück genug in ein Schüssel ward. Und über das Haupt lud er alle Choherren in das Münster, zu St. Steffen und St. Johanns und ander priester, der Zahl 34 war und wurden 6 schüsseln mit Visch in die statt verschenkt‘.“ Andere Zeiten hatten auch große Fische… Mit freundlichen Grüßen Miriam Mangold“

Das Bild zeigt den Fischermeister Haas aus Güttingen mit einem kapitalen Wels, den er im Mindelsee fing. Photo: www.moeggingen.de
Krähen im Frühling:
Krähen sind Singvögel, 1979 wurden sie vom Europäischen Parlament unter Schutz gestellt – und mit ihnen zum Entsetzen der Jäger und vieler Singvogelfreunde auch alle „Rabenvögel“. Mit Goethe könnten diese vielleicht sagen: „Es gibt nicht Schöneres als morgens eine Lerche zu hören und Mittags eine zu essen.“
Krähen können Worte nachsprechen lernen und – vor allem Eichelhäher – die Stimmen ihrer Feinde imitieren, ihr „Gesang“ ist jedoch nicht schön und melodisch. Die Krähe heißt Krähe, weil ihre Rufe sich erst einmal wie krähkräh anhören, die Raben heißen Raben, weil sie rarara sagen.
Ich bin in der norddeutschen Moorlandschaft mit dem vielstimmigen Rak-Rak-Rak der im Winter in Massen aus Osteuropa rübergekommenen Saatkrähen groß geworden, das besonders melancholisch-traurig klang, wenn es kalt und neblig war. „Totenvögel“ wurden die schwarzen Vögel deswegen auch genannt und noch heute werden in Hollywoodfilmen besonders beängstigende Szenen gerne mit ihrem Krächzen verstärkt.
Der Schriftsteller Geert Mak bemerkte auf einer Reise durch Russland – in Stalingrad -, dass abends im „Gedenkpark“ der Stadt „hunderte von Krähen als krächzende Schemen über die Baumwipfel streifen. Aus den Lautsprechern kommen Aufnahmen von Partisanenliedern.“
Der Biologe Cord Riechelmann hörte auf dem Kreuzberg „hastig, wie atemlos aufeinander folgende kurze hohe arr-arr-Rufe“ von Nebelkrähen, die bei einigen in „langanhaltende und langgezogene ärr-ärr- und käär-Rufe übergingen.“ Ein großer Krähenschwarm in den Bäumen kann mit seinem Räk-Räk-Räk einen ohrenbetäubenden Lärm machen.
Sie machen ein zärtlich-sanftes Kr-Kr-Kr-Kr
Um diese Jahreszeit hört man von den Nebelkrähen und den ebenfalls permanent hier lebenden Rabenkrähen aber immer öfter auch ein ganz zärtlich-sanftes Kr-Kr-Kr-Kr – besonders, wenn sie sich wieder in die Nähe ihrer alten Nester auf den Straßen- und Parkbäumen begeben haben. Die eher leisen, fast kollernden Töne gelten wahrscheinlich dem Partner. Diesem haben sich die Rabenvögel noch viel mehr als das zu sagen, ebenso mit ihren Kumpanen: Auf die Rufe von ihnen ehemals bekannten Individuen, reagieren die Vögel nicht nur mit erhöhter Rufaktivität, sie ändern auch ihre Stimmlage, je nachdem ob sie ehemalige Freunde oder Feinde hören. War die Bekanntschaft früher feindselig, antworten sie mit tiefen und rauen Lauten, hören sie jedoch einen Freund, dann rufen sie mit freundlicher Stimme zurück. Herausgefunden haben das zwei Wiener Biologen. Wir und viele andere Tiere halten es im übrigen genauso wie sie.
Je mehr ein Rabenvogel sich an einen oder mehrere Menschen gewöhnt hat und gefüttert wird, desto differenzierter werden seine Lautäußerungen: Aak Aak, Knrrrr, Krau Krau Krau, Krrrrr, Ieh. Wenn sie einen Menschen direkt ansprechen, kann man ein Harck, Rak, Rrrrr, Harck, Rak hören.
In Berlin verlassen die Krähenjungen Mitte Juni das Nest, in dieser Zeit sind überall laute Rufe der Krähenfamilien zu hören – die jungen Krähen sind noch ungeübte Flieger und werden ständig ermahnt. Dieses „Krächzen“ aus Besorgnis wechselt ab mit aggressivem Krächzen, das die Anwohner bisweilen nervt. Es gilt möglichen Feinden, zuvörderst den Menschen, aber auch Artgenossen, die dem Brutrevier nahekommen. Gelegentlich werden einzelne Passanten sogar laut schimpfend körperlich angegriffen. „Besonders schlimm hat es die nordfriesische Stadt Niebüll erwischt: Hier sorgen 1000 Krähenpaare dafür, dass die Einwohner keine Ruhe mehr finden,“ schrieb Die Welt. In Schleswig-Holstein beobachtete man, dass sich Nebel- und Rabenkrähen gelegentlich verpaaren.
Die kleineren schwarz-grauen Dohlen suchen dagegen nur die Nähe der anderen Arten, ihr häufigster Ruf ist ein „helles, klares ‚kjak‘ oder ‚kja'“, schreibt Cord Riechelmann in seinem Buch „Krähen“ (2013). Wenn sie sich angegriffen fühlen, stimmen sie dagegen laut Konrad Lorenz ein „wüstes Schnarrkonzert“ an, „erschreckend und satanisch“ anzuhören. Bei einer einzelnen wütenden Dohle hört sich das wie „Ääh Ääh Äähr“ an, wobei es jedoch regionale Dialekte gibt, es mag deswegen sein, dass die österreichischen Dohlen, die Konrad Lorenz an sich gewöhnte, stärker als die norddeutschen schnarren. Und sei es, weil sie und er sich beim Zusammenleben gegenseitig affizierten – und die Dohlen seinen Schnarrton übernahmen. Als sein Dohlenmännchen „Grün-Gelb“ sich mit der schönen „Gelb-Rot“ verlobte, schrieb Lorenz: „Die hätte ich auch genommen.“ Das ist kein naiver Anthropomorphismus, sondern Ausdruck einer subtilen Verhaltensforschung, die sich mit ihrem Gegenstand innigst identisch macht – was auf ein gemeinsames Werden hinausläuft.
In Berlin gibt es immer weniger Nistplätze für Dohlen, deswegen sind sie hier selten geworden. Dafür sieht man mehr Elstern: „Heisere, kaputtstimmige Schreie zerreißen die morgendliche Stille“, so empfindet der Sänger, Dichter und Singvogelfreund Wiglaf Droste die „hässlichen Geräusche“ zeternder Elstern. „Dieser Nazivogel hört Böhse Onkelz und singt entsprechend“, schrieb er in der taz, was den Biologen Cord Riechelmann zu einer wütenden Replik bewog, er mußte jedoch auch zugeben, „Elstern sind selten still. Ihr Geschacker und ‚Tschark‘-Geschirk kann sich von Herbst bis in den beginnenden Frühling, wenn sie sich in Städten zu Versammlungen von bis zu vierhundert Tieren treffen, zu Kreischkonzerten ausweiten, deren melodischer Anteil gering ist.“
Ursprünglich stammen die Krähenvögel aus der Inselwelt Neuguineas, genauso wie die Paradiesvögel und die Laubenvögel. Die beiden letzteren leben dort immer noch, sind aber vom Aussterben bedroht. Währenddessen haben sich die Krähen nahezu über die ganze Erde verbreitet – und ziehen inzwischen massenhaft vom Land in die Städte. Das alles gelang ihnen, schreibt der Ökologe Josef Reichholf, weil diese schwarzen Vögel – im Gegensatz zu den bunten – sich irgendwann den „Fortschritt“ auf ihre Fahnen schrieben. Die männlichen Paradiesvögel schaffen es mit ihrer Schönheit, die Weibchen zu beeindrucken, und die Laubenvögel, sie mit farbigen Ornamenten in ihre Laube zu locken, wo sie sie sich blitzschnell mit ihnen verpaaren. Danach verdrücken sich die einen wie die anderen Männchen. Nicht so bei den Krähenvögeln. Sie können ebenso wenig wie die anderen beiden Arten klangvoll singen, sind aber auch weder künstlerisch begabt, noch können sie die Weibchen mit ihrer Schönheit beeindrucken, denn sie sehen diesen zum Verwechseln ähnlich. Was also tun? Sie beteiligen sich einfach am Nestbau, verteidigen es und ernähren die brütenden Weibchen, danach ziehen sie mit ihnen gemeinsam die Jungen groß. Diese „Idee“ war einst „super-fortschrittlich“, wie Reichholf meint. Die Menschen taten es ihnen später nach. Auch das war ein gemeinsames Werden. Besonders gilt dies für Indien, wo jeder Städter Geschichten über einzelne Krähen weiß. Und umgekehrt wahrscheinlich auch. Hierzulande sind die Krähen inzwischen noch einen Schritt weiter gegangen: in München soll laut Reichholf bereits jedes zweite Krähenweibchen sich mit zwei Männchen verpaaren, damit das Brut- und Aufzuchtgeschäft noch besser erledigt werden kann.
Vom Zürcher Tierpsychologen Heini Hediger kommt schließlich noch ein Einwand gegen diese ganze Darwinsche Sexualselektions-Theorie von Reichholf, den dieser hätte kennen können: Die Paradiesvögel veranstalten ihre prächtigen Balztänze auch ohne das Weibchen dabei sind. Hediger beruft sich dabei auf den Biologen K. Möbius. Das Selbe gilt für Darwins Paradebeispiele für die geschlechtliche Zuchtwahl: „Gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen.“
Ähnlich ist es laut Hediger mit dem Balzverhalten der Kampfläufer, er beruft sich dabei auf den Naturforscher G. Dennler de la Tour: Deren „Kämpfe“ sind harmlose „Spiegelfechtereien, von denen die Weibchen keinerlei Notiz nehmen. ‚Nicht einmal hinschauen tun sie‘.“ Kommt noch hinzu, dass die „Sieger“ anschließend wegflogen, wie Dennler de la Tour beobachtete, und der abgekämpfte „‚Unterlieger‘ dann die Weibchen, soweit sie gerae in Stimmung waren, der Reihe nach begattete…“ (siehe Heini Hediger: „Tiere verstehen“, München 1984). Darwin und mit ihm der Darwinist Reichholf haben da anscheinend griechische Mythen und Olympiaden in die Vogelwelt projiziert.
P.S.: In Neugnadenfeld (Emsland), wo es viel mehr Dohlen als hier gibt, sah ich am Nest in einem Baum nahe der Kirche ein Krähenpärchen, das sich an seinem Nest auf die kommende Brutsaison freute, was darin bestand, dass das Männchen den ganzen Nachmittag „Ahh“, „Ahh“, „Ahh“ rief – und sich dabei wie ein Junges, das gefüttert werden will, aufführte. Das Weibchen nahm all dies relativ gelassen zur Kenntnis.

Krähen am Abend, erquickend und labend. Photo: www.bildkiste.de
Schwäne: „Boote, Schwäne und Spargel – 6 Beweise: Der Frühling ist da!“ titelte die Hamburger „Mopo“ Ich würde sagen, das sind nur 3 Beweise, höchstens.
Kurz vor Weihnachten begann am Kreuzberger Urbanhafen eine Serie von Attentaten auf Schwäne mit meist tödlichem Ausgang. Die Presse vermutete „sadistisch veranlagte“ und „grausame Tierquäler“ als Täter.
Die noch lebenden Schwäne würde man auf die „Schwanstation“ bringen, erklärte ein Feuerwehrmann. Er meinte die Kleintierklinik der FU in Zehlendorf, wo man u.a. auch verletzte Schwäne behandelt. Daneben gibt es noch das Tierheim in Falkensee und die NABU-Wildtierstation in Marzahn, aber die einen sind auf Papageien und die anderen auf Greifvögel eingestellt. Im Tierheim Berlin hat man nicht nur Tierärzte, sondern auch ein Wasservogelhaus. Früher wurden zwischen 60 und 70 verletzte Schwäne jährlich dort eingeliefert. Da es so schien, als würden es immer mehr werden, ließ die Tierheimleitung 2002 das Haus mit einem Garten drumherum und einem Wasserbecken errichten. Das Haus ist zeltförmig und heißt „Tippi“, weil der Schwan bei den Indianern ein heiliger Vogel war, wie uns erklärt wird. Aus unbekannten Gründen werden jedoch seit einiger Zeit immer weniger verletzte Schwäne eingeliefert – nur noch 10 bis 15 Tiere im Jahr. Die Verletzungen der Schwäne rühren meist von Angelhaken her, gelegentlich haben sie aber auch Flügelverletzungen, waren im Eis festgefroren und wurden befreit oder sie leiden an Butulismus, eine Algenbakterienvergiftung.
Im „Tippi“ befand sich kurz vor Winterende nur ein Schwan. Der Sturm hatte ihn am Tag zuvor in eine Baumkrone gedrückt und er war abgestürzt, hatte sich jedoch nichts gebrochen, aber vielleicht so etwas wie eine Gehirnerschütterung davongetragen, weswegen man ihn ein paar Tage zur Beobachtung da behalten wollte. Er macht einen gesunden Eindruck.
1875 schrieb der tschechische Schriftsteller Jan Neruda in einem Reisebericht aus Berlin: Ebenso wie das „Lausitzer Volkslied“ habe sich auch der „Berliner Witz verflüchtig“. Er sei „kalt und langweilig geworden. Man denkt dabei an die den Wasserspiegel der Spree zierenden traurigen Schwäne, die allesamt gebrochene Flügel haben.“
Die preußischen Könige hatten sie angesiedelt, indem sie die Vögel „durch Abnehmen der Hand zeitlebens flugunfähig“ machen ließen, das selbe geschah dann mit den Jungen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren nicht die Hohenzollern, sondern auch „ihre“ Schwäne in Berlin und auf den umliegenden Havelseen nahezu verschwunden, man hatte sie und auch ihre Eier „gestohlen“. Die neue Republik wollte unbedingt den Schwanenbestand wieder auffüllen, 1922 beauftragte die Potsdamer Stadtverwaltung Oskar Heinroth damit. Der „Vater der Ethologie“ war Schwanexperte, zudem stellvertretender Leiter des Zoodirektors. Heinroth stahl eine Anzahl bebrüteter und frischer Höckerschwan-Eier am Lucknainer See in Ostpreußen. Von den daraus geschlüpften Schwänen ließ er jedoch nur noch einer Hälfte „die Hand eines Flügels“ abnehmen, dem anderen Teil beließ er die „Flugkraft“. Weil die Schwäne zusätzlich auch noch durch ein neues Gesetz ganzjährig geschützt wurden, gelang Heinroth schließlich die „Neubesiedlung der Potsdamer Gewässer“.
Die Hamburger Bürger verfuhren ebenso mit ihren „Alsterschwänen“ – seit 1664 bereits. Aber auch in Berlin kümmert man sich um die Schwäne, so wurde z.B. ein schon lange im Charlottenburger Lietzensee ansässiges Schwanenpaar von den Anwohnern liebevoll „betreut“. Als eines seiner fünf Jungen einen Angelhaken im Bein stecken hatte, brachten sie das Tier in die Kleintierklinik. Währenddessen landete ein junges Schwanenpärchen in ihrem Lietzensee-Revier. In dem darauffolgenden Kampf tötete „der Neue“ einen der Jungschwäne. Diese Aggressivität ging den Anwohnern zu weit – sie griffen ein. Es wurden dann jedoch nicht die Revier-Eindringlinge, sondern die alteingesessene Schwanenfamilie inklusive ihres aus der Klinik als gesund entlassenen Jungen von der Initiative „Aktion Tier“ in den Wannsee „umgesetzt“, wo der „Revierdruck“ geringer sei. Die Lietzensee-Anwohner sollen derzeit „noch ein wenig böse auf das neue Schwanenpaar“ sein, meinte die Sprecherin der „Aktion“, aber sie hoffe, „dass sie die beiden neuen Höckerschwäne auch bald in ihr Herz schließen werden. Schließlich folgen diese Vögel auch nur ihren natürlichen Instinkten,“ fügte die Ornithologin beschwichtigend hinzu. Den Biologen fällt die Kulturkritik anscheinend noch immer leichter als Naturkritik.

Schwäne in der Übergangszeit.
Weiterführende Gedanken über Schwäne, Hunde, Affen und Elefanten finden sich in den entsprechend betitelten dünnen Büchern der „Reihe Kleiner Brehm“ im Peter Engstler Verlag/Rhön, die in bälde ausgeliefert werden; im nächsten Jahr folgen dann „Bienen“ und „Rinder“, im übernächsten: „Fische“, „Schafe“ und „Krähen“.