Diese Frau im roten Kleid wurde zur Ikone der türkischen Bewegung (Photo: Facebook)
Journalistenbüro in Istanbul. (Photo: Facebook)
Deniz Yüzel schreibt in der taz von morgen über die sich ausweitenden „Unruhen in der Türkei“:
Dieser Aufstand ist ein Aufstand der Stadt. Er richtet sich gegen ein technizistisches Verständnis der Moderne, das die AKP mit den Ölscheichs der Arabischen Halbinsel teilt. Als Partei der Landbevölkerung – ihrem in der Provinz lebenden wie ihres in die Armutsviertel der Städte gespülten Teils – hegt sie einen Hass auf die Stadt, der sich schon in der Bibel und im Koran findet. Der „metaphysische Eros“ (Bogdan Bogdanovic) der Stadt ist diesen Leuten fremd. Stadt bedeutet für sie nicht mehr als ein Dorf, in dem halt alles größer ist: die Straßen, die Häuser, die Einkaufszentren, die Moscheen.

Dieser Abrißzettel an einer Mauer wird zum Fanal der Berliner Mieterbewegung (Photo: Facebook)

Katrin Eissing photographiert weiter Leute in Buswartehäuschen. Auf diesem wartet jemand zusammen mit seinem Huhn.

In Moskau demonstrieren unter anderem die „Grünen Sozialisten“ – die Gaddafis „Grünem Buch“ die Treue halten.

Via Facebook kam dieses Photo von einem Plakat an einem Pfahl in der Torstrasse. Darunter befindet sich ein Aufkleber am Pfahl, mit dem gegen die Schließung der Anarchokneipe „Baiz“ in der Torstrasse protestiert wird.
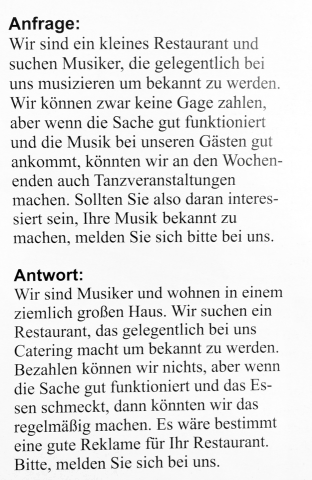
Noch ein Berliner Facebook-Eintrag
Die Nachrichtenlage:
Das Facebook quillt über vor „Neuigkeiten“ aus Istanbul, wo fünf Tage lang etwa 100.000 Demonstranten gegen die Planierung einer kleinen Parkanlage neben dem zentralen „Taksim“-Platz zugunsten eines Einkaufszentrums kämpften. Es gab mindestens eine Tote, über Tausend wurden verhaftet, zuletzt überließ die Polizei jedoch den empörten Massen die Straße – und den Park, um den es schon lange nicht mehr geht, wie ein Demonstrant sagte: „Die Leute wollen die Revolution!“
Ähnliches hörte man in Frankfurt, wo am Wochenende erneut gegen die Macht und Machenschaften des Finanzkapitals demonstriert wurde. Hier kesselte die Polizei jedoch die etwa 10.000 Demonstranten z.T. ein und konnte sie letztlich zerstreuen,die Bilder, die dabei entstanden und veröffentlicht wurden, vermitteln nun laut taz eine „klare Botschaft, die von den anderen europäischen Staaten nachgeahmt werden soll: Protest ist unerwünscht – und wird notfalls niedergeknüppelt.“
Die FAZ titelte über die Biennale von Venedig, auf der erstmals viele unbekannte Künstler mit ihren Arbeiten vertreten sind: „Wenn alle mitmachen, steht eine Revolution bevor.“ Also auch da grummelt es an der jungen Basis – ähnlich wie derzeit in vielen arabischen Ländern…Das Bild, das die FAZ von der Biennale auswählte, um den Artikel zu illustrieren, stammt vom britischen Künstler Jeremy Dellers und zeigt den Maler und Dichter William Morris, wie er die Privatyacht des in London lebenden russischen Öl-Millardärs Roman Abramowitsch im Meer versenkt.
Dieser verfügt jedoch laut „Guardian“ über zwei weitere Yachten, die allesamt zu den größten der Welt zählen, hinzu kommen noch zwei private U-Boote und zwei Schlösser auf dem Festland.
Im Berliner U-Bahn-Fernsehen lese ich die Meldung: „Angelina Jolie verpaßt die Beerdigung ihrer Tante“.
Die Westberliner BZ druckte ihre Schlagzeile „Madonna eröffnet Fitness-Studio in Zehlendorf“ auch noch auf ihre Händlerschürzen für die Kioske. Und prompt schickte die taz anderntags eine Korrespondentin nach Zehlendorf – zum Eröffnungstermin.
Während sich in Berlin-Kreuzberg etwa 4000 Leute zu einer Solidaritätsdemonstration mit den Istanbuler Parkverteidigern zusammenfanden, kam via Facebook eine Meldung von „Madonna“ selbst: „Stop the Violence in Turkey. Start a Revolution of Love!“
Das ist aber noch nicht alles – die SZ vermeldet auf Seite 1: Ein Ingenieur aus San Francisco hat für seine Freundin einen Verlobungsring gebastelt, der mit kleinen Leuchtdioden besetzt ist. Für sich hat er ein spezielles Armband konstruiert, das ein magnetisches Wechselfeld zu dem Ring aufbaut, so dass dieser aufleuchtet, wenn er seiner Freundin nahe kommt.
Das ist aber noch gar nichts gegenüber der Erfindung eines hessischen Ingenieurs, der schon seit längerer Dildos entwirft – und verkauft. Wie eines seiner Werbevideos zeigt, läßt sich seine neueste Dildo-Kreation über das Internet steuern. Auf diese Weise, so erklärt er, kann der Mann, wenn er auf Montage oder im Auslandseinsatz ist, über seinen Laptop den Dildo in der Vagina seiner Frau steuern: mal schneller, mal langsamer.
Dass es weit weniger Deutsche und Berliner sowie in Deutschland lebende Ausländer gibt – als angenommen, zeigt das „Ergebnis des Zensus 2011“; die FAZ illustrierte diese Nachricht mit dem Photo eines Gemäldes von Caspar David Friedrich, das gerade im Louvre auf der Ausstellung „De l’Allemagne“ gezeigt wird, für die Bundeskanzlerin Angela Merkel als „Schirmherrin“ fungiert. Das CDF-Bild zeigt eine Frau in langem Kleid und mit hochgesteckten Haaren „vor der untergehenden Sonne“. Ihr offenen Handflächen hält sie dem Licht entgegen – so wie Anhänger des islamischen Glaubens, wenn sie beten. Huldigt die Frau etwa dem Sonnengott Aton, der laut Freud durch den Pharao Echnaton und seiner Hauptfrau Nofretete den Monotheismus vorwegnahm; die Büste von Nofretete wurde vor rund 100 Jahren von Ludwig Borchardt ausgegraben und heimlich nach Berlin verbracht, wie der Spiegel jüngst berichtete.
Im Forum „Tierbefreiung“ erzählte die Herausgeberin der Zeitschrift „Tierstudien“, Jessica Ulrich, ihrem Interviewer: „Ich hab z.B. Paviane in Südafrika beobachtet, die jeden Abend gemeinsam schweigend auf Bäumen gesessen haben und den Sonnenuntergang über einem Fluss betrachtet haben. Keine Ahnung, was ihnen dabei durch den Kopf ging. Vielleicht hatten sie ein Gefühl der Erhabenheit, das auch bei uns aufkommt, wenn wir ein großartiges Kunst- oder Naturschauspiel sehen, oder sie fanden es einfach schön.“

Werkzeugkasten
Schau mir in die Augen, Gänseblümchen
Der Wirtschaftsredakteur der Südddeutschen Zeitung schreibt am 17. April über die herben Verluste von John Paulson, Eigner des Hedgefonds „Investmentgesellschaft Paulson & Co“: „Der Nimbus ist futsch,“ obwohl er kürzlich noch 100 Mio Dollar für die Erhaltung des Central Parks stiften konnte: „Zumindest dieses Geld ist gut angelegt.“
Das schreibt jemand auf der Wirtschaftsseite der SZ, die ansonsten ständig, quasi ununterbrochen, das Gegenteil predigt und beweist: Dass sich Investitionen lohnen müssen! So sei nun mal der Lauf der Dinge, was spätestens mit dem „Scheitern des Sozialismus“ doch klar sei. Nun wird aber mal eben die Sanierung eines öffentlichen Parks als „gute Anlage“ gepriesen.
2010 hatte der Pariser Wissenssoziologe Bruno Latour in München den „Kulturpreis der Universitätsgesellschaft“ bekommen, weil er „zu den einflußreichsten und gleichzeitig populärsten Vertretern der Wissenschaftsforschung gehört,“ wie es hieß. Der so Geehrte stellte daraufhin in der Universität sein „Kompositionistisches Manifest“ vor: Ihm scheint es so, als sei die Menschheit „wieder in Bewegung, aus einer Utopie vertrieben, der Utopie der Ökonomie, und nun auf der Suche nach einer anderen, der Utopie der Ökologie.“
Auch die FAZ denkt um: Auf ihren Wissenschaftsseiten, wo ansonsten wie im Spiegel die genetisch orientierte Biologie als „Leitwissenschaft“ fundiert wird und die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein Volhard uns versichert, dass „die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“…Auf diesen Seiten kommt sie nun der „Akteur-Netzwerk-Theorie“ (von Latour) nahe, indem sie angesichts der steigenden Zahl von Patenten für genveränderte Tiere und Pflanzen darauf hinweist: „Welche Rechte Pflanzen haben, ist keine reine Scherzfrage.“
Die „grüne“ taz hatte bereits 2009 erstmalig über die „Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen“ berichtet, an denen u.a. der taz- und „gen-ethisches-netzwerk“-Gründer Benny Härlin und die Schweizer Biologin Florianne Koechlin mitwirkten. Ihre Thesen waren „Grundlage dafür, dass der Schweizer Ethikrat beschließen möge, Pflanzen sind nicht länger eine ‚Sache‘ – ein seelenloser Gegenstand“. Seitdem wird in der Schweiz über die „Persönlichkeitsrechte“ von Pflanzen nachgedacht.
In Bezug auf die Tiere gibt es diese Debatte schon länger – spätestens seit Gründung des „Great Ape Projects“ von Peter Singer (Animal Liberation Front) und Roger Fouts (Gebärdensprachlehrer für Schimpansen). Dieses seit 1993 von vielen Tierschutzorganisationen unterstützte Projekt fordert „Grundrechte für Menschenaffen“.
1996 hatten die Pavianforscherin Shirley Strum und die Langurenforscherin Linda Marie Fedigan einen feministischen Primatologen-Kongreß in Teresopolis, Brasilien organisiert, an dem auch Bruno Latour teilnahm, anschließend meinte er: Irgendwann werde man es „genauso seltsam finden, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten.“
In der Schweiz und in Spanien wird seitdem über die „Menschenrechte für Menschenaffen“ gestritten, bereits 2006 hatte die sozialistische Regierungspartei eine Gesetzesinitiative dazu eingebracht. Sie sah vor, dass die „höheren Affen“ bestimmte Grundrechte erhalten: Erstens das Recht auf Leben, zweitens das auf Freiheit. So dass sie weder in Zoos noch in Zirkussen eingesperrt werden dürfen. Drittens soll für die Tiere das Recht auf körperliche Unversehrtheit gelten. Danach müssten Menschenaffen vor „Folter“ geschützt werden und dürften somit nicht mehr zu Forschungszwecken missbraucht werden.
Bei den Persönlichkeitsrechten für Pflanzen ist man noch nicht so weit, dass man zwischen „höheren“ und „niederen“ unterscheidet. Die „höheren“ – das sind seit dem Neuadligen Carl von Linné und seiner „Oeconomia Naturae“ alle Samen- und Farn-Pflanzen; zu den „niederen“ zählen Algen, Pilze, Moose und Flechten, wobei letztere aus einer Symbiose zwischen Algen und Pilzen bestehen.
Die Naturgeschichte ist bis heute vom Adelsdenken geprägt. Man könnte sagen: Das Geheimnis von Zoologie und Botanik ist der Adel – so die Marx-Umdrehung des Wissenschaftshistorikers Wolf Lepenies, der über Linnés „oeconomia naturae“ schrieb: Dieser habe darin „eine Ständeordnung der Pflanzenwelt vorgestellt, innerhalb derer die Moose die Ärmsten bilden, die Gräser als Bauern, die Kräuter als Adel und die Bäume als Fürsten anzusehen sind. Weiterhin werden von Linné die Botaniker ebenso wie das ‚Heer der Creaturen‘ nach militärischen Prinzipien gegliedert. Im Heer der Botaniker sieht Linné sich selbst als General, Jussieu ist Generalmajor, Haller und Gesner müssen jeder mit dem Rang eines Obersten zufrieden sein. Für Siegesbecks gar bleibt nur die Position eines Feldwebels – ein sublimer Racheakt Linnés, der sich bei Haller über die Kritik Siegesbecks an seinem System beschwert hatte.“ Nebenbeibemerkt ist auch der Begriff „Evolution“ noch „militärtechnischer Natur“. In der Enzyklopädie werden darunter „die verschiedenen Bewegungen“ gefaßt, „die man die Truppen ausführen läßt, um sie zu formieren oder in die Schlacht zu führen“.
In den Linnéschen Typen sah der Offiziersschriftsteller und Insektenforscher Ernst Jünger einen zu seiner Erhärtung in die Natur projizierten Glauben an die Unantastbarkeit der absoluten Monarchie. So ähnlich sah das 1790 auch schon die Kommune von Paris, die den „Jardin du Roi“ kurzerhand in einen Kartoffelacker umwandeln wollte (in Berlin wurde 1945 auf Weisung der Alliierten tatsächlich der Botanische Garten umgepflügt).
Die französischen Wissenschaftler hatten diese Gefahr seinerzeit noch mit einer Selbst-Revolutionierung abwehren können: Zum einen gaben sie ihrer Institution eine demokratische Verfassung (alle Professoren sollten in Rechten und Pflichten gleich sein und aus ihrer Mitte einen Direktor wählen), zum anderen benannten sie den königlichen Garten in „Museé d’Histoire“ um. Zwei Jahre später stimmte der Konvent ihren Vorschlägen zu.
Ähnliches passierte mit der königlichen Menagerie: hier stellte die Nationalversammlung allerdings die Bedingung, dass der Löwe fortan nicht mehr als „König der Tiere“ gelten dürfe. Der Revolutionshistoriker Jules Michelet ging in seiner republikanischen Gesinnung sogar so weit, dass er davon träumte, freigelassenen Löwen und Tigern die wahre Naturgeschichte vorzutragen.
Statt dessen kam es aber laut Lepenies erneut zu einer schönen kleinen Drehung – und zwar in der sich als Sozialforschung begreifenden Literatur der nachrevolutionären Epoche: „Von Balzac bis Proust vollzieht sich dabei eine enthistorisierende Bewegung, die die Leitmotive der Naturgeschichte umkehrt: während der Sittenarchäologe Balzac die Zoologie, den ‚beweglichen‘ Teil der Naturgeschichte, zum Vorbild wählt, betrachtet Proust die immobile ‚menschliche Flora‘ und versteht sich als ein ‚Botaniker der psychischen Welt‘.“
Mit Franz Kafka dreht sich dann die Perspektive der Literatur noch einmal um: Sie wird wieder historisiert und gleichzeitig werden die Tiere oder die zu Tieren Gewordenen selbst zu Erzählern (Maus, Hund, Affe). Kafka war ein Erforscher des Tieres als „Person“. Neuerdings werden die Ergebnisse der Tierforschung insgesamt auch gerne wieder auf Menschen gewissermaßen rückübertragen. So z.B. in Karen Duves Erfahrungsroman „Taxi“, in dem sie ihre männlichen Fahrgäste und Taxikollegen mit dem Wissen der Primatenforscherinnen Dian Fossey, Jane Goodall und Birute Galdikas beschreibt.
Das „National Geographic“-Magazin unterfütterte 2012 diese romantisch-feministische Sichtweise der Autorin mit harten naturwissenschaftlichen Fakten: Männer sind den Menschenaffen genetisch oft ähnlicher als Frauen. Während die genetische Differenz zwischen Schimpansen und Männern bei etwa 1,5% liegt, kann sie bei Frauen bis zu 4% betragen. Eine Schweizer Nachrichtenagentur brachte diese Meldung auf den Punkt: „Damit ist klar, es gibt einige Männer, die mehr mit einem Schimpansen gemeinsam haben als mit einer Frau.“

Werkzeug auf dem Polenmarkt – mit Hammer und Sichel in der Mitte (1989)
Glücksforschung
Na, wo ist es denn?“ So könnte die zentrale Frage lauten, die die Forscher nach dem Glück umtreibt. Nicht genug, dass die „Jagd nach dem Glück“ in der amerikanischen Verfassung verankert ist, es gibt in der „amerikanischen Welt“, in der wir inzwischen alle leben (und immer mehr darin unglücklich werden), sogar einen internationalen „Glücksindex“ – also so etwas wie ein diesbezügliches Nationen-Ranking.
An erster Stelle stehen dort Bhutan und Brunei, „aufgeklärte Diktaturen“, wie der Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle Kurt Kotrschal weiß, „Bhutans Herrscher erhob sogar das Glück des Volkes noch vor Wohlstand zum Staatsziel. Ähnlich schrullig für unsere Begriffe das Sultanat Brunei. Etwa 350.000 Bruneier leben offenbar glücklich in der Nordecke Borneos. Sie haben nichts zu sagen, weil ihr Herrscher, Sultan Hassanal Bolkiah alles bestimmt. Der herrscht mittels Wohlstand und gemäßigtem Islam. Die Menschen werden im Schnitt 77 Jahre alt und gehen mit 55 in beitragsfreie Pension. Gratis sind auch das gute Gesundheits- und Schulsystem. Die Leute sind gut gebildet, 95 Prozent können lesen und schreiben. Private zahlen keine Steuern. Autos sind unschlagbar billig, der Sprit kostet 20 Eurocent, und die vielen Staatsdiener bekommen für alles und jedes einen zinsenfreien Kredit. Alles von Herrschers Gnaden, er verteilt die reichen Erdöl- und Gaseinnahmen quasi nach Gutdünken.“
Zwei englische Glücksforscher fragten sich vor einiger Zeit anhand einer US-Langzeitstudie, ob sich das Glücklichsein auch auszahle – quasi rechnet. Ja, das tut es: „Wer sich im Teenageralter als glücklich begriff, verdiente 10 Jahre später deutlich mehr als einst unzufrieden gewesene Teenager.“ Inzwischen hat die Glücksforschung derart Konjunktur, dass immer kühnere Thesen dazu auf den Markt kommen. Die Wissensredaktion der „Zeit“ ließ z.B. wissen: „Die menschliche Psyche reagiert empfindlich auf Geld. Es macht nicht glücklich genug – und fördert den Egoismus.“ Das war aber noch längst nicht kühn genug gedacht, denn jüngst veröffentlichte eine Gruppe schottischer Primatologen erste Ergebnisse ihrer ebenfalls auf Langzeit angelegten Glücksforschung – unter gefangen gehaltenen Menschenaffen (dazu studierten sie 336 Schimpansen und 172 Orang-Utans in Zoos und Forschungseinrichtungen). Heraus kam dabei – für die Primatologen nicht überraschend, dass es keinen Unterschied im Glücksempfinden über den Lebenslauf von Menschen und Affen gibt: Man „startet frohgemut ins Leben“, wird zur Lebensmitte hin „immer mißmutiger“, aber im Alter „wieder besser gelaunt“ – so faßte die Süddeutsche Zeitung das Ergebnis zusammen, der dies jedoch „ein Rätsel“ blieb, denn: „Menschenaffen mittleren Alters müssen keine Kreditraten für Doppelhaushälften in der Vorstadt abzahlen, die Kinder rechtzeitig zur Schule bringen, mit dem Ehepartner streiten, das Smartphone bedienen und sich um das tägliche Brot kümmern, zumindest im Zoo nicht.“
Dass es gerade dieses Häftlingsleben ist, das die Menschenaffen in eine „Midlife-Crisis“ (Der Spiegel) stürzt, kommt für den FAZ- ebenso wie für den SZ-Wissensredakteur als Antwort nicht in Frage. Stattdessen führt dieser zwei weitere Glücksforschungsergebnisse an: 1. Eine Studie des schottischen Psychologen Alexander Weiss, in der dieser bewies, „dass glückliche Orang-Utans – ähnlich wie Menschen länger leben“. Und 2. eine anonyme Glücksforschung (unter Afrikanern?): „Selbst in Entwicklungsländern findet sich die umgedrehte U-Kurve der Lebenszufriedenheit.“ Diese arten-, ethnien- und klassenübergreifende Kurve, da sind sich denn auch die schottischen Primatologen einig, kann nicht mit den „klassischen sozioökonomischen Kräften“ erklärt werden – sondern nur mit „biologischen Gründen“. Fast hätten sie dafür erneut die BILD-Schlagzeile „Endlich! Glücks-Gen entdeckt“ verdient. Diese wohlfeile „Forschung“ – seit 2000 wird jedes ökonomische, soziologische und psychologische Phänomen auf dumpfdarwinistischste Weise zu einem biologischen Problem erklärt – läuft stets darauf hinaus, dass man das betreffende Gen isoliert und/oder ein Medikament gegen das jeweilige Phänomen auf den Markt wirft. Man kann sich dabei u.a. auf die Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard berufen, die klar erkannt hat, dass „die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Oder auch auf Thomas Gottschalch, der davon überzeugt ist: „Glück hat auf Dauer nur der Glückliche!“

Werkzeugreste nach dem Foucault-Kongreß in der Akademie der Wissenschaften der DDR (1990)
Für Ernst Aust, Hoch die Faust
Der Hamburger Redakteur Ernst Aust war KPD-Politiker, im Parteiauftrag gab er ab dem 1. Mai 1953 die Küstenzeitung „Blinkfüer“ heraus. Sie diente der „Bewegung zur Befreiung Helgolands“. Die 1890 von den Engländern gegen Sansibar eingetauschte Felseninsel wurde 1945 bombardiert und danach von den Briten erneut in Besitz genommen. Sie sprengten 1947 die U-Boot-Bunkeranlagen und nutzten den Inselrest als „Bombenabwurfplatz“. Die umgesiedelten Helgoländer wurden daraufhin politisch initiativ, um die Insel wieder zu besiedeln. Nachdem 1950 drei Heidelberger Studenten die Insel für einige Tage besetzt hatten, entstand eine – erfolgreiche – „breite Bewegung zur Rettung Helgolands“, die u.a. von Austs „Blinkfüer“ ideologisch befeuert wurde. Dazu gehörte auch, dass er das Fernsehprogramm der DDR darin abdruckte.
Nach dem Mauerbau 1961 drohte der Axel-Springer-Verlag als Quasimonopolist den Hamburger Zeitungshändlern mit Boykott, wenn sie weiter Zeitungen mit dem „ostzonalen Fernsehprogramm“ verkauften. Dagegen klagte der „Blinkfüer“ erfolgreich – und ging deswegen 1969 in die BRD-Geschichte ein: mit der „Blinkfüer-Entscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts. Die Helgoländer hatten schon vorher begonnen, ihre Inselsiedlung wieder – als Seebad – aufzubauen. Aust war im Konflikt zwischen Moskau und Peking nach 1959 von den sowjetischen „Revisionisten“ (die eine „friedliche Koexistenz“ mit dem Klassenfeind wollten) abgerückt und hatte 1967 die maoistische Zeitung „Roter Morgen“ gegründet, ein Jahr später die maoistische Partei KPD/ML. Nach Maos Tod und der Entmachtung der kulturrevolutionären „Viererbande“ schwenkte die KPD/ML 1978 mit ihm als Vorsitzenden auf den Kurs der albanischen Kommunisten unter Enver Hoxha ein. Dieser hatte Aust bereits 1974 zu einem Vier-Augen-Gespräch empfangen.
Im „Roten Morgen“ hieß es später über eine 1.Mai-Rede von Ernst Aust: „Langanhaltender Beifall, wiederholtes rhythmisches Klatschen; Rufe: Vorwärts mit der KPD/ML; erneuter Beifall; Rufe: Für ein vereintes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland! – Hoch die internationale Solidarität! Erneuter Beifall, Rufe: Es lebe Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tsetung und Enver Hoxha! – Es lebe der III. Parteitag der KPD/ML! – Für Ernst Aust, hoch die Faust! Beifall, rhythmisches Klatschen; Rufe: Es lebe das Zentralkomitee der KPD/ML! Beifall, rhythmisches Klatschen; Rufe: Es lebe die marxistisch-leninistische Weltbewegung! Beifall.“ Der 1923 geborene Ernst Aust starb 1985. Die Hoxha-Partei wandelte sich inzwischen zu einer Sozialdemokratischen, die KPD/ML existiert dagegen noch heute – in mehreren Splittergruppen allerdings.
Aus einer kamen einst zwei Mitglieder der Düsseldorfer Punkband „ZK“, aus der 1982 die „Toten Hosen“ hervorgingen, die 1986 auf ihrer Tournee „Damenwahl“ auch Helgoland bespielen wollten – zwei volle Tage: vom 31.4. bis 1.5.. Da sie aber nie dort auftauchten und ihr Veranstalter sich aufs Festland abgesetzt hatte, versuchen wir, die Gründe dafür vor Ort herauszufinden. Vom Bademeister der Helgoländer Schwimmhalle erfuhren wir: Über 200 „Rache für Sylt“-Punks und fast ebensoviele „Wackersdorfer“ ‚Tote Hosen‘-Fans“ hätten auf dem Festland Konzertkarten gekauft, da aber keine Übernachtungen von ihnen auf der Insel gebucht worden seien, befürchte man im Rathaus, daß diese Chaotentruppe wild auf der Insel zu kampieren gedenke, wobei es dann, wohl auch wegen des hier billig da zollfrei zu kaufenden Alkohols, erwartungsgemäß zu Ausschreitungen kommen würde, was ja im übrigen bereits die „Tote Hosen“-Tourneeankündigung in diversen Printmedien – „Ficken/Bumsen/Blasen“ – evoziere, dies letztere deutete der Bademeister aber nur an.
Kurz und gut: Die Toten Hosen samt ihren Fans hätten Inselverbot. Zur Sicherheit stünde auf dem Festland noch eine Hundertschaft Polizisten mit Hubschraubern bereit. Ob dies rechtlich äußerst bedenklich sei, wisse er – der bloß saisonal Bademeister hier auf der Insel wäre – jedoch nicht. Auch der Inselpolizist, Knauß, ließ uns im Unklaren: Er hatte sich sämtliche Polizeiberichte von den bisherigen Tote-Hosen-Konzerten schicken lassen und genauestens studiert, er wußte z.B. in welcher Stadt Bierdosen geworfen wurden und in welcher nur Pappbecher, und ob sie jeweils mit Bier oder mit Urin gefüllt waren… Das Helgoland-Konzert finde definitiv nicht statt, sagte er uns, wobei er diese Ungeheuerlichkeit so darstellte, als hätte es sich dabei um eine gütliche Einigung zwischen der Konzertagentur (Totenkopf) und dem Bürgermeister (Degendorf) gehandelt.
Auf der Rückfahrt mit dem Schiff ans Festland spielte dann – immerhin – Ahrend Tönnies, der Zahlmeister der „M.S.Helgoland“, im Bordrestaurant mehrmals das „Tote Hosen“-Lied „Bis zum bitteren Ende“ – mit dem Refrain: „Die Nordsee schlägt dir ins Gesicht/ Und trotzdem hast du verloren/ Du bist nicht weit gekommen/Du läufst weiter nach vorn…“ Tönnies war ein Tote-Hosen-Fan der ersten Stunde und sein Vater „Blinkfüer“-Abonnent in Cuxhaven gewesen, wie er uns anschließend verriet; den Ausfall gerade des Helgoland-Konzerts fand er besonders bitter: „Weil die Insel, wenigstens so lange dort die liberalen englischen Gesetze galten, immer ein Zufluchtsort für die kritische Intelligenz gewesen ist, Heinrich Heine war sogar zwei mal hier.“

„Werkzeug“ mit Raffael Rheinsberg.

„Werkzeug“ ohne Raffael Rheinsberg, aber von ihm.
Handzeichen geben und nehmen
Der französische Humanethologe Boris Cyrulnik behauptet in seinem Buch über die „Entstehung von Sinn“ bei Mensch und Tier: „Was hält mein Hund von meinem Schrank?“ (1995), dass Hunde, ebenso wie Schimpansen, auf den Zeigefinder zugehen, mit dem man ihnen eigentlich einen Leckerbissen sonstwo zeigen wollte. Jagdhunde müssten lange dressiert werden, damit sie dieses „Fingersignal“ verstehen. Von Natur aus ist ihnen „nur die unmittelbare den Sinnesreizen nächste Bedeutung zugänglich“. In diesem Sinne könne man sagen, „dass die Schimpansen, eigentlich gesprochen, keinen Zeigefinger haben.“ Das Menschenkind braucht eine ganze Weile, bis es die Zeigefinger-Geste seiner „Bezugspersonen“ versteht, es selbst zeigt zunächst mit der ganzen Hand auf etwas, dass es haben will, dann schreit es, weil es nicht dort hingelangt, und schließlich zeigt es mit dem Finger auf etwas, damit die Mutter oder der Vater es ihm holen. Das Kind schaut sie an, während es diese „Geste“ macht. Der Zeigefinger braucht also ein soziales Umfeld, um als Hinweis verstanden zu werden. Im Umkehrschluß heißt das, dass die Haushunde und die in Gefangenschaft gehaltenen Affen, auf die sich Cyrulnik stützt, ein solches Umfeld nicht haben, sonst würden sie die „Zeigegeste“ der Menschen verstehen und sie gar selbst anwenden, jedenfalls die Affen, die ja uneigentlich sogar zwei Zeigefinder haben.
Die Verhaltensforschung hat inzwischen jedoch festgestellt, das die Haushunde fast als einzige Tiere nicht nur wissen, dass sie sich auf eine Stelle konzentrieren sollen, auf die ihre Herrchen mit dem Finger zeigen, es reicht ihnen bereits ein diskreter Blick als Hinweis. Auf „cosmiq.de“ wird diese Fähigkeit mit der Unfähigkeit der Katzen als „Nicht-Rudeltier“ kontrastiert: „Die meisten Katzen verstehen Zeigegesten nicht, während das schon ziemlich früh jeder Hund versteht.“ Der Hund hat sich im Gegensatz zu den Affen „für den Menschen entschieden,“ wie Daniel Kehlmann sagt – und versteht deswegen, anders als z.B. gefangen gehaltene Schimpansen, auch dessen subtilste Zeichensprache. Das Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie hat das empirisch bewiesen, wie man so sagt. Nun kann man sich fragen, warum die Hunde von Boris Cyrulnik so wie Affen reagierten. Hatten die französischen bis hin zu seinem eigenen Hund keinen derartigen „Familienanschluß“ wie die von den Leipzigern 2009 getesteten? Und war ihnen deswegen die Zeigefinger-Geste fremd?
Bei den eingesperrten Schimpansen löst sie sogar Aggressionen aus: Im Berliner Zoo biß einer namens „Pedro“ zuletzt dem Direktor einen Zeigefinger ab. Zuvor hatte ein anderer Berliner Schimpanse seinem „Dompteur“ in einer Affen-„Auffangstation“ bei Hönow bereits den zweiten Finger abgebissen. Auch den Schimpansenforscherinnen Angelique Todd und Sue Savage-Rumbaugh wurde ihr Zeigefinger abgebissen. Man darf das aber vielleicht nicht so ernst nehmen – in einem taz-interview vom 1.6.2013 meinte die Schimpansenforscherin Jane Goodall auf die Frage, ob Schimpansenmütter ihre Kinder auch „physisch zurückweisen“ würden: „Normalerweise nehmen sie die Hand und beißen hinein. Nicht so, dass eine Wunde entsteht, aber dass es spürbar ist. Das ist eine ganz typische Bestrafung. Und es gibt Mütter, die das nicht können und die dann häufig verwöhnte Kinder haben. Diese Kinder machen oft Probleme.“
Schneller als die Geste des Zeigefingers lernen die Menschenaffen die Bedeutung des „Stinkefingers“ (siehe youtube), so wie sie nach dem Krieg auch von den Deutschen schnell gelernt wurde. Hier ist diese aus dem westlichen Ausland gekommene Geste im Straßenverkehr noch immer eine „teurere“ Beleidigung als alle anderen Wut ausdrückenden. Ähnliches gilt in Teilen Afrikas für einen ausgestreckt hingehaltenen Daumen am Straßenrand. Für uns bedeutet sie dagegen: ein Tramper, der mitgenommen werden will. Der Verleger Werner Pieper hat all diese „Gesten, Gebärden und Beleidigungen“ in seinem Buch „Der stolze Finger“ zusammengetragen. Während Pieper es darin um den „Stinkefinger“ geht, in Wissenschaft, Kunst und Literatur, hat der Kölner Journalist Martin Stankowski unsere ganzen Fingerfertigkeiten als „Handlungen“ begriffen.
Mittlerweile werden solche Gesten aber zunehmend auch metaphorisch gebraucht: im „Fingerzeig“ z.B., den jemand einem anderen, der Polizei etwa, „gibt“ – in Form eines anonymen Anrufs z.B.. Kürzlich titelte eine Zeitung: „Giftgipfel zwischen BVB und Bayern München ist ein Fingerzeig“. Da kuck auch ich – als Nichtfußballinteressierter – erst einmal auf den „Finger“ – anstatt wie der kenntnisreiche Sportreporter auf den „Giftgipfel“ – von dem ich zuvor noch nie etwas gehört, gesehen oder gerochen hatte. Überhaupt ist der Sport für mich ein „soziales Feld“, dessen Sprache/Bedeutung ich kaum verstehe.
Zuletzt sei noch der „Finger Gottes“ erwähnt, den erst Michelangelo als Übertragungsmedium malte, der dann aus bestimmten Felsformationen bestand, schließlich auch Wirbelstürme umfaßte, und eine spezielle Planetenkonstellation in der Astrologie bedeutete, sowie ein „Effekt bei der Beobachtung von Galaxienhaufen“ in der neueren Kosmologie, Wikipedia verweist dazu auf das Stichwort: „Rotverschiebungsraum“. Im englischsprachigen Internet bringt es der „Finger of God“ inzwischen auf 136 Millionen Einträge. Bei einem beträchtlichen Teil wird davon (wieder) ganz unmetaphorisch die Rede sein.
Noch eine Affennachricht:
Die Primatenforscherin Kathrin Dausmann entdeckte auf Madagaskar zwei Affenarten, die Winterschlaf halten, drei bis sechs Monate lang, also jetzt – die Hamburger Tierökologin hatte sie zuvor mit Sendern ausgestattet.
Die eine Unterart von Fettschwanzmakis, im Osten Madagaskas, buddelt sich wegen der dort mitunter sehr kalten Tage und vor allem Nächte unter Pflanzenwurzeln und Laub in die Erde ein, und ihre Körperfunktionen verlangsamen sich – sie werden kalt und atmen nur noch einmal pro Minute. Damit ähneln sie Igeln. „Für gewöhnliche Beobachter sieht es aus, als wären sie tot,“ meint Kathrin Dausmann
Die andere Unterart von Fettschwanzmakis, im Westen Madagaskas, zieht sich in Baumhöhlen zurück – bis zu 7 Monate: nicht wegen der Kälte, sondern weil in der langen Trockenzeit das Wasser und ihre Nahrung knapp wird.

Unbekannter Junge mit Werkzeug.
Kapitalgesponsortes Demokratie-Theater
Anschwellend wird die ausschließliche Steuerung des modernen Lebens durch den Kapitalfluß kritisiert. Während die Politik sich auf die Verabschiedung von kostenlosen ethischen Normen beschränkt (Rauchverbot, Glühbirnenverbot etc.) Im Deutschen Theater wurde das Langzeitprojekt „Demokratie“ gegeben, u.a. mit einem Stück von Kuttner und Kühnel über die „Brandt-Guillaume-Affäre“. In der Volksbühne spricht demnächst wieder der leninistische Philosoph Alain Badiou über den „Demokratischen Menschen“.
Dieser „lebt ausschließlich im Hier und Jetzt. Er achtet kein Gebot als das seines wechselhaften Verlangens. Heute veranstaltet er ein feuchtfröhliches Gelage, morgen schwört er ausschließlich auf Buddha, Fastenstrenge, Quellwasser und Nachhaltigkeit. Am Montag bringt er sich auf dem Hometrainer stundenlang in Form. Am Dienstag schläft er den ganzen Tag durch, dann raucht und schlemmt er ein bisschen. Am Mittwoch gibt er feierlich bekannt, dass er sich der Philosophie widmen wolle, zieht es dann aber doch vor, nichts zu tun. Am Donnerstag entflammt er mittags für Politik, speit Gift und Galle gegen die Ansichten seines Nachbarn und schießt nicht weniger scharf gegen den Konsumwahnsinn und die Gesellschaft des Spektakels. Abends sieht er dann im Kino einen Schinken, der vor blutigen Schlachten vor mittelalterlicher Kulisse nur so strotzt. Er kehrt heim, legt sich schlafen und träumt von seinem Engagement im bewaffneten Kampf zur Befreiung der unterdrückten Völker. Am nächsten Tag kommt er verkatert zur Arbeit und versucht vergeblich, die Sekretärin im Nachbarbüro zu verführen. O wie hat er sich geschworen, Geschäfte zu machen! Immobilien! Die Boni gehören ja schon praktisch alle ihm! Dumm nur, dass gerade Wochenende ist. Und Krise. Na, nächste Woche sieht man weiter. – Das ist ein Leben. Immerhin. Kein Plan, kein Gedanke, aber doch ganz nett, ja glücklich. Vor allem: so frei wie nichtssagend. Die Freiheit um den Preis der Belanglosigkeit – ein hübsches Schnäppchen!“
In der „Schaubühne“ sprach der Soziologe Wolfgang Streeck, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, über den endemischen Konflikt zwischen demokratischer Politik und kapitalistischen Märkten am Beispiel der „Verschwörung“ von Goldman Sachs Managern. Dem New Yorker Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen ist es laut Streek über Jahre gelungen, politische Spitzenpositionen in den USA mit Mitarbeitern und Freunden der Firma zu besetzen. Aber nicht nur dort: „Mario Draghi, heute an der Spitze der EZB, war zuvor Europa-Chef bei Goldman Sachs, dem Unternehmen, das Griechenland durch Anleitung in kreativer Rechnungsführung die Mitgliedschaft in der Währungsunion ermöglicht hat. Partner bei der griechischen Notenbank war damals Loukas Papadimos. In Italien habe Mario Monti als EU-Wettbewerbskommissar kräftig geholfen, das öffentliche Bankenwesen in Deutschland zu zerschlagen. Später beriet der Mann, dem die Märkte vertrauen, Goldman Sachs.“ Beim diesbezüglichen Namedropping konnte sich Streek auf den ausführlichen Rolling-Stone-Artikel „The Great American Bubble Machine“ (www.rollingstone.com.) stützen. Wer die Krise verstehen will, muss Streek zufolge die „geballte Präsenz“ der „Goldmänner“ in der amerikanischen Politik und inzwischen global ebenso zur Kenntnis nehmen wie die absurde Tatsache, „dass man als Rettungssanitäter regelmässig die ruft, die den Wagen an die Wand gefahren haben. Man muss von den Machttechniken der Experten reden,“ schreibt die SZ in ihrem Artikel über den Theater-Vortrag von Streeck.
So, wie bis zur Wende die „Siemensianer“ überall in die Bürokratien einsickerten – und nach der Wende die Berliner Sozialdemokraten in umgekehrter Richtung in die Immobilienwirtschaft, beeinflussen jetzt die Investmentbanker als „Unternehmens“- und „Privatisierungs“-Berater die demokratischen Entscheidungsprozesse: „Wo es um Abschöpfung statt um Wertschöpfung geht, spielen Kenntnisse in der Staatskunst eine entscheidende Rolle. Intrigenkompetenz ist ebenso wichtig wie finanztechnisches Wissen. Die Experten verkörpern besondere Nähe zu den ‚Märkten‘, deren Wünsche sie in Sachzwänge übersetzen. Sie sind ‚Kapitalversteher‘, die erfolgreich die westlichen Demokratien belagern.“ Wenn die Staaten nur noch als „Inkassoagenturen im Auftrag einer globalen Oligarchie von Investoren“ fungieren, ist der „demokratische Kapitalismus“ laut Streeck in großer Gefahr.

Ehemalige Werkzeughalle in Ostberlin
Elektrische Ströme und digitale Bilder aus Brandenburg
Die Prignitz in Nordbrandenburg war nach der Wende europaweit die Region mit den meisten „von unten“ entstandenen Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie – bis die süddeutschen Abschreibungsfirmen und Stromkonzerne Ostdeutschland mit „Wind-Parks aus einer Hand“ zupflasterten. Die Region Südbrandenburg gehörte dagegen nach der Wende mit 14 Fernsehkanälen zu den statistisch gesehen am besten „versorgten“ Gebieten Europas. Das kam daher, dass die Post noch schnell vor ihrer Privatisierung, d.h. vor ihrem Verschwinden in Schwindelgeschäfte, den ganzen Osten „verkabelte“. Im Zuge dessen bot sie mit Fernsehtechnik vertrauten Südbrandenburger die Verwaltung und Nutzung von Kabel-Abschnitten an. Die „Kabelnetzbetreiber“ gründeten daraufhin eigene Fernsehsender. Der kleinste war ein Ein-Mann-Betrieb und sendete hauptsächlich Videotafeln mit Busabfahrt- und Behördenöffnungszeiten, der größte, in Cottbus, beschäftigte schon bald 11 Leute.
Eine Bemerkung von Klaus Theweleit aus dem Jahr 1988 klingt in diesem Zusammenhang prophetisch: „…die wundersame Glasfaser erhebt ihre lautlose Stimme, zu schweigen von Jürgen Habermas…Wo ist die Post?“
Eine andere „Ostsicht“ – eher piratisch – auf ursprüngliche Akkumulation bedacht, brachte mir ein Mitarbeiter des Senders „RTS Senftenberg“ nahe: „Im Osten waren vor oder während der Wendezeit riesige Kabelanlagen entstanden, die oft ein größeres Plattenbauviertel versorgen, manchmal sogar ganze Ortschaften, und nicht dem Monopolisten Telekom gehören, sondern privaten oder städtischen Betreibern. Über sie begannen oft kurz nach der Wende einzelne TV-Begeisterte zu senden, ohne sich groß um komplizierte Mediengesetze zu kümmern. Seit 1993 wurden ihre Sender dann von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg lizensiert.“
Wenn in Senftenberg der Abteilungsleiter eines Musikladens zusammen mit Sendergeschäftsführer Andreas Groebe die lokalen „CD-Charts“ moderiert, sitzen sie lässig auf einem Barhocker auf einen hohen Tisch gestützt und lächeln breit in die Kamera. „Man muß technisch enthaltsam sein, damit einem nicht die Puste ausgeht“, erklärt Andreas Groebe.
So wie viele der Kleinsender begann auch das Cottbusser Lausitz-TV (LTV), das in einer schick renovierten Stadtvilla residierte und einen „Assistenten der Geschäftsführung“ hat. Reinhard Vogt, ein ehemaliger Seemann, führt mich durch die Etage. Die Moderatorin, im Hauptberuf Kindergärtnerin, schminkt sich gerade im Tonraum. Später ist sie auch noch als „Model“ in einem Werbeclip für einen örtlichen Mittelständler zu sehen.
Was Südbrandenburg betrifft, kann man sagen: Je mehr Dörfer infolge der Braunkohlegewinnung aus der Welt verschwanden, desto mehr Fernsehsender brachten den Südbrandenburgern die Welt ins neue Haus. Sie erreichen durchschnittlich 10.000 Haushalte und haben eine Sehbeteiligung von bis zu 90%. Der Spremberger Sender hat drei Mitarbeiter, er erreicht 30.000 Haushalte. Der Mangel, auch an ordentlicher Entlohnung, wird durch Enthusiasmus ausgeglichen. Die lokalen Fernsehsender sind zur Basisdemokratie verdammt. Andreas Groebe, dessen Sender in einem schmucklosen Plattenbau am Stadtrand eingemietet ist, sagt es so: „Mit zu viel Gemeinden drumherum verzettelt man sich nur und vernachlässigt einzelne; schon jetzt gibt es das Problem Weltzow – 25 Kilometer entfernt und schlecht zu versorgen.“
Dies erinnert fast schon an das Credo von Deleuze/Guattari: „Ein Klein-Werden Schaffen!“ So meint denn auch ein anderer Kleinfernsehsender-Betreiber: „Die Cottbusser haben das Prinzip Lokalfernsehen noch nicht begriffen: die wollen immer größer werden!“ 2013 hat LTV 22 Mitarbeiter. Infolge der Digitalisierung ist zwar die Konkurrenz für die Lokalfernsehsender größer geworden (man kann heute über Kabel 100 Sender empfange), dafür haben sich aber auch die Aufnahmegeräte bei den LTV-Zuschauern vermehrt, sie können ihre Fotos und Clips zudem immer unkomplizierter in „ihre“ Sendezentrale schicken.

Französin mit Büchern, dort auch „Werkzeugkästen“ genannt.
Stadt der Spätaufsteher
Ich fange mit dem Gegenteil an – mit den „Frühaufstehern“. Unter dieser Spaltung der Gesellschaft, ähnlich der zwischen Rauchern und Nichtrauchern, leide ich – als Spätaufsteher – schon so lange ich denken kann. In meiner „Moral History“ beginnt das bereits kurz nach der Einschulung – nämlich damit, dass man jeden Tag spätestens um acht in diesem hässlichen, stinkenden Schulgebäude zu sein hatte und die ganze Zeit dort wie blöd Aufmerksamkeit heucheln mußte, um nicht „rangenommen“ zu werden. Dagegen waren die Prügeleien in den Pausen auf dem Schulhof die reinste Erleichterung. Aber spätestens nach der Pubertät kriegte dieser „Kampf“ (auch gegen das sogenannte „Elternhaus“) einen antifaschistischen „Touch“, denn plötzlich wurde einem klar, dass das ganze beschissene Liedgut, mit dem man „groß“ gezogen wurde, die reinste Nazischeiße war: „.Wer nur den lieben, langen Tag/ Ohne Plag‘, ohne Arbeit/Vertändelt, wer das mag,/Der gehört nicht zu uns./ Wir steh’n des Morgens zeitig auf,/Hurtig, mit der Sonne Lauf,/Sind wir, wenn der Abend naht,/Nach getaner Tat,/Eine muntere, fürwahr,/Eine fröhliche Schar.“
Dieses Lied findet sich noch heute in der Liedersammlung „Mundorgel“; das folgende Gedicht des Leutnants F.L. Hoppe aus dem „Lesebuch für den Schulgebrauch“, 1916, hat man jedoch inzwischen daraus entfernt. Es lautete:
„Da drüben, da drüben liegt der Feind
In feigen Schützengräben,
Wir greifen ihn an, und ein Hund wer meint,
Heut würde Pardon gegeben.
Schlagt alles tot, was um Gnade fleht,
Schießt alles nieder wie Hunde,
Mehr Feinde, Mehr feinde! sei euer Gebet!
In dieser frühen Vergeltungsstunde!“
Diese lustige Truppe von wahren Frühaufstehern aus WK1 und dann auch aus WK2 („Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen!“ – und nicht etwa „nach einem ordentlichen Frühstück“) ermordete dann allein in Osteuropa Zigmillionen – in einem „Blitzkrieg“. Sie wollten Mittags alle wieder zu Hause sein – diese Irren!
Jens Rohwer, ein in Rußland kriegsverwundeter Lehrer an der Musikschule in Posen (heute wieder: Poznan) schrieb 1944, im Jahre des abermaligen Zusammenbruchs aller Fronten, das Lied: „Wer nur den lieben langen Tag/Vertändelt, wer das mag“. Es wurde bis in die Siebzigerjahre an allen Schulfronten Westdeutschlands auswendig gelernt. „Die Freiheit, die die germanischen Krieger genießen,“ meinte Michel Foucault „ist wesentlich eine egoistische Freiheit, eine der Gier, der Lust auf Schlachten, der Lust auf Eroberung und Raubzüge…Sie ist alles andere als eine Freiheit des Respekts, sie ist eine Freiheit der Wildheit.“ Diese losgelassenen „Krieger“ – das waren jedoch in der Zwischenzeit längst Friseure, Kellner und Staubsaugervertreter geworden..Egal, mit ihrem frischen Liedgut wollten wir nach dem zweiten verlorenen Krieg jedenfalls nicht mehr zu tun haben!
Kein Wunder, dass die irischen und griechischen Kneipenbesitzer dann erst ab 1990 verwundert feststellen konnten: Die Deutschen kennen ja doch einige Lieder und können sie auch singen – die Ostdeutschen nämlich. Denen hatte man zuvor ganz andere Lieder – von „sauberen Mädels und starken Genossen“- „nahegebracht“. Mit dem Fascholiedgut – bis hin zu „Wem Gott will rechte Gunst erweisen/Den schickt er in die weite Welt!“ – wollten wir Westler dagegen keinesfalls in Verbindung gebracht werden, lieber schwiegen wir im Ausland – und auch das angloamerikanische Liedgut ließen wir vorsichtshalber unübersetzt. Selbst wenn wir die Worte mitsangen, wollten wir sie nur als mehr oder weniger wollüstiges Gebrabbel verstehen. Anders die West-Musikkritiker – natürlich, die daraus gleich Quasi-Offenbarungen machten!
Dann kam die Wiedervereinigung und das am meisten vom Westen pestkolonisierte Bundesland, Sachsen-Anhalt – die schwarz-braune Haselnuß mit den super Bördeböden, wo die Arbeitslosigkeit infolge der Stillegungen fast aller Bergwerks- und Verhüttungsbetriebe Rekordhöhen erreichte, nannte sich trutzig: „Das Land der Frühaufsteher“.
„Früh“ ist klar – in „aller Frühe“ – so wie in „Frühschicht“; „Steher“ – kommt aus der Profiboxer-Sprache: Das ist ein Mann, der „Steherqualitäten“ hat, also besonders viel aushalten kann, ohne umzufallen. Der sich aber auch nicht wehrt! (Gegen die Besserwessis z.B., die gleich nach der Wende in Hundertschaften Sachsen-Anhalt buchstäblich zu Boden „entwickelten“.) „Aufsteher“ kommt ebenfalls aus der Boxersprache – das ist eine Flasche, die immer wieder zu Boden geschlagen wird, aber jedesmal wieder aufsteht – und weiter kämpft, obwohl sie natürlich keine Chance hat. Sie kann nur gut wieder „Aufstehen“ – noch leicht bedeppert, und dann z.B. „Sieg Heil“ stammeln oder sogar gröhlen. Das harmlose westliche Vorbild für so einen ist Donald Duck, der in keiner Geschichte das erreicht, was er wollte und selbst wenn doch einmal, dann sieht das Erreichte so ganz anders aus, als er es sich vorgestellt hatte. Das Credo der deutschen Donaldisten lautet deswegen – verkürzt: „Trotzdem niemals aufgeben!“
Es sollte uns daneben aber auch zu denken geben, dass es keine weibliche Form vom „Frühaufsteher“ gibt (selbst meine feministische Freundin nennt sich ein „Frühaufsteher“ – wenn sie mich als „Spätaufsteher“ beschimpft, der sie – sozusagen als Bremser – daran hindert, im Leben schwungvoll weiter zu kommen).
Trotz des Fehlens einer „Frühaufsteherin“ in unserem deutschen Wortschatz, gibt es jedoch paradoxerweise weitaus mehr Frauen als Männer, die FrühaufsteherInnen sind, schon allein deswegen, weil sie sich nicht lange querulatorisch weigern, selbst als Akademikerin irgendeinen Scheiß-Dienstleistungsjob anzunehmen, für den sie mitten in der Nacht aufstehen müssen, um den Bus zu kriegen, der sie z.B. 160 Kilometer weit ins Logistik-Center des „Otto-Versands“ in Sachsen-Anhalt transportiert, wo sie dann pünktlich ab 7 Uhr acht volle Stunden stehend irgendeinen Konsumscheiß einpacken müssen. Wenn man diese Frauen sieht, oder auch die hunderte von Sekretärinnen, die morgens aus dem U-Bahnhof Fehrbelliner Platz strömen, um sich in der Bundesversicherungsanstalt hinter ihre drögen Schreibtische zu klemmen, der kommt weiß Gott nicht auf den Gedanken: „Das ist fürwahr/eine fröhliche Schar.“
Wenn so ein „Spätaufsteher“ wie ich mal morgens mit einer der ersten U-Bahnen nach Hause fährt, dann bleibt ihm schuldbewußt die gute Laune sozusagen im Halse stecken, denn die Waggons sind um diese Zeit voll mit dicken älteren türkischen Kopftuchfrauen, die als „Raumpflegerinnen“ für ihre Familien das Geld verdienen. Während ihre mit der Wende meist arbeitslos gewordenen Männer noch schlafen, putzen sie spätestens ab 6 Uhr früh in der „City“ die Büros.
Es bleiben die wenigen freiwilligen Frühaufsteher, wie meine Freundin – und mit ihr angeblich viele, viele kreativ Tätige , die schon morgens um Halbneun ihre erste vollmundige „Brunch“-Sitzung anberaumen und spätestens um Halbzehn ihren Laptop aufmachen, um erst mal ihre „Mails“ zu checken – und dann aber loszulegen wie blöd!.
An der Humboldt-Universität, wo man zu proletarischen Kampfzeiten noch eine „Nullte Stunde“ kannte (einen Unterrichtsbeginn um 6 Uhr 45!), lehrt jetzt eine Kulturwissenschaftlerin, deren Seminare erst nach Mitternacht anfangen – also nur für wirkliche Spätaufsteher interessant sind. – Eingedenk des Mottos des kuk-Versicherungsangestellten Franz Kafka: „Der Schriftsteller arbeitet nachts, wenn alle Bürger schlafen.“
Der Weg dahin war aber steinig: Ich erinnere mich noch an das Jahr 1993, da sagte der vom Narva-Betriebsrat gewählte neue Geschäftsfüher, Jesus Comesana, auf einer Belegschaftsversammlung im Kino „Kosmos“: „Wir sind jetzt ein Dienstleistungsbetrieb, deswegen sollten wir ab 1. März morgens statt um 6 erst um 9 Uhr anfangen, vorher gibt es absolut nichts zu tun.“ Da brach ein Sturm ehrlicher schichtarbeiterlicher Entrüstung über ihn herein. Einer schrie: „Jetzt muß ich auch noch mein ganzes Leben ändern!“ Ein anderer: „Ich wohn in Kaulsdorf, da kann ich nach Feierabend ja gleich im Betrieb bleiben!“ Man einigte sich auf Halbacht.
Nur wenige Monate später lud mich der Amsterdamer Hausbesetzer Geert Loving für ein paar Tage ins „Melkweg“ – zu einer Tagung über „Wetware“ (so nennt man all die armen Schweine, die zwischen Hard- und Sofware eingeklemmt wurden). Ich wohnte in einem kleinen Hotel, wo man bis 11 Uhr frühstücken konnte, danach machte ich mich an die „Arbeit“: „nosing around“ im Weichbild der Stadt. Zu meinem Erstaunen fingen alle Straßenfeger, Händler, Kellner etc. auch erst um etwa 12 Uhr an. Die Bauarbeiter z.B. suchten auf ihren Gerüsten erst mal in Ruhe den richtigen Radiosender – mit einer zu ihrer Tagesform passenden Musik. Alles gähnte und reckte sich noch. Das war wirklich eine Stadt der Spätaufsteher – und mir auf Anhieb sympathisch. Auch dass die ganzen asiatischen Drogenhändler in den „Coffee-Shops“ auf jede Frage nach der intendierten Wirkung dieses oder jenes Stoffes stets antworteten: „It makes you feel good the whole day!“
Von Geert erfuhr ich dann noch, dass das Wort „Frühaufsteher“ („Vroege vogels“ auf Holländisch) in Amsterdam ein Schimpfwort ist – ähnlich dem „Warmduscher“ hier, wobei es jedoch die entgegengesetzt Bedeutung hat: Beschimpft werden damit eher die morgens schon penetrant-putzmunteren „Kaltduscher-und-gleich-danach-Jogger“, die ständig das Wort „Streß“ lustvoll im Munde führen und mit ihren Hunden „Agility-Kurse“ besuchen. In der taz wurde der blogwart Mathias Broeckers von den Mädels in seinem Großraumbüro neckisch als „Früher Vogel“ bezeichnet. Er gehörte zu der seltenen Sorte von kiffenden Frühaufstehern. Von ihm, dem Limburger Domspatz, hätte glatt der alte ostfriesische Merksatz stammen können: „Morgens ein Joint – und der Tag ist dein Freund!“ Als blutjunger Ministrant hatte er jede Menge (THC-haltige) Weihrauchdämpfe eingeatmet, und bereits 1970 beantragte der Limburger Bürgermeister für Broeckers‘ kirchlichen Frei- und Partyraum die Schließung des selben mit dem Argument: „Die spritze sisch da schon morgens des pure Hasch!“
Hasch macht lasch, so viel war daran richtig. Aber dadurch war dieses Mittel doch auch geeignet, der aufrührerischen Jugend von damals noch das letzte bißchen faschistische Frühaufsteherei auszutreiben. Nebenbeibemerkt kam der Stoff in jener Zeit fast zur Gänze aus Amsterdam! Und heute?
Die zur Kölner Verlagsgruppe DuMont Schauberg gehörende „Mitteldeutsche Zeitung“ schreibt am 9.März 2013: „Illegaler Cannabisanbau nimmt zu: Das Kraut gedeiht in Kellern, Dachböden oder alten Ställen. Zwar ist es oft nur für den privaten Konsum bestimmt – doch ein Kavaliersdelikt ist der Anbau von Hanf nicht. „Der Bedarf ist da“, sagte Helga Meeßen-Hühne von der Landesstelle für Suchtfragen in Magdeburg. Außerdem lasse sich mit Aufzucht und Verkauf von Cannabisprodukten sehr viel Geld verdienen. „In den zurückliegenden Jahren ist die Zahl der Fälle zwar moderat, aber ständig gewachsen“, fügte Evelyn Schiener, stellvertretende Pressesprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) hinzu.“
Früher lautete ein Slogan der staatlichen Antidrogen-Propaganda der BRD: „Du gehst kaputt/Und der Dealer macht Kasse!“ Dank der nahezu lückenlosen LKA-Überwachungssysteme heißt es heute – auch in Sachsen-Anhalt: „Der Dealer geht kaputt/Aber sein Stoff ist Klasse!“ Der dortige Ministerpräsident (CDU) hält jedoch tapfer dagegen – gegen diesen rauschgestützten Hang zur Spätaufsteherei in seinem Bundesland: Am 15.März lud er zu einem „Frühaufsteher-Frühstück“. Aber nicht nur dass bloß seine von ihm abhängigen Minderbegabten dort pünktlich erschienen – und sich sogleich auf das üppige Büffett stürzten, das für die halbe Bevölkerung des armen Bundeslandes gereicht hätte, es gab auch lautstarke Kritik daran von Parlamentariern – und zwar ganz grundsätzlicher Art: „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich diesen Frühaufsteher Slogan hasse“, wurde der Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) von der „Mitteldeutschen Zeitung“ zitiert. Der Linke-Fraktionschef Wulf Gallert sprang dem Finanzminister bei und forderte ein Ende des „Unfugs: Diese Kampagne ist unpassend und überflüssig.“ „Früh aufstehen ist ja noch kein Wert an sich,“ meinte daraufhin auch der Verkehrsminister (SPD). Während der Wirtschaftsminister Reiner Haseloff (CDU) weiterhin behauptete: „Die Identifikation gerade junger Leute mit ihrem Bundesland habe dadurch deutlich zugenommen.“ Da lachen ja die Hühner, so ein ungenannt bleiben wollender junger Leut, der im übrigen das englische Wort dafür: „Early Riser“ als „Örli Reißer“ ausspricht (wobei man wissen muß, dass „Schwarzer Örli“ eine unter den sachsen-anhaltinischen „Westernstadt“-Fans beliebte Haschsorte sein soll, während die „Blonde Örli“ eine stadtbekannte Magdeburger Schönheit ist).
Die Frühaufsteher-Werbekampagne für Sachsen-Anhalt wurde 2005 gestartet und kostete 2,5 Millionen Euro. „Ausgangspunkt war“ laut n-tv „eine Umfrage, nach der die Sachsen-Anhalter im Schnitt morgens um 6.39 Uhr aufstehen – und damit angeblich früher als alle anderen Deutschen.“ Das Bundesland hatte 2012 rund 150.000 Arbeitslose; bei einer Bevölkerung von insgesamt 2,2 Millionen waren das offiziell 12,5 %. Daneben macht sich dort nach wie vor ein starker Bevölkerungsrückgang bemerkbar – laut Wikipedia ein seit der Wiedervereinigung ungebrochener Trend, „der in etwa gleichem Maße auf die geringe Anzahl Neugeborener und die Abwanderung von Sachsen-Anhaltern zurückzuführen ist.“ Gleichzeitig stieg die Zahl der Verbrechen kontinuierlich seit der Wende: Zuletzt, 2012, waren es 189.233 Fälle, dabei wurden über 80.000 nicht aufgeklärt (43%). Bei 25.443 Fällen handelte es sich um „Rohheitsdelikte“, bei 75.027 um „Diebstahl“ und bei 5925 um „Rauschgiftkriminalität“. Trotz dieser geringen Zahl an Drogendelikten meldete das onlinemagazin „Halle life“ des Werbefuzzies Alexander Landgraf: „In Sachsen-Anhalt müssen immer mehr Patienten wegen Cannabis-Missbrauch behandelt werden.“ Am 11. April 2013 berichtete die von der Treuhand der „Bauer Media Group Hamburg“ zugeschanzte „Volksstimme“ – einigermaßen wahrheitsgemäß: „Bei Hausdurchsuchungen hat die Staatsanwaltschaft Stendal Cannabis-Pflanzen sichergestellt.“ Am 15. April berichtete das auf Rauschgiftkriminalität anscheinend spezialisierte Blatt aus dem Bauerverlag: „Bei der Durchsuchung eines 17-jährigen Wernigeröders haben Polizeibeamte 108 Gramm Cannabis, 16,6 Gramm einer weißen Substanz in einer Folientüte, zwei Feinwaagen, 56 Abpacktüten und Bargeld in Höhe von 155 Euro gefunden. Die Polizisten kontrollierten den Jugendlichen, nachdem er einen Stuhl von einem Lokal in der Breiten Straße in Wernigerode gestohlen hatte und mit diesem vor dem 40-jährigen Besitzer flüchtete, der ihn jedoch stellen konnte.“ Anschließend meinte er gegenüber der Zeitung: „Um mit meinem guten Stuhl abzuhauen, da hätte er früher aufstehen müssen.“ In beiden Fällen protestierte der Sprecher des Westdeutschen Hanf Verbands, der sich für eine Legalisierung aller Drogen ausspricht, die sich positiv gegen jede Frühaufsteherei auswirken, was von der bundesdeutschen Familienministerin – zu Recht – als „kontraproduktiv“ bezeichnet wurde.

Poller im Film

Poller mit Strickbanderole
Kriminelle Hand- und Kopfarbeiter
Eigentlich sollte man doch froh sein, wenn immer mehr Kriminelle statt mit roher Gewalt oder Explosivtechnik zu arbeiten ihr Gehirn benutzen: „Die herkömmlichen Banküberfälle gehen stark zurück,“ titelte die Berliner Zeitung – in der Rückschau zu ihrem Bericht über eine internationale Bande von „Cyber-Bankräubern“, die rund 50 Millionen Dollar/Euro erbeutete, indem sie sich u.a. in den Computer einer indischen Firma einhackten, die Prepaid-Kreditkarten für Mastercard und Visa herstellt. Dabei kamen sie an Geheimnummern von Kreditkarten arabischer Banken, mit denen ihre Sympathisanten dann in Europa und den USA an tausenden von Geldautomaten Erfolg hatten. Im Neoliberalismus zählt nur der Erfolgreiche – und als solche photographierten sich die Handlanger danach auch – mit dicken Geldbündeln in der Hand: Zur Freude der polizeilichen Ermittler.
Dennoch fällt dabei ein Wermutstropfen auf die schnelle Aufklärung gerade dieses Verbrechens: Hat man uns nicht alle gezwungen, nach der Deindustrialisierung des Westens und seiner Ökologisierung auf die Wertschöpfungstiefe von Algorithmen zu setzen? Es können nicht alle festangestellte Wolfs- oder Wattenmeer-Schützer werden! Wurde uns gesagt. Millionen haben sich deswegen zu Webpage-Gestaltern und ähnlichen ITs umschulen lassen, wobei es einige wenige, die Besten, schafften, hinter die Oberfläche – der Software – zu gelangen. Viele resignierten jedoch an der neuen Technologie und kehrten – als Wetware – in die Muckibuden, Bräunungsstudios und Surfstrände zurück oder ließen sich als Club-Türsteher oder Fahrkartenkontrolleur „vermitteln“. Sie wurden als Prols denunziert und wenn sie politisch und gewalttätig wurden gar als Neonazis.
Der kürzlich verstorbene Medienwissenschaftler Friedrich Kittler hielt im Gegensatz zu Jacques Derrida und Paul Parin nicht viel von den „Hackern“, auch das Internet ließ ihn kalt: Zuvörderst müßten wir die „Hardware“ durchdringen, meinte er – so wie einst Millionen von KFZ-Lehrlinge den Ottomotor. Denn unsere „Unkenntnis“ ist laut Kittler „selber Effekt von Programmierungen einer marktbeherrschenden Softwareschmiede,“ die sich anheischig macht, die „User“ schon bald ebenso wie ihre Computer zu „programmieren“. Der global organisierte Hack war ein Akt des Widerstands (Cyberclasswar), auch wenn die nicht-kriminellen Banker darüber lachen mögen. Die bürgerliche Presse schrei(b)t schon mal – im Interesse der „Geschädigten: den Banken“ – nach mehr „Sicherheit bei den modernen Bezahlsystemen.“ Sollen sie! Es ist ein Hase-Igel-Rennen: Schon seit den Achtzigerjahren müssen die Hersteller elektronischer Supermarkt- und Restaurant-Kassen jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen, weil die daran Beschäftigten sie bis dahin „geknackt“ haben. Natürlich gibt es nach wie vor solche handarbeitenden Brutalos wie die Mircea-Bande, die die Geldautomaten in den ländlichen Sparkassen Brandenburgs mit Lastwagen aus ihrer Verankerung reißen und dann damit abhauen. Dass es aber neulich Nachahmer gab, die stattdessen mit dem Kontoauszugsdrucker abhauten – darf eigentlich nicht mehr vorkommen. Überall bieten die Volkshochschulen inzwischen Computerkurse an – nahezu kostenlos.
In der FAZ denkt man dieser Tage global – und warnt vor rotchinesischen Spezialeinheiten des Militärs, die systematisch zu Hackern – von westlichen Konzernen und Institutionen und ihren vermeintlichen Geheimnissen – ausgebildet würden. Laut FAZ geht der „große“ Cyberwar schon in seine heiße Phase über, d.h. er ist bald voll entbrannt. Wir – auf unseren Nutzeroberflächen – werden auch noch dahinter kommen. Das meinte Friedrich Kittler glaube ich, als er dazu aufrief, sich endlich um die Hardware zu kümmern, um sie wenigstens gedanklich zu durchdringen.

Poller auf Flugplatz

Poller mit moderner Architektur
Leda mit dem Schwan
Im Buchladen lag ein neues dickes Buch des Literaturwissenschaftlers Klaus Theweleit: „Pocahontas II“ – der zweite Band seines vierteiligen „Buches der Königstöchter“. Im Vorwort heißt es: „für unsere Königstöchter-Geschichte müssen wir bis etwa 10.000 Jahre v. Chr. zurück. Es geht um die Besiedlung der Erde von Afrika aus. „Menschen in Bewegung treffen auf Menschen an Orten…mal diese auslöschend…mal sich vermischend. Die Geschichte konzentriert sich ab ca. 1600 v.Chr. auf die „Griechen“. Ich habe den Eindruck, dass Theweleit die (marxistische) Ökonomie – wie man heute sagt: nicht wirklich interessiert. Er „skizziert da „kurz die Gesellschaftsform“: Seßhaftensiedlungen mit „fest aufgeteiltem Grundbesitz“ – das sind für ihn die „materiellen Voraussetzungen für Königtümer und damit ‚Königstöchter‘.“ Die erste – in der abendländischen Geschichte und bei Theweleit – ist Medea, aus dem bronzezeitlichen kaukasischen Königreich Kolchis. Sie wird im griechischen Überlegenheitsmythos zum Einfallstor der bereits in der Eisenzeit angekommenen Griechen. Ich habe noch Folgendes gelernt: In den Steinzeitgesellschaften herrschte noch Gabentausch. Das darauf folgende Bronzezeitalter bringt in den wesentlichen Punkten noch keine Umwälzung hervor, da Bronze zu kostbar ist und nur den Herrschenden für Waffen und Luxusgegenstände zur Verfügung steht, die Primärproduzenten hingegen in der Hauptsache bei ihren Steinwerkzeugen beläßt. Der entscheidende Bruch in der Tradition der archaischen Gesellschaften tritt ein durch die Eisengewinnung und die sich entwickelnde Eisenbearbeitung. Das Eisenerz ist nahezu überall verfügbar, jedenfalls war dies in Griechenland der Fall, und Metallgeräte sowie Werkzeuge aus Eisen ungleich billiger und überdies härter als diejenigen aus Kupfer und seinen Legierungen. Die Verwendung von Eisengerät in der Bodenbearbeitung bringt eine wirtschaftliche Umwälzung in der Agrarproduktion hervor. Sie kann jetzt erfolgreicher als Einzelwirtschaft betrieben werden als in der umständlichen und aufwendigen Art der vorhergehenden kollektiven Aluvialwirtschaft. Mit dem Übergang zur Eisentechnik entsteht die Ökonomie der kleinen Bauernwirtschaften und der unabhängigen Handwerksbetriebe, die beide – nach Marx‘ berühmter Fußnote – „die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen in ihrer besten Zeit bilden, nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeinwesen aufgelöst und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft bemächtigt hat“.
Im Eisenzeitalter tragen die Einzelwirtschaften die Verantwortung für ihre Selbsterhaltung. Vor diesem Hintergrund ist auf die Bereitschaft zur Erwiderung beim Gabentausch kein Verlaß mehr, und der Austausch muß eine tiefgreifende Umformung erfahren, eben die Umformung zum Warentausch, wodurch die beiden Akte des Austauschs wechselseitige Bedingung füreinander werden. Die Partner dieses Verhältnisses stehen nun als Käufer und Verkäufer sich gegenüber. Der Tauschakt ist das komplexe Verhältnis, in dem die beiderseitigen Handlungen sich zur Einheit des Austausches aufwiegen. Das ist keine physische Einheit, sondern ein Rechtsverhältnis.
Dieses Rechtsverhältnis verpflanzen die Griechen nach Kolchis: Nachdem Medea ihren Vater, den König, und ihr Land aus Liebe zu Jason „verraten“ und an die Griechen verkauft hat, schließen die beiden unter Zeugen einen „Ehevertrag“. So findet sich diese erste Koloniegründung eines waffentechnisch überlegeneren „Volkes“ in dem, was man „Griechische Mythologie nennt (noch in seinen späteren Bearbeitungen – u.a. durch Ovid, Apollonius) wieder. „Die Geschichte beginnt mit einem Frauenraub, die Kultur mit einem Frauentausch,“ so sagte es Claude Lévi-Strauss. Theweleit arbeitet sich durch alle diesbezüglichen klassischen Mythen – bis sie Realgeschichte werden: bei der Eroberung der beiden Amerikas über die Körper der indianischen Frauen: Pocahontas und Malinche. Theweleits häufigste Illustration im Buch ist das Leda-mit-dem-Schwan-Motiv: Die ätolische Königstochter Leda wurde vom Griechengottkönig Zeus in Gestalt eines Schwans „verführt“. Dieser zoophile Mythos „zeugt“ von einer der ersten kolonialen Eroberung der Griechen, er bleibt hierzulande über berühmte Bilder – u.a. von Michelangelo und Leonardo da Vinci, über Gedichte von Rainer Maria Rilke und William Butler Yeats, über Porzellankitsch und US-Comics und Softpornos vorstellbar. Mit den diesbezüglichen „Realgeschichten“ à la „Pocahontas“, in die sich die Mythen laut Theweleit verwandeln, ist es in Ledas Fall jedoch schwierig. Der Schwanforscher Oskar Heinroth berichtet, dass zahme männliche Schwäne gelegentlich ihren Pfleger, wenn der z.B. im Gras liegt, besteigen. „Vielleicht kann man in diesem Verhalten eine Erklärung für das Entstehen der Sage von Leda mit dem Schwan finden,“ schlägt er vor – und bricht damit den Mythos auf „die Natur“ herunter, obwohl dieser einen Kulturvorgang verklärt: nämlich den Eroberungsfeldzug der Griechen (Zeus) gegen Ätolien, der über den Körper der Königstochter (Leda) führte.

Verkettete Poller in japanischer Großstadtkulisse

Poller im Härtetest
Beruf: Witwentröster
Bei den Witwentröstern unterscheiden die Beerdigungsredner zwischen „weißen“ und „schwarzen“: Erstere wollen wirklich trösten, letztere sind auf echte Werte aus (Bargeld lacht!). Aber manchmal kann man sie auch nicht so genau trennen. Da gibt es z.B. die Gruftis, die sich nicht nur gerne auf Friedhöfen rumtreiben, sondern dort auch gelegentlich Beerdigungen besuchen, wenn sie schon mal da sind. Ihr Interesse ist das (möglichst christliche) Trauerritual und die Nähe das Todes. Daneben gibt es aber auch solche, die das Leben, genauer gesagt: der Hunger, dort hintreibt – in der Hoffnung, am anschließenden Leichenschmaus teilnehmen zu dürfen, wenn sie sich nur überzeugend genug als „Freund“ des oder der „Verstorbenen“ ausgeben. Daneben gibt es auf den Berliner Friedhöfen auch noch sogenannte Winter-Witwentröster: Das sind solche Männer, die sich sommers in den meist ländlichen Reha-Orten als „Kurschatten“ durchschlagen und sich nur in der kalten Jahreszeit auf Friedhöfen rumtreiben, wo jedoch nicht allzu viel los ist. Und dann gibt es auch noch solche wie z.B. den jungen Achmed, der früher einmal Friedhofsgärtner war und die Stille sowie den Vogelgesang auf den Friedhöfen liebt. Einmal lernte er dort „meine“ unter mir wohnende alte Mieterin kennen, die das Grab ihres Mannes pflegen wollte, aber keinen Wasserhahn für ihre Blumen fand, Achmed half ihr. Sie kommt aus dem Osten, wo sie eine Pachttoilette bewirtschaftete. Seit dem Tode ihres Mannes lebte sie sehr zurückgezogen, aber nachdem sie Achmed kennengelernt – und sich quasi sofort mit ihm verheiratet hatte, fühle sie sich „wie neugeboren“ – wie sie mir gestand, als wir uns beim Getrenntmüll runtertragen auf der Treppe begegneten. „Ob er es ehrlich mit mir meint, wird sich herausstellen,“ fügte sie schmunzelnd hinzu.
Seit einigen Jahren muß ich andauernd zu Beerdigungen von Freunden, wo ich immer wieder die selben Leute treffe. Meine Bekannte, Gisela, meinte neulich schon: „Ich komm bald gar nicht mehr runter von den Friedhöfen.“ Mir hat sich dabei immerhin das Auge für Witwentröster geschärft: Jetzt, da das alte Ost- und Westberlin zügig wegstirbt, scheint diese Branche hier schier zu boomen. Vor allem im Frühjahr. Überall sehe ich jetzt Männer, die fremden Frauen ihre vollen Gießkannen oder irgendwelche Blümchen hinterhertragen, sich am Grab angekommen diskret zurückziehen und anschließend mit diesen Witwen ins nächste Café gehen. Eine Freundin von mir will demnächst an einem der Kreuzberger Friedhöfe sogar ein Café für solche Leute eröffnen. Sie meint, das wäre ein bombensicheres Geschäft – denkt dabei jedoch eher an reine Witwenrunden, denn, so zumindest ihre Beobachtung in Kreuzberg 61: Die Witwen, die regelmäßig die Gräber ihrer Lieben pflegen, kennen sich alle untereinander – und sie würden danach auch gerne noch zusammen einen Kaffee trinken gehen, aber es gibt in der Nähe der Friedhöfe so gut wie keine Cafés bisher, höchstens Steinmetze und Gärtner. Eine Ausnahme sei das schöne Gartencafé am Pankower Russenfriedhof, dort verkehren jedoch keine Witwen.
Auf dem Tierfriedhof des Tierheims in Hohenschönhausen lernte ich beim letzten Besuch eine Witwe kennen, die dort ihren 2011 eingeschläferten Hund beerdigt hatte. Sie meinte, dass sie viele „ältere verwitwete Damen“ kennen würde, die ebenfalls auf dem Friedhof das Grab eines tierlichen Angehörigen pflegen. Mit der einen oder anderen Dame ginge sie auch schon mal ins Café des Tierheims anschließend. Auf die Witwentröster angesprochen, winkte sie jedoch ab: „Ach, die Männer!“ Das seien doch fast alles „windige Gesellen“, die einem auf den Friedhöfen schöne Augen machen oder gar ansprechen. „Pietätlos“ wäre das. Sie gab jedoch zu, dass es dieses „Phänomen“ gibt, was sie sich damit erklärte, dass auf dem Friedhof, nahe dem Grab eines geliebten Verstorbenen, das Herz und die Seele besonders empfänglich seien für Zuspruch und Anrede. „Gelegenheit macht Diebe,“ so drückte sie sich aus. Auf dem Hohenschönhauser Tierfriedhof sei man jedoch, anders als auf dem alten in Lankwitz, relativ sicher vor ihnen: „Der neue jetzt ist zu weit draußen für diese Lorbasse, wissen Sie?!“

Poller mit norwegischem Fischer-Kontakt

Poller mit Seemannswitz
Wo bleibt die Tageszeitung Alte Welt?
Eine kürzliche Sechstagereise durch Böhmen, der neulich ausgestrahlte TV-Zweiteiler über türkische Gastarbeiter und der soeben angelaufene sechsstündige Reisefilm durch Osteuropa „Wroclaw-Varna-Odessa-Istanbul“ von Ulrike Ottinger bewiesen mir (Jahrgang 47) einmal mehr: Europa ist ein einziges Altersheim! Man sieht nur noch Kinder und Greise, der Rest der Bevölkerung ist irgendwo unterwegs – auf der Suche nach Arbeit. Das gilt auch und erst recht für das nahezu deindustrialisierte Berlin, wo es weitaus mehr Senioren-Center gibt als Jugend-Clubs und -lounges. Desungeachtet warten wir hier noch immer auf den großen Altersheim-Roman, während eine kleine radikale Minderheit von Teenies und Twens im Juvenilbezirk Prenzlauer Berg (www.mykiez.de) eine lächerliche Autobiographie nach der anderen rauspoppt. Gut, es gibt den Bestseller des FAZ-Herausgebers Schirrmacher: „Das Methusalem-Komplott“, in dem er uns unter Verweis auf seine 104 Jahre alte Großmutter damit droht, ebenfalls uralt zu werden (die Rache der Gene). Ferner hat der Sänger Grönemeyer den ersten Band seiner Werkreihe über Altersbeschwerden veröffentlicht: „Mein Rückenbuch“. Und es gibt die Altersheim-Einschleichreportage „Der Witwentröster“ von Mark Wortmann, aber dies ist schon wieder eine Youngster-Publikation – von einem Zivildienstleistenden.
Daneben gibt es natürlich auch noch jede Menge Chatrooms und Infoportale über Inkontinenz, Prostataprobleme, Geschwüre am Zwölffingerdarm und Altersdiabetes; runterladbare Testberichte und Preisleistungsvergleiche für zukünftige Rollstuhlfahrer, Gebißträger und Gehhilfenbenutzer; Seniorenprogramme im Radio; Führer zu Restaurants, in denen einem das Essen vorgekaut wird; und Touristikunternehmen, die sich auf Seniorenpauschalreisen zu den verlorenen Ostgebieten – bis hin nach Stalingrad – spezialisiert haben. Ins Fiktive lappen dagegen eine am 14.2. anlaufende Arte-Dou-Soap über einie „widerspenstige Alten-WG in Treptow“ und all jene lustigen Spielfilme, in denen Altersheiminsassen den Widerstand gegen ihre humorlose Heimleitung organisieren. In Wirklichkeit gibt es in diesen „Ruhesitzen“ herzlich wenig zu lachen. Im Auftrag und auf Rechnung der Sozialsenatorin habe ich einmal in zwölf Westberliner Altersheimen Diavorträge gehalten. Obwohl die Lichtbilder sämtlichst aus Sammlungen von alten Leute stammten und meine Kommentare dazu launisch gehalten waren, hörte man nur ab und zu traurige Seufzer, asthmatisches Röcheln, eingeschlafene Füße scharren und alle paar Minuten jemand, der sich quietschend mit seinem Rollstuhl entfernte. Besonders deprimierend waren die Altersheime in den Arbeiterbezirken, wo die meisten Insassen schon so debil waren, dass sie nur noch vor sich hin dämmerten – und wahrscheinlich noch mit Psychopharmaka zusätzlich ruhiggestellt wurden.
Eine Ausnahme war ein „Ruhesitz“ am Lietzensee, wo die Heimleitung meinen Vortrag schwachsinnigerweise als „Dias über neue Bademoden“ angekündigt hatte. Dort lebten jedoch zwei pensionierte Siemens-Justitiarinnen, die sich die ganze Zeit lebhaft mit mir über Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild stritten. In einem Wilmersdorfer „Ruhesitz“ wiederum ergötzten sich einige schon leicht angeschickerte Rentner derart an den Dias, dass sie laufend Kommentare wie „Ohohoh!“, „Eine scharfe Alte!“, „Der möchte ich mal im Park begegnen!“ und „Die hat ja Mordstitten!“ abgaben – bis es dem diensthabenden Oberpfleger zu viel wurde und er sie kurzerhand aus dem Speisesaal rollte.
Später traf ich sie auf der Straße an einem Imbißstand wieder, wo sie mir u.a. erzählten, dass es in der Gegend um den Heidelberger Platz ein seltsames Phänomen gäbe: Fast alle relativ gutsiuierten Ehepaare ließen sich dort scheiden, wenn die Kinder aus dem Gröbsten heraus seien. Die Männer würden dann ausziehen – jedoch nur in eine Wohnung auf der anderen Straßenseite, woraufhin sich die ehemaligen Ehepartner für den Rest ihres selbstorganisierten Lebens durch die Gardinen beobachteten. Das hätte wiederum zur Folge, dass sie ihre neuen Liebschaften stets heimlich durch den Hintereingang empfingen und während des Beisammenseins peinlich darauf achteten, kein Licht zu machen. Vielleicht sollte man den großen Rentnerroman also schon in die Zeit vor dem Altersheim ansiedeln?

Handarbeiter am Poller

Kopfarbeiter um Poller

Politiker hinter Poller

Werbung für Poller

Werbung mit Poller

Hinweis auf Poller (Alle Pollerphotos: Peter Loyd Grosse)
Aus dem Band 6 der Reihe Kleiner Brehm „Affen“, der soeben erschienen ist:
…Die Logik ist, mindestens seit Aristoteles, das Prinzip der Identität (A gleich A). Sie war zunächst wesentlich „Ontologik“, insofern das Sein durch sie begriffen wurde. Mit diesem Begriff des „Seins“ – von Parmenides, der ihn noch als Geschenk der Göttin Dyke empfing, beginnt laut Hegel die Philosophie. Für den Gräzisten Bruno Snell hat sie die Durchsetzung bestimmter Artikel bei der Substantivierung von Verben und Adjektiven (wie Das Sein z. B. ) zur Voraussetzung: ein Abstraktionsvorgang, dessen Übersetzung ins Lateinische z. B. nur um den Preis seiner Rekonkretisierung (einer umständlichen Umschreibung) gelang.
In „Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen“ (1947) schreibt Snell, dass „das Griechische in der Naturwissenschaft den Logos aus der Sprache entbunden hat OE Nur hier sind die Begriffe organisch der Sprache entwachsen. Nur in Griechenland ist das theoretische Bewußtsein selbstständig entstanden, alle anderen Sprachen zehren hiervon, haben entlehnt, übersetzt, das Empfangene weitergebildet.“ Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler hat ausgehend von Snells Studien gemeint, „daß die griechischen Buchstaben seit etwa 450 v. Chr. eine zweite, arithmetische Bewandtnis annahmen: Alpha stand zugleich für Eins, Beta für Zwei, Gamma für Drei usw. Zum erstenmal in aller Mediengeschichte entsprangen die Zeichen für Kardinalzahlen der Reihung oder Ordinalität eines Alphabets.“ Dieser „sogenannte Stoichedon-Stil im archaischen Athen“ war eine der „Möglichkeitsbedingungen von Wissenschaft überhaupt“.
Kittler wandte sich mit seiner These „Schrift, Zahl unds Ton im Medienverbund“ explizit gegen jeden marxistischen Versuch, Mathematik und die abstrakten naturwissenschaftlichen Begriffe aus der Ökonomie – konkret: aus der Einführung des Geldes im griechischen Warenhandel (etwa 500 vor Chr. in Ionien) – abzuleiten, wobei er sich namentlich auf Alfred Sohn-Rethel bezog, der an einer historisch-materialistischen Erklärung der angeblich ontologischen Kategorien arbeitete, d. h. es ging ihm um den Ursprung des abstrakten Denkens in Begriffen, die Immanuel Kant als Apriori unserer Wahrnehmung bezeichnete. Die dazu notwendige „Realabstraktion“ fand für Sohn-Rethel in der Tauschsphäre, der Warenzirkulation, statt – während einige andere Marxisten sie bereits aus der „abstrakten Arbeit“ ableiteten. Die meisten begnügten sich indes damit, das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken als adäquate Widerspiegelung der Naturerscheinungen zu begreifen. Die Natur liefert aber „keine identischen Gegenstände wie das Geld als Geld, sie liefert also kein Moment im Erfahrungszusammenhang, das die Möglichkeit der Abstraktion hervorbringen würde“, heißt es bei Rudolf Müller. Die Naturwissenschaftler glauben, die Ausschaltung des Anthropomorphismus und den Zugang zur objektiven Naturerkenntnis geschafft zu haben, sie haben aber laut Alfred Sohn-Rethel „nur einen früheren durch ihren eigenen ersetzt“.
Bei den Psychologen hat es dem gegenüber nicht an entwicklungsgeschichtlichen Erklärungen für das „logische Denken“ gefehlt, es wurde jedoch nicht als „gesellschaftliche Praxis“, sondern „subjektiv“ gefaßt. Folgt man dem „Neukantianer“ Wilhelm Windelband war die „Apriorität“ aber „bei Kant kein psychologisches, sondern ein rein erkenntnistheoretisches Merkmal: es bedeutet nicht ein zeitliches Vorhergehen vor der Erfahrung, sondern eine sachlich über alle Erfahrung hinausgehende und durch keine Erfahrung begründbare Allgemeinheit und Notwendigkeit der Geltung von Vernunftprinzipien.“
Für den englischen Biologen Rupert Sheldrake ist es originellerweise die Logik selbst, die zur Evolution fähig ist: Zunächst gab es nur so etwas wie „atomare Gewohnheiten“, aus denen z. B. „mechanische Gesetze geworden“ sind, diese können sich – ebenso wie die Tier- und Pflanzen-Arten – verändern. Die Evolutionstheorie ist also auch für die Naturgesetze gültig, deswegen gibt es sie eigentlich gar nicht: nur „zeitweilige Gewohnheiten der Natur“, schreibt Sheldrake in seinem Buch „Der Wissenschaftswahn“ (2012). Er macht darin mit der „Logik“ das selbe, was Darwin mit dem „Kapitalismus“ und Engels sowie Stalin mit der „Dialektik“ taten: Sie projizierten deren Entstehung in die Natur. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat – als Inhaber des Königsberger Kant-Lehrstuhls ab 1941 – versucht, die Apriori-Begriffe des Philosophen der Französischen Revolution darwinistisch-biologisch aus der Entwicklung und Struktur unseres Erkenntnisapparates, d. h. aus der natur- bzw. stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen, abzuleiten – um den Kantschen Dualismus von Natur und Vernunft zu überwinden. Die Logik als Ergebnis von Mutationen?
In Lorenz‘ Hauptwerk „Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens“ (1973) heißt es: „So wie die Flosse a priori gegeben ist, vor jeder individuellen Auseinandersetzung des Jungfischs mit dem Wasser, und so, wie sie diese Auseinandersetzung erst möglich macht, so ist dies auch bei unseren Anschauungsformen und Kategorien in ihrem Verhältnis zu unserer Auseinandersetzung mit der realen Außenwelt durch unsere Erfahrung der Fall.“ So spricht Konrad Lorenz auf dem Kant-Lehrstuhl (er weiß sich dabei mit dem Philosophen Karl Popper einig), als Verhaltensforscher hat er jedoch gelernt, genau zu beobachten, wie der Philosoph Wolfgang Thorwald in seinem Aufsatz über Lorenz nahelegt: „Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung. Dies kritisiert Lorenz als Verabsolutierung einer Abstraktion (Abstraktionen können prinzipiell niemals absolut gelten, weil sie im Wortsinne bestimmte Merkmale eines Gegenstandes von ihm abziehen‘ und isoliert herausstellen. D. h. Abstraktionen sind immer inhaltsärmer als der ihnen zugrundeliegende Gegenstand). Auch die Mathematik ist nach Lorenz ein Produkt des menschlichen Erkenntnisorgans, das stammesgeschichtlich entstanden ist. Daher kann auch die Mathematik für ihn keine absolute, im eigentlichen Wortsinn apriorische Geltung besitzen. Für Lorenz ist die Mathematik ursprünglich eine Anpassungsleistung des menschlichen Denkorgans an die Außenwelt: Die Mathematik sei nämlich durch das Abzählen realer Einheiten entstanden. Dabei arbeite sie mit Abstraktionen, die den realen Inhalten und Gegebenheiten aber „grundsätzlich nur annäherungsweise“ angemessen seien. Zwei Einheiten seien sich nur deshalb absolut gleich, weil es ,genaugenommen‘ beide Male dieselbe Einheit ,nämlich die Eins‘ ist, die mit sich gleichgesetzt werde. So sei die reine mathematische Gleichung letztlich eine Tautologie‘, und die reine Mathematik wie die Kantischen apriorischen Denkformen inhaltsleere Verabsolutierungen: Leer sind sie tatsächlich absolut‘, aber absolut leer.‘ In der Mathematik besitze Gültigkeit immer nur der leere Satz‘. Die Eins, auf einen realen Gegenstand angewandt, findet im ganzen Universum nicht mehr ihresgleichen.‘ Wohl seien 2 und 2 vier, niemals aber sind zwei Äpfel, Hammel oder Atome plus zwei weiteren gleich vier anderen, weil es keine gleichen Äpfel, Hammel oder Atome gibt‘.“
usw…
Pythagoräisches Allzupythagoräisches
Unser Lieblingsdichter, der auf dem Transport in den Gulag gestorbenen Ossip Mandelstam, schrieb 1933: „Die Pflanze ist ein Klang, hervorgelockt vom Stäbchen des Termenvox, das in einer von Wellenprozessen gesättigten Sphäre girrt.“
Das Termenvox (oder Theremin) ist ein elektronisches Musikinstrument, das 1920 der sowjetische Elektrobastler Leo Thermin erfand. Es ist das einzige verbreitete Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt. „Beim Theremin beeinflusst die elektrische Kapazität des menschlichen Körpers ein elektromagnetisches Feld. Dabei beeinflusst die Position der Hände gegenüber zwei Elektroden („Antennen“) die Stärke der Veränderung. Die sich ändernde Schwingung des Feldes wird verstärkt und als Ton über einen Lautsprecher ausgegeben.“ Es ist ein ziemlich extravagantes Instrument, weltweit gibt es nur fünf professionelle Theremin-Spieler, ausschließlich Frauen. Als Leo Thermin sein Instrument Lenin vorführte, war dieser außerordentlich begeistert – darüber, dass man mit der Elektrizität nicht nur die gesamte Sowjetunion in den Kommunismus überführen, sondern das auch noch mit der entsprechenden Musik. Nicht ganz unbegründet hatte zuvor H.G. Wells nach einem Besuch bei Lenin die bolschewistische Formel „Elektrifizierung des ganzen Landes + Sowjets = Kommunismus“ als eine „Utopie von Elektrikern“ bezeichnet.
Dabei ründet sich der bolschwistische GOELRO-Plan erst mit dem Theremin. Jedenfalls dann, wenn wir dem kürzlich verstorbenen Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler folgen, der sich Anfang 2000 zum Entsetzen seiner Studenten an der Humboldt-Universität und nicht nur dort von den Neuen Medien ab und den Alten Griechen zuwendete: „Die üblichen Mathematikgeschichten verzeichnen es wie eine Nebensache, daß die griechischen Buchstaben seit etwa 450 vor unserer Zeitrechnung eine zweite, nämlich arithmetische Bewandtnis annahmen: Alpha stand zugleich für Eins, Beta für Zwei, Gamma für Drei undsoweiter. Zum erstenmal in aller Mediengeschichte entsprangen die Zeichen für Kardinalzahlen der Reihung oder Ordinalität eines Alphabets. Ganz entsprechend kennt die Epigraphik, also unsere nur sogenannte Hilfswissenschaft von altgriechischen Inschriften, nur ein ‚ästhetisches Verlangen‘ zumal der Athener, „größere Einfachheit, Symmetrie und Gleichförmigkeit zwischen den einzelnen Buchstabenformen zu stiften. In Wahrheit war der sogenannte Stoichedon-Stil im archaischen Athen, den Buchstabenformen, eine der Möglichkeitsbedingungen von Wissenschaft überhaupt.“
Kittler wandte sich damit explizit gegen jeden marxistischen Erklärungsversuch, die Mathematik und die abstrakten naturwissenschaftlichen Begriffe (beginnend mit dem „Sein“ des Parmenides) aus der Ökonomie – konkret: aus der Einführung des Geldes im griechischen Warenhandel (etwa 700 vor Chr. in Ionien) abzuleiten: „Daß am Anfang unserer Kultur eine Ökonomie der Zeichen selber stand, die sich um ihre Träger kaum mehr scherte, widerlegt jeden Materialismus, der Zeichen überliest (vgl. Sohn-Rethel). Es gibt keinen Geldhandel ohne Münzen, aber auch keine Münze ohne Schrift Bild Zahl. Es gibt keine Tragödie ohne Buchstaben…“
Sein früherer Assistent Peter Berz schreibt in der neuen Ausgabe der Zeitschrift für Verkehrswissenschaft „Tumult“, die Friedrich Kittler gewidmet ist, über den „Pythagoräismus“: Für die Pythagoräer, die ebenso von der Zahl fasziniert waren wie Kittler, und deswegen von ihm in seinem letzten Werk „Musik und Mathematik 1: 1 Bd.: Hellas – 1 Tl.: Aphrodite: Bd. 1“ quasi wiederentdeckt wurden, ahmt die Zahl nicht das Seiende nach, sondern das Seiende die Zahl. Auch die Harmonie gründet in der Zahl. Anders ausgedrückt – mit Kittler: „Um Mathematik als allgemeines Wissen zu begründen, zählt nur Musik.“ An anderer Stelle kommt dieser dem Pythagoräismus noch näher: „Alles, was da blüht und lebt, geht aus dem Besten von der Welt auf, aus der Zahl.“
Peter Berz schließt seinen Tumult-Text mit einem weiteren Pythagoräismus – als den er den Satz von Mandelstam verstanden wissen will: „Die Pflanze ist ein Klang, hervorgelockt vom Stäbchen des Termenvox, das in einer von Wellenprozessen gesättigten Sphäre girrt.“ Heute ist diese Sphäre natürlich noch viel viel gesättigter mit „Wellenprozessen“ als 1933. Aber darum geht es hier nicht, sondern, kurz gesagt, um den Anfang mit Musik, dann: Zahl – Pythagoräismus – Mathematik und Naturwissenschaft – Generator/Goelro – Glühbirne und wieder Musik (mit dem Termenvox).
Während des Golfkriegs schrieb der holländische Schriftsteller Harry Mulisch siegesgewiß – in einem Aufsatz mit dem Titel „Das Licht“: „Nicht nur die Quantenmechanik, auch die klassische Mechanik liegt nicht im östlichen Erbgut begründet. Wenn sie irgendwo begründet liegt, dann stammt sie aus dem philosophisch-theologischen Erbgut derjenigen, die die klassische und die moderne Physik tatsächlich aufgestellt haben – und das sind wir, aus der westlichen Welt.“ Für den nicht minder eingewesteten Sprachwissenschaftler Noam Chomsky liegt auch unsere Grammatik im „Erbgut“ quasi fest verankert. Also gut!
Was war es aber denn nun: Das Geld – als die bare Münze des Apriori oder die in den Zahlen gründende Musik oder die aus dem griechischen Alphabet sich herausmendelnde Arithmetik der Pythagoreer oder gar – wie Bruno Snell nahelegt, dem Kittler viel zu verdanken hat – die Durchsetzung bestimmter Artikel bei der Substantivierung von Verben und Adjektiven (Das Sein z.B.)? Und ließe sich dies nicht interpretieren als die sprachliche Neuerung/Entsprechung einer ökonomischen neuen Tatsache – der Durchsetzung des Geldverkehrs? Ungeachtet all dieser Aufklärungsmotive bliebe dann auch noch zu klären: Ist die Pflanze wirklich ein Klang (inmitten von Wellenprozessen unter, über auf einer, sagen wir, Wiese)?
Aus Anlaß des 2011 verstorbenen Friedrich Kittler erschien kürzlich eine Ausgabe der Zeitschrift „Ästhetik & Kommunikation“, die ihm gewidmet ist. Sie beinhaltet vor allem eine Auseinandersetzung mit dem frühen Kittler – den Medien- und Kriegsforscher. Die Ä&K-Ausgabe wurde jüngst im Charlottenburger „Buchhändlerkeller“ vorgestellt. Auch die Zeitschrift „Tumult“ widmete ihre neueste Ausgabe „Kittler“, darin findet man auch einige Texte, die sich mit der Hinwendung des späten Kittlers zu den Griechen befassen. Die „Tumult“ wird am 12.6. ab 20 Uhr im Roten Saal der Ostberliner Volksbühne vorgestellt.
Wie oben bereits angedeutet, wendete sich auch Kittlers Freund Klaus Theweleit in seinem „Buch der Königstöchter“ den Griechen zu – um sie – ähnlich wie Kittler quasi gegen das Christentum auszuspielen. Die beiden kommen aus Freiburg, wo noch ein dritter Antichrist wirkt: Cam Carotta. Über sein erstes diesbezügliches Buch schrieb ich:
Am Anfang dieses echten Weihnachts- und Millenniumsgeschenks stand ein Verdacht: Handelt es sich beim Christentum um einen umgemünzten Cäsarenkult? Ist das Evangelium Jesu nur eine neu verfasste Vita Cäsars – des einst als Gott verherrlichten Divus Julius?
Der in Freiburg lebende Autor Francesco Carotta, genannt Cam, hat sich lange mit den lateinischen, griechischen und aramäischen Texten befasst und legt eine Fülle von Beweisen dafür vor, wie aus den cäsarischen „Siegesmeldungen“ im römischen Bürgerkrieg die „guten Botschaften“ Jesu wurden. Dieses hübsche Überraschungsei dreht die Christusforschung, die sich nur noch um Jesu-Realia bekümmert, wieder um: Hier geht es um Texte. Die Bibel hat sich in einen Buchladen verwandelt und der Glaube in Lesewut.
Bei der Diskussion des Buches – unter anderem über die Internetadresse www.carotta.de – halten sich denn auch die Theologen eher bedeckt. Einige TV-Kultursendungen haben den Autor jedoch bereits für ihre Jahresendzeit-Ausgaben eingeplant. Die Archäologin Erika Simon schreibt im Nachwort: „Die enge Verflechtung dieser Religion mit dem Römischen Weltreich wurde von Seiten der historischen Forschung schon immer unterstrichen. Das Buch knüpft an diese Tatsache an, geht aber weiter und deckt neue … Zusammenhänge auf… Im Gegensatz zu Jesus war Cäsar ein Heerführer, doch unter römischen Soldaten erfolgte … die frühe Verbreitung der christlichen Religion.“
Auch die heilige Geschichte Cäsars ist uns nur über die Werke späterer Autoren bekannt. Carotta liest die Texte als „Vitae Parallelae“, als parallele Lebensbeschreibungen also.
Während es bei Plutarch zum Beispiel heißt: „Pompeius war in Rom und rüstete auf. Währenddessen forderte Metellus Scorpio Caesar auf, seine Soldaten zu entlassen“, steht bei Markus (1,4): „Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.“ Carotta schreibt dazu: „Wir haben gesehen, dass die Taufe für lustratio steht bzw. für ein als dilutum missverstandenes dilectus, also für Rüstungen und Aushebungen, dass hinter ,predigte‘, kéryssón, Caesar steckt, hinter der ,Buße‘, metanoias, Metellus, hinter den ,Sünden‘, (h)amartión, armorum, Waffen, Armee. Nach demselben Muster ist hier Rom zur Wüste geworden: Romae – erémó, ,in Rom‘, ,in der Wüste‘.“
Um gleich die Frage im Titel des Buches zu beantworten: War Jesus Cäsar? „Nein, Jesus war nicht Cäsar: Jesus ist Divus Iulius.“ Im Übrigen ist das Oberhaupt der Römischen Kirche noch heute Pontifex maximus. Mit der feierlichen Beendigung der Bürgerkriege war bereits aus dem „imperium populi romani“ das „imperium Divi Iulii“ – das „Reich Gottes“ – geworden. Mit einem Cäsarenkult, der bis Indien reichte, mit eigenen Priestern und Liturgien. Es war ein monotheistischer Gott, den Brutus da erstochen hatte. Und seine Umwandlung vollzog sich in einer Art Transkription.
Erwähnt sei dazu die Polemik um Catos Selbstmord – zwischen Cicero und Cäsar. Man kennt ihre Schriften nur aus der Sekundärliteratur. Cäsar warf danach Cato vor, „er habe seine schwangere Frau Marcia dem reichen und betagten Horrensius abgetreten, um sie bald danach als reiche Witwe wieder zu heiraten, dadurch aus schnöder Habgier die Ehe zu einem Geldgeschäft erniedrigt … Nur zur Tarnung habe er Trauerkleider getragen.“
Carotta schreibt: Tatsächlich war dann „die von der reichen Witwe angeschaffte Erbschaft zu Catos persönlicher Kriegskasse geworden. Der Evangelist Markus wird Cäsars Polemik gegen Cato im Anschluss an den Afrikafeldzug vorgefunden haben. Nicht zufällig finden wir den Kern jener berühmten Polemik, in typischer Abwandlung, nach den bösen Weingärtnern, i. e. nach der Meuterei der Veteranen, wieder“.
Dort (12,38-40) heißt es: „Und er lehrte sie und sprach zu ihnen: Seht euch vor vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen und sitzen gern obenan in den Synagogen und am Tisch beim Mahl; sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete …“
Wieder und wieder wurde der Diskurs um das Mittelmeer getrieben, wenn man so sagen darf – auf Eseln. Mir hat an diesem Parforceritt am besten gefallen, wie dabei aus großen Bürgerkriegsepisoden kleine Heilungen wurden (er kam, sah und heilte) – und vice versa. Wobei dem ursprünglichen Text – der Wahrheit – nicht immer Gewalt angetan werden musste. So urteilte Markus über den Anteil der Gnade an der Heilung: „Wenn du kannst – alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Dies ist laut Carotta „eine gute markinische Übersetzung“ des Angebots von Cäsar an Cato: „in fidem et potestatem se permittere“.
Des Euhemeros‘ Gedanke – „Die Götter von heute sind die guten Herrscher von gestern“ – hat sich damit nach Meinung des Autors am Beispiel von Cäsar und Jesus bestätigt. „Mit der Konsequenz“ – am Vorabend des Jubiläumsjahres 2000 -: „dass uns runde 100 Jahre abhanden gekommen sind. Seit der Geburt des tatsächlichen Jesus – vom leidigen Problem des Jahres 0 (null) abgesehen – sind wir im Jahr 2099.“
Einmal mehr wird damit die bereits 1989 aufgestellte These des Medienkritikers Jean Baudrillard bestätigt: „Das Jahr 2000 findet nicht statt!“ (Francesco Carotta: „War Jesus Caesar? 2000 Jahre Anbetung einer Kopie“. Goldmann Verlag, München 1999)
Inzwischen erschien ein holländischer Dokumentarfilm, der sich mit Cam Carottas Thesen auseinandersetzt, sowie ein neues Buch des Autors, in dem er seine Thesen zu erhärten sucht: „War Jesus Caesar? – Artikel und Vorträge: Eine Suche nach dem römischen Ursprung des Christentums“ (Verlag Ludwig, Kiel 2012)
In einem Vortrag, den ich neulich in der Weddinger Galerie „oqpo“ hielt – über die Kunst in der Tierwelt, kam ich kurz auf den „Trojanischen Krieg“ zu sprechen – und zitierte dazu Friedrich Kittler:
…Was es mit diesem griechischen Sexualkrieg auf sich hat, erklärte der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler der Zeitschrift „Cicero“: „Vergleichen Sie zum Beispiel die verschiedenen Reaktionen auf Helena. – Helena, die schönste aller Frauen, deren Entführung den Trojanischen Krieg auslöste. Bei Homer, im dritten Gesang der ‚Ilias‘, sagen die alten Trojaner: Wir sollten Helena, das Miststück, dem Menelaos, ihrem Mann, zurückgeben, dann hätten wir Frieden und keinen Krieg mehr. Dann kommt sie. Und die Greise sehen Helena und sagen: Nein, so unsterblich schön, gegen eine solche Frau kann man nichts sagen. Euripides sagt in 19 Stücken, Helena ist eine Hure, und in einem Stück sagt er, sie ist eine treue Ehefrau. Und Horaz schreibt in den ‚Satiren‘: Schon lange vor Helena waren Fotzen – wörtlich: cunnus – der stinkendste Kriegsgrund. Also drei Sexualmoralen zu drei Zeiten, von denen die eine sich vor der Schönheit beugt, die zweite die Schönheit als Zügellosigkeit schlechtmacht, und die dritte im Schönen das Stinkende wahrnimmt, also das Obszöne.“
Kittlers Thema ist Kunst und Sexualität – in seinem unvollendeten Monumentalwerk „Musik und Mathematik“, wobei letzteres sowie die Oktave und die Gitarre zusammen mit dem Vokalalphabet von den Griechen quasi erfunden wurden: „Ohne Götter, die miteinander schlafen, gäb es keine Sterblichen, ohne Eltern, die miteinander Liebe machten, keines von uns Kindern. So bleiben einzig Dank und Wiederholung. Nichts anderes heisst Griechen, solang sie dichten, Mimesis, Tanz als Nachvollzug der Götter.“ Auch beim Geschlechtsverkehr ahmen wir laut Kittler die Götter nach. Er erwähnt dazu gerne ein Lied seines Lieblingsmusikers Jimmy Hendrix: „And the Gods made love“. Die Popstars haben uns seiner Meinung nach die Götter wiedergebracht. Dazu berichtet er von einem Popkonzert in Kopenhagen, wo ein Junge seine Freundin anschließend Backstage zum Sänger brachte: „Der hat die Nacht mit ihr verbracht und am nächsten Tag ging die Liebe zwischen dem Mädchen und ihrem Freund weiter.“ Eine ganz ähnliche Geschichte passierte 1986 der DDR-Punkband „Freygang“ nach einem Konzert in Bitterfeld. Für Kittler sind das Beispiele „einer uneifersüchtigen Variante des Amphytrion-Stoffes, so wie auch Amphytrion nicht ernsthaft zu Alkmene sagen kann: ‚Ich verbiete dir, mit Zeus zu schlafen!’“(Das ist etwas anderes als die derzeitige „Polyamorie“-Diskussion.)
Hier stellt sich aber die Frage: Haben auch die Tiere Götter – oder gar einen Gott?Angeblich soll der französische Kardinal Melchior de Polignac zu dem im Jardin du Roi erstmalig gezeigten Orang-Utan gesagt haben: „Sprich – und ich taufe Dich!“ Der Affe blieb jedoch stumm – und ungetauft! USW.

Straßensperre mit Pilone

Straßenspiel mit Pilon

Kneipe mit Pilon

Zaun mit zwei Pilone

Wasserleiche mit einem Pilon (Alle Pilon-Photos: Peter Loyd Grosse)
Letzte Meldungen:
1. NZZ: In Bulgarien demonstrieren seit mehr als einer Woche Tausende jeden Tag dagegen, dass Politiker Wahlversprechen zynisch in den Wind schlagen und Transparenz zwar propagieren, doch nicht wirklich gewährleisten. Nach 1989 und 1997 ist es eine neue junge Protestgeneration, die mehr Zivilgesellschaft einfordert.
2. Spiegel: Mehr als 2000 Menschen haben am Dienstagabend in Istanbul gegen die Freilassung eines Polizisten protestiert, der auf einen Demonstranten geschossen hat. Dieser starb später. Der Beamte beruft sich auf Notwehr.
3. SZ: Brasilien – Trotz Zugeständnissen der Regierung haben die landesweiten Proteste am Donnerstag noch zugenommen.
4. SZ: Hungerstreik in München 12 Flüchtlinge im Krankenhaus. Sie verweigern seit Tagen Essen und Trinken, nun sind mehrere Flüchtlinge in München zusammengebrochen. Dennoch wollen sie weiter protestieren. Bayerns Innenminister Herrmann kritisiert den Hungerstreik harsch – und spricht von „Erpressung“.
5. Berlin: Seit Monaten protestieren Flüchtlinge auf dem Oranienplatz in Kreuzberg gegen ihre Unterbringung. Trotz einiger Anwohnerproteste dürfen sie offiziell bleiben.
6. Deutsche Welle: „Die hochqualitativen Waffen samt Munition sind eingetroffen und bereits an die Rebellen an verschiedenen Fronten innerhalb Syriens verteilt“: Die Aufständischen der Freien Syrischen Armee (FSA) strahlen in der Schlacht gegen Präsident Baschar al-Assad wieder Siegeszuversicht aus. Denn: Mit den gelieferten modernen Waffen könnte der „Verlauf der Kämpfe verändert“ werden, so ihre Kommandeure, die nach den jüngsten Niederlagen neue Hoffnung schöpfen.
7. Junge Welt: Die Unterdrückung der Bauernproteste im nordkolumbianischen Catatumbo hat zwei weitere Todesopfer gefordert. Medienberichten zufolge wurden zwei Bauern, Diomar Humberto Angarita und Hermides Palacios, am Dienstag (Ortszeit) von der Polizei erschossen, als die Demonstranten einen als »La Y« bekannten Verkehrsknotenpunkt in Ocaña blockieren wollten.
8. Junge Welt: Am Dienstag gab es in Wien eine Demonstration gegen Leiharbeit im Allgemeinen Krankenhaus (AKH). Zu der Kundgebung hatte die »Initiative Übernahme« aufgerufen, eine Kampagne von Beschäftigten der Einrichtung, die sich für eine reguläre Anstellung der derzeit etwa 1000 Leiharbeiter einsetzt. Insgesamt arbeiten mehr als 9000 Menschen im AKH, das damit nicht nur eines der größten Krankenhäuser Europas, sondern auch einer der größten Betriebe in der österreichischen Hauptstadt ist. Seit einigen Monaten wehren sich die Beschäftigten gegen die schleichende Deregulierung der Anstellungsverhältnisse. Etwa 1000 von ihnen sind seit acht Jahren über die Leiharbeitsfirma AGO angestellt. Für die Betroffenen bedeutet dies ein geringeres Einkommen, kürzere Kündigungsfristen und weniger Mitspracherechte als ihre Kollegen sie haben, die direkt von der Gemeinde Wien angestellt sind.
9. Junge Welt: Den zweiten Tag in Folge ist der Eiffelturm in Paris am Mittwoch wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Die Mitarbeiter fordern u. a. höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.
10. Junge Welt: Peking – Bei blutigen Ausschreitungen in der Unruheregion Xinjiang in Nordwestchina sind 27 Menschen getötet worden. Chinesische Medien sprachen von Angriffen einer »messerschwingenden Meute« auf Polizeiwachen, Amtsgebäude und eine Baustelle in Lukqun nahe der Oasenstadt Turpan. Die Polizei habe das Feuer eröffnet und »zehn Unruhestifter« erschossen, nachdem diese zuvor mindestens 17 Menschen getötet hätten. Unter den Toten seien auch neun Polizisten und Wachleute.
11. Euronews: Mit einem massiven Sicherheitsaufgebot von Polizei und Soldaten bereitet sich Ägyptens Regierung auf die angekündigten Massenproteste gegen Präsident Mursi am Sonntag vor. Während in der Hauptstadt angespannte Ruhe herrschte, lieferten sich Gegner und Anhänger des Präsidenten nördlich von Kairo Straßenschlachten, bei denen laut Agenturmeldungen mindestens zwei Menschen starben. “Das ägyptische Volk wird auf die Straße gehen, um etwas gegen den derzeitigen Rückschritt zu tun, gegen die Spaltung, die aus der Revolution resultierte, gegen den Missbrauch der Religion in letzter Zeit und gegen den intellektuellen und religiösen Extremismus, dem wir hier gegenüberstehen”, erklärt ein Ägypter.
12. FAZ: In Griechenland hat die größte Oppositionspartei, das linksradikale Bündnis Syriza, vor sozialen Unruhen gewarnt, sollte die Regierung die Pläne für weitere Einsparungen von 11,5 Milliarden Euro verwirklichen. Syriza-Sprecher Panos Skourletis sagte im Fernsehen, die Bürger könnten in den Finanzämtern „alles kurz und klein schlagen“, weil sie kein Geld mehr hätten, ihre Steuern zu bezahlen. Er bekräftigte die Forderung, dass Griechenland die Bedienung seiner Schulden einstellen und mit den internationalen Kreditgebern über eine Abschwächung des Sparprogramms verhandeln solle.




