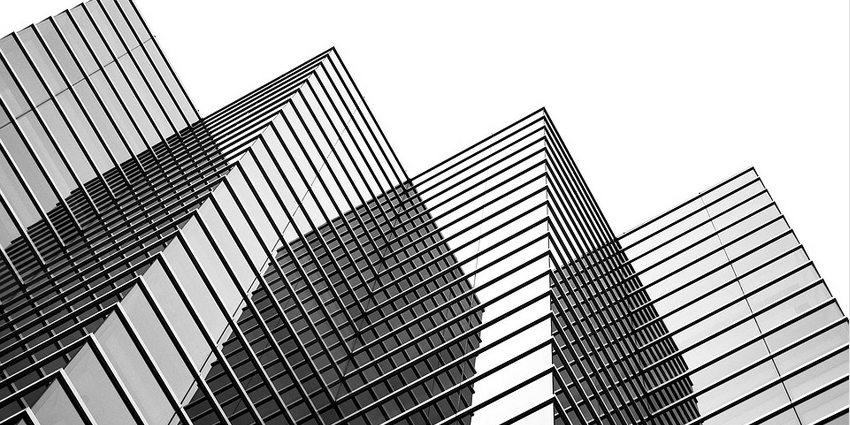Drei Schwestern Unterwegs in Schöneberg!

Ihre Eltern im Zoo

Ihre Patentante mit dem ersten eigenen Auto vor dem (weltgrößten) Abfertigungsgebäude – des Flughafens Tempelhof.
„I pity the poor immigrants,“ sang Bob Dylan 1968. Damals, in der Studentenbewegung, unterschied man zwischen „politischen“ und „Wirtschaftsflüchtlingen“ – nur den ersteren wollte die Linke „Asylrecht“ erkämpfen. Der Staat war und ist dagegen eher an letzteren interessiert – jedenfalls wenn sie genug Geld für ein Investment mitbringen. So konnten sich z.B. Taiwan-Chinesen in Westberlin gleich bei der CDU im „Europa-Center“ melden – und bekamen sogleich alle Papiere, die sie hier für eine „Niederlassung“ brauchten. Um die Armutsflüchtlinge kümmern sich dagegen nur kleine linke und protestantische Initiativen, daneben werden sie gelegentlich noch von einem oder einer Deutschen aus der „Duldung“ weggeheiratet. Selbst das versucht der Staat, dieses „kälteste aller kalten Ungeheuer“ (Nietzsche) immer mehr zu erschweren.
In Hamburg, wo kürzlich via Lampedusa 300 afrikanische und arabische Flüchtlinge »landeten«, startete der St. Pauli Fanclub eine Hilfsaktion für sie, die ihre Abschiebung verhindern soll. In Berlin gibt es seit Oktober ein Flüchtlingscamp, dessen Duldung der Kreuzberger Bürgermeister ermöglichte. Die dortigen Aktivisten veranstalteten kürzlich ein »Refugee-Tribunal« auf dem Mariannenplatz. Es ging dabei um eine würdigere Behandlung der Flüchtlinge: »Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört.« Sie fordern u.a.: Bleiberecht, Abschiebungen stoppen, Abschaffung der Residenzpflicht, eine bessere medizinische Versorgung in den Flüchtlingsheimen. 20 Leute aus einem Halberstädter Heim, die zum Tribunal anreisten, wurden von der Polizei in Magdeburg gestoppt, die ihnen ihre Dokumente abnahm.
Es gab einmal eine Zeit – bis zum Ersten Weltkrieg –, da man sich ohne Papiere in ganz Europa frei bewegen konnte, der Exilant Stefan Zweig hat oft und gerne daran erinnert. Während des Zweiten Weltkriegs konstatierte Bertolt Brecht in seinen »Flüchtlingsgesprächen« aber bereits: »Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustandekommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Paß niemals.«
Einige Jahre nach dem Krieg titelte der Spiegel: »Neckermann – macht Flüchtlingsfrauen schön«. Dabei handelte es sich jedoch um »heim ins Reich« geholte Deutsche – Heimatvertriebene im Westen, Umsiedler im Osten genannt. Nach 89 gab es dann noch einmal einen deutschen Einwanderungsschub – von sogenannten Spätaussiedlern, auch »Rußlanddeutsche« genannt. Aus »Wiedergutmachungsgründen« wurden daneben auch jüdische Russen relativ freundlich aufgenommen. Das Kreuzberger »Refugee-Tribunal« gegen die »rassistische Politik der BRD«, mit einer Demonstration am Anfang und am Ende, hatte neben der Selbstorganisation der beteiligten Flüchtlinge, vor allem aus Afrika und Arabien, auch die Aufgabe, ein Umfeld von Sympathisanten zu schaffen.
Der 2003 verstorbene Exilpalästinenser Edward Said meinte: »Die Fackel der Befreiung ist von den seßhaften Kulturen an unbehauste, dezentrierte, exilische Energien weitergereicht worden, deren Inkarnation der Migrant ist.« Auch für den englischen Publizisten Neal Ascherson sind inzwischen die »Flüchtlinge, Gastarbeiter, Asylsucher und Obdachlosen zu Subjekten der Geschichte« geworden. Der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko zog daraus den Schluß: »Der Künstler muß als nomadischer Sophist in einer migranten Polis aufzutreten lernen – auf ihren neuen Agoren, den Plätzen, Märkten, Parks und Bahnhofshallen der großen Städte.« In Berlin geht es derzeit allerdings eher um Entmischung. Jürgen Kuttner sagte es vergangene Woche in der Volksbühne so: »Im Bötzow-Viertel des Prenzlauer Bergs, wo ich wohne, sehen alle genauso aus wie ich, und sind alle wahnsinnig ›Multikulti‹; gleichzeitig tun sie jedoch alles, um ein homogenes Mittelschichtsumfeld zu etablieren« – eine »moneygated community«.

Die Alliierten üben für ihre alljährliche Parade auf der Straße des 17.Juni. Jürgen und Emanuel müssen als Bürger der demilitarisierten Zone Westberlin nicht zum Bund, treiben sich aber gerne an den Amikasernen rum.

Ihr Vater, Georg „Schorse“ Zehpernick, hat die Pausenecke in seiner Firma am Hohenzollerndamm mit lauter Hundebildern beklebt.

Seine Frau, Gitti, und er haben seit einem Jahr zu Hause einen Dackel, dem sie schon so manches Kunststück beigebracht haben.
Survival of the Prettiest
Unter dieser Überschrift fand unlängst eine Konferenz des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte statt. Dieses „Survival“ war für Darwin neben der Natürlichen Selektion bei der Entwicklung der Arten wesentlich, es geschieht über die „sexuelle Selektion“. Der FU-Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hat ausgehend von Darwin in seinem Buch „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ eine neue Soziobiologie entworfen – indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. In der Zeitung „Die Welt“ hieß es dazu: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen.“
Laut dem Biologen Adolf Portmann brachte jedoch „vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen.“ Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend zu „rasch verallgemeinert“, wobei er „begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus“ (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann). „Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen,“ schreibt der Zrücher Tierpsychologe Heini Hediger. Ähnlich sieht es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter „ganz für sich allein balzen“. Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die „spektakulären Kämpfe“ der Männchen „harmlose Spiegelfechtereien“ und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: „Nicht einmal hinschauen tun sie.“ Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen.
Nun ist der Darwinismus laut Karl Marx bloß eine Projektion der schlechten Angewohnheiten der englischen Bourgeoisie auf die Natur, so dass man sich fragen darf, wie es denn unter diesen Menschen mit dem „Survival of the Prettiest“ aussieht. Bei ihnen geht es wie bei den wachtelähnlichen Laufhühnchen, auch Kampfwachteln genannt, zu: „Hier trägt das deutlich größere Weibchen ein Prachtkleid, balzt vor dem Männchen und treibt sogar Vielmännerei,“ wie der Tierbuchautor Herbert Wendt schreibt. „Das unscheinbar gefärbte Männchen hockt auf dem Boden und stößt leise, kläglich klingende Töne aus. Die Laufhenne aber rennt im Kreis um den Hahn herum, gurrt und brummt, pfeift und trommelt, trampelt und scharrt mit den Füßen, bis der Hahn ihren Werbungen nachgibt.“
Die Kulturwissenschaftlerin Ingelore Ebberfeld hat das in Discotheken und Clubs verifiziert. Ihre Buch „Blondinen bevorzugt“ handelt vom Balzverhalten der modernen Frau. Gerade wenn junge Frauen auf die Balz gehen – „und nichts anderes ist es, wenn sie in die Disco gehen“ – setzen sie ihre „Sahnestücke“ Busen, Beine und Po in Szene. Untersuchungen belegen, dass sie besonders viel Haut zeigen, wenn sie ihren Eisprung haben. Auch dieser Befund kommt reaktionär-soziobiologisch daher, er hat jedoch das Offensichtliche für sich. Historisch gesehen war es vor allem der bunt und prachtvoll gewandte Mann in Uniform, der sich von den Frauen anschmachten ließ. Mit der Technisierung des Krieges verlor der Soldat jedoch allen verführerische Charme. Er sieht heute in seiner Ausgehuniform genauso bescheuert aus wie der Zivilist auf der Straße und in den Clubs: Kein Arsch in der Hose, unrasiert, halbe Glatze und schlabbriges T-Shirt mit albernem Aufdruck; dazu meist noch unhöflich, laut, nach Bier stinkend und prahlerisch. Da die Frauen, als sie sich noch von farbenprächtigen, stolzen Kriegern beeindrucken ließen, meist scheu, zurückhaltend und keusch gewandet waren, kann man vielleicht sagen, dass sich dieses „Sexualsystem“ heute komplett umgedreht hat, aber es funktioniert noch nicht – bzw. erst dann, wenn „das unscheinbar gefärbte Männchen auf dem Boden hockt und leise, kläglich klingende Töne ausstößt“. Manch hellhörige Feministin will diese jetzt schon hinter dem angeberischen Gedröhne der Jungmänner ausgemacht haben.

Westberliner Promis, auf die man in der Familie Zehpernick besonders stolz ist: Hier Otto Sander mit Glühbirne.

Hier die Schlagersängerin Manuela mit den Beamten, die ihr im Finanzamt Wilmersdorf immer bei der Steuererklärung halfen, damals galten Steuerberater noch als überflüssiger Luxus. Zudem waren die Finanzbeamte im Gegensatz zu den „freien“ durchweg „unbelastet“.

Und hier das „Abendschau“-Team des SFB vor Ort – in der Schrebergartenkolonie „Heimgarten“, die erste, in der ein Bürger mit Migrationshintergrund Vereinsmitglied werden konnte.
Heimgärten
Während der Sohn, Gerichtspräsident Daniel Paul Schreber, mit seinen „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken und durch die Freud’sche Analyse seiner Paranoia berühmt wurde, ist sein Vater, Professor Daniel Gottlieb Moritz Schreber, wegen seiner Leipziger Grün- und Sportflächeninitiative für sozial benachteiligte Familien bekannt geworden. Daraus entwickelte sich um die Jahrhundertwende die „Schrebergarten-Bewegung“. In Wien sprach man von „Heimgärten“, was auf Peter Roseggers gleichnamige Literaturzeitschrift zurückging. Auch in Berlin gibt es seltsamerweise eine Kolonie „Heimgarten“: am Steglitzer Munsterdamm 53. Sie feierte im Sommer 2004 ihr 100-jähriges Jubiläum – mit dem „Heimgarten-Quartett“ und eigenen, von den chinesischen, jugoslawischen, türkischen sowie deutschen Kleingärtnern zubereiteten Spezialitäten.
Einer, der Kolonist Gerhard Niederstucke (Pfarrer i. R.), hat dazu rechtzeitig eine „Festschrift“ im Steglitzer Christian Simon Verlag veröffentlicht. Ihr kleiner „Garten Eden“ war wie das große Vorbild immer wieder bedroht: 1931 wurde ein Teil des Geländes planiert und es entstand dort eine „rauchfreie Siedlung“ (also Wohnungen, die nicht mehr mit Kohle und Holz, sondern mit Fernwärme vom Kraftwerk Teltow geheizt wurden). 1932 baten die verbliebenen 83 Vereinsmitglieder, die in ihrer Mehrheit arbeitslos geworden waren, das Bezirksamt, den Pachtzins von 6,5 Pfennig pro Quadratmeter auf 2 zu senken. 1934 wird ihnen eine Reduktion von 2,5 Pfennig bewilligt, gleichzeitig ist jedoch von einem „Stadtgruppenführer“ die Rede und dass die Laubenpieper fortan im „Reichsbund der Kleingärtner“ zusammengefasst sind. Wenig später will man aus der Kolonie „Heimgarten“ gar ein paramilitärisches „Ertüchtigungsgelände“ machen. Dieser Kelch ging jedoch an den Steglitzern – zusammen mit dem Dritten Reich – vorüber.
Ihre Selbstversorgungsanlage wurde zunächst – nach 1945 – sogar noch aufgewertet: mit Hühner- und Kaninchenställen, während des Ersten Weltkriegs hielt einer dort sogar eine Kuh. Aber 1972 beschließt das Bezirksamt den Bau eines Berufsbildungs-Oberstufenzentrums – und kündigt 64 Kleingärtnern ihre Parzellen – insgesamt eine Fläche von fast 40.000 Quadratmetern. Die verbliebenen 31 Mitglieder der Kolonie „Heimgarten“ verfügen danach nur noch über 8.780 Quadratmeter, wovon sie auch noch durch Abtrennung von Gartengelände acht gekündigten Mitgliedern neue Parzellen einrichten. Zwei der altruistischen Abtreter behalten sich aber bei einigen Obstbäumen bzw. -sträuchern ein „Mitpflückrecht“ vor: Man spricht deswegen in der Folgezeit vom „Helke-Apfel“ und von der „Hartlep-Brombeere“. Die Berufsfachschule wird wegen Asbestverseuchung schon Mitte der Achtzigerjahre wieder geschlossen und 1995 abgerissen. Dafür entsteht dort zusammen mit einem Sportplatz ein noch größeres Oberstufenzentrum für Farbtechnik und Raumgestaltung, dem die „Heimgarten-Kolonie“ als „Erweiterungsfläche“ dienen soll.
Dies kann jedoch der einst eher arbeiterlich und links orientierte Verein zusammen mit der Nachbarkolonie „Schutzverband“ (die von Beamten dominiert und einst „gleichgeschaltet“ war) verhindern. Zwei „Heimgärtner“ traten nach dem Krieg der SED bei, wovon der eine, Gartenfreund Skubisch – er war bis 1933 Vorsitzender der Steglitzer SPD gewesen -, regelmäßig Urlaub auf der Krim machte. Der Gartenfreund Tworoger war dagegen in der CDU, sowie Steglitzer Baustadtrat und Mitglied in der Jüdischen Gemeinde. Die Politik war und ist jedoch Privatsache bei den Laubenpiepern.
Deswegen kam es 1983 auch zu einem Konflikt, als der Sohn des Kolonisten Reiß die Parzelle in Abwesenheit seines Vaters zu einem „Friedensgarten“ umfunktionierte und dort Zusammenkünfte so genannter „Friedensfreunde – darunter Ausländer“ organisierte. Der Vereinsvorsitzende Hartleb wandte sich dieserhalb an seinen Steglitzer Bezirksverband sowie an die Rechtsabteilung des Landesverbandes der Kleingärtner. Letztere befand, dass solche Meinungsäußerungen auf den Parzellen gestattet sein müssten. Der Chronist Niederstucke merkt dazu an, die vom Studenten Reiß damals veranlasste Diskussion in der Parzelle 1a sei „eine der vielen tausend kleinen Beiträge dazu gewesen, dass die raketenbestückte Ost-West-Konfrontation nicht tödlich endete“. Seine Chronik schließt mit einer Vorstellung all der seitdem neu hinzugekommenen „Ausländer in der Steglitzer Kolonie Heimgarten“ – und einem großen Gruppenfoto in Farbe.

Diese vier Herren haben sich, als man ihnen ihre Schrebergärten wegnahm, wegen eines Krankenhausbaus, für einen Balkon in Alt-Mariendorf entschieden. Und sind nicht schlecht dabei gefahren – bis jetzt.
Amerika zeigen
Der sozialkritische US-Schriftsteller John Steinbeck unternahm 1960 zusammen mit seinem Pudel Charley eine Reise durch die USA in einem selbstgebauten kleinen Wohnmobil namens Rosinante. Er mied dabei die großen Städte und die Staaten des mittleren Westens. Sein Bericht darüber bekam den Titel: „Meine Reise mit Charley“, er wurde 1962 veröffentlicht und war ein großer Erfolg. Vier Monate nach Erscheinen des Reiseberichts bekam Steinbeck den Literaturnobelpreis verliehen. 50 Jahre später setzte der ebenso sozialkritische holländische Journalist Geert Mak sich auf Steinbecks Spur. Statt eines Hundes saß seine Frau Mietsie neben ihm auf dem Beifahrersitz ihres Mietwagens.. Sie las die Karten und war ihm überhaupt so etwas wie ein Kopilot. Mak bedankt sich im Anhang seines Buches „Amerika“ ausdrücklich bei ihr – der „angenehmsten Reisebegleiterin, die man sich wünschen kann“.
John Steinbeck hatte 1960 beschlossen, sich alleine mit seinem Wohnmobil auf den 10.000 Kilometer langen Weg zu machen, aber seine Frau, Elaine, bestand darauf, dass er wenigstens ihren Hund, Charley, als „Begleiter“ mitnahm. Zudem verabredeten sie sich an verschiedenen Orten, um dort ein paar Tage zusammen zu sein. Der berühmte Schriftsteller war alt geworden und gesundheitlich angeschlagen, seine Reiserecherche über die geistige Befindlichkeit des konsumistischen Nachkriegs-Amerika war genaugenommen sein letztes Buch. John Steinbeck starb 1968.
Geert Maks Buch „Amerika“ verfolgt einen ähnlich großen Plan; er hat als Journalist nicht nur immer wieder aus den USA berichtet, sondern auch eine Menge Literatur über das Land gelesen, die in die einzelnen Kapitel eingarbeitet wurde. Diese sind topographisch angeordnet – und folgen den Stationen in Steinbecks „Reise mit Charley“. Zugleich umfassen sie die Zeit etwa zwischen der Bostoner Tea Party (1773) und der heutigen „Tea-Party-Bewegung“, wobei jedoch der Raum, den Steinbeck durchmaß, von Mak zugunsten der Zeit eher knapp behandelt wird. Auch seine „Reisebegleiterin“ kommt darin nur in Form eines gelegentlichen „Wir“ vor, von „Charley“ ist dagegen etliche Male die Rede.
Ich erfuhr in dem Buch, dass derzeit ein wahrer „Laubbläserkrieg“ in den grünen amerikanischen Vororten tobt – mit Bürgerinitiativen gegen den Lärm, den diese Maschinen machen und ihren mexikanischen Bedienern, die um ihren Job fürchten. Auch in Berlin, vor allem in Pankow, droht gerade ein solcher „Laubbläserkrieg“.
In Maks „Amerika“-Buch erfuhr ich ferner ein Detail, das in der bisherigen Mediengeschichte wie mir schien glatt vergessen worden war – nämlich die Erfindung des „Stacheldrahttelefons“, mit dem die US-Farmer über die Einzäunung ihrer Weiden miteinander reden konnten – und zwar alle miteinander zur gleichen Zeit und das lange vor der Elektrifizierung ihrer Farmen. Mak stellte sich vor, wie die Stille in der Prärie durch das „gelegentliche Klingeln eines Stacheldrahttelefons“ unterbrochen wurde.
John Steinbeck wurde während des Vietnamkriegs zu einer Art „Kriegstreiber“, seine beiden Söhne kämpften derweil in Indochina, wobei der jüngere, John Junior, drogenabhängig und Pazifist wurde. Seine Autobiographie, die zu einer Abrechnung mit seinem Vater geriet, hat er in Anspielung auf dessen Bestseller „Jenseits von Eden“, der mit James Dean in der Hauptrolle verfilmt wurde, „Diesseits von Eden“ genannt. So heißt jetzt nebenbeibemerkt auch das neue Buch des hiesigen Schriftstellers Wladimir Kaminer, in dem es um das Dorf Glücklitz in Brandenburg geht, wo die Kaminers ein Haus am See haben.
Von den Anekdoten über Steinbecks Beifahrer – den Pudel „Charley“, die Geert Maks für sein „Amerika“ sammelte, ist die erste ein Zitat des Regisseurs Barnaby Conrad, der Steinbecks Kurzgeschichte „Flucht“ verfilmen wollte und dazu den Autor überredete, mit zu spielen. Conrad berichtete später, dass er ihn in San Francisco traf, in „Enrico’s Café“. Charly saß während ihres Gesprächs „aufrecht und brav in einem Eckchen daneben und wartete. ‚Sieh Dir den Hund an,‘ sagte Steinbeck. ‚Gestern in Muir Woods hat er sein Bein an einen Mammutbaum gehoben, der sieben Meter dick war, über 30 Meter hoch und bestimmt 1000 Jahre alt. Was bleibt dem Hund jetzt noch zu tun?'“
Eine andere Charley-Geschichte findet sich in Maks Abschnitt über Salinas Valley, dem Geburtsort von Steinbeck: Er „sah die Landschaft mit den Augen seiner Jugend und er berichtete Charley davon: ‚…genau dort unten in dem kleinen Tal da habe ich mit deinem Namensvetter, meinem Onkel Charly, Forellen geangelt. Und dort drüben – schau, wohin ich zeige – hat meine Mutter eine Wildkatze geschossen…Im Frühling, wenn das Tal mit einem Teppich aus blauen Lupinen bedeckt ist und wie ein Blumenmeer aussieht, dann hast du hier oben den Geruch des Himmels, Charley, den Geruch des Himmels.“
Weder Steinbeck noch Mak lassen sich darüber aus, ob der Hund diese Zeigefingergeste überstand verstand, die Steinbeck während der Fahrt immer wieder anwandte – Charley auf diese Weise fast das ganze Amerika zeigend…Man ist hierbei also auf andere Quellen angewiesen:
Der französische Humanethologe Boris Cyrulnik behauptet in seinem Buch über die „Entstehung von Sinn bei Mensch und Tier:“Was hält mein Hund von meinem Schrank?“ (1995), dass Hunde, ebenso wie Schimpansen, auf den Zeigefinder zugehen, mit dem man ihnen eigentlich einen Leckerbissen sonstwo zeigen wollte. Jagdhunde müssten lange dressiert werden, damit sie dieses „Fingersignal“ verstehen. Von Natur aus ist ihnen „nur die unmittelbare den Sinnesreizen nächste Bedeutung zugänglich“. In diesem Sinne könne man sagen, „dass die Schimpansen, eigentlich gesprochen, keinen Zeigefinger haben“. Das Menschenkind brauche eine ganze Weile, bis es die Zeigefinger-Geste seiner „Bezugspersonen“ versteht, es selbst zeigt zunächst mit der ganzen Hand auf etwas, dass es haben will, dann schreit es, weil es nicht dort hingelangt, und schließlich zeigt es mit dem Finger auf etwas, damit die Mutter oder der Vater es ihm holen. Das Kind schaut sie an, während es diese „Geste“ macht. Der Zeigefinger benötigt also ein soziales Umfeld, um als Hinweis verstanden zu werden. Im Umkehrschluß heißt das, dass die Haushunde und die in Gefangenschaft gehaltenen Affen, auf die sich Cyrulnik stützt, ein solches Umfeld nicht haben, sonst würden sie die „Zeigegeste der Menschen“ verstehen und sie gar selbst anwenden, jedenfalls die Affen, die ja uneigentlich sogar zwei Zeigefinger haben.
Die Verhaltensforschung hat inzwischen aber festgestellt, das die Haushunde fast als einzige Tiere nicht nur wissen, dass sie sich auf eine Stelle konzentrieren sollen, auf die ihre Herrchen mit dem Finger zeigen, es reicht ihnen bereits ein diskreter Blick als Hinweis. Auf „cosmiq.de“ wird diese Fähigkeit mit der Unfähigkeit der Katzen als „Nicht-Rudeltiere“ kontrastiert: „Die meisten Katzen verstehen Zeigegesten nicht, während das schon ziemlich früh jeder Hund versteht.“
Der Hund hat sich im Gegensatz zu den Affen „für den Menschen entschieden“, wie Daniel Kehlmann sagt – und versteht deswegen, anders als z.B. gefangen gehaltene Schimpansen, auch dessen subtilste Zeichensprache. Das Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropies hat das jüngst empirisch bewiesen, wie man so sagt. Nun kann man sich fragen, warum die Hunde von Boris Cyrulnik so wie Affen reagierten. Hatten die französischen bis hin zu seinem eigenen Hund keinen derartigen „Familienanschluß“ wie die von den Leipzigern 2009 getesteten? Und war ihnen deswegen die Zeigefinger-Geste fremd?
Bei den eingesperrten Schimpansen löst diese Geste mitunter sogar Aggressionen aus: Im Berliner Zoo biß einer namens „Pedro“ zuletzt dem Direktor einen Zeigefinger ab. Davor hatte ein anderer Berliner Schimpanse seinem „Dompteur“ in einer Affen-Auffangstation bei Hönow bereits den zweiten Finger abgebissen. Auch den Schimpansenforscherinnen Angelique Todd und Sue Savage-Rumbaugh wurde ihr Zeigefinger abgebissen. Man darf das aber vielleicht nicht so ernst nehmen – in einem taz-interview vom 1.6.2013 meinte die Schimpansenforscherin Jane Goodall auf die Frage, ob Schimpansenmütter ihre Kinder auch „physisch zurückweisen“ würden: „Normalerweise nehmen sie die Hand und beißen hinein. Nicht so, dass eine Wunde entsteht, aber dass es spürbar ist. Das ist eine ganz typische Bestrafung. Und es gibt Mütter, die das nicht können und die dann häufig verwöhnte Kinder haben.“
Zurück zu „Charley“ in „Amerika“: Er saß während der Fahrt die ganze Zeit neben John Steinbeck oder schlief mit dem Kopf auf dessen Schoß. Die Male, da Steinbecks Frau mitfuhr, saß er hinten. Einmal gab Steinbeck ihn für einige Zeit in einen Zwinger, was Charley tief deprimierte.
Im Tour-Abschnitt Salinas/Kalifornien zitiert Mak aus dem Interview eines alten Freundes von Steinbeck, der bis Flagstaff/Arizona mitfuhr: Charly saß zwischen ihnen. „Unterwegs mußten wir ständig anhalten, um Charley rauszulassen. Der rannte dann ein Stück in die Wüste, um dort seine Blase zu leeren…Und wir konnten uns auch nicht unterhalten. Der Wagen machte solch einen Krach, daß man kein einziges Wort verstand. Und Charley war auch noch da, John sagte etwas, und Charley antwortete mit einem Schmatzen…“
Als Steinbeck durch die Mojawe-Wüste steuerte, litt „vor allem Charley sehr schwer unter der Hitze. Er japste, als hätte er Fieber, sein Körper zuckte ‚und seine Zunge hing gut 20 Centimeter schlaff und tropfend heraus‘. Steinbeck hielt in einem schmalen Seitental an. Er gab dem Hund zu trinken und goss Wasser aus dem Tank über sich und Charley, um so für ein wenig Kühlung zu sorgen. Dann setzte er sich mit einer Dose Bier in Rosinantes Schatten.“
Ähnlich war es dann in Texas: „Texas wollte und wollte nicht enden, sie fuhren zügig durch, hielten nur zum Tanken an und um Charley sein Geschäft erledigen zu lassen. Sie schliefen kurz auf einem Parkplatz und fuhren dann weiter durch die eisige Nacht. In Beaumont, an der Grenze zu Louisiana, machte Steinbeck an einer Tankstelle halt. Der Tankwart, der mit frostig blauen Fingern den Tank füllte, betrachtete Charly und sagte lachend: ‚Hey, das ist ja ein Hund! Ich dachte schon, Sie hätten ’nen Nigger da drin‘. Steinbeck hörte diese Bemerkung danach noch mindestens zwanzigmal.“
Auf dem letzten Abschnitt in Richtung New York „hatte auch Charly offensichtlich genug. Er schlief, schaute nicht mehr aus dem Fenster hinaus und sagte kein einziges Mal mehr ‚Ftt'“ – was sonst wohl sein gängiger Kommentar gewesen war. In einem alten Jahrgang des Magazins „Holiday“ fand Mak ein ganzseitiges Foto von John Steinbeck mit Charly – kurz nach der Reise aufgenommen: „Der Pudel macht einen munteren Eindruck, aber wie alt sieht Steinbeck plötzlich aus!“
Der erholte sich jedoch, zurück in seinem „Home“ und bei seiner Frau, bald wieder, während Charley „nach seiner großen Amerikaexpedition immer mehr Probleme mit den Gelenken bekam, zudem plagten ihn Altersbeschwerden. Er starb im April 1963 in Sag Harbor in Leberzirrhose, einer Krankheit, die – wie Steinbeck einem Bekannten schrieb – in der Regel auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen ist, ‚Aber Charley hat nicht getrunken, und wenn er es tat, hat er es gut verborgen.“
P.S.: Fragmente einer weiteren Hunde-Biographie fand ich dieser Tage in dem Sammelband mit Artikeln aus 30 „Dummy“-Magazinen: „Ein feiner Kerl“ – über den Berliner Ex-Strassenhund Peter Fink.

Aus meiner Sammlung „Zeigen“ (mit dem Finger auf etwas, früher „Männer zeigen Frauen etwas“ genannt). Hier verleiht der arbeitslose Hans-Werner Almstedt an der Theke gegenüber dem Tischlerlehrling Mark Pintsch seinen Worten, der sei doch auch so ein verdammter „Langhaariger“ schon bald, mit seinem Zeigefinger Nachdruck.

Und hier zeigt der Künstler Michael Bause auf ein flachgelegtes Kunstwerk. In der Galerie oqbo, Brunnenstraße, an der er beteiligt ist, las ich neulich folgenden Text vor:
Die Schönen Künste bei den Tieren
Im Sommer 2012 lud die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften auf dem Alten Markt in Potsdam zu einer öffentlichen Diskussion über Kunst und Wissenschaft – am Beispiel des Schleimpilzes „Neurospora crassa“, der sich währenddessen dort in einem gläsernen Pavillon in etwa 30 Petrischalen munter vermehrte – und dabei von weißen Pünktchen langsam über gelb-orange in schwarze Bänder überging.
Dieser eukariotische Einzeller ist weder Pflanze noch Tier und hat eine kosmopolitische Verbreitung. Er wird weltweit als Modellorganismus beforscht und hat zwei unterschiedliche „Generationszyklen“, d.h. er kann sich sowohl durch Sporen über die Luft als auch durch geschlechtliche Kreuzung vermehren. 1958 erhielten zwei Genetiker für ihre Forschung mit ihm, die in der Formel „Ein-Gen-ein-Enzym“ gipfelte, den Nobelpreis. „The Revolutionary Neurospora crassa“ ist aber nicht nur ein „Almighty Fungi“, sondern auch ein Zwangscharakter, da er exakt alle 24 Stunden eine neue Generation von (schwarzen) Sporen produziert. Auf eine Verschiebung der Zeitzone reagiert er gleich uns mit einem „Jetlag“, wie norwegische Chronobiologen herausfanden.
Die Berlin-Brandenburgische Akademie und die Berliner Akademie der Künste hatten zwar für ihre Potsdamer „ArtFakt“-Diskussion, die in einem sogenannten „Syntopischen Salon“ stattfand, eine Künstlerin – Michaela Rotsch – eingeladen, die sich in Form von „Installationen“ mit dem Schleimpilz beschäftigt; dazu war auch noch ein bayrischer Systembiologe angereist… Ihr beider Gespräch drehte sich dann aber weniger um Neurospora crassa: Was man zu welchem behufe alles mit ihm anstellt und was er möglicherweise davon hält – sondern eher um „zentrale Fragen“ von Wissenschaft und Kunst: Identität, Komplementarität, Kombinatorik, Umriß, Zwischenraum etc…. Als das Publikum beim Begriff der Identität zu sehr ins menscheln kam, intervenierte eine Physikerin mit dem „Satz der Identität in der Logik – A gleich A: Da raus zu kommen,“ das sei doch „die wirkliche Aufgabe der Kunst.“ Eine Literaturwissenschaftlerin warf lächelnd leise ein: „…Ja, diese Begriffe…“ Ihr Mann, ein Kunsthistoriker, der das letzte Wort hatte, behauptete dagegen laut: „Pilze waren immer schon sehr nachdenkliche Leute.“
Es handelt sich bei den Schleimpilzen aber gar nicht um Pilze, sondern um eine – wie der Kulturwissenschaftler Peter Berz sie nennt, „merkwürdige Klasse von Amöben“. Dazu berichtete er – auf einer Konferenz des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte zum Thema: „Survival of the Prettiest? Evolution, Kunst und Ästhetik nach Darwin“, dass diese Schleimpilze bei Trockenheit oder Nahrungsmangel ihr einzelliges, peudopodisches (d.h. scheinfüßiges) Dasein verlassen, aufeinander zustreben und sich vereinigen – zu einem stilförmigen Sporangium (Fruchtkörper), in dem viele Zellen absterben und einige sich zu Sporen umentwickeln, die beim Aufplatzen des Fruchtkörpers austreten. Mit ihnen beginnt dann ein „neuer Zyklus einzellig lebender Amöben.“
Sie nehmen dabei „verschiedene Färbungen“ an, als Furchtkörper hatten sie jedoch eine ganz bestimmte Farbe – mal braun, mal blau, mal gelb. Diese „Farbe ist ein wesentliches Merkmal zur Bestimmung einer Art.“ Peter Berz stellte sich daraufhin die Frage: Warum solch eine „Farbenpracht“ – die doch gar keinen Adressaten hat? Und kam von da aus auf das Konferenzthema – die Theorie der Sexuellen Selektion – zurück: The Survival of the Prettiest, die für Darwin neben der Natürlichen Selektion für die Entwicklung der Arten wesentlich ist. Als prägnantestes Beispiel für diese Theorie galt ihm das Gefieder des männlichen Argusfasans und des Pfaus, die damit den eher unscheinbaren Weibchen gefallen wollen. Diese wählen dann die möglichst prächtigsten Männchen zur Fortpflanzung aus. Solch ein „Survival of the Prettiest“ steht damit im Dienste des „Survival of the Fittest“, wozu die langen Schwanzfedern allerdings eher hinderlich sind, weil sie das Auffliegen im Falle einer Gefahr erschweren.
Zurück zur Farbenpracht der Schleimpilze, die damit allerdings – im Gegensatz zu den e.e. männlichen Vögeln – niemanden beeindrucken wollen. Der Basler Biologe Adolf Portmann hat ihre Färbung deswegen als „funktionslos“ bezeichnet. Das Erscheinen der Schleimpilze „in Farbe und Gestalt“ habe nur einen Sinn: Es ist reine „Selbstdarstellung der Art“, ohne den Zweck der Art- und Selbsterhaltung. Man finde es „vielgestaltig auch bei allen höheren Lebensformen“.
Der ebenfalls auf der MPI-Konferenz referierende Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus hat ausgehend von Darwin in seinen zwei Büchern „Das Versprechen der Schönheit“ und „Wozu Kunst?Ästhetik nach Darwin“ eine neue Soziobiologie entworfen – indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. In der Zeitung „Die Welt“ hieß es dazu: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren.“
Was es mit diesem griechischen Sexualkrieg auf sich hat, erklärte der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler der Zeitschrift „Cicero“: „Vergleichen Sie zum Beispiel die verschiedenen Reaktionen auf Helena. – Helena, die schönste aller Frauen, deren Entführung den Trojanischen Krieg auslöste. Bei Homer, im dritten Gesang der ‚Ilias‘, sagen die alten Trojaner: Wir sollten Helena, das Miststück, dem Menelaos, ihrem Mann, zurückgeben, dann hätten wir Frieden und keinen Krieg mehr. Dann kommt sie. Und die Greise sehen Helena und sagen: Nein, so unsterblich schön, gegen eine solche Frau kann man nichts sagen. Euripides sagt in 19 Stücken, Helena ist eine Hure, und in einem Stück sagt er, sie ist eine treue Ehefrau. Und Horaz schreibt in den ‚Satiren‘: Schon lange vor Helena waren Fotzen – wörtlich: cunnus – der stinkendste Kriegsgrund. Also drei Sexualmoralen zu drei Zeiten, von denen die eine sich vor der Schönheit beugt, die zweite die Schönheit als Zügellosigkeit schlechtmacht, und die dritte im Schönen das Stinkende wahrnimmt, also das Obszöne.“
Kittlers Thema ist ebenfalls Kunst und Sexualität – in seinem unvollendeten Monumentalwerk „Musik und Mathematik“, wobei letzteres sowie die Oktave und die Gitarre zusammen mit dem Vokalalphabet von den Griechen quasi erfunden wurden: „Ohne Götter, die miteinander schlafen, gäb es keine Sterblichen, ohne Eltern, die miteinander Liebe machten, keines von uns Kindern. So bleiben einzig Dank und Wiederholung. Nichts anderes heisst Griechen, solang sie dichten, Mimesis, Tanz als Nachvollzug der Götter.“ Auch beim Geschlechtsverkehr ahmen wir laut Kittler die Götter nach. Er erwähnt dazu gerne ein Lied seines Lieblingsmusikers Jimmy Hendrix: „And the Gods made love“. Die Popstars haben uns seiner Meinung nach die Götter wiedergebracht. Dazu berichtet er von einem Popkonzert in Kopenhagen, wo ein Junge seine Freundin anschließend Backstage zum Sänger brachte: „Der hat die Nacht mit ihr verbracht und am nächsten Tag ging die Liebe zwischen dem Mädchen und ihrem Freund weiter.“ Eine ganz ähnliche Geschichte passierte 1986 der DDR-Punkband „Freygang“ nach einem Konzert in Bitterfeld. Für Kittler sind das Beispiele „einer uneifersüchtigen Variante des Amphytrion-Stoffes, so wie auch Amphytrion nicht ernsthaft zu Alkmene sagen kann: ‚Ich verbiete dir, mit Zeus zu schlafen!’“
Hier stellt sich aber die Frage: Haben auch die Tiere Götter – oder gar einen Gott?Angeblich soll der französische Kardinal Melchior de Polignac zu dem im Jardin du Roi erstmalig gezeigten Orang-Utan gesagt haben: „Sprich – und ich taufe Dich!“ Der Affe blieb jedoch stumm – und ungetauft! Die Kunsthistorikerin Jessica Ulrich, Herausgeberin der neuen Berliner Zeitschrift „Tierstudien“, meint, über die Rezeption von Kunst oder Musik durch Tiere gibt es bisher nur vereinzelte Forschung, „zum Beispiel darüber, wie Bienen auf Van Goghs Gemälde reagieren oder wie Tauben impressionistische Gemälde unterscheiden und kategorisieren können.“ Sie ist jedoch davon überzeugt, „dass Tiere ästhetisches Empfinden haben. Das ist natürlich nur in den seltensten Fällen auf menschliche Kunstwerke bezogen. Wieso sollte es auch? Ich hab zum Beispiel Paviane in Südafrika beobachtet, die jeden Abend gemeinsam schweigend auf Bäumen gesessen haben und den Sonnenuntergang über einem Fluss betrachtet haben. Keine Ahnung, was ihnen dabei durch den Kopf ging. Vielleicht hatten sie ein Gefühl der Erhabenheit, das auch bei uns aufkommt, wenn wir ein großartiges Kunst- oder Naturschauspiel sehen, oder sie fanden es einfach schön. Gerade im Bereich der Musik geschieht aber mittlerweile viel. David Rothenberg, ein amerikanischer Philosoph und Komponist, spielt beispielsweise Walen und Vögeln auf der Klarinette vor und schafft es teilweise sogar, dass sie mit ihm musizieren.“
Hinzugefügt sei, dass man nicht nur immer mehr Menschenaffen zum Malen von Bildern animiert, sondern ihnen inzwischen auch zur besseren Verständigung die Gebärdensprache von Taubstummen beibringt. Einige Tiere lernten damit bis zu 300 Wörter und konnten damit ganze Sätze bilden. Berühmt wurde mit dieser Fähigkeit das 1965 in Westafrika geborene Schimpansenweibchen „Washoe“. Sie starb 2007 in Ellensburg/USA. In einem Nachruf des Gehörlosenforums „my-deaf-com“ heißt es: „Der einzige lebende Affe zur Zeit, der noch die Gebärdensprache beherrscht, ist die Gorilladame ‚Koko‘. Sie lernte an der Stanford University angeblich mit über 1.000 Zeichen der American Sign Language zu kommunizieren und später annähernd 2.000 englische Wörter zu verstehen.“ Daneben malt Koko auch gerne Bilder.
Washoes Sprachlehrer Roger Fouts hatte 1981 für sie und ihre Familie ein eigenes Institut mit Freigehege gebaut. Dazu sammelte er weltweit Spenden ein. „Auch die Schimpansen trugen ihren Teil bei: Washoe, Dar, Tatu und Moja lieferten Bilder für eine Ausstellung, die unter dem Titel ‚Schimpressionistische Werke von Washoe und Freunden‘ in einem Café in Ellensburg stattfand,“ schreibt er in seinem sehr lesenswerten Buch „Unsere nächsten Verwandten. Von Schimpansen lernen, was es heißt, ein Mensch zu sein“ Weiter heißt es dort: „Zwar sind Zeichnen und Malen unseres Wissens kein Teil der natürlichen Schimpansenkultur, doch in menschlicher Gesellschaft entwickeln sich Schimpansen zu wahren Kunstfreaks.
Jeder Schimpanse hat seinen ganz eigenen Stil: Washoe zum Beispiel malt leuchtende, schwungvolle Bilder mit Titeln wie ‚Elektrisch Heisses Rot‘ (Die Schimpansen betiteln ihrer Bilder selbst.) Moja hingegen ist der erste Nichtmensch, der gegenständlich malt: Ihr Lieblingsthema sind Vögel. (Es ist zwar sehr gut möglich, dass schon andere Schimpansen vor Moja gegenständlich malten, aber das läßt sich nicht beweisen, denn ihnen fehlten die Gebärden, um ihre Bilder zu betiteln.) Tatu nimmt ihre Kunst sehr ernst und legt kein Bild aus der Hand, ehe es vollendet ist, nicht einmal, wenn es Essen gibt. Ihre Werke zeigen ein hervorragendes Gespür für Farben und Kompositionen. Dar wiederum ist ein sehr temperamentvoller Künstler. Seine Bilder sind straff und dynamisch, aber wenn er das Interesse verliert, fängt er an, die Farben zu essen – ein künstlerischer Fauxpas, der seine Schwestern in Rage versetzt.“
Der Psychoanalytiker Jeffrey Masson, der in seinem Buch „Wenn Tiere weinen“ einige Bilder von Affen und Elefanten abdruckte, merkte zu den von Washoe und Moja gemalten Objekten an: „Blumen wurden als strahlenförmige Muster, Vögel als ‚zugespitzte Bewegung‘ wiedergegeben.“ Als Moja einen Basketball zeichnete, meinte Roger Fouts zunächst, dass ihr das völlig mißlungen sei, aber als sie diese Zeichnung mehrmals wiederholte, wurde ihm klar, „dass sie nicht der Form, sondern der Bewegung des Balles gelten könnte.“ Auch kleine Kinder fertigen manchmal laut Masson „kinästhetische Zeichnungen dieser Art“ an.
Von Washoe weiß man, dass sie auch gelegentlich anders dachte bzw. kombinierte: Als Vierjährige irrte sie sich z.B. öfter, wenn sie statt Gegenstände oder Photos von ihnen nur Kopien bekam, die sie benennen sollte: Auto, Hund, Kuh – alles war Baby. Weil jede „Kopie en miniature“ „Baby“ für sie war, was Roger Fouts so interpretierte: „Anscheinend kümmerte sich Washoe weniger um den Namen des Gegenstands als um die Tatsache, dass er klein war…Dahinter stand eine offenkundige Logik, zumal aus ihrer Kleinkindperspektive.“ Interessant waren auch ihre Fehler beim Zuordnen: Wenn sie z. B. „einen Kamm als Bürste, eine Nuß als Beere und einen Hund als Kuh bezeichnete. Sie irrte sich dabei immer nur innerhalb einer Kategorie, was zeigte, dass sie einen Sinn für Klassifikationen hatte. Nach Ansicht der Linguisten ist die Fähigkeit, Objekte in Symbole zu verwandeln und sie in Gedanken typologisch zu ordnen wie Gegenstände in Fächer, eines der wesentlichen Kriterien zur Unterscheidung der menschlichen Sprache von anderen tierischen Kommunikationsformen.“
In seinem Buch „Wie Tiere fühlen“ thematisierte der Biologe Donald Griffin das Problem der gedanklichen Verbindung eines Gegenstands mit einer Gebärde ebenfalls am Beispiel von Washoe. Sie hatte das Wort „Blume“ gelernt, benutzte es aber auch für Pfeifentabak und Küchendunst: „Sie mag also mehr an Gerüche gedacht haben, wenn sie es gebrauchte, als an die optischen Eigenheiten bunter Blumen, aber sie hat sicher an etwas gedacht, das wenigstens teilweise mit den Eigenheiten übereinstimmt, die das Wort Blume für uns hat.“ Anmerkung: Bei Hunden geht man inzwischen davon aus, dass sich ihr „Weltbild“, falsches Wort, noch viel entscheidender als bei den Primaten aus Gerüchen zusammensetzt.
Von den malenden bzw. zeichnenden Elefanten erwähnt Jeffrey M. Masson in seinem o.e. Buch die junge indische Elefantenkuh Siri, der ihr Pfleger eines Tages Stift und Zeichenblock gab (den er auf seinem Schoß hielt). Ihre Bilder wurden von Beobachtern als „lyrisch, energisch und schön“ beschrieben. Das Künstlerehepaar de Kooning meinte: „Das ist aber ein verdammt talentierter Elefant“. Ein anderes indisches Elefantenweibchen, Carol, malt im Zoo von San Diego auf Befehl ihres Pflegers – er gibt ihr Pinsel, Farben und Leinwand und dreht diese hin und her, damit die Pinselstriche nicht alle in die selbe Richtung gehen. Carol ist mit ihrer Malerei auf Befehl eine Besucherattraktion. Zur Belohnung bekommt sie nach jedem Bild einige Äpfel. Und dann gibt es da noch Ruby, eine indische Elefantenkuh im Zoo von Phoenix: „Sie liebt das Malen und gerät schon in Erregung, wenn sie nur das Wort hört. Blau und Rot sind mit Abstand ihre Lieblingsfarben.“ Aber als ein orangelackiertes Auto in ihrer Nähe parkte, griff sie zur Farbe Orange. Und als zwei Leute in blauen Anzügen eilig an ihrem Gehege vorbeiliefen, malte Ruby einen blauen Klecks, der von einem roten Farbwirbel umgeben war. Ihr Pfleger meint, weil die Afrikanischen Elefanten, die mit Ruby das Gehege teilen, sie um die Aufmerksamkeit, die sie auf sich zieht, beneiden, hätten sie angefangen, „mit Hilfe von Holzstückchen auffällige Zeichnungen auf die Wände zu malen.“
Zurück zu Darwins Theorie der Sexuellen Selektion und zu dem, was der FU-Professor Winfried Menninghaus daraus machte. In einer Rezension schrieb die niederländische Medienphilosophin Barbara Kuon: Zwar gestehe Darwin zu, „dass die Künste im Verlauf der Evolution ihre Funktion als Waffe im Feld der sexuellen Konkurrenz verloren haben. Gänzlich ist das Sexuelle aus ihnen aber nie verschwunden: wenn ein Kunstwerk, vor allem ein Gedicht oder ein Musikstück, zu berühren vermag, so liegt dies daran, dass es mit seinem Rhythmus und seiner Melodie vererbten Spuren einer archaischen sexuellen Protomusik im Rezipienten zur Resonanz verhilft. Es bewirkt eine ‚Rückversetzung in Gefühle und Gedanken einer längst vergangenen Zeit‘, und zwar ohne, dass der Künstler dies beabsichtigt hat. Es passiert einfach, die Natur, das genetische Erbe wirkt durch den Künstler – so wie nach Kant die Natur dem Genie die Regel gibt. In jedem Musikstück, aber auch in jedem Sprachwerk, in jedem Gedicht, in jeder Rede erklingt für uns ein Echo des – irgendwie genetisch transferierten – singing-for-sex unserer archaischen Vorfahren, mal leiser, mal lauter, mal manifest, mal latent. Und in jeder dieser Botschaften aus der Urzeit erklingt zugleich die Botschaft Darwins als des Botschafters dieser Botschaft…Menninghaus übernimmt nun Darwins These vom Verlust der sexuellen Funktion der Künste und bemüht sich im Weiteren zu erklären, wie es zu diesem Verlust gekommen ist: der Verlauf der natürlichen Evolution wurde durch das plötzliche (und für Darwin wie für Menninghaus letztlich unerklärbare) Einsetzen einer kulturellen Evolution unterbrochen. Es ist der (unerklärbare) Einbruch von Künstlichkeit ins Reich der Natur, deren Agent der Mensch ist.“
An diesem „Einbruch“ forschten u.a. japanische Primatenforscher und der südafrikanische Pavianforscher Eugène Marais. Für Marais lösen sich die Arten, die höheren – bis hin zu den Primaten – mehr als die niederen, aus ihrem Instinkt, ihrem Festgestelltsein, und entwickeln dabei die Fähigkeit, auf sich verändernde Umwelteinflüsse reagieren zu können. Marais spricht von einem „phylogenetischen Gedächtnis“, das von einem „individuellen Gedächtnis“ zurückgedrängt wird, nur das letztere kann Erfahrungen sinnvoll verarbeiten. Die japanischen Affenforscher nennen es ein „vorkulturelles Verhalten“.
Peter Berz geht es, ausgehend von den Farben der Schleimpilz-Furchtkörper und dem Federkleid des Pfau bzw. des Argusfasans, darum, die andere Seite beim Survival of the Prettiest stark zu machen: Also nicht die des wählenden Weibchens, sondern die des „Zu-sehen-Gebenden“, des Männchens – als Produzent der Farbenpracht. Denn: „Die gewählte Seite muß ja etwas anbieten, sozusagen einen ästhetischen Vorschlag machen.“ An Darwin kritisiert er, dass dessen „Natürliche“ und „Sexuelle Selektion“ nur eine „’negative‘ Macht“ darstellen, keine produzierende: „Der Produzent als ästhetische Instanz ist in der Sexuellen Selektion strukturell ausgehebelt.“ Zunächst auch die „Kunst“, die dann aber von Darwin irgendwie doch wieder reingeholt wird.
Das sei in den morphologischen Biologien, im Gegensatz zum (neodarwinistischen) Evolutionsdenken, anders. Z.B. beim französischen Biologen Paul Vignon, den Berz zitiert. Vignon hat die Mimikry (Nachahmung zwecks Abschreckung) – u.a. von Laubheuschrecken erforscht und dabei genau nachgezeichnet, wo sich die Heuschrecken von ihrem Vorbild lösen und selbständige Formen entwerfen – bis er ihnen schließlich „une mission d’art ou de science“ zuschrieb. Diese Mission, die sich auch anderswo findet (bei allokryptischen Krebsen, Gottesanbeterinnen, Buckelzikaden und Laternenkäfern z.B.), hat laut Vignon in den Laubheuschrecken ihre vornehmsten Botschafter. Er nennt sie „Heuschrecken der Kunst“. Der französische Biologe argumentiert hierbei ähnlich wie der Soziologe Roger Caillois, der sich ebenfalls mit der Mimese befaßte. In seinem Buch „Méduse & Cie“ hat er sie von ihrer darwinistischen Verklammerung mit der „Nützlichkeit“ gelöst – und sie als ästhetische Praxis begriffen: So versteht er z.B. die falschen Augen auf den Flügeln von Schmetterlingen und Käfern als „magische Praktiken“, die abschrecken und Furcht erregen sollen – genauso wie die „Masken“ der so genannten Primitiven. Und die Mimese überhaupt als tierisches Pendant zur menschlichen Mode, die man ebenfalls als eine „Maske“ bezeichnen könnte – die jedoch eher anziehend als abschreckend wirken soll. Wobei das Übernehmen einer Mode „auf eine undurchsichtige Ansteckung gründet“ und sowohl das Verschwinden-Wollen (in der Masse) als auch den Wunsch, darin aufzufallen, beinhaltet. So oder so stellt es einen Überschuß der Natur dar. Ein Rezensent schrieb: „In der [Darwinschen] Verabsolutierung des Nutzens, so Caillois, zeige sich eine tiefwurzelnde Voreingenommenheit. Gegen ein solches ‚Vorurteil‘ tritt der Autor mit seiner These an, dass die Formen und Verhaltensweisen der Insekten genauso wie bestimmte ästhetische Vorlieben und Faszinierbarkeiten der Menschen sich auf eine gemeinsame Basis zurückführen lassen: auf den Formenvorrat einer bildnerischen Natur, deren spielerisch zweckfreies Wirken sich im Naturreich ebenso niederschlägt wie in der vom Naturzwang freigesetzten Sphäre menschlicher Imagination.“
Caillois erwähnte dazu unter den Insekten die Coleopteren, die Lepidopteren und die Orthopteren: „Sie wetteifern regelrecht miteinander, sich die unvermeidliche Gestalt und Lebensart anzueignen.“ Er nennt diese Form der Mimese auch „Travestie“ (Verkleidungskunst): „Wenn es gilt, wie eine Wespe auszusehen, werden die Flügel transparent; der Hinterleib ist mit dem Vorderleib nur mehr durch einen winzigen Stiel verbunden, er ist schwarz-gelb geringelt; der Flug ist laut und lebhaft, das Gebahren drohend. Die falsche Wespe schauspielert“
Peter Berz fand beim Schmetterlingsforscher Wladimir Nabokow ein weiteres schönes Beispiel – die Raupe des Buchenspinners (Stauropus fagi): „Bei Gefahr imitiert sie mit ihrem ganzen Körper, ihren Füssen und Fortsätzen nicht nur eine Spinne, sondern eine ganze Szene: nämlich eine Raupe, die von einer Spinne angefallen wird.“ Für Berz, der den russischen Dichter Ossip Mandelstam besonders schätzt („Ich habe mein Schach vom Literarischen auf das Biologische verlegt, damit das Spiel ehrlicher werde.“), stellt sich dabei das Problem: „Muß man nicht die Frage nach dem Adressaten viel fundamentaler und vielschichtiger in das Wissen von der Evolution und die Geschichte des Wissens von der Evolution einführen als dies die Theorie der Sexuellen Selektion möglich macht?“ Denn Darwin stellte sich ja selbst schon die Frage – etwa bei der Erscheinung des Argusfasans: Können alle „diese außerordentlichen Stellungen, welche das Männchen während des Aktes der Bewerbung annimmt und durch welche die wunderbare Schönheit seines Gefieders vollständig zur Entfaltung kommt, zwecklos sein?“ Er beantwortete sie jedoch immer wieder im gleichen Sinne: Sie können nicht zwecklos sein!
Als Tierbeobachter sieht Darwin aber auch noch etwas anderes: „Es ist nichts häufiger als daß Thiere darin Vergnügen finden, irgendwelchen Instinct auch zu anderen Zeiten auszuüben als zu denen, wo er ihnen von wirklichem Nutzen ist. Wie oft sehen wir Vögel leicht hinfliegen, durch die Luft gleitend und segelnd, und offenbar nur zum Vergnügen.“ Aber das wird bei Darwin „weder Theorie noch Evolution. Es ist sozusagen Freizeitbeschäftigung von Tieren und Evolutionstheoretikern. (Evolution ist Arbeit.)“ Berz folgt deswegen lieber der amerikanischen Mikrobiologin Lynn Margulis, die in ihrem Buch „Geheimnis und Ritual. Die Evolution der menschlichen Sexualität“ mußtmaßte: „Vielleicht ist das ganze Universum nichts als ein Tanz des Organischen, ein Spiel der Erscheinungen, hinter denen sich nur weitere Erscheinungen verbergen, das kosmische Äquivalent eines Maskenballs…“
Eine ganz andere Kritik an der Darwinschen Theorie der Sexuellen Selektion, eine, die empirisch ins Detail geht, formulierte der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger in seinem Buch „Tiere verstehen“. Dabei berief er sich u.a. ebenfalls auf den Zoologen Adolf Portmann, der sich als Gestalttheoretiker wie kein anderer mit dem Pfau beschäftigte. Ihm zufolge „wurde die Darwinsche Meinung von der ästhetischen Beurteilung des männlichen Prunkgefieders durch die Weibchen schon vor 1930 selbst von den Darwinisten fallen gelassen;“ denn laut Portmann brachte „vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen.“ Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend zu „rasch verallgemeinert“, wobei er „begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus“ (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann). „Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen,“ schreibt Heini Hediger. Ähnlich sieht es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter „ganz für sich allein balzen“.
Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die „spektakulären Kämpfe“ der Männchen „harmlose Spiegelfechtereien“ und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: „Nicht einmal hinschauen tun sie.“ Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen. Ein anderer Ornithologe, J.G. Van Rhijn, stellte später fest, dass der unterlegene Kampfläufer oftmals der Besitzer des Reviers ist, in dem die Kämpfe stattfinden. Er holt die anderen Männchen quasi zu sich, damit die Anwesenheit vieler die Weibchen anlockt, die er dann nach den Kämpfen begattet.
Bei den „pantomimischen Kampftänzen“ der amerikanischen Präriehühner, die der Kieler Zoologe Adolf Remane erforschte, ist es ähnlich: Die Männchen tanzen umeinander, die Weibchen erscheinen nur „hin und wieder auf dem Tanzplatz. Sie werden sozusagen en passant begattet, ohne dass sich die Hähne dadurch in ihrem Massenritual sonderlich stören ließen.“
Daneben gilt auch für den Gesang der männlichen Singvögel, dass sie damit nicht den Weibchen imponieren wollen , sondern ihr Revier markieren – es sind „kriegerische Lieder,“ wie der Tierbuchautor Herbert Wendt das in seinem Buch „Das Liebesleben in der Tierwelt“ nennt. Kommt noch hinzu: „Eine Zeitlang glaubten die Zoologen, die Tätigkeit der männlichen Hormondrüsen veranlasse das Vogelmännchen, sich zur Hochzeit so prächtig zu schmücken. Heute nehmen wir an, dass es genau umgekehrt ist. Das männliche Prachtgewand ist das Normalkleid des Vogels [also für beide Geschlechter]; die weiblichen Geschlechtshormone dagegen sind es, die dafür sorgen, dass die Vogelweibchen zur Brutzeit unscheinbarer aussehen als ihre Partner. Denn die Mütter müssen beim Brüten und bei der Kinderpflege eine unauffällige Schutzfärbung tragen.“
Bei den wachtelähnlichen Laufhühnchen, auch Kampfwachteln genannt, ist es jedoch umgekehrt: „Hier trägt das deutlich größere Weibchen ein Prachtkleid, balzt vor dem Männchen und treibt sogar Vielmännerei,“ wie Herbert Wendt schreibt. „Das unscheinbar gefärbte Männchen hockt auf dem Boden und stößt leise, kläglich klingende Töne aus. Die Laufhenne aber rennt im Kreis um den Hahn herum, gurrt und brummt, pfeift und trommelt, trampelt und scharrt mit den Füßen, bis der Hahn ihren Werbungen nachgibt. Nach der Begattung legt sie mehrere Eier in eine Bodenmulde und überläßt dem Männchen das Brüten und die weitere Pflege der Kinder. Während der Hahn auf dem Gelege sitzt, tanzt sie längst um ein weiteres Männchen herum. Eine einzige Laufhenne kann auf diese Weise drei bis vier Männer nacheinander gewinnen und ebensoviele Nester anlegen.“
Schließlich seien hier noch die in Neuguinea und Australien lebenden Laubenvögel erwähnt, die sich etwas ganz besonderes ausgedacht haben, „was sonst nur der Mensch vermag,“ wie Herbert Wendt sagt. Die Männchen bauen auf einer freigemachten Fläche eine kunstvolle Laube, eine Art Tunnel, der mit farbigem Moos oder schönen Kieseln ausgelegt und mit Grashalmen oder Laub tapeziert wird. Dann wird ein Stöckchen zu einem Pinsel umgearbeitet, mit dem sie den blauen Saft einer zerquetschten Beere im Innenraum verstreichen. Anschließend legen sie um die Laube herum so etwas wie ein großes Mosaik an – bestehend aus „Schneckenschalen, Käferflügeln, Papageienfedern, Blättern, bunten Samenkörnern und Blüten, die sie austauschen, wenn sie verwelken; in neuerer Zeit verwenden sie daneben auch Glasscherben, Papierschnitzel und andere Hinterlassenschaften der menschlichen Zivilisation“ für ihr Kunstwerk, bei dem die blauen Laubenvögel-Männchen die Farbe blau bevorzugen. Ständig sind sie am verbessern und ergänzen, gelegentlich werden ihnen, während sie auf der Suche nach neuen Gegenständen sind, auch Teile daraus von anderen Männchen geklaut. „Jede der 19 Arten hat einen anderen Geschmack,“ schreibt Herbert Wendt. Die Weibchen fliegen von einem Mosaik zum anderen und begutachten die Kunst der Männchen. Sind sie von einem überzeugt, gehen sie in die dazugehörige Laube, wo das Männchen sie begattet. Danach fliegen sie wieder weg und bauen sich ein Nest, wo sie dann alleine die Jungen ausbrüten und aufziehen.
Damit sind wir nun beim eigentlichen Thema angelangt: den malenden Tieren. Einer der ersten Maler, der Affen einen Pinsel in die Hand drückte, war der englische Biologe Desmond Morris. 1963 veröffentlichte er seine diesbezüglichen Forschungsergebnisse – auf Deutsch unter dem Titel: „Der malende Affe. Zur Biologie der Kunst“. Besonders dem Schimpansen „Congo“ attestierte Morris darin künstlerisches Talent. Pablo Picasso soll eines seiner Bilder besessen haben. Ein weiteres Bild von Congo wurde 2005 für 21.500 Euro von einem amerikanischen Sammler ersteigert. Der o.e. Psychoanalytiker Masson schreibt: „Wenn Congo unterbrochen wurde, bevor er ein Bild vollendet hatte, fing er an zu schreien, bis man ihn weitermachen ließ.“ Auch „Alpha“, eine Schimpansin in den Yerkes-Primatenforschungslabors, war ein begeisterte Zeichnerin: Sie „bettelte die Besucher nicht um Futter, sondern um Papier und Bleistift an, um sich dann in eine Ecke zurückzuziehen und zu zeichnen.“ Die Bilder des aus den Tarzan-Filmen berühmten Affen „Cheetah“ wurden vor einigen Jahren in der Londoner National Gallery ausgestellt.
2013 berichtete „Focus“: „Not macht erfinderisch – und kreativ: Der Heidelberger Zoo braucht Geld.“ „Wir wollen das Löwengehege erweitern“, erläutert Direktor Klaus Wünnemann. „Und weil der Zoo knapp bei Kasse ist, sollen die Tiere selbst mit anpacken. Also ließ Wünnemann Affen und Elefanten mit Pinseln, Farben und Leinwänden versorgen: Sie sollten Kunstwerke malen. Am Sonntag wurden 16 Werke versteigert. Gemalt hätten alle Künstler freiwillig, betont Wünnemann. Allerdings seien die Tiere für ihre Arbeit entlohnt worden. Die Affen erhielten für ein abgegebenes Bild bis zu drei leckere Walnüsse.“ „Wir wissen nicht, ob die Aquarelle ein wirklicher kreativer Ausdruck sind“, sagt der Zoodirektor. „Es hat den Tieren aber sehr viel Spaß gemacht.“ Für 240 Euro ersteigerte dann eine Frührentnerin das Bild „Rotes Herz“ der 19-jährigen Orang-Utan-Dame Ujian. Das Kunstwerk soll das Schlafzimmer der Frau schmücken. „Ich wollte unbedingt eines der Bilder haben“, sagte sie. „Wenn ich es nicht wüsste, könnten die Werke auch von richtigen Künstlern sein.“ Genauso glücklich zeigt sich die achtjährige Schülerin Lena. Für 95 Euro hat sie das schwarz-blau-rote Tupf-Bild „Chinesisches Zeichen“ des Schimpansen Henry erstanden.“
Bereits 2008 hatte die Rheinische Post berichtet, dass eine bekannte Londoner Kunstsammlung, die ungenannt bleiben wollte, vom Krefelder Zoo 21 Bilder der Orang-Utan-Damen Sita, Sandra und Tilda für 3200 Euro erwarb. Letztere, Tilda, malte dann auch für den Kölner Zoo, der dazu verlauten ließ: „Die Bilder werden in unserem Südamerikahaus ausgestellt und zugunsten der Sanierung des Hauses verkauft.“
2012 fand eine Ausstellung am Londoner University College statt, in der erstmalig Kunstwerke von mehreren Tierarten zu sehen waren. Neben der Kunst von Schimpansen, Orang-Utans und Gorillas auch Gemälde von Elefanten sowie das mosaikartige Kunstwerk eines Laubenvogels, der in Australien und Neuguinea lebt. Der Sender N-tv fragte sich darob: „Woran mag der Künstler Bakhari wohl gedacht haben, als er leuchtende Gelbtöne zu einem energetisch wirkenden Knoten vermischte? An Hoffnung? Optimismus? Oder vielleicht doch eher an Bananenschalen? Der US-Maler Bakhari ist ein Schimpanse. Und seine Werke eignen sich bestens zum An-der-Nase-Herumführen beredter Kunstkenner: Wer es nicht weiß, kann die Gemälde schnell für Beispiele abstrakter, von Menschenhand geschaffener Kunst halten. Und mit dem Interpretieren loslegen.“ Aus diesen Sätzen spricht die alte monotheistische Überheblichkeit: Wahre Kunst beginnt demnach erst mit den Menschen, den zivilisierten wohlmöglich!
Noch einen drauf setzte der tschechisch-brasilianische Philosoph Vilem Flusser, indem er davon ausging: „Die wahre Kunst beginnt mit der Gentechnik. Erst mit ihr sind reproduktive Werke möglich.“
Für den Ethnologen Claude Lévi-Strauss nimmt die Kunst dagegen eine Mittelstellung ein zwischen dem mythischen „wilden Denken“ und dem praktischen Handeln beim Basteln. Was aber ist „wildes Denken“ – das Denken der Wilden? Der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro meint: im Westen ist ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt, während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner das Gegenteil der Fall ist: ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“ Dazu gehöre die „so gut wie universelle indianische Vorstellung“, dass Mensch und Tier ursprünglich ungeschieden waren, ihr gemeinsamer „Urgrund“ war jedoch keine Tierheit, sondern die Menschheit.
Die Amazonasindianer gehen also davon aus, dass sich nicht die Kultur irgendwann von der Natur trennte, sondern umgekehrt: diese sich von jener absetzte. Das erinnert an Lamarck, der meinte, dass die Menschen das ausgefallene „Bedürfnis“ haben „zu herrschen und zugleich weit und breit um sich zu sehen, sich anstrengend, aufrecht zu stehen“.Dadurch haben sie die armen Affen, u.a. die Schimpansen, gezwungen, immer weiter „zu fliehen und sich zu verbergen an wilde, öde, selten ausgedehnte oder an elende und unruhige Orte“ – im Urwald eben, „wo diese Tiere sich keine neuen Bedürfnisse mehr verschaffen, keine neuen Gedanken erhalten und sich immer mit denselben beschäftigen.“
Sie wurden also laut Lamarck aus der Kultur in die Natur zurückgezwungen. Diese Theorie trifft sich mit dem Befund des südafrikanischen Pavianforschers Eugène Marais, der in seinem Buch „Die Seele des Affen“ schreibt: „Der Pavian-Fötus und ein Neugeborenes sind weit schimpansenähnlicher als der erwachsene Pavian. Die individuelle Entwicklung des Schimpansen ist analog: Der Fötus ist menschenähnlicher als der Erwachsene.“ Marais will damit sagen, „dass er von Vorfahren abstammt, die menschenähnlicher waren als die erwachsenen Schimpansen.“ Diese Vermutung wird vom holländischen Ethologen Adriaan Kortlandt geteilt. Inzwischen hat man auch verschiedene kleine Menschenvölker studiert, die von anderen in abgelegene Gegenden verdrängt wurden, wo sie zwar überlebten, mehr schlecht als recht, dafür jedoch auf „primitivere“ Entwicklungsstufen zurückfielen. Ihr Vorfahren waren „höher entwickelt“ als sie es heute sind, so könnte man es vielleicht mit Marais und Kortlandt sagen.
Der Kurator der Tierkunst-Ausstellung am Londoner University College erklärte: „Die Kunst von Affen wird oft mit der von Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren im ‚Kritzel-Stadium‘ verglichen. Allerdings entwickeln sie sich über diese Stufe nie weiter.“ Den Pinsel überhaupt in die Hand oder den Rüssel zu nehmen, das machen Tiere aus unterschiedlichen Gründen. Sicher auch aus Langeweile, aber viele von ihnen „machen es tatsächlich einfach aus Spaß. Sie sind regelrecht kreativ. Andere müssen dazu angeregt werden, etwa durch Training oder Belohnungen.“ Dabei würden vor allem Schimpansen verblüffen, die offenbar aus Vergnügen malen. „Sie entscheiden sogar, wann ein Bild fertig ist. Wenn man ihnen mehrere leere Blätter gibt, legen sie das Bild,das sie gerade gemalt haben, irgendwann zur Seite und nehmen sich ein neues vor. Ob man meint, dass sich die Tiere bei ihren Bildern wirklich etwas gedacht haben, hängt auch vom Glauben daran ab“, sagte der Kurator. Menschen seien schon immer fasziniert davon gewesen, Ähnlichkeiten mit Tieren zu finden. „Wir haben keine wissenschaftliche Antwort.Und die Frage ist ja außerdem auch: Wo fängt Kunst an?“ Und was ist „Schönheit“? „Ohne Tierversuche gibt es keine Schönheit,” behauptet die Kosmetikindustrie, die ebenso wie die Pharmaindustrie besonders viele Tiere, u.a. Menschenaffen, vernutzt. Während die Schweizer (Tier-)Filmwissenschaftlerin Christine Noll meint: “Ohne Tiere gibt es keine Schönheit, denn alles leiblich Schöne erlebt man erst an Tieren. Wenn es keine Tiere gäbe, wäre niemand mehr schön.” Die Tiere sehen das allerdings anders – vielleicht urteilen sie dabei auch wieder nach dem Geruch?
Eugène Marais war jedenfalls verblüfft, dass „seine“ Paviane mindestens bei der Partnerwahl so gar „keiner Spur der menschlichen Ästhetik“ folgten: „Jugend und ihre Anmut haben keine besondere Anziehungskraft auf sie. In der Hälfte aller Fälle verwarfen die Männchen ein lüsternes junges Weibchen für eine alte Vettel, grau und narbenbedeckt, die, selbst nach Pavian-Maßstab beurteilt, als unaussprechlich hässlich betrachtet werden müßte.“ Solche Beobachtungen machten nach ihm auch andere Primatenforscher bei anderen männlichen Affenarten: Auch sie bevorzugen anscheinend alte Weibchen, wenn sie die Wahl haben.
Aber was ist überhaupt „menschliche Ästhetik“? Vielleicht entwickelte sie sich erst mit der Mathematik bei den schönheits- und jugendversessenen Griechen – und ihrer großen Vorliebe für die Symmetrie, die im Jugendstadium am ehesten zur Geltung kommt. So gesehen hat Darwin nicht nur bei seinem Konkurrenz-Postulat des „Survival of the Fittest“ die schlechten Angewohnheiten der englischen Bourgeoisie auf die Natur projiziert, wie Karl Marx spottete, sondern bei seiner vorschnellen Theorie der Sexuellen Selektion auch das Griechentum gleichsam für „natürlich“ erklärt, obwohl es eher das Gegenteil ist: die bis heute geltende Negation der Natur, auch und vor allem in seiner Ästhetik.
Aber die Heimholung der ins Abseits gedrängten wilden Tiere geht weiter – auch die der noch „wilden“ Menschen – bei denen z.B. der brasilianische Staat die selbe Indianerpolitik wie die nordamerikanischen Weißen verfolgt: “‘Unsere Indianer,’ so verkünden die Verantwortlichen, ‘sind Menschen wie wir alle. Aber das Leben in der Wildnis, das sie in den Wäldern führen, setzt sie Elend und Leid aus. Es ist unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, sich aus ihrer Zwangslage zu befreien. Sie haben ein Recht darauf, sich in den Stand der Würde eines brasilianischen Staatsbürgers zu erheben, um ganz am Fortkommen der einmheimischen Gesellschaft teilzunehmen, und um in den Genuß von deren Annehmlichkeiten zu kommen.”
Als „Staatsbürger“ werden die letzten Amazonas-Indianer aber wahrscheinlich eher in Favelas dahinvegetieren oder in Drogenkriegen aufgerieben als in den Genuß irgendwelcher „zivilisatorischer Annehmlichkeiten“ zu kommen. Und auch den Menschenaffen blüht in der Zivilisation beim heutigen Stand der Dinge nur Käfig und Gehege – also lebenslängliches Eingesperrtsein.
Von sich aus, d.h. wenn man sie nicht mit Malen, Spielzeug und Gesprächen über Gebärdensprache beschäftigt, entwickeln sie dort aber noch eine ganz andere „Kunst“, dies gilt vor allem für Orang-Utans – von denen nebenbeibemerkt die indigene Dayakbevölkerung auf Borneo behauptet, dass diese von ihnen „Waldmenschen“ genannten Affen nur deswegen nicht sprechen, weil sie sonst arbeiten müßten.
Freilebende Orang-Utans gebrauchen nur wenige Werkzeuge (Termiten graben sie z. B.mit den Händen aus), in Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen zu wahren Ausbrecherkünstlern. Der „National Geographic“-Autor Eugene Linden hat in seiner Anekdotensammlung „Tierisch Klug“, die wesentlich auf Berichten von Zootierpflegern beruht, viele Geschichten darüber veröffentlicht. „In der Zoowelt sind die Orang-Utans für ihre Fluchtversuche berühmt“, schreibt er. Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er dasselbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. „Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen“ – so lange, bis er es geöffnet hatte.
Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben, weil die Bewachung zu teuer kommt. Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans allerdings vor der ungewohnten Umgebung. „Auf einer gewissen Ebene wissen die meisten gefangenen Tiere, dass der Zoo der Ort ist, in dem sie leben.“ Von zwei Mitarbeitern an einem Projekt zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Menschenaffen im Nationalzoo in Washington erfuhr Eugene Linden von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber ins Freie kletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, diese Affen dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus- und wieder reingegangen.
Einer der Projekt“-Mitarbeiter in Washington meinte zu Eugene Linden: „Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gäbe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen.“
Linden fügte hinzu: „Und so sind die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffen-Äquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunutzen versuchen.“ Hier hilft bisher nur eine sogenannte „sinnvolle Beschäftigung“ der Affen.
Im April 2013 porträtierte die BZ Christine Peter, eine medizinisch-technische Assistentin aus dem Wedding, die sich zu Deutschlands erste und einzige Fachfrau für Tierbeschäftigung umschulen ließ. Seitdem bringt sie Menschenaffen in Zoos das Malen bei. Im täglichen Umgang mit den Tieren dort wurde ihr klar, schreibt die BZ, dass diese beschäftigt werden müssen, damit sie nicht verkümmern. „In freier Wildbahn haben sie mit der Nahrungsbeschaffung, der Aufzucht der Jungtiere und der Verteidigung ihres Reviers viel mehr zu tun als im Zoo“, sagt sie. „Wenn wir den ganzen Tag nur auf der Couch liegen und auf Futter warten würden, würden wir auch verkümmern.“ Zunächst begann sie damit, „Rosinen und andere Leckereien in Kanistern oder alten Fußbällen zu verstecken, und bohrte Löcher in Holzbretter, in denen sie Nüsse versteckte. Irgendwann reichte sie den Menschenaffen große weiße Bögen und Wachsstifte ins Gehege – und einige malten begeistert darauf los. Die dabei entstandenen Bilder werden im Internet zu Preisen von 120 bis 840 Euro verkauft (www.affenbrut.de). Wer möchte, kann Christine Peter bei ihrer Arbeit im Krefelder Zoo begleiten – für 100 Euro pro Arbeitstag. „Doch ums Geld geht es ihr nicht. Sie will, dass die Tiere glücklich sind,“ schreibt die BZ.
Ähnliches will man auch im Wuppertaler Zoo. Dort hängen zehn gemalte Bilder des 45jährigen Schimpansen Epulu im Affenhaus. Die „Westdeutsche Zeitung“ schreibt: „Der Verkaufserlös von 250 Euro pro Stück soll dem Zookonzept zugute kommen. Für ein einzelnes Bild braucht Epulu oft nur wenige Minuten, anschließend gibt es als Belohnung Obst, Hölzer zum Abnagen, Körner oder was das Schimpansenherz gerade begehrt. Dabei soll das Malen für den 45-jährigen Schimpansen aber nie zur Pflicht werden – er darf selber entscheiden, ob er malen möchte: An manchen Tagen zerstört er die Leinwand direkt, wenn die Pfleger sie ihm hineinschieben, die Belohnung bekommt er aber trotzdem. „Wenn wir ihm die Leinwand hineinschieben und er Lust hat zu malen, dann grinst er richtig, gibt fröhliche Laute von sich und wird ganz aufgeregt. Anschließend streckt er uns die Hände und Füße hin und wir waschen ihn dann mit Wurzelbürste und Kernseife“, erklärt Pfleger Julian Kusak. Mit dem Malen soll Epulu etwas tun, das ihm Freude bereitet.
In den letzten Jahren ist der Zoo wiederholt in die Kritik geraten, da das Schimpansenpärchen Epulu und Kitoto alleine gehalten wird und nicht, wie in der freier Wildbahn üblich, in einer Herde. Auch das Fehlen eines Außengeheges und eines ausreichend großen Innengeheges wurde wiederholt von Tierschützern bemängelt. Das Weibchen leide unter psychischem Stress und reiße sich die Haare aus, so die Vorwürfe. ‚Wir tun alles im Rahmen unserer Möglichkeiten, um es Epulu und Kitoto so gut wie möglich gehen zu lassen‘, erklärte der Biologe und Öffentlichkeitsbeauftragte des Zoos, Andreas Haser-Kalthoff, während der gestrigen Vernissage. ‚Die Tiere in eine Herde zu integrieren, ist zu gefährlich‘, Epulu ist in den späten 60igern nach damaligen Standards handaufgezogen worden und würde, wenn er heute in eine Herde käme, wahrscheinlich von den anderen Tieren umgebracht werden. Kitoto wurde aus ihrer Herde genommen, weil sie dort für Probleme gesorgt hat.“
Das Zoologische Museum der Universität Hamburg organisierte Anfang 2013 eine Ausstellung mit dem Titel „‚Schimpansen-Kunst‘ zum Ansehen und Kaufen“. Die Bilder stammten „aus dem wissenschaftlichen Nachlass des verstorbenen Gießener Primatenforschers Prof. Robert Glaser. Er hatte in den späten 1960er Jahren in den USA mit Schimpansen gearbeitet, dabei entstanden auch die Malereien. Die meisten davon wurden von „Poncho“ geschaffen. Wie alle anderen malenden Schimpansen hat auch Poncho seine Bilder im Alter von zwei bis fünfeinhalb Jahren angefertigt.“
Jüngst hat der Philosoph Hans Werner Ingensiep sich in seinem Buch „Der kultivierte Affe“ über das u.a. von Roger Fout organisierte „Great Ape Project“ und dessen Kampagne „Menschenrechte für Menschenaffen“ geäußert, die von vielen Primatenforschern, die alle auch Tierschützer sind, unterstützt wird. Über deren Absicht, die Menschenaffen als uns Nächststehende zu „Personen“, d. h. Mitbürgern, zu erklären, schrieb er: „Sollte der Fall eintreten, dass ein Individuum unter den Menschenaffen in diesem Sinne als ‚animal rationabile‘ und autonomes Subjekt agiert, dann werden wir es in die ‚Gemeinschaft der Gleichen‘ aufnehmen müssen und haben keinen Grund mehr, uns von ihm in dieser Hinsicht zu unterscheiden.“
Der französische Wissenssoziologe Bruno Latour ist zuversichtlich, dass dies mit den Anstrengungen der Verhaltensforscher, Botaniker, Tierschützer und Ökologen auch passiert: Irgendwann wird man es genauso seltsam finden, verspricht er, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten. Allerdings gibt er den Aktivisten zu bedenken: „Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“

Diese grau abgepollerte Charlottenburger Verkehrsinsel krönte der Künstler (Name vergessen) mit einem weißen Pyramidenpoller. Siehe dazu auch: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2007/02/10/

Hier protestieren Istanbuler Demonstranten gegen das türkische Schweinesystem, indem sie sich schweigend auf zwei Pollerreihen stellten.

Poller (Hardware) mit Polizisten (Software) zum Schutz für Obama (Wetware) in Berlin.

„Tropical Island“ von hinten – in der ehemaligen Fertigungshalle für „Cargo-Lifter“ (Zeppeline). Die Firma ging schnell pleite, jetzt ist ein „Erlebnisbad“ darin. In den USA werden nebenbeibemerkt junge Forellen in den hohen Bergseen mit „Miniaturzeppelinen“ ausgesetzt, d.h. einfach aus der Luft ins Wasser geworfen. Mit dem Packpferd kosten 1000 Fische 19,8 Dollar, mit dem Flugzeug 3, 98 Dollar, etwa das selbe kostet es mit dem Zeppelin. Die Angaben stammen von Professor Dr. Bernhard Grzimek, DDR 1970.
Zeppelinmodell-Flüge
Die „Lange Nacht der Wissenschaften“ war bisher so erfolgreich, dass es – „Me too!“ – nun auch alle möglichen anderen „langen Nächte“ gibt. Die lange Nächte der Kirchen, der Industrie, der Familie, der Weiterbildung, der Kulinarik und so weiter. Das hat die Organisatoren bewogen, bei der achten Ausgabe, an der 75 Wissenschaftseinrichtungen in Berlin und Potsdam teilnahmen, von „Der klügsten Nacht des Jahres“ zu reden. Man wird ja wirklich klüger, wenn einem auf über 1.000 Veranstaltungen die Forscher geduldig ihr jeweiliges Fachgebiet erklären und dazu jede Menge Hightech-Geräte auffahren, um die Sache noch spannender zu machen.
Die Mitarbeiter von einem der Leibniz-Institute auf dem Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof führten etwa vor, wie man aus Lösungen Kristalle züchtet. Die Kristallzüchter arbeiten dort unter anderem mit Silizium, was für die ebenfalls auf dem Gelände ansässigen Solarfirmen wichtig ist, von denen einige jedoch schon wieder pleite gegangen sind, weil die Chinesen billigere Solarmodule produzieren.
In Adlershof ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt domiziliert, in dem man die ost- und westdeutschen „Enkel der Peenemünder“ zusammenführte. Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit „Energie und Verkehr“, wozu auch die Stauforschung gehört. Daneben kartografieren sie den Mars, denn sie bauten zusammen mit Zeiss Jena eine Kamera für den Mars-Express, der den Planeten 2003 mit einer russischen Sojus-Rakete erreichte. Zudem befassen sich die Wissenschaftler mit Asteroiden-Prävention und bereiten sich auf eine Mond-Mission vor, denn „der Mond ist schlechter als der Mars erfasst“. Zur „klügsten Nacht des Jahres“ hatten sie einen „3-D-Flug über den Roten Planeten“ in ihrem Veranstaltungsangebot.
Vor dem Ferdinand-Braun-Institut, das zu seinen Mikrowellenbauelementen Reinraumführungen veranstaltete, kam es zu Warteschlangen. Ein Mann meinte zu seiner Frau gehässig: „Gleich siehste mal, wie ein Reinraum wirklich aussieht!“ Auch auf dem Campus der TU im Wedding, auf dem Gelände der AEG, gab es einen Reinraum (des Fraunhofer Instituts) zu besichtigen, wir entschieden uns dort jedoch für den Crashtest im „Haus der KFZ-Technik“ nebenan, wo ein Opel Vectra mit 35 km/h und lautem Knall gegen einen Betonpoller gedonnert wurde – und anschließend Schrott war. Das Publikum bedankte sich mit heftigem Applaus für diese Show, die einen Hauch von römischem Gladiatorenkampf vermittelte.
In der großen Peter-Behrens-Halle auf dem Gelände hatten sich die Bauingenieure zur Freude der Kinder allerhand Basteleien mit verschiedenen Materialien, darunter Nudeln und Legosteine, ausgedacht. Mit den Legohochhäusern wurden dann Erdbebentests angestellt.
Uns interessierte hier vor allem die Leistungsschau der Luftschiffbauer, die ihre zwei Meter großen Zeppeline aus Silberfolie ferngesteuert durch die Halle fliegen ließen. Ihnen geht es ansonsten ähnlich wie den Solarzellen-Konstrukteuren in Adlershof: Das Helium ist so teuer geworden, wegen des erhöhten Bedarfs der US-Militärs, dass viele zivile Luftschiff-Projekte erst einmal auf Eis gelegt wurden. Das tat jedoch dem Spaß der Konstrukteure an ihren fliegenden Modellen, die im Wettbewerb an den Start gingen, keinen Abbruch. Im Gegenteil: Sie feierten noch bis zum nächsten Morgen draußen auf dem Hof, wo in einem Kubus Gegrilltes verkauft wurde und die Berliner Wasserwerke ihr kostbares „Produkt“ in Plastikbechern ausschenkten. Dazu konnte man sich bei den Bauingenieuren in der Halle über „Wasserqualität und Wasseraufbereitung“ aufklären lassen.

Sonja Mittenwald-Böhme erklärt ihrem Hund die Welt. Siehe dazu auch den letzten blog-Eintrag.

Hier zeigt sie ihrem Hund die Pension, in der sie untergebracht sind.
Ausgefallene Berufe
Bei den Witwentröstern unterscheiden Beerdigungsredner zwischen „weißen“ und „schwarzen“: Erstere wollen wirklich trösten, Letztere sind auf echte Werte, also Geld, aus.
Aber manchmal kann man sie auch nicht so genau trennen. Da gibt es zum Beispiel die Gruftis, die sich nicht nur gerne auf Friedhöfen rumtreiben, sondern dort, wenn sie schon mal da sind, gelegentlich Beerdigungen besuchen. Ihr Interesse sind das Trauerritual und die Nähe des Todes. Daneben gibt es aber auch solche, die das Leben, genauer gesagt: der Hunger, dort hintreibt – die Hoffnung auf den Leichenschmaus, wenn sie sich nur überzeugend genug als „Freund“ des oder der Verstorbenen ausgeben.
Auch sogenannte Winter-Witwentröster finden sich auf den Berliner Friedhöfen: Männer, die sich sommers in den meist ländlichen Reha-Orten als Kurschatten durchschlagen und sich nur in der kalten Jahreszeit auf Friedhöfen rumtreiben.
Und dann gibt es auch solche wie den jungen Achmed, der früher mal Friedhofsgärtner war und die Stille auf den Friedhöfen liebt. Einmal lernte er dort meine unter mir wohnende alte Mieterin kennen, die das Grab ihres Mannes pflegen wollte, aber keinen Wasserhahn für ihre Blumen fand. Achmed half ihr. Seit dem Tod ihres Mannes lebte sie sehr zurückgezogen, aber nachdem sie Achmed kennengelernt und sich quasi sofort mit ihm verheiratet hatte, fühle sie sich „wie neu geboren“ – wie sie mir gestand, als wir uns beim Getrenntmüllruntertragen auf der Treppe begegneten. „Ob er es ehrlich mit mir meint, wird sich herausstellen“, fügte sie schmunzelnd hinzu.
Seit einigen Jahren muss ich dauernd zu Beerdigungen von Freunden, wo ich immer wieder dieselben Leute treffe. Eine Bekannte, Gisela, meinte neulich schon: „Ich komm gar nicht mehr runter von den Friedhöfen.“ Mir hat sich dabei immerhin das Auge für Witwentröster geschärft: Jetzt, da das alte Ost- und Westberlin zügig wegstirbt, scheint diese Branche zu boomen. Vor allem im Frühjahr. Überall sehe ich Männer, die fremden Frauen ihre Gießkannen oder irgendwelche Blümchen hinterhertragen, sich, am Grab angekommen, diskret zurückziehen und dann mit diesen Witwen ins nächste Café gehen. Eine Freundin von mir will demnächst an einem der Kreuzberger Friedhöfe sogar ein Café eröffnen. Sie meint, das wäre ein bombensicheres Geschäft.
Auf dem Tierfriedhof des Tierheims in Hohenschönhausen lernte ich beim letzten Besuch eine Witwe kennen, die dort ihren 2011 eingeschläferten Hund beerdigt hatte. Sie erzählte, dass sie viele „ältere verwitwete Damen“ kenne, die ebenfalls das Grab eines tierischen Angehörigen pflegen. Mit der ein oder anderen Dame gehe sie auch schon mal anschließend ins Café des Tierheims. Auf die Witwentröster angesprochen, winkte sie jedoch ab: „Ach, die Männer!“ Das seien doch fast alle „windige Gesellen“, die einem auf den Friedhöfen schöne Augen machen. „Pietätlos“ sei das.
Sie gab jedoch zu, dass es dieses Phänomen gibt, was sie sich damit erklärte, dass auf dem Friedhof, nahe dem Grab eines geliebten Verstorbenen, das Herz und die Seele besonders empfänglich seien für Zuspruch und Anrede. Auf dem Hohenschönhauser Tierfriedhof sei man jedoch relativ sicher vor ihnen: „Der ist zu weit draußen für diese Lümmel, wissen Sie?!“

Alois Loipe zeigt seinem Hund, wo es lang geht.
Periphere Ausstellungen
Laut einer Statistik von Architektursoziologen der TU wurde Pankow seit der unseligen Wiedervereinigung weit stärker gentrifiziert (also bevölkerungsmäßig ausgetauscht) als Mitte, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. Die Vorzeigemeile dafür ist die Florastraße, wo es nun ein Müttercafé, einen Bioladen, einen Schweizer Sklavenhändler für anspruchsvolle Jobs, ein „Zweites Leben“-Geschäft mit neu zusammengebauten alten Sachen, einen Tee-, einen Weinladen und einen mit selbst genähter Kleidung gibt. Dazu jede Menge Ärzte, Anwälte und Steuerberater. Demnächst bekommt die Florastraße neue Straßenlampen und Gehwegplatten, obwohl beides in Ordnung ist.
Kürzlich schlenderte ich dort entlang und sah aus den Augenwinkeln ein Transparent über einem Schaufenster: „Traurig-Ausstellung“. Drei Häuser weiter – vor einem Gummibärchen-Laden -, fragte ich mich: Ist das vielleicht so etwas wie die große „Melancholie“-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in klein? Als ich zurückging, las ich: „Trauring-Ausstellung“. Trotzdem betrat ich den Laden, ein Schmuckgeschäft. Ich war der einzige Besucher der Ausstellung. Sie bestand aus der Kollektion eines Schmuckherstellers und umfasste etwa 100 Ringe.
Die Ladenbesitzerin erläuterte mir, quasi als Kuratorin, die Exponate. Die meisten waren aus Gold, Titan oder Platin und mit Gravuren versehen: Schlieren, Schlangenlinien, Zickzackfurchen … Einige Ringe sahen aus wie Winterreifen für Matchbox-Autos. Nicht wenige hatten die Schmuckdesigner auch noch üppig mit Brillanten bestückt.
Geschickt brachte die Ladenbesitzerin das Gespräch aufs Heiraten: wann, wie, wo und so. Ich druckste herum und kam mir vor wie ein alter Sack, der ein junges Ding mit Edelmetall und -steinen an sich ketten will, aber aus Geiz Angst vor der eigenen Kühnheit hat. Aber „Schmuck geht immer“, wie meine Tante schenkunfähigen Liebhabern auf die Sprünge zu helfen pflegte. Andererseits mochte ich der Händlerin nicht sagen, dass ich bloß als neugieriger Journalist unterwegs war. Die Ringe kosteten alle mehr als 1.000 Euro. Als ich darob anerkennend durch meine Zahnlücke pfiff, legte die Ladenbesitzerin mit der Bemerkung: „Wir haben ja auch die Klassiker – die schlichten goldenen“, eine in schwarzen Samt gebettete Auswahl auf den Tresen.
Auch bei diesen Ringen gab es für Heiratende eine Qual der Wahl. Da ich jedoch, um jünger zu wirken, meine Brille eingesteckt hatte, konnte ich keine Unterschiede außer im Preis erkennen. Als ich dann den Laden verließ, fiel mir ein, wo ich das Gravurdesign der modischen Trauringe schon mal gesehen hatte: auf Berlins Friedhöfen. Auch die hiesigen Steinmetze lassen sich zur Verschönerung eines Grabsteins gerne Wellen- und Zickzacklinien einfallen.
Beim Hinausgehen nahm ich die ausgelegte Kopie eines FR-Artikels mit – eine Kulturgeschichte des Traurings, beginnend mit den alten Ägyptern. Der Text gipfelte in dem Satz: „Kein Wunder, dass neben den Hochzeitsvorbereitungen die Wahl des perfekten Traurings den meisten Paaren das größte Kopfzerbrechen bereitet. Was, wenn beide unterschiedliche Stilvorstellungen haben? Oder das Budget zu klein ist? Oder Allergien bestehen?“
Das mochte ich mir nicht ausmalen, ist aber vielleicht auch übertrieben. Ich jedenfalls will keine Frau heiraten, der ein „perfekter Trauring“ wichtig ist, eher schon eine Freundin, die sich bereits dreimal vermählt hat: erst mit Ringen aus Gras, dann mit solchen aus Isolierdraht, dann mit Bierdosenlaschen. Dabei geht der Trend zum echten Ring, wie ich im Laden erfuhr – auch und erst recht in der Florastraße.

Die beiden nackten Schwestern Fonté zeigen ihrem spanischen Dünenhund (im Bild nicht sichtbar), wo der bekleidete Spanner hingelaufen ist.
Aus den letzten Animails:
– Die Orang-Utanforscherin Birute Galdikas hat seit ihrem letzten blogeintrag 2009 – über Feuer auf Borneo – nichts Aktuelles mehr hinzugefügt.
– Das Jane Goodall-Institute meldet: „First Group of Chimpanzees Released on Tchindzoulou Island JGI moves the first chimpanzees from Tchimpounga to their new home.“
– Das Karisoke Research Center des Dian Fossey Gorilla Fund International (DFGFI) in Ruanda meldete zuletzt: „As Rwanda recovered from war, Karisoke™ built new facilities, welcomed a new director, Dr. Katie Fawcett, and continued to create new research and community partnerships.“
– Wenn die Verhaltensforscher nach und nach in den Tiergruppen, die sie beobachten, sozusagen aufgenommen werden, dann geht es dabei um ein Affizieren und Affiziertwerden. Dabei geraten sie zusammen in einen Prozeß des Gemeinsam-Werdens, der das Herr-Knecht-Verhältnis ungefähr so aufhebt wie ein Hund das Stöckchen, das man weggeworfen hat.
– Jane Goodall wurde von Katharina Granzin für die taz interviewt:
sonntaz: Frau Goodall, wenn man so lange unter Schimpansen gelebt hat wie Sie, beginnt man dann irgendwann Menschen mit Schimpansen zu vergleichen?
Jane Goodall: O ja, manchmal schon. Das ist nie absichtlich passiert, ich habe einfach festgestellt, dass es so ist. Und es hilft einem tatsächlich, manche Dinge zu verstehen. Gibt es bestimmte menschliche Züge, die Sie besonders an Schimpansen erinnern? Wenn man eine gute Mutter mit ihrem Kind beobachtet, ob Menschen oder Affen. Solange das Menschenkind noch so klein ist, dass es nicht spricht, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Außer diesem einen, dass die Menschenmutter mit ihrem Kind spricht, auch wenn das Kind selbst noch nicht sprechen kann. Was tut denn eine gute Mutter? Also: eine gute Schimpansenmutter? Eine gute Schimpansenmutter ist sehr liebevoll. Das ist sehr wichtig. Spielerisch; das ist auch wichtig. Geduldig. Tolerant in einem gewissen Ausmaß, aber fähig, das Kind zu disziplinieren. Sie muss wissen, wann sie Nein sagen muss. Und wann sagen Schimpansenmütter Nein? Zum Beispiel, wenn die Mutter gerade dabei ist, nach Termiten zu fischen, und das Kind immer nach dem Werkzeug schnappt. Dann gibt die Mutter einen keuchenden Laut von sich, und das Kind wimmert.
Gibt es auch physische Formen der Zurechtweisung?
Normalerweise nehmen sie die Hand und beißen hinein. Nicht so, dass eine Wunde entsteht, aber dass es spürbar ist. Das ist eine ganz typische Bestrafung. Und es gibt Mütter, die das nicht können und die dann häufig verwöhnte Kinder haben. Diese Kinder machen oft Probleme. Klingt sehr menschlich. Das ist es. Menschlich, ja. Haben die Schimpansenkinder noch andere enge Bindungen, außer zur Mutter? Ja, zu den älteren Geschwistern. Nie zum Vater? Erst seit Kurzem können wir überhaupt über DNA-Tests die Väter bestimmen. Man sammelt die Fäkalien und schickt sie ins Labor. Bevor es diese Möglichkeit gab, mussten wir raten. Es gibt keine Paarbindung zwischen Männchen und Weibchen.
In dem aktuellen Disney-Film „Schimpansen“ haben Sie als Beraterin mitgewirkt. Im Film sieht man unter anderem, dass es für ein Männchen unter Umständen möglich ist, seine Rolle zu wechseln?
Ein Alphamännchen muss sehr selbstbewusst sein und sehr mutig. Auch wenn ein Anführer gerade von drei anderen Männchen angegriffen wird, weil er gerade erst in diese Position gelangt ist, muss er seine Angst beherrschen und die Angreifer konfrontieren. Ein Männchen, das das kann, hat eine Chance, auch an der Spitze zu bleiben. Es gibt zwei Arten von Alphamännchen. Manche kommen an die Spitze, weil sie groß, stark und sehr aggressiv sind. Solche halten ihre Position höchstens zwei Jahre. Daneben gibt es die anderen, die vielleicht kleiner sind, aber sehr motiviert und intelligent – die können es auf sechs bis zehn Jahre bringen. Aber Weibchen haben keine Chance auf die Führungsposition. Nicht für die ganze Gruppe. Aber es gibt auch unter den Weibchen eine Hierarchie, die sich allerdings permanent ändert. Wenn etwa ein Weibchen an einem Tag von seinem schon erwachsenen Sohn begleitet wird, kann es eine andere Mutter dominieren, die nur mit ihrer erwachsenen Tochter zusammen ist. Aber da heranwachsende Schimpansen nicht mehr die ganze Zeit bei ihrer Mutter sind, ändert sich die Hierarchie ständig, je nachdem, welche Kinder eine Mutter gerade um sich hat.
Ihre Beratertätigkeit bei „Schimpansen“ – worin bestand die genau?
Ich sollte das Drehbuch lesen und kommentieren, hauptsächlich aber dabei helfen, den Film zu promoten. Das hieß für mich: die Sache der Schimpansen zu promoten! In den USA habe ich unzählige Interviews gegeben und dabei auch viel über das Jane-Goodall-Institut gesprochen, über die fünfzig Jahre, die wir schon über Schimpansen forschen und die mir die Autorität geben, über diesen Film zu sprechen. Um noch einmal auf die Rollenmuster zurückzukommen: Während der Dreharbeiten stieß das Filmteam auf eine Geschichte, die außergewöhnlich zu sein scheint: ein Männchen, das einen verwaisten kleinen Schimpansen adoptiert. Ist dieser Vorgang tatsächlich so sensationell? In all den Jahren, die ich in unserer Feldstation in Tansania geforscht habe, habe ich ein einziges Mal etwas Ähnliches beobachtet. Es kann vorkommen. Hier ist es aber ein Alphamännchen, der Anführer der Gruppe! Das ist wirklich äußerst selten.
Im Presseheft schreiben Sie, das sei so selten, weil er als Anführer in den Augen der anderen „eine Rolle zu erfüllen“ habe. Welches Verhalten impliziert das?
Das soll heißen, wenn man ein hochrangiges Männchen sein will, muss man jederzeit bereit sein, diese Position zu verteidigen. Dafür diese ganze Angeberei. Man muss groß und stark aussehen, an Bäume trommeln, das Fell sträuben, jüngere Männchen in ihre Schranken weisen. Und ich habe immer gesagt, natürlich würden Mütter sich niemals so verhalten, weil sie sich um ihr Baby kümmern müssen. Aber Freddy im Film schafft es tatsächlich, sowohl das Kind zu behalten als auch seine Position zu behaupten.
Er hat also dasselbe Alphamännchen-Verhalten gezeigt wie vorher?
Nun, zu Beginn hat er das wohl tatsächlich vernachlässigt. Dann aber, als seine Position gefährdet schien, musste er es wieder aufnehmen. Weil Sie gerade „Freddy“ sagten: Sie schreiben in Ihrem Buch „Grund zur Hoffnung“, dass Sie die Erste waren, die den Affen, die Sie beobachteten, Namen gaben. Das war früher nicht üblich? Es war offenbar nicht wissenschaftlich. Aber ich hatte damals ja noch nie wissenschaftlich gearbeitet, hatte nicht einmal studiert. Wie sollte ich das also wissen? Heutzutage geben ja alle Wissenschaftler den Tieren Namen. Nicht alle, aber die meisten. Außer den Leuten, die schreckliche medizinische Forschung betreiben. Sie wollen nicht auf diese Weise an die Tiere denken.
Was die medizinische Forschung betrifft, so sind Sie selbst seit 1986 hauptberuflich als Aktivistin tätig. Haben Sie das Gefühl, in den fast drei Jahrzehnten auf diesem Gebiet etwas bewirkt zu haben?
Es hat sich einiges getan, und wir haben dabei Einfluss gehabt, das weiß ich. Aber auch andere Faktoren haben eine Rolle gespielt. Zum einen ist es sehr teuer, Schimpansen zu halten. Zum anderen wurde die öffentliche Meinung immer kritischer. Inzwischen sind in den USA die meisten der Labore geschlossen worden, die Forschung an Schimpansen betrieben haben. Das National Institute of Health hat gerade eine Direktive herausgegeben, nach der die meisten der zu Forschungszwecken gehaltenen Schimpansen freigelassen werden sollen. Es sind immer noch etwa 1.500 Schimpansen, die in diesen schrecklichen Laboren leben. Eine Studie hat ergeben, dass die meisten Experimente für den Menschen überhaupt nicht von Nutzen sind. Etwa 500 Schimpansen sollen nun noch bleiben, die anderen werden aus der medizinischen Forschung entlassen. Diesen Entscheidungsprozess habe ich über die Jahre hinweg begleitet.
Und was wird aus den entlassenen Schimpansen?
Das ist das Problem. Der Direktor des National Institute of Health, der die ganze Zeit mein Gesprächspartner war, sagte zu mir, aber Jane, was sollen wir nur mit ihnen machen? Kannst du uns helfen, Geld aufzutreiben? Wir müssen Einrichtungen für sie bauen. Also helfen Sie mit, diese Einrichtungen aufzubauen? Nein. Sie müssen selbst zusehen, wie sie das Geld zusammenbekommen. Wir schaffen es gerade einmal, unsere Projekte in Afrika zu finanzieren, darunter auch Projekte, die das Leben von Dorfbewohnern verbessern helfen, und unser Jugendprogramm, das in 130 Ländern läuft.
Aber wo genau sind denn jetzt die Laborschimpansen, die nicht mehr gebraucht werden?
Sie sind immer noch genau dort, wo sie waren. Nur 110 Tiere aus den allerschlimmsten medizinischen Forschungszentren konnten inzwischen umziehen in eine Einrichtung, die schon zu diesem Zweck gebaut worden war und mit nicht allzu viel Geld vergrößert werden konnte. Als ich das interne Filmmaterial aus diesen Laboren gesehen habe, wäre ich fast gestorben. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das war letztes Jahr. Im Film „Schimpansen“ erfährt man, dass heutzutage nur noch ein Fünftel der Schimpansenpopulation lebt, die es noch vor zwanzig, dreißig Jahren insgesamt gab. Die Tiere werden nicht nur zur Forschung benutzt … Überall in Zentral- und Westafrika werden sie von Buschmann-Stämmen gegessen. Nicht als alltägliche Mahlzeit, sondern vor allem für zeremonielle Anlässe. Schimpanse ist eine Delikatesse. Das Problem ist: Früher aß ein ganzes Dorf vielleicht einen Schimpansen. Und in den meisten Dörfern wird das gar nicht praktiziert, es ist eine lokal begrenzte Tradition. Aber die zunehmende kommerzielle Ausbeutung der afrikanischen Wälder hat alles geändert. Die Nutzung der natürlichen Ressourcen ist nicht mehr subsistent, und die kulturellen Beziehungen zwischen Mensch und Wald sowie Mensch und Tier haben sich geändert. Ausländische Forstwirtschaftsunternehmen sind in den Wäldern, darunter auch ein großes deutsches, mit Hauptquartier im Kongo. Und selbst wenn sie alle nachhaltige Forstwirtschaft betrieben, würde das wenig nützen, da sie die Wälder durch den Bau von Zufahrtswegen zugänglich machen. Auf diesen Straßen kommen die Jäger. Heute wird nicht mehr nur für das eigene Dorf gejagt, sondern aus kommerziellen Gründen.
Was kann man dagegen tun?
Ich habe mit den Forstunternehmen geredet, und als Ergebnis wurde eine Art Verhaltenskodex verabschiedet. Darin steht zum Beispiel, dass Bäume nicht zu dicht nebeneinander geschlagen werden dürfen. Und soweit ich gehört habe, haben sie diesen Kodex jetzt um einen ganzen Abschnitt erweitert, der vom Umgang mit Tieren handelt. Ein Unternehmen, das deutsche übrigens, hat als Direktive für seine Forstarbeiter ausgegeben, dass die Arbeiten abgebrochen werden müssen, wenn in der Nähe Schimpansen zu hören sind. Ich bin schon sehr oft dafür kritisiert worden, dass ich Gespräche führe mit den Forstwirtschaftsunternehmen oder mit Leuten, die medizinische Forschung an Primaten betreiben. Aber wenn man vernünftig mit den Leuten redet, erreicht man sehr oft Veränderungen zum Positiven. Es bringt nichts, herumzuschreien und mit dem Zeigefinger zu fuchteln. Und es ist sehr schwierig, das Denken der Menschen zu ändern. Man muss versuchen, sie emotional zu berühren. Verbinden Sie mit diesem Film konkrete Hoffnungen für die Sache der Schimpansen? Zum einen hoffe ich, dass der Film zu einem besseren Verständnis für Schimpansen beiträgt. In den USA ist es völlig legal, Schimpansen als Haustiere zu halten. Wir wollen bewirken, dass das verboten wird. Aber solange es legal ist, kann dieser Film dazu beitragen, dass die Leute verstehen, dass Schimpansen nicht klein und niedlich bleiben, sondern groß, stark und gefährlich werden können. Der andere Grund, warum ich den Film promote, ist, dass mein Institut finanziell davon profitiert hat. Sie haben uns einen gewissen Prozentsatz der Einnahmen aus den ersten zwei Wochen gegeben. Keine Riesensumme, aber das Geld hat uns sehr geholfen. Wir betreiben die größte Einrichtung für verwaiste Schimpansen in Afrika. Geld dafür aufzutreiben, ist ein ständiges Thema.
– Neuland für Affen: Pongoland: Ein Besuch im Leipziger Zoo Schöner Wohnen für Primaten von Erik Raidt, 13.05.2013/Stuttgarter Zeitung – Vor dem Reich der Affen steht ein ockerfarbener Safari-Truck. Ein Schild weist auf die nächste Expedition hin. Der Truck parkt unweit eines afrikanischen Hüttendorfs. Wind raschelt durch das Schilf, das den Blick frei gibt auf eine Landschaft mit Felsen, Bäumen und einem Flusslauf. Noch ist kein Schimpanse zu sehen, kein Gorilla zu hören, es ist still, hier im Affenparadies, zehn Minuten entfernt vom Leipziger Hauptbahnhof. Jörg Junhold betritt eine der Aussichtsplattformen, er schirmt die Augen mit einer Hand gegen die Sonne ab. Es ist ein kalter Frühlingstag im Leipziger Zoo. Junhold, 48, haben verschlungene Wege in den Zoo geführt: Nach einem Studium der Veterinärmedizin ging er als Marketingmanager von Mars in die Tiernahrungssparte. 1997 wechselte er aus der Sparte Katzen- und Hundefutter ins Raubtiersegment – als neuer Chef des Leipziger Zoos ist er Herr über Löwen und Schimpansen.
– Ukumari-Land Zoo Frankfurt: Neues Zuhause für Affen und Bären Von Lukas Gedziorowski/F.R.,16. Mai 2013 – Die ehemalige Bärenanlage des Zoos ist umgestaltet worden: Wenige Tage vor den Sommerferien will der Frankfurter Zoo sein „Ukumari-Land“ eröffnen: Ab dem 4. Juli sollen dort Brüllaffen und Brillenbären ihr neues Zuhause finden. Sie empfangen dann den Besucher direkt im neuen Eingangsgebäude. Zoodirektor Manfred Niekisch hat am gestrigen Mittwoch der Presse eine Vorabführung durch das Gelände gegeben, in dem sich nicht nur Tiere, sondern auch Menschen wohlfühlen sollen.
– Die Primatenforscherin Kathrin Dausmann entdeckte auf Madagaskar zwei Affenarten, die Winterschlaf halten, drei bis sechs Monate lang, also jetzt – die Hamburger Tierökologin hatte sie zuvor mit Sendern ausgestattet. Die eine Unterart von Fettschwanzmakis, im Osten Madagaskas, buddelt sich wegen der dort mitunter sehr kalten Tage und vor allem Nächte unter Pflanzenwurzeln und Laub in die Erde ein, und ihre Körperfunktionen verlangsamen sich – sie werden kalt und atmen nur noch einmal pro Minute. Damit ähneln sie Igeln. „Für gewöhnliche Beobachter sieht es aus, als wären sie tot,“ meint Kathrin Dausmann Die andere Unterart von Fettschwanzmakis, im Westen Madagaskas, zieht sich in Baumhöhlen zurück – bis zu 7 Monate: nicht wegen der Kälte, sondern weil in der langen Trockenzeit das Wasser und ihre Nahrung knapp wird.
– FAZ: Ästhetik der Tentakel: Eine Konferenz fragt, wie Tiere den Menschen inspirieren Kulturwissenschaftler wollen die Grundlage für hiesige „Animal Studies“ legen Dear Fellow Primates, liebe Mit-Primaten!“ So wird man nicht alle Tage zu einem Vortrag begrüßt. Aber der Biologe und Anthropologe Volker Sommer ist eben nicht nur ein erfahrener Feldforscher und Kenner der Großen Menschenaffen, er wirbt auch dafür, dass Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos Grundrechte auf Leben, Freiheit und körperliche Unversehrtheit erhalten, wie sie bisher nur Menschen zustehen.
– In den „Kunstwerken“ (Auguststraße) sprach Slavoj Zizek über die Biologie – das Leben, hier einige Notizen: classstruggle in nature/ der kommunismus muß den antagonismus zwischen menschen und tieren aufheben. wenn wir das nicht schaffen, werden die tiere über kurz oder lang alle verrückt…/wir müssen das leben der tiere und pflanzen revolutionieren… do we need to think biology? nötig wäre eine kritik der statistik/The Bolshewik were the Animals of the Revolution/They were obesessed/Sex only after we build up communism/“The animal doesn’t exist“
– Zoo Frankfurt Orang-Utan schlauer als erlaubt 25.03.2013, .hr-online.de – Die Orang-Utan-Dame „Sirih“ hält das Personal des Frankfurter Zoos auf Trab: Sie löst die Sicherheitsnetze und legt Leitungen frei. Ausbrechen will sie zwar offenbar nicht, dennoch droht ihr Abschied. Audio: Einfach clever: Orang-Utan-Dame „Sirih“ 2:31 Min (© Marco Schleicher, hr, 25.03.2013)
Mehr zum Thema Bildergalerie: Orang-Utan-Baby geboren (20.12.2012) Das 20 Jahre alte Orang-Utan-Weibchen „Sirih“ beschäftigt die Tierpfleger im Zoo Frankfurt und dessen Direktor Manfred Niekisch mit ihrer Kreativität seit längerem. „Das geht jetzt schon ein paar Monate“, sagte Niekisch am Montag und bestätigte einen Bericht der „Bild“-Zeitung. „Sirih“ bastele und zerre so lange an den stählernen Sicherheitsnetzen im Menschenaffenhaus herum, bis sie locker seien, und lege auch Wasserleitungen und Heizungsrohre frei. Dabei verwende sie mitunter Hilfsmittel wie Stöckchen und Seile. Im Prinzip verhalte sie sich artgerecht, sagte Niekisch zum hr: „Wenn die sehen, dass irgendwo etwas wackelt und sie etwas manipulieren können, dann probieren sie es auch. Egal, ob sie die Wasserspender auf Dauerbetrieb stellen oder nach den Kameras greifen: Sie probieren aus, was geht.“
Eigener Wachmann postiert – Dass „Sirih“ ausbrechen will, glaubt der Zoodirektor nicht, obwohl es in den 1970er Jahren schon mal einen Affenausbruch in Frankfurt gab. „Sie ist einfach kreativ“, sagte Niekisch. Und offenbar schlauer als erlaubt. „Wir haben derzeit keine technische Lösung für das Problem“, sagte Niekisch zu „Bild“. Daher hat die Zooführung einen eigenen Wachmann vor dem Orang-Utan-Gehege postiert. Auf Dauer werde das allerdings nicht gutgehen, schränkte Niekisch ein. Denn was „Sirih“ kann, können auch die anderen fünf Affen in ihrer Gruppe lernen oder von ihr beigebracht bekommen. „Sirih“ werde wohl umziehen müssen in einen anderen Zoo, wo sie keine Leitungen freilegen könne.
bild.de, 24.03.2013: Frankfurt – Wer genau hinsieht im Zoo, dem fallen am Stahlgitternetz der Orang-Utan-Anlage Veränderungen auf … Einige Maschen sind geweitet. An anderer Stelle wurde das Netz doppellagig verstärkt. Und neuerdings schlendert IMMER ein Sicherheits-Mann vorm Gehege auf und ab. WAS IST DA LOS? Orang-Utan-Dame Sirih (20) hat sich am Netz zu schaffen gemacht! Will Sirih etwa ausbüxen? Nö! Sie knibbelt nur wahnsinnig gerne an allem möglichen rum … Zoo-Direktor Prof. Manfred Niekisch (61): „Sirih ist sehr intelligent, sie hat sich selbst beigebracht, unsere Netze zu knacken.“ ➜ Zunächst schob Sirih ein Stöckchen durch die Maschen. Niekisch: „Dann hat sie so lange daran gedreht, bis die Klammern, die das Stahlnetz zusammen halten, weg platzten. Wir haben umgehend alle Stöcke entfernt!“ Sirihs 2. Idee: Spielseile durchs Netz fädeln, kraftvoll hin und her wackeln. Niekisch: „Wieder knackten Klammern weg. Alle losen Seile kamen sofort raus.“ Sirihs 3. Idee: Ins Netz hängen, so die Spannung raus nehmen – und die Maschen mit Zähnen plus Fingernägeln bearbeiten. Der Zoo-Chef: „Das Problem: Kann das EIN Affe, lernen es ALLE!“ Und Sirih ist eine gute Lehrerin, zeigt Rosa (23, hat Baby Sayang), Djambi (54), Lucu (8), Charly (55) gerne, was sie kann … Niekisch: „Wir haben zurzeit keine technische Lösung für das Problem. Momentan gibt es nur die Möglichkeit, einen Wachmann hinzustellen, der aufpasst.“
– Als Weibchen „getarnte“ Orang-Utan-Männchen erschleichen sich Sex 10. März 2013, 22:03, derstandard.at: Beobachtungen auf Sumatra und Borneo – Geschlechtsentwicklung und soziales Gefüge stärker als bisher vermutet vom Nahrungsangebot abhängig Orang-Utan bedeutet in der malaiischen Sprache „Mensch aus dem Wald“, doch genau genommen sind die Regenwaldbewohner mit rot-braunem Fell unsere entferntesten Verwandten in der Familie der Menschenaffen. Sie unterscheiden sich von allen anderen, weil Orang-Utan-Männchen zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen durchlaufen können und dadurch in zweierlei Typen vorkommen: Die Kleinen gleichen äußerlich den Weibchen, die Großen bilden sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Wangenwülste und Kehlsäcke aus. Nun haben Wissenschafter festgestellt, dass diese Geschlechtsentwicklung, das Paarungsverhalten und das soziale Gefüge stärker als bisher vermutet von ihrer Umwelt abhängen. Einige kleine Männchen verharren mehrere Jahre lang oder sogar während ihres ganzen Lebens auf ihrer Entwicklungsstufe, ohne dass der letzte Wachstumsschub einsetzt.
Wie die Schweizer Forscherin Lynda Dunkel und ihre Kollegen vom anthropologischen Institut und Museum der Universität Zürich nun nachweisen, kommt dieser Entwicklungsstillstand auf Sumatra öfter vor als auf Borneo, der anderen südostasiatischen Insel, auf der Orang-Utans noch beheimatet sind. Auf Sumatra machten die Forschenden doppelt so viele kleine Männchen aus als ausgewachsene mit Wangenwülsten. Während der fünfjährigen Beobachtungsphase im Regenwald bildete nur ein einziges Männchen die sekundären Geschlechtsmerkmale aus. Auf Borneo hingegen gibt es zwei Mal mehr Männchen mit Wangenwülsten als ohne. Nahrungsangebot entscheidet Diese streiten sich viel öfter um die Gunst der fortpflanzungsfähigen Weibchen als auf Sumatra, wo innerhalb des beobachteten Gebiets ein einziges dominantes Männchen die sexuellen Beziehungen zu den Weibchen monopolisiert. Weil der Urwald auf Sumatra mehr Nahrung hergibt als der Wald auf Borneo, hat das dominante Männchen genügend Zeit, die Weibchen in seiner Umgebung zu bewachen. Andere Männchen mit Wangenwülsten vertreibt er, bevor sie sich mit einem Weibchen paaren können. Doch kleinere Männchen ohne sekundäre Geschlechtsmerkmale sind unauffälliger. Auf Sumatra gelingt es ihnen deshalb eher, mit einem Weibchen zu kopulieren – auch wenn sich die Weibchen in 60 Prozent der beobachteten Fälle zur Wehr setzten. Erzwungene Paarungen gibt es auch auf Borneo.
Doch weil dort die Männchen dauernd gegeneinander kämpfen und sich die kleineren nie durchsetzen, fällt der Vorteil des Entwicklungsstillstandes weg. Umweltbedingungen formen Sozialverhalten Dass das Nahrungsvorkommen im Wald sich so stark auf das Paarungsverhalten von Orang-Utans auswirkt, hat Dunkel überrascht. „Es zeigt, dass die Organisation dieser Menschenaffen – und vielleicht auch unserer Vorfahren – variabler ist, als wir bisher angenommen hatten. Anscheinend formt die natürliche Selektion nicht nur das Aussehen, sondern passt auch das Sozialverhalten an die lokalen Umweltbedingungen an“, sagt sie.
– suedostschweiz.ch, 13.03.2013, Orang-Utan-Baby verzückt Publikum im Zoo Base:l Ein Orang-Utan-Weibchen aus Frankreich ist keine acht Monate nach seiner Ankunft im Zoo Basel erstmals Mutter geworden: Vorletzten Sonntag brachte Revital ein gesundes Mädchen zur Welt. Es heisst Ketawa, ist wie seine Mutter wohlauf – und beide verzücken das Publikum. Revital war am 31. Juli vergangenen Jahres zusammen mit Ketawas Vater Vendel aus Amnéville (F) nach Basel gekommen. Dass das zwölf Jahre alte Weibchen bereits rund drei Wochen schwanger war, habe man im Zolli damals schon gewusst, da die beiden gleichaltrigen Menschenaffen vor dem Transport eingehend untersucht worden seien, sagte Kurator Adrian Baumeyer am Mittwoch vor den Medien. Ketawa ist am 3. März am frühen Nachmittag im umgebauten Affenhaus zur Welt gekommen. Die Geburt ging sehr schnell und verlief nach Angaben Baumeyers völlig problemlos. Schon nach kurzer Zeit habe die Mutter ihr Baby dem Publikum gezeigt und es danach während rund anderthalb Stunden gründlich gereinigt.
Auch während der Medienkonferenz vom Mittwoch zeigte sich Revital den Zoobesuchern immer wieder mit ihrem erst etwa eineinhalb Kilo schweren Jungen, das sich an ihrem Körper festklammert. Fühlt sich die Mutter zu fest beobachtet, nimmt sie schon mal einen Haufen Holzwolle und baut daraus ein Versteck für sich und Ketawa. Revital ist erstmals Mutter geworden. Sie mache ihre Sache super, sagte Kurator Baumeyer. Manchmal noch etwas unsicher gebe sie sich grosse Mühe und kümmere sich entspannt und ohne Stress um ihr Baby, das sie nun während den nächsten fünf bis sechs Jahren stillt. Grosses Interesse am Nachwuchs bekundet auch der Vater, der mit Mutter und Töchterchen zusammenlebt. Vendel versucht immer wieder, sich vorsichtig dem Baby zu nähern. Dass er es berührt, lässt Revital jedoch noch nicht zu. Letztmals hatte der Zoo Basel 1990 eine Orang-Utan-Geburt vermelden können. Mit Ketawas Geburt ist die letztes Jahr neu aufgebaute Orang-Utan-Gruppe auf sieben Tiere angewachsen. Die frühere Basler Gruppe hatte derweil 2009 vor dem Umbau des Affenhauses in Gelsenkirchen (D) eine neue Heimat gefunden. (sda) 12.03.13 0:00 –
– DerWesten: Fotostrecke: Neues Affenbaby im Dortmunder Zoo – Der Dortmunder Zoo hat einen neuen Publikumsliebling. Das erst zweieinhalb Monate alte Orang-Utan-Mädchen Gaya ist der jüngste Neuzugang des Affen-Geheges.
– Mein Buchhändler teilt mir mit: Er habe da ein sonderbares Buch, das mich vielleicht interessiert: Die Biographie einer Weißen, die als Fünfjährige in den amazonischen Dschungel entführt und ausgesetzt wurde. Sie überlebte dank einer Kapuziner-Affen-Horde, der sie sich immer mehr anschloß, auch sprachlich und körperlich, d.h. sie lernte auch, bei Gefahr auf Bäume zu klettern. Einer Indianer-Horde in der Nähe schloß sie sich nicht an. Schließlich landete sie als Putzfrau mit 11 in einem Bordell, geriet dann als Putzfrau in eine Familie und lebte danach als Straßenkind in einer Kleinstadt-Gang. Kam ins Kloster – und von da aus nach Bogota, wo das Buch endet. Aus den Photos im Buch erkennt man jedoch, dass sie dann einen Engländer heiratete und mit ihm in England zwei Kinder bekam, von denen eins inzwischen selbst ein Kind hat. Ihr jüngste Tochter hat sich ihr Leben auf Tonband sprechen lassen und eine englische Ghostwriterin hat das Material zu einem Buch verarbeitet, das soeben bei Rowohlt erschien. Ein seltsames Buch, um das mindeste zu sagen, ich habe heute nacht drin gelesen: Marina Chapman: „Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam. Eine Kindheit unter Affen“. Auf Youtube gibt es einen 5-Minuten-Clip über sie: „Woman Claims She Was Raised By Monkeys“ Die Huffington Post schreibt: „While the story sounds almost unreal, cases of ‚feral children‘ raised by animals have been reported before with orphan John Ssabunnya claiming he was raised by monkeys in Africa.“ In der SZ machte man daraus eine große Story um einen Spanier, der angeblich jahrelang mit einem Wolfsrudel gelebt hatte. Den Text habe ich irgendwo gespeichert.



Und hier noch die letzten Schlagzeilen aus dem U-Bahn-Fernsehen:
„Angelina Jolie verpaßt Beerdigung ihrer Tante.“
„Madonna eröffnet Fitness-Studio in Zehlendorf.“