Die Zeitschrift „Der kleine Tierfreund“ wurde von Michael Grzimek herausgegeben, dem 1959 beim Zählen von Wildtierherden in der Serengeti mit dem Flugzeug tödlich verunglückten Sohn des Frankfurter Zoodirektors Bernhard Grzimek. Einmal konnte man im „Kleinen Tierfreund“ eine Reise in die Serengeti gewinnen. Dazu mußte man die Namen von 20 verrätselten Tieren herausfinden, dann einen Aufsatz über sie schreiben und ein Bild von ihnen malen. Am Schwierigsten war für mich darin die Wasseramsel, die auf dem Grund von Bächen läuft, um dort nach Nahrung zu suchen. Seit ich sie enträtselt habe, ist sie jedoch mein Favorit unter den Vögeln. Statt der Reise in die Serengeti gewann ich dann nur ein Photobuch von Moholy-Nagy über drei Tiere, darunter ein Vogel, die wegen einer Flugzeughavarie mitsamt ihren Transportkisten über dem Donau-Delta abgeworfen werden – und sich daraufhin in der sumpfigen „Wildnis“ gemeinsam durchschlagen.
A. Monotheistische Überwachungsinstanzen
„Wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt.“ (Dostojewski) Eine etwas simple – „unterkomplexe“ – US-Theorie besagt, dass die zu ersten Gemeinschaften gewordenen Menschengruppen – „Urhorden“ – nicht mehr dem sozialen Verhalten ihrer Mitglieder vertrauten und sich deswegen eine „übernatürliche Überwachungsinstanz“ schufen: Gottheiten, die feinste Lebensregungen der Menschen registrierten und sie noch nach ihrem Tod dafür gegebenenfalls bestraften. Daraus kreierte oder generierte schließlich der ägyptische König Echnaton einen (Sonnen-)Gott – den sogenannten Monotheismus, den die Juden dann abstraktifizierten und die Christen (mit Jesus) später quasi refamiliarisierten. (1)
.
Während heute ein Teil des noch späteren Islam darauf dringt, dass die der monomanen Instanz zugeschriebenen Gesetze (eines „gottgefälliges Lebens“) alle menschengemachten Gesetze des Zusammenlebens ersetzen müssen, bringt hierzulande der hugenottische Innenminister Thomas de Maiziere den um sich greifenden Atheismus, dem während des gottlosen Kommunismus in Ostdeutschland fast die gesamte Bevölkerung anheimfiel, mit der „Fremdenfeindlichkeit“ in Zusammenhang, weswegen er sich mit einigen Grünenpolitikern einig ist, dass dagegen nur „mehr Christlichkeit“ helfe.
.
Das scheint mir überhaupt die Alternative zu sein: Entweder Ausbau des staatlichen Überwachungsstaates oder Kontrolle durch Gott und Kirche. Für kurze Zeit schien es so, dass Gott sich mit dem Protestantismus in das Innerste jedes Gutgläubigen versenken und darin Moral und überhaupt anständiges Verhalten erzwingen würde – über die Treibriemen Bibel, Pastorenhaushalte und Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung. Der protestantische Philosoph Kant fand, das funktioniere auch, denn nur noch zwei Dinge würden ihn mit besonderer Ehrfurcht erfüllen: „Das moralische Gesetz in mir und der bestirnte Himmel über mir.“ Da oben irgendwo war der Schöpfergott, unsichtbar, aber sein moralisches Gesetz wirkte fühlbar bis tief in Kant und Konsorten hinein. Indem diese enorme „Kraft“ langsam nachläßt in den ebenso aufgeklärten wie industrialisierten Ländern, in denen mehr und mehr Bürger vom Glauben abfallen, mindestens keine Kirchensteuer mehr zahlen, und auch nicht mehr behaupten „Mein Gewissen heißt Adolf Hitler“, muß dieses Wirkwunder durch Wissenschaft und Technik ersetzt werden. Dazu dient heute das ganze Hightech-Zeug der Konzerne der USA und ihrer Heloten… (Das erzkatholische Polen nimmt dabei eine gewisse Zwitterstellung ein: Dort ist neuerdings von der totalen staatlichen Überwachung nur noch das „Beichtgeheimnis“ ausgenommen.)
.
Auch wenn der „Chaos Computer Club“ (CCC) dies partout nicht wahrhaben will – und ständig dagegen klagt, weil die „Informationstechnik“ nur zu unserem Besten sein soll: zum Informieren der Bürger und Vernetzen ihrer moralisch gerechtfertigten Aktivitäten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Beim obersten Gericht in Karlsruhe gehen manche Club-Mitglieder längst ein und aus, um Stellungnahmen für die Verfassunghüter abzugeben.“
.
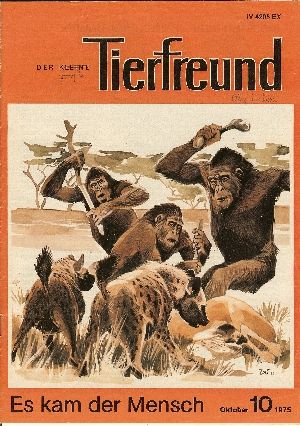
.

.
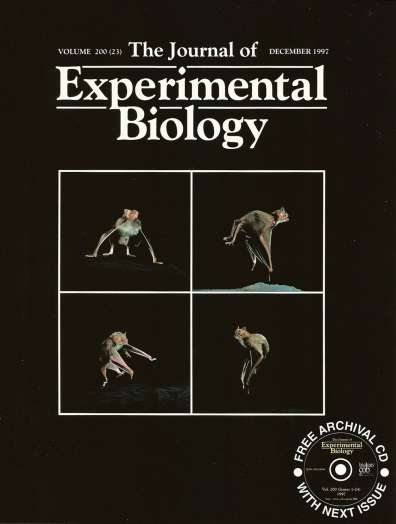
.
Anders die alten – nach wie vor „Gottesfürchtigen“ (Haredim in Israel genannt): Ihre sittenstrengen Rabbiner bildeten kein CCC sondern ein KKK: „Komitee für Kommunikations-Kalamitäten“. Die Sittenwächter des KKK sollen sich in den frommen Wohnvierteln Jerusalems vor den Handy-Läden postieren und dafür sorgen, dass nur Mobiltelefone verkauft werden, die „streng koscher“ sind, d.h. ohne Internet-Zugang und Kamera. Dabei geht es nicht darum, zu verhindern dass die eigenen oder fremden Geheimdienste und sonstigen staatlichen Kontrollbehörden über diese elektronischen Zusatzfunktionen der Handys die gutgläubigen Besitzer überwachen könnten, sondern um das Gegenteil: Um eine drohende Dekonditionierung ihrer Gottesfürchtigkeit durch die zum großen Teil unmoralischen Verführungen, die im Netz zirkulieren. Viele „Haredim“ verfahren bereits zweigleisig – indem sie ein Handy zum Vorzeigen und eins zum Surfen haben. Das zeugt bereits von einer „Doppelmoral“, die bekanntlich besonders unmoralisch ist. Wären sie Christen würde ihnen dafür im Jenseits gemäß Dantes „Göttlicher Komödie“ der achte und neunte Kreis der Hölle blühen, wo die Boshaften, Betrüger und Verräter furchtbare Vergeltung finden, denn ihre „Sünden“ zählen zu den schlimmsten.
.
Als Ersten Kreis der Hölle bezeichnete bekanntlich der orthodox-christliche Dissident Solschenizyn seine Haft in einem kleinen Arbeitslager für privilegierte Wissenschaftler, wo seine dreiköpfige Arbeitsgruppe an einem abhörsicheren Telefon arbeitete – für Stalin. (Alle drei schrieben später ein Buch darüber.) Solschenizyn bezeichnete seinen „Kreis“ deswegen nur als „ersten“, weil dort die lebenden Toten laut Wikipedia bloß mit „ewiger Sehnsucht gepeinigt werden“. In diesem Fall vielleicht, weil sie die Freiheit vermissten, draußen ein abhörsicheres Telefon für den Sowjetbürger – gegen alle staatliche Überwachung – zu konstruieren.
.

.

.

.
Anders stellt sich jetzt das Problem von Moral und Überwachung dem Wissenssoziologen Bruno Latour. In seinem Aufsatz „Die Natur ruft (an)“ schreibt er: „Kant zufolge müssen wir erst noch lernen, nicht allzu sensibel auf den Anruf der Natur zu reagieren, weil wir nur so in die Lage kommen, die Stimme der Moral zu vernehmen, die in keinerlei Verbindung mit jener der Natur steht und uns über letztere zu erheben vermag. Die Moral beruht darauf, dass wir die von der Natur ausgehenden Aufforderungen nicht oder nicht mehr vernehmen…Dass wir für den Ruf der Natur taub werden, ist für Kant eine Bedingung der Moral; für Michel Serres und James Lovelock ist diese Taubheit dagegen gerade ein Zeichen von Immoralität. Dass diese Unempfindlichkeit zum Kern moralischer Sensibilität werden konnte, ist für sie der große Skandal der Moderne.“
.
Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler hat sich in jungen Jahren statt um die Moralbildung und Taubheit des Menschen um dessen Schamhaare bekümmert, die für ihn ein Relikt des Animalischen waren – in der Renaissance pflegte man sie abzurasieren. Allerdings fehlt dieses Relikt des Animalischen beim Tier. Über diesen Anti-Kantschen Fakt wunderte er sich in einem frühen Aufsatz, der jetzt zusammen mit vielen anderen aus dem Nachlaß in einem Sammelband mit dem bezeichnenden Titel „Baggersee“ veröffentlicht wurde, inklusive eines Photos von diesem, seinem einstigen Badeort.
.

.
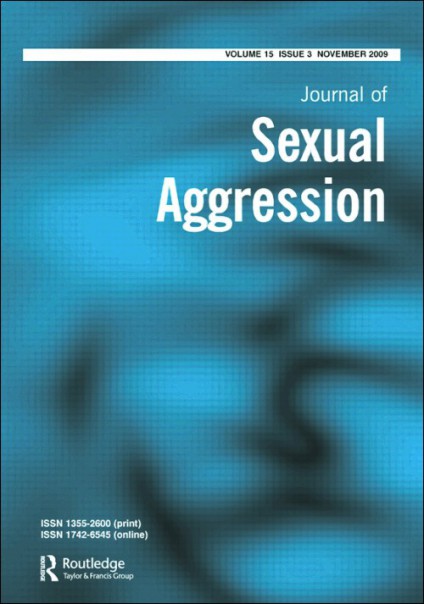
.

.
Buno Latour ist sich in bezug auf die Taubheit sicher, „dass sich die Stille keiner dem Tier wesentlichen Unfähigkeit verdankt – vielmehr ist das Schweigen gerade die Antwort der Tiere auf die Art und Weise, wie wir sie behandeln.“ Wenn wir anders mit ihnen umgehen – und sie nicht in „die Natur“ (in Naturparks und Reservate) wegsperren, sondern ihre Begegnung suchen, eine „interspecies communication“, wie Latours „Mitforscherin“, die Biologin Donna Haraway, das nennt, dann läßt sich vielleicht ein vormoderner Zustand wieder erreichen, der nicht mehr vom Schweigen einerseits und von Taubheit andererseits geprägt ist. Wenn man dem Münchner Ökologen Josef Reichholf folgt, dann haben die in die Stadt eingewanderten Wildtiere hierzu bereits den ersten Schritt getan, während wir mit „Natur-“ bzw. „Nationalparks“ und elektronisierter „Massentierhaltung“ sie immer weiter von uns fernhalten. Übrigens läuft in den Schutzzonen schon bald jedes „Wildtier“ mit einem Minisender am oder im Körper herum, und die „Haus-“ und „Nutztiere“ sowieso.
.
Bei der langjährigen Auseinandersetzung um den Nationalpark Wattenmeer meinte ein friesischer Bauer gegenüber dem „Spiegel“: „Die Grünen sind schlimmer als die Gutsherren einst.“ Dem gegenüber schrieb der Ethnologe Werner Krauss – in seinem Bericht „Die goldene Ringelgansfeder“, dass sich „der Kampf [für die Ringelgänse] gelohnt“ habe. Heute werde das verbliebene Kulturland vom renaturalisierten Land durch eine weiß-rote Schranke abgetrennt: „In dieser Schranke steckt die ganze Vermittlungsarbeit“. Die Bauern bekommen „verbilligte Karten“ für sie.
.
Aus aktuellem Anlaß füge ich hinzu: „Das glücklichste Volk der Welt“, die im Regenwald am Amazonas lebenden Piraha (siehe: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2014/04/10/ursprunge-des-europaischen-denkens/) haben nun auch „eine Straßenschranke errichtet,“ wie „Die Zeit“ meldete, deren Reporter selbst davon betroffen war – d.h. von der mobilen Zollkontrolle dieses kleinen Volkes, bestehend aus „jungen Männern mit Pfeil und Bogen und verwaschener Fußballkleidung“. Neben Wegegeld fordern sie, die permanent im transzendentalen Präsenz leben, die Rückkehr ihres Ethnologen Daniel Everett, der sie als „glücklichstes Volk der Welt“ berühmt machte, dem es dann jedoch von der brasilianischen Regierung verboten wurde, jemals wieder ihr Gebiet zu betreten. Die brasilianische Regierung geht davon aus, laut ihrer Verfassung, dass das Glück jedes Brasilianers, auch der letzten, verborgen im Regenwald noch „unberührt“ lebenden Indigenen, in der „Zivilisation“ liegt. „Ordnung und Fortschritt“ steht auf ihrer Staatsfahne.
.
Der Wissenssoziologe Latour gibt gegenüber den Ökologen zu bedenken: „Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“ Und gegenüber den Menschenrechtlern meinte er: Irgendwann werde man es „genauso seltsam finden, dass die Tiere und Pflanzen kein Stimmrecht haben – wie nach der Französischen Revolution, dass bis dahin die Menschenrechte nicht auch für Frauen und Schwarze galten.“
.
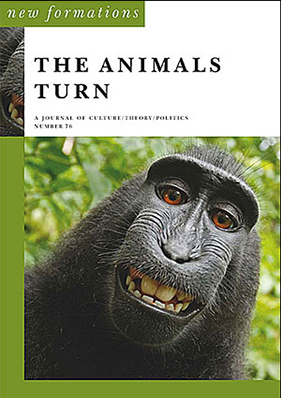
.

.
Anmerkung
.
(1) In den autobiographischen Aufzeichnungen seiner Lebensphilosophie „Notizen eines hässlichen Entleins“ (Nostrum-Verlag 2015) vermutet der sowjetische Philologe, Weltkriegsteilnehmer, Lagerhäftling und Dissident Grigorij Pomeranz (1918 – 2013), dass die Diaspora-Juden (mit Moses vorneweg?) Echnatons Monotheismus gewissermaßen retteten – vor seinem eigenen Volk, das den von ihm verfügten Kult nach seinem Tod sogleich abschaffte. „Es heißt, der Polytheismus habe die Urgesellschaft widergespiegelt und der Monotheismus die orientalische Despotie.“ (Der wir mit „political correctness“ nicht entkommen – sonst hätte man nicht ausgerechnet die Odenwaldschule wegen sexueller Verfehlungen geschlossen, die römische Kirche aber wegen viel schlimmerer Vergehen – in Irland und in Regensburg z.B. – unangetastet gelassen.)
.
Über die griechischen Götter schreibt Pomeranz an einer Stelle: „Sie waren menschlicher und die Menschen waren göttlicher“. Mit Emmanuel Levinas bezeichnete er allerdings die „Neigung der griechischen Philosophie zur Totalität, als Hang zu einer falschen Ganzheit und zu einem logisch aufgebauten System, das sich auf ein Prinzip gründete.“ Er sah in der „Totalität des philosophischen Gedankens eine der Quellen des Totalitarismus.“
.
Das Christentum ist für Pomeranz, gleich ob patriachal-familiarisierter Monotheismus, vor allem „ein ‚ökumenischer‘, ein kosmopolitischer Glaube…Der Glaube ist die Aufdeckung der unsichtbaren und unverkörperten Dinge. Darunter auch der ökumenischen Bruderschaft.“ Und das Leben darüberhinaus? „Das gewaltige Leben eines Durchschnittsmenschen…“
.
Gegen den Katholizismus wandte er ein: „Auf ihre Weise Recht haben die Juden und die Protestanten, die die fragwürdige menschliche Heiligkeit überhaupt nicht anerkennen.“
.

.

.

.
Über den Stalinschen Terror schreibt Pomeranz, „er drehte sich wie ein ewiger Motor, speiste sich selbst mit einer Lawine von Denunziationen und Geständnissen, die unter der Folter erzwungen wurden.“
.
Als er die Aufklärerin des Mordes an Kirow, Olga Girgorjewna Schatunowskaja, fragte, warum sie nicht ihre Erinnerungen aufschreibe, antwortete sie: „Ich habe mein Leben der falschen Sache gewidmet, und ich möchte mich nicht daran erinnern.“
.
Über seine Kriegszeit schreibt Pomeranz: „Die Deutschen bringen uns bei, Krieg zu führen, und wir gewöhnen es ihnen ab.“ Allmählich entstand für ihn an der Front sogar ein Raum der Freiheit: „Diese Art der Freiheit hängt häufig mit einem äußerlich erniedrigten und nicht stellenplanmäßigen Zwischenzustand zusammen…Alle an der Front waren gut Freund.“
.
Er las Schopenhauer, Buber, Meister Eckhart, Mandelstam natürlich und Florenski, sowie Konfuzius, Tagore, Krishnamurti…
.

.

.
„Der Krieg befreite einen von jeglicher Angst. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass uns, den Helden, alles erlaubt war…Verlieren die Menschen die Angst vor dem Tod, verlieren sie erstaunlich leicht auch ihr Gewissen.“ Über die Plünderungen, das Anzünden der Häuser (damit die rückwärtigen Truppen nicht so viel Beute machen konnten) und die Vergewaltigungen, die beim Einmarsch in Ostpreußen begannen, heißt es: „Jedes Mal, wenn ich das ‚Alles-ist-erlaubt‘ in der Wirklichkeit sah, wich ich jäh zurück…Ist das Gewissen nicht auch eine Art Furcht und Gottesfurcht. Und ist der Mensch nicht ein Scheusal ohne diese Furcht?“
.
Immer wieder kommt er in seinen Erinnerungen auf den Kriegskorrespondenten Wassili Grossman („Leben und Schicksal“), sowie mit „aufrichtigem Respekt“ auf den Lagerhäftling Schalamow und die Dissidenten General Grigorenko und den Atomphysiker Sacharow zurück.
.
(Nicht nur, wenn Gott tot ist, auch wenn keine Zukunft mehr existiert, ist alles erlaubt, das schrieb nicht Pomeranz, sondern die Hamburger Schriftstellerin Karen Duve in ihrem neuen Roman „Macht“. Pomeranz empfand zuletzt ähnlich: „Die gesamte Weltzivilisation befindet sich in der Krise (die im Westen getarnt, im Osten offen ist), unsere lokale Krise ist mit der Weltkrise verflochten.“)
.
Über das Reaktorunglück in Tschernobyl urteilte er: „Vieles kam von der russischen Sorglosigkeit, die ich im Krieg so liebte.“
.
Immer wieder trieb ihn der Sinn abwärts: „Die Betteltasche und das Gefängnis sollte man nicht ausschlagen. Sowohl im Gefängnis als auch im Lager gab es ein Leben.“ Dort war im übrigen „alles erlaubt und alles verboten“. Die Anfänge des sowjetischen Strafsystems waren noch relativ harmlos. Pomeranz erinnert daran: 1922 hatten die inhaftierten Anarchisten darum gebeten, sie zu beurlauben, um an der Beerdigung von Kropotkin teilnehmen zu können. Das wurde ihnen auch – auf „Ehrenwort“ – genehmigt, anschließend kehrten sie alle in den Knast zurück. Pomeranz war eine zeitlang in der „Lubjanka“ mit Wolodja Gerschuni in einer Zelle zusammen.
.

.
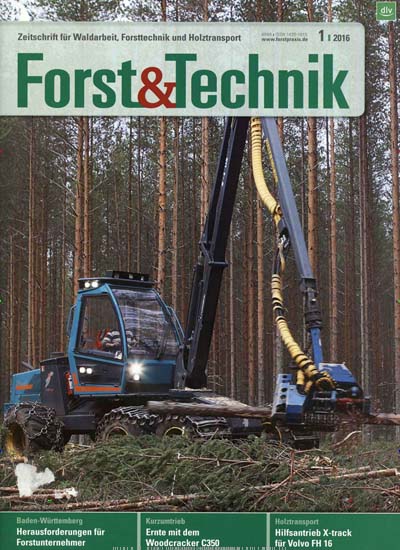
.
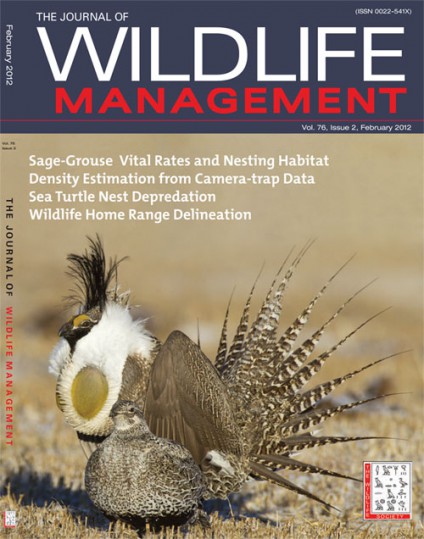
.
Über ihn – Vladimir Lvovitsch Gerschuni – notierte ich mir vor einigen Jahren:
.
„Gesegnet, wer die Welt besucht/in ihres Schicksals großer Stunde“ (Fjodor Tjutschew)
.
„Krieg und Frieden“ dauerte fort – nur hatte der Ruhm sein Revier gewechselt, schrieb Ossip Mandelstam. Spätestens 1905 wechselte er, der Ruhm, von den Generälen des Zarengefolges zum Z.K. der Sozialrevolutionäre. Mandelstam verkehrte als Schüler bei den Sinanis, die ein Landhaus in Finnland besaßen: „Einzeln kommen sie, in englischen Mänteln und Melonen, aus dem Dunkel des Sommerhauses…Als ich die Küche durchquerte, bemerkte ich den großen, geschorenen Kopf Gerschunis“.
.
Der Mitbegründer der S.R., Grigori Andrejevitsch Gerschuni, starb 1908. Sein Neffe, Vladimir Lvovitsch Gerschuni, wurde 1930 geboren. Nach dem Krieg wird er Mitglied einer antistalinistischen Gruppe – und 1949 zum ersten Mal verurteilt: zu zehn Jahren Arbeitslager. In Ekibastuz trifft er Alexander Solchenizyn. Dieser schreibt über ihn: Nachdem ein Lagerwächter die „Konterrevolutionäre“ aufgefordert hatte, sich auf den Boden zu legen, „sah man Wolodja Gerschuni aufspringen, fast ein Knabe noch, den man im ersten Studienjahr gepflückt hatte, keine Namensgleichheit, sondern der leibhaftige Neffe des anderen Gerschuni: ‚Ich verbiete ihnen, uns als Konterrevolutionäre zu bezeichnen! Diese Zeit ist vorbei. Heute sind wir erneut Re-vo-lu-tio-nä-re geworden! Nur eben gegen die Sowjetmacht!'“
.
1955, nach Stalins Tod, wird Gerschuni amnestiert. Er hilft Solschenizyn bei der Abfassung des „Archipel GULag“ (ebenso wie auch Schalamow). Im Samisdat erscheinen Artikel und Gedichte von Gerschuni. 1969 wird er wegen Besitz von KGB-Dokumenten erneut verhaftet, nach Verurteilung jedoch für unzurechnungsfähig erklärt und in die psychiatrischen Anstalt von Orel gesperrt. Nach internationalen Protesten entläßt man ihn dort im Oktober 1974. Drei Jahre später wird Gerschuni Mitarbeiter der branchenübergreifenden Arbeiteropposition SMOT und Redakteur ihrer illegalen Zeitschrift „Poiski“. 1978 umfaßte SMOT etwa zehn Gruppen mit 150 bis 200 Mitgliedern – im Gegensatz zur polnischen Solidarnosc, aber ähnlich wie in den Anfängen des tschechoslowakischen KOR „auf die nicht selbst ausgesuchte Rolle reduziert, durch gegenseitige Hilfe die minimalen innerorganisatorischen Strukturen aufrechtzuerhalten, Streiks und Ereignisse zu dokumentieren, in die weitertreibend und bestimmend einzugreifen SMOT nicht in der Lage ist“, so charakterisierte Klaus Bittermann die SMOT-Tätigkeit 1985: in seinem Vorwort zu einem im selben Jahr aus dem Französischen übersetzten Buch mit Texten der „russischen Gewerkschaftsopposition SMOT: ‚Das unterirdische Feuer'“ (vgl. dazu auch Karl Schlögels Doktorarbeit „Arbeiterproteste in der Sowjetunion 1953 – 1983: Der renitente Held“).
.
Gerschuni wird im Rahmen der Moskauer Säuberungen im Vorfeld der dortigen olympischen Spiele erneut inhaftiert, jedoch anschließend wieder freigelassen. 1982 geht der KGB gegen SMOT vor, Gerschuni wird wieder verhaftet – und kommt 1983 noch einmal in eine psychiatrische Spezialanstalt.
.
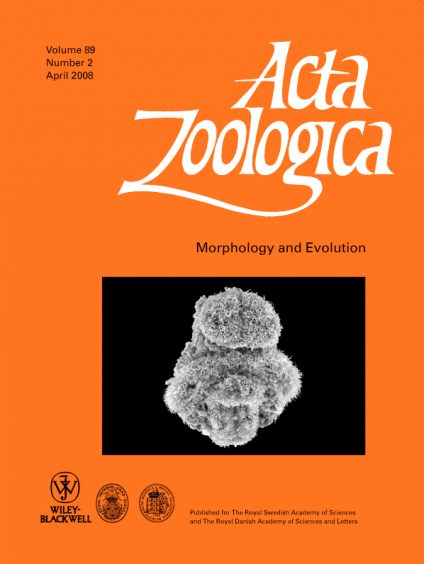
.
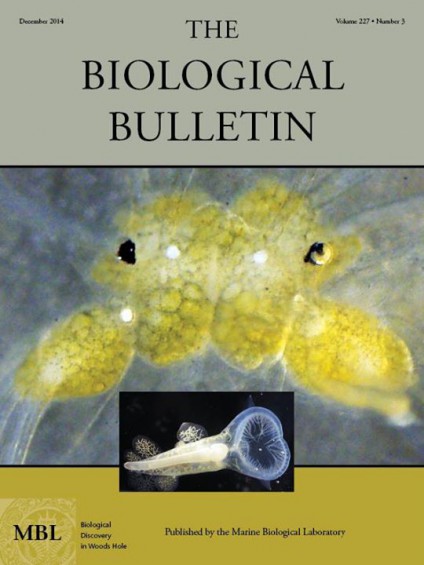
.
In einem Text aus dem Jahre 1979 schreibt er: „Ich nehme an, daß sich Fälle ereignet haben, wo die Gewerkschaften ihre Mitglieder bei Arbeitskonflikten verteidigt haben, aber jeder Arbeiter bei uns weiß, wie sehr diese Aspekte der Gewerkschaftspraxis – wenn es diese je gegeben hat – dem Wesen ‚der Schule des Kommunismus‘ widersprechen. Ich habe mehr als 20 Jahre in der Fabrik und auf Baustellen gearbeitet und erinnere mich an kein Beispiel dieser Art, obwohl ich mich stets für das Gewerkschaftsleben interessiert habe, insbesondere zur Zeit Chruschtschows, als es so schien, als ob seine mageren Reformprogramme sich auch auf die Gewerkschaften erstrecken könnten. Aber man ist nie über die Abschaffung der arbeiterfeindlichen stalinistischen Gesetze der Vorkriegszeit hinausgegangen, und bis heute sind die Gewerkschaften die Stütze der Parteibürokratie und des Staates geblieben… Ich habe (deswegen) die Gründung der SMOT begrüßt und bin Mitglied geworden. Leider ist meine Teilnahme bis jetzt im wesentlichen symbolisch geblieben, da heute nahezu jegliche Tätigkeit von SMOT verboten ist und sich auf den Kampf ums Überleben beschränkt. Dieser Kampf ist notwendig geworden durch die Repression und die Verhaftungen, mit denen die Wächter des Systems die ersten Keime einer freien Gewerkschaftsbewegung in der UDSSR zu zerstören suchen.“
.
In den späten Achtziger Jahren folgte zunächst eine Phase der relativen Duldung der SMOT. Ironischerweise wurde sie dann jedoch im Zuge von Gorbatschows „Perestroika“ zusammen mit einigen anderen Oppositionsgruppen zerschlagen. 1993 starb Vladimir Lvovitsch Gerschuni. Die Moskauer Gruppe „Memorial“ bewahrt einen Teil seines Nachlasses auf. In der Zeitschrift „Gegner“ veröffentlichten wir 2001 ein Gedicht – ins Deutsche übersetzt – von ihm.
.
Zurück zu Pomeranz, der in den Sechzigerjahren eine Kontroverse mit Solschenizyn hatte, auf die er in seinen „Notizen eines hässlichen Entleins“ mehrmals zurückommt: Während Solschenizyn die „Intelligenzija“ ablehnte, konnte Pomeranz seiner Idee vom „russischen Volk“ nichts Positives abgewinnen. Zudem begriff er eine Geschichte mit realen Personen in Solschenizyns „Ersten Kreis der Hölle“ als gemein ausgedacht.
.

.

.
Für Russland behauptete Pomeranz eine tiefe Kluft zwischen der Intelligenzija und dem Volk, nur in der Tschechoslowakei existiere sie nicht. Die meisten Texte von Pomeranz erschienen im Samisdat, einige im Ausland. Er wollte mit seinen Schriften nicht überzeugen, sondern „anstecken“. „Das Druckverbot galt für mich von 1976 bis 1987 einschließlich.“ Nach 1990 durfte er auch ausreisen. Sogar die Bundeswehr lud ihn einmal ein. „Mit 70 begann ich wieder, mich ins Leben durchzuschlagen.“ Aber auch vorher verlor er so gut wie nie seine „Lebensfreude“: Im Rubljowskij Wald (wo sein erster Essay entstand), am Wochenende auf der Datsche, im Sommer in Koktebel…“Im Lager vertiefte ich mich in die weißen Nächte.“
.
Seine zweite Frau brachte ihn „erst mit vierzig“ dazu, in der Natur genauer hinzuschauen, sich z.B. für den „Naturkalender“ zu interessieren. Er zitiert P’ang Yün: „Wie erstaunlich dies ist! Wie übernatürlich und wunderbar dies ist!/ Ich schleppe Wasser, ich bringe Brennholz.“ Im westlichen Ausland merkte er: „Es ist schwieriger, sich von der marktwirtschaftlichen als von der staatlichen Gemeinheit abzuschotten.“ Inmitten all der Kunstwerke in Florenz geriet er „in den Zustand einer leichten Ekstase“ (als hätte er nicht Tee, sondern starken Teesud getrunken). Sein „Zustand“ war das (sowjetische) Gegenstück zum „Stendhal-Syndrom“ – Ohnmachtsanfälle angesichts der ganzen Renaissancekunst in Italien, worunter vor allem amerikanische Touristen leiden.
.
Bei Ravenna auf einem Kongreß traf er den Philosophen Hans-Georg Gadamer. Sie unterhielten sich über Heigegger, nach der Rückkehr kaufte er sich in Moskau einige Bücher von Gadamer und setzte so das Gespräch mit ihm fort. (Bei der Trauerfeier für Gadamer in Heidelberg 2002 meinte der Universitäts-Rektor in seiner Vorrede: Die schlimmsten Folgen von 68 seien noch immer nicht beseitigt. Und der Ministerpräsident Teufel fügte im Beisein des Festredners Jacques Derrida hinzu: Die Postmoderne würde bloß die Jugend verderben. Das aber nur nebenbei, damit es nicht ganz unter den Tisch fällt.)
.
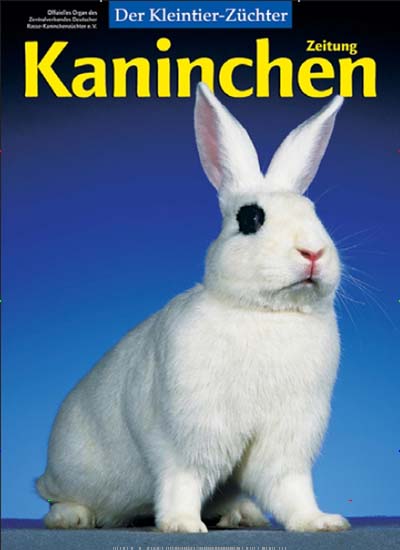
.
Im Zusammenhang mit dem „Antisemitismus“ begreift Pomeranz die (jüdische) „Assimilation“ zwar nicht nur als schmerzlich, sondern auch als fruchtbar, aber er wünscht keinen Zerfall seines „inneren jüdisch-russischen Reiches“. In den späten Achtzigerjahren bemerkt er: „Der Raum für die Seele wird auch zu einer kommerziellen Dienstleistung…Und wenn man nicht nach der Lüge lebt? Dann werden Sie allmählich zu einem Ausgestoßenen. Man kann nur als Hausmeister arbeiten.“
.
Pomeranz war 18 Jahre lang Bibliograph in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften – „doch die Lebensfreude ging mir nicht verloren…Man sagt, Dumme hätten Glück.“ Das Glück hat tatsächlich „etwas vom Erfolg, vom dummen Dusel…’Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen’…Auf die Frage ‚Welche Moral brauchen wir?‘ antwortete ich: eine persönliche. Die jedes Mal im Herzen ausgetragen wird. Die sich aus keinen Regeln ergibt…Alle Revolutionäre waren Logiker. Dadurch unterscheiden sie sich übrigens von Rebellen und Dichtern.“ (Pomeranz war zwei Mal mit Dichterinnen verheiratet, in seinen Erinnerungen zitierte er viele Gedichte von ihnen.)
.
Anfang 1968 spürte er: „in Tschechien kochte alles.“ Er wollte nicht weiter mit Solschenizyn streiten, zudem hatte ihn dessen „Archipel GULag“ geradezu begeistert, und er kürzte daraufhin seinen Text „Der Mann ohne Eigenschaftswort“ (The Man Without Adjectives). Aber dann kam im August der Einmarsch der Roten Armee in Prag.
.
1985 war die bleierne Zeit derart, dass er Je. W. Sawadskaja beipflichtete: „Man muß entweder leben oder Zeitungen lesen.“ Damals bemerkte er die sich andeutenden Veränderungen zunächst nicht: „Radio hörte ich nicht und den Fernseher schaltete ich ein, um Ballett zu sehen.“ (Ich nehme an, dass Pomeranz damit meint, dass er nur die Tode der obersten Parteiführer zur Kenntnis nahm, denn dann wurde im Fernsehen jedesmal das Schwanenballett gezeigt.
.

.
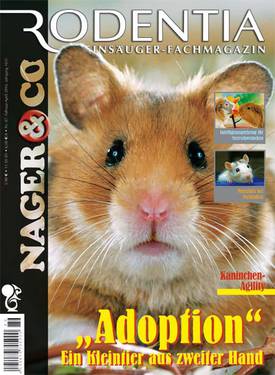
.
.
B. Natur und Moral
.
Ökologie nennt man die Wissenschaft vom Haushalt (dem „oikos“). Der Ökologe Josef Reichholf kritisiert daran, dass diese einen anzustrebenden statischen Idealzustand impliziert, in dem Ein- und Ausgaben ausgewogen (balanciert) sind. Dabei ist alles darin im Fluß, man muß nur lange genug beobachten (Öko-System-Daten sammeln). Aber: „Ist der Öko-System-Begriff überhaupt hilfreich? Wo beginnt und endet ein Öko-System?“ fragt er. „Das Leitbild vom ‚Haus der Natur‘ ließ sich mit so selbsterklärenden Bildern wie Nischen (ökologische Nische), Ebenen, Betriebskosten und Stabilität füllen. Fast alle zentralen Begriff der wissenschaftlichen Ökologie beziehen sich auf mehr oder weniger festgefügte Verhältnisse, die damit der Vorstellung Vorschub leisten, dass sie auch so sein müssen…Parallel dazu wurde die Ökologie immer stärker von einer fakten- und wissensbasierten Forschung zu einer Arbeit an Computermodellen reduziert.“ Damit zusammen hängt laut Reichholf eine unselige Anglifizierung dieses Faches und seiner Begriffe. Überhaupt kann er sich mehr und mehr für die deutschen Biologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begeistern: Was und wie die alles schon erforscht haben! (0)
.
Während die Naturschützer heute die Spaltung von Natur und Mensch (Kultur – würde Bruno Latour sagen) vorangetrieben haben, im Verein mit der „wissenschaftlichen Ökologie, die in ihren neuen Modellen den Menschen als Störfaktor einführte und den Spezialzweig der Störungsökologie einführte.“ Reichholf hat sich selbst eine Weile daran beteiligt. Oft wird dieser Forschung „ein künstliches Korsett aus Zahlen und Meßgrößen übergestülpt. Denn alles, was sich in Formeln und Maßzahlen ausdrücken läßt, erweckt den Anschein von größerer Wissenschaftlichkeit…Aber wir jungen Ökologen störten uns nicht daran, denn die Modelle und die ihnen zugrunde liegende Mathematik werteten die Ökologie auf. Sie hatte damit Eingang gefunden in den gehobenen Kreis der quantitativen Naturwissenschaften.“ Sein dem am Wenigsten unterworfenes Buch – über Rabenvögel veröffentlichte Reichholf erst 2009, es löste heftige Kontroversen aus, schreibt er.
.
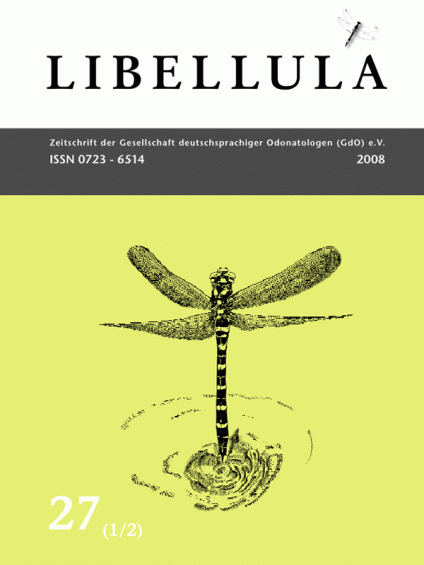
.

.
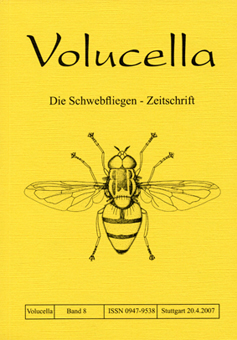
.
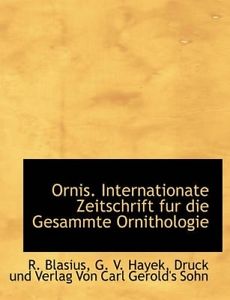
.
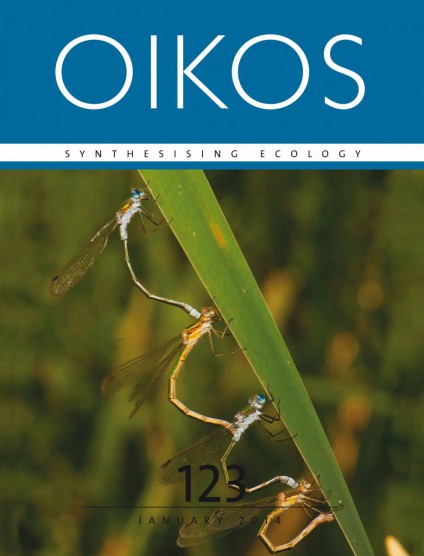
.
Bei seinen Forschungen in den Stauseen des Nationalparks am oberen Inn hatte Reichholf sich auf Wasservögel spezialisiert, u.a. auf Schwäne. Aber auch die dankten es ihm nicht: Um sie auseinander zu halten, mußte er sie beringen und dazu diese Nestflüchter erst einmal einfangen: Sie schissen ihn dabei jedesmal voll, aber noch schlimmer war, dass sie ihn im Gegensatz zu anderen Naturbeobachtern fortan mieden: „Sie drehten ab, sobald sie mich sahen. Ich war ihr Intimfeind geworden.“
.
Das selbe war bereits Konrad Lorenz beim Beringen seiner Dohlen passiert, weswegen er sich jedesmal verkleidete und eine Maske aufsetzte, wenn er sich ihren Nestern auf dem Dach des elterlichen Hauses näherte: „In einem gruseligen Teufelskostüm mit Hörnern, Schweif und Klauen kletterte der Herr Professor von Schornstein zu Schornstein, zur Verwunderung der Passanten drunten, die so entgeistert gafften, dass ich fürchten mußte, ‘ins Narrenhaus eingeliefert zu werden’,” schrieb er.
.
Bei den vom amerikanischen Rabenforscher Bernd Heinrich in Volieren gehaltenen Kolkraben reichten verschiedene Kopfbedeckungen: Seine „rote Mütze“ – die „gute“ – setzte er auf, wenn er sie fütterte; eine schwarze – „böse“, die er über die Augen zog, und vor der sie sich fürchteten, trug er dagegen, wenn er sie mit dem Netz fangen mußte, um sie zu wiegen: „Es ist wichtig, dass ich deutlich signalisiere, ob ich Gutes im Sinn habe.“ Auf Deutsch erschienen von ihm bisher zwei Bücher: „Die Seele der Raben“ („Ravens in Winter“ -1989) und „Die Weisheit der Raben“ (Mind of the Raven“ – 1999)
.
Der US-Rabenforscher John Marzluff führte mit einigen Studenten auf dem Campus seiner Universität, wo Krähen lebten, diesbezügliche Experimente durch: Diejenigen, die Im Nest Junge beringt hatten, wurden noch lange danach von den Krähen wütend verfolgt, während eine Studentin, die sie lange gefüttert hatte, als „Freundin“ angesehen wurde. Marzluff ging es dabei um die ausgezeichnete Gesichts-Gedächtnis-Leistung der Rabenvögel.Von ihm und dem Zeichner Tony Angell seien die Bücher „In the Company of Crows and Raven“ (2005) und „Gifts of the Crow“ (2012) erwähnt.
.
Ich beobachtete: An der Eidermündung in Schleswig-Holstein eine brütende Seeschwalben-Kolonie auf dem Beton des Stauwehrs. Sie brüteten keinen Meter von den ihnen dabei zuschauenden Touristen entfernt. Ihre Nester bestanden aus schnell zusammengeklaubtem Unrat, den die Flut angespült hatte. Attackiert wurden von ihnen nur die Vogelschutzwarte, wenn sie sich dort inmitten der Nationalparktouristen sehen ließen. Sie beringen jedes Jahr ihre Jungen, was die Vögel als Angriff auffassen. Nicht nur Rabenvögel haben gute Augen und ein gutes Personen-Gedächtnis.
.

.

Die wissenschaftliche ökologische Freilandforschung wird jetzt mehr und mehr von privaten Studien abgelöst, „im universitären Bereich abwertend Amateurforschung genannt,“ schreibt Reichholf. „Auch dass Modellrechnungen an Globalszenarien und der damit verbundene Megakongress-Tourismus immense Mengen Energie umsetzen, wirft Fragen nach der Moral [der Wissenschaft] auf.“ (Reichholf begleitete einst den Umweltminister Klaus Töpfer auf mehrere internationale Klima- und Umweltkonferenzen.)
.
Aber jetzt, mit 70 und nachdem er wie wir alle einen „schweren ökologischen Fußabdruck hinterlassen“ hat, reift in ihm die (postprotestantische) Erkenntnis: „Die Menschen brauchen schlechtes Gewissen.“ Er selbst fühlt sich mit seiner „Lebensweise“ schuldig, tröstet sich aber damit: „Vielleicht geht sie ja rechtzeitig vorüber, die Zeit des Menschen, bevor allzu viel Natur vernichtet ist. Dann erholt sie sich wieder. Leider haben wir, habe ich nichts mehr davon.“
.
Ähnliches hat auch die Tierbefreierin und Schriftstellerin Karen Duve kürzlich in ihrem Endzeit-Essay „Warum die Sache schiefgeht“ geäußert: Am Schluß ihrer pessimistischen Weltbetrachtung schöpft sie nur noch daraus Hoffnung, dass nach dem Untergang der Menschheit eine andere Spezies hochkommt: „Großäugige, intelligente Weidetiere. Es kann doch eigentlich nur besser werden.“ Der Kuhforscher Robert W. Hegner hatte schon vor dem „Welterfolg“ des Neoliberalismus die Wiederkäuer an die Spitze der evolutionären Säugetier-Entwicklung platziert, weil ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.
.
.
Reichholf ist trotz seiner Öko-Ideologiekritik nicht frei von Ideologismen – mit seinem darwinistischen Utilitarismus, in dem stets nach dem „Nutzen“ gefragt wird. Selbst die Kooperation von Individuen wird als Mutualismus begriffen, d.h. sie geschieht zum „Nutzen“ der Beteiligten. Der Rabenforscher John Marzluff spricht sogar von einer „mutualistischen Ko-Evolution“ – zwischen Raben und Menschen.
.
Der Zoologe Bernd Heinrich schreibt über die Rufe eines Raben nach seinen „Kumpanen“, wenn er ein größeres totes Tier entdeckt hat: „Für mich ist es ein elegantes System des Teilens, das die Evolution da entwickelt hat, denn es ist nicht abhängig vom so oft unzuverlässign Altruismus eines einzelnen.“ In „Die Weisheit der Raben“ schreibt er: „Sowohl Sender [Nestjunge] als auch Empfänger [Elternpaar] haben Nutzen von der Kommunikation. Aber Kosten und Nutzen der Beteiligten können schwanken, und die Evolution verfolgt bei allen Beteiligten das Ziel, die Kosten zu minimieren.“ Aus einer banalen Bemerkung schließt er auf eine „Formel“ für die ganze Naturgeschichte – mit dem BWL-Begriff „Kosten“ auch noch. Der „Nutzen“ wird heute gerne in Energiemengen gemessen: Input-Output, dazwischen befindet sich eine Black Box: Sei es Pflanze oder Tier oder alles zusammen in einem „Öko-System“.Bernd Heinrichs halbe Studie über Hummeln besteht aus Energiemessungen.
.
Und Reichholf ist von klein auf an aufs Zählen fixiert, wie er in seinem vorläufigen Résümee eines unermüdlichen Erforschers der Naturgeschichte „Mein Leben für die Natur. Auf den Spuren von Evolution und Ökologie“ (2015) erwähnt.“Saß ich am Fernrohr, betätigten meine Finger ganz automatisch die Zähluhren…Es wurde mir nie langweilig, obgleich ich mit den Zahlen noch nichts anfangen konnte.“ In Tansania schaffte er später „mit einer Zähluhr in jeder Hand nach einiger Übung ein gleichzeitiges Zählen dreier verschiedener Arten, eine davon im Kopf.“ Das schafft „Tatsachen“, ebenso wie seine Photographiererei.
.

.
„Tatsache ist“ aber auch, schreibt Doris Lessing in einem ihrer hervorragenden Bücher über einige Londoner Katzen, „dass jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer mehr über Katzen weiß als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Cat News‘ oder ‚Pussy Pals‘ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“
.
Doris Lessings Katzen-Texte stehen in einer interessanten Tradition engagierter englischer Tierliebhaberinnen – aus der heraus solche phantastischen Bücher wie Clare Kipps „Clarence der Wunderspatz“ (1956) und Gwendolen „Len“ Howards „Birds as Individuals“ („Alle Vögel meines Gartens“ – 1954) entstanden. Die beiden waren musikalisch ausgebildete Hobbyornithologinnen, ihre Bücher wurden vom Biologen Julian Huxley bevorwortet; für die deutsche Ausgabe von „Clarence der Wunderspatz“ schrieb der Basler Biologe Adolf Portmann ein Nachwort.
.
Was Huxley in Len Howards „Tatsachenberichte“ schrieb, gilt erst recht für die Spatzenbiographie von Clare Kipps: „Howards Buchtitel – ‚Birds as Individuals‘ – weist auf einen der Hauptpunkte in dem Buch hin, dem die Verfasserin ihr Interesse zugewandt hat.“ – Und das über Jahre und Generationen, wobei es u.a. um Blaumeisen und Amseln ging, die von ihr gefüttert und umhegt wurden, und vornehmlich in ihrem Garten lebten, wozu auch das Innere des Hauses gehörte. „Nur wenn die Vögel zutraulich werden und keine Angst mehr haben, kann ein Beobachter hoffen, einen Blick in das Geheimnis ihres Lebens zu tun,“ meint Julian Huxley, der selbst Reiher und (arktische) Tauchvögel erforschte.
.
Egomanische Dichter sind dazu selten geeignet. Beispielsweise Peter Handke in: „Gestern unterwegs, Aufzeichnungen November 1987 bis Juli 1990“ (2005)
Der Autor ist in diesen anderthalb Jahren durch die halbe Welt gereist, mit Bus, Zug und Flugzeug, nirgends hielt er sich lange auf, gelegentlich unternahm er kleine Spaziergänge. Seine Aufzeichnungen bestehen aus kurzen Beobachtungen, Aphorismen und Notizen für weitere Buchprojekte. Die österreichische Zeitschrift „Profil“ nennt Handke in ihrer Rezension von „Gestern unterwegs“ (dem 4. in diesem Stil geschriebenen Buch des Autors), einen „Dichter, Feldforscher und Wandervogel“. Eigentlich sind alle drei Bezeichnungen zu hoch gegriffen, vor allem der „Feldforscher“. Im Folgenden seine Bemerkungen über Spatzen, für die er ein besonderes Interesse entwickelte:
„Gestern, als es noch nicht regnete, bei trockenem Asphalt, landete neben einem liegenden Platanenblatt ein Spatz, und das Blatt flog davon kurz auf; als ein anderer Spatz landete, rollte von ihm ein Steinchen hin auf das Blatt.,“ am Busbahnhof von Ljubljana, Slowenien 20.Nov. 1987.
„In-der-Welt-Sein (angesichts, ja angesichts, der abgefallenen Blätter jetzt im Morgenlicht von Zadar, mit Alten und Kindern als Passanten, mit Spatzenschreien.““
„Dubrovnik, Morgendämmerung, Spatzen raschelnd in der Palme.“
„Die Spatzen fliegen unter dem Wind (sie fliegen gerade im Tiefflug über den nassen Boden, lauter schrillend als der Sturm, diesen durchdringend.“ 6.Dez.1987
„Heute, noch in Bitola, gegen Mittag, beim Busbahnhof, dachte ich: ‚Wo bleiben die Spatzen?‘ Und im nächsten Moment landete mir schon einer vor den Füßen, und einen Moment später war der ganze Vorplatz spatzenvoll.“
Im Busbuffet von Florina, Griechenland: „draußen die Spatzen in einem Straßenbusch, der von ihnen, den Unsichtbaren, ruckelte.“
In Dodona: „Spatzen, kleine Fliegen in Stromlinienform.“
In Ioannina: „Die Spatzen und die Farne (die Spatzen hervorschwirrend aus den welken Winterfarnfeldern.“
„Olympia, Morgen, Spatzen.“
Die Startschwelle des Stadions von Olympia, „der etwa 20 Meter langen, aus hellem Marmor, und auf dieser langen Linie saß ein einzelner Spatz, und ein Flugzeug flog hoch darüber – gut, dass die Spatzen sich zu den Trümmerfeldern gesellen.“
In Arkadien: „Eisenhaufen neben den Gleisen, die Schrauben darin wie verrußte Zigarren, samt Spatzen…“
Mykene: „Graues Bruchland, das sich regt und regt und regt: von den grauen Spatzen.“
Gizeh, Ägypten: „die Spatzen auf den Pyramidenblöcken.“
Kairo: „im dicken Stadtstraßenstaub, wie einst auf den ländlichen Feldwegen der beginnende warme Sommerregen; die Beheimatung wieder durch die Allgegenwart der Spatzen.“
„Und in der Dämmerung dann auf dem Platz das wilde Geschrill der sich sammelnden Spatzen in den spärlichen Bäumen…“
An der Bahnlinie Clamart, Frankreich: „Die Stimme aus dem Dornbusch spricht von überallher, aus den Spatzenlauten..“
Tokio, Japan: „Der Schall der ersten japanischen Spatzen vor dem Fenster.“
„Oben auf dem Kastell das Trillern der Spatzen.“ Lissabon, 18.März 1988
„Die Spatzen am Meer als fliegende Fische.“
„Im Finstern des Vormorgens jetzt das Schrillen der ersten Spatzen.“
„Indem du wieder im Dunkeln die Spatzen belauschst, heute am Sonntag kaum übertönt durch die Autos.“
Leòn, Kastilien, 2.April 1988: „Spatz auf dem Zebrastreifen.“
„Spatzen in der Trauerweide, von der Weide das Wort ‚Trauer‘ wegschilpend.“
Arles, Frankreich: „Die Spatzen, wo sind sie heute? Und da sind sie auch schon. Und da waren sie auch schon.“
St. Antonin-sur-Bayon: „Die Spatzen sind mir lieb.“
Salzburg, 3.Mai 1988: „…wenn ein Spatz an mein Fenster kommt, dann schlüpfe ich in seine Existenz und picke im Kies herum.“
Gemona, Friaul: „Mann und Frau sind einander fremder als Mann (oder Frau) und Spatz – sie können sich vielleicht nur über den Dritten, den Spatzen, zeitweise näherkommen?“
Paris, Frankreich: „Auf wie schwachen Beinen wir stehen! – Ja, wie die Spatzen.“
Inverness, Schottland, 6.Jan. 1989: „…gestern Abend das Tausendgeschrei der seltsam großen Spatzen…die Erinnerung an den Sadat-Platz in Kairo vor genau einem Jahr, dort die Spatzen ebenso schreiend in den Bäumen.“
Birmingham, England, 18.Jan. 1989: „Abend, und auch hier die Völkerschaften der dunklen Spatzen mit den hellen Bäuchen, allerwärts auf den Simsen, wie in Inverness.“
Manchester: „Und das Schwarz der dichtgedrängten Spatzen auf den Haussimsen vom Vorabend wiederholt sich jetzt am Morgen an den Schuhreihen in der Auslage eines Schuhgeschäfts…“
Canterbury, England: „Im kahlen, weitverzeigten Vorknospenkirschbaum die Spatzen in Kirschrindenfarben…“
Dover, England: „Mein Stigmagefühl wäre etwa das einer Spatzenform in den Handflächen.“
Tours, Frankreich, 28.Jan. 1989: „In jeder Stadt unterwegs bisher zumindest ein Spatzenbaum; in dem sich die Spatzen am Abend versammeln zum Schlafen, noch bis lang in die Nacht schreiend; der Baum bezeichnet durch Spatzenkotteppiche zu seinen Füßen.“
Frankreich: „Auch in Ille-sur-T`èt die Spatzen nachts in dem einen Baum: sie schwirren wie aus dem Schlaf, wie im Schlaf von Platane zu Platane; …mitternachtlang das Rascheln und Schilpen der Spatzen, neugeborenenhaft, dazu das Geknatter der kleinen Schnäbel, ein Endlosgeknatter und -geschnäbel…“
Cerdagne, Pyrenäen: „…der Schneetag; und ein Spatz pickt vor mir auf dem Weg herum nach den da auftreffenden Flocken, eher Körnern.“
„Als der Sturm wieder einsetzt, wirbelt ein Spatz auf dem Weg auf der Stelle wie ein Blatt.“
Clamart, Frankreich 9.Juli 1989: „Der verwundete Spatz auf dem leeren Parkplatz, berührbar, todgeweiht, dahockend, ‚der Schatten seiner selbst‘: Bewahr wenigstens seine Form (jenes ‚Verschreibt!‘ = schreibt auf!, in den KZs).“
Gemona, Friaul, 18.Oktober 1989: „Ein liebliches Geräusch: das von badenden Spatzen in einer Wasserlache.“
26.Oktober 1989: „Gerumpel der Spatzen in einer welkenden Lärche.“
Soria, Spanien, 20 Dez.1989: „Verb für die Spatzen in den Winterbäumen: sie ‚knospen‘.“
Die Fassade von Santo Domingo: „Sie schubst mich, gibt mir einen Ruck, wie die Spatzen von Soria…“
„Immer wieder: Immer wieder denke ich bei aufschwaermenden Spatzen an Sternbilder (im Bus nach Salamanca).“
Auf der morgenleeren Rambla de Catalunya von Port Bou, „wo nichts unterwegs war als die Spatzen und ein Hund.“
Paris, 7.Juni 1990: „Und wieder erschienen die Spatzen als die Vögel des rechten Moments.“
Chaville bei Paris, 16.Juli 1990: „Am frühen Abend, niemand mehr da als er, betrat er erstmals sein Haus: Prachtvolle Leere. Lesen! Die lila Hortensien im Garten…Das Einfliegen der Spatzen.“
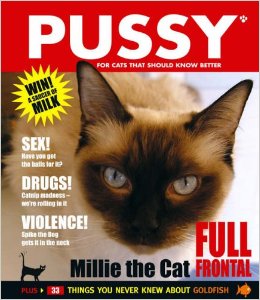
.
Die wissenschaftlichen Arbeiten der männiglichen Vogelforscher unterscheiden sich z.T. empörend von den Langzeitstudien dieser drei englischen Amateurinnen. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass der „Tierschutz“ in England „erfunden“ wurde – 1822. In England wurde aber auch etwa zur gleichen Zeit der „Utilitarismus“ – das Nützlichkeitsdenken – „erfunden“ – von Jeremy Bentham, den Darwin dann für seine Evolutionstheorie übernahm, dazu noch von Herbert Spencer die Vorstellung vom Überleben des Tüchtigsten und von Thomas Malthus den Populationsbegriff, verbunden mit der Idee der Konkurrenz als treibende Kraft der Artenentwicklung. Die drei Theoretiker gelten als Vordenker eines umfassenden Liberalismus, d.h. der definitiven Liberalisierung der Arbeits-, Boden- und Geldmärkte, verbunden mit der Zerstörung der Allmende (Common) und der Atomisierung aller Dorfgemeinschaften, was etwa um 1860 zum Abschluß kam.
.
Ebenso wie Bernd Heinrich ist auch Josef Reichholf bei seiner ornithologischen Forschung der Betriebswirtschafts-Jargon nicht fremd: „Im amazonischen Regenwald ist die Produktion hoch, die Produktivität aber (sehr) gering. Mit letzterem ist die Vermehrungsrate gemeint: der „erzeugte Überschuss“. Der Nachwuchs ist für ihn „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. In Brasilien begeisterte ihn „verständlicherweise“ die Kolibribeobachtung sehr, weil diese Winzlinge als Vögel „sehr leistungsfähig waren“. Über die Fischjagd der Reiher, die aus Warten und Lauern besteht, bemerkt er: „Das kostet sie kaum mehr als die Aufrechterhaltung des Grundumsatzes an Energie.“ Während die Tauchvögel viel Energie bei der Jagd auf Fische einsetzen: „In der Bilanz muß sich dieser Einsatz lohnen, d.h. mehr bringen, als der Kraftaufwand zur Unterwasserjagd an Energie kostet.“ An anderer Stelle heißt es: „Das Angebot nimmt Einfluß auf die Nachfrage. Diese Gegebenheit ist uns aus der Wirtschaft vertraut. In der Natur verhält es sich nicht anders.“ Das klingt fast nach der Einschätzung der Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Derlei naive Begriffs-Übertragungen von (Un-)Kultur auf Natur und umgekehrt sind tief verankert. Und sie haben System, wie der Semiotiker Roland Barthes in seinen „Mythen des Alltags“ (1957) bemerkte: „Die Bourgeoisie verewigt sich und ihre Produktionsverhältnisse, indem sie permanent Geschichte in Mythos verwandelt: Der Mythos leugnet nicht die Dinge, seine Funktion besteht im Gegenteil darin, von ihnen zu sprechen. Er reinigt sie nur einfach, er macht sie unschuldig, er gründet sie als Natur und Ewigkeit, er gibt ihnen eine Klarheit, die nicht die der Erklärung ist, sondern die der Feststellung.”
.
Nach Erscheinen des Buches über “Die Entstehung der Arten” merkte Karl Marx an: “Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluß neuer Märkte, ,Erfindungen’ und Malthusschen ,Kampf ums Dasein’ wiederkennt. Es ist Hobbes ,bellum omnium contra omnes’, wo die bürgerliche Gesellschaft als ,geistiges Tierreich’, während bei Darwin das Tierreich als bürgerliche Gesellschaft figuriert.”
.
Der Soziologe Marcel Mauss schrieb in seiner berühmten Studie „Die Gabe“ (1923/24): “Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ‘ökonomischen Tier’ gemacht…Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.”
.

.
Der “Primitive” rechnet dagegen nicht. Marcel Mauss konnte sich auf den Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski berufen, dessen dreijährige “Feldforschung” bei den Trobriandern in der Südsee, die in mehreren Büchern ihren Niederschlag fand, zu den Pioniertaten der Ethnologie zählt. In “Korallengärten und ihre Magie” (1935) versucht Malinowski das dem Gabentausch (im Gegensatz zum Warentausch) innewohnende Denken zu charakterisieren:
.
Auf den Trobriand-Inseln gibt es fünf Dörfer, die neben Gartenbau, den alle betreiben, noch fischen gehen. Dazu gehört auch eine kleine Perlmuschel, ‘lapi’ von den Eingeborenen genannt, die traditionell als wichtigste eßbare Muschel gilt. „Wenn man eine Muschel öffnete und dabei eine große, wohlgerundete Perle fand, warf man sie meist den Kindern zum Spielen zu. Unter europäischem Einfluß ist nun ein neuer Erwerbszweig aufgeblüht; dank der klugen Gesetzgebung von Papua-Neuguinea ist es europäischen Händlern nämlich untersagt, die Perlenfischerei selbst auszuüben oder zu organisieren; erlaubt ist lediglich, den Eingeborenen Perlen abzukaufen.“ Das hat sich für die fünf Gemeinden als eine „große Einkommensquelle“ erwiesen. Aber es hat ihre Insel-Gesellschaften nicht durcheinander gebracht: „Obgleich nämlich die Perlenfischerei Aussicht auf unermeßlichen Reichtum eröffnet und die gesamte Verteilung der Macht in Frage stellt, wird sie doch nur in den fünf Gemeinden betrieben, in denen man schon immer nach ‘lapi’-Muscheln tauchte.“
.
Zudem haben die Trobriander nur geringen Bedarf an europäischen Waren, seien es Schmuck, Eisenwaren oder anderes. Immer wieder bieten europäische Händler deswegen Neues an, ja versuchen sogar in Europa bestimmte Dinge für sie aus Südsee-Materialien herzustellen. Eigentlich haben die Trobriander nur Interesse an Tabak, und das auch nur in kleinen Mengen. Umgekehrt zeigen sie „für die kindische Sucht der Europäer nach Perlen Verachtung. Für die Trobriander in den erwähnten fünf Gemeinden kommt der Gartenbau (für den Eigenbedarf) zuerst, dann der Fischfang (zu Tauschzwecken) „und zuletzt die Perlfischerei“. Ein Händler schimpfte gegenüber Malinowski über sie: Wenn die Gärten in voller Freife stehen „schwimmen diese gottsverdammten Nigger nicht, auch wenn du sie mit kaloma (Schmuckmuscheln) und Tabak vollstopfst.“ Wenn auf Grund einer Übereinkunft mit einer Gartenbaugemeinde ein großer Fischzug unternommen werden muß, „kann rein gar nichts diese Hornochsen dazu bringen, sich ordentlich um die ‘lapi’-Muscheln zu kümmern.“
.

.
Jacques Derrida spricht im Zusammenhang der Gabenanalysen von Malinowski und Mauss von einer „Anökonomie“. Denn Malinowski meinte, „im Hinblick auf die trobriandische Wirtschaft von Währung, Geld oder Tauschmittel zu reden, ist ebenso unrichtig wie die Anwendung der Begriffe Kapital und Zins oder die Vorstellung, es gäbe bei ihnen in Handwerk und Arbeit eine der unseren vergleichbare Spezialisierung“ (Arbeitsteilung). Er hat ausgerechnet: „Gemessen ins Yamskörben, dem Standardmaß, oder in Tabakstangen, dem heutigen Äquivalent, kann ein Fischer nach meiner Schätzung mit einem Durchschnittsertrag beim Perltauchen täglich etwa zehn- bis zwanzigmal mehr verdienen als mit einem erfolgreichen Fischfang. Aber darauf achtet er nicht.“
.
Bereits mehr als hundert Jahre zuvor hatte der russische Weltumsegler Adam Johann von Krusenstern über eine andere Gruppe von Südseeinsel-Bewohnern in seinem Buch „Reise um die Welt in den Jahren 1803-1806“ geurteilt: Die Bewohner der Sandwich- Inseln (Hawaii) und der Washington-Inseln (Nukahiwa) werden von keinen andern an körperlicher Schönheit übertroffen.“ (Reichholf behauptet dies von den Massai). Krusenstern bemerkte aber darüberhinaus auch noch: Ihre Schönheit sei im Gegensatz zu den Europäern „kein Vorzug, den die Natur nur den Vornehmen gewährt, sie ist hier ohne Ausnahme einem jeden verliehen. Die mehr gleiche Vertheilung des Eigenthums mag wohl den Grund dazu legen. Der noch wenig aufgeklärte Nukahiwer erkennt in der Person seines Königs noch nicht den Despoten, für den allein er seine besten Kräfte aufopfern muß…Die geringe Autorität lässt ihm mehr Freiheit zur Arbeit und gewährt ihm den freien Besitz des Landes, so dass ein jeder mit sehr geringen Einschränkungen daran Theil haben kann.“
.
Schon wenig später machten die Europäer jedoch den letzten Inseln der Anökonomie den Garaus: Erst mit Betrug und Zwangsarbeit und dann mit Niedriglohnarbeit. So dass die Forschung vor einigen Jahrzehnten bereits gezwungen war, von der Ethnologie zur Ethologie überzuwechseln.
.
(„Über Tiere habe ich immer mehr gewußt als über meine engsten menschlichen Freunde,“ schrieb der Mitbegründer der Ethologie Konrad Lorenz. Ähnlich meinte Doris Lessing, dass sie immer mehr über ihre gestorbenen Katzen als über ihre verstorbenen Freunde und Verwandte getrauert habe.)
.
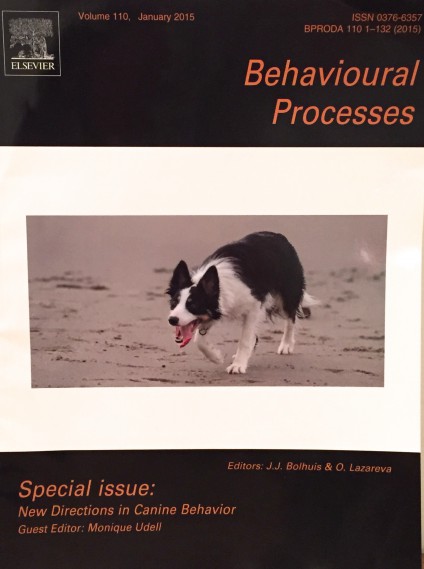
.
Mit diesem „Shift“ war es – wie noch bei Krusenstern und vielen anderen Forschern nach ihm – allerdings nicht mehr möglich, bereits nach 10 Stunden in Alaska, so wie der Naturforscher Georg Wilhelm Steller einst, Wesentliches zu entdecken; oder wie Charles Darwin, nach vier Wochen auf den Galapagos-Inseln. Die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum brauchte Jahrzehnte mit einem geduldeten Aufenthalt unter Pavianen in Kenia, um sie einigermaßen zu verstehen.
Auf einem Pavian-Kongreß in Brasilien berichtete sie, dass in ihren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen seisen sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das “wirklich nett” – nicht zuletzt deswegen, “weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der ‘Nettigkeit’…Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.”
.

.

.
Wenn man die Anökonomie verläßt, fängt man an, die Natur zu berechnen. Nach Abwicklung der deutschen Hochseefischerflotte schrieb der ehemalige Bremerhavener Matrose Jens Rösemann, um seine jahrzehntelange Tätigkeit „aufzuarbeiten“, einen Brief an seinen Enkel Armin: „Vielleicht meinst Du, dass wir Tierquälerei betrieben hätten. So dachte ich zuerst auch. Vor allem hatte ich etwas Angst, wenn ich vor einem Kabeljau von über einem Meter stand, der mit dem Schwanz schlug und sein großes Maul aufsperrte. Aber so ist das in der Natur, einer frißt den anderen. Und wir lebten nun davon, dass wir Fische fingen. Später sah jeder von uns nicht mehr das einzelne Tier, das da an Deck lag. Es war Geld! Davon lebten wir und unsere jungen Familien daheim.“ Fast logisch geht hier die darwinistische Weltsicht in eine kapitalistische über – und beide legitimieren sich gegenseitig. Die „Logik“ wird überhaupt gerne in Naturvorgängen „entdeckt“.
.
Die Fischer sind im übrigen die einzigen Lebensmittelproduzenten, die nicht säen, aber ernten, deswegen hießen z.B. die Fischrestaurants in der DDR „Gastmahl des Meeres“. Bezeichnenderweise erholten sich die „Bestände“ der Speisefische in den Meeren nur während der zwei Weltkriege halbwegs, weil die Fischer und ihre Schiffe anderweitig eingesetzt wurden.
.

.
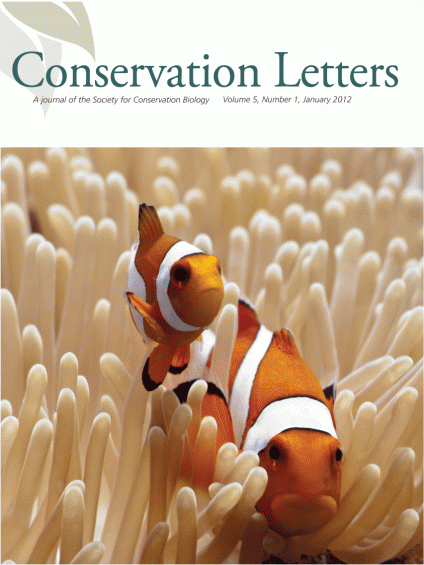
.
Zur Naivität, mit der Reichholf und Heinrich BWL-Begriffe in die Verhaltensforschung integrieren, gehört ihre weitgehende Ignoranz gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen: Während Heinrich abgesehen vom Treiben der Holzfirma in den Wäldern von Maine sich für keine Nachrichten mehr interessiert, weil er sowieso nichts daran ändern kann, wie er sagt, übersah Reichholf während seines Aufenthaltes in Eritrea schlicht den Beginn des Krieges mit Äthiopien: „In unserer Unbekümmertheit als Ornithologen hatten wir so gut wie nichts mitbekommen von den sich zuspitzenden politischen Ereignissen.“
.
Man muß jedoch auch erwähnen, dass er in seinem Buch immer mal wieder an Darwins politökonomisch fundiertem Theoriegebäude kratzt, hackt. Und dass er sich nicht scheut, immer mal wieder „steile Thesen“ aufzustellen. (1)
.
Die Art von Biologiewissen, die er in seinen demnächst 30 Büchern erfolgreich entwickelt hat, nähert sich trotz aller Populations-Schätzungen und -Statistiken gleichzeitig den wunderbaren Tier-Erzählungen der ersten Verhaltensforscher Konrad Lorenz und Oskar Heinroth an, die, wie Reichholf auch, auf Wasservögel spezialisiert waren. „Das bloße Bestimmen, das allzu leicht in eine Jagd nach Raritäten übergeht, war es nicht, was mich an den Wasservögeln fesselte, (2) Zudem ist er wie sie ein leicht misanthropischer Konservativer, der jedoch – ebenfalls wie sie – mit seinen fundierten Theorien immer wieder alte Natur-Ansichten und -Aspekte „revolutioniert“.
.

.

.
Nur schade, dass ihn dabei die Sozialwissenschaften kalt lassen, dabei steckt in der Natur mehr Kultur als man heute noch glaublich findet. Reichholf sieht das (natürlich möchte man fast sagen) genau andersherum: „Es steckt doch weit mehr Biologie in den Menschen, als Human- und Geisteswissenschaftler bereit sind zu akzeptieren.“ Er kommt, wie man so sagt, aus der bayrischen „Jagdwissenschaft“, was sich heute in Deutschland durchgängig „Wildtierforschung“ nennt. Nach Engagement im Naturschutz und Promotion (über Wasserschmetterlinge) folgte er seinem Vorvorgänger Hans Krieg (3) auf die Lebensstelle eines Sektionsleiters Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München, eine der größten Sammlungen weltweit. Zuvor unternahm er, wie vor ihm Hans Krieg, eine erste Forschungsreise nach Brasilien – in den Regenwald. Später beteiligte er sich an ornithologischen Exkursionen und Expeditionen nach Äthiopien, Italien, in die Serengeti, nach Indien, Südostasien und auf einige mehr oder weniger exotische Inseln.
.

.

.
Von diesen Reisen erzählt er in seinem o.e. Buch, und was für Gedanken und Fragen ihm dabei kamen – z.B.: Warum befindet sich „die Wiege der Menschheit“ ausgerechnet in der Serengeti (die Bernhard Grzimek einst „rettete“), d.h. warum gingen bzw. liefen die „Vormenschen“ von der dortigen Savanne aus – aufrecht – in die übrige Welt hinaus? Und was hat das mit den dort lebenden Pferden (Zebras) und ihrem seltsamen schwarz-weiß gestreiften Fell zu tun – und wie das wiederum mit der dort ebenfalls „heimischen“ Tsetsefliege zusammenhängt, die der Frankfurter Zoodirektor Grzimek den „bedeutendsten Naturschützer Afrikas“ nannte… (4) So denkt sich das alles bei Reichholf fort und zusammen. Auch bei ihm daheim, wo er den Anhängern eines ideologisierten „Ökologismus“ vorwirft, den Faktor „Zeit“ bei ihren Einschätzungen von Entwicklung zu gering zu schätzen. So erklärt er sich den Rückgang der Schmetterlinge, deren Raupen von Kohlblättern leben, damit, dass ihm „aus der Distanz von Jahrzehnten die große Umstellung aufgefallen ist, die seit den Siebzigerjahren stattgefunden hat. Weithin. Aber regional unterschiedlich. Aus vielen, aus den meisten der früheren Gemüsegärten wurden in Stadt und Land Blumengärten.“ Wenn nicht bloß saubere Rasenflächen. Seit einigen Jahren ist daneben das Anlegen von Gartenteichen beliebt. Es gibt ganze Zeitschriften, die immer neue Garten-Tipps und -Ideen liefern.
.
In Brasilien notierte Reichholf sich: „Die große Zerstörung der Tropenwälder setzte ein mit der Umstellung der Weide- auf Stallviehhaltung in Europa. Sie ist auf den Import von Futtermitteln aus Übersee angewiesen.“ Er nennt das „Öko-Kolonialismus“. Er bekam dort, in Mato Grosso, Zahnschmerzen, das verschaffte ihm einen intellektuellen Zugang zu den schlechten Zähnen der Indios und vor allem der Mischlinge, sowie auch zu den Erde fressenden Papageien dort, was sich beides auf einen extremen Kalzium-Mangel in der Region zurückführen läßt.
.
Auch die Südsee-Insulaner, deren schöne Zähne von den ersten europäischen Weltreisenden bewundert wurden, haben heute sehr schlechte Zähne. Dies liegt jedoch an ihren amerikanisierten Eßgewohnheiten (Fast-Food und Snickers). Auf Tahiti, das zu Frankreich gehört, kaufen die dort stationierten Fremdenlegionäre ihren einheimischen Freundinnen als erstes ein Gebiß, das sie allerdings mitnehmen, wenn sie ihren Heimaturlaub antreten. Diese nicht-chemische Zahnverfalls-Erklärung erwähnt jedoch nicht Josef Reichholf, sondern der Schriftsteller Paul Theroux in seinem Reisebericht: „Die glücklichen Inseln Ozeaniens“ (1998).
.
Erwähnt sei aber auch noch, was Reichholf in seinem Serengeti-Kapitel nur streift: Die kenianischen Nationalparks wurden von Richard Leakey verwaltet, der vor allem mit der Bewaffnung seiner Parkwächter im Kampf gegen Wilderer beschäftigt war. Er war zugleich Direktor des Nationalmuseums von Kenia und oberster Hüter aller archäologischen Stätten des Landes. 2007 initiierte er das „Turkana Basin Institute“, das Forschungsprojekte unterstützt und der lokalen Bevölkerung am Turkana-See die in dieser Region entdeckten vorzeitlichen Funde näherbringt. Diese Funde hatten seine Eltern – die Paläoonthologen Mary und Louis Leakey ausgegraben und dort gräbt immer noch Richard Leakeys Frau, Meave, zusammen mit ihrer Tochter. Sie fanden 1994 die bisher älteste Australopithecusart und 1999 einen 3,5 Millionen Jahre alten Schädel, den sie „Kenyanthropus platyops“ nannten (zu Deutsch: „Keniamensch mit flachem Gesicht“, auf Englisch: „Flat Faced Man“).
.
Louis Leakey beteiligte sich an der Publizierung dieser vorerst letzten Entdeckung seiner Familie. In den Sechzigerjahren finanzierte er zehn Jahre lang die drei Nicht-Akademikerinnen Jane Goodall, Dian Fossey und Birute Galdikas, damit sie Menschenaffenforschung auf eine neue – interaktive – Weise betrieben. Durch deren Arbeit und ihre Publizität entstand daraus später eine ganze feministische Affenforschung. Von der u.a. die Akteur-Netzwerk-Theorie des Wissenssoziologen Bruno Latour beflügelt wurde.
.

.

.
Es finden sich in Reichholfs neuem Buch durchaus Anklänge an den Wissenssoziologen Latour, den er aber wahrscheinlich nicht kennt, jedenfalls nicht nennt, obwohl der 2009 in Reichholfs Münchner Wirkungsstätte einen „Kulturpreis“ der Universitätsgesellschaft bekam, weil diese ihn „zu den einflußreichsten und gleichzeitig populärsten Vertretern der Wissenschaftsforschung (Science Studies)“ zählte. Eine seltsam amerikanische Begründung – übers „Ranking“. Der so Ausgepreiste stellte daraufhin sein „Kompositionistisches Manifest“ in München vor. Es beinhalte nichts „Konstruiertes“, sei leicht zu „kompostieren“ und nicht „allzu weit vom ‚Kompromiß‘ entfernt“. Als erstes richtete sich sein „Kompositionismus“ gegen die „Kritik“, denn „was nützt es, Löcher in die Einbildung zu schlagen, wenn nichts Wahreres dahinter enthüllt wird?“ Als zweites plädierte er für einen „Multinaturalismus“ – statt „die Natur“, die in einem Gegensatz zu „der Gesellschaft“ und „der Wissenschaft“ steht. Alle drei müßten wir überwinden oder jedenfalls nicht einfach als gegeben voraussetzen.
.
Latour fühlt sich dem „16.Jahrhundert näher als der Moderne“ – der Zeit vor dem „epistemologischen Bruch“, den Hobbes und Locke mit der Trennung von Objekt und Subjekt, Fakt und Fetisch vollzogen. Den heutigen „Reduktionisten“, namentlich in der Biologie, wirft er ihr „materialistisches Weltbild“ vor, das stets auf der „widersprüchlichen Vorstellung einer Handlung ohne Handlungsinstanz“ hinauslaufe. Wobei er jedoch einräumt, dass dieser Reduktionismus in den Laboratorien eine „enorm wichtige Handhabe biete, um praktische Effekte zu produzieren“. So sieht das auch der Virologe und Erforscher etlicher Rabenvögel: Lawrence Kilham, der davon jedoch nichts wissen will.
.
„Kompositionisten“ können sich laut Latour „allerdings auf solch einen Trick nicht verlassen. Die Kontinuität aller Handelnden in Raum und Zeit ist ihnen nicht gegeben wie den Naturalisten: Sie müssen sie langsam und fortschreitend komponieren. Und zwar aus diskontinuierlichen Teilen.“ Dazu gehört auch noch seine Einschätzung – eingedenk „Kopenhagen, Klimaerwärmung, Genmais und Virenepidemien“, dass die Experimente der „Naturalisten“ längst den Laboratorien entwachsen sind und alle betreffen – jeden von uns: „Mitforscher“ von ihm genannt. Auf sie setzt auch Reichholf: „Ornis“, „Bird-Watcher“ oder auch „Birder“ von ihm genannt. (5) Dabei kritisiert er immer wieder die Naturschützer, dass sie in den von ihnen durchgesetzten deutschen Nationalparks die Naturbeobachter und -forscher aussperren, die Jäger und Angler dagegen zulassen.
.
(Die Umweltschutzorganisationen ähneln mit ihren praktisch-politischen Kompromissen den Radfahrerverbänden, die scheinbar den Stärkeren – den Autofahrern – Radwege abtrotzen, in Wahrheit jedoch dazu beitragen, dass sich die Radler gegen die Schwächeren – die Fußgänger – durchsetzen, für diese sind sie inzwischen gefährlicher als Autos. Man muß aber ja vielleicht nicht so weit gehen wie der reaktionäre Westberliner Bauunternehmer Karsten Klingbeil, der am Wannsee wohnend meinte: “Wir sind früher mit unseren Mädchen im Kanu immer ins Schilf gefahren. Kein Mensch hat uns da entdeckt. Aber heute ist das streng verboten. Dafür haben die Grünen mit ihrem Röhrichtschutzgesetz gesorgt. Wo sollen die jungen Leute jetzt hin? Das ist eine verlorene Generation.“)
.

.

.

.
Kurzum: „Aus Fakten wurden Belange“ (Latour). Wir müssen uns also nun alle kümmern, kämpfen. Seine „politische Ökologie“ ist jedoch das Gegenteil von einer (grünen) „Öko-Politik“. (6) Dazu gehört die Einsicht, „Kritik, Natur, Fortschritt, das sind drei der Zutaten des Modernismus, die kompostiert werden müssen“. Aber etwas bleibt – wie er am Schluß seines „Münchner Manifests“, gestand, und das hätte sein neues noch mit dem alten Manifest (von Marx und Engels aus dem Jahr 1847) gemein: „Der Hunger nach der Gemeinsamen Welt ist das, was vom Kommunismus im Kompositionismus steckt, mit diesem kleinen aber wichtigen Unterschied, dass sie langsam komponiert werden muß, anstatt als gegeben betrachtet und allen auferlegt zu werden.“
.
Latour gab sich in München optimistisch: Es scheint als sei die Menschheit „wieder in Bewegung, aus einer Utopie vertrieben, der Utopie der Ökonomie, und nun auf der Suche einer anderen, der Utopie der Ökologie“.
.

.

.
Zurück zu Reichholf, dem das meiste nicht fremd sein sollte. Der jedoch abseits eines solchen „French Discourse“ eher an „Nature Narratives“ – an Naturgeschichten – interessiert ist. Zu den besten „Nature Narratives in American Literature“ gehört laut Wikipedia das 1968 von Edward Abbey veröffentlichte Buch „Desert Solitaire“. Es war Abbeys erstes Non-Fiction-Buch und handelte von seinem einjährigen Aufenthalt in den Canyons von Utah 1956-57. Der Schriftsteller und Anarchist arbeitete in verschiedenen Nationalparks und begründete die Umweltschutz-Organisation „Earth First“, deren Aktivisten immer mal wieder des „Öko-Terrorismus“ verdächtigt wurden. Dies gilt noch mehr für ihren Ableger, die 1977 gegründete „Earth Liberation Front“ (ELF), die vom FBI schon bald als „einheimische Terroristengruppe Nummer 1“ klassifiziert wurde.
.
Die Organisation „Earth First“ gab kürzlich einen zweiten „Direct Action Manual“ heraus, ein Handbuch für Sabotageaktionen von Umweltschützern. (7) Berühmt wurde in dieser Hinsicht der „UNA-Bomber“ Theodore Kaczynski – ein Mathematiker (seine Doktorarbeit schrieb er über Grenzfunktionen), den Wikipedia als „naturorientierten Anarchisten“ und „Neo-Ludditen“ bezeichnet. Er lebte zurückgezogen im Wald von Montana und verschickte von dort 16 Briefbomben an Informatiker und Computerhändler, wobei etliche schwer verletzt wurden und einige starben. Nachdem er damit den Abdruck seines ökologischen Manifests „Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft“ in der New York Times erzwungen hatte, konnte er anhand seines Denk- und Schreibstils identifiziert und 1996 verhaftet werden. Er bekam eine lebenslange Gefängnisstrafe.
.
Der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck drehte 2004 einen Film über ihn und seine Gegner: „Das Netz“, außerdem veröffentlichte er Kaczynskis Manifest auf Deutsch. Sein Film besteht vor allem aus Interviews mit Beteiligten an der Entwicklung von Internet-Technologien und den entsprechenden Sozialtheorien. Deren Voraussetzung war die inzwischen nahezu weltweit durchgesetzte und empirisch fruchtbar gewordene Überzeugung, dass die Gesetze komplexer Systeme unabhängig von dem Stoff, aus dem sie gemacht sind – also auf Tiere, Computer und Volkswirtschaften – gleichermaßen zutreffen. Dass der UNA-Bomber einigen dieser Denker und Macher Briefbomben geschickt hatte, wurde als „Maschinenstürmerei“ bezeichnet.
.

.

.
Diesen Begriff (in bezug auf einen Zentralcomputer allerdings noch) hatte 1953 der Schriftsteller Kurt Vonnegut mit seinem Buch „Das höllische System“ wieder eingeführt. In dem Aufstands-Szenario, das er darin entwarf, indem er die Militärforschung des „Fathers of Cyborg“ Norbert Wiener und des Mathematikers John von Neumann weiter dachte – geht es um die Folgen der Elektronisierung von Hand- und Kopfarbeit, d.h. um die aus dem Produktionsprozeß entlassenen Massen, die überflüssig geworden sind und nur noch die Wahl haben zwischen 1-Dollarjobs in Kommunen und Militärdienst im Ausland, wobei sich beides nicht groß unterscheidet. Dagegen revoltieren sie irgendwann, ihr Aufstand wird jedoch niedergeschlagen. Norbert Wiener beschwerte sich laut der Biologiehistorikerin Lillly Kay brieflich beim Autor über seine reaktionäre Rolle darin. Vonnegut antwortete ihm: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird.“ Es endet damit, dass die Rädelsführer hingerichtet werden, darunter der Überläufer John von Neumann, er verspricht: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie.“
.
Noch während der Attentatsserie von Kaczynski beantwortete der anarchistische Schriftsteller Thomas Pynchon 1984 in der „New York Times Book Review“, die alte Frage „Is it O.K. to Be a Luddit“? Er spielte damit ebenso wie Vonnegut und Kaczynski auf die englischen Maschinenstürmer um 1800 an, die man „Ludditen“- nach ihrem( fiktiven) Anführer Ned Ludd – nannte, wobei Pynchon jedoch an eine mögliche Zerstörung der heutigen Hightech-Netzwerke dachte. Sein Text endete mit dem Satz: „Wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren… Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben“. (8)
.

.

.
Theodore Kaczynski und ebenso Edward Abbey waren zunächst Henry David Thoreau theoretisch wie praktisch in die Waldeinsamkeit gefolgt. Dieser hatte dort in einer selbstgebauten kleinen Hütte zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage verbracht und darüber 1854 seinen „Klassiker aller Alternativen“: „Walden oder das Leben in den Wäldern“ (von Maine) veröffentlicht. Er beschrieb darin laut Wikipedia sein einfaches Leben am See und dessen Natur, aber er integrierte auch Themen wie Wirtschaft und Gesellschaft.“ Zentral ist für Thoreau der Begriff „Reliance“ (Autarkie, Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten). Beeinflußt hat ihn in dieser Hinsicht der Dichter Ralph Waldo Emerson, der 1841 einen Essay mit dem Titel „Self-Reliance“ veröffentlicht hatte – über „the nature of the aboriginal self“. Seine „Self-Reliance“ läßt sich mit Selbständigkeit übersetzen, wobei sie dann politisch als Konzentration auf die ländliche Entwicklung und deren Abkoppelung vom internationalen Handel begriffen wird.
.

.
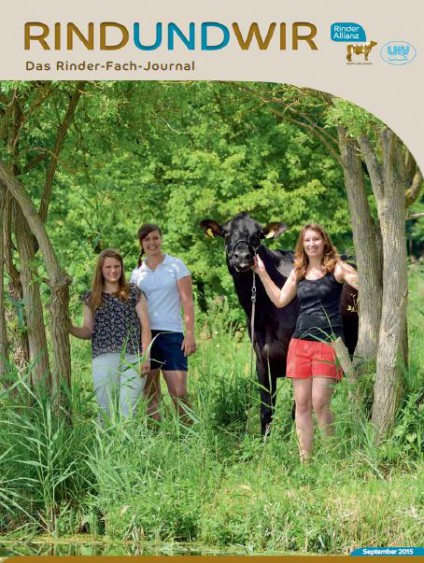
.

.
In diesem Horizont denkt auch Edward Abbey, wenn er z.B. schreibt: „Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle.“ (9) Einer seiner unmittelbaren Vorläufer war der Forstwissenschaftler, Wildbiologe, Jäger und Ökologe Aldo Leopold, dessen 1949 veröffentlichter Bericht über sein Renaturierungsprojekt am Wisconsin River „Sand County Almanac“ ebenfalls zu den „Landmarks of the Conservation Movement“ zählt.
.

.
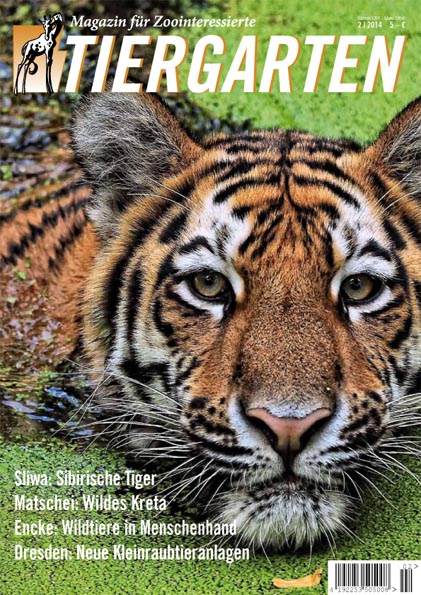
.
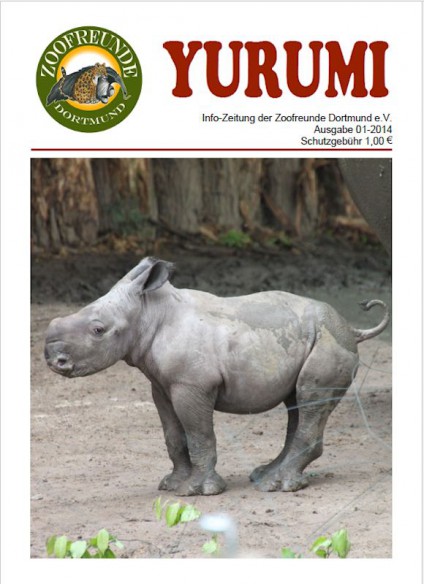
.
Auf ihn sowie auf Abbey und Thoreau beruft sich der Rabenforscher Bernd Heinrich in seinem 1994 veröffentlichten Bericht „Ein Jahr in den Wäldern von Maine“. Auch der Zoologe aus Maine lebte zurückgezogen in einer selbstgebauten Hütte – um dort das Zusammenleben von Kolkraben zu studieren. Der Uniprofessor, Langstreckenläufer und Jäger Bernd Heinrich ist aktives Mitglied der „Wilderness Society“, die sich seit 1935 auf jenes Viertel der US-Landfläche konzentriert, das allen Amerikanern gehört, d.h. auf Nationalparks, Bundesforsten, Wildreservate und die Regionen, die das U.S. Bureau of Land Management verwaltet. (Reichholf ist im „World Wide Fund For Nature“ – WWF – aktiv.)
.
Zu Heinrichs Studenten, die ihm ein paar Wochen bei seiner Rabenforschung im Wald halfen, zählte auch einer, der ein T-Shirt von „Earth First“ trug. Da in einem der Wälder von Maine zuvor gerade eine „Earst First“-Sabotageaktion stattgefunden hatte: Es wurden Maschinen sabotiert und Nägel in Bäume geschlagen, um diese vor dem Gefälltwerden zu schützen (der Konzern „Timberlands“ wollte 42.000 Festmeter Holz fällen lassen), befürchtete Bernd Heinrich, dass man ihn dieser Tat verdächtigen würde, zumal er ebenfalls einige Nägel in Bäume geschlagen hatte, allerdings nur vorübergehend, um über sie an die Rabennester in den Baumkronen heranzukommen.
.
Er wurde den Raben immer ähnlicher, schreibt er in seinem o.e. „Nature Narrative“ (10), das jedoch „Wirtschaft und Gesellschaft“ außen vor läßt, dafür aber überflüssigerweise ein paar Exkurse in Astronomie und Physik bietet.
.

.

Das Coverphoto zeigt bestimmt einen „Garten“ in Westdeutschland. Josef Reichholf fragt sich in seinem Buch „Mein Leben für die Natur“, warum in der ökologisch so versauten DDR mit ihren vergifteten Flüssen und der vergifteten Luft im „mitteldeutschen Chemie-Dreieck“ trotzdem noch jede Menge Fischadler, Biber, Kolkraben und andere Tiere lebten, die in der BRD längst verschwunden waren – trotz aller Umweltschutzgesetze, Filter- und Kläranlagen, Naturschutzgebiete und zig Millionen DM teuren Renaturierungen dort. Diese Frage wirft Reichholf auch in Interviews und bei sonstigen Gelegenheiten auf. Ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass er sie bündig – und sei es mit einer „steilen These“ – beantwortet.
Wenn man hingegen einen Ostler, irgendeinen, fragt, wie das möglich war, kommt sofort die Antwort: „Kein Geld!“ Gemeint ist damit, dass nicht alles – flächendeckend – „kultiviert“ werden konnte. Es handelte sich dabei nicht um eine bürgerliche Gesellschaft, sondern um einen „Arbeiter- und Bauern[d.h.Landarbeiter]staat“, was bedeutete, dass man mit ihnen nicht wie mit den Arbeitern [Arbeitnehmern] und Bauern [Selbstausbeuter] im Westen umgehen konnte. „Wir tun so, als ob wir arbeiten – und die tun so, als ob sie uns bezahlen.“ Andersherum, mit den Worten des DDR-Dramatikers Heiner Müller über den Westen gesagt: „Wer Arbeitslosigkeit hat, braucht keine Stasi!“ In der ostdeutschen Betriebsräte-Initiative wurde klar: Die DDR ist nicht an zu viel Unfreiheit, sondern im Gegenteil, an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrunde gegangen. Und bekanntlich waren die Produktionsbetriebe so etwas wie „Lebensmittelpunkte“ für die Werktätigen, und das waren wegen der „Arbeitspflicht“ quasi alle, trotzdem mangelte es – scheinbar paradox – in der DDR an allen Ecken und Ende an Arbeitskräften. Die Hamburger Bankierstochter Birgit Breuel sah das als Treuhandchefin natürlich am Ende ganz anders, indem sie von einer in den DDR-Betrieben bloß „versteckten Arbeitslosigkeit“ sprach (um die von ihr verfügten Massenentlassungen – „Großflugtage“ von den Treuhandmanagern genannt – zu begründen). Der Besitzer des oben abgebildeten Gartens mit Teich hat jedenfalls keine Kosten und Mühen gescheut, um etwas ganz ganz Tolles zu kreieren bzw. zu generieren, wie man heute sagt, da man mehr und mehr von „Evolution“ statt von „Geschichte“ spricht.
.

.
Anmerkungen:
(0) Das trifft sich mit seinem ökologisch-politischen Credo: „Hauptzweck ist das Persönliche, das Erleben von Natur…Erfolgreicher Naturschutz braucht nicht mehr Ökologie oder sonstige Wissenschaft, sondern viel mehr Emotion.“ Aber auch diese wurde inzwischen in die kapitalistischen „Scheuer des Nutzens“ eingefahren. Indem „die Natur heilt“: Waldspaziergänge machen gesund, Moore und Sümpfe helfen gegen den modernen Streß. Japanische Forscher haben neuerdings sogar quantitativ bestimmt, wie lange wir in der Natur verweilen müssen, um uns besser zu fühlen. Eine von ihnen 2009 in 24 Wäldern durchgeführte Studie mit dem Titel ‘Die physiologische Wirkung von Shinrin-yoku’ [Waldbaden] lieferte eine überzeugende Auflistung der Vorteile des Waldaufenthalts: ‘Senkung der Cortisol-Werte, der Pulsfrequenz, des Blutdrucks sowie der Sympathikus-Aktivität, während die Aktivität unseres parasympathischen Systems zunimmt.’ Schon nach 20 Minuten im Wald begannen die Probanden sich merklich zu entspannen.” Für ihre Hunde galt im Wald jedoch das Gegenteil. Für andere Wälder als japanische gilt das jedoch nicht. So schrieb der aus Sibirien stammende Dichter Jewgeni Jewtuschenko in seiner Biographie “Der Wolfspaß”, dass seine städtischen Freunde aus Westrussland, wenn sie mit ihm einen sibirischen Wald betraten, plötzlich ganz ängstlich wurden – und überall Gefahren vermuteten. Auch für den Waldforscher Cord Riechelmann war der Lakandonische Regenwald in Mexiko “zu voll”.
Hierzulande gibt es inzwischen ganze Zeitschriften, die sich der heilenden Wirkung von Aufenthalten und Aktivitäten im Wald und auf der Heide widmen. Die Übergänge von den biologischen Fachzeitschrift zu (Öko-) Lifestyle-Magazinen sind mit dem Neoliberalismus in Fluß geraten.
.

.

.

.
Noch eine Bemerkung zur Ökologie und zum „Oikos“: In den frühen Fünfzigerjahren erforschten japanische Biologen, Kinji Imanishi, Junichiro Itani, Masao Kawai und Denzaburo Miyadi, acht Jahre lange japanische Rotgesichtsmakaken. Dabei studierten sie 20 Horden, die von ihnen „oikas“ (Höfe) genannt wurden, sie hatten unterschiedlich strenge Regeln und Zusammenhalte – „subhumane Traditionen“ – entwickelt. „Das Bild vom Leben der Makaken, das Imanishi und seine Mitarbeiter gezeichnet haben, ist hochinteressant. Es entspricht in mehr als einem Punkt dem, was wir über das Leben der Naturvölker wissen“, schreibt der Biologe Rémy Chauvin in seinem Buch über „Staat und Gesellschaft im Tierreich“ (1964). Auf einigen japanischen Inseln hat man schon immer mit Affen zusammen gelebt, zudem „macht die japanische Kultur kein Aufhebens um den Unterschied zwischen Menschen und Tieren und ist damit bis zu einem gewissen Grad vor den Verlockungen des Anthropomorphismus geschützt … Wir sind davon überzeugt, daß dies zu vielen wichtigen Entdeckungen geführt hat“, wie Itani meinte. Leider ignorierte man ihre Forschungsarbeiten im Westen lange Zeit nahezu komplett. Das gilt auch für die künstlerische Darstellung der Natur dort. Über die Krähen von Hiroshige und Hokusai meint Esther Woolfson: Sie zeigen, dass man diese Vögel auch ganz anders als bei uns sehen kann.
.

.
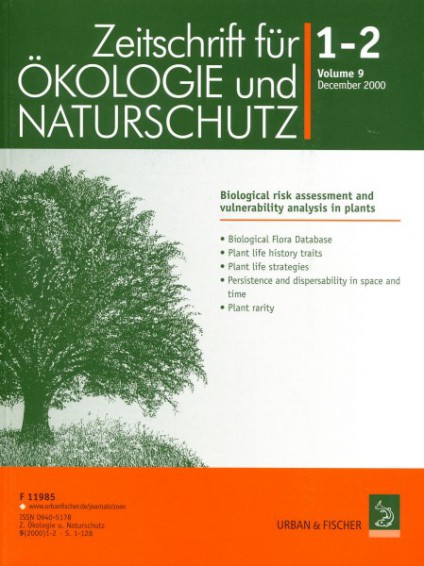
.
(1) Diese z.B.: „Jeder Organismus braucht für seine Existenz Ungleichgewicht.“ – Eine Zuspitzung seiner Kritik an ökologischen Betrachtungsweisen, die die Zeit einfrieren. Der Konfliktforscher Herfried Münkler würde das Ungleichgewicht als „asymmetrische Kriegsführung“ bezeichnen – ausgehend von einer gedachten „symmetrischen Kriegsführung“. Dafür standen einst die Ritter, von wo sich das „ritterliche Verhalten“ herleitet, das so mancher Birder noch oder schon auch in der Vogelwelt wahrzunehmen meint. Die Cowboy- und Indianer-Filme haben die moralische Seite der Ritterlichkeit in Form des Duells geradezu vorexerziert – bis in die untersten Klassen hinein. Auge in Auge sich mit gleichen Waffen gegenüber stehen – und das wo möglich noch vor Zeugen bzw. Kameras. Der Filmregisseur Alexander Kluge meint: „Früher standen sich die Menschen näher, ihre Schußwaffen trugen nicht so weit.“
.
Aber dann wurde der Krieg immer asymmetrischer. Bis dahin dass in den modernen Kriegen die Waffentechnik entscheidet – was ihre Führung laut Friedrich Engels „so rational wie eine Betriebsführung“ macht. Dies mündete in ein weltweites Wettrüsten und in militärisch-industriell-politische „Komplexe“ . Die „symmetrische Kriegsführung“ wird darin noch einmal im „Konflikt“ zwischen den Hegemonialmächten USA und UDSSR (erfolgreich) angewendet und nennt sich „Kalter Krieg“. Ausgangspunkt war dabei der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, also ein Klassenkampf bis zur Weltrevolution, gewesen, was dann im Kalten Krieg innerstaatlich auf die „Sozialpartnerschaft“ hinauslief. Nach Auflösung des „sozialistischen Blocks“ und der „Blockfreien“ fanden stattdessen wieder immer mehr „asymmetrische Kriege“ statt. Dazu zählen auch und vor allem die zwischen „Terroristen“ und „staatlichen Sicherheitskräften“.
.

.

.
Es wimmelt inzwischen von Antiterror- und Terrorismus-Experten. Der kalifornische Autor Mike Davis kam 2005 in einem Essay über die Geschichte der Autobombe auf den Autoterroristen – das Selbstbrandopfer – zu sprechen. Genealogisch wurden dabei laut Davis die von der IRA quasi erfundenen Autobomben ab 1983 von der palästinensischen Hisbollah mit dem Selbstmord-Attentäter als “Kamikaze-Kämpfer” bzw. Märtyrer verbunden. Diese Form der Selbstverbrennung in einem explodierenden Auto, wobei es oftmals gerade darum geht, andere, d.h. möglichst viele Menschen, mit in den Tod zu reißen, wird heute im Irak und in einigen anderen islamischen Ländern fast täglich praktiziert. Sie ähnelt eher dem Amokläufer als dem Selbstmörder, der mit seiner öffentlichen Verbrennung gegen unzumutbare gesellschaftliche Zustände protestiert.
.
Letzteren wird man kaum als Attentäter oder Terroristen bezeichnen können. Dennoch deuten z.B. auch die Taten der amoklaufenden Schüler in Colombine und Erfurt noch direkt auf gesellschaftliches “Unrecht” hin, wie das der ostdeutsche Schriftsteller Lutz Rathenow nannte – insofern sind sie auch ein Protest dagegen, der etwas bewirken, d.h. ändern will. Dem Westen ist die scheinbar leichte Sterbebereitschaft von jungen Islamisten zunehmend ein Rätsel, so dass immer mehr Psychogramme von Selbstmordattentätern veröffentlicht werden.
.
Der in Deutschland lebende iranische Islamwissenschaftler Navid Kermani kommt in seinem Essay – “Dynamit des Geistes” – zu dem Schluß: “Durch eine einzige, unbedingt öffentliche Tat gewinnt der Amoktäter ein Surrogat für das, was einer modernen Gesellschaft beinah per definitionem fehlt: ein umfassender Sinnzusammenhang, der dem Individuum seinen Platz zuweist…Aus der Nichtigkeit schwingt der Amoktäter sich auf zu Gott.” Dies kommt dem nahe, was einer der Söhne des polnischen Patrioten Riyszard Siwiec, der sich 1968 im Stadion von Warschau verbrannt hatte, meinte: “Nur ein vereinsamter Mensch wie mein Vater war zu einer solchen Tat fähig”. Und seine Mutter erinnerte sich: “‘Zuerst kommt Gott, dann Vaterland und Familie’, hat er immer gesagt.” Ähnliches schrieb auch die Journalistin Ute Scheub in ihrem Buch „Das falsche Leben“ über ihren Vater, ein überzeugter Nationalsozialist, der sich 1969 im Stadion von Stuttgart öffentlich mit Zyankali vergiftete. Seine letzten Worte waren: „Ich provoziere jetzt und grüße meine Kameraden von der SS“. Demnächst veröffentlicht außerdem der Historiker Karsten Krampitz seine Dissertation über den „Fall Oskar Brüsewitz“. Der DDR-Pfarrer hatte sich 1976 auf dem Marktplatz von Zeitz verbrannt, aus Protest gegen das „kommunistische Regime“.
.
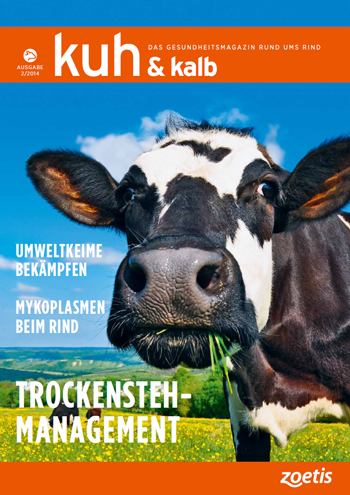
.
Nach dem sogenannten „Zusammenbruch des Kommunismus“ erläuterte uns (Wählern) 1998 ein Bundeswehr-Major auf der Bonner Hardthöhe die daraus folgende „neue NATO-Verteidigungsdoktrin“ – die gegen einen solchen oder ähnlichen “Sinnzusammenhang” (N. Kermani) gerichtet ist: “Sie ist nicht mehr nach Rußland hin angelegt, die russischen Soldaten haben inzwischen die selbe Einstellung zum Krieg wie wir auch – sie wollen nicht sterben! Außerdem ist die Stationierung von Atomwaffen in Ungarn und Polen z.B. so gut wie gesichert, es geht eigentlich nur noch darum, wie viel wir dafür zahlen müssen. Ganz anders sieht es jedoch bei den Arabern aus, mit dem Islam. Deswegen verlaufe die neue Verteidigungslinie jetzt auch” – Ratsch zog er hinter sich eine neue Landkarte auf – “etwa hier: zwischen Marokko und Afghanistan”.
.
Auch bei den hiesigen Demonstrationen kann man von einer „asymmetrischen Kriegsführung“ sprechen – zwischen Protestierern und Polizisten. Einer der ersten, der in der internationalen Studentenbewegung von einer weiteren militanten Auseinandersetzung mit der „Staatsmacht“ warnte, war der amerikanische Aktivist Jerry Rubin. Er meinte, die Eskalation habe nur dazu geführt, dass aus dem freundlichen Polizisten an der Ecke bis an die Zähne bewaffnete Bullen geworden seien. Ähnlich empfand man die Entwicklung der „Protestkultur“ bisweilen auch hier.
.
Dagegen stand jedoch dann die Einschätzung des SPD-Landrats Hans Schuierer vom Landkreis Schwandorf, wo man sich jahrelang gegen den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf gewehrt hatte – und zwar zunehmend militanter. Er meinte 2005 in einem Interview: “Für unsere Region war das eine furchtbare Zeit. Wenn man sich vorstellt, wie viele Strafverfahren gegen friedliche Demonstranten liefen. Wie sich die Polizeiführung verhielt, dann kommt einem der Zorn hoch. Die Polizeihunde, die Schlägertrupps aus Berlin, wie die gewütet haben. Doch der fünfjährige Kampf hat sich gelohnt. Wir haben an dem Standort, wo die WAA errichtet werden sollte, inzwischen ein Industriegebiet und somit einen guten Tausch gemacht. Anfangs versprach die Betreibergesellschaft DWK 3200 Arbeitsplätze in der WAA, später 1600, dann 1200. Im Industriegebiet haben wir heute 4000 Arbeitsplätze…Ich muss aber ganz ehrlich sagen: Wir haben diese Autonomen gebraucht. Denn die Regierung hätte uns noch zehn Jahre um den Zaun rumtanzen lassen.”
.

.
Auch die Selbstmordattentate, die mit dem buddhistischen Mönch Thich Quang Duc 1963 in Hué begannen, der sich aus Protest gegen den “Vietnamkrieg” der Amerikaner und die Politik ihrer Marionettenregierung in Saigon mit Benzin übergoß und verbrannte, eskalierten – mindestens in Vietnam – von „primitiver Bewaffnung“ (wie Erdfallen und Steinschleudern) bis hin zu modernsten Kriegsmitteln, die Kämpfe endeten jedoch überraschenderweise mit einem Sieg des technologisch unterlegenen aber laut General Giap moralisch überlegenen „vietnamesischen Volkes“. Auf der anderen Seite erklärte ein Sprecher des US-Einsatzkommandos die Luftangriffe so: „Wir mußten Hué zerstören, um die Stadt zu befreien.“
.
In Israel haben nach der Zerstörung Gazas durch Bomben junge Palästinenser paradoxerweise die „asymmetrische Kriegsführung“ ihres Volkes mit einer weiteren Asymmetrisierung eskaliert, indem sie nun individuell mit einem Messer angreifen – mehrere wurden bereits erschossen. Es geht den Attentätern dabei anscheinend um eine „Symmetrie des Schreckens“. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte zum Jahresende bereits eine „Chronik der Messerattacken in Israel“. Und im Januarheft von „konkret“ rät ihr Autor Alex Feuerherdt, sich anzugucken, „wie man in Israel mit dem längst alltäglichen Terror umgeht“ – nämlich cool.
.

.
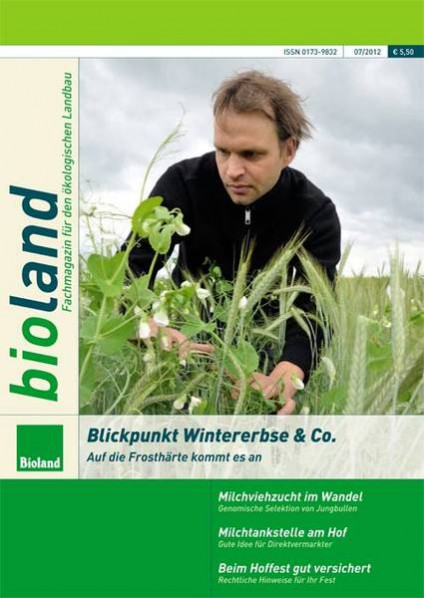
.
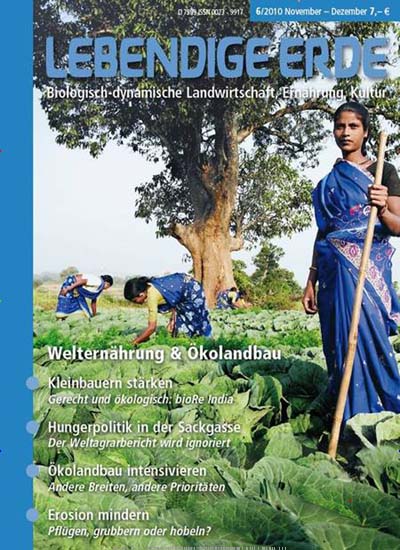
.
Zur „Asymmetrischen Kriegsführung“ gehört auch dies: Noch im 20. Jhd. verdiente die arbeitende Klasse, die Mehrheit der Bevölkerung, so wenig, dass sie kaum davon leben konnte. Dennoch sollte sie nicht alles ausgeben, sondern sparen: für Arbeitslosigkeitszeiten und Notfälle. Dazu wurden "Sparkassen" gegründet. Sie sollten die "Bevölkerung", vor allem die "unteren Schichten", zur Sparsamkeit erziehen, so dass sie so oft wie möglich ein paar Groschen oder Mark auf ihr "Sparkonto" einzahlten, damit es sich, festangelegt, noch vermehre - ein bißchen jedenfalls. . Die Emder Sparkasse "schenkte" liderlichen Personen in der Stadt sogar Geld - für ein "One-Way-Tickert" nach Amerika, damit sie aus Ostfriesland verschwanden. Umgekehrt war es bei dem Schriftsteller Wladimir Kaminer, dem als "Russe" kein Kreditinstitut in Berlin ein Konto einrichten wollte, sehr wohl jedoch die Stadtsparkasse von Jever, die ihn außerdem noch gelegentlich einlädt und großzügig bewirtet. . Ansonsten haben die "Sparkassen" sich jedoch inzwischen halb (und gedanklich sogar schon ganz) privatisiert, deswegen verfolgen sie nun entgegen ihres staatlichen Auftrags (zur "Vermögensbildung" möglichst vieler beizutragen) eine völlig andere Strategie: Sie agitieren ihre "guten Kunden", oft sogar noch nach Feierabend, ihr Geld als "Risikokapital" zu "investieren". Dazu stehen ihnen die Börsenkurse und die üblichen farbigen Werbeprospekte der vielversprechendsten Investment-Fonds und ähnlicher Kapitaleinsammler zur Verfügung. ..
. Gleichzeitig wurde aus der Freude über den Besitz eines Sparkontos die,Pflicht, ein Konto zu "führen": Auf immer mehr Rechnungsformularen steht nun: "Der Begünstigte muß mit dem Kontobesitzer identisch sein". Man kann also nicht mehr sein "Honorar" irgendwohin überweisen lassen, um es dort "in bar" abzuholen. Gleichzeitig entledigten sich die "Sparkassen" und Banken immer mehr Kunden, deren klammes Konto kaum noch "Bewegung" verzeichnete. Neue Kontobeantrager, die nur wenig Zinsen und "Bearbeitungsgebühren" versprechen, oder Gott behüte, bei der Schufa-Bonitäts-Auskunftei registriert waren, lehnten sie sogar ab. . Als daraufhin langsam klar wurde: Analog war besser! griff die Regierung ein: 1. müssen die "Kreditinstitute" seit 2010 für finanziell besonders Bedrängte "pfändungssichere", sogenannte "P-Konten", bereit halten, für das ein "Pfändungsfreibetrag nach § 850c Zivilprozessordnung von derzeit 1028,89 im Monat" gilt. 2. müssen sie ab Mitte 2016 für alle Armen, Obdachlosen und Asylsuchenden sogenannte "Basiskonten" zulassen. Sie können also niemanden mehr abweisen. . Wir können aber davon ausgehen, dass diese scheinbare Verbesserung sich umdreht - in einen Zwang, d.h. zur "Kontopflicht" wird - zur "Lebensführung" unverzichtbar. . Der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen begrüßte diesen Ukas der Bundesregierung bereits: "Dass das Girokonto für Jedermann kommt, ist ein Meilenstein für Verbraucher", meinte er. Ein Meilenstein auf dem "schwedischen Weg"? Dort will man nämlich den Bargeldverkehr ganz abschaffen: Eine brauchbare Idee, um alle analog Verdienenden (Straßenmusiker, Bettler, Drogendealer und fliegenden Händler) endgültig zu liquidieren. Schon jetzt muß man dort jeden "Coffee to go" mit Kreditkarte zahlen. In Deutschland haben knapp eine Million Bürger so etwas nicht. . Von dem ursprünglichen "Sparkassen-Slogan" (Spare in der Zeit - so hast du's in der Not) blieb nichts übrig - als eine zunehmend empfindlicher empfundene Lücke. Da hinein sprang zunächst der vom Partisanenbekämpfer zum Partisanenforscher fortgeschrittene BRD-Politiker Rolf Schroers mit der Gründung der Künstlersozialkasse (KSK) im strukturschwachen Wilhelmshaven (ich habe dort nebenbeibemerkt die äußerst niedrige Mitgliedsnummer "H007"!). Damals konnte dort jeder Mitglied werden, er mußte seine Tätigkeit nur als Kunst plausibel machen, und mitunter auch beweisen: thailändische Prostituierte z.B., dass sie singen können, um als Sängerin versichert zu werden!). Die KSK-Versicherung war, da von kapital und staatlicher Seite "kofinanziert", billiger als alle sonstigen Krankenversicherungen für "Selbständige", dazu war man dort gleichzeitig auch noch rentenversichert (ich werde deswegen, da von Beginn an bei der KSK, einmal 154 Euro Rente am Ende monatlich ausbezahlt bekommen). .
.
. Wer gedacht hat, dass er als privilegierter Kunde (König!) dort beitritt, irrte sich: die KSK ist eine Pflichtversicherung - für wenig verdienende Künstler (die Vielverdiener müssen sich unsubventioniert privat versichern). In dieser asymmetrischen Kriegsführung drehte sich das Verhältnis zwischen Kunde und Verkäufer um: der KSK-Versicherte darf (und muß gegebenenfalls) von den Wilhelmshavenern zusammengeschissen - d.h. erzogen - werden: mindestens zu regelmäßiger Beitragszahlung und vorgeschriebener Formularausfüllung. Wer die alle paar Jahre fälligen Beitragserhöhungen partout nicht mitmachen kann, der fliegt raus, und auch der Künstlerbegriff wurde mit der Zeit immer enger, weg von den "genialen Dilettanten", den Amateuren (von "amator": jemand, der liebt ohne Gegenliebe zu verlangen) gefaßt. So postete der Sachbuch-Autor Falko Hennig z.B. am 15. Januar auf Facebook: "Mein bisher größter Erfolg des Jahres: Die KSK hat meinen Ausschluß rückgängig gemacht. Darauf einen alkoholfreien Sekt!" . Vielen Autoren, die es wegen der "Printmedienkrise" besonders hart traf, raten ihre "Arbeitgeber", sich im deutschen Presseversorgungswerk anzumelden. Das ist irreführend: auch das PVW ist eine "Pflichtveranstaltung" - zur Altersfinanzierung, deswegen darf man dort ebenfalls keine Höflichkeit gegenüber den Kunden erwarten, sondern muß es sich gefallen lassen, dass man schon bei der (telefonischen) Anmeldung angeherrscht wird: Man hätte sich längst anmelden müssen! Dieser Ton gilt jedoch nicht für gutbetuchte Anmelder, ihnen wird als "Kunde" aufs Freundlichste eine "weit überdurchschnittliche Gewinnbeteiligung" mit der PVW-"Produktvariante 'Perspektive'" angeboten: "Die Kosten für die Absicherung von Garantien fallen bei Perspektive geringer aus. Diese Einsparung geben wir an die Kunden weiter." Ab einem bestimmten Einkommen mendelt sich also quasi automatisch ein Kunde aus dem pflichtvergessenen Staatsbürger heraus, der es wahrscheinlich zu keiner "Perspektive" bringen wird. Aber auch an ihn wird gedacht. Dazu heißt es im PVW-Geschäftsbericht: "Bei den klassischen Produkten steht die Presse-Versorgung mit einer Gesamtverzinsung von 4,3 % in 2015 weiterhin ganz vorne im Markt." Als Grund werden "die hohe Finanzkraft und die damit einhergehenden Freiheitsgrade" des Versorgungswerkes genannt, das auf diese Weise laut Wikipedia erfolgreich "160.000 Versicherungsverträge verwaltet". Das gelingt der PVW als Zwitter: halb staatlich-arbeitnehmerfürsorglich, halb neoliberal-arbeitgeberorientiert. Die über mehrere Milliarden Euro verfügende Organisation befindet sich dann auch im Besitz der Gewerkschaft und des Verbandes der Journalisten sowie der zwei Verbände ihrer Arbeitsplatzbesitzer. Mit ihren "Einnahmen" läßt sie jedoch anscheinend den Allianz-Konzern pokern (investieren/ spekulieren), der auch gleich noch die "Korrespondenz" mit den PVW-"Kunden" bzw. -"Pflichtversicherten" erledigt. Man fragt sich, was denn da noch für die PVW an "Verwaltung der Versicherungsverträge" zu tun bleibt. . Aber man muß sich das auch gar nicht mehr fragen! "Ja, die Sozialversicherung - das ist der Staat," schlußfolgerte bereits der Ethnologe Pierre Clastres, der kleine kriegerische Völker in Lateinamerika erforschte und dabei zu der Erkenntnis kam, dass es nicht die Klassengesellschaft ist, die den Staat hervorbrachte, wie Marx meinte, sondern umgekehrt, der Staat erst schafft die Klassengesellschaft. "Der Staat, dieses kälteste aller kalten Ungeheuer," wie Nietzsche ihn nannte. Ein Ungeheuer deswegen, weil alle seine Agenten und Agenturen (einschließlich der heute von ihm privatisierten Infrastruktur- Einrichtungen) einen kaltherzig zur statistischen Durchschnitts-Staatsbürger-Verstellung zwingen, zur Lebenslüge. .

.
(2) Das persönlichste Buch von Josef Reichholf ist eins über Landvögel: „Rabenschwarze Intelligenz: Was wir von Krähen lernen können“ (2009). Es handelt von seinen Erlebnissen mit einigen Dohlen sowie mit der Rabenkrähe Tommy und dem Kolkraben Mao. Wohingegen sein vorletztes Buch „Ornis“ (2015) eher, wie im Untertitel bereits angedeutet, „Das Leben der Vögel“ – perspektivisch bis zur Restlosigkeit – behandelt. Herausgekommen ist dabei eine Art Nachschlagewerk, jedoch nicht nach Vogelarten oder Habitaten geordnet, sondern nach ihren Körperfunktionen. Das Wissenschaftsportal „spektrum.de“ lobte: „Anatomie, Stoffwechsel und Energiehaushalt der Vögel nehmen in dem Buch viel Raum ein. Auf der Grundlage dieser Abschnitte erörtert der Autor zahlreiche Phänomene aus der Welt der Vögel. Was dabei herauskommt, ist immer wieder verblüffend. ‚Ornis‘ überzeugt als aufschlussreiches und originelles Buch über die Vögel und ihre vielfältigen Beziehungen zur Umwelt, zumal es ganz ohne Fachjargon auskommt.“
.
Das selbe konservative Wissenschaftsportal kritisierte an dem von mir besonders geschätzten Reichholfbuch über Rabenvögel: „Eine Reihe von Begründungen basieren auf einzelnen, persönlichen Erlebnissen, niederbayerischen Anekdoten aus den 1950er und 1960er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, und sind damit wissenschaftlich nicht sonderlich robust.“(Robust – das ist auch so ein Idiotenwort!)
.
Ähnlich wird der Wissenschaftsjournalismus aber wohl auch die Forschungsarbeiten des amerikanischen Zoologen Bernd Heinrich über die „Seele“ und die „Weisheit“ von Raben sowie über Hummeln loben – und dagegen seinen quasi privaten Erfahrungsbericht „Ein Forscher und seine Eule“ (1995) abschätzig rezensieren. Mit diesem Tier lebte Heinrich lange Zeit zusammen. So wie auch der englische Militärhistoriker Martin Windrow, dessen ähnlich schöner Eulenbericht den Titel „Die Eule, die gern aus dem Wasserhahn trank: Mein Leben mit Mumble“ (2015) hat. Oder die Historikerin und Falknerin Helen MacDonald mit ihrem Buch über ihr Habichtweibchen Mabel: „H wie Habicht“ (2015), in dem sie sich daneben und dagegen auch noch mit dem Habicht-Erfahrungsbericht eines Mannes, T.H.White, auseinandersetzt.
.

.

.

.
(3) Der Ethnologe und Zoologe Hans Krieg war Mitherausgeber der „Zeitschrift für Jagdwissenschaft“. Von 1923 bis 1938 führte er vier Expeditionen nach Südamerika durch. Seine Autobiographie beginnt laut Reichholf mit dem Satz: „Ich habe versucht, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen.“ In einer von Marschall Titos Jagdhütten nicht weit von Belgrad hängt der Spruch: „Die Jagd ist eine Kunst“.
.

.

.

.
(4) Im Zusammenhang mit Reichholfs „Tsetsefliegen“-Überlegungen sei noch das Buch „Eine Fliege macht Landschaft“ (2013) erwähnt – von Catrin Schmidt. Die Direktorin des Instituts für Landschaftsarchitektur der TU Dresden erforschte verschiedene „Landschaften im Wandel“ – in Ostafrika, Australien und Polynesien. Ihr Bericht erschien in dem 2011 gegründeten „Aufland Verlag“ des Eberswalder „Büros für Landschaftskommunikation“ der Kulturwissenschaftler Kenneth Anders und Lars Fischer.
.

.

.

.
(5) Der „Vogelwelt“ widmen sich besonders viele Laien (Birder). Die Ornithologie, so sie sich nicht auf das Studium von in Gefangenschaft gehaltenen und/oder getöteten Vögel beschränkt, ist wie kaum eine andere Forschung auf solche „Citizen-Scientists“ angewiesen, also auf möglichst viele Vogelbeobachter, denn was der Rabenforscher Bernd Heinrich über seine Forschungsobjekte sagt, gilt nahezu für alle Vögel: „Wilden Raben kann man nicht folgen. Bumms sind die weg, in zehn Sekunden sind die abgehauen.“ Seine Bücher über sie, die er im Wald immer wieder mit riesigen Mengen Fleisch anlocken mußte, das er jedesmal einen Berg hochschleppte, handeln dann auch fast ebenso oft von seinen Mühen und Entbehrungen (vor allem im Winter) wie von den Raben. Es mangelte ihm offensichtlich an „Mit-Rabenforschern“, bei den beliebten kleinen Singvögeln, aber auch bei den Wasservögeln hätte sich sein „Forschungs-Design“ mit Ketten von Beobachtern sicher anders entwickeln können. Josef Reichholf meint: „Durch die Förderung dieser Bürgerwissenschaftler gewinnt auch die wissenschaftliche Ökologie.“ Bei der Durchsetzung des „Naturschutzgebietes Stauseen am Unteren Inn“ war er jedoch wie auch Heinrich eher ein „Einzelkämpfer“. Der Rabenforscher Kilham hält das Alleinsein bei der Vogelbeobachtung sogar für notwendig.
.

.

.
(6) Das gilt auch für Josef Reichholf. Die Natur wird von den Ökopolitikern, von einer „ideologisierten Ökologie, als Gegenentwurf zum Menschen dargestellt,“ meint er. „Der Mensch ist nun der Böse, der mit seinem ökologischen Fußabdruck die Erde zertrampelt – als Ganzes und auch im konkreten Fall jedes einzelnen Menschen. Nach dieser apokalyptischen Sicht sollte der Mensch möglichst aus der Natur herausgedrängt werden, um diese sich selbst zu überlassen.“ Für Reichholf steht dieser Prozeß „im Zusammenhang mit der Politisierung des Naturschutzes über die Partei der Grünen. Es wurde eine Art Gegenentwurf zu politischen Zielrichtungen entwickelt, und zwar nicht am normalen Spektrum zwischen rechts und links orientiert. Darin hätten die Grünen keinen Platz gefunden. Sie mussten sich an der Natur orientieren. Mutter Natur wurde auf diese Weise idealisiert als Höheres Wesen, das vor den Eingriffen geschützt werden musste. Politisch tragfähig wurde diese Haltung, als man sich der vielen Bürgerinitiativen annahm.
.
Zumeist ging es um die verständliche persönliche Ablehnung von Veränderungen, die sie selbst betrafen, etwa einen Autobahn- oder Flughafenbau. Was ist zum Beispiel dem Münchener Flughafen alles angedichtet worden, was er auf die Natur bezogen bewirken wird! Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Verluste an Arten, an attraktiven Biotopen sind durch die Gewinne bei weitem übertroffen worden. Heutzutage müsste eigentlich der Flughafen ein Fauna-Flora-Habitat-Gelände sein. Der größte noch existierende Brutbestand des Brachvogels in Bayern lebt auf dem Münchener Flughafengelände. Nirgendwo in Bayern gibt es so viele Feldlerchen wie dort. Und vieles andere mehr, so dass die Flughafenbetreiber eher das Problem haben zu verhindern, dass zu viele Vögel auf das Flughafengelände kommen, weil es so attraktiv ist. Da ist eben sehr, sehr viel Ideologie im Hintergrund gewesen.“
.

.

.
(7) In dem „Earth First-Handbuch für Direkte Aktionen“ befaßt sich ein Kapitel mit Polizei-Taktiken und gleich mehrere mit Blockaden (von Schiffen, Flughäfen etc.), dazu gehört auch das Klettern auf Bäume, um sie zu besetzen und damit vor dem Gefälltwerden zu schützen.
.
Die Tochter eines amerikanischen Wanderpredigers: Julia Hill hielt es zwei volle Jahre in 60 Meter Höhe auf einem kalifornischen Redwood-Baum aus, um diesen vor dem Gefälltwerden durch eine „gewissenlose Nutzholz-Mafia“ zu schützen – wobei sie schließlich zu einem “höheren Selbst” gelangte. Seitdem nennt sie sich “Butterfly”. Die Schilderung ihres Weges zur individuellen Erleuchtung (Satori) erschien in nahezu allen Kultursprachen, auf Deutsch im Verlag Bertelsmann-Riemann – unter dem Titel “Die Botschaft der Baumfrau” in der Reihe „Satorierte Frauen“. Die Autorin ist eine Öko-Mystikerin von Rang und mittlerweile einiger Prominenz – und ihr Werk, abgesehen von der gelungenen Rettung des Mammutbaums, ein Erlebnisbericht, der nichts zu wünschen übrig läßt, außer daß ihre Extremerfahrung nicht leicht Nachahmer finden wird – obwohl: Vielleicht könnten auch solche säulenheiligenartige Aktionen unter den Ökoaktivisten epidemisch werden – die Schlauchboot-Ninjas von Greenpeace sind bereits auf dem Weg dahin. Julia Butterfly Hill jedenfalls ist weiterhin in diesem oberen Bereich aktiv. Extremsport und Naturforschung hatten schon oft enge Berührung.
.

.
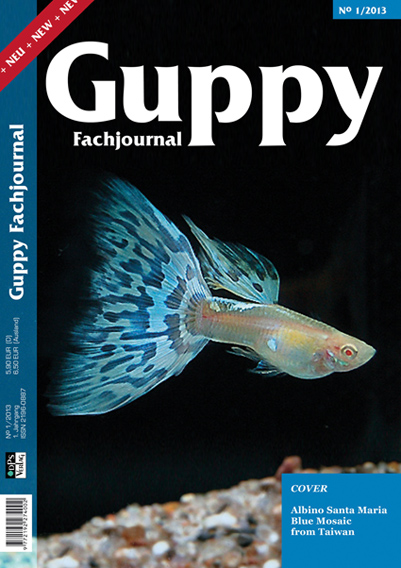
.

.
(8) Pynchon sieht damit – ähnlich wie der französische Philosoph Jean Baudrillard – das Heil nicht mehr in sozialen Bewegungen, sondern in „Objekt-Strategien“: Erst mit der Vervollkommnung der Logarithmen kehren die Götter wieder, um es mit dem Berliner Kulturwissenschaftler und Pynchonfan Friedrich Kittler zu sagen.
.

.

.

.
(9) Im Tagebuch-Bericht über seine Rabenforschung im Wald zitiert Bernd Heinrich Edward Abbey zwei Mal, einmal im Vorwort und ein andern Mal im Kapitel „Es gibt kein Weg zurück“, dort heißt es: „Eine Stadt mit mehr Kirchen als Kneipen hat ein ernstes gesellschaftliches Problem.“ So stellt sich für Abbey das Problem von Religion und gesellschaftlicher Moral. Auf keine Stadt trifft das mehr zu als auf den 8000-Seelen-Ort Bluffdale, das an einem von den Mormonen Jordan genannten Flüßchen in Utah liegt und Hauptquartier einer Abspaltung der Mormonen ist, die an der Vielehe festhalten. Dort errichtete der US-Geheimdienst NSA jüngst sein neues Rechenzentrum, das “Utah Data Center” – auf dem Militärgelände “Camp Williams”. Es gibt in Bluffdale, kein Hotel, Restaurant, Café oder Supermarkt, dafür bereits das “Granite Point Data Center”, dessen Datenlager sich in den nahen Granitfelsen befinden, “der sichersten Gegend der Welt,” wie die sich auch “C7″ nennende Firma wirbt, die “world class co-location” anbietet: die Unterbringung und Netzanbindung von Kundenserver. Ihre Anschrift lautet – wahrscheinlich zur Freude von Thomas Pynchon: 14944 Pony Express Rd., Bluffdale – der Ort ist etwa 30 Kilometer entfernt vom „Weltzentrum der Mormonen“: Salt Lake City, in dessen Universität am laufenden Band fertige IT-Ingenieure ausgestoßen werden. Die Mormonisierung der NSA, ist ein noch viel zu wenig beachteter Vorgang – beispielsweise vom CCC.
.
Und da wir gerade beim „Intelligence Service“ sind, in der angloamerikanischen Biologie wird besonders gerne „Intelligenzforschung“ betrieben, mit Affen, aber zunehmend auch mit Rabenvögeln, wobei gesagt wird, vor allem Neukaledonische Krähen seien mindestens so intelligent wie unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen. Die guten Verhaltensforscher halten sich mit der „Intelligenz“ ihrer Studienobjekte freilich nicht lange auf, das gilt für den Ornithologen Josef Reichholf ebenso wie für den Rabenforscher Bernd Heinrich. Letzterer schreibt im Bericht über sein einjähriges Lebensexperiment im Wald: „Ich finde es merkwürdig, dass das Leben an sich nicht allen Leuten beendruckend erscheint, aber aus irgendeinem Grund beeindruckt sie das ‚intelligente‘ Leben. Wenn man das Leben insgesamt betrachtet, ist Intelligenz nur eine Borste am Schwein.“
.
Auch wenn er mit dieser bildhaften These Recht hat, so versucht er desungeachtet doch auch bei seiner Rabenforschung und in seinen Experimenten mit ihnen heraus zu bekommen, ob ein (z.B. besonders kluges) Verhalten artspezifisch ist und wenn ja, ob angeboren oder erlernt. Als er eine Einladung von einer Kollegin bekommt, sie an den sibirischen Baikalsee zu begleiten, wo es in der Region 1080 Arten gibt, die sonst nirgendwo leben, lehnt er ab – mit der Begründung, auch in den Wäldern von Maine „gibt es viele Spezies, die ich noch kaum kenne. Ich fühle mich schon sensorisch überlastet von den paar Dutzend Arten von Moosen. Und eine Spezies, die Raben, bringt meinen Geist fast zur Explosion.“ Deswegen scheut er nicht davor zurück, wenn er von einem Menschen hört, der mit einem oder mehreren Raben zusammenlebt, in Deutschland z.B., sofort dorthin zu fliegen, um ihn zu besuchen.
.

.

.
Er denkt, wegen seiner Nägel, die er in sein Auto gelegt hatte, könnte man ihn für einen „selbsternannten ‚Rave Watcher’“ und – schlimmer noch – „Bäume vernagelnden Öko-Terroristen“ halten, zumal er sich auch „schon ziemlich aus dem Fenster gehängt hatte“, als er das Konzept in Frage stellte, „mit dem Herbizidmaßnahmen ‚Forstwirtschaft‘ genannt werden.“ Dabei läßt der Holzkonzern Gifte der „Agent-Orange-Art“ vom Hubschrauber aus versprühen, um nach einem Kahlschlag das Sprießen der Laubbäume zu verhindern und damit das Wachsen seiner Koniferen zu fördern.
.
Ein durchaus ähnlich wirksames Gift versprühte ein US-Biologe über einige tropische Bäume in Südamerika, um die Zahl der Insektenarten, die in ihren Kronen leben, ermitteln zu können: Sie sterben davon und brauchen nur noch auf dem Boden eingesammelt zu werden. Mit Glück sind einige bisher unbekannte Arten dabei, die der glückliche Sammler dann benamen darf. Der Insektenforscher und Taxonom des Berliner Naturkundemuseums Michael Ohl berichtet darüber in seinem Buch „Die Kunst der Benennung“ (2015) Josef Reichholf schreibt – im Zusammenhang von „Thomson-Gazellen“ und „Rothschild-Giraffen“ in der Serengeti: „Namensgebung spiegelt Eitelkeiten und tut dies bis heute. Viele wissenschaftliche Namen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr über die Menschen aussagen, die sie festlegten, als über die Tiere, die den Namen verpasst bekommen haben.“ Kommt noch hinzu: „Tiere und Pflanzen sammeln bedeutet töten! Daran hat sich bis heute wenig geändert.“ Michael Ohl (oder war es Bernd Brunner in seinem Birdwatcher-Lexikon „Ornithomania“?) erwähnt in seinem Buch über Taxonomie einen Biologen, der sich auf die Suche nach einer als ausgestorben geltenden Tierart machte. Als er tatsächlich ein Exemplar fand, tötete er es sogleich – und sorgte damit vielleicht wirklich für das Ausgestorben-Sein dieser Art.
.
Bernd Heinrich dämpfte seine aufkommende Angst vor einer Verfolgung durch die Justiz, die in seiner Nachbarschaft nach den Tätern der Baum-Vernagelung fahnden ließ, damit, dass er sich erinnerte, „auch Thoreau war für kurze Zeit im Gefängnis“.
.

.
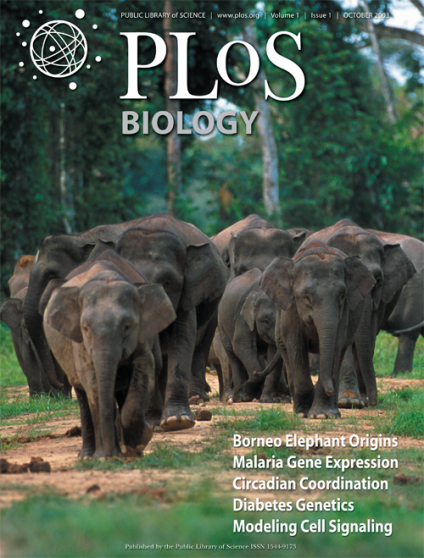
.
Dessen letzte Worte waren „Elche“, Bernd Heinrich merkt dazu an: „Als Thoreau in Maine wanderte, wurde die Zunge als das beste Teil angesehen. Elche (und Bisons) wurden nur der Zunge wegen getötet, den Rest ließ man liegen.“ In Rom aßen die Reichen gerne Nachtigall-Zungen. Das letzte Wort des Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich war „Kartoffelchips“.
.
Nachdem Heinrichs Zoologiestudenten der Universität Vermont ihn in seiner Hütte besucht und er einige kleinere „Forschungsprojekte“ mit ihnen im Wald durchgeführt hatte, schrieb er: „Im vergangenen Jahr hatten mehrere der Studenten sich geweigert, Fallen aufzustellen, aus ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘. Dieses Jahr hatte ich den Studenten klargemacht, dass wir damit das Recyceln von Nagern zu Raben erleichtern. Da alle die Raben liebten, hatte in diesem Jahr also niemand mehr Skrupel, und alle waren begeisterte Fallensteller. Wir fingen eine hübsche Menge Hirschmäuse und Feldmäuse, mindestens 60 Stück – eine Raben-Monatsration.“ (Heinrich hielt einige Raben in Volieren, die täglich gefüttert werden mußten! Psychoanalytisch nebenbeibemerkt betätigte sich schon sein Vater als Fallenfänger von Mäusen, die er an wissenschaftliche Einrichtungen verkaufte. )
.
Manches scheint mir bei Heinrich dennoch widersprüchlich zu sein – da heißt es an einer Stelle: „Die Evolution bringt nichts ‚Überflüssiges‘ hervor, weil alles, was sie produziert, seinen Preis hat“…Und: „Der einzige Grund, weshalb die Evolution Beziehungen erhalten würde, ist der, dass sie nützlich sind.“ Abgesehen von seinen fragwürdigen Begriffen aus der warenproduzierenden Gesellschaft bzw. dem darwinistischen Utilitarismus schreibt er an anderer Stelle – über die verschiedenartigen Spechte in „seinem“ Wald: „Trotz all meiner wissenschaftlichen Erklärungsversuche glaube ich, dass sie im Grunde aus schierer Lebensfreude singen, hämmern oder tanzen.“ Auch „seine“ wilden Raben probieren alles neugierig aus und spielen, aber das könnte man natürlich auch unter dem neumodischen Begriff des „Lifelong Learning“ abbuchen – dann wäre diese „Energieverschwendung“ wieder als nützlich anerkannt – um „fit“ zu bleiben für den „Struggle of Life“ . Nachdem Heinrich eine Schar in Formation fliegender Kanadagänse beobachtet hat, bemerkt er über „seine“ Raben: „Sie jagen und necken einander, bummeln, kreisen, führen Loopings aus, sie krächzen oder kreischen oder geben rasselnde Geräusche von sich. Sie machen alles mögliche, nur in [energie-ökonomischer] Formation fliegen tun sie nicht.“
.
Nachdem sein zahmer Kolkrabe „Jack“, der sich laufend „neue Spiele“ ausdachte, seiner Katze „Jasper“ begegnet war, notierte Heinrich, dass er „den Umgang mit einem weiteren Raubtier gelernt hatte, und erfahren, dass eine Katze kein Hund ist – was für eine Gelegenheit zur Weiterbildung.“ Zuvor hatte „Jack“ sich mit einem Hund angelegt gehabt, und dabei „gelernt, was er riskieren konnte, wenn solch ein Tier Nahrung bewachte. Ich konnte nur hoffen, dass er nicht zu sehr verallgemeinern würde.“ Fragwürdig ist auch seine Bemerkung: „Durch den Wald laufen und die Lieder nicht zu kennen, heißt, sie nicht hören.“ Es geht ihm um deren Zuordnung zu einer Vogelart, um ihre namentliche „Identifizierung“ als Art anhand ihres Gesangs. Was dem Naturforscher Goethe anscheinend schwer fiel. Eckermann, der zu Hause Dutzende von Vögel besaß und sehr viel Vogelwissen besaß, notierte, nachdem Goethe auf ihrem obligatorischen Osterspaziergang stehen geblieben war und bemerkt hatte, ‘Hör mal, Eckermann, eine Drossel‘: “Es war ein Rotkehlchen…So ein großer Dichter und keine Ahnung von Vögel.”
.

.
All „Labelling is lethal,“ behauptet der Kommunikationsforscher Tom Hayden. Der Käfersammler Ernst Jünger nahm dazu eine vorsichtige Mittelposition ein: “Schön ist es, die Dinge zu benennen, und schöner noch, wenn man die Namen vergißt.” Das bezog sich auf die Arten im Berliner Botanischen Garten, in dem ich immer wieder dazu komme, dass ich erst die Bäume und Sträucher mir dort genau ankucke, dann die Namen auf den Schildern genau lese und schließlich nur noch auf die Schilder kucke. Ich erkläre mir diesen „Zwang“ damit, dass ich als Kind über das Entziffern von (Reklame-) Tafeln lesen gelernt habe. Weiter ging es dann mit Tier- und Pflanzenbüchern – und dem Anlegen eines Herbariums. Bernd Heinrich beginnt sein Wald-Tagebuch mit dem Satz: „Als ich zehn Jahre alt war, hatte ich bereits sechs Jahre als Flüchtling in einem Wald in Norddeutschland verbracht.“ Das ist jetzt erneut das Schicksal – von zigtausenden Flüchtlingen, hat aber nichts mehr mit der hier angesprochenen Benamung von Pflanzen- und Tier-Arten zu tun.
.
In Bernd Heinrichs Büchern hat man mitunter den Eindruck, er traut seinen eigenen Beobachtungen nicht – weil sie bestenfalls den Wert von „Anekdoten“ haben, die im Wissenschaftsbetrieb als nahezu wertlos angesehen werden. Einerseits werden Anekdoten leicht überinterpretiert, und andererseits werden bei der Ablehnung von Anekdoten auch die Fakten verworfen, schreibt er in seinem Buch „Die Weisheit der Raben“ (2002) kompromißlerisch – und zitiert gleich darauf den Biologen Mark Pavelka, der das Verhalten von Raben für die amerikanische Umweltbehörde United States Fish and Wildlife Service untersuchte: „Bei anderen Tieren kann man gewöhnlich 90 Prozent der Geschichten, die man hört, vergessen, weil sie übertrieben sind. Bei Raben ist es umgekehrt. Mag die Geschichte noch so komisch oder seltsam klingen, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es irgendwo Raben gibt, die so etwas tatsächlich getan haben.“ Das liegt daran, fährt Heinrich fort, „dass Raben Individuen sind, und Ameisen z.B. nicht.“
.
Weiteren Umgang mit „Anekdoten“ findet man in den Rabenbüchern der englischen Forscher Mark Cocker und Esther Woolfson: „Crow Country: A Meditation on Birds, Landscape and Nature“ heißt das von Cocker, und das von Woolfson: „Corvus. A Life with Birds“. Dann das wunderbare im „anecdotal style“ verfaßte Buch „The American Crow and the Common Raven“ des verstorbenen Virologen und Bird-Watchers Lawrence Kilham und die sechs leider etwas kitschigen, aber mit vielen guten Photos ausgestatteten Rabenbücher von Gertrude Drack, über die an anderer Stelle mehr gesagt sein soll. Erwähnt seien hier aber noch das schöne kleine Buch des DDR-Rabenforschers Johannes Gothe „Kolkrabe, schwarzer Gesell“; die Studie über „Kolkraben: Der ’schwarze Geselle‘ kehrt zurück“ des Biologen Dieter Glandt, das kleine aber feine „Naturkunden“-Portrait „Krähen“ von Cord Riechelmann und natürlich die gestreut veröffentlichten Aufsätze von Konrad Lorenz über einen Kolkraben und vor allem über „seine“ Dohlen. Davon handelt u.a. auch der Konrad-Lorenz-Roman „Kaltenburg“ (2008) von Marcel Beyer.
.

.

.
Die meisten Rabenforscher scheinen Männer zu sein, während die Primatenforschung heute von Frauen dominiert wird, ebenso die „Symbioseforschung“. Für die Meeresbiologin Nicole Dubilier, Leiterin der Abteilung Symbiose im Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, ist das kein Zufall: „Ist doch klar, es geht um Kooperation.“ Reichholf spricht im Zusammenhang der brasilianischen Gauchos und ihrer Pferde von einer „Symbiose“, obwohl diesen von jenen beim Zureiten „jeder Widerstand gebrochen“ wird.
.
Vielleicht kann man sagen, dass sich die Biologie am einen Pol in Genetik und Biochemie ausentwickelt, und am anderen in Verhaltensforschung und Tierpsychologie. Erstere produzieren „harte Fakten“, letztere „Anekdoten“. Josef Reichholf kommt an einer Stelle seines Buches „Mein Leben für die Natur“ auf das letztlich Anekdotische der Ökologie zu sprechen: „Sie beruht viel auf Beschreibungen lokal beobachteter Zustände. Dass es da oder dort so ist, heißt aber nicht, dass es so sein muß und sich woanders nicht anders verhalten kann.“ Zudem ist er sowieso der Meinung, dass man sich schon viel zu lange nur mit der Art beschäftigt hat.
.
Bernd Heinrich schreibt: „Nicht bewußt handelnde Vögel und Säugetiere scheinen manchmal vorauszuplanen, reagieren aber in Wirklichkeit nach festgelegten Mustern.“ Von da aus kommt er auf das „Schmerzempfinden“ von Würmern an Angelhaken und Hummer in kochendem Wasser, das er ihnen abspricht. Dem gegenüber stehen einige neuere Erkenntnisse der Schmerzforschung, weswegen die Hummerfischer in Maine immer häufiger mit Tierschutz-Organisationen aneinander geraten, die das Zubereiten der Großkrebse – z.B. auf der weltgrößten „Hummerparty“ in Maine – als barbarisch kritisieren: Die Tiere werden lebend in riesige Behälter mit kochendem Wasser geworfen. Das rohe Massenvergnügen in der „Hummerhauptstadt“ wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace kritisiert – und das ausgerechnet in einer amerikanischen Gourmet-Zeitschrift. Auf Deutsch erschien sein Essay „Am Beispiel des Hummers“ 2009. Argumentationshilfe lieferten ihm u.a. US-Krebsforscher, die feststellten, dass Hummer „Nozizeptoren“ besitzen und demzufolge auch Schmerzen empfinden. Die hiesigen Tierschützer fordern eine Gesetzesänderung: „Die derzeit gültige Verordnung über das Schlachten von Hummern stammt aus dem Jahr 1936, als über die Leidensfähigkeit der Krustentiere noch wenig bekannt war.“
.
Josef Reichholf geriet einmal mit den Hobbyanglern in Konflikt, in dem Bericht „Naturgeschichte(n)“ der Bayrischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege“ erzählt er davon: „In den 60er und frühen 70er Jahren habe ich um das große Naturschutzgebiet Stauseen am Unteren Inn gekämpft. Erfolgreich! Die Gemeinden versuchten zu bremsen, weil die Hauptgegner die Fischerei und die Angler waren. Bei einer Veranstaltung, vielleicht der entscheidenden, in der es um dieses Naturschutzgebiet gegangen war, musste ich mit Polizeischutz, tatsächlich begleitet von einem Polizisten mit Waffe, in das Wirtshaus gebracht und dann daraus wieder entfernt werden, um zu verhindern, dass ich von den Anglern verprügelt wurde.“
.

.

.
Reichholf rät den Naturschutzorganisationen, statt sich auf faule Kompromisse mit der Politik und den Behörden einzulassen, mit ihren Spendengeldern lieber Land zu kaufen, um „ein Netzwerk privater Schutzgebiete aufzubauen“. Er hat am Unteren Inn besonders gute Erfahrungen mit den Kraftwerksbetreibern an den dortigen Stauseen gemacht, die seine Vorarbeiten für das Naturschutzgebiet unterstützten: „In unserer Gesellschaft ist es viel wichtiger, Rechte zu erwerben als auf Recht und Gesetz zu pochen.“ Auch dass die Naturschützer gegen „invasive Arten“ vorgehen, findet er grundfalsch, wie ebenso, dass sie die inzwischen viel größere Artenvielfalt in den Städten als auf dem Land weitgehend ignorieren. Beim „Problem der Fischerei“ denkt aber auch er ausschließlich an die Angler an „seinen“ bayrischen Flüssen, die bloß einen Angelschein kaufen müssen, um im Naturschutzgebiet weiter ihrem Hobby nachgehen zu können, und an keiner Stelle an die Hochseefischer, denen US-Ökologen prophezeien, dass es 2048 keine Nutzfische in den Ozeanen mehr geben wird, überhaupt keine Fische mehr. Aber das ist auch wieder so eine Öko-Apokalyptiker-Hochrechnung, würde Reichholf sagen.
.
„Es ist unerträglich, dass die Beschränkungen und Verbote des Naturschutzes nahezu ausschließlich die Naturfreunde treffen. Der Artenschutz gilt de facto nur für die ordentlichen Naturfreunde, die für fast jede intensivere Betätigung im Naturschutzgebiet ‚Ausnahmegenehmigungen‚ beantragen müssen.“ Auf der anderen Seite spricht er von einem „Urvertrauen“, das sich bei den Tieren gegenüber dem Menschen wieder einstellt, wenn sie nicht mehr bejagt, geangelt oder sonstwie verfolgt werden. „Im Ausdruck ‚Wildtiere‘ schleppen wir die seit Jahrhunderten andauernde Verfolgung mit, die alle größeren Tiere wild werden ließ.“
.
Das es mit diesen Tieren auch einen anderen Umgang geben kann, beweist immer wieder Indien: So leben z.B. im Tal des Dorfes Akole bei Bombay in der Umgebung der Menschen mehr als ein Dutzend Leoparden – und das sollen sie auch weiterhin. Manchmal reißen die Raubtiere einen Hund, eine Hauskatze oder eine Ziege. Sie werden von den Dörflern aber auch gefüttert, indem sie dem Gott der großen Katzen, Waghoba, ein Fleischopfer auf den Schrein legen. Für getötete Ziegen zahlt der Staat ihnen eine Entschädigung. Ein Team norwegischer und indischer Biologen hat dieses seltsame fast konfliktfreie Zusammenleben über Jahre erforscht – und darüber eine schöne Broschüre veröffentlicht: die „Waghoba Tales“. Dieses „Zusammenleben“ ist ein wichtiges Beispiel, denn die anderswo eingefangenen und in unbesiedelten Gebieten oder Schutzparks freigelassenen Leoparden waren bisher alle wieder – nur noch aggressiver – in ihre ursprünglichen Reviere zurückgekehrt.
.

.
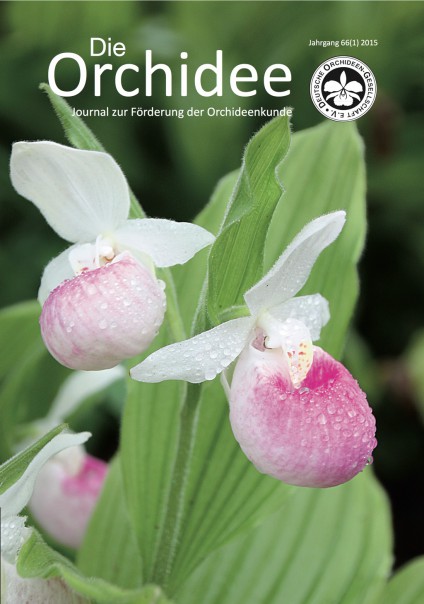
.
Eines von Reichholfs Beispielen für wiederhergestelltes „Urvertrauen“ durch Jagdverbote ist ein Grauwal-Weibchen, das im Golf von Kalifornien an die Seite seines „Whale-Watcher“-Schlauchbootes kam, damit er ihm die lästigen Seepocken vom Kopf entfernte. In der Schilderung dieser anrührenden Begegnung, die ihn sogar das Photographieren vergessen ließ, erwähnt Reichholf John Steinbeck – d.h. dessen südkalifornische Erzählung „Der Fremde Gott“, nicht jedoch dessen „Geschichte einer Expedition: Logbuch des Lebens“. 1944 mietete der Schriftsteller zusammen mit seinem Freund Ed Ricket eine Yacht samt Mannschaft, mit der sie von der Fischverarbeitungsstadt Monterey in den Golf von Kalifornien, auch Cortez-Meer genannt, fuhren. Sein Freund hatte eine Firma „Pacific Biological Laboratories“ in der Cannery Row, die Steinbeck mit seinem Roman „Die Straße der Ölsardinen“ berühmt machte. Ricket ließ Kinder und Arbeitslose Frösche, Schlangen und vor allem Katzen sammeln, die er dann en gros und einzeln oder sogar en détail an Forschungseinrichtungen verkaufte. Bei ihrer Expedition ging es um Meerestiere. Während der ganzen Fahrt sammelten, fischten, angelten und erschossen sie Fische, Schnecken, Muscheln, Krabben, Krebse – zentnerweise. Es war eine hemingwaysche Abenteuertour: zwei alte Männer und das Meer, dessen Bewohner sie massenweise zur Strecke brachten. Diese „Jagd-Strecke“ war vollkommen sinnlos. Zwar bemerkt Steinbeck in seinem „Logbuch“ gelegentlich, dass er diese oder jene gefangene Art kannte oder eine andere Art ihm vollkommen unbekannt war, aber viel mehr als die Namen schien die beiden Männer auch nicht zu interessieren. Zum Teil schmissen sie ihren Fang auch wieder über Bord. Kurzum: Sie hinterließen im Kielwasser eine Spur der Verwüstung maritimen Lebens, kamen sich dabei aber vor wie Darwin auf der „Beagle“. Zwei schreckliche Kindsköpfe, die nach Sonnenuntergang betrunken über die individuelle „Kreativität“ räsonierten. „Rickets naturwissenschaftliches Denken war ökologisch und aufs Ganze gerichtet,“ schreibt Steinbeck über seinen Freund, dessen Credo lautete: „Wir müssen mit dem, was uns zu Gebote steht, so viel Freude wie möglich erringen!“ An anderer Stelle heißt es: „Nach unserer Rückkehr machten wir uns sogleich ans Werk, die Tausende aufgesammelten Tiere wissenschaftlich auszuwerten. Unser Bestreben war weniger auf Entdeckung neuer Arten ausgerichtet als auf eine Geographie der pazifischen Fauna.“
.
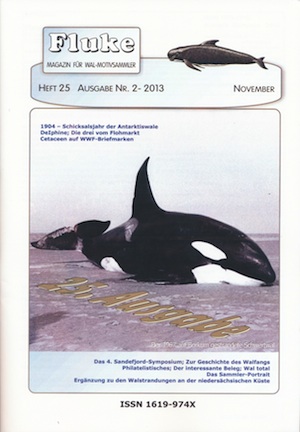
.
Sie hatten den Fangort der Tiere jedoch ebensowenig auf ihren Transportkisten und -gläsern vermerkt wie Charles Darwin seine Fänge auf den Galapagosinseln. Das immerhin hatten sie mit ihm gemeinsam. Im Gegensatz zu Darwin etikettierten sie ihre Tierleichen nicht einmal: „Etikettieren aber, genauer, die Information, die sie enthalten, machen ein gesammeltes Objekt erst zu dem, was es sein soll, nämlich zu einem wissenschaftlichen Gegenstand,“ wie Michael Ohl in seinem Taxonomie-Lehrbuch „Die Kunst der Benennung“ schreibt. Als Ricket 1948 starb, ließ Steinbeck das „Logbuch“ mit einem Vorwort versehen neu auflegen, kam jedoch auf ihre Bearbeitung der gesammelten Tiere nicht mehr zurück. Zum Vergleich: Die einjährige deutsche Tiefsee-Expedition mit dem Dampfer „Valdivia“ (1898-99) erbrachte eine derartige „Ausbeute“, dass die Herausgabe des wissenschaftlichen Berichts in 24 Bänden erst 1940 abgeschlossen wurde. Im Berliner Naturkundemuseum ist der für Crustacea zuständige Wissenschaftler sogar noch heute damit beschäftigt, die von der Valdivia-Expedition heimgebrachten Flohkrebse zu bearbeiten.
.
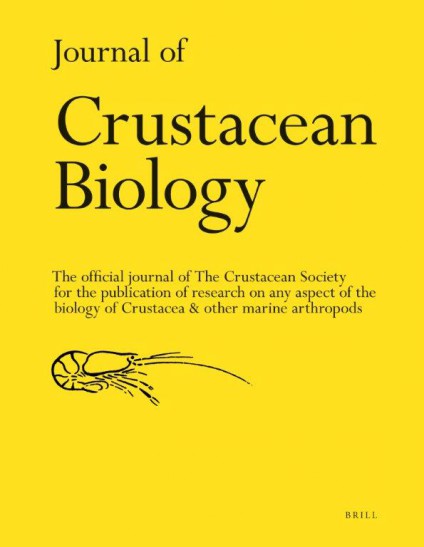
.

.

.
(10) Er notierte das fast stolz. Vom Rabenforscher Lawrence Kilham gibt es ähnliche Bemerkungen über sein „Rabe-Werden“ (er arbeitete anders als Heinrich und viele andere Rabenforscher nicht mit Markierungen und Überwachungsgeräten oder gar Blutproben, nicht einmal mit Photoapparat). Die englische Historikerin und leidenschaftliche Falknerin Helen MacDonald wurde jedoch an einer solchen Überidentifikation fast irre, als sie in ihrem über fünf Jahre langen engen Zusammenleben mit einem Habicht namens „Mabel“ wunschgetrieben dahin kam „ein Habicht zu werden“. In ihrem Buch „H wie Habicht“ schreibt sie: „In meinem Unglück hatte ich den Habicht aber nur in einen Spiegel meiner selbst verwandelt…Irgendetwas lief schief. Sehr schief.“ Sie erinnert sich an den Anthropologen Rane Willerslev, der das sibirische Volk der Jukagiren erforschte. Dabei erfuhr er, dass „eine solche Verwandlung bei den jukagirischen Jägern als sehr gefährlich gilt, weil man dadurch den Kontakt zur ‚Identität der eigenen Spezies verlieren und eine unbemerkte Metamorphose durchlaufen‘ könne“.
.
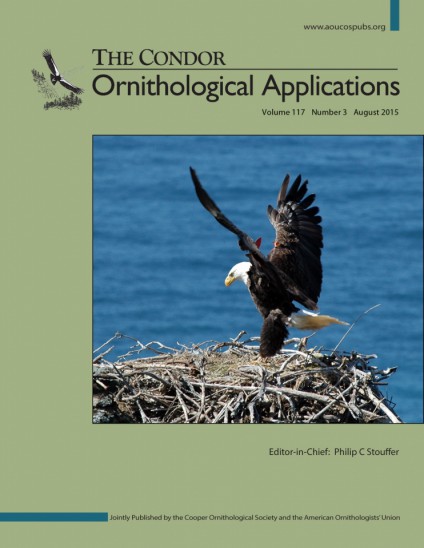
.

.
P.S.: Der taz-blogwart Mathias Broeckers empfahl mir noch das Buch: „Crows: Encounters with the Wise Guys of the Avian World“ von Candace Savage, einer kanadischen „Nature and Science“-Schriftstellerin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in ihrem Buch auch eine Geschichte von Louise Endrich abgedruckt, einer deutsch-indianischen Anthropologin. Ihr Großvater mütterlicherseits war ein Indianerhäuptling in Dakota, sie wuchs im Reservat auf und betreibt nebenbei eine Buchhandlung. Ihre Bücher handeln meist von einem fiktiven Reservat in Norddakota. Die Indianer hatten ein besonderes Verhältnis zu den Rabenvögeln. Sie kooperierten in gewisser Weise mit ihnen – beim Auffinden von verletztem oder verendetem Wild. Heute kooperieren die Rabenvögel auf diese Weise oft mit Wölfen und Kojoten – sofern sie nicht als alte „Kulturfolger“ in die Städte abgewandert sind. Dies in etwa der Stand des Wissenschaftsjournalismus in dem, was er aus den Veröffentlichungen der angloamerikanischen Rabenforscher macht.
.
Eine fand ich heute im Internet: „Raven Abundance at Anthropogenetic Resources in the Western Mojave Desert, California“ William Boarman (National Biological Service, California), Richard Camp (Solorado State University) und Mark Hagan sowie Wanda Deal – zwei Wissenschaftler der Luftwaffe, die auf der „Edwards Air Force Base, California“ stationiert sind. Dort auf dem Militärstandort in der Mojave-Wüste sowie in zwei benachbarten Siedlungen halten sich die Raben der Mojave-Wüste am Liebsten auf. Auf dem Militärgelände schon allein deswegen, weil dort wegen des häufigen Wagenwaschens auch während der Trockenzeit immer viel Wasser verspritzt wird, zudem locken die kleinen und großen Abfalldeponien in der Umgebung, wo die allesfressenden Raben ansonsten nicht viel mehr finden als Wüstenschildkröten, die deswegen bereits als gefährdete Art gelten.
.
Die Forscher, unter ihnen der bereits oben erwähnte Rabenforscher Mark Pavelka (von der US-Umweltbehörde), fuhren erst einmal gehörig Hightech-Gerät auf, dann fingen sie etliche Raben und statteten sie mit Sendern bzw. farbigen Markierungen aus. Am Ende und nach allerlei Geräteausfällen und Federverlusten kam bei der Rabenforschung in der Mojave-Wüste nicht viel mehr heraus, als dass die meisten Raben in den drei untersuchten menschlichen Ansiedlungen immer erst Mittags dort auftauchen, abends fliegen sie dann zu ihren einige Kilometer entfernten Nist- bzw. Schlafbäumen zurück. Die Autoren berufen sich in ihrem Artikel immer wieder auf Bernd Heinrich, dessen Rabenforschung sich von einem bloßen Datensammeln mittels einer Batterie hochtechnischer Geräte jedoch sehr unterscheidet. Noch radikaler distanzierte sich der Rabenforscher Lawrence Kilham von einem solchen Vorgehen: Schon der kleinste Aufzeichnungsapparat lenke ihn von seinem Bestreben ab, das Vertrauen Raben zu gewinnen, um eventuell mehr Einsicht in ihr Leben zu bekommen. Erst recht sei das Einfangen keine vertrauensbildende Maßnahme. Das Markieren der Vögel lehnte er schon deswegen ab, weil es ihn vom Suchen nach „wirklichen“ Unterschieden und Identifikationsmerkmalen abhalte.
.

.

.
Die Raben sehen zwar wesentlich besser als wir, dennoch ist es eine Schande, dass wir bei den Rabenvögeln noch immer nicht einmal zwischen Männchen und Weibchen und jungen und alten Raben unterscheiden können; es scheint, dass die Rabenforschung noch am Anfang steht. Jedenfalls hat sie unseren Blick auf Raben noch nicht gehörig genug geschärft.“Wie kann das sein,“ fragt sich die Krähen- und Elsternbesitzerin Esther Woolfson,“ dass wir so wenig über die Rabenvögel wissen? Sie leben unter uns, über uns, neben uns…Wir möchten Leben auf anderen Planeten und andere Zivilisationen finden, und wissen so wenig über die Zivilisationen um uns herum.“
.
Dass z.B. viele heterosexuelle Ehen bei den Rabenvögeln in Wahrheit gleichgeschlechtliche Freundschaften sind, weiß man erst seit kurzem. In diesem Zusammenhang sei noch ein weiterer wissenschaftlicher Forschungsbericht erwähnt, der im Internet zu finden ist: die Doktorarbeit der Bielefelder Verhaltensforscherin Anke Adrian. Sie wollte bei einer Reihe in Volieren gehaltenen Dohlen herausfinden, ob sie zu so etwas wie „Freundschaft“ fähig sind, ihre genaue Fragestellung lautete: „Gibt es Anzeichen für freundschaftsähnliche Beziehungen bei Dohlen?“. Am Schluß kam, nach einer ebenso zeit- wie geräte- und begriffs-aufwendigen Untersuchung, heraus – was sie gegenüber ihrer „Universitätszeitung“ so zusammenfaßte: „Bei den Dohlen gibt es keine Freundschaft, jedenfalls nicht nach meiner Definition.“
.
Diese Definition – von Freundschaft – stand am Anfang ihrer Forschungsarbeit und schloß u.a. Beziehungen zwischen Männchen und Weibchen aus. Sie hatte einen ganzen Katalog von verschiedenen Elementen einer Freundschaft zusammengestellt: „Die Grundstruktur ist zunächst die Zweierbeziehung. Zu ihren Elementen zählen u. a. Stabilität, Kooperation, Gegenseitigkeit und Freiwilligkeit, anders als etwa bei Verwandten. Wichtig ist auch, dass eine Beziehung zwischen zwei Individuen besteht und nicht zwischen so genannten Rollenträgern wie etwa Tieren, deren Verhalten durch ihre Gruppenfunktion (‚Babysitter‚) bestimmt wird. Das Tier an sich ist wichtig und nicht seine Rolle,“ meinte sie. Es „liegt an der Komplexität dieser Fragestellung, überhaupt zu definieren, was Freundschaft ist. Wir Verhaltensforscher vermeiden es, psychologische Begriffe auf Tiere zu übertragen. Freundschaft ist ja eigentlich für den Menschen gedacht. Berichtet man in einer Konferenz, meine Tiere haben aber Freundschaften, dann wird man von allen Seiten sehr skeptisch betrachtet. Man lernt als Verhaltensforscher, die Tiere so zu sehen, wie Tiere sich verhalten, und nichts Menschliches hinein zu interpretieren.“
.
Aber man hat auch den Eindruck, dass Anke Adrian selbst dann „unseren“ Begriff von „Freundschaft“ nicht in das Verhalten ihrer Versuchsdohlen reininterpretieren würde, wenn er dort zuträfe. Und selbst wenn diese gefangen gehaltenen Rabenvögel tatsächlich keine Freundschaften untereinander schlossen, heißt das nicht, dass Dohlen in anderen Volieren dazu ebenfalls nicht in der Lage sind. Zudem betonen nicht wenige Forscher bei wild oder halbwild lebenden Rabenvögeln gerade deren Neigung zu Freundschaften, auch zu ihnen, den Menschen, die sich ihnen nähern und füttern und dabei nichts weiter wollen als sich Gedanken über sie zu machen.
.

.
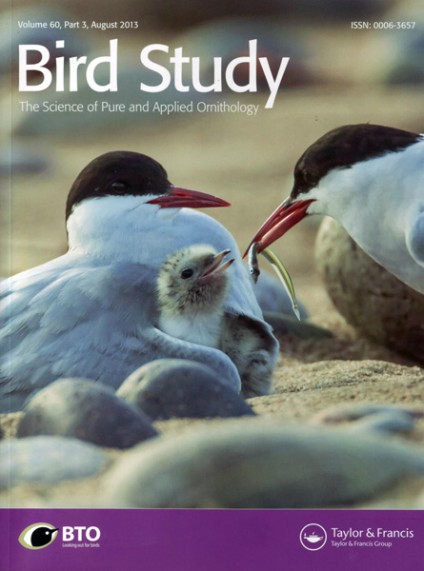
Ein gutes Beispiel dafür ist die schottische Autorin Esther Woolfson – u.a. mit ihrem Buch „Corvus – A Life With Birds“ (2008, mit Zeichnungen von Helen MacDonald). Sie lebte jahrelang mit einer Saatkrähe namens „Madame Chickeboumskaya“, kurz „Chicken“ und einer Elster namens „Spike“ sowie mit etlichen anderen Vögeln zusammen. Aus ihren Erfahrungen heraus, vor allem mit den Rabenvögeln, neigt sie dem „kritischen Anthropomorphismus“ des Psychologen Gordon Burghardt zu. Dazu beruft sie sich auf Rachel Carsons 1941 veröffentlichtes Buch „Unter dem Meerwind“: „Für sie ist eine Tonne einfühlsame Intimität mehr geeignet, den Lesern die Geheimnisse der Welt, über die sie schreibt, nahe zu bringen, als alle Sprachen der Wissenschaft mit ihrer kalten und messenden Distanz.“ Die Meeresbiologin Rachel Carson hat noch zwei weitere Bücher über das Meer geschrieben.
.
An der Münchner Universität gibt es ein „Rachel Carson Center for Environment and Society“, von dort schreibt Professor Mauch in einer im Internet veröffentlichten Eloge auf die Begründerin der amerikanischen Umweltschutzbewegung: „Eines der berühmtesten Fotos von Rachel Carson zeigt sie über ein Labormikroskop gebeugt; doch auf den meisten ist sie inmitten der Natur zu sehen: an einen Baum gelehnt etwa oder an der Küste ihrer Heimat Maine. Auf ihren Spaziergängen gehörte ein Feldstecher, mit dem sie Vögel beobachtete, zur ständigen Ausrüstung. Das Nebeneinander von Mikroskop und Fernglas ist symptomatisch für die Art und Weise von Carsons Beobachten und Denken.
Kein anderes naturwissenschaftliches Werk bedient sich so konsequent wie „Silent Spring“ [mit dem sie bderühmt wurde] einer ständigen Zoomoptik, die die Mikro- und Makrobereiche der Natur zusammen sieht: Klein und groß, Moleküle und Organismen, Fauna und Flora, Wasser, Land und Luft – alles gehörte für Carson aufs Engste zusammen… Für die Ökologin, die die Welt nicht nur mit den bloßen Augen in den Blick nimmt, nicht nur durchs Mikroskop, sondern umfassend – wie durch ein ‚Ökoskop‘–, ist die „Balance der Natur“ ständigen Gefährdungen ausgesetzt…Vor Rachel Carson gab es in
Amerika Teddy Roosevelt und die conservationists [die sich für Nationalparks engagierten], nach Rachel Carson kamen die environmentalists.“
.

.
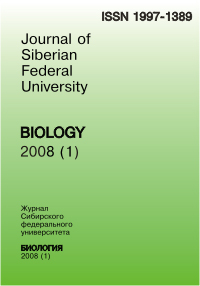
.
P.P.S.: Die Stadtbibliothek in der Breiten Strasse gibt bekannt, dass sie sowohl die DVD „Göttervögel-Galgenvögel – Geschichten von Kolkrabe & Co“ als auch die CD „Die Stimmen der Raub- und Rabenvögel“ im Angebot hat. In Summa geht daraus über die Rabenvögel hervor, von mir etwas ergänzt:
.
Die Krähe wird auch – nach Linné – Aaskrähe genannt, sie kommt als grau-schwarze Nebelkrähe und als schwarze Rabenkrähe vor und wird zur Familie der Rabenvögel (Corvidae) gezählt. Dazu gehören hierzulande auch noch Dohlen, Alpendohlen, Kolkraben, Alpenkrähen, Saatkrähen, Elstern, Eichelhäher, Tannenhäher. Sie alle wurden von der Internationale der Taxonomen unter die Ordnung Sperlingsvögel und die Unterordnung Singvögel subsummiert. Die Krähen stammen aus Neuguinea, wo sie mit den Paradiesvögeln und den Laubenvögeln „verwandt“ sein sollen. Während diese jedoch vom Aussterben bedroht sind, leben die Rabenvögel inzwischen fast überall auf der Welt. „Raben und Krähen sind ausgeprägte Kulturfolger“. Wahr ist, dass die scheuen Vögel sich mehr und mehr in die menschlichen Siedlungen trauen, mancherorts brüten sie schon auf den Bäumen direkt in der Ortsmitte.
.
Im emsländischen Neugnadenfeld hat man sich anscheinend nicht anders zu helfen gewußt, als alle nach dem Krieg gepflanzten Eichen um den Kirchplatz zu fällen. Umgekehrt verfährt man in der Mongolei, wo die Elstern sich paarweise den Jurten der Hirtennomaden zugesellt haben. Sie erwarten das geradezu von ihnen. Auch dass sie gelegentlich glänzendes Eigentum, Silberlöffel z.B., stehlen, nimmt man ihnen nicht übel, denn man weiß dort, in welchem der wenigen Bäume das Elsternpaar brütet und dort holt man sich das Verschleppte zurück.Da bei den Nomaden aber alles Eigentum sich selbst tragen muß, haben sie sowieso nicht viel „Glitzerndes“. Bei den Massai z.B. besitzt jeder durchschnittlich 30 Dinge, bei den Seßhaften in Mitteleuropa sind es rund 10.000.
.
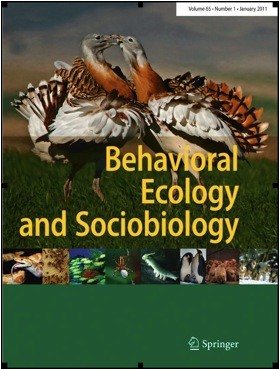
.

.

.
Hierzulande streitet man darüber, ob Elstern überhaupt von glitzernden Dingen beeindruckt werden. 2014 meldete „wissenschaft.de“: „Britische Forscher haben im Experiment getestet, wie begehrt glänzende Objekte bei den Elstern wirklich sind. Das Ergebnis: Die Rabenvögel dachten meist gar nicht daran, diese Preziosen zu stehlen – ganz im Gegenteil. Sie mieden sie sogar und zeigten Misstrauen gegenüber den ihnen unbekannten Objekten. Nach Ansicht der Forscher sind die Elstern damit nicht Täter, sondern vielmehr meist Opfer – eines Rufmords.“ Gemeint ist der Begriff „diebische Elster“. Der „stern“ hatte zuvor eine Umfrage gestartet: „Woher stammt der Begriff?“ Einer der Leser schrieb: „Diese Vögel gehören zu den Raben und sollen sogenannte Nestplünderer sein. In vielen Elsternestern wurden schon glitzernde Dinge wie Schmuck gefunden. Ob es Zufall ist oder nicht, scheinbar finden sie Gefallen daran. Es sollen sehr intelligente Vögel sein.“
.
In der Alten Schönholzer Strasse in Pankow sind die Bewohner nicht gut auf Elstern zu sprechen, weil sie ihnen so oft alle dort in Balkon-Nistkästen groß gewordenen Meisen bei ihren ersten Flugversuchen gefressen haben, dass die Meiseneltern schließlich weggezogen sind – und ihre Nistkästen seitdem leer stehen. Einige der Meiseneltern waren bis in die Balkonzimmer gekommen und hatten sich dort von der Gardinenstange aus das menschliche Treiben angekuckt. Die Vertreibung der Meisen wird nicht nur in Pankow den Elstern übel genommen. Der Dichter und Singvogelfreund Wiglaf Droste schrieb in einem Elstern-Haßgedicht: „Die zarte Blaumeise greift sie an und all die zaubrisch tirilierenden Sängerinnen und Sänger der Vogelwelt…Erdrückend ist die Beweislast gegen die Elster. Elster hört Böhse Onkelz und singt entsprechend, Elster liest Junge Freiheit und spricht auch so. Elster zetert ständig, das Volk der Elstern stürbe aus. Das ist leider überhaupt nicht wahr...Der Nazivogel braucht einen vor den Latz. Schnell, dringend und unmissverständlich…“
.
Der Biologe Cord Riechelmann, war erbost und klärte den Dichter in der taz auf: Es sei zwar wahr, dass Elstern „in manchen Gegenden einen Großteil der Erstbruten von Amseln fressen. Dennoch lasse sich „kein nachweisbarer Einfluss dieser Tatsache auf den Bestand der Amseln finden. Amseln bringen es in Städten mitunter auf bis zu drei Bruten in einem Jahr und offensichtlich können sie sich den Verlust des ersten Geleges ‚leisten‘. Dass Elstern die Zweitbruten wesentlich weniger bis gar nicht angreifen, erklärt sich aus ihren Fressgewohnheiten. Magen-, Kot- und Speiballenanalysen von Elstern ergeben überall – ob in Manchester, Poznan oder Erfurt – ein ähnliches Bild. Sie ernähren sich in der Hauptsache von Samen, Früchten, Insekten und deren Larven, Regenwürmern, Knospen und Haushaltsabfällen aller Art, von Fischschuppen bis Hühnerknochen. Kleinvogelküken- oder Eierreste lagen bei allen Untersuchungen etwa bei drei Prozent.“
.
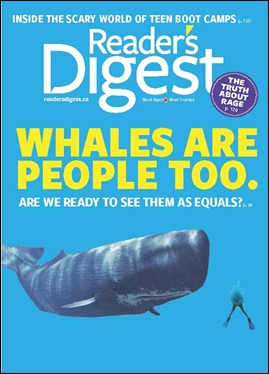
.
Der Ornithologe Josef Reichholf zitierte zur Aufklärung aus einer Langzeit-Untersuchung unter Rabenkrähen. Sie ergab: Die Krähenpaare besetzen Reviere, während die noch unverpaarten Jungvögel umherschweifende Banden bilden. Werden nun die Krähenpaare gejagt und ihre Nester zerstört, steigt dort der Anteil der Nichtbrüter. „Damit ist die Quote der von ihnen verursachten Verluste an Gelegen von Singvögeln und Niederwild nicht nur nicht gesenkt, sondern angehoben worden.“
.
Um das Töten von tausenden Rabenvögeln ging es im Münsterland, das Magazin „Wild und Hund“ übertitelte seinen Bericht darüber mit: „80 gegen Huckebein“. Dort hatte eine revierübergreifende „Forumskrähenjagd“ stattgefunden. Allein in Nordrhein-Westfalen werden jährlich etwa 130.000 Krähen geschossen. „Obwohl die Tiere gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, setzen sich die meisten Bundesländer durch Ausnahmeregelungen und Verordnungen auf Druck der Jagdlobby über die Regelung hinweg und erlassen Jagdzeiten, die teils bis in die Brutzeiten hineinreichen,“ empörte sich der Naturschutzbund, der 1899 als Bund für Vogelschutz gegründet wurde. Zu den Krähenjägern mit Jagdschein gesellen sich laut NABU immer mehr anonym bleibende Wilderer, die „Crowbusters“ heißen und sich im Internet „über ihr krudes Hobby austauschen“, wie der „Spiegel“ berichtet. Sie haben laut NABU „nur ein Ziel: so viele Rabenvögel wie möglich vom Himmel zu schießen.“
.
In Husum wurden die vielen Möven von Dohlen verdrängt, seitdem es kaum noch Fischfang gibt, dafür an Land aber immer mehr Dönerbuden. Verdrängt kann man deswegen vielleicht auch nicht sagen. Das von den Husumern halb freiwillig zur Verfügung gestellte Nahrungsangebot hat sich einfach zu Ungunsten der einen und zu Gunsten der anderen entwickelt.
.

.
P.P.P.S.: Und dann noch diese Geschichten vom Krähenstammtisch in der Muskauer Strasse:
.
– Ein richtiges Interesse für Krähen entwickelte ich erst 1999 in Bombay. Die indischen Ornithologen nennen sie „Hauskrähen“. Sie werden von den „Waldkrähen“ unterschieden. Diese versuchen angeblich jene langsam zu verdrängen. Es gibt also auch dort eine Wanderungsbewegung der Tiere und Menschen vom Land in die Stadt. In Bombay ist die „Hauskrähe“ aber immer noch allgegenwärtig. Sie ist kleiner und wendiger als die hiesigen Krähenvögel. Das gilt für viele Tiere und Menschen in den Tropen, die zudem anders als bei uns zusammenleben, was nicht zuletzt mit der (buddhistisch-hinduistischen) Religion zusammenhängt. Die „Hauskrähe“ wird in Indien, obwohl man weiß, dass sie wegen ihrer Klugheit und Gewandtheit viele andere Vogelarten aus dem „city life“ vertreibt, nicht als „Parasit“ (Räuber) oder „Symbiont“ (Partner) begriffen, sondern als „Kommensale“ – als jemand, der zusammen mit einem anderen von der gleichen Nahrung lebt, ohne diesen zu schädigen. In der Nähe von Bombay, aber nicht nur dort, gibt es ein Altersheim für Tiere, wo man neben diversen Haustieren auch Skorpione und Giftschlangen aufgenommen hat – ebenso alte Krähen, die dem anstrengenden Stadtleben nicht mehr gewachsen waren.
.
– Nicht nur ich, auch andere Deutsche, die Bombay besuchten – haben in ihren „Reiseberichten“, -Reportagen und „Eso-Forum-Beiträgen“ die Krähen in der Stadt thematisiert:
.
– „Am Tag als ich auswanderte, in der ersten Nacht in Bombay, haben sich vor meinem Hotelzimmer in einem Baum hunderte von Krähen versammelt und einen Krach gemacht, das ich dachte, das werde ich nie aushalten…..ich kam mir vor wie im Alfred Hitchcock Film! 3 Jahre lebte ich in diesem Hotelzimmer und sie kamen nie mehr in dieser Vielzahl in den Baum. Sie kamen aber jeden morgen an mein Fenster und wenn ich mal nicht aufmerksam war, flogen sie mit meinem Spiegelei davon.“
.
– „Von Mumbai aus ins Nirgendwo – Indien… eine wirklich andere Welt. Lautes Vogelgekreisch von unzähligen Krähen …“
.
– „Mumbai: Überall gab es zutrauliche Krähen.“
.
– „Schon auf der Fahrt zum Hotel bekamen wir einen recht bunten Eindruck von unserer neuen Umgebung. Wegen des Abfalls, der vielfach am Rand der Straßen herumlag, waren etliche Krähen unterwegs.“
.
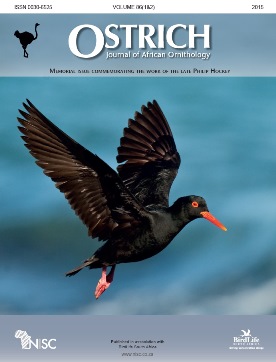
.
– „Die Türen des Zugs stehen offen, so weht ein Lüftchen durch das Frauenabteil. Müll liegt an den Bahngleisen, fauliger Geruch wabert mir entgegen, vermischt sich mit Smogschwaden, und unzählige Krähen kreischen und picken im verderbenden Unrat.“
.
– „Personal sehr freundlich, hilfsbereit und effizient. Frühstücksbuffet reichhaltig, große Auswahl, Ambiente im Frühstücksraum sehr angenehm. Poolbereich sehr schön. Allerdings versammeln sich abends hunderte von Krähen in den Palmen; sie fliegen einem kamikazeähnlich über den Kopf hinweg.“
.
– „Das einzige, was die Poolboys nicht in den Griff bekommen haben, waren zwei tote Fischchen, die wohl eine der 500 Krähen, mit denen wir uns täglich um unsere Nachmittagskekse prügeln, reingeschleppt haben.“
.
– „Anscheinend bestimmt weniger der Grad der Luftverschmutzung als das Verhältnis der Menschen zu ihrer lebendigen Mitwelt den Artenreichtum der Avifauna in den urbanen Zentren, denn wir haben während unserer jahrelangen Indienreisen noch niemals einen Einheimischen auf einen Vogel schießen oder auch nur einen Stein nach ihm werfen gesehen, sondern die Städter lassen beispielsweise Spatzen in ihren Wohnungen nisten, heben nur nachlässig einen Stock, wenn eine Krähe ihnen wieder einen Fisch geklaut hat.“
.

.
– Ein Amerikaner: „In Mumbai auf Einladung des Rotary Clubs. Ich liebe fremdes Essen und das Essen ist auf solchen Veranstaltungen immer ausgezeichnet. Wir schießen Krähen und töten riesige Ratten, aber bei den Affen regt sich die Öffentlichkeit hier furchtbar auf.“
.
– „Dunkle Wolken haben sich am Himmel zusammengezogen, so dass sich die Hochhäuser der entfernten Bombay-Skyline dramatisch gegen einen kobaltgrauen Hintergrund abzeichnen. Als ob sie dieses stimmungsvolle Bild vervollständigen möchten, kreisen Scharen von Krähen wie in einem Hitchcock-Film kreischend über unsere Köpfe hinweg.“
.
– „Umringt von einer Mauer stehen Siebziger-Jahre-Hochhäuser mit vergitterten Fenstern, in denen sich unser Apartment befindet. Schwärme von kreischenden Krähen umkreisen sie – daher die Gitter. Was für eine Ankunft. Als uns gerade erklärt wird, wie ein indisches Badezimmer funktioniert, ruft aus der Ferne der Muezzin in das Morgengrauen hinein, begleitet von den Krähen. Und so warm es auch ist. Es ist das kalte Grauen. Dazu die Gerüche.“
.
– „Ich schreibe dies in einem Hotelzimmer von Bombay. Alle halbe Stunde schaut Riyaz vorbei und fragt, ob ich etwas zu trinken oder zu essen möchte. Natürlich ist ihm langweilig und er will sehen, ob ich vielleicht schon fertig bin. Sobald er wieder aus dem Zimmer ist, kommt die Krähe vom nahe gelegenen Baum zurück auf den Fensterrahmen, wo sie die ganze Zeit hockt, und mir aufmerksam zuhört, was ich ihr für Fragen über ihr Land stelle…“
.
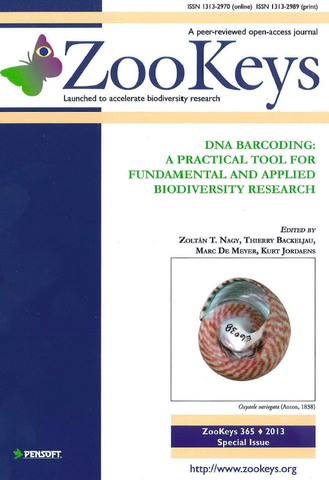
.

.
– Mir sind die Krähen in Bombay zunächst nicht groß aufgefallen, auch in Berlin sieht man sie täglich und nahezu überall, wenn auch nicht so viele auf einmal. Angeblich sollen sie seit 2010 die Tauben aus der Stadt vertreiben. Wir wohnten 1999 in Bombay im 12.Stock eines Hochhauses. Die Mieterin, die uns ihre Wohnung für einige Wochen überließ, hatte jeden Tag zu einer bestimmten Stunde einen kleinen Heuballen von ihrem Küchenfenster auf das Parkdeck geworfen, wo eine der heiligen Kühe schon darauf wartete. Diesen Fütterungsdienst übernahmen wir nicht, dafür stellten wir irgendwann kleine Futterexperimente mit den Krähen an, die täglich zwischen den Hochhausschluchten hin und her flogen und alles genau beobachteten. Wir legten Wurst-, Brot- oder Käsestückchen auf die Fensterbretter. Es dauert oftmals keine Minute, bis eine Krähe sie fand. Ich empfand das als eine ziemliche Leistung – bei den vielen Fenstern und der geringen Größe des Futters. Jedenfalls konnte ich mir nicht vorstellen, dass unsere mitteleuropäischen Krähen ähnlich aufmerksam sind und vor allem so wenig Scheu zeigen, d.h. derartig schnell reagieren.
.
– Ich habe jedoch wenig persönliche Erfahrungen mit Krähen. In den Fünfzigerjahren hatte ich einmal eine am Flügel verletzte Nebelkrähe gefangen, die ich in meinem Zimmer pflegte – und mit Fleischstückchen fütterte. Sie hackte jedesmal nach meiner Hand und kackte alles voll, schien überhaupt unglücklich und ständig schlecht gelaunt zu sein. Ich war froh, als sie einigermaßen wiederhergestellt war und ins Freie entlassen werden konnte.
.
– In Bombay fing ich dann an, jeden nach den Krähen zu fragen. Fast alle wußten eine Geschichte über sie zu erzählen. Am Häufigsten wurde mir berichtet, dass die Krähen oft ungebeten in die Wohnung oder auf die Veranda kommen, um sich Lebensmittel zu stehlen. Aber wenn man sie wirklich benötige, würden sie sich rar machen. Es gibt dort den Brauch, dass sich am Jahrestag eines Verstorbenen seine Freunde und Verwandten zu einem Festmahl versammeln, das aus dem Lieblingsgericht des Toten besteht. Und dabei gebührt einer zufällig vorbeikommenden Krähe der erste Bissen. Diese läßt jedoch gerade bei solchen Gelegenheiten, da sie direkt eingeladen ist, nicht selten stundenlang auf sich warten, so dass das Essen kalt wird. Die Krähen werden dabei nicht als zufällig Angeflogene begriffen, sondern als Wiedergeburt der Seele oder einer der Seelen des Verstorbenen, die sich mit ihrer kurzen Teilnahme am Essen dafür bedankt, dass man an sie gedacht hat.
.

.
– Eine solche Geschichte, die ich mehrfach gehört habe und der ein Seelenwanderungsglaube zugrunde liegt, wird ähnlich auch von Abodh Aras, einem jungen Mann aus Bombay, erzählt: Nachdem sein Großvater gestorben war, erschien eines Tages eine Krähe am Fenster und rief „Abodh, Abodh“. Seine Großmutter war davon überzeugt, dass sie die Seele ihres Mannes verkörperte, zumal die Krähe dann auch noch besonders gerne „Chakli“ aß, ein Reismehl-Gebäck, das der Großvater immer besonders geliebt hatte. Der Vogel nahm die Gebäckkringel aus der Hand von Abodh Aras. Nach einiger Zeit kamen immer mehr Krähen angeflogen. Noch heute kommen täglich welche zu ihm und warten auf dem Fensterbrett seines Eßzimmers darauf, dass er ihnen was zu Essen gibt, wobei jede gewisse Vorlieben hat.
.
– Inzwischen kennt sich Abodh Aras mit der Vogelwelt in seiner Stadt aus und ebenso die Literatur darüber. Bereits Mark Twain hat 1896 über die Krähen von Bombay in seinem Buch „Meine Weltreise nach Indien“ mehrere Seiten geschrieben, er nennt sie die „Vögel der Vögel“. Auch in der lokalen Presse ist immer mal wieder von den Krähen die Rede: Mal wird berichtet, dass sie die Eulen attackieren, und ebenso die armen Tiere im Bombay-Zoo, wo sie es besonders auf die Elefanten abgesehen haben, ein andern Mal, dass es den Kuckucken nach wie vor gelingt, den Krähen ihre Eier in die Nester zu legen, die sie dann ausbrüten und großziehen, und dass sie die Spatzen aus der Stadt vertrieben haben, was Abodh Aras jedoch bezweifelt: Es waren seiner Meinung nach die Menschen.
.
– Dies ist auch die Meinung des stellvertretenden Direktors der „Natural History Society“ von Bombay, Ranjit Manakadan. „So next time, you look at your own indian crow in disdain, think twice and give it the respect due to the fitteste survivor among birds,“ rät er, der im übrigen behauptet, dass die Bombay-Krähen, selbst wenn sie gelegentlich kleine Kinder attackieren, dies nur aus Spaß tun – um sie zu erschrecken.
.
– Es gibt dort jedoch auch noch die Geschichte von einer Frau in Bombay, die ein Krähennest im Baum vor ihrem Fenster zerstörte, woraufhin sich die Krähen zusammentaten und sie fast ein Jahr lang angriffen, sobald sie das Haus verließ. Derartige Geschichten kennt man auch von unseren Krähen – aus der Presse, wobei sie hier jedoch regelmäßig die Krähenvernichter auf den Plan rufen.
.
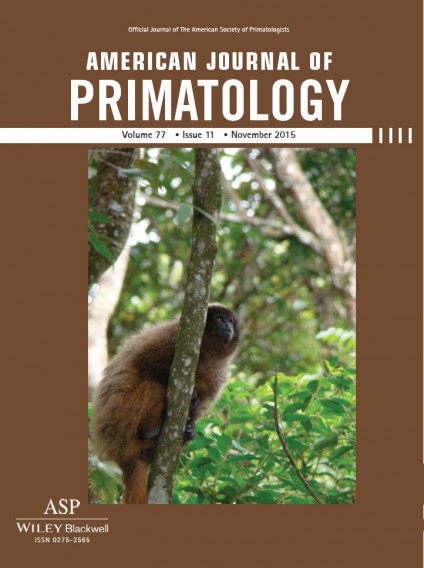
.
– Madame Blavatsky, die Begründerin der Theosophie hielt sich viele Jahre in Indien auf, 1885 berichtete sie: „Das erste, was einem in Bombay auffällt, sind die Millionen Krähen und Geier. Sie sind die Abfallbeseitiger; eines der Tiere zu töten, ist nicht nur polizeilich verboten, sondern erregt auch die Aggression der Hindus, die stets bereit sind, ihr Leben für das einer Krähe hinzugeben.
.
Der schreckliche Krach, den die Krähen sogar Nachts machen, ist einem erst unheimlich, aber dann kommt man dahinter, dass alle Zuckerpalmen und Kokospalmen in und um Bombay herum von der Regierung verpachtet werden. Man zapft sie an und hängt ausgehöhlte Kürbisse an die Stämme. Der Saft, der dort reinfließt fermentiert und wird zu einem berauschenden Getränk: „toddy“ (Palmwein, den man zu Rum weiterverarbeiten kann). Die Kürbisse werden zwar von sogenannten „toddy-Walas“ regelmäßig gelehrt, aber da die Krähen in den Palmen ihre Nester haben, trinken sie natürlich immer wieder davon. Mit dem Ergebnis, dass diese lärmenden Vögel ständig berauscht sind. Wenn sie in unserem Garten auf einem Bein um uns herum tanzten, hatten diese betrunkenen Vögel definitiv etwas Menschliches und einen schelmischen Ausdruck in ihren listigen Augen.“
.
– Ergänzt sei: Die Geier lebten u.a. von den menschlichen Leichen auf den „Türmen des Schweigens“ der Parsen – Anhänger des Zarathustra, die einst aus Persien u.a. nach Bombay geflüchtet waren. Da sie immer weniger werden, nicht zuletzt, weil ihre Kinder zunehmend homosexuell orientiert sind, haben die Geier schon seit langem nicht mehr genug zu fressen – und hauen ab. Es wurden von den Parsen bereits neue Geier illegal aus Pakistan eingeführt, aber auch diese blieben nicht lange in der Stadt. Und die Krähen können sie nicht ersetzen, sie essen zwar am Liebsten Fleisch, aber sie können die Leichen mit ihrem leichten Schnabel nicht „aufbrechen“.Ob man sie ihnen sozusagen schnabelgerecht macht, weiß ich nicht.
.
– Die Parsen werden auch „Crow-Eater“ genannt, wahrscheinlich weil sie als nicht-hinduistische und nicht-moslemische Minderheit verschiedene Tabus der Hindus und Moslems angeblich nicht für sich akzeptieren. Siehe dazu die pakistanische Novelle von Bapsi Sidhwa: „The Crow-Eaters“ (Reprint 2006), was die Tabus darin betrifft, ist die Hauptfigur, ein Parse „mindful of all possible Sacred Crows,“ schreibt Asif Farrukhi anläßlich der Übersetzung der Novelle von Sidhwa in Urdu. In Wirklichkeit ist es eher umgekehrt, dass höchstens die Krähen dort wie erwähnt Parsen-Eater sind – nach deren Tod.
.

.

.
– „Crow-Eater“ nannte man auch die ersten Siedler in Südaustralien, weil sie in ihrer Not manchmal einheimische Vögel, u.a. Krähen, aßen.
.
– In amerikanischen Interneteintragungen (über 500.000) ist „Crow-Eater“ ein anarchistisch-faschistischer Subkulturspaß und steht für lose Groupies von Motorrad-Gangs und ähnlichen männerbündischen Idiotenclubs über die es natürlich jede Menge Idiotenfilme gibt, in denen die hübschen Mädchen T-Shirts mit der Aufschrift „Crow-Eater“ tragen, z.B. als Groupies der „Sons of Anarchy“.
.
– In manchen Gegenden Deutschlands war Krähenfleisch eine Delikatesse und das Fangen von Krähen ein Geschäft. So nannte man z.B. die Fischer der Kurischen Nehrung „Krähenbeißer“ – Krajebieter, weil sie im Herbst während des Vogelzugs mit ihren Netzen Krähen fingen: „Gefesselte zahme oder frisch gefangene Vögel und ausgeworfene Fischabfälle lockten die Krähenzüge an. Das im Sand getarnte Schlagnetz wurde von einer kleinen Reisighütte aus bedient. An einem guten Zugtag konnten mehr als 60 Krähen gefangen werden. Ein Biss in die Schädeldecke ließ sie sofort verenden. Sie wurden eingepökelt und dienten als Winternahrung. Die sogenannten ‚Nehrungstauben‘ wurden auch an große Gaststätten und Hotels verkauft und erschienen als Delikatesse unter ihrem eigenen Namen auf der Speisekarte. Im Königsberger Hotel „Continental“ gab es noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein Nebelkrähen als Spezialität des Hauses.“ (Wikipedia) Heinz Sielmann, der seine ersten Tierfilme in der Kurischen Nehrung im Umkreis der Vogelwarte Rossiten drehte, hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch „Krajebieters“ beim Krähenfang aufgenommen. Die Vogelwarte Rossiten, die inzwischen eine russische „Biologische Station“ ist – in Rybatschi, wird heute übrigens von der Sielmann-Stiftung finanziert.
.
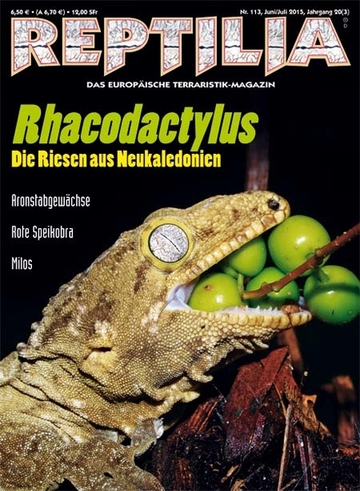
.
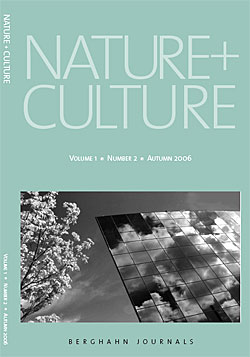
.
.
C. Dichtung und Wahrheit
.
In Aristophanes Komödie „Die Vögel“ ( 414 v. Chr.) fliehen zwei Athener vor privaten Gläubigern und politischen Demagogen aus ihrer korrupten Heimatstadt. Geführt von einer Krähe und einer Dohle gelangen sie ins Reich der Vögel, wo sie zunächst als Menschen – Vogelfänger und -töter – von der versammelten Vogelschar angegriffen werden. Aber dann gelingt es ihnen in „zähen Verhandlungen“, dass man sie akzeptiert und schließlich, dass sie sich zu den Führern einer gemeinsame Zukunft aufschwingen, was in einem Fiasko endet.
.
„Die Komödie ‚Die Vögel‘ ist einem angesichts der herrschenden Verhältnisse tief empfundenen Ekel geschuldet. Und gleichzeitig gelingt diesem großartigen Dichter etwas unerhört Neues: die Utopie eines herrschaftsfreien Raums; die Fantasie einer Gesellschaft der Freien und Gleichen,“ findet die „Theater-AG“ des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bergzabern. „Aristophanes geht es in seiner Komödie ‚Die Vögel‘ im Wesentlichen um die negative Beeinflussung stupider, verbohrter und/oder unbedarfter Massen,“ heißt es dagegen auf „allgemeinwissen.de“. Die Vögel sind also hier die Dummen.
.
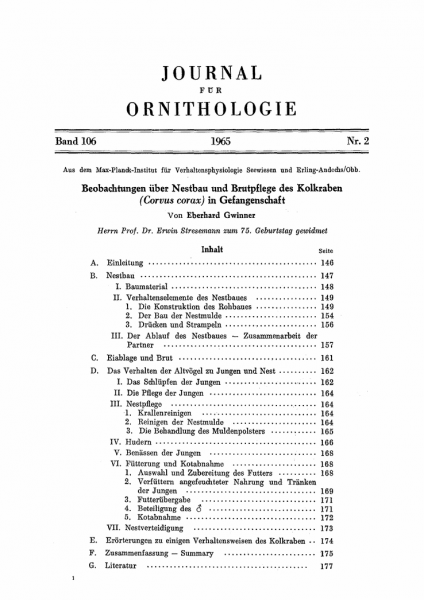
.
Ganz anders in der Kurzgeschichte „Die Vögel“ (1952) von Daphne du Maurier: Ein englischer Landarbeiter bemerkt, dass sich die See- und Landvögel immer aggressiver verhalten. Er vermutet schon bald, dass hinter ihrer scheinbar zufälligen Schwarmbildung eine Art kollektive Intelligenz steckt.
.
Während die Frankfurter Kulturwissenschaftlerin Eva Horn der „Schwarmintelligenz“ (2009) nur Positives abgewinnen kann (in ihrem Buch darüber), sieht der englische Landarbeiter darin eine zunehmende Gefahr und fängt an, seine Hütte zu befestigen. Aus dem Radio erfährt er von ähnlichen Vorgängen im ganzen Land. Nachdem alle Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen und die benachbarten Bauern durch Attacken der Vögel umgekommen sind, entwirft der Landarbeiter für sich und seine Familie einen Überlebensplan.
.
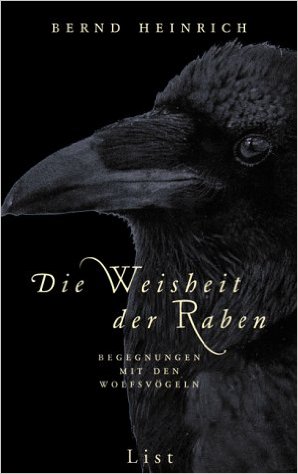
.
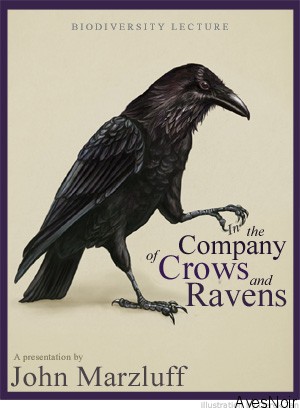
.
Die Erzählung endet ebenso offen wie der Film „Die Vögel“, den Alfred Hitchcock dann daraus 1963 machte. Er verwendete dazu noch zwei Realereignisse – eine aus dem kalifornischen Ort „La Jolla“: Dort war ein größerer Schwarm Spatzen durch den Kamin in ein Haus eingedrungen. Während der Vorbereitungen für den Film kam es in der nahen Küstenstadt Capitola zu einem weiteren Vorfall: Hunderte „Dunkler Sturmtaucher“ (aus der Familie der „Sturmvögel“) flogen gegen Hausdächer, zerbrachen Fenster und durchtrennten Stromleitungen. Im Film wurde darauf bezug genommen – mit einem Dialog zwischen einer Ornithologin und einem Handelsvertreter in einem Restaurant.
.
Jahrzehnte später stellte sich laut Wikipedia heraus, dass die Tiere von Domoinsäure, einem von Kieselalgen der Gattung Pseudo-nitzschia produzierten Nervengift, befallen waren. 1991 wurde in Monterey Bay ein ähnliches Massensterben von Braunpelikanen beobachtet, was auf die Toxine einer seltenen Algenblüte zurückgeführt werden konnte. Ein Zusammenhang zwischen den beiden „natürlichen“ Massenvergiftungen in derselben Gegend wurde aber erst im Dezember 2011 im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung nachgewiesen.“
.

.
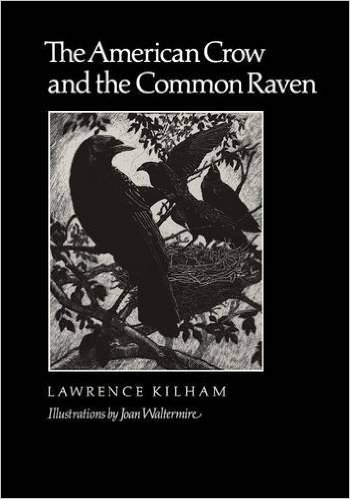
.
Dem Regisseur Francois Truffaut erzählte Hitchcock später, Raben hätten Lämmer angegriffen und einem Farmer die Augen ausgehackt. Tatsächlich können Rabenvögel aber keine Leichen „aufbrechen“. Wenn kein Wolf oder Fuchs kommt, der dies übernimmt, müssen sie sich mit Augen und Zunge zufrieden geben. Das taten sie auch bei den im Mittelalter Gehenkten, weswegen man sie „Galgenvögel“ nannte, oder „Unglücksvögel“. Auch über den Schlachtfeldern tummelten sie sich gerne. In seinem Gedicht „Die Raben“ (1920) läßt Karl Kraus sie dort sagen: „Immer waren unsre Nahrung/ die hier, die um Ehre starben.“ Der Nazi-Bestsellerautor Erich Edwin Dwinger erwähnt in seinem Roman „Zwischen Weiß und Rot“ (1930), wie die schwarzen Vögel in Sibirien über seine am Straßenrand zusammenge-gebrochenen Kameraden herfielen. Dwinger kämpfte und marschierte in der sich auflösenden Armee des Weißen Generals Koltschak auf der Flucht nach Wladiwostok mit – bis die Roten Partisanen ihn auf dem zugefrorenen Baikalsee gefangen nahmen. Seine Bücher wurden unlängst in Österreich neu aufgelegt und in der FAZ unter dem Titel „Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft“ ganzseitig rezensiert.
.
In vielen Filmen wird inzwischen nahendes Grauen mit Rabengekrächze untermalt. In E.A.Poes Gedicht „Der Rabe“ ist es bereits sein Name: „Nimmermehr“, den der Vogel so lange wiederholt, bis die Seele des Icherzählers sich nimmermehr erhebt. Poe bezieht sich dabei auf Charles Dickens‘ Novelle „Barnaby Rudge“, in dem ein Rabe vorkommt, mit dem Dickens tatsächlich zusammenlebte.
.
Wie man aus vielen Berichten von Rabenbesitzern inzwischen weiß, können sie nicht nur Worte nachsprechen, sondern sie auch situationsgerecht einsetzen. Im übrigen ist ihre tricksterhafte Bosheit uralt: Im alten Testament galt der Rabe als unreines Wesen, als Inkarnation des Bösen und des Teufels. Einst entsandte Noah den Raben, um nach trockenem Land zu suchen, doch der Rabe fand einen Tierkadaver und ergötzte sich an diesem. Er kam nicht zurück und Noah verfluchte ihn und entsandte die Taube, die mit dem Ölzweig wiederkehrte. Im jüdischen Glauben sind Raben aufgrund dessen schwarz geworden. Auch war es Gott gewesen, der den Rabenvögeln die Singstimme nahm und sie somit kreischen und krächzen mussten, als Strafe für ihre Untugend, wie der Ornithologe Josef Reichholf in seinem Buch „Rabenschwarze Intelligenz“ (2009) schreibt. Es würde sich lohnen, in diesem Zusammenhang der Verbindung der „Crow“-Indianer mit ihrer „Urkrähe“ und ihrem Schicksal bis heute nachzugehen. Im Zweiten Weltkrieg fasste das US-Militär schwarze Soldaten zusammen – in einer sogenannten „Crow“-Einheit. Kürzlich antwortete der ehemalige US-Drohnenpilot Brandon Bryant vor dem „Geheimdienst-Untersuchungsausschuß auf die Frage, ob die völkerrechtswidrig Ermordeten „Einzelfälle“ waren oder ob das der „Regelfall“ war: „Ziemlich. Drei Kennzeichen: Männer in militärischem Alter. Dann Raben und Krähen. Das waren Frauen und Kinder. Sonst Männer in militärischem Alter, d.h. über 12 Jahre. Das waren legitime Ziele.“
.
Hitchcocks Hauptdarstellerin in „Die Vögel“, Tippi Hedre, ließ und läßt sich von diesen ganzen Geschichten nicht beeindrucken. „Die Welt“ berichtete Ende 2015: „‚Die Vögel‘-Star Tippi Hedren lebt mit vielen Raben zusammen“ – auf ihrer Ranch in Kalifornien. Der Anblick der Vogelschar erinnere sie ein wenig an die Dreharbeiten 1963. „Der Unterschied ist: Sie greifen nicht an.“
.
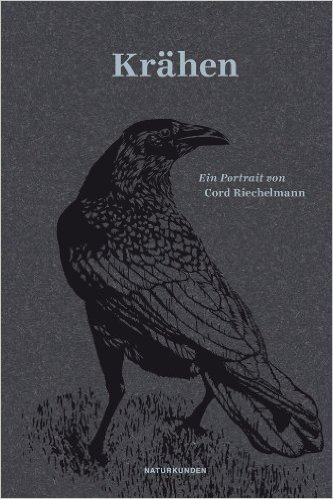
.
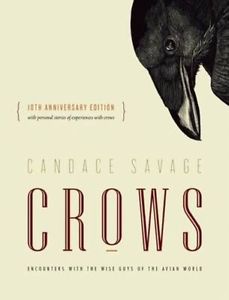
.
Raben und Krähen sind „Kulturfolger“ und nicht nur Aasvertilger, sondern „Allesfresser“. „Das Film-Team verbrachte damals drei Tage an einer Mülldeponie in San Francisco und drehte dort über 6000 Meter Film,“ heißt es auf Wikipedia. Ray Berwick, Hollywoods berühmtester Tiertrainer, übernahm die Arbeit mit den Vögeln am Filmset (unter der Aufsicht von Vertretern der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Er arbeitete überwiegend mit Raben und Krähen, die sich wegen ihrer Intelligenz besonders gut dressieren lassen, wie er meinte. Inzwischen haben tausende von Intelligenz-Tests und -Experimente bewiesen, dass Raben und Krähen mindestens so intelligent wie Primaten sind. Auch neigen unverpaarte Raben dazu, beim Auffinden eines aufgebrochenen Kadavers ihren Schwarm zu Hilfe zu rufen. Aber noch nie haben sie sich kollektiv gegen den von ihnen zu Recht gefürchteten Menschen verschworen, im Gegenteil, mit den Indianern, Eskimos und anderen Jägervölkern kooperierten sie einst sogar.
.
So wie die Ornithologin in dem Film davon überzeugt war, dass den Vögeln das geistige Potential fehlt, Angriffe mit destruktiven Beweggründen zu führen, ist sich auch heute noch der Harvard-Neurologe Marc Hauser sicher, Tiere sind generell nicht in der Lage, sich zu einem (Sklaven-) Aufstand gegen die Menschen zusammenzurotten. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, schreibt er in seinem Buch „Wild Minds“.
.
Fakt ist aber, „je länger der Film andauert, desto größere, schwärzere und desto mehr Vögel kommen ins Bild,“ wie ein Hitchcock-Verehrer bemerkte. Der Dramatiker Heiner Müller mutmaßte: Die Bedrohung durch die Vögel könnte ein Symbol für die „Rebellion der Natur“ sein, die der Mensch „ohne Rücksicht auf seine Zukunft als Gattungswesen verwüstet… Vielleicht geht es letztlich nur noch darum, wer zuerst mit wem fertig wird, die Natur mit der Menschheit oder die Menschheit mit der Natur…“
.
In seiner „Bildbeschreibung“ (1985) notierte Heiner Müller – zur klammheimlichen Freude der militanten Naturschützer: „Sturzflug des Vogels, Landung auf dem Schädeldach des Mannes, zwei Schnabelhiebe rechts und links, Taumel und Gebrüll des Blinden.“ Zwar arbeiten so ziemlich alle Ornithologen und Bird-Watcher dieser Mär aufklärerisch entgegen, aber nach wie vor sind viele Bauern fest davon überzeugt, dass Rabenvögel gelegentlich Schafe und Kälber auf diese Weise töten, und die netten kleinen Singvögel sowie Eichhörnchen und Ziesel sowieso. Die in die Städte gezogenen Rabenvögel haben es dagegen vor allem auf das Symbol des Friedens – die Tauben – abgesehen. Trotzdem sie in Deutschland gesetzlich geschützt sind, werden hier alljährlich hunderttausende Rabenvögel abgeschossen. Im Internet findet man mindestens ebenso viele wissenschaftliche Gutachten von Jagdverbänden, die das für nützlich bzw. notwendig halten, wie Gutachten von Naturschutzverbänden und -experten, die das Gegenteil beweisen – für sich genommen eine „symmetrische Kriegsführung“.
.
John Marzluff und Tony Angell erwähnen in ihrem Buch „Gifts of the Crow“ einen Kolkraben, dem die Nationalparkwächter und -biologen in den Washington State’s Cascade Mountains den Namen „Hitchcock“ gaben. Er hatte die Angewohnheit, auf den Parkplätzen das Gummi von den Scheibenwischern der Autos abzureißen – und zu verstecken. Marzluff und ein paar Helfer fingen ihn und seine Gefährtin mit einem Netz und beringten ihn. Wobei sie die Hoffnung hatten, dass er diese unwürdige Behandlung mit den Scheibenwischern in Zusammenhang bringen würde. Marzluff dachte dabei an die Pawlowsche Konditionierungs-Theorie. Weitere Diebstähle von Scheibenwischergummi durch Raben erwähnt Marzluff in einer Fußnote dazu. Der Rabe von Lawrence Kilham hatte ebenfalls diese Angewohnheit. In Berlin haben Krähen auf dem Dach des neuen Hauptbahnhofs sofort die gummiartige Fensterisolierung rausgezerrt, woraufhin es auf die überdachten Bahnsteige regnete.
.

.
Am 7.2. 2012 fand in Chemnitz eine Fachtagung „Vogelschutz am Bau“ statt, zu der der Verein Sächsischer Ornithologen und die Stadt Chemnitz eingeladen hatten. Es ging es dabei um die Dohle, den Vogel des Jahres. Mehr als 90 Interessenten und Experten aus Sachsen und Thüringen, aber auch aus Münster, Bonn und Prag nahmen daran teil. Die Bestände der Dohle sind in vielen Gebieten teils drastisch rückläufig, allerdings nur noch bedingt wegen Nistplatzmangels, heißt es vom Verein. Dieser Mangel ist jedoch nicht zu unterschätzen, da das Renovieren von Häusern und das Fällen alter Bäume den Dohlen massenhaft Nistplatzmöglichkeiten nimmt.
.
„Den Dohlen“, notierte Günter Eich, „ist der Turm Horst und Felsenmassiv“ und Goethe dichtete: „Sollen dich die Dohlen nicht umreih’n, mußt nicht Knopf auf dem Kirchturm sein.“
.
„Der weltweite Bestand der Dohle bewegt sich wahrscheinlich noch im zweistelligen Millionenbereich,“ behauptet Wikipedia. In Berlin sieht man so gut wie keine (mehr), in Schleswig-Holstein dagegen noch relativ viele. Dort ist dafür die Elster und die Nebelkrähe eher selten, die man in Berlin überall sieht.
.
Erwähnt seien noch die Saatkrähen, für die Schleswig-Holstein ein Brutverbreitungs-Schwerpunkt darstellt. Auch sie wandern in die Städte ab. Dort scheinen sie sich kommoder zu fühlen. Zwischen 1954 und 1974 hatte sich der Bestand von etwa 16.000 Paaren auf rund 8.400 Paare verringert. „Neben der Vergiftung durch quecksilberhaltiges Saatgut, war für den Bestandsrückgang und das völlige Verschwinden der Saatkrähe als Brutvogel aus weiten Bereichen Deutschlands vor allem die gezielte Verfolgung durch den Menschen verantwortlich. Weit verbreitet war der Abschuss der eben flügge gewordenen Jungvögel, die zum Teil im Wildhandel als ‚Saatgeflügel ohne Haupt und Ständer‘ angeboten wurden. Innerorts wurden die Nester oft mitsamt den Eiern oder Jungvögeln aus den Bäumen gestoßen, weil man die Vögel als Belästigung empfand. In vielen Kolonien war so alljährlich der gesamte Nachwuchs vernichtet worden,“ heißt es in einer ornithologischen Mitteilung – von Dr. Wilfried Knief.
.
Er war bis 2008 Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte Schleswig-Holstein und ist seit 30 Jahren stellvertretender Vorsitzender der OAG. Der Schutz von sogenannten „Problemvögeln“ ist ihm ein besonderes Anliegen. 1980 trat die Bundesartenschutz-Verordnung in Kraft. Wie zuvor schon in anderen Bundesländern war die Saatkrähe damit auch in Schleswig-Holstein ganzjährig geschützt. Der Bestand erholte sich daraufhin auf jetzt rund 25.000 Brutpaare, mancherorts gelten sie schon oder wieder erneut als eine „Landplage“, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird. „Flensburg online“ fragte sich bereits erbost: „Wem gehört eigentlich die Stadt?“ Was den Berlinern das Gebell und die Hundescheiße ist den Flensburgern das laute Saatkrähen-Gekrächze und ihr Kot. Die krähenfeindliche „Welt“ schrieb: Ein Mittel gegen diese „Problemvögel“ gibt es bisher noch nicht. Saatkrähen seien aus den Städten nicht mehr heraus zu bekommen, meinten die Experten Ende 2011 beim ersten „Krähensymposium“ im ostfriesischen Leer. Dort berieten Fachleute aus dem gesamten Bundesgebiet über mögliche „Auswege“.
.
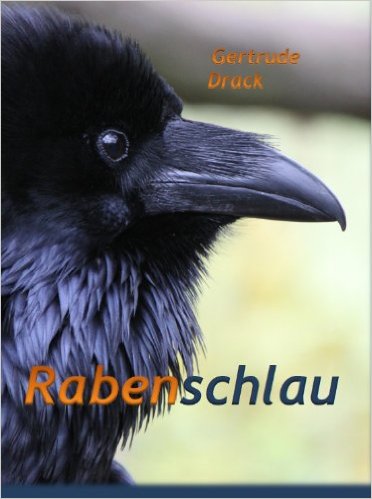
.
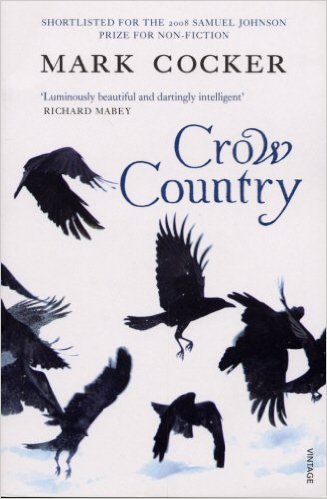
.
P.S.: In der Ringvorlesung der Humboldt-Universität „Tier im Text“ thematisierte der Literaturprofessor Ernst Osterkamp den Raben. Dieser Vogel ist literaturhistorisch ergiebig. Nacheinander diente er den Schriftstellern als „Metapher, Medium und artistisches Instrument“. Sie befreiten damit den „mythischen Inauguralvogel“ von seinen „Verkrustungen“. In den Mythen changierte zwischen Göttervogel und Todesbote. Auf diese Weise wurde er laut Osterkamp „hoffnungslos übercodiert“, so dass er für die Dichter fast nicht mehr zu gebrauchen war. Mit seiner Verwissenschaftlichung und ausdauernder Beobachtung mythifizierte ihn die Ornithologie dann erneut, indem sie seine besondere Rolle in der Vogelwelt herausstellte – und ihn vermenschlichte – in „Brehms Tierleben“ heißt es z.B. über die Raben: „Sie führen ein sehr bequemes Leben“, sie sind klug, sprachbegbt, „erfreuen ihren Gebieter, ärgern andere“. Der Ethologie Konrad Lorenz stellte klar: „Wir vermenschlichen das Tier nicht, sondern vertierlichen den Menschen.“ Seine ersten Forschungstiere waren Dohlen.
.
Für Osterkamp ist die Dohle hoffnungslos untercodiert. Er erwähnte als Beispiel Adalbert Stifter, der in seiner Erzählung „Turmalin“ den Raben durch eine Dohle ersetzte, mit der er „dann aber nicht viel anfangen kann“. Die Dohle gehört wie die Krähe zu den Rabenvögeln. Im „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“ heißt es, dass Raben und Krähen im Volk häufig verwechselt werden. Die Literaturforschung darf sie aber laut Osterkamp niemals verwechseln, „denn die Krähen tummeln sich semantisch ganz woanders.“ Z.B. wurde der CDU-Politiker Klaus Wohlrabe einmal von Herbert Wehner als „Übelkrähe“ beschimpft: „Er hat sich davon politisch nie wieder erholt“. Ganz anders verhält es sich mit den Raben – in England z.B.: Wenn sie im Tower of London verschwinden, ist es der Legende nach auch mit der Monarchie vorbei. Die flügelgestutzten Vögel haben dort deswegen einen eigenen Rabenvater (Ravenmaster). Als eines der Tiere (wahrscheinlich von einem Fuchs) getötet wurde, versicherte die Tower-Sprecherin der Presse: „Wir nehmen das Wohlergehen der Raben sehr ernst.“ Real- und Literaturgeschichte, Mythos und Medium gehen ineinander über. Als Charles Dickens einen „Tale“ mit Raben, „Barnaby Rudge“, veröffentlichte, berichtete er im Vorwort über die Raben in seinem Wohnhaus. Es ist heute ein Museum, in dem es die Dickensschen Raben immer noch gibt – ausgestopft. Der wegen seines Gedichts über diese Vögel von ominöser Bedeutung“ berühmte Edgar Allan Poe rezensierte „Barnaby Rudge, noch bevor die letzte Folge dieser Geschichte erschienen war, wobei er den Mörder verriet. Charles Dickens was not amused.
Osterkamp arbeitete sich dergestalt, lichtbildgestützt, durch die literarischen Verwendungen des Rabens im 19. Jahrhundert, verfolgte die Verwendung dieses Vogels von Walter Scott bis Puschkin und Fallersleben, urteilte, dass bei Fontane die Raben zu einer „moralpolitischen Taskforce“ werden, dass Chamisso ihnen aber wieder „poetische Flügel“ verleiht, und dass sie im „Ring der Nibelungen“ zum „Medium“ werden, Wagner intonierte dazu „das Rauschen der Raben“, Osterkamp ließ diese Passage im Hörsaal 1101 einspielen.
„Der Rabe Ralf“ in Christian Morgensterns „Galgenliedern“ begeht am Ende „semantischen Selbstmord“, während Wilhelm Buschs „Hans Huckebein der Unglücksrabe“ sich am Ende sozusagen real strangulierte. „Bei Busch sind die Tiere zentrale Akteure – von Schopenhauer beeinflußt geht er in seiner pessimistischen Weltsicht davon aus, dass der Verstand nicht auf den Willen einzuwirken vermag.“ Auch Buschs Rabe folgte nur seinem Willen, „man hätte ihm nicht die Freiheit nehmen sollen“.
.
Den expressionistischen Dichtern, Trakl und van Hoddis, werden die Raben dann geradezu prophetisch zu „Auguralvögeln einer Zeitenwende“.
.
Erwähnt seien noch zwei reale Raben – aus der Sowjetunion: Der mit Konrad Lorenz befreundete Zoologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt berichtete, dass er sich noch gut an die erste Begegnung mit seinem großen Vorbild Lorenz erinnern kann, als der 1948 gerade aus der sowjetischen Gefangenschaft zurückkam – mit einem dicken Manuskript über die Verhaltensforschung sowie mit einem Käfig und zwei gezähmten Vögeln. Einer davon war ein Rabe.
.
Ähnlich produktiv war auch die „sowjetische“ Zeit für den Peenemünder Raketenbauer Helmut Gröttrup, den die Rote Armee 1945 zusammen mit seiner Frau und etlichen Mitarbeitern zunächst im „Institut Rabe“ im Harz halb freiwillig internierte und dann auf der Insel Gorodomlia im Seligersee, um ihnen beim Bau von Raketen zu helfen. In seinen fünfbändigen Erinnerungen “Raketen und Menschen” schreibt der stellvertretende Leiter des sowjetischen Raumfahrt-Programms B.E.Tschertok über die Gröttrups, dass sie sich in Helmut Gröttrup nicht getäuscht hätten und dass Irmgard Gröttrup viel Initiativkraft besaß. So schaffte sie z.B. als erstes zwei Kühe an, um die Ernährungslage der Leitungskader des “Instituts Rabe” sowie der Kinder zu verbessern und zwang überdies immer wieder den für die Versorgung zuständigen Offizier, “defizitäre Produkte” heran zu schaffen. Auf Gorodomlia langweilte sie sich bald und fing an, eine Art Tagebuch zu schreiben (das später in der BRD veröffentlicht wurde – unter dem Titel: „Die Besessenen und die Mächtigen im Schatten der roten Rakete“) und einen kleinen Raben aufzuziehen. Diesen nahm sie 1953 auch mit nach Deutschland, wo das Ehepaar zunächst im Ostberliner Hotel Adlon unterkam. Wegen des Rabens, der alles vollschiß, mußten sie jedoch das Hotel bald wieder verlassen – und zogen nach Westberlin um. Laut ihrer Tochter erklärte Irmgard Gröttrup dann den CIA-Agenten, die das Ehepaar nach Amerika einluden, “daß sie sich ausreichend mit der Raketentechnik in Rußland befaßt hätten und jetzt aus Deutschland nicht wieder wegfahren wollten”.
.
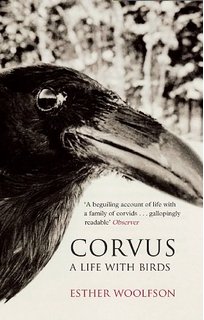
.
Immer mehr Autoren verwenden inzwischen Tiernamen in ihren Buchtiteln (Marc-Uwe Kling „Das Känguruh-Manifest“ oder Felicitas Mayall „Nacht der Stachelschweine z.B.), ohne dass die Tiere darin vorkommen. Die Buchgestalter greifen ebenfalls immer öfter zu Tierbildern bei ihrer Umschlagsgestaltung, egal, wovon der Text handelt. Tierbücher verkaufen sich gerade gut. Ich kaufte drei Romane, in denen von Krähen bzw. Raben die Rede sein sollte. Das war auch der Fall, aber ihr „Mitspiel“ darin war überflüssig. In „Krähen“ (2015) von Kader Abdolah geht es um einen Iraner, der nach Chomeinis Machtergreifung flieht – und schließlich in Holland als Kaffeehändler landet. Der kleine Roman ist zu großen Teilen autobiographisch (gehalten), und Krähen sind seit des Icherzählers erste Liebe, die kurz ihren schwarzen Tschador für ihn ablegte, immer mal wieder in seiner Nähe. Mehr aber auch nicht. Der Roman des Schweden Tomas Bannerhed „Die Raben“ (2011) handelt von einem Bauernsohn, der den Hof übernehmen soll, sich aber mehr für Vögel interessiert, dabei u.a. auch für Raben, aber andere Vögel interessieren ihn mehr. Im dritten Roman „Oben ist es still“ (2008) von Gerbrand Bakker, ein holländischer Autor, der schon öfter Erzählungen über Tiere veröffentlicht hat, geht es ebenfalls um einen Bauernsohn. Dieser ist jedoch wildentschlossen, den Hof in eigener Regie zu führen. Als erstes verbannt er seinen kranken Vater in das obere Stockwerk ihres Wohnhauses. Gelegentlich taucht eine Nebelkrähe auf, einmal greift sie seinen Praktikanten an und bringt ihm eine Kopfwunde bei. Meistens sitzt sie auf einem Baum nicht weit weg vom Hof, er kann sie von seinem Küchenfenster aus sehen. Das ist alles. Die Probleme und Beobachtungen gelten in den drei Romanen den Menschen, im Hinblick auf Raben und Krähen geben sie nicht viel her. Demgegenüber haben die etwa 30 bekanntesten Dichter in Ost- und Westdeutschland die Krähen und Raben ernster genommen, sie dabei jedoch zumeist auf deren Angewohnheit, die Leichen von Gehenkten und Gefallenen zu verzehren, reduziert. Ihre diesbezüglichen Gedichte finden sich in der Sammlung „Rabenvögel“ (2013) von Bernd Philippi. Es gibt natürlich auch jede Menge enttäuschende Berichte von, wie es heißt ausgewiesenen Rabenforschern. Einen habe ich oben erwähnt – über die Krähen in der Mojave-Wüste.
.
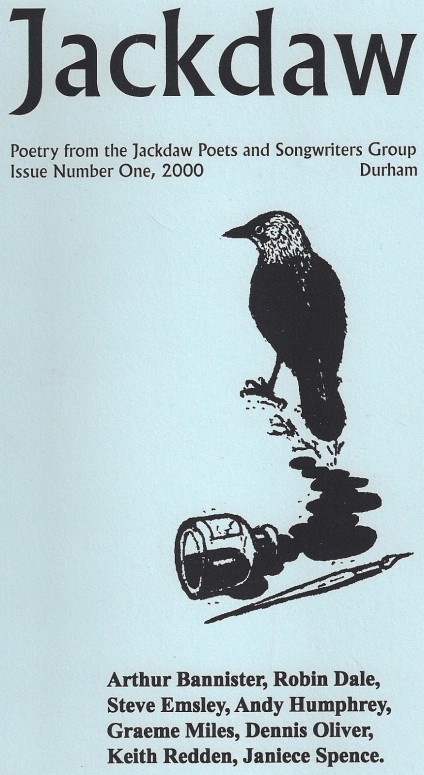
.




