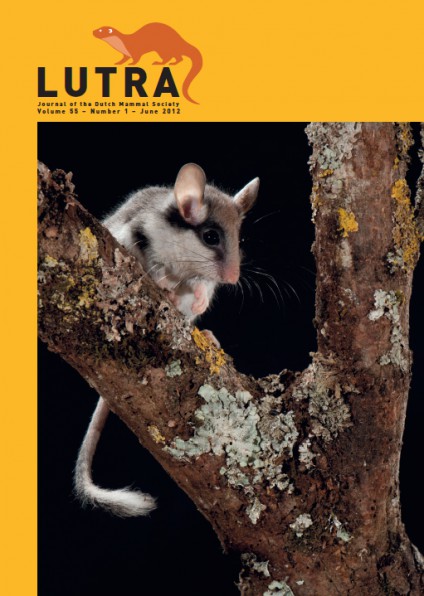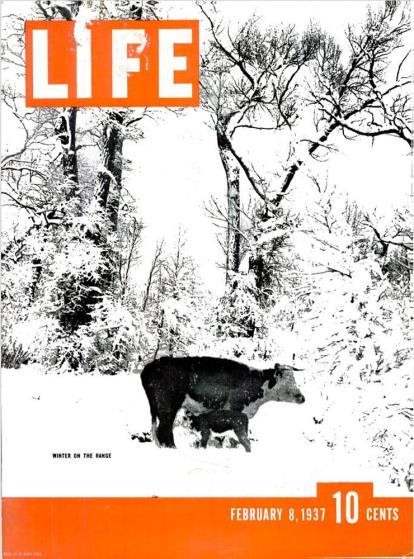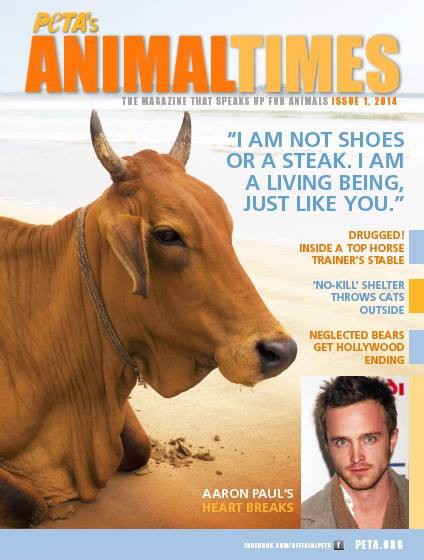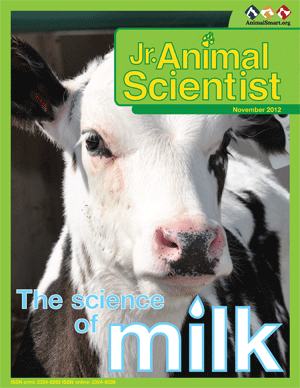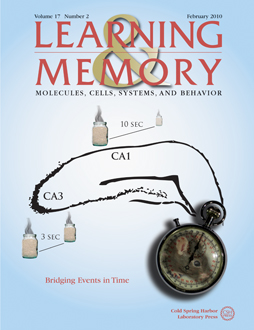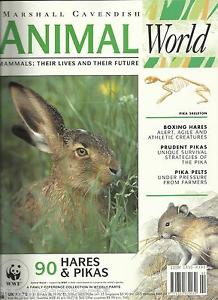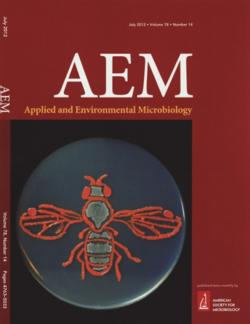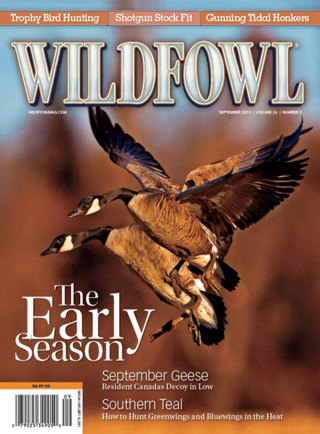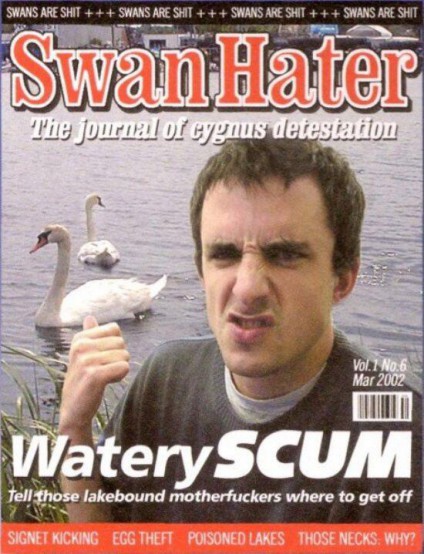Der Satz – von Luther – lautete ursprünglich: „Der Bauer ist witzig geworden“ – das meinte: gewitzt und aufmüpfig. Was sich schon bald zu einem Bürgerkrieg ausweitete, der nach Rosa Luxemburg nichts anderes als ein Klassenkampf ist. Und dieser „Krieg“ wurde von der unterdrückten Klasse der Bauern verloren. Der Leipziger Maler Werner Tübke gestaltete das Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen. Sein Monumentalgemälde entstand zur Erinnerung an den blutig niedergeschlagenen „großen deutschen Bauernkrieg“ (1524-26). Wenn die Bauern damals (wie 100 Jahre zuvor die böhmischen und mährischen Bauern sowie auch die Handwerker in den „Hussitenkriegen“) gegen Adel und Kirche gesiegt hätten, sähe Deutschland anders – besser – aus, meinten noch der Freiherr von Stein und Friedrich Engels, für die der „Bauernkrieg“ das wichtigste Ereignis in der deutschen Geschichte war. Das Photo zeigt einen Ausschnitt aus Tübkes Bauernkriegspanorama.
.
Als freie Mitarbeiter der LPG „Florian Geyer“, Saarmund, war es für uns natürlich Ehrensache, einer Einladung des Bauernkriegs-Panorama-Kollektivs in Band Frankenhausen 1990 Folge zu leisten. Neben der Vorführung eines erst jüngst fertiggestellten Defa-Dokumentarfilms („Theatrum mundi“) über die Entstehung des Tübkeschen Monumental-Gemäldes stand noch eine Pressekonferenz mit dem Meister selbst auf dem Programm. Werner Tübke hatte ein Jahr nach der 450-Jahrfeier des Bauernkriegs, 1976, mit dem Malen im Rundbau angefangen und sechs Jahre ununterbrochen daran gearbeitet, zusammen mit einigen Assistenten. Von seiner Pressekonferenz erhofften wir außerdem Näheres über die sowjetische Arbeiterinnen-Brigade zu erfahren, die ihm seinerzeit die Leinwand (14 Meter breit und 123 Meter lang) hergestellt hatte – und zwar „nahtlos“!
.
Zuvörderst verlas der Generaldirektor des Panoramas jedoch eine längere Erklärung, in der eine Statuten- und eine Namensänderung des von durchschnittlich 800 Touristen täglich besuchten „Objekts auf dem Schlachtberg“ angekündigt wurde. Solche Überarbeitungen („Umpositionierungen“ oft auch genannt) sind jetzt in der DDR nicht eben selten. Hier bedeuteten sie eine eindeutige und von uns leise, aber von einem Göttinger Historiker laut bedauerte Akzentverschiebung: das Wort „Bauernkrieg“ wurde nämlich aus dem Namen gestrichen. Falsche Ideologie weg, wahrer Kunstgenuß her: Das Panorama-Gebäude soll unter Hinzuziehung weiterer Gemälde des Meisters – aus dem Keller der Nationalgalerie und aus dem bald einem Luftschloß weichenden Palast der Republik – sukzessive zu einem reinen Tübke-Museum umgestaltet werden. Da wir den Maler schätzen, darf ich hier vielleicht kurz sagen, warum diese gleichsam verbale Abkopplung des Realen durch seine Hauptwerk-Verwalter zu bedauern ist.
.
Auf der Pressekonferenz gefielen uns im übrigen auch die mündlichen Äußerungen des „Mammutschinken-Malers“ (ZDF). Dem Superintendenten der Evangelischen Kirche in Frankenhausen, der ihn fragte, warum die Kreuzigung Christi im Vergleich etwa zum Turmbau zu Babel daneben so unverhältnismäßig klein geraten sei, antwortete Tübke schlicht: sie hätte ihm sonst den ganzen Rhythmus (der Horizontalen) versaut. Eine der anwesenden Mitarbeiterinnen am „Theatrum mundi“-Film berichtete von ihrer – bisher noch zu wenig beachteten – „Entdeckung“: der Umwandlung (Umbiegung?) der zumeist linear gedachten Geschichte in ein anfang- und endloses Rundgemälde. Nietzsches „ewige Wiederkehr“ als Panorama? Der Gedanke hatte etwas für sich. Er könnte sich vielleicht auch auf die Bearbeitung des Stoffes durch den Künstler selbst beziehen, der gut und gerne schon einmal – in seinem früheren Leben etwa – zum engeren Kreis von, sagen wir: Lucas Cranach d.Ä. gehört haben könnte. Dafür spricht, daß er sich auf dem Bauernkriegs-Panorama gleich mehrmals selbst porträtiert hat, einmal auch seine dritte Ehefrau – hoch zu Roß.
.

.
In seinem Buch über den „Circulus vitiosus deus“ schreibt Pierre Klossowski: „Die Bildung des Verstandes auf dem Gebiet der tierischen Biologie erfordert eine explorative Progression, für die das Gehirn ein Instrument bildet: bei Nietzsche gibt es eine Tendenz zur Befreiung der Exploration gegenüber dem Instrument, da letzteres das Erforschte seinen begrenzten funktionellen Grenzen unterordnet. Daher strebt Nietzsche nach einer Dezentralisierung (also nach Ubiquität). Und daher auch die Ablehnung eines ‚Denksystems‘.“
.
Wir fragten Werner Tübke aber nur, quasi im Auftrag unseres zu der Zeit schon fast gescheiterten LPG- Vorsitzenden, nach der Anwesenheit Florian Geyers auf dem Bauernkriegs-Gemälde: „Er ist leider nicht mit drauf, ich musste auswählen“.
.
Der Vorsitzende der „LPG Florian Geyer“ Kärgel, der bereits mehrmals seinen Urlaub im Kyffhäuser-Gebirge verbrachte, hatte uns vor der Abfahrt das wunderbare Thomas Müntzer-Buch von Gerhard Brendler geliehen und gemeinsam hatten wir darin auf einer Reproduktion eines Tübkeschen Schlacht-Details den laut Zimmermann „schönsten Helden dieses Kampfes“ gesucht. Zimmermanns Geschichte des Bauernkrieges hatte ich einige Jahre zuvor schon vom „Speckenmüller“, einem Bauern im oberhessischen Vogelsberg und Sprecher der dortigen Bewegung gegen den „Wasserraub“ der Stadt Frankfurt, geliehen bekommen (und, wie mir grad zu meiner Schande einfällt, nie wieder zurückgegeben).
.
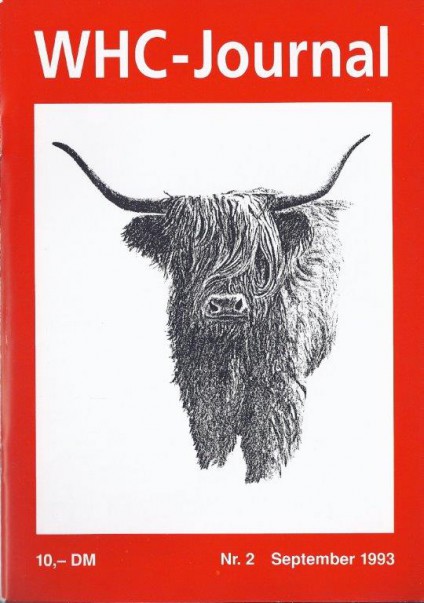
.
Die Ende der siebziger Jahre entstandene Regional-Bewegung war z.T. von einer Kneipe namens „Bundschuh“ (einer umgebauten Zehntscheune) ausgegangen. Und dort hing später als kleine Reproduktion (aus einer westdeutschen Kunstzeitschrift) auch das Bauernkriegs-Panorama von Tübke an der Wand – natürlich wieder linearisiert, genauer gesagt: plan gemacht. Mich faszinierte darauf insbesondere der große blaue Fisch (Jahre zuvor hatte ich auf einer Fahrt nach Portugal, aus Anlaß der sogenannten „Nelkenrevolution“ dort, an der Atlantikküste ein arges Versagens-Erlebnis gehabt, das mit einem kleinen blauen Fisch zusammenhing, der in einem von der Ebbe zurückgelassenen Wasserloch schwamm).
.
Tübkes Fisch war über das Titelblatt einer Schrift des Astrometeorologen Leonhardus Reynmann aus dem Jahre 1523 in das Panorama gekommen. Der Autor sagte darin anhand von Interpretationen einer ungewöhnlichen Planeten- Konjunktion den baldigen Weltuntergang voraus: „Es gibt eine ausgedehnte Literatur in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, die in pro und contra dies künftige Ereignis (eine neue Sintflut) diskutiert. Besorgte Hausväter greifen zu Vorsichtsmaßnahmen – der Bürgermeister zu Wittenberg soll sich auf dem Dachboden seines Hauses eingerichtet haben, und auch ein Faß Bier mit heraufschaffen lassen …“ (so H.D. Kittsteiner, der sich dabei auf K.M. Kobers „theatrum mundi, Anmerkungen zu Werner Tübkes 1:10- Fassung ‚Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ beruft).
.

.
Mir fällt dazu ein Aktivist aus der Anfangszeit der sogenannten 68er- Studentenbewegung ein, der damals – im starken Glauben, die Kämpfe würden zunehmen und die Versorgungslage dadurch prekär werden – überall in den Wäldern der Umgebung Bremens Rotwein-Depots anlegte. Als das Gegenteil eintrat, wurde dieser bewunderungswürdige Mensch in die Psychiatrische Anstalt eingeliefert, wo er vor einiger Zeit Selbstmord beging.
.
Auch zu Tübkes bzw. Müntzers „Regenbogen“ fiele mir noch eine Geschichte (aus dem sogenannten „Deutschen Herbst“, 1977/78 und dem darauffolgenden „Tunix-Kongreß“) ein, aber ich will es genug sein lassen, schon um nicht in die Nähe peinigender Pathetik – etwa der des Blochschen Müntzer-Entwurfs – zu geraten.
.
Auch die im Herbst 1989 mit einem Staatsakt eingeweihte „Apologie einer sozialistischen Erbetheorie“ in Frankenhausen wurde – jedenfalls im Ort und seiner Umgebung – als durchaus peinigend empfunden, zumindest die Kosten dafür (fast 40 Millionen Mark). Der als „abgebrochene Säule“ bezeichnete Rundbau auf dem Berg, dessen Betrieb ein 64köpfiges Kollektiv aufrechterhält, wird unten in Frankenhausen respektlos „Faultier-Ranch“ bzw. „Elefanten-Klo“ genannt.
.
Hierzu sollte man vielleicht wissen, dass es in der mittelhessischen Einkaufsmetropole Gießen eine – inzwischen leider pleite gegangene – linke Stadtzeitung gab, die „E-Klo“ hieß, in Anlehnung an eine im Volksmund „Elefanten-Klo“ genannte Fußgängerbrücke, die, völlig überdimensioniert, bei ihrer Errichtung in den sechziger Jahren den ganzen Stolz der (sozialdemokratischen) Stadtväter darstellte.
.
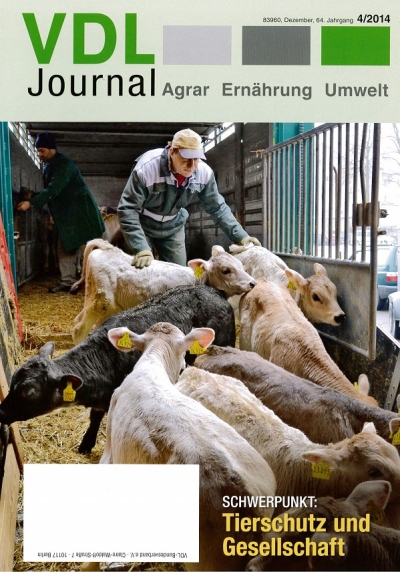
.
Stolz ist man auch oben auf dem Frankenhäuser Schlachtberg: „Sehen und erleben Sie das größte Denkmal der Welt!“ heißt es z.B. schon auf dem Titelblatt eines Prospekts.
.
Quasi zu Füßen des Panoramas befindet sich eine LPG namens „Thomas Müntzer“ (Tier- und Pflanzenproduktion). Und auf dem Rückweg nach Berlin entdeckten wir in einem kleinen Ort des Bezirks Halle ein LPG-Kulturhaus mit dem Namen „Florian Geyer“; in Wittenberg hat man ihn mit einer kleinen Tafel am Schloß geehrt. Ich erwähne dies nur aus einem gewissen Hang zur Ründe heraus – was aber ja im Kontext einer Panorama-Besprechung sicher nicht unbillig ist …
.
Kommt noch hinzu, dass das Objekt sozusagen den krönenden Abschluß der – wie immer auch hinterfragwürdigen – kollektiven Anstrengung der DDR zur „Aufarbeitung des Bauernkriegs“ bildet, und – fast zeitgleich mit seiner Eröffnung – die Bauern dieses Landes anfingen, sich für ihre Interessen auf der Straßen „zusammenzurotten“. Über kurz oder lang mag die eine oder andere ihrer Versammlungen gar auf die Seminar-Räume des Museums reflektieren. Warum durch „Umpositionierung“ den Weg dahin erschweren, wo es doch neben einer „Vergangenheitsbewältigung“ auch und gerade darum geht, „das Erbe lebendig zu erhalten“? Besteht nicht eines der großen Probleme der DDR- Landwirte momentan und ausgerechnet aus einem (wachsenden) „Schlachtberg“ – nach Jahrzehnten, in denen sie nie genug produzieren konnten …? Was nicht bewältigt ist, kehrt ewig wieder – mehr wollte ich eigentlich nicht sagen.
.
Ergänzend sei jetzt – nach dem Millenniumswechsel – aber noch hinzugefügt: Die LPG „Thomas Müntzer“ gibt es nicht mehr, auch die LPG „Florian Geyer“ nahebei und das Kalibergwerk „Thomas Müntzer“ in Bischofferode sind mittlerweile verschwunden. Sogar die vielen, erst nach der Wende dort in der ganzen Umgebung aufgetauchten China-Restaurants sind schon wieder weg. Dafür stößt man nun zwischen Harz, Kyffhäuser-Gebirge und Magdeburger Börde überall auf griechische Landgaststätten. Ist das nicht merkwürdig? Und mangels Konkurrenz wird deren Küche auch gut angenommen – von den busweise aus ganz Deutschland anreisenden Bauernkriegs-Panorama-Besuchern. Das „größte Gemälde der Welt“ entfaltet eine immer größer werdende Anziehungskraft!
.
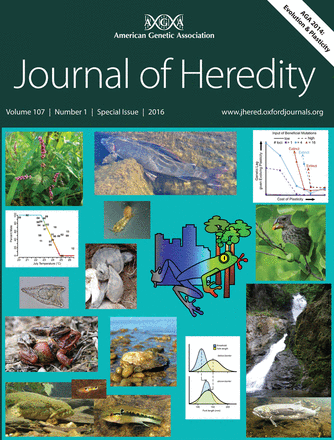
.
Der Schweizer Historiker Peter Blickle meint am Schluß seines Buches über den Bauernkrieg, daß damit der Aufstand von 1525 nun zu den „Daten“ gehört, über die man sich in Deutschland seiner Identität versichert. „Und das wird auch so bleiben, solange Frankenhausen seine Ausstrahlung behält, und sie wächst von Besuch zu Besuch. Selbst die wildesten Bilderstürmer haben Frankenhausen nicht in die Debatte um den Palast der Republik in Berlin mit einbezogen. Das liegt vermutlich weniger daran, daß in Frankenhausen nicht Asbest am Bau verwendet wurde, sondern ‚Utopien‘, die ‚jede Bedingung eines Auftrags unterlaufen'“. Zwar sei uns die ebenfalls gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848 viel näher, aber „als Kunstwerk kann es die Paulskirche in Frankfurt mit dem Schlachtberg in Frankenhausen nicht aufnehmen. So setzt die Kunst listig und subversiv ihre Maßstäbe für eine historische Gerechtigkeit“. Das Kolossalgemälde überlistete sogar seinen Meister (Tübke) selbst, indem es nicht ihn und sein Gesamtwerk museal krönt, sondern trotz „Umpositionierung“ weiterhin des Bauernkriegs von 1525 gedenkt.
.
Darüber haben sich auch die Gemüter des gemeinen Volkes zu Füßen des sündhaft teuren Denkmals beruhigt, denn ohne es würden einfach nicht so viel Touristen mehr nach Frankenhausen kommen. „Das ist ja richtig glamourus,“ murmelte die amerikanische Historikerin Anjana Shrivastava nach dem Besuch des Bauernkriegsdenkmals – fast überrumpelt. Von außen sieht man das dem Rundbau auf dem Schlachtberg nämlich nicht an. Hier gilt noch: mehr Sein als Schein.
.
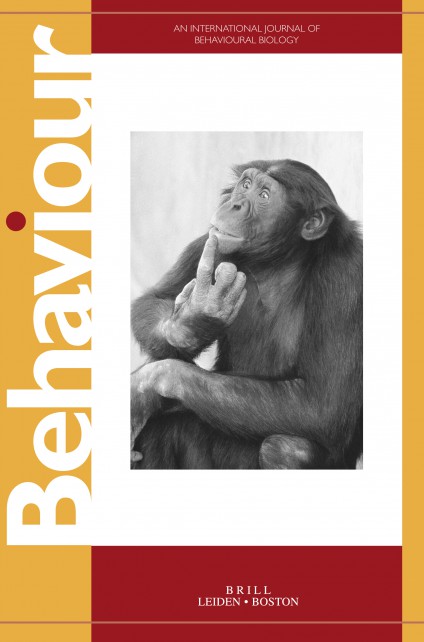
.

.
„Das Tier ist witzig geworden“, damit ist nicht nur gemeint, dass heute vom Bauern nicht mehr viel zu erwarten ist, sondern dass man erst bei einer Konzentration auf das individuelle Tier merkt, wieviel „Witz“ es hat – u.a. ebenfalls bei den Versuchen, seine Unfreiheit zu überwinden.
.
Freilebende Orang-Utans gebrauchen nur wenige Werkzeuge (Termiten graben sie z.B. mit den Händen aus), in Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen zu wahren Ausbrecherkönigen. Der „National Geographic“-Autor Eugene Linden hat in seiner Anekdotensammlung „Tierisch Klug“ (2001), die wesentlich auf Berichten von Zootierpflegern beruht, etliche Geschichten darüber veröffentlicht. „In der Zoowelt sind die Orang-Utans für ihre Fluchtversuche berühmt,“ schreibt er. Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er das selbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. „Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen“ – so lange, bis er es geöffnet hatte. Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben.
.
Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans vor der ungewohnten Umgebung. „Auf einer gewissen Eben wissen die meisten gefangenen Tiere, dass der Zoo der Ort ist, in dem sie leben.“Von zwei Mitarbeitern am Projekt „Think Tank“ zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Orang-Utans im Nationalzoo in Washington erfuhr Eugene Linden von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, die Orang-Utans dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus – und wieder reingegangen. Einer der „Think Tank“-Mitarbeiter meinte zu Eugene Linden: „Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gebe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen.“ Linden fügte hinzu: „Und so sind die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“
.
Der Berliner Arbeitskreis für Human-Animal-Studies hat gerade ein neues Buch veröffentlicht: „Das Handeln der Tiere“. Die Autoren loten darin deren Widerstandspotential aus. Im Vorwort erwähnen die Herausgeber bereits einige Anekdoten über Tiere, die sich etwas einfallen ließen, z.B. die von einer Schimpansin, die eine Zeichensprache lernte und diese nutzte, um damit Bitten an eine Wissenschaftlerin zu richten, oder die über eine Kuh, „die aus einem Schlachthof ausbrach und sich ihren Weg durch eine Großstadt bahnte“. Die Herausgeber fügen jedoch hinzu: „Die Geschichten über die freiheitsliebenden und gewitzt handelnden Tiere scheinen die Ausnahme zu bilden, die die Regel bestätigen, wonach ‚das Tier‘ das Gegenbild ‚des Menschen‘ darstellt.“ Wenn man jedoch sensibilisiert genug ist, erlebt man mit Tieren, selbst mit Goldhamstern und Balkonkaninchen, laufend solche „Ausnahmesituationen“, die freilich nicht so spektakulär sind, aber dennoch oder erst recht sogar das „Gegenbild ‚des Menschen“ nach und nach zersetzen, indem sie sich als die interessanteren „Menschen“ erweisen. Sind nicht eigentlich alle Biologen, mindestens die Verhaltensforscher, Menschenfeinde, denen der Schutz „ihrer“ Tiere oder Tierart das Wichtigste ist? Als Aushilfstierpfleger im Bremer Zoo hatte ich den Eindruck: Je engagierter und besser ein Tierpfleger war, desto unbefriedigender fand er den Umgang mit Menschen.
.

.
Gegenbeispiele
.
Angesichts der zunehmenden Aggressionen, die sich nationalistisch artikulieren, suchen die Aufklärer vermehrt nach Gegenbeispielen. Hier lebt ein Dorf „harmonisch“ mit einer größeren Gruppe Flüchtlingen zusammen, dort hat ein Ehepaar eine kenianische Kleinfamilie aufgenommen…Mit der mehr oder weniger verzweifelten Suche nach einem friedlichem Miteinander von Menschen verschiedener Nationen oder Religionen geraten den Wissenschaftlern und Journalisten noch ganz andere Inseln der Seligkeit in den Blick, wobei sich ihnen langsam der Unterschied zwischen Soziotop und Biotop verwischt.
.
So fanden z.B. Biologen aus Indien und Norwegen bei Bombay ein Dorf, in dessen Umland mehr als ein Dutzend Leoparden leben – und das sollen sie auch weiterhin. Manchmal reißen die Raubtiere einen Hund, eine Hauskatze oder eine Ziege. Sie werden von den Dörflern aber auch gefüttert, indem sie dem Gott der großen Katzen, Waghoba, ein Fleischopfer auf den Schrein legen. Für getötete Ziegen zahlt der Staat ihnen eine Entschädigung. Das Forschungsteam hat dieses seltsame fast konfliktfreie Zusammenleben über Jahre erforscht – und darüber eine schöne Broschüre veröffentlicht: die „Waghoba Tales“. Das Dorf hat Beispielcharakter, denn die anderswo eingefangenen und in unbesiedelten Gebieten oder Schutzparks freigelassenen Leoparden waren bisher alle wieder – nur noch aggressiver – in ihre ursprüngliche Reviere zurückgekehrt. Eine solche „interspecies tolerance“ eröffnet die Möglichkeit einer „interspecies communication“, die es auch zwischen Tieren unterschiedlicher Arten gibt.
.

.
Hierzulande begann dies spektakulär ebenfalls mit einem „Einzelfall“: mit der Geschichte des jungen Wildschweins Freddy, das sich bei Göttingen auf einer Weide einer Kuhherde angeschlossen hatte, von einer Kuh gesäugt wurde und sich ansonsten wie alle dort von Gras ernährte. Die Illustrierte „stern“ berichtete wenig später, dass „Freddy“ schon muhen kann, und der Spiegel, dass er auf „Friederike“ umgetauft wurde.
.
Egal, das Muhen brachte ihr und uns einen Erkenntnisfortschritt: Es beweist, wie recht der Biologe Adolf Portmann einst mit seiner Bemerkung hatte, dass jeder soziale Verband auch einschränkend auf die Fähigkeiten seiner Mitglieder wirkt: In der Wildschweinrotte seiner Mutter hätte der Kleine nie muhen gelernt.
.

.
Portmanns Bemerkung bezog sich auf den englischen Spatzen “Clarence”, der von einer Musikerin und Hobbyornithologin namens Clare Kipps aufgezogen wurde und zwölf Jahre bei ihr lebte. In dieser Zeit lernte er, von der Autorin am Klavier begleitet, singen. Sie veröffentlichte 1953 ein Buch über “Clarence”, zu dessen deutscher Ausgabe Adolf Portmann ein Nachwort beisteuerte. Für den Basler Biologen ist der Spatz ein Beispiel dafür, “wie wenig ‘frei’ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt…Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.” In anderen Worten: Unter Spatzen hätte er nie singen gelernt. Er wäre sozusagen blöd geblieben.
.
Auf youtube findet man dutzendweise weitere Beispiele von “interspecies communication”, wenn auch keine, die sich über 12 Jahre erstreckte. Die feministische US-Biologin Donna Haraway hat dazu ein ganzes Manifest veröffentlicht, einlösen will sie diese Kommunikation mit ihrer Hündin Cayenne – ebenfalls in einem Zeitraum von etwa 12 Jahren.
.

.

.

.

.
Friederikes Beispiel machte schnell Schule: Schon bald kam ein weiteres Wildschwein im Landkreis Göttingen bei einer Kuhherde unter, ein Frischling, den der Bauer Johann taufte. Der Presse erzählte er: Die Kühe hätten sich um Johann gekümmert, als sei er ihr eigenes Kalb. Das kleine Wildschwein wurde sauber geleckt und durfte sich ankuscheln. Die Boulevardblätter sprachen daraufhin von einer „ungewöhnlichen Willkommenskultur auf der Weide“ für einen Gast mit „Migrationshintergrund“. Aus Schleswig-Holstein kam die Nachricht, dass dort ebenfalls ein Wildschwein bei einer Rinderherde ein neues „Zuhause“ gefunden hätte, es werde „Banana“ genannt. Die Süddeutsche Zeitung titelte: „‚Muhltikuhlti‘: Das rätselhafte Phänomen der Tieradoption greift um sich.“ Damit meinte der Autor nicht nur die von Kühen. Inzwischen hatten sich auch Adoptionen zwischen anderen Arten herumgesprochen: Im Wladiwostoker Zoo war ein Amurtiger ein freundschaftliches Verhältnis zu einem Ziegenbock eingegangen, den er eigentlich fressen sollte. Und in Kenia adoptierte eine Löwin immer wieder junge Antilopen, die jedoch früher oder später von ihren Artgenossen gefressen wurden… „Insgesamt sind mehr als 120 Säugetier- und 150 Vogelarten bekannt, die entfernten Arten mindestens so nahe kommen wie einst das junge Nilpferd ,Mzee‘ der 130 Jahre alten Schildkröte ,Owen‘ im Zoo von Mombasa“ – deren Freundschaft 2005 alle Tierschützer überrascht und für internationale Schlagzeilen gesorgt hatte.
.
Im Internet findet man unter dem Stichwort „Tierfreundschaften“ inzwischen über 100.000 Einträge. 47 Geschichten über ungewöhnliche Tierfreundschaften versammelte die National Geographic -Autorin Jennifer Holland in ihrem Buch „Ungleiche Freunde“. Weil es so erfolgreich war, folgte ein weiteres zum selben Thema: „Unbändige Liebe“. Der Süddeutschen Zeitung erklärte sie: „Die Zeiten sind hart genug, die Leute lechzen danach, etwas zu lesen, was sie aufbaut.“ Und das besteht aus „Geschichten von Affen, die junge Katzen bemuttern und von einem Hamster, der auf einer zusammengerollten Schlange kauert“ usw.. Sicher ist – merkt die wissenschaftlich geschulte SZ an: „Die Tiere verhalten sich auf eine Weise, dass man, wären sie menschlich, sagen würde, sie empfinden Freundschaft füreinander.“
.

.
Einige Beispiele, die mit Photos dokumentiert und von der Online-Journalistin Laura Hafner erwähnt werden:
.
– Die Katze Libby und der Hund Cashew lebten viele Jahre unter Akzeptanz, aber ohne jegliche Berührung, zusammen. Als der Hund Cashew mit 12 Jahren anfing sein Augenlicht zu verlieren, fing die Katze an, sich um ihn zu „kümmern“. Als Cashew schließlich vollständig erblindete, wich Libby nicht mehr von seiner Seite. Sie begleitete ihn zum Fressen und führte ihn herum. Die Katze ist zum Blindenführer für den Hund geworden. Mit 15 Jahren starb der Hund, Libby suchte jeden Tag vergeblich, miauend die Plätze auf, an denen sie mit ihrem Freund Zeit verbrachte. Libby konnte sich für keinen anderen Hund mehr begeistern.
.
– In einem Safari Reservat in Amerika wurden ein Elefant und ein Labradorhund, nach der Rettung vor Elfenbeinjägern, zu besten Freunden und weichen sich bis heute nicht mehr von der Seite.
.
– Die Giraffe Bea und der Strauß Wilma sind unzertrennlich. Die Bekanntschaft erfolgte in einem Vergnügungspark in den USA. Die unzertrennlichen Freundinnen leben in einem Gehege zusammen.
.
– In einem anderen Tierpark leben zwei Tiger und ein Braunbär seit über drei Jahren freundschaftlich zusammen, was sich darin zeigt, dass sie ständig miteinander schmusen.
.
.
Wie mißt man „Freundschaft“ – z.B. bei gefangen gehaltenen gleichgeschlechtlichen Dohlen. Das war das Problem, vor dem die Bielefelder Verhaltensforscherin Anke Adrian 2014 bei ihrer Doktorarbeit stand, wobei sie zu dem Ergebnis kam, dass wenigstens die von ihr beobachteten Dohlen unfähig zur Freundschaft waren. (Siehe: http://blogs.taz.de/hausmeisterblog/2016/01/03/aus-der-natur-herauskommen/)
.

.
Die ebenfalls im Internet zu findende Masterarbeit der Hamburger Biologin Sandra Katarzyna Lekarczyk befaßte sich 2014 mit einem ähnlichen Beziehungs-Problem bei heterosexuellen Kolkrabenpaaren, die sie in verschiedenen deutschen und österreichischen Zoos beobachtete. In der Zusammenfassung ihrer Forschungsarbeit heißt es:
.
Die bisherigen Studien hätten den Fokus auf Beziehungen zwischen Mitgliedern sozialer Gruppen gelegt, während die Qualität der Bindungen von in Paaren lebenden Arten nicht untersucht wurde. „Die vorliegende Studie soll diese Wissenslücke schließen, indem die Qualität der Paarbindung in einer dauerhaft monogam lebenden Rabenvogelart, dem Kolkraben (Corvus corax), untersucht wird.“ Während hier die „Qualität“ einer Beziehung definiert und in meß- und zählbare Merkmale gewissermaßen „verifiziert“ wurde, war es bei Anke Adrian die „Freundschaft“
.
In der Zusammenfassung von Sandra Katarzyna Lekarczyk heißt es weiter: „Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Kolkraben in ihrer Kommunikation Gesten benutzen, die möglicherweise dazu dienen, eine bereits bestehende Paarbindung zu testen und/oder zu stärken. Auf diesem Fund basierend befasste sich die zweite Forschungsfrage damit, ob die Qualität der Paarbindung den kommunikativen Austausch innerhalb von Rabenpaaren beeinflusst. In Bezug auf die erste Forschungsfrage ermöglichten Unterschiede in den Frequenzen und Dauern spezifischer sozialer Interaktionen die Einteilung der Rabenpaare in harmonische oder unharmonische Einheiten. Diese zwei Gruppen wurden daraufhin in Bezug auf die Nutzung kommunikativer Signale verglichen. Nichtsdestotrotz konnte in der vorliegenden Studie kein signifikanter Effekt von der Qualität der Paarbindung auf den kommunikativen Austausch festgestellt werden. Eine Ausnahme stellten zwei von 24 untersuchten Signaltypen dar, wo ein signifikanter Effekt der Parabindungsqualität auf die Dauer pro Auftreten eines Signals bzw. auf den kommunikativen Erfolg gefunden wurde. Da die Nutzung von Gesten bei Raben noch nie zuvor im Detail untersucht worden ist, liefert die vorliegende Studie als erste systematische Informationen zur Beziehung zwischen der Stärke der Paarbindung und der gestischen Kommunikation.
.
Beide Verhaltensforscherinnen haben sich, so scheint es mir, von ihren Professoren und ihrer zukünftigen Profession zu sehr wissenschaftlich kujonieren lassen…Aber „wenns der Wahrheitsfindung dient…“ wie Fritz Teufel einmal als Angeklagter sagte, als er vor Gericht aufstehen mußte.
.

.
Nicht nur mit der „Qualität der Paarbindung“, auch mit der „gestischen Kommunikation“ bei Vögeln ist es so eine Sache: 2007 implantierte der Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im oberösterreichischen Grünau, Kurt Kotrschal 25 Graugänsen zwei Jahre lang Sonden, die ihren Herzschlag registrierten. Dabei kam heraus, dass dieser schon dann extrem in die Höhe schnellte, wenn die Tiere „soziale Kontakte zwischen ihren Artgenossen“ nur beobachteten. Kotrschal folgerte daraus: „Gänse sind sozial viel komplexer organisiert als bisher angenommen“ – und somit dem Mensch „verdammt ähnlich“.
.
Einige österreichische Tierschützer waren über sein Implantations-Experiment derart erbost, dass sie das Institut kurzzeitig besetzten. Sie wurden danach angeklagt. Bei der juristischen Klärung vorab, ob der Gänseforscher oder die Gänseschützer ein Verbrechen begangen hatten, ergab jedoch die Abwägung der Tatbestände Tierquälerei versus Hausfriedensbruch, dass das Verfahren gegen sie eingestellt wurde.
.
Die Messung der Erregungszustände bei den Gänsen im scheinbaren Ruhezustand bewirkte einen Erkenntnisfortschritt. Der Gänse-, Dohlen- und Kolkrabenforscher Konrad Lorenz hatte noch 1949 in seinem Buch „Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen“ angenommen, dass die zehn Graugänse, mit denen er fast täglich in die Donau-Auen ging, einfach nur „wunderbar faul“ waren, was ihn zu der grundsätzlichen Bemerkung über sein Fach, die Verhaltensforschung, veranlaßte: „Will man Wildgänse kennenlernen, muß man mit ihnen leben, und will man mit ihnen leben, muß man sich ihrem Lebenstempo anpassen. Ein Mensch, der nicht [so wie ich] von Natur aus mit einer gottgewollten Faulheit ausgestattet ist, kann das gar nicht.“
.

.
Die Lorenzsche „Faulheit“, wiewohl zu vorschnell von ihm auf das Verhalten von Gänse übertragen, wünscht man trotzdem vielen seiner Nachfolger, besonders unter den Rabenvögel-Forschern, die dazu jede Menge High-Tech auffahren und sogar ihr Leben (auf allzu hohen und schwankenden Bäumen) riskieren, um an (robuste) „Daten“ zu kommen.
.
Der kurzzeitige US-Pavianforscher Robert Sapolsky veröffentlichte 2001 seine Forschungsergebnisse unter dem Titel „Mein Leben als Pavian“. Er beobachtete die Tiere jedoch kaum, er saß vielmehr abseits von ihnen in der Savanne – lauernd, um einzelne Männchen per Fernschuß zu betäuben und ihnen Blut abzunehmen, das dann auf Testosteron untersucht wurde; diese „objektiven“ Werte verglich er dann mit dem Rang des betreffenden Männchens, so wie er diesen oberflächlich einschätzte.
Anders die Pavianforscherin Barbara Smuts: Sie schrieb über „ihre“ Tiere (in „Sex and Friendship in Baboons“ – 1985): „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie mußte zuvörderst die Paviankommunikation wenigstens annähernd beherrschen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen.“ Dabei interessierte die Forscherin jedoch nicht mehr die Frage ihres Doktorvaters: „Sind Paviane soziale Wesen?“, sondern sie fragte sich selbst: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ Als sie das schließlich im Hinblick auf „ihre“ 123köpfige Affenhorde einigermaßen positiv beantworten konnte – und ihre Forschung dementsprechend voranschritt, kam sie zu dem Schluß, dass die nicht-sprachliche Kommunikation, bei der sich die Beteiligten über Blicke und Gesten „eng austauschen“, der sprachlichen Verständigung in puncto Ehrlichkeit und Wahrheit überlegen ist.
.
Demnach scheint in der Kommunikation/beim Kontakt eine auf die Beteiligten unmittelbar bezogene Reziprozität der Gesten und Laute gegenüber dem Austausch von Äquivalenten, auf die unsere Warensprache abhebt, stabilere Kollektive/Gemeinschaften zu schaffen. Kann man sagen: der Affe favorisiert soziale Erfindungen, der moderne Mensch dagegen technische? Schon der Kieler Meeresbiologe Adolf Remane begann sein 1960 veröffentlichtes Buch über den Stand der Soziobiologie mit dem Eingeständnis, dass „das soziale Zusammenleben den Menschen große Schwierigkeiten bereitet“. Dies war schon dem „ersten Naturwissenschaftler“ Aristoteles aufgefallen. Als Beweis hatte er u. a. die vielen „Reisegruppen“ erwähnt, in der man sich wegen jeder Kleinigkeit streitet.
.

.
Karens Tierleben
.
Bei der Tierliebhaberin Karen Duve hatte ich den Eindruck, das ihr das „soziale Zusammenleben mit Menschen“ mindestens lästig ist. Etwa so wie der finnischen Ethnologin und Vogelbeobachterin Ulla-Lena Lundberg. In ihrem Buch „Sibirien: Selbstporträt mit Flügeln“ (2003) schreibt sie: „Seit den Tagen Darwins ist es in Mode, bei der Interpretation tierischen Verhaltens Nützlichkeitsaspekte zu beachten. Weil das fragliche Tier sich so und so verhält und bis heute überlebt hat, muß sein Verhalten für seine Art die zweckdienlichste sein. Von daher regt es die Phantasie so an, gerade Arten zu studieren, die nicht sonderlich erfolgreich sind; jedenfalls wenn man sie an ihrer Zahl mißt.“ Für Ulla-Lena Lundberg kommt aber noch etwas hinzu: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“
.
Das erste, was ich von Karen Duve las war der Roman „Taxi“. Sie hatte zuvor die Studien aller feministischen Affenforscherinnen – von den „Trimates“ Goodall, Fosey, Galdikas bis zu der „Troika“ Haraway, Strum, Fedigan – gelesen und war dann in Hamburg Taxifahrerin geworden. In allen ihren Fahrgästen erkannte sie dann Schimpansen-, Bonobo-, Gorilla- oder Orang-Utan-Verhalten. Zuletzt konnte sie jedoch in ihrem Roman nicht auf einen echten Schimpansen als Fahrgast verzichten, mit dem sie dann auch prompt einen (fiktiven) Unfall erlitt.
.
Auch das nächste Buch, das ich von Karen Duve wahrnahm, basierte auf Erfahrung: Es handelte davon, wie ihr über die Beschäftigung mit dem Elend der industriellen Nutztierhaltung jeder „Hackbraten zu Quälfleisch“ wurde. Sie ging dabei so weit, dass sie nächtens an einer Tierbefreiungsaktion teilnahm, wobei sie ein kahles Huhn aus einem vorgeblichen Biohof rettete, um ihm auf ihrem Hof in Brandenburg ein schöneres Leben zu bieten. Sie unterzog sich daneben einem Selbstversuch – indem sie sich jeweils einige Monate lang biologisch, vegetarisch, vegan und frutarisch ernährte (für die Frutarier ist sogar das Ausreißen einer noch lebenden Mohrrübe Mord). Ihr Buch „Anständig Essen“ wurde in vielen Zeitungen besprochen, meist zusammen mit einem Photo, dass die Autorin mit ihrem geretteten Huhn „Rudi“ zeigte. Nach einer Lesungstour meldeten sich zig Tier- und Naturschutz-Organisationen bei ihr.
.
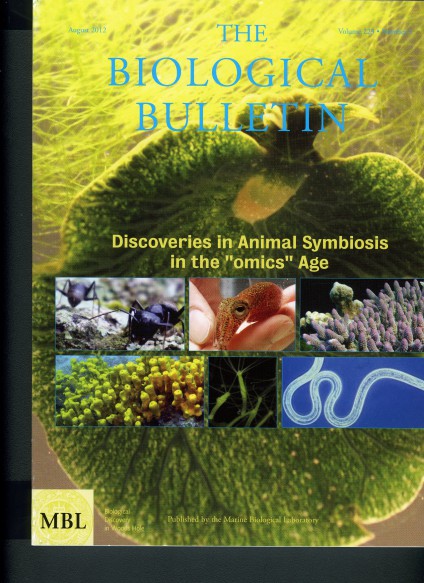
.
Karen Duves „Lexikon der berühmten Tiere“ erwarb ich als Nachschlagewerk. Das nächste, was ich von ihr las, war ein Endzeit-Essay „Warum die Sache schiefgeht“, der im vergangenen Jahr erschien. Da ich ebenfalls von der Vergeblichkeit aller Bemühungen zur wesentlichen Verbesserung der Zustände ausgehe und mich außerdem für das Leben und Sterben von Kühen interessiere, gefiel mir an ihrer pessimistischen Weltsicht, dass sie zuletzt nur noch daraus Hoffnung schöpfte, dass nach dem Untergang der Menschheit eine andere Spezies hochkomme: „Großäugige, intelligente Weidetiere. Es kann doch eigentlich nur besser werden.“
.
Zuvor hatte ich bei dem amerikanischen Kuhforscher Robert W. Hegner Ähnliches gelesen: Er hatte die Wiederkäuer schon vor dem Siegeszug des Neoliberalismus an die Spitze der evolutionären Säugetier-Entwicklung gesetzt, weil deren Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.
.
Im Antiquariat fand ich schließlich noch einen Band mit Erzählungen aus ihrer Hamburger Sinnfindungs-Zeit: „Keine Ahnung“, darin ein Gespräch mit einem Hund. Bereits als Teenager hatte sie sich einen Hund – aus dem Tierheim – angeschafft. Mit dem war sie dann bis nach Göttingen geflüchtet, weil sie den Berufswunsch, den die Eltern ihr einpflanzen wollten, nicht erfüllte.
.
Als wir uns trafen, fragte ich sie als erstes, ob sie noch heute Tiere besitze. „Fast hundert,“ sagte sie daraufhin, „wenn man die Goldfische im Teich mitzählt.“ Allerdings habe sie keine Hühner mehr, auch Rudi sei inzwischen gestorben. Im Boden hätten sich Hühner-Tuberkulose-Keime befunden, deswegen könnte sie sich auch keine neuen anschaffen.
.

.
Ihren weiteren Tiergeschichten entnahm ich, dass sie aus ihrem Hof schon fast ein Tierasyl gemacht hat, nicht einmal vor Großvieheinheiten (GV) schreckt sie zurück, deren Haltung und ärztliche Versorgung u.U. ein Vermögen kostet: „Zum Glück sind die Tierärzte im Osten nicht ganz so teuer,“ meinte sie. Immerhin leistete sie sich für einen ihrer zwei alten Bulldoggen eine Computertomographie, wobei festgestellt wurde, dass der Hund eine Wasserblase im Gehirn hat: „Der ist praktisch debil, Pflegestufe 2 würde ich sagen.“ Bulldoggen seien sowieso „Qualzüchtungen: bis zur Absurdität auf Kindchenschema gezüchtet.“ Sie seien dafür aber auch sehr lieb und die herausgezüchtete Augenstellung nach vorne, wie bei Menschen, ermögliche ihnen eine gewisse Klugheit beim emotionalen Begreifen. Als Beispiel erzählte sie jedoch keine Geschichte von ihren zwei Hunden, sondern von einer Bulldogge, die richtig surfen konnte, gesehen hatte sie das in einem Videoclip. An Hundeliteratur erwähnte sie die Bücher von Eberhard Trumler und Horst Stern. Beide waren davon überzeugt, Hunde gehören nach draußen: „Selbst ein Zwinger sei besser als eine Wohnung.“ Das fand Karen Duve nicht: „Man muß sich doch artenübergreifend entgegenkommen.“
.
Sie argumentierte hier wie die Berliner Schriftstellerin Katharina Rutschky in ihrem Buch „Der Stadthund“, während die beiden erwähnten Hundeforscher ähnlich dachten wie die amerikanische Ethnologin Elizabeth Marshall Thomas, die ihre Hunde laufen ließ und ihnen bloß unauffällig – wissenschaftlich – folgte. Dabei kam sie zwangsläufig zu dem Schluß: „Wie wir alle wissen sind Menschen für Hunde bloß ein hundeähnlicher, schwacher Ersatz“. Demgegenüber schrieb Katharina Rutschky: „Wer sagt denn eigentlich, dass der Hund sich auf einer Party langweilt, und nicht vielmehr evolutioniert? Hunde auf dem Lande, ja schon solche mit eigenem Haus und großem Garten können wenig am Prozeß der Zivilisation mitwirken, weil sie dort, entgegen ihrer Neigung, als Naturwesen gehalten werden und darüber leicht vertrotteln.“ Der Biologe Cord Riechelmann hält umgekehrt die Haushunde mit Familienanschluß für „völlig verblödet“.
.
Karen Duve hat trotz einer Katzenallergie auch noch zwei Kater, die sie mit dem Hof übernahm. Sie waren meist draußen, aber nun – im Alter – wissen sie das Haus mehr und mehr zu schätzen. Im Stall stehen außerdem zwei Pferde: „Turina“, ein kleines Pferd, das jeden Tag geritten werden muß, und Apollo, über den ich nichts Näheres weiß. Von ihrem kleinen Maulesel, den sie auch noch hat, weiß ich nicht einmal den Namen. Vor einiger Zeit erwarb Karen Duve auf Rügen noch ein drittes Pferd – mit Stoffwechselstörung: Djego. Es hatte sich auf der Weide mit einer alten Kuh angefreundet, die sie gleich mit kaufte: „Ich habe sie vorm Schlachter gerettet.“ Die Kuh ist alt und muß nicht mehr gemolken werden, macht aber trotzdem viel Arbeit, weil Djego sich von ihr ab- und den anderen Pferden zugewendet hat, so dass sie sich nun einsam fühlt und deswegen immer mit in die Pferdeboxen will.
.
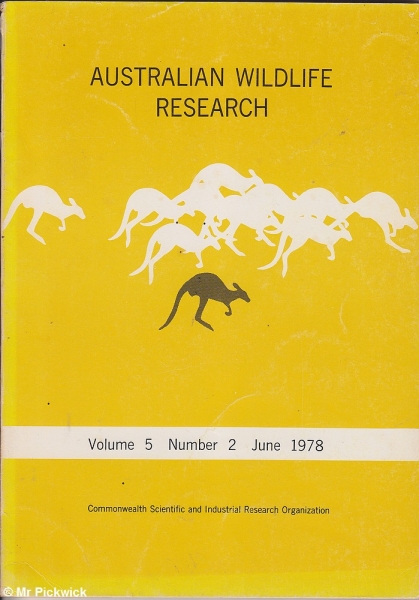
.
Karen Duve hatte vor einiger Zeit eine Talkshow gesehen, in der jemand erzählte, dass er seinem Hund eine neue Niere gespendet habe, was einen anderen Studiogast furchtbar aufgeregt hatte: „Er hat sich so geärgert, weil der Mensch für ihn eine Sonderstellung hat. Religiöse Menschen wollen Tiere nicht auf Augenhöhe haben.“
.
Von da aus kam sie auf ihren demnächst erscheinenden Roman „Macht“ zu sprechen. Es gibt darin wieder eine Selbsterfahrung: Sie begleitete die „Animal Angels“ in die spanische Exklave Melilla in Marokko, wo zum mohammedanischen Opferfest jedes Jahr 2000 Schafe geschächtet werden. Die Veganer gehen dort hin, um kleine Verbesserungen des brutalen Rituals zu erreichen: „Sie sind sehr pragmatisch“. U.a. gehen sie an den Strand und zünden Kerzen an: „Ich fand das peinlich und blieb weg, überhaupt bin ich kein konsequenter Vegetarier. Das blutige Opferfest geht ja auf Abraham zurück, dem der monotheistische Gott befahl, ihm statt Menschen Schafe zu schlachten.“
.
Mir fielen dazu die Friesen ein, die bei der Schließung eines neuen Deichs ein Schaf in die letzte Lücke versenkten. Ein heidnischer Brauch, während Fürst Pückler es beim Anlegen seines berühmtem Parks wissenschaftlich begründete, dass frisch getötete Schafe den Wurzelballen der verpflanzten Bäume beigegeben wurden. Man kann Schafe aus den unterschiedlichsten Gründen töten. Karen Duve hat aber keine Schafe: „Da verwechselt du mich mit Hilal Sezgin:“ Eine konsequente Tierschützerin und Schriftstellerin, die auf ihrem Hof in der Lüneburger Heide eine ganze Schafherde hat. Leider erfährt man in ihren Büchern nur wenig über diese Tiere.
.
Karen Duve kam noch einmal auf das marokkanische Opferfest und die Veganer zu sprechen, die sie etwas distanziert bewundert: „Der Leiter von den ‚Animal Angels‘ litt derart mit den Tieren, dass es ihm immer schlechter ging. Das Reinversetzen ins Tier können die nicht wählen, im Gegensatz zu mir. Sie fahren aber jedes Jahr dort hin: Einer muß dabei sein, um hinzuschauen. Viele Veganer, die auch Tiere haben, betreiben schon fast Selbstausbeutung. Sie bewegen sich ethisch und moralisch auf einem anderen Niveau – sind mitfühlender, auch Menschen gegenüber.“ Da Karen Duve wegen einer Honorarverhandlung das Interview abbrechen mußte, meinte sie zum Schluß nur noch – lächelnd: „Wenn ich die Tiere alle los wäre, würde ich mit meinen Einnahmen hinkommen.“
.

.
Das macht Sinn
.
Bei den Rabenforschern las ich mehrmals: Dieser oder jener Vogel agierte logisch, bewies Logik. Was (vor allem im Amerikanischen und Amerikanisierten) ein anderes Wort für besonders sinnvolles Verhalten ist. „Die klassische Logik versteht sich selbst als Wissenschaft von den Gesetzen des menschlichen Denkens, die vom Logiker nicht konstruiert, sondern im menschlichen Denkvermögen angelegt sind“, schreibt der marxistische Erkenntnistheoretiker Rudolf Müller (in: „Geld und Geist“ 1977). Die Logik ist, mindestens seit Aristoteles, das Prinzip der Identität (A gleich A). Sie war zunächst wesentlich „Ontologik“, insofern das Sein durch sie begriffen wurde. Für Kant gehörte diese Abstraktion zum Apriori unserer Wahrnehmung. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat – als Inhaber des Königsberger Kant-Lehrstuhls ab 1941 – versucht, die Apriori-Begriffe des Philosophen der Französischen Revolution darwinistisch-biologisch aus der Entwicklung und Struktur unseres Erkenntnisapparates, d. h. aus der natur- bzw. stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen, abzuleiten – um den Kantschen Dualismus von Natur und Vernunft zu überwinden. Die Gesetze der reinen Mathematik sind für Kant wie die der Geometrie von jeder Erfahrung unabhängig, apriorisch, denknotwendig und besitzen daher für ihn eine absolute Geltung. „Dies kritisiert Lorenz als Verabsolutierung einer Abstraktion,“ wie der Philosoph Wolfgang Thorwald in einem Aufsatz über Konrad Lorenz schreibt.
.
Bei den (Tier-)Psychologen hat es gleichfalls nicht an entwicklungsgeschichtlichen Erklärungen für das „logische Denken“ gefehlt, es wurde jedoch nicht als „gesellschaftliche Praxis“, sondern „subjektiv“ gefaßt. Folgt man dem „Neukantianer“ Wilhelm Windelband war die „Apriorität“ aber „bei Kant kein psychologisches, sondern ein rein erkenntnistheoretisches Merkmal: es bedeutet nicht ein zeitliches Vorhergehen vor der Erfahrung, sondern eine sachlich über alle Erfahrung hinausgehende und durch keine Erfahrung begründbare Allgemeinheit und Notwendigkeit der Geltung von Vernunftprinzipien.“ Und diese müssen wir anerkennen – und können sie auch erkennen, d.h. „der Mensch“, obwohl es nur für den westlichen – griechischen – Menschen (in einer entfalteten warenproduzierenden Gesellschaft) gilt. – Parmenides, Galilei, Newton, Einstein. Die Zahlen sind die Substanz der Logik und das Brot der Logiker.
.
Deswegen wurde der Graupapagei „Alex“, dem die US-Philosophin Irene Maxine Pepperberg das Zählen beigebracht hatte, auch sogleich als „Papageien-Einstein“ bezeichnet. Die Mitarbeiterin im „Arbeitskreis Human Animal Studies – Chimaira“ Katharina Dornenzweig merkt dazu im neuen Reader „Das Handeln der Tiere“ an, dass Irene Pepperberg nach dem Tod von Alex mit anderen Papageien weiter arbeitete, die sich als ebenso „kompetent“ erwiesen, „was schwerlich zu dem Wunderkindnarrativ paßt“.
.
.
.
Nun zu den fünf, sechs, sieben Sinnen. Man weiß, wenn einer ausfällt – das „Augenlicht“ z.B., dass dann ein anderer – das Hörorgan z.B. – die Wahrnehmungsbeeinträchtigung bis zu einem gewissen Grad kompensiert. Ein schönes Beispiel dafür ist eine südamerikanische Geierart, deren Revier die Regenwälder sind, über die sie kreisen. Wegen des dichten Blätterdachs können sie jedoch keinen Kadaver sehen. Geier sind ansonsten berühmt für ihre Sehfähigkeit – mit der ihnen in der Savanna, in der Steppe oder im Gebirge kaum ein Aas entgeht. Die Regenwald-Geier riechen dagegen jedes Stück Fleisch, das auf dem Waldboden liegt, während sie hoch in der Luft über den Bäumen kreisen. Der englische Tierfilmer David Attenborough machte für eine BBC-Dokumentation im Urwald den Test mit einem.
.
.
Ähnlich gute Augen wie die Geier haben im übrigen auch die Raben und Aaskrähen. Mangels toter Tiere, die stinkend in der Gegend herumliegen, hat man sich hierzulande entschlossen, auch die Aaskrähen – aber nur als Artbegriff (Corvus corone) – abzuschaffen, indem man daraus zwei Arten machte: die Nebelkrähe (Corvus corone cornix) und die Rabenkrähe (Corvus corone corone). Diese (schwarzen) leben mehr im Westen Europas und jene (grau-schwarzen) im Osten, aber „quer durch Deutschland läuft eine Grenzlinie [ungefähr entlang der Elbe, 15 bis 150 Kilometer breit], auf der sich Nebelkrähen und Rabenkrähen paaren. Trotz der Vermischung ihres Erbguts erhält sich das unterschiedliche Aussehen beider Vögel. Ursache scheint eine Art Selbstliebe zu sein,“ schreibt der Spiegel und beruft sich dabei auf eine Studie von Forschern um Jochen Wolf von der Universität Uppsala. Die Charlottenburger Veterinärmedizinerin und Rabenkrähenhalterin Almut Malone meinte kürzlich, dass die Nebelkrähen, die im Winter in Berlin leben, aus dem Osten kommen, während die hier lebenden nach Westen abwandern, im Frühjahr fliegen beide Populationen wieder zurück. Die Saatkrähen, die früher zu tausenden im Winter ihr Quartier in Berlin bezogen, kamen ebenfalls aus dem „Ostblock“. Wohin die vielen in Berlin lebenden Dohlen verschwunden sind, weiß man nicht. In manchen Städten an der Küste gibt es sie noch in nennenswerter Zahl – und es werden sogar immer mehr. Ähnliches gilt dort auch für die Rabenkrähen. In vielen Städten überlegt man sich schon „humane“ Maßnahmen zu ihrer Vertreibung.
.
In Berlin gibt es mindestens vier Frauen und einen Mann, die in Volieren u.a. Rabenkrähen aufziehen bzw. gesundpflegen, um sie, wenn möglich, nach einiger Zeit wieder frei zu lassen, die Tiere dürfen deswegen nicht zahm werden. Rabenvögel werden besonders schnell zahm. Im „Rabenforum“ gibt es immer wieder Hilferufe, selbst von rabenerfahrenen Leuten, die „den Zeitpunkt der Abnabelung verpaßten“:
„Damals hatte ich versucht sie bei uns am Tierheim fliegen zu lassen, sie war da in einem wenig frequentierten Raum, da hab ich dann die Tür aufgelassen… aber sie kam dann immer einfach woanders rein und ärgerte die Hunde… Also viel zu gefährlich. Jetzt lebt sie bei uns Zuhause… in Küche und Büro (wobei das Büro keines mehr ist, sondern zum Elsternzimmer umfunktioniert wurde). Wenn ich sie mit raus nehme hat sie keinerlei Interesse wegzufliegen. Sie läuft mit hinterher wie ein Hund oder ärgert unsere Hunde oder unsere Katze. Ich bin mir sicher, dass sie draußen so keine Überlebenschance hätte.
Wie seht ihr das? Gibt es noch eine Möglichkeit zur Auswilderung? Gäbe es einen Platz bei anderen Elstern, wo man es probieren könnte? Hätte das überhaupt Chancen? Sollte ich versuchen eine andere Elster aufzunehmen?“
.
In Spandau hält eine Rabenkrähenfreundin zwei beige-weiße Nebelkrähen. Sie können nicht in die Freiheit entlassen werden, weil sie derart auffällig sofort zur Beute von Greifvögeln werden würden.
.
.
Vögel können nicht gut riechen…“Nur die Kiwis, mit Abstrichen auch die Tauben, Enten und Greifvögel, verfügen über ein gewisses Riechvermögen,“ heißt es auf „herz-fuer-tiere.de“. Daneben ist auch ihr Geschmacksinn nicht besonders ausgeprägt. Dafür haben sie einen „feinen Hörsinn“ (tiere-online.de) – und erkennen z.B. ihre Jungen u.a. an ihren Lautäußerungen. Sie füttern aber auch schon Mal ein fremdes Junges, wenn es auf einem Ast sitzt und jämmerlich schreit. Man kann ein Junges, wenn es z.B. aus dem Nest gefallen ist, ruhig nehmen und wieder reinsetzen, weil die Eltern dies am Nestling nicht riechen (im Gegensatz zu den menschengeruchs-empfindlichen Kaninchen und Rehen beispielsweise). Auch umsetzen kann man ein Vogeljunges zur Not (wenn z.B. seine Eltern getötet wurden), d.h. man kann es einfach zu einem anderen Paar ins Nest legen. Wenn der Altersunterschied zu deren Jungen nicht allzu groß ist, füttern sie es mit. Ein Grünfinken-Nestling läßt sich z.B. laut der Vogelkundlerin Almut Malone in einem Spatzen-Nest unterbringen, ein kleiner Spatz jedoch nicht im Nest von Grünfinken, weil deren Jungen (wie auch die von Rabenvögeln) alle rote Rachen haben, Spatzen-Jungen aber nicht. Und deswegen werden sie nicht mitgefüttert.
.
Auch als Zoologe kann man ein (zu erforschendes) Sinnesorgan durch ein anderes kompensieren. Dies tat der Entdecker der Bienensprache Karl von Frisch. 1932 hatte er sich die Frage gestellt, ob Fische erkennen können, woher der Schall kommt, denn ihnen sind die anatomischen Voraussetzungen dafür nicht, wie bei uns, gegeben: Sie können die Schallrichtung nicht erkennen. Das hatte von Frisch auch erwartet, aber es führte ihn auf ein anderes Gebiet: Er hatte eine Ellritze gefangen und mit der Nadel einen bestimmten Nerv durchtrennt. Als er sie wieder ins Wasser [des Sees vor seinem Haus] entließ, flüchtete der ganze Schwarm und versteckte sich. Es stellte sich heraus, dass bei Verletzung der Haut einer Ellritze ein „Schreckstoff“ ins Wasser gelangt, der für die anderen eine alarmierende Wirkung hat, sobald sie ihn riechen. Als Ergebnis vieler Versuche, auch mit anderen Fischen, stand für von Frisch daraufhin fest, „dass ein Schreckstoff ganz allgemein bei Karpfenfischen vorkommt, zu denen fast ¾ unserer Süßwasserfische gehören.“ Er berichtete darüber zuletzt in seinen „Erinnerungen eines Biologen“ (1973).
.
.
Neuerdings wollen australische Biologen festgestellt haben, dass einige Korallenfische, u.a. Mönchsfische, diesen „Schreckstoff“ auch ausstoßen können, wenn sie sich von anderen Raubfischen nur bedroht fühlen. Da die Wissenschaftler anders als von Frisch „Altruismus“ ausschließen, gehen sie davon aus, dass der Schreckstoff weitere Raubfische anlocken soll, so dass diese erst einmal untereinander kämpfen. Angeblich kann sich die Überlebenschance des Mönchsfischs dabei „von fast null auf ca. 40 Prozent“ erhöhen.
.
.
Ich hatte zu Hause in meinem Kaltwasseraquarium einen Flußkrebs namens Fritz, den ich mit Leberwurst fütterte: Wenn ich einen kleinen Klumpen zusammen mit einem Kiesel zum Beschweren etwa 40 Zentimeter entfernt von ihm ins Becken warf, dauerte es nur ein paar Sekunden, bis er den Braten roch und eiligst auf ihn zuschoß.
.
Amseln hören besonders gut – z.B. das leise Kratzen der Borsten von Regenwürmern an den Wänden ihrer unterirdischen Gänge. Mit dem Anlegen von immer mehr Rasenflächen wurde die Stadt für den einst scheuen Waldvogel immer attraktiver, weil er darauf die Regenwürmer besser hören konnte als auf Langgraswiesen. Mit dem massenhaften Einsatz der Rasenmäher wurden die Amseln immer schneller und intelligenter, wie einige Forscher in den Achtzigerjahren meinten herausgefunden zu haben. Zwar gilt: je kürzer der Rasen desto schneller kann die Amsel den Wurm orten, aber dieser wurde „on the other hand“ auch immer gewitzter – im Maße die Mode des Kurzrasens fortschritt. Amseln und Regenwürmer liefern sich im Zuge der Gartentechnikentwicklung quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
.
Die gustatorische Wahrnehmung, das Schmecken, ist besonders bei Rindern entwickelt. Sie haben 25.000 Geschmacksknospen auf der Zunge und im Schlund (wir Menschen nur etwa 8000). „Wenn wir uns in das Tier hineinversetzen wollen,“ sagt der Schweizer Kuhexperte Martin Ott über das Wiederkäuen ( (in: „Kühe verstehen“, 2011), dann merken wir, „dass dieses ‚Würgen‘ eigentlich gar kein Würgen ist, sondern dasselbe wie eine Schluckbewegung – einfach in die umgekehrte Richtung. Die Kuh schluckt quasi rückwärts mit einem Wohlgefühl und Zufriedenheitsgefühl ihren Bissen aus dem Magen in den Mund zurück, und hier wird dieser Bissen, der anfangs einfach einmal verschlungen wurde, in einer ganz intensiven Weise wiedergekäut. Bei diesem Vorgang, der durch eine immense Speichelbildung [etwa 120 Liter täglich] begleitet ist, wird die Kuh nun wirklich zur Feinschmeckerin“ – und das kann sie auch noch unzählige Male wiederholen. „Bei Menschen haben wir diese Gründlichkeit an einem anderen Ort. Im geschulten Denken! Die Kuh denkt die Nahrung quasi hin und her, meditiert sie durch.“ Von da aus gesehen ist es also gar nicht so falsch, was der US-Kuhforscher Robert W. Hegner sagte: dass ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert ist und die Kuh uns deswegen in gewisser Weise überlegen sei.
.
.
.
Dem Wiener Psychologen Siegmund Exner gelang es, die Augenlinse eines Käfers als Linse für eine Kamera zu verwenden und damit ein Photo zu machen: Voilà, so sieht ein Käfer die Welt! Nein, so geht es nicht: das Sehen mit den Augen eines Tieres.
.
Mindestens ebenso viel experimentiert wie Exner hat der amerikanische Zoologe Donald R. Griffin (der daneben auch viele gute Tierbücher schrieb), um dem Orientierungssinn der Fledermäuse, der ihnen Nachts die Wahrnehmung mit den Augen ersetzen muß, auf die Spur zu kommen. Schon im 18. Jahrhundert hatte Lazzaro Spallanzani entdeckt, daß Fledermäuse in absoluter Dunkelheit zwar ohne Augenlicht fliegen konnten, aber mit verschlossenen Ohren die Orientierung verloren. „Den Grund für diesen unerwarteten Befund fand er jedoch nicht heraus, da er seine Versuchstiere nicht rufen hörte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gelang es Donald Griffin mit Hilfe eines neuentwickelten Ultraschallmikrofons, die Rufe von Fledermäusen hörbar zu machen,“ heißt es auf „fledermauskunde.de“. Mit ihren fein entwickelten Ohren fangen sie dann das Echo auf und ziehen daraus ihre Schlüsse (Flugrichtungen). Griffins Buch darüber, das ihn berühmt machte, heißt auf Deutsch: „Vom Echo zum Radar. Mit Schallwellen sehen“ (1959). Einige Nachtfalterarten haben sich auf das schnelle „Entschlüsseln“ der für uns unhörbaren Rufe von Fledermäusen, ihre Freßfeinde, konzentriert – und sind dabei relativ erfolgreich gewesen. Auch hier findet in gewisser Weise ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt – im Dunkeln und in der Luft.
.
.
Bei den zumeist tagaktiven Vögeln ist der Sehsinn wie erwähnt besonders geschärft, zudem machen „UV-empfindliche Zapfen und Öltröpfchen in der Retina sie zu wahren Meistern des Farbensehens,“ heißt es auf „farbimpulse.de“. Die für uns schwarzen Kolkraben und Rabenkrähen sehen deswegen füreinander aufgrund ihrer UV-Licht-Wahrnehmung farbig schillernd aus.
.
Bei den nachtaktiven Eulen sorgen laut „eulenwelt.de“ ihre extrem lichtempfindlichen und riesengroßen Augen für eine Art Restlichtaufklärung. Aber „das wahrlich starke Sinnesorgan der Eule ist das Gehör,“ fügt „swr.de“ hinzu. „Wenn die Dunkelheit eintritt und damit für sie die Jagdzeit nach Mäusen beginnt, muss sich die Eule auf ihre hochsensiblen Ohren verlassen. Denn bei absoluter Finsternis sehen auch Eulenaugen zu wenig. So nimmt die Schleiereule beispielsweise mit Hilfe ihres großen Gesichtsschleiers kleinste Geräusche auf. Der Schleier funktioniert ähnlich wie ein Parabolspiegel, er bündelt und verstärkt die akustischen Signale. Der Gehörgang der Schleiereule befindet sich dabei unter einer Hautfalte zwischen innerem und äußerem Schleier.“ Bei anderen Vögeln ist er unter Federn verborgen.
.
Hunde haben im Vergleich zu uns ein eingeschränktes Farbsehen, dafür können sie besser hören. Ihre maximale Empfindlichkeit liegt bei 8000 Hz, unsere dagegen im Bereich zwischen 2000 und 4000 Hz. Vor allem ist jedoch das Riechorgan des Hundes sehr viel empfindlicher als das des Menschen. Messungen haben laut Wikipedia „ein im Vergleich zum Menschen etwa eine Million Mal besseres Riechvermögen ergeben. Da ihre Nase (ähnlich wie beim Sehen) rechts und links differenzieren kann, können Hunde zudem ‚Stereo‘ riechen.“ Auch wenn mir das übertrieben scheint, Jip, der Hund von Dr.Dolittle konnte wirklich gut riechen. Einmal lag er auf dem Deck eines Hochseeschiffes und witterte, wo der verlorene Onkel wohl sein könnte (es war da ein Onkel verloren gegangen). Er stellte sich hin, zog die Luft ein und analysierte. Dabei murmelte er:
»Teer, spanische Zwiebeln, Petroleum, nasse Regenmäntel, zerquetschte Lorbeerblätter, brennender Gummi, Spitzengardinen, die gewaschen werden – nein, ich irre mich, Spitzengardinen, die zum Trocknen aufgehängt worden sind, und Füchse – zu Hunderten – junge Füchse – und – Ziegelsteine«, flüsterte er ganz leise, »alte gelbe Ziegel, die vor Alter in einer Gartenmauer zerbröckeln; der süße Geruch von jungen Kühen, die in einem Gebirgsbach stehen; das Bleidach eines Taubenschlages – oder vielleicht eines Kornbodens – mit daraufliegender Mittagssonne, schwarze Glacéhandschuhe in einer Schreibtischschublade aus Walnußholz; eine staubige Straße mit Trögen unter Platanen zum Pferdetränken; kleine Pilze, die durch verfaultes Laub hindurchbrechen; und – und – und –« „Das ist nicht gemacht – das ist gefühlt,“ fügte Kurt Tucholsky in seiner Rezension des Buches „Dr.Dolittle und seine Tiere“ 1925 hinzu.
.
.
Der Arzt und Schriftsteller Michail Bulgakow schrieb 1925 eine Erzählung mit dem Titel „Hundeherz“, die von einen Moskauer Straßenhund namens Bello handelt. Erst einmal mußte der Hund laut Bulgakow die kyrillischen Schriftzeichen zu entziffern lernen, bevor er „street-wise“ wurde: „Lesen lernen hat überhaupt keinen Zweck, wenn Fleisch auch so einen Kilometer weit zu riechen ist“, heißt es da zunächst, und erinnert daran, dass für den Hund nicht das Sehfeld, sondern das Duftfeld seinen „Mikrokosmos“ gründet, und er deswegen vielleicht laut Kenneth Shapiro die „Räumlichkeit der Zeitlichkeit vorzieht“, aber, so Bulgakow weiter, „wenn Sie in Moskau leben und ein bißchen Grips im Kopf haben, lernen Sie wohl oder übel lesen, obendrein ohne Lehrgang. Unter den 40.000 Moskauer Hunden wird es kaum einen Idioten geben, der nicht das Wort Fleisch buchstabieren kann.
.
Bello hatte nach Farben lesen gelernt. Als er gerade vier Monate alt war, wurden in ganz Moskau grüne und blaue Schilder mit der Aufschrift MVKG ausgehängt, das bedeutete Fleischhandel. Um es noch einmal zu sagen, das ganze Lesenlernen hat keinen Sinn, denn Fleisch riecht man sowieso. Einmal kam es zu einem Mißverständnis, denn Bello, dessen Geruchssinn von dem Benzinqualm eines Motors geschwächt war, orientierte sich nach der giftig-blauen Farbe und lief statt in eine Fleischerei in den Elektroladen der Gebrüder Golubisner in der Mjasnizkaja-Straße. Bei diesen Brüdern bekam er Isolierdraht zu spüren, und der zieht noch mehr durch als eine Kutscherpeitsche. Dieser denkwürdige Moment darf als der Beginn von Bellos Ausbildung gelten. Wieder draußen auf dem Gehsteig überlegte er, dass ‚blau‘ nicht immer ‚Fleisch‘ bedeutet. Heulend vor Schmerz prägte er sich ein, dass bei allen Fleischläden links als erstes ein goldener oder rötlicher Krakel steht. Weiterhin lief es besser. Den Buchstaben N lernte er bei dem ‚Fischladen‘ Ecke Mochowaja-Straße“ (weil er sich dort den letzten Buchstaben zuerst einprägte).“
.
Die US-Ethnologin Elizabeth Marshall Thomas erforschte u.a. den außerordentlichen „Orientierungssinns“ ihres Hundes „Misha“, ein Husky, der ein „Stadtstreuner“ war und das bei ihr auch bleiben durfte. Seine Navigationskünste waren nicht angeboren, schreibt sie (in: „Das geheime Leben der Hunde – 1993), denn seine „Husky-Frau Maria“ verirrte sich jedesmal auf ihren Streifzügen.Wahrscheinlich sind viele „herrenlose Hunde“ (und Katzen) solche, die nur einen mangelhaften Orientierungssinn besitzen – und deswegen nicht wieder „nach Hause“ fanden.
.
.
Der Orientierungssinn scheint kein Organ zu haben, deswegen vermutet man immer noch alles Mögliche (z.B. bei der rätselhaften Orientierungsfähigkeit der Zugvögel oder Brieftauben, die uns nebenbeibemerkt immer mehr verloren geht – aufgrund von GPS und dem fatalen kapitalistischen Hang, es überall auf der Welt gleich aussehen zu lassen. Dem kommt unser Abstraktionszwang entgegen, der zwar schnelles Identifizieren von Gegenständen oder Situationen erlaubt, dem dies aber nur auf Kosten des genauen Hinsehens gelingt (für Leute, die ihren Sehsinn besonders entwickelt haben, Künstler und andere Spezialisten, gilt dies allerdings nur bedingt).
.
.
Die US-Psychologin Alexandra Horowitz hat aus den vielen haltlosen Interpretationen von tierischem Verhalten den langweilig-wissenschaftlichen Schluß gezogen (in ihrem Buch: „Was denkt der Hund? Wie er die Welt wahrnimmt und uns“ – 2012), uns bloß davor zu warnen, „Tieren keine besonderen Fähigkeiten zuzuschreiben, solange sich ihr Verhalten durch einfachere Mechanismen erklären läßt“. Tiertrainer sollten deswegen bei Hunden keinen „sechsten Sinn“ vermuten, sondern ihre heimlichen „Hinweise [für das Tier] unterdrücken“, wenn sie ihm z.B. etwas beibringen oder ihn auf etwas Beigebrachtes hin testen wollen.
.
Der englische Botaniker Rupert Sheldrake hat sein Forscherleben dem morphogenetischen Feld und der morphischen Resonanz gewidmet, danach ist nicht das Gehirn ein Speicherorgan, es gibt dafür ein immaterielles Feld, das man heute vielleicht auch als „Cloud“ bezeichnen könnte, auf das wir gewissermaßen „Zugriff“ haben. Es ist eine Medientheorie, denn Sheldrake stellt sich das „Eintunen“ auf das morphogenetische [formbildende] Feld wie eine Feineinstellung auf den Sender eines Radios oder Fernsehens vor. Ende der Neunzigerjahre begann er ein Forschungsprojekt via Internet. Es ist noch nicht abgeschlossen. Sheldrake geht es dabei um eine Untersuchung dessen, was man gemeinhin die übersinnlichen Fähigkeiten von Tieren nennt (die z.B. lange vor den Menschen ein Erdbeben „spüren“), und speziell um das Einfühlungsvermögen von Hunden ihren Besitzern gegenüber, mit dem sie diese u.U. „trösten und heilen“ können. In seinen bisher gesammelten 120 Berichten über ein derartiges Verhalten von Hunden, so schreibt er in seinem Buch „Der siebte Sinn der Tiere“(2003), gehe es immer wieder darum, wie einfühlsam sie auf einen Menschen, der traurig oder krank ist, reagieren. Einige werden bereits gezielt als „Therapiehunde“, in Pflegeheimen z. B. , eingesetzt. Ihre Stärke ist dabei der „Siebte Sinn“. Einer fehlt also noch.
.
Vorher will ich aber noch erwähnen, dass es für Sheldrake originellerweise die Logik selbst, die zur Evolution fähig ist: Zunächst gab es nur so etwas wie „atomare Gewohnheiten“, aus denen z. B. „mechanische Gesetze geworden“ sind, diese können sich – ebenso wie die Tier- und Pflanzen-Arten – verändern. Die Evolutionstheorie ist demnach also auch für die Naturgesetze gültig, deswegen gibt
es sie eigentlich gar nicht: nur „zeitweilige Gewohnheiten der Natur“, schreibt er in seinem letzten Buch „Der Wissenschaftswahn“ (2012). Er macht darin mit der „Logik“ das selbe, was Darwin mit dem „Kapitalismus“ und Engels und Stalin mit der „Dialektik“ taten: Sie projizierten deren Entstehung in die Natur. „Die Natur“ – in die alle spucken.
.
.
Wer nicht hören will, muß fühlen, sagt man im Deutschen. Oder auch: „Haut heißt Haut, weil man drauf haut!“ Gemeint ist die taktile Wahrnehmung mit der Haut – das Fühlen. In Berlin ordnete ein Gericht kürzlich die Kastration einer männlichen Nacktkatze („Canadian-Spinx“) an, nachdem ein Tierarzt in seinem Gutachten laut der Bild-Zeitung ausgeführt hatte, die fehlende Schnurrbarthaare (Vibrissen) seien für Katzen Einschränkungen, wie wenn einem Mensch der Geruchssinn fehle. Zum einen dienten die Tasthaare der Orientierung in der Dunkelheit und bei engen Durchgängen. Zum anderen der Kommunikation: „Es ist die Verlängerung der Gesichtsmimik, damit drücken Katzen ihre Stimmung aus.“ Aber der Kater Willi habe „keine funktionsfähigen Vibrissen“. Ihr Fehlen werde vererbt. „Dieser Rasse fehlt ein Sinnesorgan“, sagte der Tierarzt, „und das Fehlen eines Sinnesorgans bewerte ich als Schaden.“
.
.
Die Bienen haben zum Fühlen „Antennen“. Mit diesen, ihren zwei „Fühlern“, können sie auch über geringe Entfernungen „luftgetragenen Schall wahrnehmen“, wie ebenso mit den Härchen an ihren Beinen. Der Würzburger Bienenforscher Martin Lindauer spricht dabei von einem „Vibrationssinn“, mit dem sie u.a. auch die Summtöne anderer Bienen empfangen. Auch ihr Geruchssinn befindet sich auf den Fühlern, was man dadurch herausfand, dass man sie einfach abschnitt. In ihrer Welt spielen Düfte die Rolle einer Sprache. Honigbienen können z.B. auch Wasser „riechen“. Karl von Frisch sprach von „Duftparolen“ und „Duftworten“, mit denen einige soziale Insekten auch ohne Tanz andere zu einer ergiebigen Blütentracht führen – „nicht von den Blumen übertragen, sondern von den Bienen selbst erzeugt“. Auch die Hummelmännchen legen „Duftstraßen“ an, damit die Weibchen zu ihnen finden, während bei den in den Tropen lebenden stachellosen Bienen die Weibchen Duftmarkierungen zu besonders ergiebigen Blütentrachten legen und die anderen Sammelbienen dann auch noch dorthin lotsen (statt ihnen tanzend den Weg zu weisen).
.
Den Berliner Science-Fiction-Autor Dietmar Dath hat die Duft-Kommunikation der Bienen untereinander und mit ihren Trachtpflanzen darauf gebracht, dass sich in seinem Roman „Die Abschaffung der Arten“ (2008) alle neuen Lebewesen, die inzwischen „aus der Evolution das schlechthin Willentliche“ machen, über „Pherinfone“ verständigen: ein Wort, „zusammengesetzt aus Pheromon und Infone, Daten zum Riechen“.
.
Daneben verlassen die Honigbienen sich in ihrem dunklen Stock auch noch auf den Tastsinn. Und draußen auf ihre großen Facettenaugen, deren Sehbereich im Vergleich zu unserem nach der Seite des kurzwelligen Lichts hin verschoben ist – so dass Rot für sie Schwarz ist, dafür sehen sie noch Ultraviolett. Ihr Geschmackssinn befindet sich ebenfalls auf den Fühlern, sowie „an Härchen im Bereich des Mundes und an den Beinenden“, wie Insektenforscher der Universität Toulouse herausfanden. Ob etwas genießbar ist, entscheiden die Bienen mit Rezeptoren an ihren Vorderbeinen. Kein Tier und keine Pflanze kommt ohne einen „Schweresinn“ aus, bei den Bienen kommt noch ein „magnetischer Sinn“ hinzu, mit dem sie das magnetische Feld der Erde wahrnehmen, um sich bei ihren Flügen zu orientieren. So viele Sinne bei so einem kleinen Insekt – und dann befinden sich die meisten auch noch in und auf seinen Fühlern, wenn man den Bienenforschern glauben darf.
.
.
Säugetiere und Vögel fühlen eher mit dem ganzen Körper – und viele können gar nicht genug Körperkontakt mit anderen fühlen. Der berühmte Londoner Spatz „Clarence“ schlief z.B. Nachts mit im Bett seiner Besitzerin Clare Kipps. Er war so eifersüchtig, dass er eine Freundin von ihr zwang, auf der Couch zu übernachten. Unser Spatz, den wir zu Hause hatten, Benjamin, schlief am Liebsten in der Halsbeuge meines Vaters. Das Streichel- und Schmusebedürfnis der Katzen kennt fast jeder. Am weitesten haben es diesbezüglich die Bonobos gebracht, die das „Groomen“, Schmusen und Vögeln an die Stelle von Aggressionen praktizieren.
.
Für die japanischen Primatenforscher um Takayoshi Kano, deren Forschungsstation sich seit 1974 im kongolesischen „Wamba-Wald“ befindet, haben die von ihnen dort beobachteten Bonobos den (mit ihnen nahe verwandten) Schimpansen genau entgegengesetzte Konfliktlösungen entwickelt: während bei diesen das Soziale mit mehr oder weniger männlicher Gewalt zusammengehalten wird, geschieht das bei den von Weibchen dominierten Bonobo-Gruppen über sexuelle Handlungen. Laut Kano besteht bei ihnen „die Funktion des Kopulations-Verhaltens in erster Linie zweifellos darin, das friedliche Nebeneinander von Männchen und Weibchen zu ermöglichen, und nicht darin, Nachkommen zu zeugen“. Zumal ein Großteil des Sexualverhaltens, vor allem bei den Weibchen, aus homosexuellen Praktiken besteht. Die männlichen Bonobos bleiben bis weit ins Erwachsenenalter eng an ihre Mutter gebunden, die weiblichen bauen enge Beziehungen untereinander auf. Den Forschern erklärt sich damit, warum ihre Sozialverbände viel enger und stabiler sind als bei den Schimpansen; dementsprechend raffinierter und wandelbarer sind die gruppeninternen Strukturen der Bonobos: „In ihrer Persönlichkeit gibt es eine so große Variationsbreite, dass man keine einfache graphische Darstellung von den Beziehungen zwischen Herrschenden und Untergebenen zeichnen kann. Sie beweisen, dass Einzelwesen zusammenleben können, ohne dass es Konkurrenz und eine Rangordnung geben muß“, meint Kano (in: „The Last Ape“ – 1992). Dies gilt auch nach außen hin: statt auf Fremde aggressiv zu reagieren bieten sie denen gerne Futter an – sogar eher als Mitglieder ihrer eigenen Gruppe, wie zwei US-Wissenschaftler, Jinghzi Tan und Brian Hare, beobachteten. Der Primatenforscher Frans de Waal bezeichnete diese „maternale Kultur“ der Bonobos, von denen es noch etwa 15.000 gibt, bereits als „unsere letzte Rettung“. Die Bonobos haben auf diese Weise zur feministischen Theoriebildung beigetragen: „ihre Botschaft ist bei uns angekommen“, schrieb die Zeitschrift „Emma“.
.
.
.
.
Vom Großriecher zum Großrechner/Zahlenschmecker
.
In einem Ort nahe Oranienburg wurde im vergangenen Jahr ein Mann von einigen Dörflern verprügelt. Er und sein Bruder waren Anfang der Achtzigerjahre in den Westen gekommen und hatten in einem Hamburger Hotel Koch gelernt. Mit der Wende waren sie zurück nach Ostberlin gezogen und hatten in Treptow ein Restaurant eröffnet. 2010 erwarben sie in dem Dorf bei Oranienburg einen Restgutshof mit einigen Hektar Wiesen, die sie mit Schafen beweideten. Wegen diesen, aber auch, weil man sie im Ort für arrogante Wessis hielt, wurden sie bald von den Dörflern angefeindet. Nach einem Dorffest kam es zu der erwähnten Prügelei, wobei einer der Brüder am Kopf verletzt wurde und seinen Geruchssinn verlor, so dass er nicht mehr als Koch arbeiten konnte. Der andere Bruder erzählte mir daraufhin: „Das ist alles nicht so schlimm, er schult sich jetzt um auf Buchhaltung, das können wir auch gut gebrauchen. Sowieso läßt er sich nicht unterkriegen – und hat die Schafherde sogar noch vergrößert.“ Von einigen Stammgästen ihres Restaurants erfuhr ich, dass sie ihn „Großriecher“ genannt hatten, weil er viel feinere Gerüche als sie wahrnehmen konnte. Nach seiner Umschulung nannten sie ihn „Zahlenschmecker“.
.
Zu den Großriechern (Makrosmatikern) zählen vor allem Schweine, Hirsche und Hunde, zu den Zahlenschmeckern einige Mathematiker und viele Autisten. Die Großriecher können nur Konkretes wahrnehmen, die Zahlenseher nur Abstraktes. Der englische Neuropsychologe Oliver Sacks berichtete 1985 von einem Mann, der eine Kopfverletzung erlitt, „die seine olfaktorischen Nervenstränge schwer in Mitleidenschaft zog, so dass er jeglichen Geruchssinn verlor“. Er grämte sich sehr über den Verlust, und dass seitdem alles „fade“ schmeckte, aber nach einigen Monaten nahm er erst das Aroma seines Morgenkaffees wieder wahr, und dann auch das seines Pfeifentabaks. „Er glaubte, er könne wirklich wieder riechen“. Dem war aber nicht so: Er konnte die Gerüche nur halluzinieren. Dies war bei dem Ostberliner auch ein bißchen so, aber um wieder als Koch arbeiten zu können, reichten solche „unbewußten Geruchsassoziationen“ nicht aus.
.
Oliver Sacks erwähnt einen weiteren „Fall“, bei dem das Gegenteil eintrat: Einen Kollegen und Freund, der als Medizinstudent viele Psychodrogen einnahm und eines Nachts träumte, er wäre „ein Hund in einer Welt voller unvorstellbar starker und bedeutsamer Gerüche. Beim Aufwachsen stellte er fest, dass sein Traum Wirklichkeit geworden war. Vor der Intensität der Gerüche verblaßten alle anderen Wahrnehmungen“. Fortan identifizierte er seine Freunde und Patienten am Geruch, „jeder von ihnen hatte seine eigene olfaktorische Physiognomie, „ein Duft-Gesicht, das weit plastischer und einprägsamer, weit assoziationsreicher war als sein wirkliches Gesicht“. Wie ein Hund konnte er ihre Gefühle – Angst, Zufriedenheit, sexuelle Erregung – riechen. Auch Läden und Straßen erkannte er am Geruch. „Nichts war mehr für ihn wirklich vorhanden, bevor er es nicht gerochen und befühlt hatte.“ Das Entscheidende war jedoch, dass er, der zuvor eher intellektuell orientiert war und zu Reflexionen und Abstraktionen neigte, sich plötzlich in einer Welt befand, „die aus ungeheuer konkreten Einzelheiten bestand, deren Unmittelbarkeit und unmittelbare Bedeutsamkeit überwältigend war“. Diese Welt war zudem viel farbiger.
.
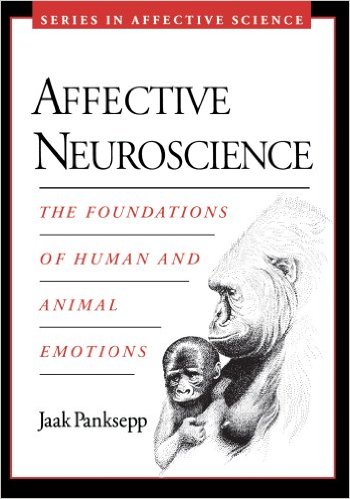
.
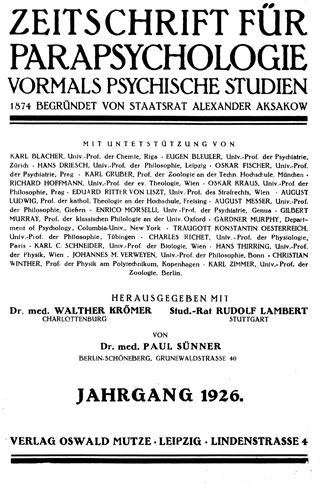
.
Als sein „Zustand“ nach drei Wochen plötzlich zu Ende war, fand er sich zu seinem Bedauern, aber auch zu seiner Erleichterung „in seiner alten, blassen Welt der beschränkten Sinneserfahrung, der Nicht-Konkretheit und Abstraktion wieder“ – und begriff, dass wir mit unserer Zivilisierung und der damit einhergehenden Reduzierung auf visuelles Erfassen (der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann spricht von einer „Okulartyrannis“) etwas Wesentliches verloren haben: „das ‚Primitive'“. Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss nannte es „eine Wissenschaft des Konkreten“, wohingegen er unsere als eine „Wissenschaft des Abstrakten“ bezeichnete. Diese beruht wesentlich auf der Logik und auf Zahlen. Inzwischen sind so gut wie alle Gegenstände – Anziehsachen, Geschirr, Möbel, Häuser, Straßen, Fahrräder, Waffen mit denen wir uns umgeben – mathematisch produzierte, zunehmend betrifft das auch Nutzpflanzen und -tiere sowie zu immer mehr Teilen auch uns selbst.
.
Konrad Lorenz postulierte, dass die Mathematik mit Abstraktionen arbeite, die den realen Inhalten und Gegebenheiten „grundsätzlich nur annäherungsweise“ angemessen seien. Zwei Einheiten seien sich nur deshalb absolut gleich, weil es „genaugenommen“ beide Male dieselbe Einheit „nämlich die Eins“ ist, die mit sich gleichgesetzt werde. So sei die „reine mathematische Gleichung letztlich eine Tautologie“, und die reine Mathematik wie die Kantischen apriorischen Denkformen inhaltsleere Verabsolutierungen: „Leer sind sie tatsächlich absolut, aber absolut leer.“ In der Mathematik „besitze Gültigkeit immer nur der leere Satz. Die Eins, auf einen realen Gegenstand angewandt, findet im ganzen Universum nicht mehr ihresgleichen.“ Wohl seien zwei und zwei vier, „niemals aber sind zwei Äpfel, Hammel oder Atome plus zwei weiteren gleich vier anderen, weil es keine gleichen Äpfel, Hammel oder Atome gibt“.
.
Dies ist der Grund, warum „primitive Völker“ nicht rechnen können: Selbst wenn sie es lernen wollen, kommen sie nicht über die Zahl vier hinaus. Denn es gibt nichts in ihrer Welt, das sich so gleicht wie bei uns zwei Nägel, zwei Teller oder zwei Kugelschreiber z.B.. Der Unterschied im Denken hat darin seinen Grund, dass sie höchstens einen Gaben- oder Geschenketausch praktizieren und wir mit der Durchsetzung des Geldverkehrs den Warentausch: Ersterer ist gekennzeichnet durch die Verpflichtung zur Erwiderung (Reziprokation) der empfangenen Gabe, der Warentausch aber darüberhinaus durch das Postulat der Äquivalenz (Gleichwertigkeit) der getauschten Dinge. Der Erforscher des Gabentauschs, Marcel Mauss schrieb 1923/24 in seiner berühmten Studie „Die Gabe“: „Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ‚ökonomischen Tier‘ gemacht…Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.“
.

.
Diese „Ökonomie“ hat laut Adorno und Horkheimer zur Folge: Das Mannigfaltige wird quantitativ unter eine abstrakte Größe gestellt und vereinheitlicht, um es handhabbar zu machen. Das symbolisch Benannte wird formalisiert; in der Formel wird es berechenbar und damit einem Nützlichkeitsaspekt unterzogen, verfügbar und manipulierbar gemacht. Das Schema der Berechenbarkeit wird zum System der Welterklärung. Alles, was sich dem instrumentellen Denken entzieht, wird des Primitivismus verdächtigt. Der moderne Positivismus verbannt es in die Sphäre des Unobjektiven, des Scheins. Aber diese Logik ist eine Logik des Subjekts, die unter dem Zeichen der Herrschaft, der Naturbeherrschung, auf die Dinge wirkt. Diese Herrschaft tritt dem Einzelnen nunmehr als Vernunft gegenüber, die die objektive Weltsicht organisiert.
.
Die berühmten Mathematiker nun, aber auch die anonymen Autisten, von denen es immer mehr gibt, sind sozusagen auf den Kern dieser „Weltsicht“ reduziert: auf das Äquivalenzprinzip, d.h. auf die abstrakten Zahlen, die man ironischerweise „natürliche Zahlen“ nennt. Wie sich das am und im Einzelnen äußert, hat der sowjetische Psychologe Alexander Lurija am Beispiel eines „Gedächtniskünstlers“ aufgezeichnet, der alle Zahlen, die man ihm nannte, behielt und wiedergeben konnte, wobei er sie in seinem Gedächtnis als konkrete Gegenstände behandelte, die Geschmack, Farbe und Töne besaßen. Er „sah“ sie wie Objekte in einer Landschaft.
.
Ähnliches vermutete dann auch Lurijas „Schüler“ im Westen, Oliver Sacks, bei einem amerikanischen Zwillingspaar, die in einer Anstalt lebten und als retardiert galten. Sie hatten jedoch ein „ungeheuerliches Zahlengedächtnis – lässig wiederholten sie drei-, dreißig- oder dreihundertstellige Zahlen“. Schüttete man eine Schachtel mit Streichhölzern aus, „riefen beide gleichzeitig ‚hundertelf'“. Auf Nachfrage erklärten sie: „Wir haben sie nicht gezählt, wir haben die Hundertelf gesehen.“ Eine derartige Fähigkeit haben auch andere „Einfallspinsel“ – wie das „Zahlenwunder“ Zacharias Dase z.B., der bei einem Glas ausgeschütteter Erbsen sofort ihre Zahl „sah“.
.
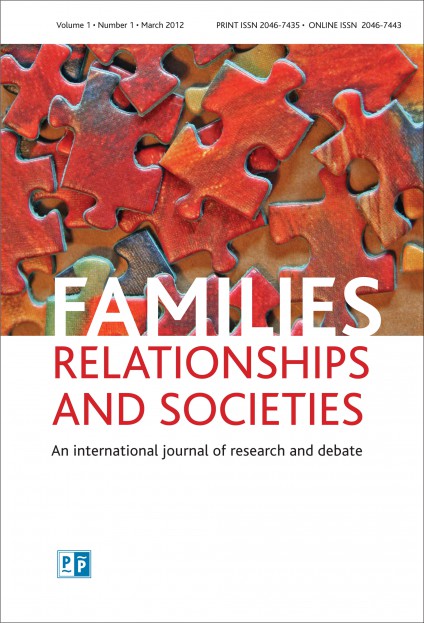
.
Waren sie allein, unterhielten sich die Zwillinge folgendermaßen: „John nannte eine sechstellige Zahl; Michael griff die Zahl auf, nickte, lächelte und schien sie sich gewissermaßen auf der Zunge zergehen zu lassen.“ Es waren Primzahlen. Die Beliebtheit von Primzahlen ist bei Autisten weit verbreitet, es sind für sie „Fenster zu einer anderen Welt,“ wie die Mutter einer autistischen Tochter Oliver Sacks schrieb. Man könnte aber vielleicht auch sagen: Es ist das einzige ihnen verbliebene Fenster zu unserer warenproduzierenden Gesellschaft. Insofern sind sie zur völligen Asozialität verdammt. Als der Neuropsychologe sich den Zwillingen zuwandte, tat er dies, indem er ihnen eine achtstellige Zahl nannte. Sie überlegten eine Weile „und begannen dann plötzlich gleichzeitig zu lächeln“. Sie hatten seine Primzahl erkannt. Diese „Kommunikation“ ging dann bis zu zwanzigstelligen Primzahlen. Sacks meinte, „sie beschwören seltsame Zahlenszenen, in denen sie sich wie zu Hause fühlen; sie wandern ungezwungen durch riesige Zahlenlandschaften.“ Sie „übertragen“ die Zahlen nicht in etwas anderes, sondern „erfühlen“ sie als „Formen“, wie „die vielfältigen Formen, die in der Natur vorkommen“. Der in New York lehrende Neuropsychologe vermutet, dass die Zahlen ihre Freunde sind: „die einzigen, die ihnen in ihrem isolierten, autistischen Leben begegnet sind.“ Auch für einige berühmte Mathematiker galt, dass ihnen Zahlen schon in früher Kindheit „Freunde“ wurden. Sacks erwähnt George Park Bidder und Shyam Marathe und zitiert Wim Klein: „Zahlen sind sozusagen meine Freunde. Für Sie ist das nicht so, stimmt’s? Zum Beispiel 3844 – für Sie ist das bloß eine 3, eine 8, eine 4 und noch eine 4. Ich aber sage: ‚Hallo, 62 hoch 2!'“
.
Der „Logiker“ Kurt Gödel war der Meinung, dass Zahlen, vor allem Primzahlen, als „Markierungen“ für Gedanken, Menschen, Orte oder irgend etwas anderes dienen können; eine solche Markierung würde den Weg zu einer „Arithmetisierung“ oder „Bezifferung“ der Welt ebnen. Oliver Sacks folgert daraus: „Sollte dieser Fall eintreten, dann ist es möglich, dass die Zwillinge und andere, die ebenso veranlagt sind wie sie, nicht mehr lediglich in einer Welt aus Zahlen, sondern als Zahlen in der Welt leben werden.“ In der sich durchalgorithmisierenden heutigen Welt sind die Autisten Avantgarde. Eine traurige, eine unterworfene Speerspitze. Demgegenüber meinte ausgerechnet eine Physikerin – auf einer Tagung der Akademien der Wissenschaften und der Künste in Potsdam über Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen Kunst und Wissenschaft: „Es geht dabei im Kern um den Satz der Identität in der Logik – A gleich A: Da raus zu kommen, darauf kommt es doch wohl an – in der Kunst.“
.

.
Beutekunst
.
Ich las gerade das kürzlich auf Deutsch erschienene spannende Buch des US-Ethnologen Michael F. Brown „Stromaufwärts – Das bewegte Leben eines Amazonasvolkes“ (gemeint sind die Aguaruna, die sich Awajun nennen, am Rand des peruanischem Staatsgebietes leben und um ihre Selbstbehauptung kämpfen), plötzlich kam ein Peruaner aus Lima in die taz und wandte sich an mich. Zufall.
.
„Heimatlose Volkskunst“ – so lautete das Pseudonym dieses schon lange in Berlin lebenden peruanischen Künstlers, Performers und Dichters: Kenno Apatrida. Ich besuchte ihn in Moabit. Was er dort in und aus seinem Atelier machte – mit Collagen, Plastiken, Siebdrucken, Zeichnungen, Tafelbildern etc., war eine Art Gesamtkunstwerk, dessen Teile sich mit den Jahren allerdings dem Kunstmarkt angenähert hat. – Bis er mit drei vorgeblich kapitalkräftigen Galeristen in Kontakt kam, die ihm das Blaue vom Himmel versprachen – und ihn dann um über 200 Arbeiten erleichterten.
.
Kenno Apatrida war im Sommer 1991 mit einem Touristenvisum nach Berlin gekommen. Nachdem er hier seine Aufenthaltsgenehmigung überzogen hatte und der Rückflug verfallen war, kam er nicht mehr weg. Er wollte aber zurück. Bei der Ausländerbehörde lachten sie ihn aus: „Du bist der erste, der nicht hierbleiben will. Da mußt du zur Polizei gehen und dich deportieren lassen.“ Sie gaben ihm 100 DM, vier U-Bahn-Fahrscheine und wünschten ihm „viel Glück“. Der Künstler schlief im Park, manchmal auch bei Freunden und erfuhr dann von besetzten Häusern in Ostberlin. Im ausgebrannten Teil eines solchen Hauses fand er eine Bleibe – und legte los. Die Strassen und Mülltonnen waren voll mit interessantem Material, das er verarbeitete: „Berge von Fundstücken, alles, was die Leute vom Sozialismus los sein wollten.“ Im besetzten Haus lebt eine Künstlergruppe. Mit ihrer existentiellen Lebensweise empfand er eine Verwandtschaft: „Wir haben da in der Mitte der Kunst gelebt – nicht für irgendeinen Kunstmarkt etwas hergestellt. Es war auch alles durchdrungen von einem guten Humor, obwohl sie als europäische Undergroundkünstler auch ein bißchen arrogant mir gegenüber – als Südamerikaner, als unidentifizierbarer Eindringling – waren. Sie hatten aber auch einen Grund, eingebildet zu sein, weil sie seit 89 vollkommen frei waren. Wir hatten Berge von allem, was wir brauchten zum Leben, Räume, Essen, Recyceltes: Kameras, Musikinstrumente, tonnenweise Farben, Klamotten – eben alles, es war phantastisch.“
.
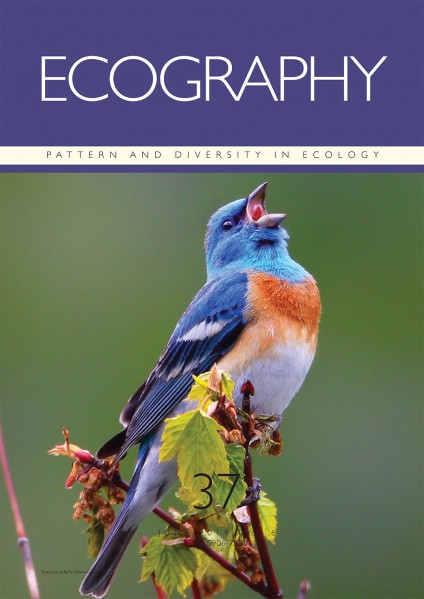
.
Mitte der Neunzigerjahre ermöglichte man ihm eine Ausstellung in einer kommunalen Galerie des Prenzlauer Bergs. Er organisierte sich den Schlüssel für die Räume und zog in die Galerie. „Es war dann eine ‚offene Werkstatt‘. Irgendwann hatte ich so viele Arbeiten, dass ich die neuen Galeristen in der Auguststrasse eingeladen habe, sich meinen ‚Altar der Emigranten‘ anzusehen. Eine New Yorker Galerie hat daraufhin 20 Bilder von mir mit zur Messe nach Miami genommen. Ich merkte bald: Meine Werke arbeiten für mich, ich habe keine Papiere, keine Legalität, aber meine Bilder können überall hinreisen und gezeigt werden. Den ausländischen Galeristen war meine Illegalität egal – auch wenn sie was verkauften, bei den deutschen war das anders.“
.
Der „Heimatlose Volkskünstler“ zog dann in eine leerstehende Brauerei, wo der Verwalter ihm einen 300 Meter langen Keller zum Arbeiten überließ. Aus diesem Riesenraum machte er 2007 eine Installation. „Das ist mir dann noch mehrmals passiert, dass Hausbesitzer mir verfallene, unbenutzte Räume zur Verfügung stellten. Es war ein bißchen paradox: Eine Person, die jeden Moment deportiert werden konnte, machte große Installationen – mit Katalog auch noch.“
.
2009 hatte er eine Ausstellung in der Galerie „Wilde“, die seine Arbeiten auf mehrere Messen zeigten. Das Kunstmagazin „art“ schrieb: „Ein fast unbekannter Künstler ist mit einem Werk von mystischer Aura zu entdecken. 17 Jahre lang hat der Südamerikaner im Berliner Untergrund aus Zivilisationsmüll ein Werk von wuchernder Lebendigkeit und tiefgründiger Symbolik geschaffen.“ Über den kanadischen Galeristen Wilde kam der Künstler mit einem Kunsthändler in Kontakt, ein Schwede, Björn Stern, der Partner des Kanadiers war und in London dann als „Art-Dealer“ und Berater von Sammlern tätig wurde. In Berlin hatte er zuvor ein Jahr im Gefängnis gesessen, weil er angeblich Bilder von Felix Nußbaum verkauft hatte, die gefälscht waren.
.
Als er bei Kenno Apatrida auftauchte, hatte er einen neuen Partner dabei: einen Dänen, Henrik Omme, mit einer Galerie im Künstlerdorf Silkeborg, angeblich eine der ältesten und renommiertesten in Dänemark. Die beiden wollten ihm sogleich sämtliche Arbeiten im Brauereikeller abkaufen. „Sie nannten großkotzig eine Summe. Das ist zu wenig, sagte ich ihnen“. „Aber das ist doch erst mal nur die Hälfte,“ erwiderte der Londoner Galerist, „die andere Hälfte ist das, was wir in deine Karriere investieren: Wir schicken dich nach Peru und zurück, dann bist du hier legal; wir zahlen dein Atelier, Materialkosten, Krankenversicherung; wir drucken einen Katalog – mit einem Text von einem bekannten Kunstkritiker; wir werden dich bedeutenden Sammlern vorstellen und deine Werke in bekannten Sammlungen positionieren. Deine Figuren werden wir in Bronze gießen und Du wirst reisen – zu unseren Werkstätten in Thailand und zur alten Druckwerkstatt in Kopenhagen, um Lithgraphien und Siebdrucke von deinen Zeichnungen anzufertigen…“ Der Däne ergänzte: „Wir werden in zwei dänischen Museen für kontemporäre Kunst Ausstellungen für dich organisieren. Wir werden sozusagen eine konstruktive und langfristige Beziehung zu dir aufbauen, die uns allen viel Geld einbringt.“
.

.
Daraufhin gaben sie ihm eine Anzahlung, jedoch nicht auf einmal, sondern in mehreren Portionen und meistens durch eine dritte Person. Außerdem kauften sie ihm ein Flugticket nach Peru. Der Londoner flog mit und übergab dann dem deutschen Konsulat in Lima drei schriftliche Erklärungen – von ihm, vom dänischen Galeristen und vom Freien Museum Berlin. „Darin stand, etwa gleichlautend, dass sie alles für mich tun und mir 1000 DM plus Atelierkosten monatlich zahlen würden. Das ‚Freie Museum‘ verpflichtete sich sogar, mit 1500 DM monatlich zu zahlen.“
.
Bevor Kenno Apatrida abflog, schafften „seine“ Galeristen rund 200 Bilder von ihm in den „Art Storage Schlien & Friends“. Von dieser Firma bekam er eine Quittung darüber, dass sie „verschiedene Dinge“ aus seiner Wohnung abgeholt hätten. Er unterschrieb sie zwar als „Auftraggeber“, kam aber bald trotzdem nicht mehr an seine Arbeiten ran, weil die Lagergebühr im „Art Storage“ vom Londoner Galeristen bezahlt wurde.
.
„Ich war 22 Jahre von Peru weg gewesen – und fand die Gesellschaft nach einer Reise ins Landesinnere völlig von der Globalisierung gefressen. Nicht zuletzt deswegen habe ich dort schnell, in vier Monaten, eine Ausstellung gemacht, mit der ich diese Veränderung kritisch thematisierte. Ich hätte davon einiges in Lima verkaufen können, aber mein Londoner Galerist hat mir per Skype gesagt, er kaufe fast die komplette Ausstellung, um sie in London zu zeigen. Dann hat er den teuersten Kunsttransporter in Lima um einen Kostenvoranschlag für den Transport meiner Arbeiten nach London gebeten. Aber als ich nach Berlin zurück kam, waren meine Bilder noch immer in Lima – bis heute. Auch ein Atelier, das sie mir versprochen hatten, gab es nicht. Erst nach Monaten bekam ich eines – im ‚Freien Museum Berlin‘. Danach organisierte ich mir eine Ausstellung im Kreuzberger ‚Großbeeren-Keller‘.“
.
Obwohl seine Galeristen nichts taten, was sie versprochen hatten, arbeitete der Künstler einfach weiter. Er verlangte jedoch von ihnen seine Bilder aus dem Depot zurück, weil sie sich nicht an die Vereinbarungen hielten. Sein Visum war bald nur noch einen Monat gültig und er sollte unbedingt sein Atelier im „Freien Museum“ räumen, weil der Londoner keine Miete dafür zahlte. Da tauchten die beiden Galeristen erneut bei ihm in Berlin auf. Sie entschuldigten sich für alle ihre Versäumnisse, und versprachen, dass sie demnächst alles wie vereinbart arrangieren würden.
.

.
Der Künstler war verzweifelt, er schwankte, er konnte nicht glauben, dass sie ihn anlügen würden. Also vertraute er ihnen noch einmal und gab ihnen seine zuletzt gemalten etwa 20 Bilder – Öl auf Leinwand – mit: Sie sollten in Dänemark ausgestellt werden. Die beiden Galeristen gaben ihm etwas Geld, damit er eine Zahnarztrechnung zahlen konnte. Im Sommer 2014 kam tatsächlich eine Ausstellung – mit Katalog – in Silkborg zustande und der Künstler bekam noch einmal Geld, um zur Eröffnung anzureisen. Er fand: „Die Ausstellung war eine Schande, einige Bilder waren falsch herum aufgehängt, sie waren voller Staub, niemand kam. Und zurückbekommen habe ich sie auch nicht – bis heute.“
.
Das alles war eine Katastrophe für ihn. Alle Bilder weg, kein Geld, kein Atelier, kein Visum mehr. Zum Glück heiratete ihn seine Freundin und er fand einen Hauseigentümer, der ihm eine alte leerstehende Werkstatt zur Verfügung stellte. Dort stabilisierte er sich langsam wieder, indem er erneut loslegte.
.
Über 20 Jahre lebte er illegal und jeder Kontakt mit einer Behörde hätte das abrupte Ende seines Hierseins bedeutet. Eine solche Existenz bewirkt eine Intensität des Lebens, die seinem riesigen Werk, das in den Jahren entstand, zugute kam – und weiterhin kommt: „Ich glaube, die Erfahrung der Emigration ist eine Initiation, notwendig, um die ‚human condition‘ zu verstehen…Also wenn du in ein Land kommst, ohne Geld, ohne Verwandtschaft oder Freundschaften und bei Null anfängst…“
.
2015 kam Kenno Apatrida mit dem Berliner Künstler Henrik Jacob in Kontakt. Jacob hatte dem Londoner Galeristen – als seinen „Agenten“ – 2011 mehr als 120 Arbeiten mitgegeben: für eine Ausstellung in London. Dafür hatte er ebenfalls einen Vorschuß bekommen. Er bekam seine Bilder jedoch ebensowenig zurück wie Kenno Apatrida, und alle Versuche von Jacob, „seinen Agenten“ zu erreichen, verliefen bisher im Sand. Jacob hat sein Atelier im Weddinger „Kulturpalast“, in dem ein Kunstverein domiziliert ist, in dessen Räumen Kenno Apatrida am 29.1. eine Ausstellung mit neuen Arbeiten eröffnet. Sie ist eine Art Zwischenlösung, denn sein Atelier fiel der Gentrifizierung zum Opfer und er sucht dringend ein neues. Da er in seinem Atelier auch lebte, ist er nun wie zu Anfang in Berlin quasi obdachlos.
.

.
Die lustige Welt der Tiere (1)
.
Um wieder auf Tiere zurück zu kommen, kuckte ich mir erst mal „Die lustige Welt der Tiere“ an. Das war 1974 ein erfolgreicher Dokumentarfilm über Tiere in der Kalahari- und der Namib-Wüste gewesen – vom südafrikanischen Filmemacher Jamie Uys, der anschließend in der Kalahari den ebenso lustigen Ethnofilm „Die Götter müssen verrückt sein“ drehte. Beides sind Genre, die fast immer ernst, mindestens nachdenklich stimmen sollen. Zumal die Tierfilme ebenso wie die Ethnofilme stets damit enden, dass gesagt wird, die Protagonisten seien sämtlichst vom Aussterben bedroht, die letzten ihrer Art quasi. Der Sohn einer Freundin klagte, als er noch klein war, nach jedem Tierfilm weinend: „Ich möchte kein Mensch mehr sein.“ Auch Deutschlands bekanntester Naturforscher Josef Reichholf versteht sein ökologisches Wirken in Wort und Tat als moralische Aufrüstung und Sensibilisierung: „Die Menschen brauchen schlechtes Gewissen“.Er fühlt sich selbst in seiner „Lebensweise“ schuld – als ein in München lebender und viel reisender Professor, der demnächst sein 30. Buch veröffentlicht. Dennoch scheint auch er wenig Hoffnungen zu haben: „Vielleicht geht sie ja rechtzeitig vorüber, die Zeit des Menschen, bevor allzu viel Natur vernichtet ist. Dann erholt sie sich wieder. Leider haben wir, habe ich nichts mehr davon.“ Ähnlich äußerte sich die Tierbefreierin und Schriftstellerin Karen Duve kürzlich in ihrem Endzeit-Essay „Warum die Sache schiefgeht“: Am Schluß ihrer pessimistischen Weltbetrachtung schöpfte sie nur noch daraus Hoffnung, dass nach dem Untergang der Menschheit eine andere Spezies hochkommt: „Großäugige, intelligente Weidetiere. Es kann doch eigentlich nur besser werden.“ Der amerikanische Zoologer Robert W. Hegner hatte zuvor bereits die Wiederkäuer an die Spitze der evolutionären Säugetier-Entwicklung gestellt, weil ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.
.
Das Lustige an den Tieren entdeckten meist nur Leute, die sich Tiere anschaffen, um sich an ihnen zu erfreuen. Wir z.B. hatten zu Hause so viele „Pets“, dass meine Mutter ganze Abendrunden mit lustigen Tiergeschichten unterhielt, wobei ich manchmal als Stichwortgeber fungieren durfte. Den professionellen Tierforschern andererseits, die keine Kosten und Mühen scheuen, um statt bloße Anekdoten „objektive Daten“ über bestimmte Tiere zu sammeln, ging und geht es um „artspezifische Reaktionen“ (Instinkte, genetische Fixierungen, Hormonhaushalte). In der darwinistisch-utilitarischen Verhaltensforschung wird zudem ständig nach dem Nutzen gefragt.
.
Im Grunde stimmen die meisten Biologen mit der Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard überein, „dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Bei dem israelischen Ornithologen Amotz Zahavi ist daraus ein ganzer kapitalistischer Gesellschaftsroman geworden. Er hat Lärmdrosseln („Arabian Babbler“) erforscht. Bei ihnen bekommen Paare von unverpaarten Artgenossen „Hilfe beim Nestbau und Füttern der Jungen“. Diesen schon fast klassischen Fall von Kooperation – neuerdings: Altruismus genannt – deutet er in „ein selbstsüchtiges Verhalten“ um, indem er es mit BWL-Begriffen durchdekliniert: „Die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren; Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen“. Es ist von „Werbung“, „Qualität des Investors“ und „Motivation“ die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen der Vögel quasi mikronietzscheanisch auf ein egoistisches Gen zurück, indem die „individuelle Selektion“ bei den Lärmdrosseln eben „Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen“ begünstige, der berühmte Darwinsche „Selektionsmechanismus“ aber ansonsten erhalten bleibe.
.
„Die lustige Welt der Tiere“ kam zu früh (1974), erst jetzt könnte sie in der „Spaßgesellschaft“ einen zoologischen Paradigmenwechsel einleiten. Beim Thema „Spiele“ ist sich der Ornithologe Bernd Heinrich bereits unsicher: „Manchmal führen Raben scheinbar sinnlose kleine Handlungen aus, bei denen ich mich frage, ob sie wirklich einem blinden genetischen Programm folgen oder ob sie nicht doch unter dem Einfluss von Denken oder gelegentlichen Launen handeln.“
.

.
Die lustige Welt der Tiere (2)
.
Ich finde die im Süden lebenden Laufhühnchen besonders lustig: Die Weibchen sind größer als die Männchen und können aufgrund ihrer vergrößerten Luft- und Speiseröhre verschiedene weittragende Laute erzeugen, die Männchen können dagegen nur gackern. Auch sind es die Weibchen, die untereinander kämpfen und balzen, wobei sie sich nacheinander mit mehreren Männchen verpaaren, eins übernimmt dann dann das Ausbrüten der Eier und die Aufzucht der Jungen. Das Weibchen kommt nur, wenn dem Nest Gefahr droht.
.
Dem Positivismus zufolge, dem sich die Biologie in gewisser Weise verpflichtet hat, genügt bereits ein Gegenbeweis, um z.B. die Darwinsche Generaltheorie von der sexuellen Selektion zu widerlegen, und das ist mit dem Paarungsverhalten der Laufhühnchen der Fall. Laut Darwin geschieht die sexuelle Selektion durch die Weibchen, indem sie die schönsten und gesündesten Männchen (mit den besten Genen) auswählen, die ihnen deswegen mit einem immer prächtigerem Federschmuck oder Geweih imponieren wollen. Bei den Laufhühnchen ist es genau umgekehrt.
.
Desungeachtet wurde die Darwinsche Theorie der sexuellen Selektion neuerdings vom Ornithologen Josef Reichholf wieder aufgewärmt. Und der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus entwarf daraus in seinem Buch „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ eine ganze Soziobiologie, indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. Die Zeitung „Welt“ schrieb: „Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen.“ Das Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte organisierte daraufhin einen Kongreß unter dem Titel: „Survival of the Prettiest“.
.
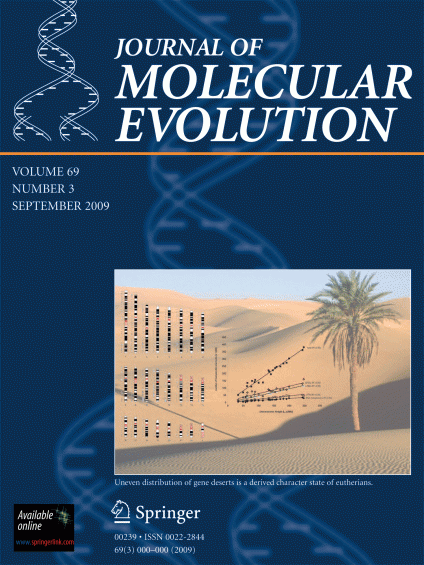
.
Bereits 50 Jahre zuvor hatte der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger sich von dieser Theorie verabschiedet, wobei er sich auf den Basler Zoologen Adolf Portmann berief, der sich als Gestalttheoretiker lange mit dem Pfau beschäftigt hatte. Ihm zufolge „wurde die Darwinsche Meinung von der ästhetischen Beurteilung des männlichen Prunkgefieders durch die Weibchen schon vor 1930 selbst von den Darwinisten fallen gelassen;“ denn laut Portmann brachte „vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen.“ Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend zu „rasch verallgemeinert“, wobei er „begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus“ (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann). „Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen,“ schreibt Heini Hediger. Ähnlich sähe es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter „ganz für sich allein balzen“. Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die „spektakulären Kämpfe“ der Männchen „harmlose Spiegelfechtereien“ und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: „Nicht einmal hinschauen tun sie.“ Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es sogar ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen. Ein anderer Ornithologe, J.G. Van Rhijn, stellte später fest, dass der unterlegene Kampfläufer oftmals der Besitzer des Reviers ist, in dem die Kämpfe stattfinden. Er holt die anderen Männchen quasi zu sich, damit die Anwesenheit vieler die Weibchen anlockt, die er dann nach den Kämpfen begattet.
.
Bei den „pantomimischen Kampftänzen“ der amerikanischen Präriehühner, die der Kieler Zoologe Adolf Remane erforschte, ist es ähnlich: Die Männchen tanzen umeinander, die Weibchen erscheinen nur „hin und wieder auf dem Tanzplatz. Sie werden sozusagen en passant begattet, ohne dass sich die Hähne dadurch in ihrem Massenritual sonderlich stören ließen.“ Daneben gilt auch für den Gesang der männlichen Singvögel, dass sie damit nicht den Weibchen imponieren wollen , sondern ihr Revier markieren – es sind „kriegerische Lieder,“ wie der Tierbuchautor Herbert Wendt das in seinem Buch „Das Liebesleben in der Tierwelt“ nennt. Kommt noch hinzu: „Eine Zeitlang glaubten die Zoologen, die Tätigkeit der männlichen Hormondrüsen veranlasse das Vogelmännchen, sich zur Hochzeit so prächtig zu schmücken. Heute nehmen wir an, dass es genau umgekehrt ist. Das männliche Prachtgewand ist das Normalkleid des Vogels [also für beide Geschlechter]; die weiblichen Geschlechtshormone dagegen sind es, die dafür sorgen, dass die Vogelweibchen zur Brutzeit unscheinbarer aussehen als ihre Partner. Denn die Mütter müssen beim Brüten und bei der Kinderpflege eine unauffällige Schutzfärbung tragen.“ Wenn beispielsweise Enten zu alt werden, um noch zu brüten, bekommen sie ein „männliches“ Federkleid. Dies gilt in etwa auch für ein kleines indigenes Volk in Neuguinea – mit rigider Geschlechtertrennung. Dort wechseln die Frauen im Alter ebenfalls in das Lager der Männer über – für die sie dann allerdings Spitzeldienste leisten: unter den jungen Frauen, damit die keine empfängnisverhütenden oder abtreibenden Mittel benutzen.
.
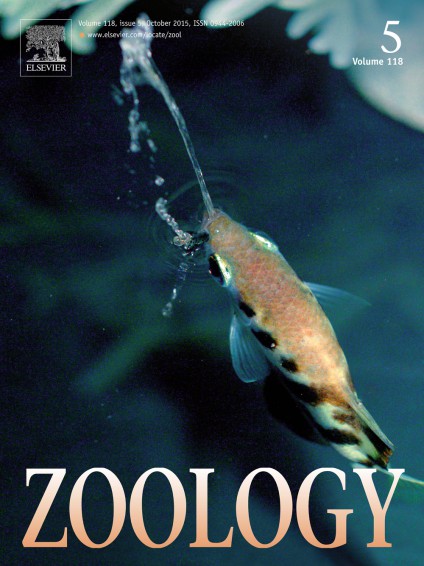
.
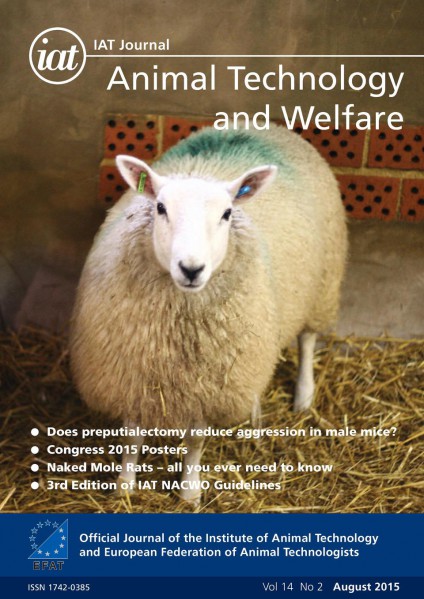
.
Tiere anlachen
.
Tieren lacht man nicht ins Gesicht. Schon gar nicht lacht man über sie – das mögen sie nicht, es ist unhöflich. Obwohl auch sie durchaus so etwas wie Schadenfreude kennen. Als Aushilfstierpfleger im Bremer Zoo mußte ich morgens immer zwei junge Orang-Utan mit dem Schlauchboot auf eine kleine Insel in einem See bringen. Auf dem Weg dorthin nahm ich sie an die Hand, sie bissen mir in den Fuß oder ins Bein dafür. Auf der Insel sperrte ich als erstes die Tür eines kleines Häuschens auf, damit sie bei Regen darin Schutz finden konnten. Einmal sprangen mir währenddessen die beiden Orangs wieder zurück ins Schlauchboot – und ich befand mich auf der Insel und machte ein dummes Gesicht, während die Affen über den See trieben und sich halb totlachten: Vor Freude hüpften sie auf die Wülste des Schlauchboots, kreischten und bleckten ihre Zähne.
.
In der ersten Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift „Tierstudien“ macht sich der Dramaturg Maximilian Haas Gedanken darüber, was umgekehrt das Lachen des Publikums über Tiere auf einer Theaterbühne bedeutet. Er hatte 2011 in Amsterdam zusammen mit dem belgischen Performancekünstler David Weber-Krebs das Stück „Balthazar“ aufgeführt, in dem ein Esel namens Balthazar neben fünf Schauspielern die Hauptrolle spielt. Inspiriert wurde das Projekt von Robert Bressons berühmten Film „Au hasard Balthazar“ (1966), in dem es um das traurige Leben und den einsamen Tod eines Esels geht – eine „schicksalhafte Abwärtsspirale“ laut Maximilian Haas.
.
Erst bei der Premiere stellte sich heraus, dass sie eine Komödie inszeniert hatten – mit dem völlig untheatralischen Esel. In dem Lachen des Publikums über das Tier lag „gleichermaßen eine Quelle der Lust wie ein Gewaltpotential.“(Die Asymmetrie wird nicht zuletzt auch immer wieder dadurch hergestellt, dass wir die Namen der Tiere gerne in der Verniedlichungsform verwenden – in diesem Fall „Eselchen“ vielleicht.)
.

.
Umgekehrt macht sich die französische Kuh auf dem Käse „La vache qui rit“ über die Deutschen lustig – im Sinne einer „vacherie“: eines üblen Scherzes, wie Peter Bexte in seinem Kuh-Beitrag für den Aufsatzband „Zoologicon“ zu Ehren des Kulturwissenschaftlers Thomas Macho schrieb. Wegen ihrer Wertschätzung der Wagner-Opern wurden die Deutschen von den Franzosen im 1.Weltkrieg als „Walkyries“ (Walküren) verspottet. Der Comiczeichner Benjamin Rabier, der noch die preußische Belagerung von Paris 1870/71 miterlebt hatte, machte, d.h. malte aus diesem Spott „entlang der Wortreihe Walkyries, Wachkyrie, Vacherie -“ schließlich eine „Vache qui rit“, nachdem er die Verballhornung als Graffiti auf einem Nachschubwagen der französischen Armee entdeckt hatte. „Vergleichbar der kuhäugigen Hera über dem Schlachtfeld von Troja fuhr fortan diese lachende Kuh über die Schlachtfelder des 1.Weltkriegs.“ Und seitdem lacht sie uns auch auf dem französischen Schmelzkäse an, den es inzwischen nahezu überall auf der Welt zu kaufen gibt, in Deutschland heißt er, etwas zackiger als in Frankreich: „Die lachende Kuh“. Als die Schmelzkäsesorte in Finnland eingeführt wurde, inspirierte das den dortigen Autor Arto Paasilinna sogleich zu einem Roman: „Der Sommer der lachenden Kühe.“
.
„Die Kuh die lacht“ – das ist in Deutschland auch noch das „Qualitätsversprechen“ einer GmbH, die Fleisch von Rindern aus dem hessischen Vogelsberg verkauft. Daneben ist dies auch der Name eines „Lieferservices“ in Frankfurt am Main, der ebenfalls stark rindfleischausgerichtet ist.
.
Bei all diesen Beispielen hat die Kuh genaugenommen nichts zu lachen. Anders ist es bei den immer nutzungsfreier werdenden Hunden: Wenn man dem Wolfsforscher Erik Zimen glauben darf, haben sie es gelernt, die menschliche Mimik zu verstehen, weil wir umgekehrt deren „Signale“ oft nicht richtig deuten: „Das Blecken der Zähne zum Beispiel gilt unter Hunden eigentlich als Drohgebärde. Doch mittlerweile haben sich Haushunde an die Menschen angepasst, bei denen das Zähnezeigen – also das Lächeln – ein Begrüßungssignal ist. Wenn ein Hund Menschen die Zähne zeigt, ist das freundlich gemeint: Der Hund hat in der Gesellschaft der Menschen das Lächeln gelernt.“ Auch der Verhaltensforscher Konrad Lorenz will beim gemeinsamen Spielen mit seinem Hund ein Grinsen „fast von Ohr zu Ohr“ ausgemacht haben.
.
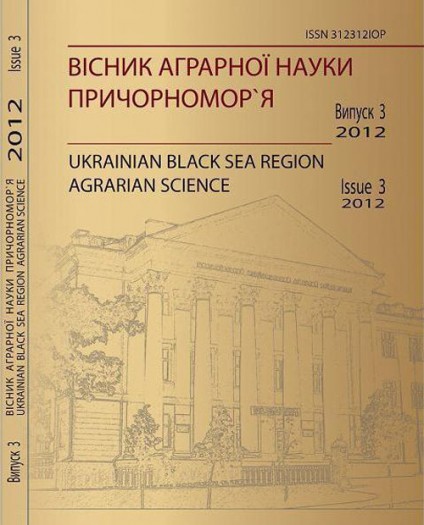
.
Das Tier im Sozialismus
.
– hatte anscheinend nichts zu lachen. „Tiere unter der SED-Diktatur“ lautete – verkürzt – eine Tagung in der TU. Da haben sie wieder eine neue Opfergruppe in der DDR entdeckt, höhnte die Junge Welt. Und hatte nicht einmal Unrecht, allerdings erforschen die Veranstalter – der interdisziplinäre „Arbeitskreis für Human-Animal-Studies ‚Chimaira'“ – ausschließlich die (Opfergruppe) Tiere, denen sie nun eben auch in dem abgeschlossenen Forschungsgebiet DDR nachgingen. Warum nicht gleich „Das Tier im Sozialismus,“ dachte ich. Für die Fortschrittler Marx, Engels, Lenin usw. waren die Nutztiere allesamt nur Mittel – zum Sozialismus. Dementsprechend „effektiv“ mußte man mit diesem Lebensmittel umgehen. Und so war es dann auch. Auf dem Höhepunkt gab es Großviehanlagen, die 200.000 Schweine mästeten, oder welche mit 40.000 Rindern und Milchviebetriebe mit 2000 Kühen (diese gehört heute übrigens einem Westler, der sie auf 2600 Kühe erweiterte!).
.
Der vielbeschäftigte Tierarzt einer LPG bei Potsdam mußte statt von geborenen von „produzierten“ Kälbern sprechen, und von jedem Behandlungsnachweis eine Kopie an das MfS schicken. Er vertrat nach der Wende, als er das „einfach“ nicht mehr tat, die These, dass die Stasi sich als oberste Tierschützer besonders viele Gedanken über das Wohl und Wehe der Tiere in der DDR gemacht hätte. Wenn auch nicht aus Tierliebe. Die Tierliebe gab es im Sozialismus quasi erst nach Feierabend, sei es in der kleinen privaten Landwirtschaft, die man ihnen als „Genossenschaftsbauern“ gelassen hatte, sei es als Aquarianer oder Hobbyornithologe im Verein. Letztere, so erfuhr ich in einem der (filmischen) Referate, hatten sich nach Vogelarten aufgeteilt, einer kümmerte sich z.B. um die Großtrappen. Er erzählte: Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft ab den Siebzigerjahren und dem vermehrten Einsatz von giftigen Chemikalien auf den Feldern sei die Großtrappenpopulation ständig zurückgegangen. Einige wurden republikflüchtig, drei flogen im Winter nach Frankreich und blieben dort. Der letzte im Großraum Leipzig starb 1994.
.
In allen Vorträgen, Filmen und Diskussionen ging es um „das reale Tier“ (das nur allzu oft von der Statistik verdeckt wird). Oder noch schlimmer – wie es „unser“ Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft auf einem Plakat verspricht, das man an die Wand des Tagungsraumes projizierte: „Den Tieren muß es am Ende der Legislaturperiode besser gehen als heute.“
.
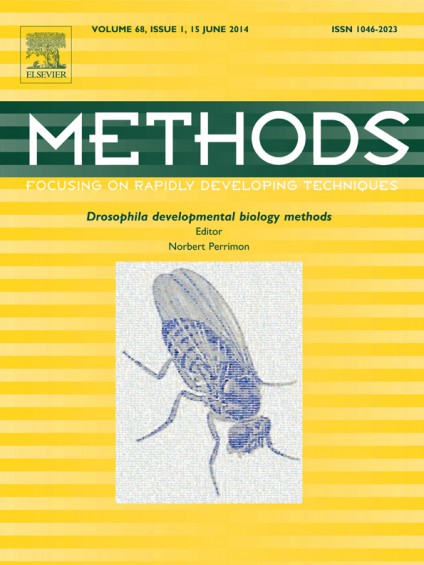
.
Zwei Referentinnen führten aus, dass sich mit der Industrialisierung ab den Achtzigerjahren die Landwirtschaft von den jahrhundertelang nachhaltig praktizierten Wirtschaftsweisen gelöst habe. Dies geschah auch im Westen. Was dort marktwirtschaftlich („Wachsen oder Weichen“) „geregelt“ wurde und wird, geschah im Osten von oben, angefangen mit der Bodenreform und der anschließenden Kollektivierung. Letzere bewirkte bei den Tieren: chronischen Futtermangel (als Ersatz wurden u.a. Brauereiabfälle verfüttert, was jedoch mitunter bei den Rindern zur Alkoholabhängigkeit führte), schlechte Unterbringung, Seuchenausbrüche, Vernachlässigung (man bekümmerte sich lieber um sein Privatvieh). Die Folgen waren „Versorgungskrisen“ – denen man mit der Industrialisierung beikommen wollte. Dabei stand man wie bei der Bildung immer größerer Industriekombinate im Wettbewerb mit der BRD. Zudem ging es der Partei um eine „Angleichung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land.“
.
Das (einzel-)“bäuerliche Bewußtsein“ wurde dabei zuerst bekämpft, als es dann in den „Kolchosen“ jedoch allzu akkordarbeiterlich gedieh, auf Kosten der Tiere und Äcker, versuchte man wieder gegenzusteuern. Auch wollte man die unselige Trennung der „Tier-“ und „Pflanzenproduktion“ rückgängig machen, aber dann kam die Wende. Der sozialistische Fortschritt (so hieß auch das Kombinat für Landmaschinenbau) zeigte sich in den LPGen u.a. in Form von Betonspaltenböden, Fütterungstechniken und Karusselmelkständen, was gleichzeitig eine zunehmende Arbeitsteilung hervorrief. Das dabei immer mehr „gestörte Verhältnis zum Tier ist jedoch nicht DDRspezifisch“. Wohl aber der ständig gestiegene Fleischkonsum dort, der schließlich der weltweit höchste war. Besonders war auch, dass die industrialisierte Großlandwirtschaft ideologisch propagiert wurde – bis in die Kinderbücher hinein, in der BRD wird die Landwirtschaft stattdessen seit eh und je mit idyllischen Bauernhöfen beworben.
.

.
Tier und Staat
.
Das Wappentier der USA ist der Weißkopfseeadler, Deutschland hat einen schwarzen Adler und Polen einen weißen im Wappen. Russland hat – ähnlich wie Serbien und Österreich – sogar einen „Doppeladler“ im Wappen. Er stammt vom Adler der byzantinischen Kaiser, in dessen Tradition sich die Moskauer Großfürsten und die späteren russischen Zaren stellten. Mit der Revolution wurde er abgeschafft, nach Abschaffung der Revolution 1993 aber wieder eingeführt.
.
In Weissrussland wählte man kürzlich den Biber als Wappentier, er ist in den riesigen Pripjetsümpfen nicht selten und inzwischen, da geschützt, fast schon zu einer Plage geworden, was man vom Adler nicht sagen kann: Bei den Nazis wurde das Erschießen eines Adlers mit dem Tode bestraft, in Nordamerika wurde und wird er dagegen trotz Verbot derart bejagt, dass es ihn in nennenswerter Zahl fast nur noch in Kanada gibt. Dort hat man sich im übrigen 1965 für ein Zuckerahornblatt als staatliches Symbol entschieden. Damals wurde dieses Blatt noch gelegentlich mit dem von Marihuanapflanzen verwechselt, das man in jenen Jahren zu einem Symbol der „Legalize Cannabis“-Bewegung machte. Als einige Aktivisten damit vor dem Amtssitz des kalifornischen Gouverneurs Ronald Reagan demonstrierten, fragte dieser seine Mitarbeiter: „What are those fucking Canadians doing here?“ Um derlei Verwechslungen zu vermeiden, änderten die Cannabislegalisierer ihr fünffingriges, einem Ahornblatt ähnelndes Symbol in ein siebenfingriges.
.
Die ebenfalls zum Britischen Imperium gehörenden Neuseeländer wählten in den Sechzigerjahren ihren vom Aussterben bedrohten kleinen Laufvogel Kiwi als Nationalsymbol, so heißt dort auch eine bepelzte neuseeländische Beerenfrucht, die massenhaft exportiert wird.
.

.
Die skandinavischen Länder – Dänemark, Faröer, Aland-Inseln, Finnland, Island, Norwegen und Schweden – haben vor einigen Jahren die Hummel als Hauptelement für ihr gemeinsames Wappen gewählt. Das hatte weniger mit ihrer Landwirtschaft zu tun, als damit, wie ihre südlicheren Nachbarn sie sehen: eine erfolgreiche Wirtschaft, die auf hohen Steuern und hohen Sozialausgaben basiert, so dass es im Ideal weder Reiche noch Arme gibt. Einige Biologen haben behauptet, gemäß ihres Gewichts und ihrer Flügelgröße dürfte die Hummel eigentlich gar nicht so gut fliegen können wie sie es tut. Und einige US-Ökonomen behaupteten, die nordischen Staaten dürften mit ihrer sehr sozialen Wirtschaftspolitik eigentlich gar nicht so erfolgreich sein wie sie es sind. Dies hat die skandinavischen Staaten bewogen, die Hummel als ihr gemeinsames Wappentier zu wählen. Als sie dann aber auch vom Neoliberalismus erfaßt wurden, nahmen sie wieder Abstand davon, zumal sich aus der weltweiten Deregulierung dann in Island fast ein Zusammenbruch der Wirtschaft entwickelte.
.
Mit der fleißigen Biene hatten die Wappengestalter weniger Probleme: So prägten z.B. schon antike Stadtstaaten auf ihren Wappen und Münzen gerne Bienen, ebenso dann die Freimaurer. Die Mormonen und die Frankfurter Stadtsparkasse wählten als Zeichen einen Bienenkorb, die Mittenwalder Sparkasse eine Biene, die eine Reichsmark heimbringt. Napoleon ließ in vielen städtischen Wappen die königliche Lilie durch Bienen ersetzen, Wikipedia erwähnt u.a. Mainz und Bremen. Eine Schülergruppe des Kurpfalz-Internats ergänzte auf ihrer Internetseite: „Bei der Biene hatte Napoleon zuerst Bedenken, weil eine Königin an der Spitze des Bienenvolkes steht, sie aber dann doch genommen…Unter den vorgeschlagenen Tieren nahmen die Bienen eine hervorragende Stelle ein, denn nach dem Erzkanzler des Kaisers stehen sie als Sinnbild für eine Republik, die einen Chef hat. Zudem hatten die Kirchenväter bereits ebenfalls in der Bienengesellschaft ein für die Menschen perfektes soziales Modell gesehen.“ Augustinus, der selber Imker war, hielt die Bienen sogar für auserwählt: „Sie kennen keine Männer, die Blume ist ihr Bräutigam.“ Die Republik Frankreich hat heute einen Hahn in ihrem Wappen und Hahnenkämme gelten dort als Delikatesse.
.
Weltweit sind neben Adlern die Löwen – einzeln oder gleich mehrfach – das beliebteste Staatssymbol: in Indien, Singapur, Burma, Sri Lanka, Kenia, Malawi, Äthiopien, Luxemburg, Belgien, Bayern, Rumänien, Tadschikistan, Georgien und Armenien beispielsweise. Somalia wählte stattdessen zwei Leoparden, Botswana zwei Zebras, Zimbabwe ebenso wie Südafrika zwei Antilopen, Nigeria zwei Schimmel und das „britische Territorium im indischen Ozean“ zwei Schildkröten. Die Kaimann-Inseln entschieden sich für eine Schildkröte und einen Löwen, Chile für einen Rehbock und einen Kondor, Hawaii für eine Gans, die Elfenbeinküste für einen Elefanten, der libanesische Staat für eine Zeder im Wappen und Saudi-Arabien für eine Palme.
.
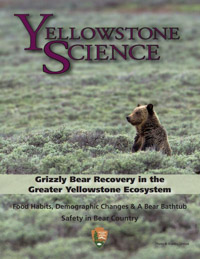
.
Bei Russland fällt einem als Quasi-Wappentier meist der Braunbär ein und bei China der Pandabär. Seltsam, dass man ausgerechnet zwei kommunistische Großmächte mit diesen gemütlichen und eher harmlosen Tieren assoziiert. Der Pandabär ist zudem ein ausgesprochener Vegetarier. Der chinesische Künstler An-Chi Cheng zeigt neulich in Berlin mit einer diesem Bär gewidmeten Arbeit, dass der Panda in China zwar kein Wappentier, aber ein Staatstier ist: Neben einem ausgestopften Pandabär unter Glas hängte er eine Graphik: Sie zeigte vom ersten bis zum letzten von der chinesischen Regierung verschenkten Pandabär, was sie in den Jahren ihrer „Panda-Diplomatie“, die 1982 aufgrund weltweiter Proteste von Tierschützern beendet wurde, damit alles erreicht hat – an Verträgen, Handelsbeziehungen usw.. Nur einmal verursachte ein solcher Regierungs-Panda Ärger: Als man 1980 Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Pandabärin namens „Tjen Tjen“ (Himmelchen) und einen namens Bao Bao (Schätzchen) schenkte, und der die beiden an den Westberliner Zoo weiterverschenkte, woraufhin Moskau intervenierte, weil Westberlin nicht Teil der BRD war. Der ausgestopfte weibliche Pandabär ist das, was von „Tjen Tjen“ übrig blieb: Sie starb 1984 an einer Virusinfektion. Man vermutete damals im antikommunistisch verseuchten Westberlin, dass eine B-Waffe des KGB dahinter steckte. Die Journalistin Prisca Straub schrieb später Bao Baos Exilbiographie, darin heißt es: „Sein Lebensstil war so anspruchsvoll, wie es sich für einen echten Star gehört; seine Mahlzeiten so teuer, dass exquisite Feinschmecker neben ihm bescheiden wirken. Sein Sexleben füllte Jahrzehnte lang die Klatschspalten der Boulevardblätter, und der Zustand seines Geschlechtsapparats war Gegenstand verwickelter diplomatischer Verhandlungen: Als der große chinesische Panda Bao Bao am 5. November 1980 im Zoologischen Garten in Berlin eintraf, erwartete ihn die halbe Weltpresse.“
.
Die beiden Pandabären bekamen ein geheiztes Glasgehege und Spezialkost: Unmengen frischen Bambus, der alle paar Wochen für sie eingeflogen wurde. Außerdem waren die beiden Tiere hochversichert. Die Westberliner Linke meinte, für das Geld sollte man lieber Kitas bauen. Aus Protest besetzten sie die Flamingo-Wiese im Zoo. Es war zu befürchten, dass die chinesische „Panda-Diplomatie“ diesmal mehr Ärger als „Freundschaft“ bewirkte. Hinzu kam noch, dass die beiden Bären partout keinen Nachwuchs zeugen wollten. Dann biß Bao Bao auch noch einem Fotografen einen Finger ab – was dem Zoo teuer zu stehen kam, und Tjen Tjen starb. Aus Peking kam ein neuer weiblicher Panda: Yan Yan – als Leihgabe. Doch wie sich bald zeigte, hatte Yan Yan, „die Schöne“, Zyklusprobleme.
.

.
Eine Hormontherapie bewirkte laut Prisca Straub lediglich, dass sie mit Bambusstöckchen zu masturbieren begann. In Paarungsstimmung kam sie aber nicht. Man beschallte die Tiere mit Brunftgeräuschen und belästigte sie mit einschlägigen Filmchen – Panda-Pornos. Yan Yan blieb paarungsunwillig. Alle Versuche, das Panda-Weibchen künstlich zu schwängern, schlugen fehl. Schließlich wurde ein Besamungsexperte aus China eingeflogen. Aber auch er konnte nicht helfen. Stattdessen wurden Versuche unternommen, Bao Bao mit weiblichen Pandabären aus anderen Zoos zu paaren. 1991 wurde er an den Londoner Zoo ausgeliehen, um die dort gerade angeschaffte Pandabärin Ming Ming (Lichtlein) zu schwängern. Auch das klappte nicht: „Das Pandaweibchen interessierte sich nicht für Bao Bao, der ihr ein Ohr abbiss,“ heißt es auf Wikipedia.
.
Wenn es in Westberlin und London geklappt hätte und die Panda-Weibchen Junge bekommen hätten, wären diese chinesisches Staatseigentum gewesen – so war es vereinbart worden. Ihr Wert wurde im übrigen auf 1 Million Euro geschätzt. 2007 starb Yan Yan an einer Darmverstopfung. Auf Anordnung des chinesischen Forstministerium sollte die Leiche nach China überführt werden und nicht als Tierpräparat in Berlin verbleiben. Sie kam desungeachtet erst einmal ins Naturkundemuseum. Dann wurden alle Politiker, die nach China reisten, angehalten, eine neue Pandabärin von der chinesischen Regierung zu erbitten. Bao Bao blieb jedoch allein in seinem Gehege, wo er von 1980 bis 2009 vom Tierpfleger Lutz Störmer betreut wurde, der ihn laut Wikipedia als „zuverlässigen Kumpel ohne hinterlistige Gedanken“ beschrieb. 2012 starb Bao Bao – mit 34 Jahren. Seitdem titelt die Hauptstadtpresse alle paar Monate: „Berlin braucht wieder einen Panda!“ Aber die chinesische Regierung hat ihre Panda-Diplomatie längst beendet und bleibt hart.P.S.: 2015 meldete der RBB, die chinesischen Kommunisten hätten sich endlich erweichen lassen – „Berlin wird bald wieder Panda-Stadt“.
.

.
Zwei weitere politische Zootiere:
.
1.“Der Tod des einäugigen Löwen Marjan im Zoo der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Tierfreunde in aller Welt erschüttert. Er hatte die Invasion der Sowjetunion, den Bürgerkrieg, die Taliban und zuletzt die US-Bombenangriffe überlebt. Das Tier kam 1974 mit Hilfe des Kölner Zoos nach Kabul. Als vor einiger Zeit ein Taliban-Kämpfer in den Käfig kletterte, um seine Tapferkeit zu beweisen, fraß Marjan ihn. Der Bruder des Taliban warf daraufhin eine Granate auf ihn, weshalb er am Ende halb blind und lahm sein Dasein fristete. Marjan starb am Montag an Nierenversagen.“ (Der Spiegel)
.
2. „Zu seiner ausgestopften Giraffe auf der documenta , erklärte der österreichische Künstler Peter Friedl, dass sie in Kalkilia, dem einzigen palästinensischen Zoo, tot umgefallen sei, als die israelische Armee dort ein Versteck der Hamas angriff.“ (FAZ)
.
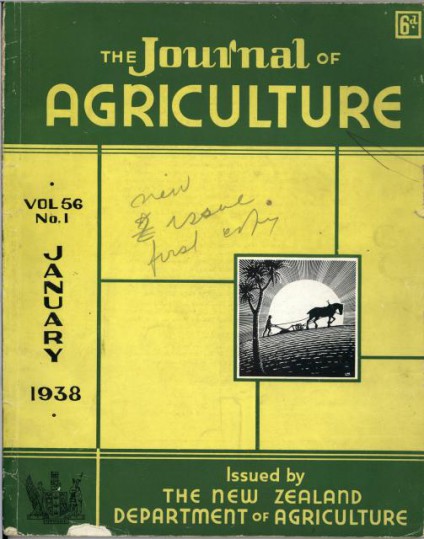
.
DDR-Landwirtschaft
.
Werdegang und Gedanken eines brandenburgischen LPG-Vorsitzenden, dem der „Übergang“ seiner Großlandwirtschaft vom sozialistischen Volkseigentum zum kapitalistischen Privateigentum quasi wider Willen gut gelang.
.
Er vermisse die Visionen im jetzigen Gesellschaftssystem, sagte er 1998. Und das sagte er jetzt wieder. Inzwischen ist er Rentner und wohnt mit seiner Frau, einer pensionierten Lehrerin, in einem 1976 gebauten Bungalow in Lenzen, wo er sich derzeit gedanklich mit Hummeln beschäftigt. Seine LPG „Friedrich Ludwig Jahn“ in Lanz heißt nun auch nicht mehr „GWL: Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH,“ sondern hat sich als „Rinderzucht Lanz-Lenzen AG“ in mehrere GmbHs untergliedert.
.

.
Seine mit der Wende umgewandelte „Kolchose“ wurde dadurch „berühmt“, dass er es damals schaffte, sämtliche Mitarbeiter, ausgenommen die Vorruheständler, weiterzubeschäftigen: 300 Leute insgesamt – fast 80 Prozent der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter der Großgemeinde Lenzen/Elbe in der Nordwestprignitz. Ihre „Agar Holding“ bewirtschaftete 4.700 Hektar – davon 52 Prozent in zwei Landschaftspflegebetrieben, 500 Hektar mit einem Rinderzuchtbetrieb und 1.024 Hektar mit einem Marktfruchtbetrieb. Über 2.000 Hektar wurden auf „Bioland“ umgestellt, dessen Produkte, u.a. Wurstwaren und Säfte, über die Marke „Biogarten“ vermarktet werden.
.
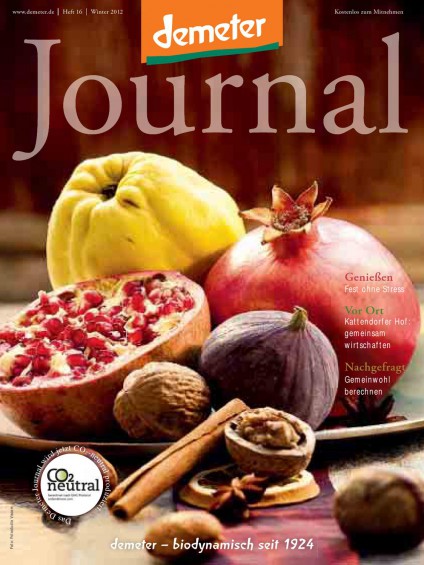
.
Die Westjournalisten, die sich nach der Wende für diesen Großbetrieb interessierten, suchten zunächst vornehmlich nach Dreckecken. Das änderte sich aber – spätestens ab 2000. Da besuchte Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Journalisten und Bodyguards das Unternehmen, nach einem Rundgang bestellte er aus der Gänsemast eine geschlachtete Weihnachtsgans. Kurz bevor die gesamte Gänseschar auf Wunsch eines Großabnehmers in einen Schlachthof bei Göttingen gefahren wurde, hatte ein Mitarbeiter im Kanzleramt mit Reportern aus der Märkischen Allgemeinen Zeitung und der Bild-Zeitung eine „Riesenidee“: Schröder sollte eine seiner Gänse zu Weihnachten quasi „begnadigen“ wie es ihm US-Präsident Clinton mit einem Truthahn zum Erntedankfest vorgemacht hatte. Der MAZ-Reporter markierte schon mal eine in Frage kommende Gans mit farbigem Bändchen. Als Schröder mit dem Plan einverstanden war, konnte Horst Möhring überredet werden, den Gänsepfleger, der schon auf der Autobahn war, über Handy anzuweisen, die markierte Gans vom Schlachthof wieder mit zurück zu bringen: lebend. Sie wurde dann „Doretta“ getauft und zu einer „Story“ ausgebaut, die sich bis zu ihrem Tod 2009 im „Altenheim ‚Haus Schönow’“ infolge eines Lebertumors in den Medien hielt. Schon zu Dorettas erstem Weihnachtsfest reisten sieben Fernsehteams an. Die taz sprach in diesem Zusammenhang vom „kleinen Biohof von Horst Möhring“. Dieser hatte damals für sein Wirtschaften im Elbauengebiet gerade einen „Naturschutzpreis“ bekommen und auch sonst bereits viele Ehren und Ämter von diversen Verbänden angetragen bekommen.
.
Er erzählt sein Leben als Teilnehmer an einem großen Agrarprojekt, der hinter diesem Werk gerne zurücktritt. Horst Möhring wurde 1939 geboren. Als Vollwaise kam er auf den Hof seiner Großeltern in Lenzen. 1955 begann er eine Lehre als landwirtschaftlicher Gehilfe. 1960 bestand er in einer Lehreinrichtung in Lenzen seine Meisterprüfung. Im selben Jahr fing er in der dortigen LPG an: „Ich habe gemolken und die Bullen gefüttert.“ Der Betrieb delegierte ihn schon bald auf die Arbeiter- und Bauern-Fakultät, wo er das Abitur machte. Danach studierte er Landwirtschaft in Rostock. 1966 heiratete er, seine Frau Christel, die als Grundschullehrerin tätig war, sie bekamen zwei Kinder, eins adoptierten sie noch dazu. Im selben Jahr schloß er sein Studium mit einem Diplom ab, danach arbeitete er als Leiter der Tierproduktion in der 1000-Hektar-LPG von Mödlich bei Lenzen. 1968 faßte man diese sowie fünf weitere in der Nachbarschaft zu einer LPG – „Lenzener Wische“ – zusammen. Gleichzeitig wurde dort investiert, u.a. Teile der Elbe-Überflutungsflächen trockengelegt – zur Stabilisierung der Erträge. Die DDR mußte damals Futtermittel importieren, der Westen reagierte darauf zwei Mal mit einem Getreide-Embargo, es ging bei dem Meliorationsprojekt mithin darum, eine Unabhängigkeit von Getreideeinfuhren zu erreichen. 1970 bekam die LPG Mittel zur Errichtung einer Jungvieh-Anlage für 5500 Tiere – jeweils ein Stall für 1000 Rinder. 1972 wurde erneut eine Großmelioration durchgeführt: Die Mündung der Löcknitz verlegte man um 12 Kilometer, wodurch eine Rücküberflutung aus der Elbe verhindert und 10.000 Hektar Ackerfläche geschaffen wurden. Horst Möhring bekam einen Infarkt und mußte sich erst einmal schonen.
.
Im selben Jahr kam es zu einer Abtrennung der Pflanzen- von der Tierproduktion in der DDR, dafür wurden in Möhrings Region „kooperative Einrichtungen“ zwischen drei Groß-LPG geschaffen. Außerdem sollten sie den Mittelstand in ihrer Region ersetzen, indem sie Bau-, Metall- und andere Betriebe in den LPG aufbauten. Trotz seiner Parteilosigkeit wurde Horst Möhring dann in den Rat des Kreises nach Ludwigslust aufgenommen, wo er die nächsten viereinhalt Jahre für die Tierproduktion im ganzen Kreis verantwortlich war. Damals wurde die Bewirtschaftung der Tierbestände neu überdacht: So sollte u.a. die Zucht und Mast der Schweine aufeinander abgestimmt werden, damit ein Kreislauf im eigenen Landkreis entsteht – wieviel Mastschweine mußten z.B. Am 1.Mai in welchem Stall stehen? Dabei ging es auch darum, die eigene Arbeit von jedem zu qualifizieren. „Damals war ich täglich im Kreis unterwegs – mit Dienstwagen. Es kam die Vision auf: In jeder Kooperation muß eine Schafherde aufgebaut werden.“ Das wurde auch umgesetzt. Dann machten die Großherden der Rinder Probleme: „Wir hatten 15.000 Rinder, es gab eine Zuchtgemeinschaft mit dem Kreis Gadebusch, von denen wir Färsen bezogen. Die Probleme in der Milchpropduktion waren die Euterkrankheiten und die Milchleistung. Dazu mußten Flachsilos für die Silageherstellung geschaffen werden, bei der Silagefütterung stellten sich Probleme mit der Milchqualität ein. Wir produzierten ja Babynahrung, nach der Wende hatten wir einen Direktvertrag mit Alete/Nestle.“ Heute gibt es – z.B. in Neuruppin – Firmen, die Silageverbesserungsmittel anbieten: u.a. Säurestabilisatoren zur Geschmacksverbesserung und Mixturen mit Milchsäurebakterien um den Gärvorgang zu optimieren.
.

.
1974 qualifizierte sich Horst Möhring als Fachingenieur für Rinderproduktion. 1983 absolvierte er noch ein Zusatzstudium in Hochschulpädagogik für Tierzuchtleiter. Er kam aber nicht dazu, an einer Uni zu lehren, denn im selben Jahr wurde er Vorsitzender der LPG „’Friedrich Ludwig Jahn‘ Lanz“- und das blieb er bis zur Wende. Sie versorgte 2000 Milchkühe, dazu Kälber und Färsen, 2000 Schafe, 70 Pferde und 800 Schweine. Als erstes wurde unter seiner Leitung die Milchviehanlage modernisiert, und in die Grünlandbewirtschaftung investiert. Außerdem eine betreute Brigade für Leute mit Suchtproblemen geschaffen. Dann wurden mit den Handwerkern der LPG zwei Kinderkrippen und zwei Gaststätten errichtet sowie ein Wohnheim für die damals 150 Landwirtschafts-Lehrlinge gebaut. Die letzten 70 Auszubildenden wurden nach der Wende in den Westen delegiert, um dort ihren Abschluß zu machen. Horst Möhrings Sohn machte seinen Meister in Kiel. Jeweils zwei LPG hatten damals zwei koperativen Einrichtungen, diese wurden aufgelöst.
.
Horst Möhring bekam mehrere Jobangebote – u.a. als Vorsitzender in einem Herdbuchverband im Westen und im Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern: „Wir blieben aber als Leitung zusammen und wandelten die LPG um“ – gemäß dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz, das die BRD der DDR verordnet hatte. Dabei behielten wir alle Mitarbeiter, 580 Beschäftigte kamen auf geförderte Arbeitsplätze. Ich war damals Kreistagsabgeordneter und mithilfe eines Landrats in Nordrhein-Westfalen holten wir im August 1990 zwei Ausbildungsfirmen ran. Sie boten u.a. eine Spezialschweißer-Ausbildung an und wir stellten die Räumlichkeiten. Sie organisierten außerdem eine Berufsqualifizierung – als Altenpfleger, Krankenpfleger und Buchalter. Über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und andere Förderungen wurden Hecken gepflanzt, Müllhaufen abgetragen, ein Pflanzgarten u.a. für Farbpflanzen angelegt und alte Kartoffelsorten weitergezüchtet. Es ging darum, durch geförderte Arbeitsverhältnisse ältere Kollegen bis zum Vorruhestand zu bringen. Man kann auch sagen, der soziale Frieden auf dem Dorf blieb erhalten, weil wir weiter machten.“
.
Das Ehepaar Möhring hatte keine Verwandte drüben, aber „Westkontakt“: In den Siebzigerjahren war ihnen eines Tages ein Luftballon zugeflogen, an dem ein Brief aus Hildesheim hing – von einem 12jährigen Mädchen. Daraus entwickelte sich eine Brieffreundschaft zwischen den beiden Familien, später besuchten sie sich auch gegenseitig.
.
Die LPG hatte Beziehungen zum „Institut für Rinderproduktion mit dem Schwerpunkt Technologie“ in Iden (Sachsen-Anhalt). „Zusammen mit denen, einem Leipziger Wissenschaftler und dem Institut für Agrarforschung an der Rostocker Uni, haben wir an der Entwicklung eines Melkroboters gearbeitet. Außerdem wollten wir aus Rindergülle Papier herstellen. Es gelang uns, Blumentöpfe, d.h. Preßlinge zum Auspflanzen herzustellen. Das wurde nach der Wende auch wieder aufgenommen. Dann gab es drei Millionen DM für ein biologisches Forschungsprojekt zur Rückdeichung, um Ökologie und Landwirtschaft nicht länger gegeneinander zu stellen. Daran beteiligt war das Leibniz-Institut für Nutztierforschung in Dummerstorf und die Universitäten in Leipzig, Berlin und Lüneburg. Es ging dabei um 480 Hektar Überflutungsfläche. Dadurch verschwinden drei Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, dafür entstehen aber etliche mehr im Tourismus. Auf der Fläche werden heute Wildpferdartige gehalten, wissenschaftlich begleitet von einem Schweizer Zoologen. Wenn man als Landwirt Wirtschaftfläche abgibt, will man genau wissen, was damit passiert: Ist das, was man als Leiter macht, auch in der nächsten Generation noch tragfähig?“
.

.
„Ich fühlte mich verantwortlich für den Übergang und hätte gerne gesehen, dass der soziale Bereich weitergeführt würde. Er wurde in Vereinsform übertragen. Die Nachfolger machen nur noch den landwirtschaftlichen Bereich. Sie leisten da gute Arbeit. Und die Zeit ist nun mal so. Wir waren geprägt, Verantwortung für die Menschen und die Region zu tragen. Das ist heute nicht mehr unbedingt gewollt oder möglich. Bis auf die Ausgeschiedenen ist der alte Stab noch da. Es ist aber jetzt eine andere Generation – die ohne Ismen auskommt. Es geht alles in Richtung Fremdbewirtschaftung. Die Betriebe gehören zunehmend Investitionsgesellschaften. Mein Sohn arbeitet auf einem Gut, dass einem Großunternehmer, Fiege, gehört. Im landwirtschaftlichen Buchführungsverband Kiel habe ich erfahren, dass 80% der Höfe in Deutschland den Banken gehören. In Mecklenburg sind 38% der Landwirtschaftsfläche schon im Besitz von Industriellen und holländischen Agrarunternehmern. Der Boden wird als Investition gekauft. In der Landwirtschaft geht die Verbindung zum Boden verloren. Mein Großvater mußte den Boden noch riechen, bevor er ihn bearbeitete, heute wird er reduziert auf eine Nutzung, die sich kapitalisiert. Die derzeitige Rückbesinnung auf ökologische Kreisläufe z.B. ist gut, wird aber den Kern der Landwirtschaft nicht erreichen. Ich stehe für Naturschutz, bin mit dem Leiter des Biosphärenreservats Mittelelbe hier befreundet und war im Vorstand von „Biopark“, der größten Anbauorganisation in Mecklenburg und Brandenburg.“
.
„Es gibt so Aufwach-Momente. Die Fläche konzentriert sich auf immer weniger Landwirte. Wir hatten 2000 Hammel auf der Weide. Zur Wollverfeinerung bekamen wir Merinoschafe aus Neuseeland, die wir drei Jahre quarantänisieren mußten. In der Wende besuchte uns der neuseeländische Züchter. Anschließend lud er uns zu sich nach Neuseeland ein. Ich sah, dass wir in der DDR bei der Zucht um eine Meile voraus waren. Er besaß 14.000 Mutterschafe mit Nachwuchs, die wurden von seiner Schwiegertochter bewirtschaftet, der er seinen Betrieb übergeben hatte. Sie sortierte 80 Zuchtböcke aus, die der Alte dann noch einmal auf 40 reduzierte.“
.
„Mit einer Agrarwissenschaftlerin des Leibniz-Instituts war ich in Argentinien. Dort sahen wir in einer Einkaufszone, wie obdachlose Kinder, die bettelten, eingefangen und auf Lastwagen abtransportiert wurden, am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass man 18 Kinderleichen am Stadtrand von Buenos Aires gefunden hatte. Auf dem Land bekamen wir mit, wie die Pampa umgepflügt wurde: die Humusschicht verschwand und mit Kunstdünger wurde Soja angebaut. In Uruguay erfuhren wir, dass große Konzerne, Esso, Siemens, etc., Prämien zahlen für die Rodung des Urwalds, der Staat fördert die Arbeitsplätze dafür. Es werden schnell wachsende Eukalyptus-Bäume angepflanzt – zur Holzgewinnung.“
.

.
„Ich habe Angst vor der Entwicklung der deutschen Landwirtschaft – dass sie eine reine Kapitalanleger-Sache wird und dadurch die Gesundheit des Bodens aufs Spiel gesetzt wird. Im Moment ist die Landwirtschaft noch gut aufgestellt, außer Problemen mit den Besitzverhältnissen. Wir sind als Landwirte keine Einheit – in den Verbänden gibt es divergierende Interessen. Ich denke, bestimmte Grundeinheiten müssen volkseigen sein. Wenn der Wald und die landwirtschaftlichen Nutzflächen volkseigen würden, wäre ein anderer Umgang damit möglich. Damals bei den jährlichen Plansitzungen stand der Boden immer als erstes zur Debatte: die Düngemittelversorgung, der Einsatz von Pflanzenschutzmittel… Wichtig ist aber auch, genau hinzukucken wie es den Menschen, Kollegen, geht. Daraus erfolgte ja die Gründung der Fördergesellschaft, wobei wir mit einer dänischen Organisation kooperierten. Ich würde mir wünschen, dass man wieder eine gesellschaftliche Vision findet.“ Und die müßte auch die Landwirtschaft umfassen, die Pflanzen- und Tierproduktion…“
.
„2000 lag der Milchpreis bei 22-24 Cent pro Liter, heute ist er auf 40 Cent gestiegen. Wenn in der EU 2015 die Milchquote wegfällt, wird das nur punktuell etwas verändern. Es werden zwar noch mehr Milchbauern aufgeben, aber die Zahl der Milchkühe nicht abnehmen, im Gegenteil. Und die Tiere werden weiter vom Grünland verschwinden, d.h. ganzjährig in Laufställen gehalten werden. Ich war im Vorstand der ‚Erzeugergemeinschaft Prignitzer Weiderind‘, zu der 16 Betriebe gehörten. Wir hatten einen Vereinbarungspreis für Fleisch mit Edeka und Alete. Unsere Wirtschaftsweise hat dann auch Auswirkungen auf den Tourismus gehabt: Uns besuchten 88 Reisebusse pro Jahr, wir haben sie verkostet und sie kauften im Hofladen ein. 2000 hatten wir 11 Stände aufgebaut, die die verschiedenen Facetten unseres Betriebes zeigten. Da besuchte uns Bundeskanzler Schröder, der dann eine Weihnachtsgans kaufen wollte, woraus diese endlose Geschichte mit der begnadigten Gans „Doretta“ entstand, die ein Ganter war – wie alle unsere Schlachtgänse.“
.
„ Erwähnt werden muß noch der Filzverein, deren Mitglieder ein internationales Filzsymposium organisierten, und der Naturlehrgarten, dessen Blumen einigen Floristinnen zur Herstellung von direkt vermarkteten „floristischen Objekten“ dienen, vom Leiter des Gartens wurden die Blumen auch noch zu Ölen und Kräuterlikören weiterverarbeitet. Außerdem haben 11 angehende Agrarwissenschaftler, u.a. aus Ghana und Syrien, hier auf dem Hof promoviert. Wir sind seit fast 50 Jahren mit Ausstattung und Organisation an diversen Forschungsprojekten beteiligt. Nach der Wende haben wir selbst eine wissenschaftliche Tagungsreihe organisiert – die ‚Lenzener Gespräche‘, deren Ergebnisse auch publiziert wurden. Und mit dem Leiter des Brandenburger Bauernverbands haben wir drei Jahre lang öffentliche Diskussionen veranstaltet zu der Frage ‚Sterben die Dörfer der Prignitz?‘ Noch zu DDR-Zeiten wollten wir einen Ökohandel mit der Ukraine aufbauen und haben eine begrenzte Kooperation mit denen vereinbart. 1990 habe ich sie zusammen mit einem Holländer in Charkow besucht. Wir waren denen um 20 Jahre voraus, nach 1991 wanderten sie in die Schweiz aus. Auch ich habe mich, als ich in Rente ging, von allen Posten zurückgezogen, heute bin ich nur noch Ehrenvorsitzender des Schafzuchtverbands. Vor allem habe ich mich für den Übergang verantwortlich gefühlt.“
.

.
Morchelmörder
.
„Pilze sind immer schon sehr nachdenkliche Leute,“ meinte ein Kunsthistoriker auf einer Konferenz der Akademien der Wissenschaften und der Künste in Potsdam, auf der es um Schleimpilze – als Objekt des ‚Interesses von Kunst und Wissenschaft ging. Der Pilzsammler Karl Berchthold hätte eher Morcheln gewählt: „Morcheln sind die schlausten Pilze,“ behauptet er auf seiner Morchel-Internetseite. Man möchte es aber doch genauer wissen. Zum Glück erschien soeben der reich bebilderte Ratgeberband „Faszination Morchel“ des passionierten Schweizer „Morcheljägers“ Heinz Gerber.
.
Zwar gehören die Morcheln zu den Pilzen (die man heute nicht mehr zu den Pflanzen zählt), aber auch Heinz Gerber hält die Morcheln für etwas „Besonderes“. Obwohl die Morchellalogie noch am Anfang steht, hat sie doch schon eine eigene „Fachliteratur“ hervorgebracht. Heinz Gerber macht sich in seinem Morchelbuch anheischig, die eine oder andere Forschungserkenntnis über sie zu kritisieren. So z.B. bei der „Halbfreien Morchel“, die „oft als unergiebig und weniger wertvoll bezeichnet wird.“ Gerber besteht darauf: „Sie braucht einen Vergleich bezüglich Qualität mit ihren Verwandten ganz und gar nicht zu scheuen.“
.
Jeder kennt das, selbst die teuersten Pilzbücher erweisen sich im Revier als wenig hilfreich, weil die Pilze „in Wirklichkeit“ ganz unterschiedlich aussehen. Noch weiter gehen die Morcheln – laut Gerber: „Die Morchel versteht es wie kaum ein anderer Pilz, sich unseren Blicken und unserem Zugriff zu entziehen. Sie ist eine Tarnkünstlerin ersten Ranges und oft scheint es, als besitze sie Mimikry-Fähigkeiten.“ An anderer Stelle heißt es, dass sie sich sogar (weg)“ducken“ kann. Was also tun?
.
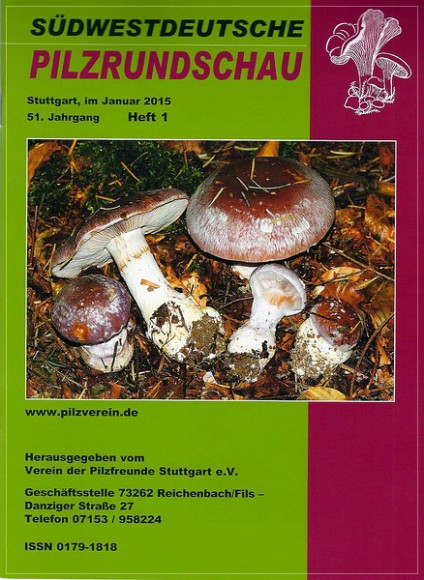
.
Man muß seine Sinne konsequent auf Morcheln trainieren. Der Autor hat dazu die inzwischen umstrittene Reflextheorie von Iwan Pawlow für die Morchelsucher nutzbar gemacht. Der „Neuling“ sollte erst einmal inne halten, wenn er einen Standort gefunden hat, und die natürliche Umgebung der Morchel in Ruhe aufnehmen: „So lassen sich Auge und Hirn auf die Morchel konditionieren, d.h. sobald das Auge eine Morchel oder mit fortschreitender Übung auch nur ein Fragment hiervon erblickt, wird ein Reiz ausgelöst und unser Hirn reagiert blitzschnell mit der Botschaft ‚Morchel‘.“
.
Damit diese Konditionierung nicht nachläßt, während der morchellosen Zeit (zwischen Juli und März), empfiehlt Gerber, sich ein „Morchel-Bildarchiv“ aufzubauen. „Des weiteren,“ schreibt er, „stimulieren meinen Sehsinn einige Morchel-Exponate in der Glasvirtrine neben dem Bürotisch“ (in seinem Morchelbuch findet der Anfänger einige Such-Photos zum Trainieren). Für die eigentliche „Morchelpirsch“ rät Gerber zu „robusten Wanderschuhen“ und „atmungsaktiver Bekleidung in dezenten Grau- und Grüntönen.“ Also nichts Grelles, wie es heute z.B. bei den Sneakers Mode ist.
.

.
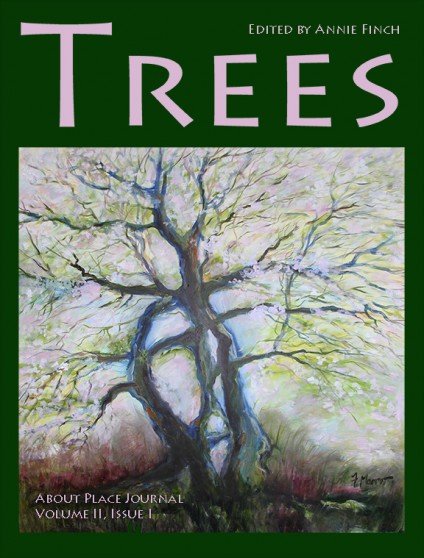
.
Ich vermutete sofort, bei solch einer auffallenden Kleidung verstecken sich die scheuen Morcheln sofort. Weit gefehlt, es geht Gerber, in dessen Revieren „oft Morchelsucher in (grell) farbigen Kleidern unterwegs sind“, darum, dass diese „Mörcheler“ leicht beobachtet werden können „und so ihre Fundstellen unfreiwillig verraten. Für den erfahrenen Mochelsucher gilt dagegen das Motto: ‚Sehen, aber nicht gesehen werden‘.“
.
Um das Wissen über die Morchel-Vorkommen zu vermehren (manche trifft man z.B. gerne unter Eschen an), empfiehlt Gerber das Führen eines Tagebuchs – um Fundstellen und -zeiten zu notieren und eine „Saisonplanung“ vorzunehmen. Wem das übertrieben vorkommt, der muß sich sagen lassen: „Die Morschelpirsch hat wenig gemein mit der Pilzsuche im Sommer und Herbst, ausser dass das Zielobjekt auch zu Pilzfamilie gehört.“
.
Nach dem aus dem militärischen Tötungswortschatz übernommenen Begriff „Zielobjekt“ wird dieses aber ganz im Sinne des Schweizer Jägerkodex sofort hymnisch verklärt: „Der Morchelfreund betrachtet diese von der Mutter Natur geschaffene Gabe mit Ehrfurcht und lässt deren Frische, Reinheit und Ausstrahlung auf sich wirken.“
.

.
Schön und gut, aber gilt beim Gabentausch nicht zwingend, als oberste Benimm-Regel quasi, eine Gegengabe? – Sonst ist es schnöder Diebstahl/Raub.
.
Nun weiß man zwar: Der eigentliche Pilz wächst in der Erde. Was man sieht – und abbricht bzw. abschneidet (Gerber empfiehlt dazu „ein Klapp- oder spezielles Pilzmesser“), ist der Fuchtkörper, aus dem die Sporen austreten. Die gehen der Morchel natürlich verloren, wenn man den Fruchtkörper in den Pilzkorb packt (Gerber empfiehlt stattdessen übrigens ein „Leinensäcklein“, weil man damit im Unterholz nicht so leicht hängen bleibt).
.
Zum Glück können sich Pilze und damit auch die Morcheln sowohl geschlechtlich als auch ungeschlechtlich vermehren. Der Fruchtkörperraub durch Pilzsammler verliert dadurch viel von seiner bornierten Selbstgefälligkeit. Dennoch bleibt ein Rest Unbehagen an dieser Stelle, wo es dann nämlich heißt: „Selbstverständlich gelten für den Sammler in alpinen Regionen dieselben Benimm-Regeln wie im Auenwald“ – und Gerber damit bloß an die Tiere denkt, die er auf der Morchelpirsch eventuell aufstöbert. Immerhin endet sein „Ratgeber“ mit einer Liste über die Mengenbeschränkungen in der Schweiz: Höchstens ein Kilo und das auch nur im Kanton Schwyz; in Österreich sind dagegen durchweg zwei Kilo Morcheln erlaubt. „Pilzkontrollen“ sorgen dafür, dass diese Obergrenze nicht überschritten wird von allzu gierigen Morchelsammlern. Zudem bieten sie „unkundigen Sammlern“ eine Hilfe bei der Auswahl der Pilze: die giftigen, ungenießbaren und überalterten werden einbehalten und vernichtet.
.
So etwas gibt es auch im Berliner Botanischen Garten. Dort spricht man von „Pilzberatung“. Der dafür zuständige Biologe schrieb – etwas überheblich: „Stolz präsentieren die Sammler ihre Funde, und neugierig sind sie, was der Nachbar im Korb trägt. Mit ihren Kenntnissen wollen sie imponieren oder einfach dazulernen. Selten kommt noch einer mit der Bitte, nur Eßbares aus einem wüsten Sammelsalat auszusortieren. Pilzberatung muß zur Entzauberung beitragen.“ Dieses Diktum, vom Pilzjäger Max Weber 1917 geprägt, ist ebenfalls überholt. Der jetzige Pilzberater im Botanischen Garten legt Wert auf die Feststellung, dass er sich mit diesen Äußerungen seines Vorgängers nicht identifiziert. Heute muß die Pilzberatung eher zur Verzauberung beitragen, was Heinz Gerber am Beispiel der Morcheln durchaus gelungen ist.
.

.
Projekt-Lexika
.
In Diderots „Enzyclopédie“ wird das Projekt definiert als „ein Plan, den man sich vorgibt, um ihn zu realisieren“. Mit den „Projekt-Lexika“ sind jedoch keine Übersichten über Projekte gemeint, die es wegen ihrer Fülle und Kurzlebigkeit auch gar nicht geben kann, sondern Lexikas als ein (eher durch Ordnung denn Originalität gekennzeichnetes) Projekt. Kaum sind die großen mehrbändigen Lexikas, deren Eintragungen meist von Wissenschaftlern stammten, eingestellt und sogar aus den privaten Bücherregalen verschwunden (ersetzt durch Wikipedia, Internet-Wörterbücher und Interessens-Foren), da kommen schon die ersten neuen Lexika auf den Markt. Die Welt-Lexika geben auf, die Provinz-Lexika fangen an, denn es geht diesen um eine Art „Klein-Werden schaffen“, in manchmal ganz unalphabetischer Weise.
.
Da wäre zum Einen der „Große Stockraus“ von Henner Reitmeier aus Waltershausen. Der Autor hatte sich über den fünfbändigen Brockhaus, den er 1971 erwarb, so geärgert – wegen all der darin enthaltenen „Verzerrungen/Auslassungen/Lügen“, dass er ein einbändiges „Relaxikon“ mit seiner Gedankenwelt alphabetisch geordnet herausgab. Es beinhaltet seine Lieblingsautoren und -vögel ebenso wie einige noch nicht existierende Einrichtungen – das „Misfitness-Center“ z.B., sowie schwer abzugewöhnende Gewohnheiten: u.a. das „Rauchen“ und etliche persönliche Macken wie das „Fluchen“ und den „Hochmut des Alters“… Erwähnt sei ferner das Provinzlexikon „Am Abend mancher Tage“ von Joachim Krause aus Meerane, das alle von antikommunistischem Westschmäh benebelten Zuspätgeborenen über DDR-Biographeme von „Aufbruch“ und „Feindberührung“ über „Flugblätter“ und „Kartoffelkäfer“ bis „Loslassen“ und „Zeltplatzleben“ informiert.
.
Nicht das mähliche Verschwinden, sondern das aufdringliche Erscheinen hat dagegen der westdeutsche Bauernsohn Henning Ahrens thematisiert, indem er akribisch alle Allerweltsideen, die in seinen ländlichen Lebensraum landeten, von A bis Z registrierte: „Baumärkte“, „Canapees“, „Fußgängerzonen“, „Mehrzweckhallen“, „Nagelstudios“…Daneben vermittelt sein Lexikon aber auch noch modernes Rübenbauernwissen. Der Klassiker des antikolonialen Befreiungskampfes auf dem Territorium der BRD, Herbert Achternbusch, hat 1981 gemeint: „Da, wo früher Rübenberge und Weilheim war, ist jetzt Welt…Die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“
.

.
Aber es gibt neben diesen „vernichteten“ noch andere Provinzen – und zwar immer mehr. Es sind geistige, die nun lexikalisiert werden: Z.B. das „Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen“ von Arianne Ferrari und Klaus Petrus. Sie und ihre über 100 Autoren kommen großteils aus dem hierzulande erst noch durchzusetzenden Forschungszweig „Human Animal Studies“, der sich aus den Feminismus- und Gender-Studies entwickelte. In ihrem Lexikon – von A wie Anarchismus bis Z wie Zoophilie – gibt es die unterschiedlichsten Stile, einige erinnern an Einträge im „Großen Brockhaus“. Die allgemeine Stoßrichtung des 480-Seitenwerkes ist der Tierschutz. Mehrere Autoren, darunter die Herausgeberin der Berliner Zeitschrift „Tierstudien“ beteiligten sich auch noch an einem anderen Lexikon – aus einem bereits etablierten Forschungsbereich: der Kultur- und Medienwissenschaft. Es heißt schlicht „Tiere“ und will ein „Kulturwissenschaftliches Handbuch“ sein. In ihm hat z.B. der „Tierschutz“ nur eine Eintragung, die, ebenso wie beim Stichwort „Tierversuch“ und „Zoo“, relativ ausführlich aber oft schematisch seine „Geschichte“ thematisiert. Herausgeben hat es der Literaturhistoriker Roland Borgards, die Eintragungen stammen von 26 Autoren, von denen sich etliche schon länger mit „Cultural Animal Studies“ beschäftigen, was leider nicht zwingend eine Beschäftigung mit realen Tieren bedeutet. Auch die lexikalische „Geschichte ‚Ornithomania'“ des Schriftstellers Bernd Brunner handelt nicht von Tieren, sondern von Tiernarren, genauer gesagt: Es sind Kurzporträts von mehr oder weniger exzentrischen Vogelliebhabern (siehe taz v. 22.10. 2015).
.
Dem Autorenkollektiv des „Wörterbuchs kinematografischer Objekte“ blieben die Tiere dagegen nicht erspart. Eine Anekdote daraus über den Umgang mit ihnen im Film soll das verdeutlichen: „Warum sie denn keine echten Kühe benutzen, fragt der Streber Martin Prince in einer Episode der Simpsons einen Requisiteur, der auf einem Set ein weißes Pferd mit schwarzen Farbflecken bemalt. ‚Kühe sehen im Film nicht wie Kühe aus, da muss man Pferde nehmen‘, lautet die Antwort. Und was macht man dann, wenn man tatsächlich Pferde filmen will? ‚Da binden wir meistens nur ein paar Katzen aneinander‘.“
.
Inzwischen sind über die Massenmedien derartig viele Tiere namentlich bekannt geworden, dass Karen Duve und Thiess Völker ein ganzes „Lexikon der berühmten Tiere“ zusammenstellten. Das Spektrum reicht von Lassy, Fury und Flipper bis zu Winnie-the-Pooh, Yogi Bär und Micky Maus. Hier wird also nicht mehr zwischen vermeintlich realen und virtuellen Tieren unterschieden. Der Deutschlandfunk schrieb: „Ein Tier, so kann man nach 670 Seiten durchaus erschöpfender Lektüre sagen, ist kein Tier, sondern ein veränderbares Konzept.“
.
Das scheinen die bürgerlichen Politiker auf ihren Weltkonferenzen auch vom „Klima“ anzunehmen. Die Klimaforscher des Helmholtz-Zentrums Geesthacht warnen bereits vor einer „Klimafalle“ – in der ein Teil der Klimaforscher der neoliberalen Politik beratend auf den konzeptuellen Leim geht. Nun hat jedoch die Geographin Sybille Bauriedl ein „Wörterbuch Klimadebatte“ herausgegeben, in dem das Vokabular dieses neuen Forschungsfeldes streng umrissen und geklärt wird – ausdrücklich gegen „neoliberale Klimapolitik“.
.

.
Abschließend sei noch das „Handbuch des kleinen Zoosystemikers“ von Louis Bec erwähnt. Der südfranzösische Künstler klärt darin die Begriffe und Aufgaben des Zoosystemikers, der „geheime ‚hypofizielle‘ zoologische Systeme zu entdecken und erforschen hat.“ Sein Lexikon ist ein „Manual“: Dabei „muß unbedingt alles unternommen werden,“ heißt es darin unter Punkt 1.10, „um in den Augen der Mitmenschen das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen und vernunftbegabten Menschen aufrechtzuerhalten.“ Desungeachtet muß es der angehende Zoosystemiker, wie es unter Punkt 4.2 heißt: „stillschweigend und gelassen hinnehmen, von den Wächtern über die ‚Eigenarten‘, den großen Vertretern des Wissens, den bedingungslosen Anhängern des Mythos vom Kunstschaffenden mit dem abgeschnittenen Ohr, von den sehr ehrenwerten Kunstkritikern und sogar von den Medizinstudenten im zweiten Studienjahr ausgebuht zu werden.“ Daneben sollte er (Punkt 5.6) „mit der Fähigkeit begabt sein, Expeditionen in die vagen und konturlosen Zwischenreiche einer atopischen Zoogeographie vorzubereiten.“
.
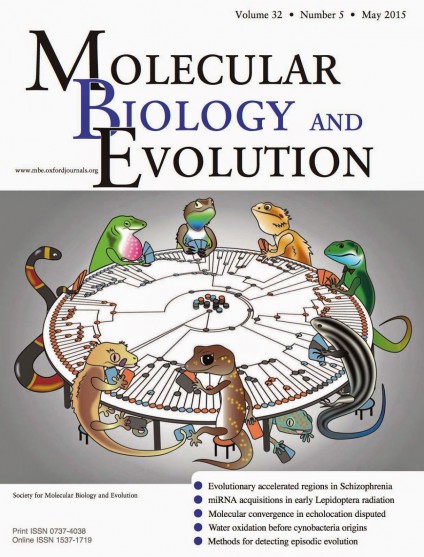
.
Projektemacherei
.
Der Politologe Wilhelm Hennis holte gegen die Projektemacherei den Begriff der „Sorge“ wieder hervor – „ohne allen Heidegger“, wie er hinzufügte. 1994 veröffentlichte er einen „Versuch zum Verständnis des ‚Traums der Vernunft'“, den er „Die Vernunft Goyas und das Projekt der Moderne“ betitelte. Es befaßte sich mit Goyas Capricho 43 „Der Traum der Vernunft“. Hennis ging darin vom Spanischen Original aus, wo „Sueno steht, das Schlaf und Traum gleichzeitig bedeutet und meinte, Goyas Inscriptio spiele auf „die spezifisch projektierende Vernunft“ an. „Das Blatt stehe damit in frappierender Parallele zum zweiten Teil des ‚Faust‘, in dem Goyas Generationskollege Goethe (Goya ist nur drei Jahre älter, stirbt vier Jahre vor ihm) den Magister und Alchemisten Doktor Faustus zu einem modernen Projektemacher avancieren läßt. Und so kommt Hennis schließlich zu dem Schluß: „es sind die Träume der Projekte schmiedenden Vernunft, die Ungeheuer produzieren.“ Es sind also die Projektemacher, die die Welt ruinieren! Er war 1994 der Meinung, er hätte damit als erster wieder den Begriff des „Projektemachers“ ins Spiel gebracht. Darin irrte er sich jedoch, denn bereits 1987 veröffentlichte der Luhmann-Assistent Georg Stanitzek einen kritischen Aufsatz über den „Projektmacher. Projektionen auf eine ‚unmögliche‘ moderne Kategorie“ in der Zeitschrift „Ästhetik & Kommunikation.
.
Auch Hennis Setzung der „Sorge“ wider die „Projektemacherei“ wurde in den Achtzigerjahren erneut ins Spiel gebracht: von Michel Foucault – mit seinen drei Bänden „Die Sorge um sich – Sexualität und Wahrheit“. Hennis meint dagegen die Sorge um andere: „Mein Vater kommt aus einer Gärtnerfamilie. Da muß man sich um die Pflanzen sorgen.“ Es ist eine „vorausschauende Anteilnahme“ laut Wikipedia. Was ist aber nun ein „Projekt“? Laut dem Projekte-Forscher Georg Stanitzek begann nach erscheinen des „Essays upon Projects“ von Daniel Defoe (1697) geradezu eine „Projektenperiode“. Schon in den ersten aufklärerischen Publikationen wimmelte es von Anregungen zur „Verbesserung“, wurden Preisaufgaben gestellt usw..
.
Für den protestantischen Bürger und Unternehmer insgesamt waren die Projektemacher zunächst alles „windige Geschäftemacher“, d.h unseriöse Konkurrenten und überhaupt charakterlose, unmoralische Menschen. Bereits im „Universal Lexicon Aller Wissenschaften und Künste“ von 1741 wird vor ihnen gewarnt, „weil sie insgemein Betrüger sind“. In seiner „Einleitung zur wahren Staatsklugheit“ erklärte ein Autor 1751, Grundling, auch warum: „Solche Leute machen gemeiniglich fürtrefflich scheinbare Projecte auf dem Papier, und thun dem Herrn allerhand Vorschläge; können sie aber selten ausführen, und kommen darüber in Ungnade“. Die Verachtung des „lächerlichen Projectanten“ (Josef Richter 1811) geht einher mit einer – bis heute – wachsenden Wertschätzung von Projekten.
.

.
„Wer sich dem Projektemachen widmet“, schreibt Georg Stanitzek, „fährt nicht in den sicheren Hafen eines ‚Charakters‘, sondern zieht es vor, immer von neuem, von Projekt zu Projekt, die unsichere Zukunft herauszufordern“. Bereits 1761 hatte ein Projektemacher selbst, Gottlob von Justi, sich darüber erste Gedanken gemacht – und war dabei zu dem Schluß gekommen, daß doch im Grunde alle Menschen so sein sollten wie er, und daß ein jeder „einen wohl überlegten Plan und Project seines Lebens“ entwerfe und nach ihm handle. Justis „Lebensart“ zielte bereits auf das, was man heute „Karriereplanung“ nennt. Und „Karrieren“, so die Analyse von Niklas Luhmann, dem Stanitzek hier folgt, „bestehen aus Ereignissen der erfolgreichen – oder mißlungenen – Verknüpfung von Selbstselektion und Fremdselektion. Der Projektemacher nun ist darauf aus, die Unwahrscheinlichkeit des Zueinanderfindens von Selbst und Fremselektion methodisch zu reduzieren, indem er mit seinem Projekt die Selektionen prospektiv engführt, d.h. in Form des Projektes gleichsam ein Exposé zu ihrer Verknüpfung vorlegt. Wenn die Selbstselektion sich in Projektform annonciert, so ist sie von vorneherein präzise auf eine Fremdselektion hin adressiert, steuert sich nah an sie heran, macht sich beobachtbar und beurteilbar“. Dieses Suchen der Nähe tatsächlicher Anschlußmöglichkeiten läßt sich – mit Stanitzeks Worten – „durchaus Opportunismus nennen“. Einige Darwinisten behaupten, dass selbst die Sorge um andere opportunistisch sei, weil man sich damit egoistisch Vorteile verschafft.
.

.
Falsche Flaggen
.
Ein Déja-vu? 1977 gab es einige „klammheimlich“ begrüßte Terrorakte und darauffolgend einen flächendeckenden Überwachungsangriff von oben. Eine Autovermietungsfirma ließ jeden Kunden heimlich filmen. Damals fand als Reaktion der Linken gegen die staatlich verordnete Jagd auf RAF-Sympathisanten am Winterende 1978 in Berlin der so genannte Tunix-Kongreß statt. Für mich hatte der „deutsche Herbst“ bereits 1976 begonnen, als das LKA wiederholt niedersächsische Landkommunen-Bewohner, zu denen ich damals gehörte, wegen ihrer vermeintlichen Nähe zum RAF-Täter-Umfeld verhaftet und verhört hatte. Im Frühjahr 1977 zog ich zu einem befreundeten Bauern-Ehepaar ein Dorf weiter, um ihnen beim Umbau des Hofes und dann auch bei der Ernte zu helfen. Damals besaß ich ein Pferd – und mit diesem ging ich anschließend – an einem sonnigen Herbsttag – los: zu einem anderen Bauern, nahe Osnabrück. Abends kamen das Pferd und ich müde bei Wagenfeld an einer Kneipe vorbei. Plötzlich stürzte ein Mann mit zwei Korngläsern raus – und auf uns zu: „Eben ist der Arbeitgeberpräsident Schleyer entführt worden. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Prost!“ sagte er und darauf tranken wir dann einen. Anschließend gingen das Pferd und ich weiter.
.
Am Nürnburgring in der Eifel – einige Wochen später – wurde es langsam ungemütlich. An der Mosel ging dann nichts mehr: Ich hatte in einer Dorfdisco zwei junge Weinbauern kennen gelernt und wir hatten anschließend zusammen gekifft. In der Pension, wo ich übernachtete, hörte ich dann in der Nacht Polizeistiefel im Treppenhaus und Walkie-Talkie-Geflüster hinter der Tür. Ich war gerade dabei gewesen, einen Leserbrief über die Fahndungs-Hysterie zu schreiben, als die Paranoia in mir hochstieg – und die Geräusche immer realer wurden. Würde man diesen Brief nicht gegen mich verwenden? Fragte ich mich – und schlief zum Glück irgendwann über diese Frage ein. Während ich danach bei einem Bauern im Hunsrück arbeitete, erschien Ende Dezember 1977 ein Artikel von Michel Foucault im Spiegel. Er hatte kurz zuvor – im „deutschen Herbst“ – das Land bereist: und zwar Ost wie West. Der Franzose begann den kleinen Text mit einer Schilderung seines Verhörs durch die Volkspolizei bei der Ausreise aus Ostberlin. In Westberlin wurden er und seine Begleiter anschließend vor ihrem Hotel von einer schwerbewaffneten BKA-Einheit festgenommen, weil Nachbarn sie denunziert hatten: seine Gruppe hätte sich angeblich mit der blonden Terroristin Inge Viett getroffen.
.
Die „Topterroristin“ war ja tatsächlich in der DDR untergetaucht, wie man in der Wende erfuhr, man vermutete sie damals jedoch in Frankreich, nachdem die taz sie dort – fiktiv – interviewt hatte.
.

.
.Auch dass der US-Sender CBS vier Tage vor dem Mauerfall schon eine Sendebühne am Brandenburger Tor aufbaute, wo es dann nach Schabowskis gestotterten Grenzöffnungssatz los ging, ist so ein Merkwürdigkeit. Über sein Erlebnis mit der Staatsmacht im Westen urteilte Foucault ironisch: „Beklagen Sie sich nicht über die Polizei, sie steht im Dienste der Ängste irgendwelcher Leute, ihrer Wahnvorstellungen ihrer Abscheu. Sie greift ein, wie die Feuerwehr bei Gasgeruch: sobald es schlecht riecht.“ Über den Unterschied zwischen Deutschland-West und Deutschland-Ost sagte er: „Hier Theater und Maschinenpistole, dort Bürokratie und Photokopiergerät. Hier die mögliche Beschuldigung eines jeden durch andere, drüben die allgemeine Verdächtigung aller durch die Verwaltung“. Im deutschen Herbst 1977 fühlte sich die Bevölkerung der BRD erstmalig wieder derart polarisiert und hysterisiert, daß z.B. die Bäuerinnen, bei denen ich mit dem Pferd (das übrigens ein wahrhaft trojanisches Pferd war, denn ohne es hätte ich nirgendwo eine Übernachtung geschweige denn Arbeit gefunden) – anklopfte, erst einmal beim BKA in Wiesbaden anriefen, um sich auf einer Hotline, die damals noch nicht so hieß, die Stimmen der Terroristen anzuhören. Nachdem das Ergebnis sie beruhigt hatte, ließen sie mich auf den Hof. „Ein ganzes Land jagt 16 Mörder“ titelte die Bild-Zeitung. Und das war nicht gelogen. Kurz danach waren die meisten Bäuerinnen jedoch mir – als ihrem Landarbeiter – schon wieder derart gewogen, daß sie nicht nur täglich den Aschenbecher in meinem Zimmer leerten und das Kalenderblatt abrissen, sondern sogar meine Jeans wuschen – und bügelten.
.
Auf Foucault ruhte dagegen in Berlin das kalte „große Auge“ zweier Staatsapparate. Nach seiner Verhaftung in Westberlin fragte er sich: „Sind wir nicht…eine Gruppe Deutscher und Franzosen, ganz offensichtlich ,Intellektuelle‘, die laut über Politik reden, genau die Leute, die Leute ähneln, die ihrerseits wieder denen ähneln, die mit ihren Worten und Schriften Leute unterstützen, die selbst gefährlich sind. Nein, nicht eine schmutzige Rasse, wie man früher sagte, sondern eine ,schmutzige Spezies?. Wir haben uns wie eine schmutzige Spezies gefühlt“. Ähnliches gilt jetzt für die (islamischen) „Schwarzköppe“ – wenn sie mal wieder bevorzugt von der Polizei kontrolliert werden. Nach der Zerstörung des „World Trade Centers“ 2001 wurden angeblich nach und nach alle Anhänger des Islam in Deutschland überwacht.
.
Ich sah den Aufbau der Bühne des US-Senders vor dem Brandenburger Tor, weil ich zwei mal daran vorbeigegangen bin. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht, außer: die spinnen die Amis. Weil das vor und erst recht dann in der Wende der Ekeltreffpunkt der sektrinkenden Deutschlandjubler (JU etc.) war. Auch heute treffen sich dort ausschließlich vereinsamte Nervbolzen. Heute denke ich über diesen „false flag“ so: Das war von den zwei großen Alliierten oder auch von dreien oder sogar den vieren verabredet worden – und jemand aus dem ZK der SED mußte das verkünden oder sie haben hart verhandelt und konnten dieses Ende der DDR daraufhin selbst verkünden. Wenig später – nach dem Mauerfall – stürmte im übrigendie Punkband „Feeling B“ in das Ostparlament zu Gregor Gysi, der gerade aus einem Sitzungssaal kam, und bestürmte ihn, dafür zu sorgen, dass die Mauer wieder dicht gemacht werde, sonst sei es das Ende der DDR. Gysi lächelte nur etwas und hob entschuldigend die Schulter, womit er vielleicht sagen wollte: Da ist jetzt nichts mehr dran zu ändern.
.

.
Etwas mit Tieren machen
.
„Irgendwas mit Tieren,“ sagen viele, wenn man sie nach ihrem Berufswunsch fragt – und sie nicht „irgendwas mit Medien“ oder „irgendwas mit Refugees“ machen wollen. Und tatsächlich vermehren sich die Berufschancen in der Tier-Branche, insofern das Wissen über die einzelnen Tiere (und in gewisser Weise auch über Pflanzen) ständig wächst. Diese Aufkärung, das Lebenswissen, umfaßt dabei immer mehr – die Umwelt, die Ökologie, was zu Schutzzonen, Nationalparks und Tierschutz führt. Diese müssen von Forschung begleitet, von Parkleitungen verwaltet und von Parkwächtern geschützt werden. Mit Schildern, Schranken, Besucherzentren und Lehrpfaden ausgerüstet werden. Dieses praktisch-politische Prinzip begrenzter Regionen (wie Teile des Wattenmeeres oder des Unteren Odertales z.B.) zieht zudem laufend weitere Kreise – darüber hinaus. So hat Berlin z.B. einen Falkenbeauftragten (für das auf dem Roten Rathaus brütende Falkenpaar), die Lausitz gleich mehrere Wolfsbeauftragte und einem Fuchs wurde in der Tiefgarage des Hotels am Alexanderplatz lebenslängliches Gastrecht eingeräumt. Dafür braucht man jemand, der das möglichst regelmäßig kontrolliert. Auch die Aufgaben der Tier- und Naturschutzvereine werden immer umfangreicher.
.
In Berlin-Falkenberg wurde 2001 das größte Tierheim Europas eröffnet, später kam noch eine erweiterte Anlage mit Ambulanz für Schwäne hinzu, da immer öfter verletzte Tiere eingeliefert wurden. Zum Glück ist deren Zahl inzwischen wieder rückläufig. Auch Tierfilmer und -photographen werden immer öfter gebraucht. Auf den Schiffen der privaten und staatlichen Meeresforschungseinrichtungen wird die Mannschaft erweitert. Aus dem Millionenheer der „Bird-Watcher“ entstehen immer öfter Beobachtungsstationen für Zug- und Standvögel, die ebenso professionell wie langfristig bemannt werden müssen. Überhaupt haben die Tier- und Naturschutzorganisationen als NGOs die Tendenz angenommen, sich zu professionalisieren, als „Experten“ (für dieses und jenes Tier oder Habitat) zu gelten und (im Auftrag) „Expertisen“ anzufertigen. Im Endeffekt heißt das für die meisten, die „irgendwas mit Tieren“ machen wollten, dass sie doch „irgendwas mit Medien“ machen. Das Tier ist wesentlich medial geworden. Oder hat schon mal jemand eine der berühmten Großtrappen freilebend gesehen, deretwegen eine ganze Bahntrasse umgestaltet wurde. Wir kennen diese Vögel nur aus Funk und Fersehen. Und das ist auch gut so, denn sonst hätten wir schon lange ihr kleines märkisches Biotop zerstampft. Auch die Parteien, wenigstens die Grünen haben längst Natur- und sogar Tier-Beauftragte, die z.B. „Expertisen“ über diese oder jene Population in Auftrag geben. Kurzum: Es werden immer mehr Arbeitsplätze für „kleine Tierfreunde“ geschaffen.
.

.
Bauern und Handwerker
„Das Salz der Erde“ (Matthäus 5,13)
.
Im „Ulysses“ von James Joyce heißt es: „Die Bewegungen, die in der Welt Revolutionen hervorbringen, werden aus den Träumen und Visionen im Herzen eines Bauern auf dem Hügel geboren.“ Aus den Handwerkern und Bauern wurden erst Schuldsklaven, dann Leibeigene, schließlich Arbeiter und nun Dienstleister oder prekäre Jobber. Noch heute geben jedes Jahr hunderte Landwirte in Deutschland auf. In Portugal schrieb der Philosoph Almeida Garrett über die zunehmende Verarmung: „Ich frage jene, die sich der politischen Ökonomie verschrieben haben, ich frage die Moralisten, ob sie schon die Zahl der Menschen berechnet haben, die zum Elend verdammt sind, zu unverhältnismäßigen Arbeitsleistungen, zu Demoralisierung, Schmach, Unwissenheit und zum Ruin, zu unüberwindbarem Unglück und absoluter Entbehrung – nur um einen einzigen Reichen zu produzieren.“
.
Die Ökonomie der kleinen Bauernwirtschaften und der unabhängigen Handwerksbetriebe die beide – nach Marx‘ berühmter Fußnote – „die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen in ihrer besten Zeit bilden,“ entsteht im Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit, „nachdem sich das ursprünglich orientalische Gemeinwesen aufgelöst und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft bemächtigt hat“. Im Eisenzeitalter tragen die Einzelwirtschaften die Verantwortung für ihre Selbsterhaltung. Hierbei findet der Übergang vom Gaben- zum Warentausch statt. Wobei sie sich, wie der Ethnologe Bronislaw Malinowski auf den Trobriand-Inseln feststellte, noch lange weigerten, zu rechnen und an ihrer alten „Anökonomie“, ein Begriff des Philosophen Jacques Derrida, festhielten, die eben nicht „ökonomisch“ ist, sondern gemeinschaftlich ausbalanciert war. Noch heute wird immer wieder versucht, sich gemeinschaftlich auszubalancieren. Z.B. bei den von Frauen gegründeten Genossenschaften der Viehzüchter in der Wüste Gobi: Dort arbeiteten sie erst einmal alle in Betrieben, um mit dem Geld für die inzwischen Verarmten unter ihnen Vieh zu kaufen, so dass sie beim wirtschaftlichen Beginn ihrer Genossenschaft alle in etwa gleich viel besaßen. Hierzulande stirbt jeder Bauer für sich alleine. Ihre Wirtschaftsweise ist zu unterschiedlich geworden als das sie sich vereinigen könnten. Sogar kleinste Maschinenringe, etwa für die gemeinsame Anschaffung eines Mähdreschers, der nur wenige Wochen im Jahr gebraucht wird, heißen bloß bei Schlechtwetter „Eintracht“ – bei gutem „Zwietracht“, weil dann alle zur selben Zeit dreschen wollen.
.
Die organisatorische Kraft der Arbeiter beruhte auf ihrer Gleichheit – gegenüber dem Kapital. Bei den letzten Bauern kommen neben der Ungleichheit untereinander auch noch die Unterschiedlichkeiten beim Wirtschaften hinzu. Selbst unter den Biobauern gibt es fast so viele Wirtschaftsstile wie Höfe. Das machte ja gerade den Reiz der Landwirtschaft aus – „in ihrer besten Zeit“.
.

.
Dass diese wiederkommt, dafür wurde kürzlich demonstriert, aufgerufen vom Bündnis „Wir haben es satt!“ Womit die „industrielle Landwirtschaft & Lebensmittelproduktion“ gemeint ist, gegen die eine „Förderung der bäuerlichen Betriebe“ verlangt wird. In den ersten Jahren hatten sich dazu auch die Vegetarier und Veganer bekannt. Inzwischen hadern sie jedoch auch mit den „bäuerlichen Betrieben“, in denen die Tiere ebenfalls ausgebeutet und getötet werden.
.
„Wir werden von dem Aberwitz abkommen, ein ganzes Huhn zu züchten, nur um die Brust oder den Flügel zu essen, und diese stattdessen in einem geeigneten Medium züchten“, versicherte Winston Churchill 1932. Kürzlich gelang es holländischen Forschern tatsächlich, künstliches Rindfleisch herzustellen – indem sie Zellen aus dem Muskelgewebe einer Kuh isolierten und sie in einer Nährlösung zu kleinen Muskelstreifen heranwachsen ließen. Diese schichteten sie übereinander, würzten sie und brieten sie zu einer Frikadelle. Ihre Entwicklung kostete 250.000 Euro, aber die Forscher meinen, dass die Konsumenten das künstlich hergestellte Fleisch, wenn es billiger wird, annehmen werden – aus ökologischen Gründen. Eine industrielle Herstellung von Laborfleisch würde im Vergleich zu herkömmlichem europäischen Fleisch 99 Prozent weniger Land und je nach Tierart 7 bis 45 Prozent weniger Energie sowie 82 bis 96 Prozent weniger Wasser verbrauchen, die Einsparung von Treibhausgasen läge zwischen 78 und 96 Prozent. Der deutsche Tierethiker Jörg Luy, ehemals Leiter des Instituts für Tierschutz und Tierverhalten an der Freien Universität Berlin, ist davon überzeugt, dass sich das „In-Vitro-Fleisch nach einigen Startschwierigkeiten durchsetzen wird“.
.

.
Fisch-Größen und -Grüße
.
Ende 2015 veröffentlichten amerikanische Meeresforscher alarmistisch eine Hochrechnung, wonach es 2048 keine Meeresfische mehr geben werde. Selbst ihre tüchtigsten Vertreter haben dann den Kampf ums Überleben verloren. Nun haben kanadische Fischforscher nachgelegt, indem sie bewiesen, dass in den letzten 60 Jahren viel mehr Fische gefangen wurden als angegeben. Im Jahr 1996 beispielsweise, zum Höhepunkt des Fischfangs, wurden nicht 86 Millionen Tonnen Fisch angelandet, sondern gut 130 Millionen Tonnen. „Der Fischfang sei von den offiziellen FAO-Statistiken, die auf den Meldungen der Mitgliedsländer beruhen, um gut 50 Prozent unterschätzt worden. Das liegt daran, dass Datenlücken vor allem bei Klein- und Freizeitfischern, was den unerwünschten Beifang und illegale Fischerei angeht, jeweils als null gewertet werden. Die Forscher haben statt der offiziellen Meldungen 100 Fischereiexperten in 50 Institutionen weltweit nach ihren Fangdaten und -schätzungen befragt,“ berichtete die FAZ, die auf der selben Seite darwinistisch jubelte: „Eine seltene Haiart ist ins Netz gegangen.“
.
Der thüringische Schriftsteller Landolf Scherzer heuerte 1977 auf dem Fischfang-Trawler „ROS 703 Hans Fallada'“ als „Produktionsarbeiter“ an. Die Fahrt ging nach Labrador. Die DDR hatte von Lizenzhändlern eine kanadische Fanglizenz – mit Mengenbeschränkung – gekauft. Als sie im Fanggebiet ankamen, waren dort schon zwei andere DDR-Fischereischiffe, sowie zwei polnische, ein dänisches, ein bulgarisches, und vier westdeutsche. „Die Hochseefischerei ist wie die Hatz auf Hirsche oder Wildschweine kaum über das bloße Erbeuten hinausgekommen,“ schreibt Landolf Scherzer. Die Kabeljau-Beute der „Fallada“ war jedoch diesmal so gering, dass sie es in einem anderen kanadischen Fanggebiet mit Rotbarsch versuchten. Weil Scherzer die Verarbeitung der Fischmassen am Fließband nicht gleichgültig ließ, führte er manchmal Gespräche mit einem toten Kabeljau. Zuvor hatte er sich auch schon am sibirischen Baikalsee mit einem lebenden Omul (eine Lachsart) unterhalten. Merkwürdigerweise tat das zur selben Zeit auch ein westdeutscher Dichter, der der DKP nahe stand, beide berichteten anschließend darüber in ihren Reisebüchern. Damals hatte der „Fischfreund“ Breschnew gerade die Rettung des Sees verfügt, erklärte dazu der Dichter.
.

.
Der Rotbarsch wird tagsüber mit Grundschleppnetzen gefangen und nachts mit Schwimmschleppnetzen. Als sie nach Wochen noch immer keine großen Rotbarsch-Schwärme gefunden hatten, kam aus der Kombinatszentrale in Rostock die Anweisung: „Noch 4 Tage vor Labrador fischen, dann nach England dampfen und im Hafen von Falmouth Makrelen, die englische Fischer verkaufen, verarbeiten.“ Für ein Kilo zahlten sie dann 5 Mark. Auf der Weiterfahrt nach Rostock mußten die Fische an Bord noch sortiert, gewaschen, geköpft, filetiert und gefrostet werden. In den Läden kostete das Kilo dann 1 Mark 40. – Fast schon ein staatliches „Gastmahl“. Scherzers „Buch“ „Fänger und Gefangene“ wurde 1998 noch einmal verlegt – ergänzt um Interviews mit seinen ehemaligen Bordkollegen, die fast alle arbeitslos geworden waren.
.
Die DDR-Fischfangflotte wurde gleich nach der sogenannten Wende mit einem Roland-Berger-Gutachten „versenkt“, aber schon in den Achtzigerjahren hatte der Direktor Günter Ubl vom VEB Fischkombinat Rostock seinem Minister „zwei Varianten“ vorgeschlagen, damit nicht länger jedes Stück Fisch hochsubventioniert werden mußte: 1. Investititionen in Schiffe, Gebäude, Maschinen in Höhe von 3,6 Milliarden Mark – „unmöglich zu bewilligen“. 2. Ähnlich wie zuvor die BRD: die Fischereiflotte abschaffen und Fisch importieren – das hätte jedoch die DDR „politisch erpreßbar“ gemacht (immer wieder hatte der Westen Handelsembargos verhängt).
.
Neben der Liquidation der Fischereiflotte wurde auch die Handelsflotte der DDR reduziert, dann privatisiert und schließlich ausgeflaggt. Das bekamen die öffentlichen Aquarien zu spüren. Der Leiter des Aquariums im Meeresmuseum Stralsund, Karl-Heinz Tschiesche, war ab 1983 fast schon systematisch von Seeleuten der Handelsflotte mit Korallenfischen versorgt worden, wie er in seinen Erinnerungen „Seepferdchen, Kugelfisch und Krake“ (2005) schreibt. Weil er im Westen für eine Garnele, die 18 DM kostete bis zu 250 Mark der DDR zahlen mußte, für einen Schmetterlingsfisch gar 1000 Mark, griff er die Idee eines Matrosen auf, sich Fische aus dem Roten Meer, wo die Schiffe stets eine längere Liegezeit hatten, mitbringen zu lassen. Er rüstete daraufhin zwei Schiffe mit je zwölf Aquarien aus. Am Anfang waren die Verluste hoch, weil die Offiziere und Mannschaften keine Erfahrung mit den anspruchsvollen Korallenfischen hatten, aber dann kamen die Ehefrauen der Offiziere, die alle zwei Jahre mit auf Fahrt gehen durften, darauf, sich während der vier- bis sechsmonatigen Reise, da sie nichts zu tun hatten, der Tiere anzunehmen. Seitdem „war der Gesundheitszustand der Fische bei ihrer Ankunft in Rostock immer ausgezeichnet.“ Und Tschiesche sparte zigtausende von Mark. Zudem profitierten auch noch die Aquarianer von den Fängen.
.
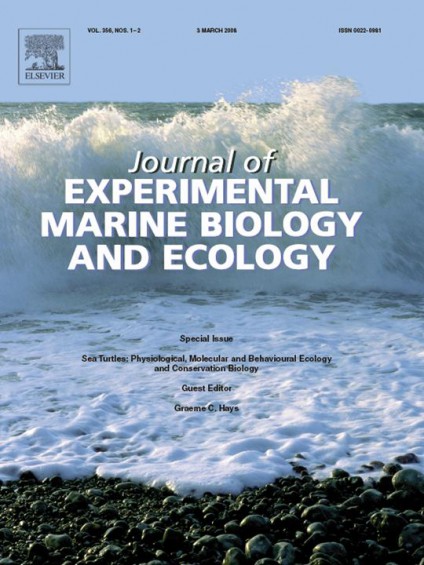
.
Auf der anderen Seite war in Bremerhaven, heute die westdeutsche Stadt mit den meisten Arbeitslosen, bis 1983 „die größte deutsche Fischereiflotte“ stationiert gewesen. Sie befand sich zuletzt im Besitz der Firmen „Nordstern“ (Frosta), „Dr.Oetker“ und „Nordsee“ – die sie dann an isländische und chinesische Reeder verkauften. Ihre Handelsketten werden heute von der isländischen Fischereiflotte beliefert – „just in time“. Einige um die Musealisierung der letzten Reste der Bremerhavener Fischindustrie bemühte „Küstendenker“ schreiben: „Das Kapitel Hochseefischerei ist in der deutschen Wirtschaft im Wesentlichen abgeschlossen. Deshalb hat sich 1997 ein ‚Arbeitkreis Geschichte der deutschen Hochseefischerei‘ gebildet, der vom Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven wissenschaftlich betreut wird – und dazu beitragen will, die mit der Hochseefischerei verbundenen Erinnerungen zu sammeln, zu bewahren und aufzuarbeiten.“
.
Zu diesem Zweck hielt man u.a. die letzten noch lebenden Hochseefischer an, ihre Erlebnisse an Bord aufzuschreiben. Der ehemalige Matrose Jens Rösemann tat dies in Form eines Briefes an seinen Enkel Armin, er schrieb: „Vielleicht meinst Du, dass wir Tierquälerei betrieben hätten. So dachte ich zuerst auch. Vor allem hatte ich etwas Angst, wenn ich vor einem Kabeljau von über einem Meter stand, der mit dem Schwanz schlug und sein großes Maul aufsperrte. Aber so ist das in der Natur, einer frißt den anderen. Und wir lebten nun davon, dass wir Fische fingen. Später sah jeder von uns nicht mehr das einzelne Tier, das da an Deck lag. Es war Geld! Davon lebten wir und unsere jungen Familien daheim.“
.
Neuerdings hat ein Dresdner Biologe, Michael Beleites, das Gespräch zwar nicht mit, aber über den Kabeljau weiter geführt – ausgehend von einem Befund kanadischer Fischereiforscher, dass der Kabeljau immer kleiner werde. In Beleites Buch „Umwelt Resonanz – Grundzüge einer organismischen Biologie“ (2014), das sich gegen die darwinistische Selektion-Mutations-Formel richtet: „Nun ist gewiß kaum ein stärker selektierender Faktor vorstellbar, als ein Netz, das mit einer bestimmten Maschenweite ganze Fischpopulationen förmlich durchsiebt – und ab einer bestimmten Körpergröße ausnahmslos alle Individuen ausmerzt‘. Die Schleppnetze sind allerdings kein natürlicher‘ Selektionsfaktor, auch wenn die Selektion an wildlebenden Fischen stattfindet.“ Die Fische würden wahrscheinlich wieder älter und größer werden, wenn man die Intensivfischerei beendete. Es handelt sich hierbei also gerade „nicht um den Aufbau einer neuen Population durch eine positive Selektion von Anfang an genetisch frühreifer bzw. kleinwüchsiger Mutanten.“ Dieses Kabeljau-Beispiel ist nur eines von vielen mit denen Michael Beleites seine „Umwelt Resonanz“-Theorie entwickelt hat. Ob sie geeignet ist, dem Kabeljau zu helfen, wird sich wohl erst auf lange Sicht hin erweisen.
.

.
Quallen-Qualen
.
Als der Schauspieler Till Schweiger auf seiner Facebookseite ein Video veröffentlichte, auf dem ein Mann mit einer Flasche zwei Feuerquallen zerquetscht, waren sein Fans empört: „Wie gestört kann man eigentlich sein?“ und „Soll ich Tierquälerei jetzt lustig finden???“ fragten sie. „Die Welt“ fragte den Hamburger Quallenforscher Gerhard Jarms, ob Quallen Schmerzen empfinden können. Wahrscheinlich nicht, antwortete er. Die Zeitung erinnerte zudem an einen berühmten Quallenversteher: den Jenaer Zoologen Ernst Haeckel: Alle übrigen Tierformen werden an Schönheit und Zierlichkeit von den herrlichen Siphonophoren übertroffen‘, schrieb er, und schilderte diese auch Staatsquallen genannten Hohltiere als ‚zierliche Blumenstöcke‘ mit ‚Blüten, durchsichtig wie Glas‘. Die Aquarelle, die er von ihnen malte, gehören zu den schönsten naturkundlichen Darstellungen des 19.Jahrhunderts. Eine Fahnenqualle benannte Haeckel nach seiner früh verstorbenen Frau Anna Sethe, die er sehr liebte: ‚Desmonema annasethe‘.“
.
Bei den „Staatsquallen“, gibt es eine Art, die für Menschen besonders schmerzhaft und manchmal sogar tödlich ist: die „Portugiesische Galeere“ (Physalia physalis). Haeckel schätzte die „Siphonophoren“ vor allem weil sie aus tausenden von Individuen bestehen, die Arbeitsteilung praktizieren, indem sie verschiedene Funktionen ausfüllen: Beutefang, Verdauung, Verteidigung, Vermehrung usw.. Damit ähneln sie einem „stark centralisirten“ und „hochcivilisirten Culturstaate,“ fand er.
.
Der Biologe Mark Martindale entdeckte in ihnen die gleichen Gene, die bei Säugetieren die Aufteilung und den Aufbau des Körpers steuern. „Die Welt“ fand: „Viel haben sie bei den Quallen nicht aufzubauen. Hohltiere besitzen kein Herz, kein Gehirn und kein zentrales Nervensystem. Die einzigen Organe, die bei der in Nord- und Ostsee häufigen Ohrenqualle als rosa Ringe im ansonsten durchsichtigen Fladenkörper auffallen, sind die Geschlechtsteile.“ Die Quallen – auch Medusen genannt – erzeugen durch geschlechtliche Fortpflanzung Larven. Diese setzen sich irgendwo fest und entwickeln sich zu Polypen. Die Polypen erzeugen daraufhin auf ungeschlechtlichem Weg – durch „Sprossung – wieder freischwimmende Quallen.
.
Der von der Französischen Revolution beflügelte Naturforscher Jean-Baptiste de Lamarck, der den Begriff „Biologie“ prägte, befaßte sich mit „wirbellosen Tieren“; in den Korallenriff-Gemeinschaften hatten es ihm vor allem die Quallen – franz. „Méduses“ – angetan. In ihnen sah er „die Spiele, die Eleganz und das Lächeln der neuen Freiheit“ verkörpert.
.

.
Inzwischen werden die Quallen weltweit eher als Bedrohung wahrgenommen, weil sie sich in immer mehr Gewässern frei schwimmen, d.h. sich wegen Überfischung und Verschmutzung der Meere ungehemmt ausbreiten; hinzu kommt die Erwärmung des Wassers, was die rhythmische Pulsation ihres Magens und ihre Schwimmbewegungen mit dem Schirm (beides geschieht über Ringmuskeln) beschleunigt – und damit auch ihren Nahrungsbedarf. Polypen wie Medusen leben von Plankton (gr. das Umherirrende), letztere können mit ihren Tentakeln aber auch kleine Fische und Krebse fangen.
.
Anfang der Achtzigerjahre gelangte – vermutlich über das Ballastwasser von Frachtschiffen – eine Rippenquallenart (die Meerwaldnuss) in das Schwarze Meer, wo sie sich derart vermehrte, dass schließlich 240 Exemplare pro Kubikmeter Wasser gezählt wurden. Erst durch Aussetzen ihres Freßfeindes Beroe ovata (eine andere Rippenquallenart) konnte ihre Population, die derweil auch ins Kaspische Meer und in die Ostsee eingedrungen war, reduziert werden. In der für die Meerwaldnuss eigentlich zu kalten Ostsee leben bereits zwei Quallenarten, die von der biologischen Anstalt Helgoland als ihre Freßfeinde identifiziert wurden.
.
Im Mittelmeer „vermiest“ die Wurzelmundqualle (Rhizostoma pulmo) „Jahr für Jahr den Urlaub an Italiens Küsten,“ schreibt der österreichische „Standard“ über diese Quallenart, die den Strand violett färbt, wenn sie in Massen angeschwemmt wird. „Der Stachel an den mit Gift gefüllten Nesselzellen lässt bei Berührung die Nesselkapsel im Inneren der Zelle platzen, worauf ein Nesselfaden nach außen gestülpt wird, der das lähmende Gift abgibt.“ Für den Menschen ist das nur schmerzhaft, das Beutetier hingegen wird vergiftet und verdaut.
.

.
Im Mittelmeer gibt es jedoch eine kleine Makrelenart, die am Liebsten Quallen frißt. Laut dem Biologen Jakob von Uexküll, der den Begriff der „Umwelt“ prägte, haben es diese Fische auf zwei Quallenarten abgesehen, die mitunter viel größer als sie selbst sind.
.
In Kiel will eine Firma aus Quallen Arzneimittel und Kosmetika herstellen. Das aus ihnen extrahierte Bio-Kollagen sei ideal für die Wundbehandlung, schreibt der Spiegel, dabei gäbe es nur noch ein Problem: „Wie bringt man Quallen um?“ Bisher erledigten die Kieler Forscher das mit einem Quirl, das Tierschutzgesetz verlangt jedoch eine „artgerechte“ Tötung.
.
In China und Japan ißt man gerne „Quallensalat“. In „Asien ist der Handel mit Quallen für den Verzehr bereits ein Multi-Millionen-Dollar Geschäft,“ berichtete der SWR, hierzulande habe allerdings die Lebensmittelbehörde Quallenspeisen noch nicht freigegeben. Desungeachtet versuche die Industrie bereits aus der zunehmenden Not – schrumpfende Fischschwärme und wachsende Quallenbestände – das Beste zu machen, indem sie u.a. das Problem zu lösen versucht, wie man die Tiere entgiften und dabei ihren Nährwert erhalten kann.
.
Im Institut für Meereswissenschaften in Barcelona gibt es laut SWR „Quallen für jeden Geschmack: Mit grünen oder phosphoreszierenden Tentakeln, mit bläulichen oder kräftig gelben Schirmen. Der Biologe Josep-Maria Gili züchtet unzählige Quallen in seinen Aquarien als Nahrungsmittel und erprobt Entgiftungsmethoden: „Die Qualle hat kein Cholesterin. Sie ist fettfrei. Wie Fisch liefert sie viele Proteine und Spurenelemente und ist reich an Natrium, Kalzium, Calium und Magnesium.“
.

.
Im „Guardian“ fragte sich kürzlich ein Autor: „Ist es o.k. für Vegetarier, Quallen [Jellyfish] zu essen?“ Was er wohl für solche, die sowieso Fisch essen, in Ordnung fand. Aber dürfen auch Veganer Quallen essen? Im Forum „vegane-inspiration.com“ wurde darauf geantwortet: „Quallen haben kein Gehirn, daher können sie auch nicht leiden. Quallen sind eher wie bewegliche Pflanzen.“ In der taz wurde daraufhin kurz über diese beiden Fragen diskutiert. „Sind sonst alle weltbewegenden Probleme gelöst? fragte eine Redakteurin erst mal. Während eine andere, die Frage, „Was wollen wir essen? durchaus für weltbewegend“ hielt. Eine dritte behauptete: „Quallen schmecken wie Austern!“ Und ohnehin seien bereits über 50 % der in Europa geschlürften Austern mit Quallen gefüllt. Einer der Hausmeister wies darauf hin, dass man Quallen auch immer öfter in Aquarien halte – um sich an ihnen lebend zu erfreuen.
.
Im Aquarium des Berliner Zoos wird bereits seit den Achtzigerjahren die größte Quallenzucht des Kontinents aufgebaut. Der für diese „Feenwesen“ zuständige Tierpfleger Daniel Strozynski erzählte dem Tagesspiegel: „‚Erst dachte ich, das wird auf Dauer ja langweilig‘. Schließlich lässt sich zu den glibberigen Schönheiten nicht wirklich eine persönliche Beziehung aufbauen… Immerhin ließ er sich auf die Aufgabe ein und sagt heute: ‚Das ist mein Traumjob.‘ Weil Medusen hochsensible, kompliziert zu haltende Geschöpfe sind. Ständig fordern sie ihn neu heraus…“ In seinen Becken werden 22 Quallenarten gehalten. „Wer solche Tiere sehen will, muss also nicht ans Meer fahren, nach Spanien oder Italien“, meint der Kurator des Aquariums, Rainer Kaiser. Der WWF zählte die Quallen zu den „tierischen Gewinnern 2015“.
.

.
Kunst und Wissenschaft verwischen
.
„Seit einigen Jahren scheint es ein neues Lieblingsthema zu geben – die Verbindung von Wissenschaft und Kunst,“ schreibt Michael Hagner auf der Internetseite der Technischen Hochschule Zürich . Diese „Verbindung“ wird vornehmlich „ökologisch“ gesucht. Inzwischen gibt es in Kalifornien fast nur noch „Eco-Artist“ und „Bio-Hacker“. Erstere widmen sich künstlerisch der Natur, letztere experimentieren mit dem „Leben“ anderer. Aus Kalifornien kamen Ende der Achtzigerjahre auch die ersten Öko-Künstler nach Westberlin – auf Einladung des DAAD: Helen Mayer und Newton Harrison, „the leading pioneers of the eco-art movement“ heute genannt. Sie nahmen sich hier nichts weniger als die „Revitalisierung der Spree“ vor, nebenbei hoben sie noch die „Trümmerflora“ in der „Topographie des Terrors“ ins allgemeine Bewußtsein.Inzwischen gilt das Haus der Kulturen der Welt, nachdem es auch noch das Zeitalter des „Anthropozäns“ ausgerufen hatte, als die hiesige „Think-Tanke“ für Öko-Kultur.
.
Etwa zur selben Zeit wie das Ehepaar Harrison sich hier umtat, zog die norwegische Mathematikerin Sissel Tolaas nach Westberlin, wo sie mit „Geruchskunst“ experimentierte. Irgendwann kam sie jedoch künstlerisch nicht mehr weiter, wie sie meinte – und beschäftigte sich fortan wissenschaftlich mit Gerüchen. Seit 2006 ist sie Professorin für „unsichtbare Kommunikation und Rhetorik“ in Harvard. Derzeit arbeitet sie gerade im Auftrag einer Geschichts-Ausstellung in Berlin am „Geruch des Zweiten Weltkriegs“ – den man hier ja wegen der immer strenger werdenden Umwelt-Gesetze und -Verordnungen nicht einmal mehr punktuell riechen kann. Bei der Öko-Kunst, wenn sie nicht Forschungsergebnisse schlicht visuell umsetzt, kann es sich um Rückgriffe auf (goethische) „Ganzheitlichkeit“ handeln, was sich im Mitbedenken der „Umwelt“ eines Kunstwerks bereits andeutet, es kann dabei aber auch – angesichts des „Visual Turns“ – darum gehen, neue Sinne für die Kunst zu mobilisieren – und neue „Leute“, Tiere z.B. im Zuge des sozialwissenschaftlichen „Animal Turn“.
.
Im Gegensatz zur eher stillen Geruchskünstlerin predigte der dänische Künstler Olafur Eliasson in Berlin geradezu die aktuelle Notwendigkeit von „Öko-Kunst“. Auch außerhalb: So erfreute er z.B. die New Yorker mitten im heißen Sommer mit einem riesigen Wasserfall für 15 Millionen Dollar und an die Afrikaner, beginnend mit den Äthiopiern, die abseits eines Stromnetzes leben, verkaufte er solarbetriebene Leuchtdioden als Lampen. Auch Eliasson spricht von „Ganzheitlichkeit“, meint damit aber seine Verbindung von Eco-Business und -Art.
.

.

.
In Kassel hat unterdes eine Semiamerikanerin die halbe Kunst für die diesjährige „documenta“ ökologisch durchkuratiert: Für die Postfeministin Carolyn Christov-Bakargiev gibt es „keinen grundlegenden Unterschied zwischen Menschen und Hunden“. Das Feuilleton höhnte: „Documenta-Chefin will Wahlrecht für Erdbeeren“ (orf), „documenta ist auf den Hund gekommen“ (dorstener zeitung), „Heftige Kritik an documenta-Chefin“ (giessener zeitung). Die „Akzeptanz“ (derstandard) für so was ist also noch nicht durch. Aber flankiert werden derartige Kunststücke schon mal von immer mehr Wissenssoziologen und Kulturwissenschaftlern, die sich durch die Bank die Metaphern der modernen Biologie vornehmen, gleichzeitig aber auch die Pflanzen, Pilze und Tiere selbst – wobei sie diese aufgrund ihrer literarischen Neigungen jedoch nur allzu oft metaphorisieren.
Umgekehrt holen sich die Naturwissenschaftler immer öfter Künstler ins Haus. Die Zoologischen und Botanischen Gärten sowie die Naturkundemuseen, weil sie in Zeiten sich „verschlankender“ Staaten um die „knappe Ressource Aufmerksamkeit“ beim zahlenden Publikum buhlen müssen – und dabei zunehmend auf „Topevents“ setzen.
.
So hat das Naturkundemuseum schon seit Jahren den Schauspieler Hans Zischler verpflichtet, regelmäßig eine schöne Veranstaltung – z.B. über Vilem Flussers Weltbild einer Tiefseekrake oder die sexuelle Selektion nach Darwin – zu bestreiten.
.
Im Naturkundemuseum gibt es eine riesige „nasse“ Fischsammlung, deren Grundstock einst Dr. Marcus Elieser Bloch im 18.Jahrhundert zusammentrug: „Millionen Fische, Reptilien, Krebs- und Spinnentiere, seit Humboldts Zeiten in aller Welt gesammelt, konserviert in 80 Tonnen reinem Ethanol, verteilt auf knapp 260.000 Gläser,“ wie die Morgenpost schrieb. 2014 bekamen die etwa 50.000 Fische des Berliner Naturkundemuseums einen eigenen Saal: Gut ausgeleuchtet stehen da nun alle ihre Gläser auf hohen Metallregalen und mittendrin befindet sich ein aus Brandschutzgründen fiktiver Arbeitsplatz eines Fischforschers. Als Besucher kann man bloß außen herum gehen und beeindruckt sein von den vielen Fischen – in so einer modernen Metall-Glas-Licht-Inszenierung.
.
In der Aufsatzsammlung „Wissenschaft im Museum“ (2014) der Wissenshistorikerinnen Margarete Vöhringer und Anke te Heesen kritisierte letztere diesen neuen „Raum voller Gläser“, in dem „nicht das einzelne Objekt hervorgehoben und mit einer Erklärung versehen“ wird, sondern „ihr Erscheinen als Menge im Vordergrund“ steht. In den Naturkundemuseen wird die „Natur mithilfe toter Gegenstände dargestellt, ihre Präsentationen aber sollen das Leben selbst symbolisieren.“ Aus der Warte des naturkundlichen Objekts stellt der Raum mit den Fischgläsern ein „Unterforderung“ dar. Von der Warte allein des Atmosphärischen her stellt er jedoch eine „Überforderung“ dar, „denn was sollen wir auswählen, was besonders intensiv betrachten, woran uns orientieren?“ fragt Anke te Heesen. Hier wurde ihr zufolge mit großer Geste leichtfertig der Museumsauftrag Vermittlung von Wissen zugunsten einer künstlerischen Rauminstallation fallen gelassen, das eventversessene Feuilleton lobte dann auch prompt den Verzicht auf „die sonst übliche Museumspädagogik“.
.
.
Der HUB-Professor Thomas Macho, Autor vieler Texten über Tiere und Kurator einer Ausstellung über Schweine, erweiterte seine „Animal Studies“ mit einer Beteiligung an der neuen interdisziplinären Zeitschrift „Tierstudien“, deren erste Ausgabe sich mit „Animalität und Ästhetik“ befaßt. U.a. wird darin die Arbeit mit Tieren als „künstlerische Agenten“ auf der Theaterbühne, in der Architektur und in der bildenden Kunst (vornehmlich in Kalifornien) thematisiert. „Es ist eine der angenehmsten Eigenschaften aller im Tierstudienheft versammelten Arbeiten, dass sie zuerst nach dem fragen, was man über das Tier weiß,“ schrieb der Biologe Cord Riechelmann in seiner Rezension.
.
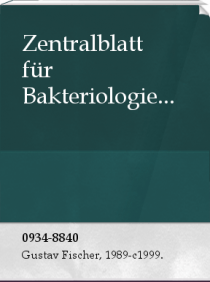
.
Im „Prinzessinnengarten“ am Moritzplatz, einem der Öko-Vorzeigeprojekte in der Stadt, zeigte die Dänin Åsa Sonjasdotter eine Fruchtfolge lang Ausschnitte aus ihrer Kartoffelkunst: „The order of the potatoes“. Ihre Eltern sind Kartoffelbauern auf einer Insel und ihre Arbeit besteht im Wesentlichen aus dem Sammeln und der der Aufzucht von bisher über 100 Kartoffelsorten. So viel konnte nebenbeibemerkt auch der Gutsverwalter und Kartoffelspezialist Hans Fallada unterscheiden. Die zwei Betreiber des nomadischen Gemüsegartens am Moritzplatz bezeichnen sich nicht als Gärtner oder Manager, sondern als „Kuratoren“.
.
Inzwischen gibt es auch bereits etliche „Bienenkünstler“ und sogar „Hummelkünstler“. Für so etwas ist die Kreuzberger NGBK immer mal wieder gut. Eingedenk der optimistischen These des Philosophen Vilem Flusser „Das wahre Zeitalter der Kunst beginnt mit der Gentechnik – erst mit ihr sind selbstreproduktive Werke möglich“ beschäftigte sich außerdem eine NGBK-Künstlergruppe kritisch mit „Genkunst“, vornehmlich aus den USA, eine andere eher konstruktiv mit dem französischen Diktum „Tier-Werden, Mensch-Werden“.
.
Kürzlich wurde in Berlin die erste Bio-Hackerin – im Think-Tank „Stadtbad Wedding“ – aufgestöbert: Lisa Thalheim. Die Informatikkünstlerin beschäftigt sich laut Süddeutsche Zeitung mit dem Auslesen von DNS-Profilen. „Natürlich würde auch Genmanipulation sie reizen, aber da steht, so lange ihr Labor keine Lizenz hat, das Gentechnikgesetz vor. Die Bewegung der Gentech-Heimwerker steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen“. Das gilt sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, aber sie scharrt bereits mit den Hufen.
.
Während jedoch hierzulande ein „Gen-ethisches Netzwerk“ gegründet wurde (von dem ex-tazler Benny Härlin), das gegen solch eine „Lebenskunst“ argumentiert und mobilisiert, wird in den US-Universitäten auf Sommercamps schon seit Jahren gentechnisch experimentiert, d.h. – in Teams, die international im Wettbewerb (iGem) stehend sogenannte „BioBricks“ z.B. in Bakterien einbauen. Nicht selten wird dabei die „Öko-Kunst“ wissenschaftlich auf den (vielversprechendsten) Punkt gebracht: 2011 gehörte zu den umgesetzten „SyntheticBiology“-Projekten laut spiegel-online „der Abbau von Pestiziden in der Zelle, die Herstellung von Biotreibstoffen, Zellen, die sich selbst umbringen, aber auch zellinterne informationsverarbeitende Netzwerke“.
.

.
Anfang August eröffnete die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und die Berliner Akademie der Künste einen „Syntopischen Salon“ auf dem Alten Markt in Potsdam und lud zu einer öffentlichen Disputation über Kunst und Wissenschaft am Beispiel des Schimmelpilzes „neurospora crassa“, der sich währenddessen dort in einem gläsernen Pavillon auf dem Alten Marktplatz in etwa 30 Petrischalen munter vermehrte – und dabei von weißen Pünktchen langsam über gelb-orange in schwarze Bänder überging.
.
Dieser eukariotische Einzeller ist weder Pflanze noch Tier und hat eine kosmopolitische Verbreitung. Er wird weltweit als Modellorganismus beforscht und ist hierzulande als Brotschimmel bekannt. Er hat zwei unterschiedliche „Generationszyklen“, d.h. er kann sich sowohl durch Sporen über die Luft als auch durch geschlechtliche Kreuzung vermehren. 1958 erhielten zwei Genetiker für ihre Forschung mit ihm, die in der Formel „Ein-Gen-ein-Enzym“ gipfelte, den Nobelpreis. Der Pilz ist aber nicht nur ein „Almighty Fungi“, sondern auch ein Zwangscharakter, da er exakt alle 24 Stunden eine neue Generation von (schwarzen) Sporen produziert. Auf eine Verschiebung der Zeitzone reagiert er gleich uns mit einem „Jetlag“, wie norwegische Chronobiologen herausfanden. In Bayern, wo die Gentechnik bereits vollends den Biologieunterricht ersetzt hat, wird den Abiturienten folgende Aufgabe gestellt: „Entwickeln sie mithilfe des Materials die Syntheseschritte zur Aminosäure Methionin bei neurospora crassa.“ Mit dem „Material“ sind mittels UV-Bestrahlung erzeugte Mangelmutanten gemeint, die auf Minimalnährböden verschieden gedeihen. Dabei geht es darum, deren künstlich erzeugte Stoffwechsellücken lückenlos zu beschreiben. Für so etwas bekam man in den Achtzigerjahren noch ein Biologiediplom an den Unis.
.
Der Potsdamer Kunsthistoriker, der wie oben erwähnt behauptet hatte: „Pilze sind immer schon sehr nachdenkliche Leute“ schien sich mit dem Begriff – „Leute“ sowohl auf das kleine Volk des Taigajägers Dersu Usala (über den Wladimir Arsenjew ein Buch schrieb, das von Akira Kurosawa vderfilmt wurde) als auch auf das Volk der Pirahas in Amazonien (über das Dan Everett berichtete) zu beziehen: Beide Völker benutzen das Wort Leute für Tiere, Pilze und Pflanzen in ihrer Umgebung, um anzudeuten, dass sie die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Natur und Kultur nicht mitmachen – und Abstraktionen (wie den Darwinschen Stammbaum – mit dem Menschen ganz oben und der Amöbe ganz unten) abhold sind. Mit den Worten des brasilianischen Ethnologen Eduardo Viveiros de Castro: Im Westen ist ein „Subjekt“ – der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt, während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner das Gegenteil der Fall ist: ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“ Als Schlußwort eines „Syntopischen Salons“ war die Pilz-Leute-Bemerkung leider nur utopisch.
.
Weiter ging es mit den mindestens ebenso interessanten Schleimpilzen (Mycetozoa) – Einzeller, die in ihrer Lebensweise laut Wikipedia „Eigenschaften von Tieren und Pilzen gleichermaßen vereinen, aber zu keiner der beiden Gruppen gehören.“ Trotz ihres Namens sind sie also genaugenommen keine Pilze. Aus ihren Sporen werden Amöben. Es gibt über sie unendlich viele Forschungsarbeiten, darunter einige erfreulich spekulative. In Weimar gibt es ein „Schleimpilzprojekt“. Von dort findet nun im neuen „Collaboratorium“ (CLB) des „Aufbau-Hauses“ am Moritzplatz eine Veranstaltung über Schleimpilze statt: am 4. Februar von 14 bis ca. 22 Uhr.
.
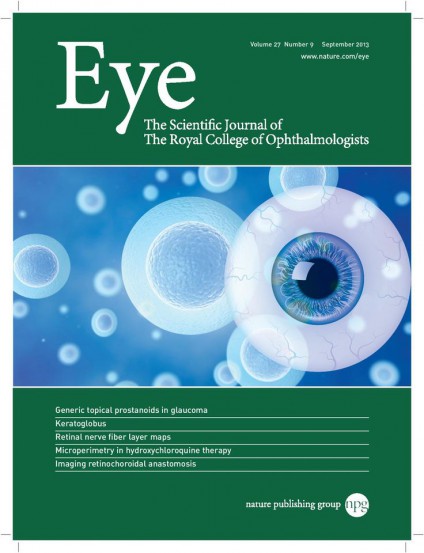
.
Schlangen in der Volksbühne
.
Seltsam: Während ein Spaziergang des Künstlers Andreas Wegner mit einem Huhn an der Leine durch Kreuzberg vom Ordnungsamt verboten wurde, erlaubte man die „Mitwirkung“ mehrerer Riesenschlangen an einer Veranstaltung in der Volksbühne.Es war ein bißchen wie früher, als Biolehrer mit Berufsverbot sich als Reptilienhalter und -züchter selbständig machten und mit den Tieren dann gegen ein kleines Honorar im Biologieunterricht ihrer entnazifizierten Kollegen auftraten.
.
Hier bekamen wir es nun mit einer Schlangen-Performance als Belehrung und Kunst zu tun. Das war etwas Neues, denn bisher traten die Tiere in den Volksbühnenstücken nurmehr als Statisten auf. Im Gegensatz zu vielen anderen Bühnen, auf denen bestenfalls noch gut gehorchende Hunde mitwirken dürfen, hat Frank Castorf in seinen Aufführungen immer wieder auch Großtiere wie Pferde oder eine ganz Ziegenherde – aus dem Tierasyl des alten Herrn Wilhelm – eingesetzt. Überhaupt müssen immer mehr Tiere ihr Geld im Showgeschäft verdienen.
.
Nun waren das fünf große Pythonschlangen und drei kleine Erdnattern. Letztere versuchten – kaum aus dem Sack gelassen – sofort ins Dunkle unters Publikum zu fliehen. Die Pythons wirkten bühnenreifer. Sie balancierten auf einer Bambusstange und bewegten sich langsam auf der Schulter ihres Besitzers Rainer Kwasi, dem sie damit auch seinen Lebensunterhalt finanzierten. Die größte, eine ca. fünf Meter lange gelbe Python, spielte sogar die Hauptrolle in einem Film, in dem sie langsam, aber ständig züngelnd die Volksbühne von unten nach oben scheinbar erkundete, bevor sie sich dann im Roten Salon „live“ dem zahlreich erschienenen Publikum zeigte.
.
Ein Conferencier erklärte uns dazu das multifunktionale Sinnesorgan gespaltene Schlangenzunge. Dazu kommt bei den Python noch eine Art drittes Auge auf der flachen Stirn, um Infrarotstrahlen wahr zu nehmen. „Die Schlange weiß damit mehr über den Menschen als wir über sie.“
.
.
Aber die Volksbühne wäre keine Erfolgsbühne, wenn nicht noch ein Bremer Regisseur, eine russische Dramaturgin, ein spanischer Tänzer, eine japanische Tänzerin und eine lateinamerikanische Psychoanalytikerin dabei wären, wobei letztere noch einen ganzen Workshop angehender Pschoanalytiker mitbrachte. Sie hockten sich nach der Vorführung um die große gelbe Python , die sich in der Mitte des Saales locker zusammengerollt hatte und berührten sie vorsichtig.
.
Obwohl ihr Besitzer zuvor gemeint hatte, Schlangen mögen kein Alkohol und eigentlich auch nicht angefaßt werden, schien die große Gelbe auch das gelassen hinzunehmen. Sie züngelte nicht einmal und ihre Augen hatte sie, vielleicht seufzend, geschlossen. Irgendwie gewann sie dabei jedoch als „Star des Abends“ so etwas wie Charakter. Vielleicht war ihr als längste und dickste und damit älteste Schlange unter den unfreiwilligen Darstellern nichts Menschliches mehr fremd. Jüngere Reptilien fliehen dagegen vor den Menschen, und wenn man sie packt, kucken sie so kaltherzig, als erinnerten sie noch die Zeit von vor 65 Millionen Jahren, da wir so klein wie Spitzmäuse waren und sie so groß, dass sie nicht in den Roten Salon gepaßt hätten. Wenn das auch für die große gelbe Python galt, dann ließ die sich jedenfalls nichts anmerken. Überhaupt wird schon bald für alle wilden Tiere gelten, dass sie gute Miene zum bösen Spiel machen müssen – als Edutainment-Elemente in menschlichen Soziotopen, wenn sie nicht aussterben oder im Zoo verblöden wollen. Dazu kommt nun noch von wissenschaftlicher Seite, vom Münchner Ökologen Josef Reichholf, die Aufforderung: Wir müssen weg von der Beschränkung der Forschung auf Arten, auf „artgerecht“, und uns auf Individuen konzentrieren: Jedes hat eine andere Persönlichkeit.
.
Im Film wurden der Python natürlich die Drehorte zugewiesen und sie brauchte sich dort bloß bewegen, dabei entschied sie sich jedoch stets für eine interessante Nach-vorne-Strategie – statt sich einfach beleidigt zusammen zu rollen. So kroch sie z.B. durch die kleine Öffnung der Theaterkasse und erzüngelte sich kurz den Kassierer, nahm auf einem der Tische in der Kantine ein schnelles Bad in einer Plastikwanne und wagte sich sogar die lange Treppe zu den oberen Rängen hinauf. Das alles hatte wenn schon nichts Spielerisches auch nichts Quälerisches an sich, aber man kann sich irren – gerade bei den Python, die zwar in der Alten Welt beheimatet, aber schon lange aus Europa verschwunden sind. Zum privaten Gebrauch einführen darf man sie allerdings noch.
.
In der Volksbühne hieß dieser an dem Abend: „Bodytalk“. Dazu ließen sich die beiden Tänzer mutig zwei gefleckte Python über den nackten Körper schlängeln, wo eine es sich scheinbar gemütlich machte. Zwar war der Saal für sie mit 27 Grad extra überhitzt worden, aber eine Körpertemperatur von 37 Grad direkt zu fühlen, schien dann doch noch angenehmer für Kaltblüter zu sein. Die beiden Reptilien hinterließen rote und grüne Farb-Schlieren auf dem Körper der Tänzer, diese wurden dann mit Hilfe der erwähnten Psychoanalytikerin gedeutet. Sie meinte jedoch, dass das Wichtige dabei – mindestens in therapeutischer Hinsicht – der direkte Körperkontakt sei. Vielleicht sind Schlangen ähnlich „heilsam“ wie Therapiehunde, -Delphine, -Pferde usw…
.
.
In Hoppegarten lebt das Ehepaar Ralf und Manuela Grabo. In ihrer ausgebauten Scheune und mehreren Volieren im Garten halten sie vier Hühner, drei Greifvögel, einen Kolkraben und zwei Pferde. In zwei Terrarien im Haus leben fünf Riesenschlangen und in einem Aquarium etliche Fische. Ralf Grabo war früher Jockey und arbeitete dann im Tierpark (Abt. Raubtierhaus), Manuela Grabo hat, als gelernte Tischlerin, früher nie was mit Tieren zu tun gehabt. Sie fand jedoch Schlangen „schon immer schön, mein Liebling aber ist der Uhu“. Dieser sowie die anderen Greifvögel wurden zu DDR-Zeiten aus Nachzuchten erworben, teilweise über befreundete Falkner. Über den Heimtierpark Thale fanden die Grabos 1995 ihren Kolkraben „Kolja“, der schon seinen Namen sowie „Hollo“ sagt, außerdem kann er bellen und gackern. Ihre Nebelkrähe spielte in einem neudeutschen Film mit, der im Knast Rummelsburg gedreht wurde, sowie in einem phantastischen US-Film – auf einem See in der Sächsischen Schweiz, wo sie auf dem Rand eines im Wasser schwimmenden großen Schuhs entlangzugehen hatte: „Die tat das, als hätte sie nie etwas anderes gelernt.“ Auch die Zumutung, mit einem fremden Hund zusammen einen überfahrenen Hasen an der Landstraße zu verspeisen, absolvierte sie mit Bravour: „In die Kamera fliegen mußte sie dann auch noch, und dann hatte die Filmproduktion auch noch nicht mal Geld dafür.“
.
Die leidige Honorarfrage: „Das sind Aufwandsentschädigungen, die nicht einmal den Unterhalt der Tiere decken.“ Eines der Graboschen Hühner spielte – für ein Trinkgeld – in einem Kinderfilm mit: auf einem schwankenden Oderkahn. „Auch das hat gut geklappt, mit der Zeit werden wir ja sowieso alle, wie soll ich sagen: professioneller.“ Neulich brauchte RTL eine Schlange, die sich kurz um einen beleuchteten Globus windet: Grabos Boa schaffte es, ohne daß Styropor-Stückchen als Stützen auf die Kugel geklebt werden mußten. Bei einer anderen Dreharbeit traf Ralf Grabo auf den amerikanischen Vogeltrainer, der einst mit Hitchcocks „Vögeln“ gearbeitet hatte – er bat ihn sofort um ein Autogramm: „So jemand ist für mich natürlich interessanter als irgendsoein Star.“
.
Mit Greifvögeln darf man laut des nun auch im Osten geltenden Bundestierschutzgesetzes nur beschränkt kommerziell auftreten. Grabos Bussard trat neulich in einem Stück von Johann Kresnik auf: Er saß auf dem ausgestreckten Arm einer schwangeren Schauspielerin. Obwohl der Bussard kaum Probleme mit dieser Rolle hatte, durfte er dann nicht mit auf ein Gastspiel der Volksbühne nach Belgrad: „Die Behörden wollten es nicht genehmigen. Serbien gehöre nicht zur EU und so weiter.“ Wegen solcher oder ähnlicher Restriktionen nehmen die Filmproduktionen meist gleich einen Falkner vor Ort in Anspruch oder hier einen Vogel der Adlerwarte im Teutoburger Wald. Und dann haben die Grabos auch noch zunehmend mit politisch korrekten Jungjournalisten zu kämpfen, die – wie tip-TV – immer wieder gerne Reportagen über falsch verstandene Tierliebe beim Halten seltener Tiere in urgemütlichen 3-Zimmer-Wohnungen senden: „Solche Tiere gehören in den Urwald!“
.
Manuela Grabo meint: „Eigentlich haben wir einen ganz schweren Stand in dieser Gesellschaft, wir sind eine Randgruppe. Und wie die Behörden mit uns umgehen, das grenzt mitunter schon an Schikane.“ Mit einigen Schlangen veranstaltet sie regelmäßig „Patientenabende“ in Reha-Kliniken: „Das hat sich so aufgebaut“, wobei sie kein „Zirkusspektakel“ veranstaltet, sondern primär „Aufklärung“ leistet. Auch ihre Schlangen kommen nicht aus dem Urwald, sondern aus der DDR. Eine wirkte neulich in einer TV-Dokumentation über verbotenen Tierhandel mit, wo sie auf dem Schwanebecker Zollhof in einer Voliere eine beschlagnahmte Python zu mimen hatte, die sich auf einem Ast zusammenringelt und noch ganz benommen ist von der ganzen. Schmuggeltour: Es klappte auf Anhieb.
.

.
Wissenschaft, Literatur und Leben
.
Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das Leben subtil, deswegen brauchen wir die Literatur, meinte Roland Barthes. Erschwerend kommt noch hinzu: Die theoretische Ökonomie überläßt die „Gesellschaft“ der Soziologie und diese klammert darin die Ökonomie aus. Die Literatur ist geeignet, Schlaglichter auf beider blinde Flecken zu werfen und sie in der Geschichte ihrer Protagonisten zusammen zu führen. Der Wissenschaftsjournalist der SZ Christian Weber berichtete jüngst über ein Forschungsprojekt des Anthropologen Alexander Bentley an der University of Bristol, in dem mit einem „Literarischen Elends-Index“ Wirtschafts- und Sozialgeschichte erhellt wurde: Mithilfe einer Datenbank von Google, in der man bis jetzt acht Millionen Bücher einscannte, konnte gezeigt werden, „dass sich in der Wortwahl englischsprachiger Bücher, die zwischen 1929 und 2000 veröffentlicht wurden, die ökonomische Lage der jeweiligen Epochen widerspiegelt“. Die Texte wurden danach durchsucht, „wie häufig bestimmte emotionale Wörter vorkommen, die auf Basisemotionen wie Ärger, Ekel, Angst, Freude, Trauer, Enttäuschung oder Überraschung hindeuten.“ Der daraus entstandene „literarische Elends-Index“ stimmte ziemlich genau mit einem ökonomischen Elends-Index überein, der sich aus den Inflations- und Arbeitslosenraten aus jenem Zeitraum zusammensetzte. Allerdings hinkt der literarische laut Christian Weber dem ökonomischen zehn Jahre hinterher. So lange brauchten die Autoren wohl, um die sozialen Verwerfungen, die sie u.U. in jungen Jahren selbst erlebten, künstlerisch zu verarbeiten. Konkret bezog sich das Vorhaben auf die ökonomischen Krisen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, auf die große Depression in den USA ab 1929, und die Stagflation in den Siebzigerjahren.
.
Was ist aber mit der Verelendung, die durch den „Neoliberalismus“ in den Achtzigerjahren, forciert noch nach Auflösung des Sozialismus einsetzte – und die noch anhält. Hierzu erschienen – ebenfalls mit etwa zehnjähriger Verspätung – eine Unmenge Sachbücher: Amazon listet allein unter dem Stichwort „Neoliberalismus“ 918 deutsche Titel auf, hinzu kommen noch mehr als drei mal so viele Titel zu Unterthemen wie: „Landgrabbing“ (50), „Verelendung“ (72), „Finanzkrise“ (2286) – und bedeutsam besonders in Berlin: „Prekariat“ (103), „Leiharbeit“ (217), „Mobbing“ (1756), „Mietwucher“ (12), „Gentrifizierung“ (111), „Gated Communities“ (102) sowie zu Überthemen wie: „Marxismus“ (4941), „Kapitalismuskritik“ (226), „Soziale Bewegung“ (etwa 2000) und „Occupy“ (116).
.
Slavoj Zizek, der „Superstar der Kapitalismuskritik“, wie „Die Zeit“ ihn nannte, meinte unlängst in der Volksbühne: „Die Mächtigen legitimieren sich heute mithilfe von technologischen Autoritäten: Vermeintliche Experten inszenieren sich als Problemlöser. Dabei ist oft schon die Art und Weise, wie ein Problem formuliert wird, irreführend. In der Ökologie ist beispielsweise von Mutter Erde die Rede. Was soll das sein? Die Prämisse einer radikalen Ökologie müsste lauten: Die Natur gibt es gar nicht. Sie ist kein harmonisches Ganzes, sondern selbst voller Katastrophen. Und das vom Einzelnen geforderte ökologisch korrekte Verhalten ist erst recht ideologisch – tu etwas für Mutter Erde, sammle deine Cola-Dosen. Das ist eine geniale Operation. Du fühlst dich schuldig, und gleichzeitig bietet man dir einen einfachen Ausweg an. Doch die wahren Ursachen bleiben unangetastet: unsere Fertigung von Waren.“
.
Das heißt, der gesellschaftliche Zusammenhang stellt sich im Kapitalismus nicht über gemeinschaftliche Produktion her, sondern über individuellen Warentausch, deswegen gibt es zum Stichwort „Konsum“ die meisten Buchtitel (3162), wenn auch viele eher „Shoppingtipps“ sind. Erinnert sei an den US-Präsidenten George Bush, der nach Twintower-Attentat, Hurrikan „Katrina“ und Finanzkrise, als der gesellschaftliche Zusammenhang ernsthaft gefährdet schien, den Konsum zur patriotischen Pflicht erklärte. Ähnliches gilt nun auch in Deutschland. Die FAZ vermeldete Anfang 2014 auf Seite 1 – unter Berufung auf das Statistische Bundesamt: „Die private Konsumnachfrage ist zur wichtigsten Stütze des Wirtschaftswachstums geworden.“
.

.
Alles wird grün und wächst
.
Damit ist nicht die „Übergriffigkeit“ der Naturwissenschaft gemeint, die z.B. dem Siegener Kulturwissenschaftler Niels Werber in seinem Buch „Faszinationsgeschichte Ameisengesellschaft“ bei den Insektenforschern unangenehm aufstieß. Man findet sie bei vielen Biologen, indem sie das von ihnen analysierte Tierverhalten zum „Modellfall der Gesellschaftstheorie“ erklären, also daß die Sozial- und Kulturwissenschaftler bei den Naturwissenschaftlern gefälligst in die Lehre gehen sollen, wenn sie weiterhin ernst genommen werden wollen. In Deutschland wurde das allerdings schon einmal durchexerziert (1), weswegen man diese Übergriffigkeit hierzulande inzwischen etwas gelassener sieht.
.
Dennoch sah sich das Zentrum für Literaturwissenschaft (ZfL) jetzt veranlaßt, den Bio-Philosophen Georg Toepfer zur Mitarbeit heranzuziehen. Er spricht von der Abwanderung biologischer Begriffe – und will dabei vielleicht nicht sehen, dass die armen Geistes- und Sozialwissenschaftler reihenweise vor den reichen „Lebenswissenschaftlern“ einknicken, indem sie von „generieren“, von der „Evolution des Internets“ oder vom „Ökosystem der Medien“ faseln. Am Schlimmsten sind die Journalisten, die von nichts eine Ahnung haben, aber perfektes „Bio-Speak“ beherrschen – wenn es um soziale Themen geht. Die FAZ schreibt: „Toepfer möchte die Geisteswissenschaften und ihre Leitbegriffe wie Kultur, Geist und Sprache vor einer ‚feindlichen Übernahme‘ durch den Naturalismus schützen,“ übertitelte ihren Artikel jedoch mit „Migrationshintergründe der Biologie“.
.
Mit „alles wird grün“ will ich jedoch nicht auf das symbolische, sondern auf das reale – spekulierende – Kapital hinaus. Die dem „Verein Westberliner Wertpapierbörse“ gehörende „Berliner Börse“, deren Domizil einem Gürteltier nachempfunden wurde, bietet laut eigener Angabe „eine einmalig große Auswahl an internationalen Titeln. Rund 10.000 Aktien aus 120 Ländern stehen zur Auswahl. Schwerpunkte liegen u.a. auf Aktien aus Amerika, Australien, Osteuropa und China.“ Man unkt, noch vor einigen Jahren wären amerikanische „Spielcasino-“ und „Privatgefängnis“-Aktien die Renner gewesen. Heute zählt man dort u.a. die Aktien der „Umweltbank“ zu den „umsatzstärksten“. Als Neuheit bietet die Börse via Internet „kostenlose Realtime-Kurse“ an. Ein Banker erzählte kürzlich dem Fernsehpublikum: „Früher wurden Aktien Jahre gehalten, heute oft nur noch Stunden, sogar nur Minuten. Die Privatanleger sind meistens die Verlierer, es gewinnt, wer die schnellsten Rechner hat, mitunter entscheidet weniger als eine Sekunde.“
.
Die „Umweltbank AG Nürnberg“ setzt sich für den „Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere für klares Wasser, reine Luft und eine gesunde Umwel“ ein. Das ist doch mal eine klare Ansage, mögen sich viele gedacht haben, weswegen die „Nürnberger Nachrichten“ schrieben, sie „stürmt seit 15 Jahren von Rekordergebnis zu Rekordergebnis“. Zwar zeigt das Börsenbarometer beim Trend nun etwas nach unten, aber das tut erfreulicherweise auch die „CO2-Bilanz“, die der „Umweltbank“ als „Gradmesser ihres ökologischen Erfolges“ dient.
.
Die taz hat ein Journal namens „zeozwei“ und berichtete 116 Mal über „Deutschlands grüne Bank“. Fast hat man den Eindruck, die Redaktion steht heute eher den fränkischen Bankern als den Bundesgrünen nahe. Erstere „emittieren“ gerade ihren „ersten grünen CoCo-Bond“ – zur „weiteren Stärkung des haftenden Eigenkapitals und damit als Grundlage für das zukünftige Wachstum.“ Wachsen wollen wir alle. Die taz kritisierte zuletzt, dass die Umweltbank ihren angestellten Werkstudenten bezahlten Urlaub und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verweigert habe – und damit gegen geltendes Arbeitsrecht verstieß. Das taz-Aufsichtsratsmitglied Hermann-Josef Tenhagen kritisierte in der Zeitschrift „Finanztest“ der gemeinnützigen „Stiftung Warentest“, die Bank habe Anlegern mit falschen Werbeaussagen riskante Beteiligungen an Windparks verkauft. Zudem sollen langjährige Investitionen in Windparks zur Altersvorsorge empfohlen worden sein. Anlegern bei ihren geschlossenen Fonds, die Verluste erlitten hatten, klagten: die Umweltbank habe sie bewusst über die Risiken der Windfonds getäuscht.
.

.
Wikipedia ergänzte: „Nach einer Klage der Verbraucherzentrale gegen die Umweltbank unterlag diese vor dem OLG Nürnberg. Nach Ansicht des Gerichts durfte die Bank nicht auf die Vorteile (hohe Genussrechtszinsen) hinweisen, ohne auch die Risiken entsprechend darzustellen.“ Desungeachtet tickerte der „Solarserver“ aus der „nach-gesellschaftlichen Projektewelt“ zum Jahresende: „Das Geschäftsvolumen der Umweltbank überschreitet die 3-Milliarden-Euro-Marke; Solar-Projekte haben größten Anteil am grünen Kreditportfolio.“
.
Parallel zu den „Windfonds“ – für den Bau neuer und zur Aufrüstung alter Windkraftanlagen (WKAs), gründeten sich deutschlandweit etwa 80 Bürgerinitiativen gegen weitere „Windparks“. Sie nennen sich „Rettet die Uckermark“, „Gegenwind Ettlingen“ usw.. Neuerdings werben sie gemeinsam für ein „Moratorium gegen Windkraftanlagen in Europa“ und haben sich dazu eine „European Platform“ geschaffen.
.
Berliner BIs – z.B. gegen den Ausbau der WKAs in Buch und Malchow, sind nicht dabei. Dafür um so mehr aus dem Umland, wo die „Windparks“ 15% des Strombedarfs von Berlin und Brandenburg decken. Wie man ihrer „Liste“ (auf Wikipedia) entnehmen kann, sind sie im Besitz von etlichen großen Aktiengesellschaften, u.a. die Bremer WKA-Entwicklungs-AG „Energiekontor“, deren Aktie laut Berliner Börse im vergangenen Jahr wieder stieg, nachdem sie sich bei ihrer Standortplanung wiederholt auf falsche „Wind-Prognosen“ verlassen hatte, aber „2015 alle gebauten Projekte erfolgreich ins Ziel brachte,“ wie „aktiencheck.de“ meldete. Die taz berichtete zuletzt, dass die Energiekontor AG „mehr als 500 Windräder in 86 Parks errichtet hat“, weitere seien geplant.
.
Alle wollen wachsen. „Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle,“ meint demgegenüber der Ökologe und Gründer von „Earth First“ Edward Abbey. Die BZ titelte am Sonntag: „Krebs, die Geisel der Menschheit“, weil nämlich gerade David Bowie gestorben war.
.

.
Anmerkung:
.
(1) Ernst Bergdolt, ein im „Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund“ organisierter Botaniker am Münchner Institut für Zoologie, wo von Frisch Direktor war, entrüstete sich 1936 – in einem Brief an das Reichserziehungsministerium: „Professor von Frisch hat ein unübliches Talent, seine Forschungsergebnisse für propagandistische Zwecke zu missbrauchen, ein Talent, das wir von jüdischen Wissenschaftlern kennen. Dagegen fehlt ihm völlig die Fähigkeit, seine Wissenschaft von einem weiteren Gesichtspunkt zu überschauen oder gar, was doch bei seinem speziellen Arbeitsgebiet, den Bienen, so nahe liegend und leicht wäre, Beziehungen zu finden zu der naturgegebenen Einrichtung eines völkischen Staatswesens.“
.
1941 wurde Karl von Frisch als „Mischling zweiten Grades“, als „Vierteljude“, eingestuft – und aus seinem Institut entfernt. Als dann aber der Schädling „Nosema apis“, ein „Sporentierchen, unter den deutschen Bienenvölkern wütete, über dessen Bekämpfung von Frisch schon 1927 publiziert hatte, setzte man ihn nach „Intervention eines hochrangigen Fürsprechers“ als „Sonderbeauftragten“ ein, wie der Anthropologe Hugh Raffles in seiner „Insektopädie“ schreibt – und das Ernährungsministerium verschob von Frischs „Entfernung aus dem akademischen Milieu ‚bis nach Kriegsende‘.“
.
Bei dem „hochrangigen Fürsprecher“ handelte es sich um den Veterinär Dr. Bernhard Grzimek, der seit 1933 als Unterabteilungsleiter erst im Landwirtschaftsministerium und dann in dessen Massenorganisation „Reichsnährstand“ arbeitete, wo er für „Eierüberwachung, Schlachtgeflügel und Bienenhaltung“ zuständig war. Um Unterstützung für Karl von Frisch hatte ihn sein Förderer Otto Koehler, damals Direktor des Zoologischen Instituts der Universität Königsberg, gebeten. Grzimek schrieb daraufhin laut seiner Biographin Claudia Sewig dem Kultusministerium „mit dem Briefbogen des Ernährungsministeriums“, dass von Frischs Bienenforschung extrem wichtig sei, „um die Honigerträge zu erhöhen und die deutsche Ernährung zu verbessern“.
.
.
Mit dem Hinweis auf diesen Brief unterstützte Otto Koehler nach dem Krieg wiederum Bernhard Grzimek selbst, als der wegen verschwiegener NSDAP-Mitgliedschaft seine Anstellung als Direktor im Frankfurter Zoo verlor. Auch in diesem Fall war das Schreiben hilfreich. 1941 war Karl von Frisch nicht nur weiterbeschäftigt worden, man erweiterte dann sogar „die Nosema-Aufgabe um den Forschungsauftrag, Bienen zu veranlassen, um einer Rationalisierung der Bestäubung willen, nur ökonomisch wertvolle Pflanzen aufzusuchen. Jahrzehnte zuvor hatte von Frisch bereits mit Duftorientierung experimentiert – indem er Bienen dressierte, auf einen bestimmten Geruch anzusprechen, bevor er sie freiließ, damit sie die entsprechende Blume aufsuchten -, doch es war ihm nicht gelungen, kommerzielles Interesse dafür zu wecken.“
.
Aber nun, mit dem sich ausweitenden Krieg, ging es darum, eine möglichst umfassende Autarkie bei der Versorgung des deutschen Reiches herzustellen. Raffles schreibt: „Diesmal, wachgerüttelt durch eine sich abzeichnende Misere, nationale Begeisterung und Neuigkeiten über ein breitangelegtes sowjetisches Forschungsprogramm ähnlichen Zuschnitts, drängte sogar die Reichsfachgruppe Imker auf Unterstützung seiner Arbeit.“
.
Das sowjetische Forschungsprogramm hatte nicht zuletzt Karl von Frisch selbst durch seine Schriften befördert, die in den Dreißigerjahren vom sowjetischen Biologen Jossif Chalifman ins Russische übersetzt worden waren. In seinem „Kleinen Bienenbuch“, das in den Fünfzigerjahren in der DDR erschien, schreibt Chalifman: „Die Methode der Bienendressur verbreitete sich schnell“ in der Sowjetunion. Dies geschieht mittels einer Zuckerlösung, die mit dem Duft der entsprechenden Blüte versehen wird. Damit konnte man die Tiere sogar dazu bringen, „Blüten auch solcher Pflanzenarten zu besuchen und erfolgreich zu bestäuben, auf denen sie nicht einmal süße Nektarnahrung fanden.“ Neben Flieder erwähnt Chalifman Weinreben: „Auf der Krim beobachteten Imker, wie die dressierten Bienen in Massen mit Höschen aus Blütenstaub vom Wein zu den Stöcken zurückkehrten. Niemals hatten Bienen den Wein besucht, und hier besuchten die mit Sirup aus den Blüten der [georgischen] Sorte ‚Tschausch‘ gefütterten Bienen nur diese Sorte. Unfehlbar fanden sie diese unter Dutzenden anderer Sorten heraus. Die Bienen erwiesen sich als fähig, die Weinsorten zu unterscheiden.“
.
Der Bienenforscher von Frisch hatte in seinem ins Russische übersetzten Buch „Aus dem Leben der Bienen“ (1927) über die „wichtigste Futterpflanze“, den Rotklee, geschrieben: „Der Nektar dieser Hummelblumen ist für Bienen nicht voll auszuschöpfen, weil ihr Rüssel zu kurz ist, um bis auf den Grund der Blumenröhrchen vorzudringen.“ Andererseits: „Wo der Rotklee feldmäßig angebaut wird, ist die Zahl der Hummeln zu gering, um die Millionen von Einzelblüten zu bestäuben. Die Bienen zeigen keine Lust, die für sie wenig ergiebigen Kleefelder zu befliegen, und wenden sich lieber besseren Trachtquellen zu. Die Folge ist eine schlechte Samenernte…Diesem Übelstand kann abgeholfen werden. Man stellt Bienenvölker an den Rotkleefeldern auf, dressiert sie auf Rotkleeduft und erreicht dadurch eine derartige Steigerung des Befluges, daß die Samenerträge durchschnittlich um 40% höher ausfallen. Die nunmehr zuverlässigen Ernten haben erfahrene Samenbauern in Rotkleegebieten rasch für das neue Verfahren ‚Duftlenkung‘ erwärmt.“ In Ermangelung eines weitergehenden „ökonomischen Interesses“ wurde das Verfahren aber leider nur „an wenigen Stellen geübt,“ fügte von Frisch hinzu. Er sah jedoch voraus, dass „es größere Verbreitung finden wird, wenn die Not zu intensiver Ausnützung des Bodens zwingt.“
.
.
1930 hatte Karl von Frischs Forscherkollege Gustav A.Rösch „Eine bienenkundliche Reise durch Sowjetrussland“ unternommen und dort vor allem Bienenzucht-Versuchsstationen besucht. Damals wurden analog zu den Kolchosen und Sowchosen überall „Kollektivimkereien“ und „Staatsbienenstände“ eingerichtet. Die Honigproduktion sollte damit, nicht zuletzt für den Export, gesteigert werden. Rösch fand die Chancen dafür außerordentlich gut, denn zum Einen wurde das Land noch nicht so wie in Westeuropa von intensiver Landwirtschaft genutzt und zum Anderen gab es für die Bienen große Trachtquellen: Buchweizenfelder, Sonnenblumenfelder und Lindenwälder z.B.. Ausführlich befaßt sich der Autor in seinem Reisebericht mit dem „Rotkleeproblem“ der UDSSR: Es gab dort für die Befruchtung dieser Pflanze seltsamerweise nicht genug Hummeln. Rösch konnte nicht herausfinden, warum, aber im Kaukasus lebte eine Bienenrasse – die mingrelische – mit einer für die Kleeblüten ausreichenden Rüssellänge. Diese nun im übrigen Russland für den Rotklee einzusetzen, darüber forschte insbesondere eine Versuchsstation nahe Moskau, die zu diesem Zweck zunächst 70 „Rotkleebeobachtungsstationen“ über das Land verteilt eingerichtet hatte.
.
Es ist anzunehmen, dass sie beim Einsatz kaukasischer Bienen auf den Kleeanbaugebieten von der „Duftdressur“ Gebrauch machten – zumal diese „Methode“ laut dem „Schweizerischen Zentrum für Bienenforschung“ sowieso „ursprünglich aus Russland stammt“. Karl von Frisch meinte jedoch: „Das Verfahren fußte auf meinen alten Versuchen über den Geruchssinn und über die ‚Sprache‘ der Bienen“ – um 1910 etwa. Gustav Rösch berichtete nur, dass er im Nordkaukasus eine „Königinnenzuchtstation“ besuchte, von wo aus die dort gezüchteten „langrüßligen ‚Rotkleebienen‘ in alle Teile der Union verschickt werden“. Die sowjetischen Bienenforscher waren jedoch damals über diese Lösung des „Rotkleeproblems“ noch „verschiedener Meinung“. Rösch war sich aber sicher, dass sie mit den kaukasischen Bienen erfolgreich sein würden.
.
Das wurden sie dann auch. Aber nach Auflösung der Sowjetunion sah man das plötzlich anders – politischer: Der Moskauer Bürgermeister Luschkow, ein leidenschaftlicher Imker, der sogar einmal eine Verbesserung der sowjetischen Bienenstöcke erfand, sagte 2008 in einer Rede auf dem Plenum der russländischen Bienenzüchter: „Unser Hauptproblem ist die Erhaltung der russischen Biene. Viele sagen – künstliche Befruchtung. Aber wie? Die Russin fliegt 80 Kilometer die Stunde, damit nur die Stärksten an sie herankommen. Sollen wir sie flach legen, auf den Rücken oder wie? Und viele Züchter sagen, na, ich nehme die kaukasische, die ist langsam. Wir dürfen aber nicht die russische Biene aufgeben. Die grauen kaukasischen sind diebisch, faul und langsam. Viele nehmen sie und sagen, sie sind besser, weil sie nicht stechen. Das kennen wir.“
.

.
Reduktionen
.
Wenn ich die „Zurück zum Bauernhof – Wir haben es satt“- und die „Degrowth“- sowie die Veganer- und Tierschützer-Bewegung richtig verstanden habe, dann müssen wir noch einmal auf den „realen Sozialismus“ zurückkommen, den Enzensberger einst „als höchste Stufe der Unterentwicklung“ abtat. Heute würde man jedoch statt von Unterentwicklung eher von Negativwachstum oder Gesundschrumpfung sprechen.
.
Beispiele für „Weniger ist Mehr“ gibt es auch in großen Organisationen: Im April 1999 lud die OAO Gazprom – der Welt größte Gaskonzern, das auf Aktienbasis privatisierte ehemalige Energieministerium der UDSSR – rund 100 Gas- Manager und -Experten aus der ganzen Welt ins Berliner Hotel Adlon. Es ging dabei um das Ende des Gebietsschutzes der nationalen Gaskonzerne und die Privatisierung der Gasnetzzugänge, wovon diese Branche sich ungeahnte Profite versprach. Holland, dessen „Gasunie“ immer noch das größte europäische Versorgungsunternehmen ist, hatte einen Manager auf die „internationale Gaskonferenz“ geschickt, der alle anderen auf der Konferenz schockte – mit seinem Vortrag, in dem er ausführlich erklärte, warum sein Konzern jährlich mehrere Millionen Gulden ausgibt, um die Verbraucher darüber aufzuklären, wie sie weniger Gas verbrauchen können. Das hörte sich unter all diesen Profitrittern auf dem Gasmarkt geradezu aberwitzig an – und wurde dann in den anschließenden Berichten über die Konferenz auch gar nicht erwähnt.
.
Als Beispiel aus einer kleinen Wirtschaftseinheit sei der Hof des Biobauern Matthias Stührwoldt bei Bad Segeberg erwähnt, der seine Kuhherde um drei Tiere verkleinert, denn er möchte wieder welche mit Hörnern halten, dazu muß jedoch zuvor der Stall umgebaut werden, wodurch drei Liegeplätze wegfallen. Daneben hat er 30 Hektar Pachtland abgegeben. Auf einer taz-Veranstaltung in Hamburg verriet er mir kürzlich, dass er mit seinen Kolumnen in der „unabhängigen Bauernstimme“, seinen Büchern und Auftritten bei Landfrauen- und Jungbauernverbänden, in Buchläden und Kulturzentren inzwischen mehr verdiene als mit seiner Milchwirtschaft, er könne diese jedoch nicht aufgeben, da es zu seinem Schriftstellerimage gehöre, dass er Bauer sei, dazu noch ein politisch aktiver.
.
Stührwoldt bewegt sich politökonomisch zwischen der industrialisierten Landwirtschaft, die gemäß der andauernden EU-Politik „Wachsen oder Weichen“ ständig expandiert, um auch noch die entferntesten Märkte bedienen zu können – und den „echten Bauern“, über die der Wiener Soziologe Roland Girtler eine Studie veröffentlichte. Den „echten Bauern“ fand er indes nur noch im indischen Gujarat und im rumänischen Siebenbürgen. Gleich am Anfang heißt es da, „daß sich seit über 5000 Jahren, als der Mensch seßhaft wurde, in unseren Breiten nicht soviel geändert hat wie nach dem letzten Krieg und vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als bei uns die alte bäuerliche Kultur allmählich zu Ende ging.“ Der „echte Bauer“ stellt laut Girtler „so ziemlich alles, was er zum Leben braucht, selbst her. Er übersteht Krisenzeiten wie Kriege mit Würde und Tüchtigkeit. Er widerspricht einer langweiligen, konformistischen Konsumkultur-“ indem er darauf besteht, auch in Zukunft Hand- und Kopfarbeit nicht zu trennen. Heute hingegen werde der Bauer „dirigiert und geknecht“. Der Schriftsteller Alexander Tisma meinte, in Serbien gab es nie eine bürgerliche Kultur, deswegen kamen die Bauern auch während der Bombardierungen in die Stadt – und ohne, dass sie den Preis für ihre Produkte erhöhten.
.