Der Satz lautete ursprünglich – bei Luther: „Der Bauer ist witzig geworden“ – im Sinne von: gewitzt, listig und aufmüpfig, sich schließlich militant gegen Adel und Klerus zusammenrottend. Was sich dann zu einem Bürgerkrieg ausweitete, der nach Rosa Luxemburg nichts anderes als ein Klassenkampf ist. Und dieser „Krieg“ wurde von der unterdrückten Klasse der Bauern 1525 verloren. Luther stand auf der Seite ihrer Ausbeuter.
.
Der Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz verglich die List mit dem Witz: „Wie der Witz eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen“.
.
„Das Tier ist witzig geworden“, damit ist nun nicht bloß gemeint, dass heute von den Bauern nicht mehr viel zu erwarten ist, sondern dass man erst bei einer ausdauernden Konzentration auf das individuelle Tier merkt, wieviel „Witz“ es hat – nicht zuletzt bei den Versuchen, seine Unfreiheit zu überwinden oder seinen Willen durchzusetzen, also sich etwas einfallen zu lassen.
.
Der US-Psychologe Kenneth Shapiro spricht z.B. in bezug auf Hunde von ihrem „Interesse, eine Beziehung zu einem Menschen zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten“. In seinem konkreten Fall handelte es sich um einen herrenlosen Mischlingswelpen, den Tierschützer auf einer Müllkippe fanden und in ein Tierheim brachten, wo der Autor ihn erwarb. Sein Bericht über das Zusammenleben mit dem von ihm „Sabaka“ genannten Rüden findet sich in der Aufsatzsammlung „Ich, das Tier“ (2008). Der Hund schaffte es z. B. mit seiner „offensichtlichen Überzeugung“, dass Shapiro „ihn ausführen werde“, dass genau „diese Absicht“ auch bei ihm „ausgelöst“ wurde.
.
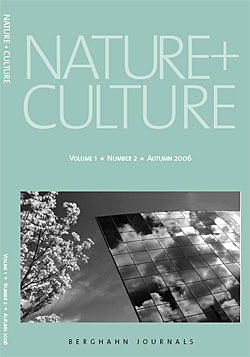
.
Der Berliner Arbeitskreis für Human-Animal-Studies Chimaira hat gerade ein neues Buch veröffentlicht: „Das Handeln der Tiere“ (2016). Zentral ist darin der Begriff „Agency“, was so viel wie Handlungsmacht und Wirkmacht bedeutet. Dabei kritisieren sie u.a. die feministische Biologin Donna Haraway, die nicht einmal Labortieren die Handlungsmacht absprechen will. Ich fand dazu in dem Buch „Vom Übertier“ ein Beispiel aus dem permanent Hunde vernutzenden Leningrader Großlabor von Iwan Pawlow: Einer der Hunde „vertrug die Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit nicht“, woraufhin Pawlow prompt einen „Freiheitsreflex“ in seine Reiz-Reaktions-Theorie einführte.
.
Die Autoren der „Human-Animal-Studies“ loten in ihrer Aufsatzsammlung weniger das Widerstandspotential der Tiere aus als die Tragfähigkeit des Begriffs „Agency“. Im Vorwort erwähnen sie jedoch einige Anekdoten über Tiere, die sich etwas einfallen ließen, z.B. von einer Schimpansin, die eine Zeichensprache lernte und diese nutzte, um damit Bitten an eine Wissenschaftlerin zu richten, und die über eine Kuh, „die aus einem Schlachthof ausbrach und sich ihren Weg durch eine Großstadt bahnte“. Die Herausgeber fügen jedoch hinzu: „Die Geschichten über die freiheitsliebenden und gewitzt handelnden Tiere scheinen die Ausnahme zu bilden, die die Regel bestätigen, wonach ‚das Tier‘ das Gegenbild ‚des Menschen‘ darstellt.“
.
Mit den „gewitzt handelnden Tieren“ meinen die Autoren „Einzelfälle“; es gibt jedoch ganze Tierarten, die so – unter den besonderen Bedingungen ihrer Inhaftierung – handeln.
.
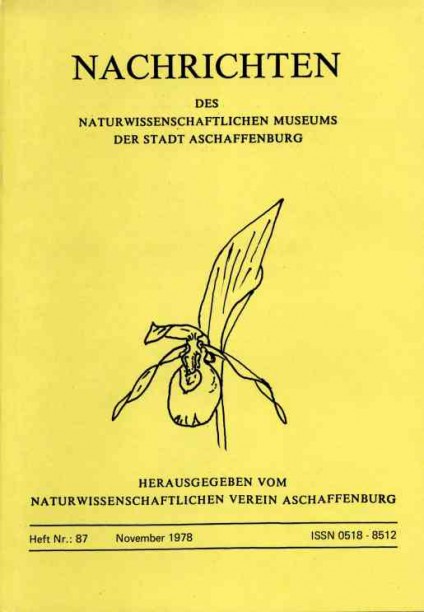
.
Freilebende Orang-Utans z.B. gebrauchen nur wenige Werkzeuge (Termiten graben sie z.B. mit den Händen aus), in Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen zu wahren Ausbrecherkönigen. Der „National Geographic“-Autor Eugene Linden hat in seiner Anekdotensammlung „Tierisch Klug“ (2001), die wesentlich auf Berichten von Zootierpflegern beruht, etliche Geschichten darüber veröffentlicht. „In der Zoowelt sind die Orang-Utans für ihre Fluchtversuche berühmt,“ schreibt er. Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er das selbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. „Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen“ – so lange, bis er es geöffnet hatte. Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo erneut aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wird seitdem ständig überwacht. Demnächst will man sie in einen anderen Zoo abschieben.
.
Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans vor der ungewohnten Umgebung. „Auf einer gewissen Eben wissen die meisten gefangenen Tiere, dass der Zoo der Ort ist, in dem sie leben.“Von zwei Mitarbeitern am Projekt „Think Tank“ zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Orang-Utans im Nationalzoo in Washington erfuhr Eugene Linden von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, die Orang-Utans dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus – und wieder reingegangen. Einer der „Think Tank“-Mitarbeiter meinte zu Eugene Linden: „Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gebe, werde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen.“ Linden fügte hinzu: „Und so sind die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“
.

.
In Romanen und Filmen wird die Handlungsmacht von Tieren mitunter als Bedrohung dargestellt:
In der Kurzgeschichte „Die Vögel“ (1952) von Daphne du Maurier bemerkt ein englischer Landarbeiter, dass sich die See- und Landvögel immer aggressiver verhalten. Er vermutet irgendwann, dass hinter ihrer scheinbar zufälligen Schwarmbildung eine Art kollektive Intelligenz steckt.
.
Während die Frankfurter Kulturwissenschaftlerin Eva Horn der „Schwarmintelligenz“ neuerdings nur Positives abgewinnen kann (in ihrem Buch darüber), sieht der englische Landarbeiter darin eine zunehmende Gefahr und fängt an, seine Hütte zu befestigen. Aus dem Radio erfährt er von ähnlichen Vorgängen im ganzen Land. Nachdem alle Verbindungen zur Außenwelt unterbrochen und die benachbarten Bauern durch Attacken der Vögel umgekommen sind, entwirft der Landarbeiter für sich und seine Familie einen Überlebensplan.
.
Die Erzählung endet ebenso offen wie der Film „Die Vögel“, den Alfred Hitchcock daraus 1963 machte. Er verwendete dazu noch zwei Realereignisse – eine aus dem kalifornischen Ort „La Jolla“: Dort war ein größerer Schwarm Spatzen durch den Kamin in ein Haus eingedrungen. Während der Vorbereitungen für den Film kam es in der nahen Küstenstadt Capitola zu einem weiteren Vorfall: Hunderte „Dunkler Sturmtaucher“ (aus der Familie der „Sturmvögel“) flogen gegen Hausdächer, zerbrachen Fenster und durchtrennten Stromleitungen. Im Film wurde darauf bezug genommen – mit einem Dialog zwischen einer Ornithologin und einem Handelsvertreter in einem Restaurant.
.
Erst Jahrzehnte später stellte sich laut Wikipedia heraus, dass die Tiere von Domoinsäure, einem von Kieselalgen der Gattung Pseudo-nitzschia produzierten Nervengift, befallen waren. 1991 wurde in Monterey Bay ein ähnliches Massensterben von Braunpelikanen beobachtet, was auf die Toxine einer seltenen Algenblüte zurückgeführt werden konnte. Ein Zusammenhang zwischen den beiden „natürlichen“ Massenvergiftungen in derselben Gegend wurde aber erst im Dezember 2011 im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung nachgewiesen.“
.

.
In vielen Filmen wird derweil nahendes Grauen mit Rabengekrächze untermalt. Hitchcocks einstige Hauptdarstellerin, Tippi Hedre, ist davon frei. Sie lebt heute auf ihrer Ranch in Kalifornien mit Raben zusammen. Der Anblick der Vögel erinnere sie ein wenig an die Dreharbeiten 1963, meint sie. Der Unterschied sei jedoch: „Sie greifen nicht an.“
.
So wie die Ornithologin in dem Hitchcock-Film davon überzeugt war, dass den Vögeln das geistige Potential fehlt, Angriffe mit destruktiven Beweggründen zu führen, ist sich auch heute noch der Harvard-Neurologe Marc Hauser sicher, Tiere sind generell nicht in der Lage, sich zu einem Aufstand gegen die Menschen zusammenzurotten. Eine Revolution ist mit Tieren nicht zu machen, schreibt er in seinem Buch „Wild Minds“.
.
Der Dramatiker Heiner Müller mutmaßte: Die Bedrohung durch die Vögel in Hitchcocks Film könnte ein Symbol für die „Rebellion der Natur“ sein, die der Mensch „ohne Rücksicht auf seine Zukunft als Gattungswesen verwüstet…Vielleicht geht es letztlich nur noch darum, wer zuerst mit wem fertig wird, die Natur mit der Menschheit oder die Menschheit mit der Natur…“
.

.
Dieser apokalyptischen Frage will ich hier aber nicht nachgehen, sondern mich auf den Witz von Tieren konzentrieren, der in ihrem sozusagen normalen Leben zutage tritt, bei manchen Individuen und Arten mehr, bei anderen weniger. Mehr z.B. erwiesenermaßen bei Rabenvögeln, weniger vielleicht bei Eidechsen…Aber selbst dabei gibt es z.B einen Leguan, Igor der seiner Besitzerin, Annemarie Beyer, laufend witzig kam. Sie hat das in ihrem schönen kleinen Buch „Mein Leben mit Igor“ (2007) beschrieben, der Untertitel lautet: „Eines Tages verlor ich den Verstand und kaufte einen grünen Leguan…
.
Spatzen sind eigentlich schon witzig, wenn man sie nur vor sich in einem Gartenrestaurant sieht, wie sie die Speisereste aufpicken. Zudem gibt es immer wieder ganze Spatzen-Populationen, die sich etwas Neues einfallen ließen.
.
Das wissenschaftliche Standardwerk „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ (HBV) widmet allein den Spatzen fast 100 Seiten. Sie gehören wie die Rabenvögel zu den Singvögeln. Wenn es um Verbreitung, Nahrungssuche, Wanderungen, Gesang, Fortpflanzung. Brut- und Sozialverhalten, Bestandsentwicklung etc. geht, schreiben die HBV-Autoren im Präsens. Dieses Verhalten ist quasi ewig wahr. Beobachtungen von einzelnen Tieren oder kleinen Schwärmen bzw. Populationen werden dagegen im Imperfekt erzählt, so als wäre deren Verhalten bereits Vergangenheit. Das liest sich so:
– „An einer Bushaltestelle öffneten Haussperlinge durch Flattern vor dem Photosensor die automatische Tür zum Warteraum, zu dem sie vorher durch eine Schwingtür gelangt waren. (1991)“
.
– „In einen Baumarkt, in dem Sämereien verkauft wurden, verschafften sie sich Zutritt, indem sie die Lichtschranke an der Eingangstür betätigten.“
– An einem Hotel „klammerten sie sich über Stunden einer über dem anderen an die Fassade und warteten auf das Balkonfrühstück der Gäste (1984),“
.

.
Die englische Musikerin und Hobbyornithologin Clare Kipps veröffentlichte 1953 ein Buch über einen Spatzen, der zwölf Jahre bei ihr lebte. Die Autorin, die allein in London wohnte, entwickelte ein besonderes Verhältnis zu „Clarence“ – ihrem Spatz, der in den Kriegsjahren, da Clare Kipps im Luftschutz eingesetzt war, in ganz England berühmt wurde, weil er die im Luftschutzbunker sich Versammelnden unterhielt, so dass sie vorübergehend ihrer Sorgen und Ängste vergaßen. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag über „Clarence“:
.
„Neben einigen anderen Tricks war die Luftschutzkellernummer sehr beliebt: Clarence rannte auf den Ruf „Fliegeralarm!“ hin in einen Bunker, den Mrs. Kipps mit ihren Händen bildete, und verharrte dort reglos, bis man „Entwarnung!“ rief. Noch beliebter waren indes seine Hitlerreden: Der Spatz stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten, durch ein Jugendunglück leicht lädierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu tschilpen. Er steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezeter, verlor dann scheinbar den Halt, ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht.“ Applaus! „Clarence wurde zu einer Symbolfigur der von Hitlers Luftangriffen geplagten Londoner und ihres Durchhaltewillens. Er wurde in Presseberichten gefeiert, und sein Bild zierte Postkarten, die zu Gunsten des Britischen Rotes Kreuzes verkauft wurden.“
.
Clare Kipps Buch über ihn, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, wurde von dem Biologen Julian Huxley mit einem Vorwort versehen. Für die deutsche Ausgabe – „Clarence der Wunderspatz“ – schrieb der Biologe Adolf Portmann ein Nachwort: „Vom Wunderspatzen zum Spatzenwunder“ betitelt. Darin versuchte er vorsichtig einige Verallgemeinerungen aus Clare Kipps Langzeitbeobachtung an einem einzelnen Tier zu ziehen. Clarence konnte singen, wobei er von der Autorin am Klavier begleitet wurde; Portmann schreibt: „Es mag im Spatzen ein sehr vages allgemeines Erbschema eines Liedes vorhanden sein, das in der Spatzenwelt normal gar nicht ausreift, das aber in neuer Umwelt sich entwickelt. Solche Erscheinungen kennt die Erbforschung da und dort. Das würde uns zeigen, wie wenig ‚frei‘ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt…Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.“
.
Ansonsten begrüßte es Portmann, dass der knapp 100seitige Bericht sich auf die Individualität eines Vogels konzentrierte: „Wir wissen durch nüchterne Beobachtung, dass bei manchen Vogelarten gerade im Gesang starke Individualitäten sich äußern.“ Außerdem erfreute es Portmann, dass sich auch in der biologischen Forschung langsam Begriffe wie „Stimmungen“ oder „Gemütsleben“ durchsetzen: „Das Tiergemüt kommt zu Ehren,“ schrieb er. In dem Buch von Clare Kipps hört sich das so an:
.
„…Er nahm mir nie etwas übel und betrachtete mich von klein auf als seine Erretterin aus jeder Schwierigkeit und Klemme.“
Clarence schlief im Bett der Autorin, an ihren Hals geschmiegt. Einmal wollte eine Freundin von Clare Kipps im Bett übernachten: „Er lief das Kissen auf und ab, schalt und drohte und griff schließlich meine Freundin so wütend an, dass sie als Eindringling gezwungen war, aufzustehen…“ Und im Wohnzimmer zu schlafen.
„Der erste Teil oder die Einleitung [seines Gesangs] war ein Ausdruck des Vergnügens, der guten Laune und alltäglichen Lebensfreude, während der zweite Teil, das eigentliche Lied, ein Verströmen reinen Entzückens war. Beide Teile waren gewöhnlich in F-Dur, aber der zweite Teil variierte an Tonhöhe um soviel wie eine kleine Terz, je nach der Tonstärke.“
„Wenn er es satt hatte [das Publikum im Luftschutzbunker mit Tricks zu unterhalten], „nahm er eine Patiencekarte in den Schnabel und dreht sie darin zehn- oder zwölfmal herum. Das war glaube ich sein Lieblingstrick, denn er hatte ihn selbst erfunden und vergnügte sich noch jahrelang damit…“
„Leider begann er im Frühjahr 1941 des Lebens in der Öffentlichkeit mit all seinem Glanz überdrüssig zu werden…“
„Es war eine sehr wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens, dass wir viele Stunden friedlicher Betrachtung in Stille zusammen genießen konnten. Ich liebe weder Geräusche noch zuviel Musik.“
Umgekehrt war Clarence „sehr heftig dagegen, daß ich in einem neuen Kleid erschien, und selbst ein neuer Hut oder neue Handschuhe riefen scharfen Protest hervor.“
„Nach der verspäteten Reife bildete sich sein Charakter, und weil sein Dasein verhältnismäßig frei von Ereignissen war, blieben sein Verhalten und Gewohnheiten ziemlich gleich…Sein Charakter war – abgesehen von seinem wilden Temperament und der Eifersucht – ohne Makel. Es lag nichts Zerstörerisches in seinem Wesen, und nie war er gierig…“
Im Kapitel über sein letztes Lebensjahr heißt es: „Das stolze Gebaren, das wählerische Verhalten und der tyrannische Eigensinn waren verschwunden…“ Er erwies sich als sehr weise – „es fiel mir immer schwerer, ihn als einen gewöhnlichen Vogel zu betrachten.“
Abschließend schreibt Clare Kipps: „Wenn meine Vermutung richtig ist, dann ist die Psyche eines kleinen Vogels von größerem Interesse, als es die Ornithologen bisher angenommen haben…Dass seine Intelligenz überragend war, glaube ich nicht. Ich bin klügeren Vögeln begegnet. Was ihn so interessant und reizend machte, war die Fähigkeit, durch das Medium der ungewöhnlichen Umgebung seine Vogelnatur in einer Sprache auszudrücken, die ein menschlicher Verstand begreifen und an der er teilhaben konnte. Und darin war er vielleicht einzigartig.“
.

.
Ich brachte als Kind auch einmal einen Spatz mit nach Hause. Er war aus dem Nest gefallen und ich zog ihn groß. Zwar hatte ich damals keine Ahnung vom Füttern eines solchen Jungvogels, aber meine Eltern halfen mir – wir probierten einfach alles aus. Und er entwickelte sich gut. Im Sommer kam er mit aufs Land. Und dort mauserte er sich zu unserem interessantesten Haustier. Bei Spaziergängen im Wald flog er voraus, landete aber immer wieder auf der einen oder anderen Schulter und erzählte uns von da aus alles mögliche. Er unterhielt sich gerne mit uns. Im Haus stürzte er sich auf den Frühstückstisch, landete dabei auch mal im Honig und in der Marmelade – und mußte jedesmal mühsam gewaschen werden. Auch stürzte er sich gerne auf den in der Sonne liegenden Dackel und zupfte ihm graue Haare aus dem Fell. Mittags schlief er bei meinem Vater in der Halsbeuge. Einmal schlüpfte er nachts unter den Bauch des Meerschweinchens, das ihm daraufhin gedankenverloren die Flugfedern anknabberte. Der Spatz, den wir Benjamin nannten, konnte danach eine ganze Weile nur noch schlecht fliegen, er blieb aber fröhlich und unternehmungslustig und begleitete uns z.B. einfach zu Fuß auf unseren Spaziergängen. Am Liebsten fuhr er im Auto mit, wobei er sich auf die Rückenlehne des Fahrers setzte und sich auf den Verkehr konzentrierte. Lange Zeit erzählten wir anderen Leuten nur noch Geschichten, in denen er die Hauptrolle spielte. Und er dachte sich auch fast täglich neue Aktivitäten aus, die uns begeisterten, auch wenn sie aus seiner Sicht vielleicht schief gingen. Schon bald war er unser beliebtestes Familienmitglied. Wenn einer von uns nach Hause kam, war seine erste Frage: „Wo ist Benjamin?“ „Was macht er?“ Wir kamen zu der Überzeugung, dass er sich als Mensch begriff, Vögel, auch Spatzen interessierten ihn nicht, und der Größenunterschied zwischen sich und uns schien ihm nichts aus zu machen.
.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es seltsamerweise viele Bücher, meist für Jugendliche, die von einem Tier und seinem Schicksal handelten. Erwähnenswert sind vor allem zwei Autorinnen, die sich wie Clare Kipps auf einige wenige Vögel konzentrierten – und das über Jahrzehnte und mehrere Generationen: Einmal die englische „Bird-Watcherin“ Len Howard, deren Buch „Birds as Individuals“ 1952) von Julian Huxley bevorwortet wurde, und zum Anderen die Berchtesgardner Malerin Else Thomé, deren „Salzberger Schwalbengeschichten“ 1949 erschienen.
.
Tier- und Ethnofilme, beides sind Genre, die fast immer ernst, mindestens nachdenklich stimmen sollen. Zumal die Tierfilme ebenso wie die Ethnofilme stets damit enden, dass gesagt wird, die Protagonisten seien sämtlichst vom Aussterben bedroht, die letzten ihrer Art quasi. Der Sohn einer Freundin klagte, als er noch klein war, nach jedem Tierfilm weinend: „Ich möchte kein Mensch mehr sein.“ Auch Deutschlands bekanntester Naturforscher Josef Reichholf versteht sein ökologisches Wirken in Wort und Tat als moralische Aufrüstung und Sensibilisierung: „Die Menschen brauchen schlechtes Gewissen“.Er fühlt sich selbst mit seiner „Lebensweise“ schuld – als ein in München lebender und viel reisender Professor, der demnächst sein 30. Buch veröffentlicht. Dennoch scheint auch er wenig Hoffnungen zu haben: „Vielleicht geht sie ja rechtzeitig vorüber, die Zeit des Menschen, bevor allzu viel Natur vernichtet ist. Dann erholt sie sich wieder. Leider haben wir, habe ich nichts mehr davon.“ Ähnlich äußerte sich die Tierbefreierin und Schriftstellerin Karen Duve kürzlich in ihrem Endzeit-Essay „Warum die Sache schiefgeht“: Am Schluß ihrer pessimistischen Weltbetrachtung schöpfte sie nur noch daraus Hoffnung, dass nach dem Untergang der Menschheit eine andere Spezies hochkommt: „Großäugige, intelligente Weidetiere. Es kann doch eigentlich nur besser werden.“ Der amerikanische Zoologer Robert W. Hegner hatte zuvor bereits die Wiederkäuer an die Spitze der evolutionären Säugetier-Entwicklung gestellt, weil ihr Verdauungssystem weiter als das menschliche Gehirn spezialisiert sei.
.
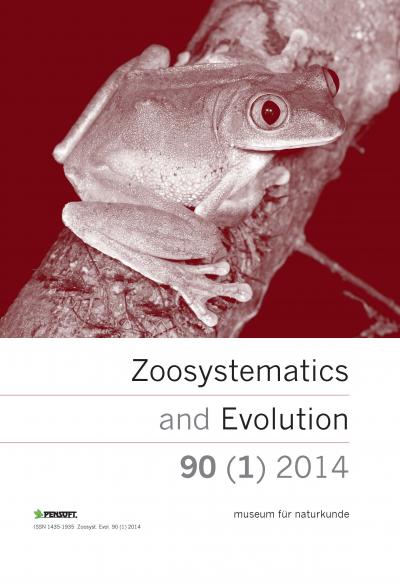
.
Das Lustige an den Tieren entdeckten meist nur Leute, die sich Tiere anschaffen, um sich an ihnen zu erfreuen. Wir z.B. hatten zu Hause so viele, dass meine Mutter ganze Abendrunden mit lustigen Tiergeschichten unterhalten konnte. Den professionellen Tierforschern andererseits, die keine Kosten und Mühen scheuen, um statt bloße Anekdoten „objektive Daten“ über bestimmte Tiere zu sammeln, ging und geht es meist um „artspezifische Reaktionen“ (Instinkte, genetische Fixierungen, Hormonhaushalte). In der darwinistisch-utilitarischen Verhaltensforschung wird zudem ständig nach dem Nutzen gefragt. So schreibt der amerikanische Rabenforscher Bernd Heinrich: „Sowohl Sender [Nestjunge] als auch Empfänger [Elternpaar] haben Nutzen von der Kommunikation. Aber Kosten und Nutzen der Beteiligten können schwanken, und die Evolution verfolgt bei allen Beteiligten das Ziel, die Kosten zu minimieren.“ Auch Josef Reichholf macht bei seinen Naturbeobachtungen gerne Kosten-Nutzen-Rechnungen auf. Der „erzeugte Überschuss“ – Nachkommen – ist für ihn „die eigentliche ‚Währung der Evolution'“.Und wenn etwa junge Katzen ständig spielen oder Dohlen sich gerne als Luftakrobaten betätigen – ist auch das äußerst nützlich – als „notwendiges Lernen“, um fit für den „Struggle of Life“ zu sein.
.
Heute wird der „Nutzen“ im übrigen gerne objektiviert und mathematisiert, d.h. in Energiemengen (Kosten) gemessen: „What comes out must come in! Input-Output, dazwischen befindet sich eine Black Box: Sei es eine Pflanze oder ein Tier oder alle zusammen ein „Ökosystem“, in dem „Nischen“ besetzt werden.
.
Im Grunde stimmen die meisten Biologen mit der Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard überein, „dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Bei dem israelischen Ornithologen Amotz Zahavi ist daraus ein ganzer kapitalistischer Gesellschaftsroman geworden. Er hat Lärmdrosseln („Arabian Babbler“) erforscht. Bei ihnen bekommen Paare von unverpaarten Artgenossen „Hilfe beim Nestbau und Füttern der Jungen“. Diesen schon fast klassischen Fall von Kooperation – neuerdings: Altruismus genannt – deutet er in „ein selbstsüchtiges Verhalten“ um, indem er es mit BWL-Begriffen durchdekliniert: „Die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren…Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen“. Es ist von „Werbung“, „Qualität des Investors“ und „Motivation“ die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen der Vögel quasi mikronietzscheanisch auf ein egoistisches Gen zurück, indem die „individuelle Selektion“ bei den Lärmdrosseln eben „Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen“ begünstige, der berühmte Darwinsche „Selektionsmechanismus“ aber ansonsten erhalten bleibe.
.

.
Die Erforschung des Witzes von Tieren könnte desungeachtet langsam in der „Spaßgesellschaft“ einen zoologischen Paradigmenwechsel einleiten. Beim Thema „Spiele“ ist sich der amerikanische Rabenforscher Bernd Heinrich bereits unsicher: „Manchmal führen Raben scheinbar sinnlose kleine Handlungen aus, bei denen ich mich frage, ob sie wirklich einem blinden genetischen Programm folgen oder ob sie nicht doch unter dem Einfluss von Denken oder gelegentlichen Launen handeln.“
.
Der ungarische Psychoanalytiker Sandor Ferenczi freute sich jedoch zu früh, 1923, dass der „einseitige Nützlichkeitsstandpunkt, der jetzt die ganze Naturwissenschaft beherrscht,“ wankt, denn die „bisherige Nutzphysiologie…, auch wenn sich nur ein Teil unserer genitalthoretischen Annahmen bewahrheit, bedarf einer ‚lustbiologischen Ergänzung‘.“
.
In der ersten Ausgabe der Berliner Zeitschrift „Tierstudien“ machte sich der Dramaturg Maximilian Haas Gedanken darüber, was das Lachen des Publikums über Tiere auf einer Theaterbühne bedeutet. Er hatte 2011 in Amsterdam zusammen mit dem belgischen Performancekünstler David Weber-Krebs das Stück „Balthazar“ aufgeführt, in dem ein Esel namens Balthazar neben fünf Schauspielern die Hauptrolle spielte. Inspiriert wurde das Projekt von Robert Bressons berühmten Film „Au hasard Balthazar (1966), in dem es um das traurige Leben und den einsamen Tod eines Esels geht – um eine „schicksalhafte Abwärtsspirale“ laut Maximilian Haas. Erst bei der Premiere stellte sich heraus, dass sie keine Tragödie, sondern eine Komödie inszeniert hatten – mit dem völlig untheatralischen Esel. Im Lachen des Publikums über das Tier lag jedoch „gleichermaßen eine Quelle der Lust wie ein Gewaltpotential.“
.
Die Asymmetrie zwischen uns und den Tieren wächst statt geringer zu werden. Die heutige Tierwelt ist bedroht – und das ist eine Tragödie. Nicht zuletzt, weil das Globale inzwischen als System das Innere geworden ist und das Lokale das Außen und Andere, das immer mehr zusammenschmilzt. Die Tiere und Pflanzen reagieren darauf mit massenhafter Flucht in die Städte – in das System.
.

.
Man kann den „Alarmismus“ aber nicht immer weiter treiben, deswegen versuchte der Ökologe Josef Reichholf bereits zu bremsen: „Erfolgreicher Naturschutz braucht nicht mehr Ökologie oder sonstige Wissenschaft, sondern viel mehr Emotion“. Er denkt dabei aber nicht an „witzige Tiere“, sondern eher an frohgemute Tierfreunde, und dass die ihre „Sache“ mit mehr Einfühlungsvermögen und weniger Bestimmungsbüchern angehen. Der Psychoanalytiker Jacques Lacan behauptete, am Anfang jeder Wissenschaft stehe die Hysterie. Auf die Ökologie bezogen: Erst sind es emotional hocherregte Tierbefreier und ins Illegale lappende Naturschutz-Aktivitäten (wie z.B. Bäume „vernageln“, um sie vor dem Gefälltwerden zu retten oder Versuchstiere aus Labore befreien), daraus werden dann mit der Zeit aufklärerisch engagierte „Naturliebhaber“, die am Ende abgeklärte Forschungsberichte (z.B. über die Wachstumszyklen von Nadelwäldern) in ihren Fachjournalen veröffentlichen. Wie alle Wissenschaften geht auch die Ökologie sozusagen den Weg allen Fleisches.
.
Der Dichter und Singvogelfreund Wiglaf Droste schrieb in einem Elstern-Haßgedicht in der taz: „Die zarte Blaumeise greift sie an und all die zaubrisch tirilierenden Sängerinnen und Sänger der Vogelwelt…Erdrückend ist die Beweislast gegen die Elster. Elster hört Böhse Onkelz und singt entsprechend, Elster liest Junge Freiheit und spricht auch so. Elster zetert ständig, das Volk der Elstern stürbe aus. Das ist leider überhaupt nicht wahr…Der Nazivogel braucht einen vor den Latz. Schnell, dringend und unmissverständlich…“
.
Der Biologe Cord Riechelmann war darüber so erbost, dass er in der selben Zeitung klar stellte: Es sei zwar wahr, dass Elstern „in manchen Gegenden einen Großteil der Erstbruten von Amseln fressen.“ Dennoch lasse sich „kein nachweisbarer Einfluss dieser Tatsache auf den Bestand der Amseln finden. Amseln bringen es in Städten mitunter auf bis zu drei Bruten in einem Jahr und offensichtlich können sie sich den Verlust des ersten Geleges ‚leisten‘. Dass Elstern die Zweitbruten wesentlich weniger bis gar nicht angreifen, erklärt sich aus ihren Fressgewohnheiten. Magen-, Kot- und Speiballenanalysen von Elstern ergeben überall – ob in Manchester, Poznan oder Erfurt – ein ähnliches Bild. Sie ernähren sich in der Hauptsache von Samen, Früchten, Insekten und deren Larven, Regenwürmern, Knospen und Haushaltsabfällen aller Art, von Fischschuppen bis Hühnerknochen. Kleinvogelküken- oder Eierreste lagen bei allen Untersuchungen etwa bei drei Prozent.“
.
Der Ornithologe Josef Reichholf zitierte zur Warnung vor übermäßiger Bejagung der Nesträuber aus einer Langzeit-Untersuchung von Rabenkrähen. Sie ergab: Die Krähenpaare besetzen Reviere, während die noch unverpaarten Jungvögel umherschweifende Banden bilden. Werden nun die Krähenpaare gejagt und ihre Nester zerstört, steigt dort der Anteil der Nichtbrüter: „Damit ist die Quote der von ihnen verursachten Verluste an Gelegen von Singvögeln und Niederwild nicht nur nicht gesenkt, sondern angehoben worden.“
.
Während es dem Dichter um die einzelne Blaumeise geht, bekümmern sich die Wissenschaftler um die Art. Da stehen sich Tierfreund und Tierschützer, Anekdote und wissenschaftliche Forschung gegenüber. Während diese in ihrer darwinistischen Ausprägung immer aus Statistiken über eine Art oder Population besteht, wird in jener über den Tod eines Meisenpärchens, das mehrmals auf dem Balkon brütete, Herzblut vergossen.
.

.
Ohne Zweifel gibt es ganze Arten, die schon aufgrund ihres arttypischen Verhaltens und Aussehens auf uns witzig wirken. Auch das ist eine Wirkmacht, und nicht die Schlechteste. Ich finde z.B. die auf den südlichen Kontinenten lebenden Laufhühnchen besonders lustig: Die Weibchen sind größer als die Männchen und können aufgrund ihrer vergrößerten Luft- und Speiseröhre verschiedene weittragende Laute erzeugen, während die Männchen nur gackern. Auch sind es die Weibchen, die untereinander kämpfen und balzen, wobei sie sich nacheinander mit mehreren Männchen verpaaren, eins übernimmt dann dann das Ausbrüten der Eier und die Aufzucht der Jungen. Das Weibchen kommt nur, wenn dem Nest Gefahr droht. . Ähnlich die auf der anderen Seite der Erde lebenden Odinshühnchen, die zu den arktischen Schnepfenvögeln zählen. Bei ihnen sucht sich das Weibchen aktiv den Partner aus und wirbt um ihn in einem auffälligen Balzflug. Die Männchen kümmern sich dann um die Jungvögel. . Auch bei den großen flugunfähigen Laufvögeln, wie den Kasuaren, Emus und Nandu s führt das Männchen die Jungen. Es bereitet eine Nistkuhle vor und muß dann ein Weibchen nach dem anderen nicht nur begatten, sondern sie auch dazu bringen, ein Ei in sein Nest zu legen, ab etwa zwölf Eiern fängt das Männchen an zu brüten. - Dem Positivismus zufolge, dem sich die Biologie in gewisser Weise verpflichtet hat, genügt bereits ein Gegenbeweis, um z.B. die Darwinsche Generalthese von der sexuellen Selektion zu widerlegen, und das ist bei dem Paarungsverhalten der Laufhühnchen der Fall. Laut Darwin geschieht die sexuelle Selektion durch die Weibchen, indem sie die schönsten und gesündesten Männchen (die mit den besten Genen) auswählen, die ihnen deswegen mit einem immer prächtigerem Federschmuck oder Geweih imponieren wollen. Die Männchen konkurrieren, die Weibchen wählen. Bei den Laufhühnchen und den anderen e.e. Vögeln ist es genau umgekehrt. . Desungeachtet wurde die Darwinsche Theorie der sexuellen Selektion neuerdings vom Ornithologen Josef Reichholf wieder aufgewärmt – in seinem Buch "Der Ursprung der Schönheit. Darwins größtes Dilemma" (2011). Und der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus entwarf daraus in seinem Buch "Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin" (2011) eine ganze Soziobiologie bzw. Humanethologie, indem er einen Bogen vom Rad schlagenden Pfau zu dem seinen Körper bunt bemalenden Neandertaler und darüberhinaus bis zu uns heute schlug. "Die Welt" schrieb: "Menninghaus erwähnt den Trojanischen Krieg, wenn es darum geht, dass Tiere in blutigen Kämpfen um Weibchen konkurrieren, die dann ihre Wahl treffen." Das Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte organisierte daraufhin einen Kongreß mit dem Titel: "Survival of the Prettiest". .. 50 Jahre zuvor hatte der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger sich von dieser Theorie bereits verabschiedet, wobei er sich u.a. auf den Basler Zoologen Adolf Portmann bezog, der sich als Gestalttheoretiker lange mit dem Pfau beschäftigt hatte. Ihm zufolge "wurde die Darwinsche Meinung von der ästhetischen Beurteilung des männlichen Prunkgefieders durch die Weibchen schon vor 1930 selbst von den Darwinisten fallen gelassen"; denn laut Portmann brachte "vor allem die Beobachtung keinerlei einwandfreie Beweise für eine Wahl seitens der Weibchen." Darwin hatte, wie auch viele andere Biologen, anscheinend "zu rasch verallgemeinert", wobei er "begreiflicherweise besonders beeindruckt war von Vögeln mit starkem Sexualdimorphismus" (d.h. bei denen man deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen erkennen kann). "Doch gerade mit den imposantesten Beispielen dieser Art, dem Pfau und dem Argusfasan, hatte er Pech: hier gibt es keinerlei Wahl durch die Weibchen," schreibt Heini Hediger. Ähnlich sähe es bei den Paradiesvögeln, Webervögeln und Seidenstaren aus, die mitunter "ganz für sich allein balzen". Die Kampfläufer dagegen, die Hediger ebenfalls erwähnt, balzen zwar in Gruppen, aber zum Einen sind die "spektakulären Kämpfe" der Männchen "harmlose Spiegelfechtereien" und zum Anderen nehmen die Weibchen keinerlei Notiz davon: "Nicht einmal hinschauen tun sie". Ihr Erforscher, G. Dennler de la Tour, beobachtete zudem, dass es sogar ganz antidarwinistisch der im Duell unterlegene Kampfläufer ist, der, sobald er sich erholt hat, zu den Weibchen geht und sie nacheinander begattet, während die Sieger davonfliegen. Ein anderer Ornithologe, J.G. Van Rhijn, stellte später fest, dass der unterlegene Kampfläufer oftmals der Besitzer des Reviers ist, in dem die Kämpfe stattfinden. Er holt die anderen Männchen quasi zu sich, damit die Anwesenheit vieler die Weibchen anlockt, die er dann nach den Kämpfen begattet. . Bei den "pantomimischen Kampftänzen" der amerikanischen Präriehühner, die der Kieler Zoologe Adolf Remane erforschte, ist es ähnlich: Die Männchen tanzen umeinander, die Weibchen erscheinen nur "hin und wieder auf dem Tanzplatz. Sie werden sozusagen en passant begattet, ohne dass sich die Hähne dadurch in ihrem Massenritual sonderlich stören ließen". Daneben gelte auch für den Gesang der männlichen Singvögel, dass sie damit nicht den Weibchen imponieren wollen, sondern ihr Revier markieren - es sind "kriegerische Lieder", wie der Tierbuchautor Herbert Wendt das in seinem Buch "Das Liebesleben in der Tierwelt" nennt. Kommt noch hinzu: "Eine Zeitlang glaubten die Zoologen, die Tätigkeit der männlichen Hormondrüsen veranlasse das Vogelmännchen, sich zur Hochzeit so prächtig zu schmücken. Heute nehmen wir an, dass es genau umgekehrt ist. Das männliche Prachtgewand ist das Normalkleid des Vogels; die weiblichen Geschlechtshormone dagegen sind es, die dafür sorgen, dass die Vogelweibchen zur Brutzeit unscheinbarer aussehen als ihre Partner. Denn die Mütter müssen beim Brüten und bei der Kinderpflege eine unauffällige Schutzfärbung tragen." Wenn beispielsweise Enten zu alt werden, um noch zu brüten, bekommen sie ein männliches Federkleid. . Das Videoportal Youtube ist voll mit Anekdoten (Clips) über lustige Tiere, vor allem Katzen. Die FAZ bezeichnete sie als "die populärsten Klicktiere", vor allem in den USA, wo bereits 2012 in Minneapolis das erste Videofestival mit Katzen-Clips lief. In New York eröffnete laut FAZ das erste "Katzen-Café" und im dortigen Museum of the Moving Image findet derzeit eine Ausstellung über Katzenbilder und -videos statt. Der Ausstellungskurator vermutet, dass die Beliebtheit der Katzen auf dem Bildschirm daher kommt, dass "reale Katzen die Menschen erwiesenermaßen glücklich machen. Das Katzenvideo simuliert diesen Effekt". Und dieser stellt sich oft über lustige Mißverständnisse und Begebenheiten zwischen Mensch und Katze oder zwischen Katze und z.B. Hund her. . Komisch ist aber auch die Katzengeschichte, die mir Rosemarie Fieting von der Reinickendorfer Künstleragentur für Tiere erzählte: "Manchmal sind Herrchen oder Frauchen schwieriger als deren Tiere, weil sie so oft besondere Bedingungen stellen. Einmal habe ich die Katze einer Frau vermittelt, die für 400 DM in einem Lehrfilm der Theaterwissenschaftler an der Freien Universität mitspielen sollte, da waren das u.a.: 'keine Scheinwerfer, keine Zugluft und keine Straßenszenen'“, der Vertrag war fast 10 Seiten lang. Als wäre die Katze ein Filmstar. Dabei sah sie gar nicht so aus. Die war ganz normal geblieben." . Neben vielen lustigen Katzenclips fand ich im Internet auch einen Clip, der zeigte, wie ein Grauwal weit aus dem Wasser steigt und ein Delphin ihm daraufhin auf den Rücken springt und hochschlittert, um über seinen dicken Kopf ins Wasser zu springen. Sie übten Bockspringen. .
. Wer mit Tieren zusammen lebt, wird eigentlich laufend in mehr oder weniger komische, mindestens ungewöhnliche Situationen verwickelt. Wilhelm Buschs Rabe "Hans Huckebein" bringt einer Frau den ganzen Haushalt durcheinander, und betrunken verwüstet er ihn dann komplett. Viele Besitzer eines solchen Vogels können noch heute ein Lied davon singen, inzwischen haben sie ihre Wohnungen jedoch längst "rabensicher" gemacht. . Das verhindert aber nicht, dass manche Haustiere gerne Alkohol trinken und dann lustig werden. Bei einigen Kuhherden in LPGen der DDR wurden die Tiere allerdings alkoholabhängig, weil man sie dauerhaft mit Rückständen aus Brauereien gefüttert hatte. Der Direktor des Tiergarten Friedrichshain, Heinrich Dathe, berichtete in seinem Buch „Im Tierpark belauscht“ (1969), dass vor dem Krieg auf einem Gutshof der Rinderbestand „restlos wahnsinnig“ geworden sei, weil man die sogenannte Schlempe aus der Schnapsbrennerei als Mastfutter an sie verfüttert hatte. Ähnliches sei in einem Schweinestall passiert, wo man den Tieren die Rückstände beim Keltern von Johannisbeerwein zu fressen gab. Dathe erwähnt ferner ein Eichhörnchen, das durch ein offenes Fenster in eine Wohnung eingedrungen war und dort zu viele Kognakbohnen gefressen hatte. Der Zoo in Wladiwostok berichtete jüngst: Bei großer Kälte gäbe man den Elefanten Wodka zu trinken, was diese auch gerne annehmen, negative Folgen habe das nicht. . Madame Blavatsky, die Begründerin der Theosophie hielt sich viele Jahre in Indien auf, 1885 berichtete sie: "Das erste, was einem in Bombay auffällt, sind die Millionen Krähen und Geier. Sie sind die Abfallbeseitiger, eines der Tiere zu töten, ist nicht nur polizeilich verboten, sondern erregt auch die Aggression der Hindus, die stets bereit sind, ihr Leben für das einer Krähe hinzugeben. . Der schreckliche Krach, den die Krähen sogar Nachts machen, ist einem erst unheimlich, aber dann kommt man dahinter, dass alle Zuckerpalmen und Kokospalmen in und um Bombay herum von der Regierung verpachtet werden. Man zapft sie an und hängt ausgehöhlte Kürbisse an die Stämme. Der Saft, der dort reinfließt fermentiert und wird zu einem berauschenden Getränk namens 'toddy' (Palmwein, den man zu Rum weiterverarbeiten kann). Die Kürbisse werden zwar von sogenannten 'toddy-walas' regelmäßig gelehrt, aber da die Krähen in den Palmen ihre Nester haben, trinken sie natürlich immer wieder davon. Mit dem Ergebnis, dass diese lärmenden Vögel ständig berauscht sind. Wenn sie in unserem Garten auf einem Bein um uns herum tanzten, hatten diese betrunkenen Vögel definitiv etwas Menschliches und einen schelmischen Ausdruck in ihren listigen Augen.“ . Rund zehn Jahre später ging Mark Twain auf eine Weltreise und landete in Bombay, wo er bereits in der ersten Nacht im Hotel von den dortigen Krähen akustisch derart belästigt wurde, dass er erst nach Mitternacht, als sie endlich Ruhe gaben, einschlafen konnte. „Morgens um halbfünf ging der Spektakel aber von neuem los,“ schrieb er. „Und wer hat ihn angefangen? Die indische Krähe, dieser Vogel aller Vögel. Mit der Zeit lernte ich ihn näher kennen und war dann ganz in ihn vernarrt. Ich glaube, er ist der durchtriebenste Spitzbube, der Federn trägt und dabei so lustig und selbstzufrieden wie kein anderer. Er ist öfter wiedergeboren als der Gott Schiwa und hat bei jeder Seelenwanderung etwas zurückbehalten und es seinem Wesen einverleibt. Jedesmal hat er ein gottloses, sündhaftes Leben geführt, bloß weil es ihm das größte Gaudium machte. Und das Ergebnis der stetigen Ansammlung aller verwerflichsten Eigenschaften ist merkwürdigerweise, daß er weder Sorge, noch Kummer, noch Reue kennt; sein Leben ist eine einzige Kette von Wonne und Glückseligkeit, und er wird seiner Todesstunde ruhig entgegengehen, da er weiß, daß er vielleicht als Schriftsteller oder dergleichen wiedergeboren wird, um sich dann womöglich als ein noch Durchtriebener behaglicher zu fühlen denn je zuvor. . Die Krähe ist ein Vogel, der nicht schweigen kann; er zankt, schwatzt, lacht, schnarrt, spottet und schimpft beständig. Seine Ansicht äußert er über alles, auch wenn es ihn gar nichts angeht, mit größter Heftigkeit und Rücksichtslosigkeit.
Ich glaube, die indische Krähe hat keinen Feind unter den Menschen. Sie wird weder von Weißen noch Mohammedanern belästigt, und der Hindu tötet schon aus religiösen Rücksichten überhaupt kein Geschöpf; er schont das Leben der Schlangen, Tiger, Flöhe und Ratten. Wenn ich an einem Ende auf dem Balkon saß, pflegten sich die Krähen auf dem Gitter am andern Ende zu versammeln und ihre Bemerkungen über mich zu machen; nach und nach flogen sie näher herzu, bis ich sie fast mit der Hand erreichen konnte. Da saßen sie und unterhielten sich ohne Scham und Scheu über mich – bis ich es vor Verlegenheit nicht länger aushalten konnte und sie wegscheuchte. Darauf kreisten sie eine Weile in der Luft, unter Geschrei, Gespött und Hohngelächter, kamen dann wieder auf das Gitter geflogen und fingen die ganze Geschichte noch einmal von vorne an.
.
In wahrhaft überlästiger Weise zeigten sie aber ihre gesellige Neigung, wenn es etwas zu essen gab. Ohne daß man ihnen erst zuzureden brauchte, kamen sie auf den Tisch geflogen und halfen mir mein Frühstück verzehren. Als ich einmal ins Nebenzimmer ging und sie allein ließ, schleppten sie alles fort, was sie nur tragen konnten, und obendrein lauter für sie ganz nutzlose Dinge. Man macht sich keinen Begriff davon, in welcher Unzahl sie in Indien vorkommen, und der Lärm, den sie verursachen, ist nicht zu beschreiben. Ich glaube, sie kosten dem Land mehr als die Regierung, und das ist keine Kleinigkeit. Doch leisten sie auch etwas dafür, und zwar durch ihre bloße Gegenwart. Wenn man ihre lustige Stimme nicht mehr zu hören bekäme, so würde die ganze Gegend einen trübseligen Anstrich erhalten.“
.

.
Es gibt einen Biologen, Mario Ludwig, der sich mit dem Rauschmittelkonsum von Tieren beschäftigt. Der evangelische Pressedienst berichtete darüber kürzlich – ich zitiere: „Rentiere essen Ludwig zufolge sehr gerne Fliegenpilze. Weil die Pilze bewusstseinserweiternde Substanzen enthalten, beginnen die Rentiere nach dem Verzehr zu schwanken. Auch im australischen Tasmanien sind Drogen bei manchen Tieren angesagt. So dringen immer wieder Kängurus bewusst in Schlafmohnfelder ein, fressen Mohnkapseln und laufen anschließend berauscht von dem darin enthaltenen Morphin im Kreis. Eine besonders kuriose Art der Selbstberauschung betreibt eine spezielle Delphinart. „Der Große Tümmler nimmt sich ein anderes Tier als Droge, nämlich den Kugelfisch.“ Kugelfische enthalten eine hohe Konzentration des Nervengifts Tetrodotoxin und sondern dieses unter Stress ab. Einmal seien mehrere Große Tümmler dabei gefilmt worden, wie sie einen Kugelfisch malträtierten, ihn „wie einen Joint“ herumgehen ließen und sich an seinem Gift berauschten. „Erstaunlicherweise machen das aber nur junge, männliche Delfine.“
.
Der Konsum von Alkohol in Form von vergorenen Beeren sei im Tierreich ebenfalls gang und gäbe. Szenen wie in Astrid Lindgrens Kinderbuch „Michel aus Lönneberga“, wo Haustiere nach dem Verzehr von verdorbenen Kirschen betrunken über den Hof torkeln, seien keineswegs Fiktion. „Ein massives Alkoholproblem“ haben nach den Worten des Forschers Igel in Großbritannien. Der Grund seien die vielen sogenannten Bierfallen, mit denen englische Hobbygärtner ihre Blumen- und Gemüsebeete schützten. Eigentlich sollten die mit Gerstensaft gefüllten Becher lediglich Nacktschnecken anlocken. Weil Schnecken aber die Leibspeise von Igeln seien, machten sich diese regelmäßig über die Gefäße mit dem Bier-Mix her. Kein ungefährliches Unterfangen, sagt Ludwig, „denn hinterher sind die Igel sturzbetrunken und schlafen ihren Rausch recht ungeschützt in der Gartenecke aus“. Noch direkter und ohne Scheu vor Menschen gehen die Meerkatzen auf der Karibikinsel St. Kitts vor: „Sie trinken den Touristen die Cocktails weg und liegen schon nachmittags betrunken am Strand.“ Für ein ganzes Buch reichten seine Recherchen zum animalischen Rauschmittelmissbrauch noch nicht aus, meint der viel veröffentlichende Biologe: „Die Drogenforschung bei Tieren steckt noch in den Kinderschuhen.“
.
Zurück zum Witz von nüchternen Tieren. Dazu gehört auch und erst recht art-untypisches Verhalten – z.B. das des jungen Wildschweins Freddy, das sich bei Göttingen auf einer Weide einer Kuhherde angeschlossen hatte, von einer Kuh gesäugt wurde und sich ansonsten wie alle dort von Gras ernährte. Die Illustrierte „stern“ berichtete wenig später, dass „Freddy“ bereits muhen könne, und der Spiegel, dass es auf „Friederike“ umgetauft wurde. Sein Beispiel machte schnell Schule: Schon bald kam ein weiteres Wildschwein im Landkreis Göttingen bei einer Kuhherde unter, ein Frischling, das der Bauer Johann taufte. Der Presse erzählte er: Die Kühe hätten sich um Johann gekümmert, als sei er ihr eigenes Kalb. Das kleine Wildschwein wurde sauber geleckt und durfte sich ankuscheln. Die Boulevardblätter sprachen daraufhin von einer „ungewöhnlichen Willkommenskultur auf der Weide“ für einen Gast mit „Migrationshintergrund“. Aus Schleswig-Holstein kam die Nachricht, dass dort ebenfalls ein Wildschwein bei einer Rinderherde ein neues „Zuhause“ gefunden hätte, es werde „Banana“ genannt. Die Süddeutsche Zeitung titelte: „‚Muhltikuhlti‘: Das rätselhafte Phänomen der Tieradoption greift um sich.“ Damit meinte sie nicht nur die von Kühen. Inzwischen hatten sich auch Adoptionen zwischen anderen Arten herumgesprochen: Im Wladiwostoker Zoo war ein Amurtiger ein freundschaftliches Verhältnis zu einem Ziegenbock eingegangen, den er eigentlich fressen sollte. Und in Kenia adoptierte eine Löwin immer wieder junge Antilopen, die jedoch früher oder später von ihren Artgenossen getötet wurden. Die SZ bekam heraus: „Insgesamt sind mehr als 120 Säugetier- und 150 Vogelarten bekannt, die entfernten Arten mindestens so nahe kommen wie einst das junge Nilpferd ‚Mzee‘ der 130 Jahre alten Schildkröte ‚Owen‘ im Zoo von Mombasa“ – deren lustige Freundschaft 2005 alle Tierschützer überrascht und für internationale Schlagzeilen gesorgt hatte.
.

.
Um solch individuelles Verhalten zu beobachten, braucht es Geduld. „Das Problem bei Pflanzen war immer: Du willst Verhaltensforschung betreiben, aber wie soll das gehen, wenn es kein Verhalten zu beobachten gibt?“ meinte der schottische Biologe Anthony Trewavas.
.
Anfänglich galt das auch für Tiere, insofern Artregungen erforscht wurden: Kennst du ein Tier, kennst du alle. Jedes Tier repräsentierte quasi „automatisch“ (instinktgesteuert) seine Art, woraus sich die „artgerechte Haltung“ ergab, die man mit einem „Tierschutzgesetz“ einklagen kann. Der Biologe Josef Reichholf fordert dem gegenüber: „Tiere, auch solche in freier Wildbahn, müssen zu Individuen mit besonderen Eigenheiten werden. Zu lange wurden sie lediglich als Vertreter ihrer Art betrachtet, sogar von Verhaltensforschern. Das machte sie austauschbar und normierte sie zum arttypischen Verhalten‘. Und das ist falsch.“
.
Ähnlich argumentiert die Innsbrucker Fischforscherin und Aquarianerin Ellen Thaler in ihrem Buch „Fische beobachten“, mit dem sie zeigen wolle, wie sie schreibt, „dass bei all dem umfassenden Wissen über Technik und Systematik allzu oft etwas Wesentliches auf der Strecke bleibt: nämlich die Koralle, der Krebs hier, die Muschel dort und schon gar der Fisch, das Individuum also, an dem wir unsere helle Freude haben sollten!“
.
Einer der genau beobachtete (u.a. Rabenvögel und Gänse) – und dafür den Nobelpreis für Medizin bekam, war der Mitbegründer der Verhaltensforschung Konrad Lorenz. Er muß sich heute sagen lassen – vom Bayrischen Rundfunk: „Seine Beobachtungen sind zwar akribisch, aber häufig nur an einzelnen Tieren gewonnen. Dergleichen gilt heute als nahezu wertlos, weil sich solche Beobachtungen statistischen Berechnungsverfahren entziehen.“ In anderen Worten: Sie sind nicht arttypisch verifizierbar, die heutigen „Wissenschaften vom Leben“ billigen ihnen höchstens den Status von „Anekdoten“ zu. Die kleine Gruppe der Biologen, die diese aufwerten will und sich nicht scheut, sogar welche zu publizieren, wächst zwar, aber auch sie tut sich schwer, z.B. mit der bloß Anekdoten liefernden Laienforschung zu kooperieren.
.
Die Literaturnobelpreisträgerin Doris Lessing beobachtete jahrzehntelang ihre Katzen und veröffentlichte Bücher über sie. Sie schreibt: „Tatsache ist, dass jeder aufmerksame, sorgsame Katzenbesitzer mehr über Katzen weiß als die Leute, die sie beruflich studieren. Ernsthafte Informationen über das Verhalten von Katzen und anderen Tieren findet man oft in Zeitschriften, die ‚Katzen-Echo“ oder ‚Geliebte Katze‘ heißen, und kein Wissenschaftler würde im Traum daran denken, sie zu lesen.“
.

.
Freundlicher ausgedrückt: „Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das Leben subtil, deswegen brauchen wir die Literatur,“ wie der Semiologe Roland Barthes meinte. Zur letzteren gehören auch die bunten Katzen-Magazine und Katzenbücher von Prominenten. Hinzu kommen Internetforen – wie z.B. „Das große Katzenforum“. Es gibt bald für jede Tier- und Pflanzen-Art bis hin zu Bandwürmern und Pilzvergiftungen mindestens ein Internetforum. Besonders geängstigt werden die medizinischen Profiwissenschaftler von solchen, in denen Patienten sich als Laienwissenschaftler über Krankheiten und Ärzte austauschen – wobei sie meistens homöopathischen Ärzten mehr Einfühlungsvermögen attestieren, während die „Schulmediziner“ eher statistisch an die Sache rangehen: mittels Hightech-Gerät, das aufs Genaueste Abweichungen von Mittelwerten registriert. Die Gegner der „Alternativmedizin“ haben jetzt ein Gegenforum gegründet, dass die verlorenen Schafe wieder an ihre Geräte zurücktreiben soll. Die SZ interviewte dazu den Initiator, einen „Pseudomedizin“-Kritiker, wie sie ihn nennt, er meinte: „Die Befürworter der Homöopathie argumentieren ja immer mit Anekdoten von vermeintlichen Erfolgsgeschichten. Da wollen wir ein Gegengewicht schaffen.“
.
Dem vermeintlichen Anekdoten-Sammler Konrad Lorenz hat man inzwischen den Ehrendoktor an der Universität Salzburg aberkannt. Nicht, weil er die Nazi-Herrschaft laut eigener Aussage (bei seiner Nobelpreisannahme) einst gut fand, sondern weil er sich die Ehrung erschlichen habe. Die FAZ empörte das: „Die Vorstellung, der neunfache Ehrendoktor“ wollte partout „vor seinem Tod auch noch den Salzburger Doktorhut erwerben, notfalls durch Täuschung, verrät eine groteske Selbstüberschätzung der Universität.“ Lorenz hatte nie eine Veröffentlichung verheimlicht. Seine oft kritisierte Theorie „Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens“ (1940) war lange zuvor schon, auch unter linken Verhaltensforschern und Literaten, u.a. Theodor Lessing, verbreitet. Sie besagt: jegliche „Höherzüchtung“ entfremdet vom Wesen. Der von den Nazis 1933 in seinem tschechischen Exil ermordete Lessing kam in seinen „Tier“-Aufsätzen für das Prager Tageblatt immer wieder darauf zu sprechen, dass die Züchtung die Tiere ihrem wilden Leben in Freiheit entfremdet habe. Während die Biologen wie Konrad Lorenz darauf bestanden, dass der Hund durch seine lange „Verhaustierung“ völlig „degeneriert“ sei, kam der Philosoph Theodor Lessing beim Vergleich des Wolfs mit dem Hund zu dem Ergebnis, dass letzterer „ein durch jahrtausendelange Zucht geknebelter und sozusagen in sich hineingeprügelter Wolf“ sei. Für Lessing bedeutete jede „Verfeinerung und Hochzüchtung“ eines Tieres oder einer Pflanze eine Entfremdung von ihrem „Wesen“ – zum Schlechteren hin. Noch in den Augen der Pferde erkannte er diesen „Irrsinn“, den die Zebras nicht hätten. Diese Sichtweise des Biologen und des Philosophen, die sie mit vielen Denkern damals teilten, dringt heute noch beim liberalen Josef Reichholf durch, wenn er die schöne Männlichkeit der Massaikrieger in Kenia a là Lenin Riefenstahl mit Münchner Büromenschen vergleicht. Der auf biologischer Grundlage operierende Nazistaat war für die Naturwissenschaftler quasi ein Geschenk des Himmels. 1920 hatte der Hamburger Umweltforscher Jakob von Uexküll ein Buch mit dem Titel „Staatsbiologie“ veröffentlicht, und 1975 gründete der Schüler von Konrad Lorenz Irenäus Eibl-Eibesfeldt ein Max-Planck-Institut für Humanethologie.
.
Ernst Bergdolt z.B., ein im „Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund“ organisierter Botaniker am Münchner Institut für Zoologie, wo der berühmte Bienenforscher Karl von Frisch sein Direktor war, schrieb 1936 – in einem Brief an das Reichserziehungsministerium: „Professor von Frisch hat ein unübliches Talent, seine Forschungsergebnisse für propagandistische Zwecke zu missbrauchen, ein Talent, das wir von jüdischen Wissenschaftlern kennen. Dagegen fehlt ihm völlig die Fähigkeit, seine Wissenschaft von einem weiteren Gesichtspunkt zu überschauen oder gar, was doch bei seinem speziellen Arbeitsgebiet, den Bienen, so nahe liegend und leicht wäre, Beziehungen zu finden zu der naturgegebenen Einrichtung eines völkischen Staatswesens.“ Der ebenfalls berühmte „Umwelt“-Forscher Jakob von Uexküll hatte dazu bereits einen großen Entwurf veröffentlicht: „Staatsbiologie“ betitelt.
.

.
Manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass die Biologen noch heute alle Nazis sind – qua Profession; schon allein weil sie sich mit ihrer Tierart, die sie erforschen, so identifizieren, dass sie um ihr Weiterleben kämpfen, und dafür die Natur zerstörenden Menschen hassen, die sich zudem wie die Karnickel vermehren. Die finnische Ethologin Ulla-Lena Lundberg sagt es so: „Von Vogelbeobachtern heißt es, sie seien Menschen, die von anderen Menschen enttäuscht wurden. Darin liegt etwas Wahres, und ich will nicht leugnen, dass ein Teil des Entzückens, mit anderen Vogelguckern gemeinsam draußen unterwegs zu sein, in der unausgesprochenen Überzeugung liegt, die Vögel verdienten das größere Interesse.“
.
Man kann es aber auch so sagen wie die zwei Gymnasiasten aus Aurich, Jan Trebesch und Meint-Hilmar Broers. Sie erforschten wild lebende Guppys auf Trinidad, indem sie einzelne Tiere markierten. Dabei fanden sie heraus: Je mehr ihr Platz eingeschränkt wurde, umso aggressiver reagierten die Guppys; sie entwickelten regelrechte „Beißhierarchien“. Fisch Nummer 8, der bevorzugtes Opfer von „Macho-Guppys“ wurde, tat ihnen sogar „irgendwie leid“, was Broers und Trebesch darauf zurückführten, „dass man auch ein bißchen verrückt wird, wenn man sich so lange mit ihnen beschäftigt“.
.
Umgekehrt erfuhr ich von der Berliner Aquariumsbesitzerin Nicola Schwarzmaier über „Verrückte„, die sich auf den Aquarianer-Foren über ihre Fische austauschen: „Einige sind richtig verrückt: die diskutieren da z.B., wie man einen unheilbar kranken Guppy am humansten tötet.“
.
Die englische Historikerin und leidenschaftliche Falknerin Helen Macdonald wurde fast irre, als sie in ihrem über fünf Jahre langen Zusammenleben mit ihrem Habicht „Mabel“ wunschgetrieben dahin kam, „ein Habicht zu werden“.
.

.
In ihrem Buch „H wie Habicht“ schreibt sie: „In meinem Unglück hatte ich den Habicht aber nur in einen Spiegel meiner selbst verwandelt…Irgendetwas lief schief. Sehr schief.“ Sie erinnert sich an den Anthropologen Rane Willerslev, der das sibirische Volk der Jukagiren erforschte. Dabei erfuhr er, dass „eine solche Verwandlung bei den jukagirischen Jägern als sehr gefährlich gilt, weil man dadurch den Kontakt zur ‚Identität der eigenen Spezies verlieren und eine unbemerkte Metamorphose durchlaufen‘ könne.“
.
Einige berühmte Ornithologen vermerken dagegen stolz, dass sie den Vögeln immer ähnlicher wurden, während ihrer mitunter jahrelangen Beobachtung. Das kommt dabei raus, wenn man bestimmte Tiere besonders „witzig“ findet.
.
Wenn nicht, kommt aber auch nichts bei raus. So bekam z.B. der Verhaltensforscher Bert Tolkamp bei seiner Kuhforschung heraus, dass eine Kuh, die schon lange liegt, wahrscheinlich bald wieder aufstehen wird – aber wenn sie erst mal aufgestanden ist, ist es nicht mehr so leicht vorhersagbar, wann sie sich wieder hinlegen wird. „Ich beobachte Kühe seit vielen Jahren“, sagte der Wissenschaftler, „deswegen kann ich mit einiger Kompetenz sagen: Kühe können wirklich langweilig sein.“ Das Verhalten seiner Untersuchungsobjekte sei „äußerst enttäuschend gewesen“.
.
Anders die amerikanische Schafforscherin Thelma Rowell, die auf einem Menschenaffen-Kongreß ein Referat hielt, in dem sie sogleich richtig stellte: „Ich gehe davon aus, dass Schafe genauso klug wie Schimpansen sind. Denn wenn ich der Meinung wäre, dass Schafe blöd sind, dann könnte ich es gleich sein lassen. Indem ich sie aber auf eine Stufe mit den intelligenten Schimpansen stelle, gebe ich ihnen die Möglichkeit, unerwartete Verhaltensweisen zu zeigen und mir, diese auch zu bemerken. Je mehr ich daran arbeite, desto autonomen werden die Schafe.“ In einem Forschungsbericht, den sie einige Jahre später veröffentlichte, kam sie zu dem Schluß: „Schafe haben eine Meinung.“
.

.
Nun noch ein paar Bemerkungen zu dem Film, der gleich läuft. Der südafrikanische Regisseur Jamie Uys arbeitete fast zehn Jahre daran. Gedreht wurde er in der Namib-Wüste und im Okavango-Becken. 1974 kam er unter dem Titel
„Animals Are Beautiful People“ in die Kinos, in Deutschland hieß er dann – wenig zutreffend: „Die lustige Welt der Tiere“. Diese ist nicht lustig, aber der Regisseur hat das Beste daraus gemacht, u.a. mit viel klassischer Musik, und auch wenn der Film ihm gelegentlich etwas kitschig geraten ist, was nicht zuletzt mit dem Fortschritt in der Tierfilmerei – also mit unserer Wahrnehmung – zu tun hat. Uys‘ bekannteste Dokumentation ist der ebenfalls in der Kalahari gedrehte Ethnofilm „Die Götter müssen verrückt sein“, der angeblich auch ganz „witzig“ sein soll.
.

.
.
Irridentia
1. Fisch-Größen und -Grüße
Ende 2015 kamen amerikanische Meeresforscher zu der alarmistischen Hochrechnung, dass es um 2048 keine Meeresfische mehr geben wird. Selbst ihre Tüchtigsten haben dann den Kampf ums Überleben verloren. Nun haben kanadische Fischforscher nachgelegt, indem sie bewiesen, dass in den letzten 60 Jahren viel mehr Fische gefangen wurden als angegeben. Im Jahr 1996 beispielsweise, zum Höhepunkt des Fischfangs, wurden nicht 86 Millionen Tonnen Fisch angelandet, sondern gut 130 Millionen Tonnen. „Der Fischfang sei von den offiziellen FAO-Statistiken, die auf den Meldungen der Mitgliedsländer beruhen, um gut 50 Prozent unterschätzt worden. Das liegt daran, dass Datenlücken vor allem bei Klein- und Freizeitfischern, was den unerwünschten Beifang und illegale Fischerei angeht, jeweils als null gewertet werden. Die Forscher haben statt der offiziellen Meldungen 100 Fischereiexperten in 50 Institutionen weltweit nach ihren Fangdaten und -schätzungen befragt,“ berichtete die FAZ, die auf der selben Seite darwinistisch jubelte: „Eine selten Haiart ist ins Netz gegangen.“
.
Der thüringische Schriftsteller Landolf Scherzer heuerte 1977 auf dem Fischfang-Trawler „ROS 703 Hans Fallada'“ als „Produktionsarbeiter“ an. Die Fahrt ging nach Labrador. Die DDR hatte von Lizenzhändlern eine kanadische Fanglizenz – mit Mengenbeschränkung – gekauft. Als sie im Fanggebiet ankamen, waren dort schon zwei andere DDR-Fischereischiffe, sowie zwei polnische, ein dänisches, ein bulgarisches, und vier westdeutsche. „Die Hochseefischerei ist wie die Hatz auf Hirsche oder Wildschweine kaum über das bloße Erbeuten hinausgekommen,“ schreibt Landolf Scherzer. Die Kabeljau-Beute der „Fallada“ war jedoch diesmal so gering, dass sie es in einem anderen kanadischen Fanggebiet mit Rotbarsch versuchten. Weil Scherzer die Verarbeitung der Fischmassen am Fließband nicht gleichgültig ließ, führte er manchmal Gespräche mit einem Kabeljau. Zuvor hatte er sich auch schon mit einem im sibirischen Baikalsee lebenden Omul (eine Lachsart) unterhalten. Merkwürdigerweise tat das zur selben Zeit auch ein westdeutscher Dichter, der der DKP nahe stand, beide berichteten anschließend darüber in ihren Reisebüchern. Damals hatte der „Fischfreund“ Breschnew gerade die Rettung des Sees verfügt, erklärte dazu der Dichter seinem westdeutschen Publikum.
.
Der Rotbarsch wird tagsüber mit Grundschleppnetzen gefangen und nachts mit Schwimmschleppnetzen. Als sie nach Wochen noch immer keine großen Rotbarsch-Schwärme gefunden hatten, kam aus der Kombinatszentrale in Rostock die Anweisung: „Noch 4 Tage vor Labrador fischen, dann nach England dampfen und im Hafen von Falmouth Makrelen, die englische Fischer verkaufen, verarbeiten.“ Für ein Kilo zahlten sie dann 5 Mark. Auf der Weiterfahrt nach Rostock mußten die Fische an Bord noch sortiert, gewaschen, geköpft, filetiert und gefrostet werden. In den Läden kostete das Kilo dann 1 Mark 40. – Fast schon ein staatliches „Gastmahl“. Scherzers „Buch“ „Fänger und Gefangene“ wurde 1998 noch einmal verlegt – ergänzt um Interviews mit seinen ehemaligen Bordkollegen, die nach Abwicklung der DDR-Fischfangflotte fast alle arbeitslos geworden waren.
.
Neuerdings hat ein Dresdner Biologe, Michael Beleites, das Gespräch mit dem Kabeljau weiter geführt – ausgehend von einem Befund kanadischer Fischereiforscher, dass der Kabeljau immer kleiner werde. In Beleites Buch „Umwelt Resonanz – Grundzüge einer organismischen Biologie“ (2014), das sich gegen die darwinistische Selektion-Mutations-Formel richtet, heißt es: „Nun ist gewiß kaum ein stärker selektierender Faktor vorstellbar, als ein Netz, das mit einer bestimmten Maschenweite ganze Fischpopulationen förmlich durchsiebt – und ab einer bestimmten Körpergröße ausnahmslos alle Individuen ausmerzt‘. Die Schleppnetze sind allerdings kein natürlicher‘ Selektionsfaktor, auch wenn die Selektion an wildlebenden Fischen stattfindet.“ Die Fische würden wahrscheinlich wieder älter und größer werden, wenn man die Intensivfischerei beendete. Es handelt sich hierbei also gerade „nicht um den Aufbau einer neuen Population durch eine positive Selektion von Anfang an genetisch frühreifer bzw. kleinwüchsiger Mutanten.“ Dieses Kabeljau-Beispiel ist nur eines von vielen mit denen Michael Beleites seine „Umwelt Resonanz“-Theorie entwickelt hat. Ob sie geeignet ist, dem Kabeljau zu helfen, wird sich wohl erst auf lange Sicht hin erweisen.
P.S.: Mehr über Meerestiere findet man im 10. Büchlein der Reihe „Kleiner Brehm“: „Fische“, das vor einer Woche vom Peter Engstler/Rhön ausgeliefert wurde.
.
.
2. Schöpferische Zerstörung
Der Münchner Biologe Josef Reichholf fragt sich in seinem neuen Buch „Mein Leben für die Natur“, warum in der ökologisch so versauten DDR mit ihren vergifteten Flüssen und der vergifteten Luft im „mitteldeutschen Chemie-Dreieck“ dennoch jede Menge Fischadler, Biber, Kolkraben, Laubfrösche und andere Tiere lebten, die in der BRD längst verschwunden waren – trotz aller Umweltschutzgesetze, Filter- und Kläranlagen, Naturschutzgebiete und extrem teuren Renaturierungsmaßnahmen. Diese Frage wirft Reichholf auch in Interviews auf, ich habe jedoch nicht den Eindruck, dass er sie bündig beantwortet.
.
Wenn man hingegen einen Ostler fragt, wie das möglich war, kommt sofort die Antwort: „Kein Geld!“ – d.h. nicht alles konnte flächendeckend „kultiviert“ werden. Es handelte sich dabei nicht um eine bürgerliche Gesellschaft, sondern um einen „Arbeiter- und Bauern- [d.h.Landarbeiter] Staat“, was bedeutete, dass man mit ihnen nicht wie im Westen mit den Arbeitern [Arbeitnehmern] und Landwirten [Selbstausbeutern] umgehen konnte. „Wir tun so, als ob wir arbeiten – und die tun so, als ob sie uns bezahlen“. Andersherum, mit den Worten des DDR-Dramatikers Heiner Müller über den Westen: „Wer Arbeitslosigkeit hat, braucht keine Stasi!“ In der ostdeutschen Betriebsräte-Initiative wurde uns klar: Die DDR ist nicht an zu viel Unfreiheit, sondern im Gegenteil, an zu viel Freiheit – im Produktionsbereich nämlich – zugrunde gegangen. Und bekanntlich waren die Betriebe so etwas wie „Lebensmittelpunkte“ für die Werktätigen, und das waren wegen der „Arbeitspflicht“ quasi alle, trotzdem mangelte es – scheinbar paradox – an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften. Die Hamburger Bankierstochter Birgit Breuel sah das als Treuhandchefin natürlich am Ende ganz anders, indem sie von einer in den DDR-Betrieben bloß „versteckten Arbeitslosigkeit“ sprach (um die von ihr verfügten Massenenentlassungen – „Großflugtage“ von den Treuhandmanagern genannt – zu rechtfertigen).
.
Auch im Tierpark Friedrichsfelde, dem ersten DDR-Betrieb, in dem sich ein Betriebsrat in der „Wende“ gründete, kam es zu solchen Entlassungen. Für die verbliebenen „Beschäftigten“ wurden sogleich Stechuhren installiert – schwäbische. Auch die Verwaltung dieses Großbetriebs ist nun im Westen (im Zoo), und wenn man mit einem der Tierpfleger des Tierparks reden will, muß man vorher die Pressesprecherin in Charlottenburg um Erlaubnis bitten. Von ihr bekommt man dann gesagt: „Da unsere Tierpfleger primär mit ihren Tieren zu tun haben, würde ich Sie bitten, uns Ihre Fragen per Mail zu schicken.“
.
Sehr viel selbstbestimmter war die Situation der Tierpfleger in der DDR jedoch nicht, wie mir einer der Elefantenpfleger im Tierpark, der auch Betriebsrat war, berichtete (ich interviewte ihn für das Buch „Elefanten“ in meiner Reihe „Kleiner Brehm“). Auch das Leben für die Wildtiere war in der DDR nicht so idyllisch wie oben dargestellt. Die Hobbyornithologen hatten sich in und um Leipzig nach Vogelarten aufgeteilt, einer kümmerte sich z.B. um die Großtrappen, er erzählte: Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft ab den Siebzigerjahren und dem vermehrten Einsatz von giftigen Chemikalien auf den Feldern sei die Großtrappenpopulation ständig zurückgegangen. Einige wurden republikflüchtig, drei flogen im Winter nach Frankreich und blieben dort. Der letzte im Großraum Leipzig starb 1994.
.
In Brandenburg sollten noch einige leben, deswegen wurden ab 1995 beim Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Hannover auf ein drittes Gleis verzichtet und für 12 Millionen Euro hohe Dämme aufgeschüttet. Weil die Füchse sich aber nach 89 sehr vermehrt hatten und in der Folgezeit zu viele Großtrappen fraßen, wurden neue aus Polen importiert, was noch einmal viel Geld kostete. Noch teurer war und ist das europäische „Waldrapp-Projekt“: Um diese Ibis-Art wieder in Bayern anzusiedeln, wo die Jäger sie ausgerottet hatten, wurden Jungtiere aus Zoos aufgekauft, die man an ein Ultraleichtflugzeug gewöhnte, das sie dann ins italienische Überwinterungsgebiet geleitete, von wo aus sie selbständig nach Bayern zurückkehrten, um sich zu verpaaren und zu brüten.
.
Ausgerottet und wieder kostspielig angesiedelt wurden auch der Wachtelkönig, das Auerhuhn, die Moorente und der Lämmergeier. Aber „manches, was da geschieht,“ meint der Vize-Chef des Dachverbands Deutscher Avifaunisten, „ist etwas fragwürdig“.
.

.
3. Urvertrauensbruch
Der Biologe Josef Reichholf spricht von einem „Urvertrauen“, das sich bei den Tieren gegenüber dem Menschen wieder einstellt, wenn sie nicht mehr bejagt, geangelt oder sonstwie verfolgt werden. „Im Ausdruck Wildtiere‘ schleppen wir die seit Jahrhunderten andauernde Verfolgung mit, die alle größeren Tiere wild werden ließ.“
.
Eines von Reichholfs Beispielen für wiederhergestelltes „Urvertrauen“ durch Jagdverbote ist ein Grauwal-Weibchen, das im Golf von Kalifornien an die Seite seines „Whale-Watcher“-Schlauchbootes kam und er ihm die lästigen Seepocken vom Kopf entfernte. Diese anrührende Begegnung ließ ihn das Photographieren vergessen.
.
Auf Youbube gibt es neuerdings ein Video von drei Skippern, die – ebenfalls im Golf von Kalifornien – auf einen fast leblos treibenden Grauwal stießen, dem einer von ihnen dann mit Taucherausrüstung aus einem Fischernetz aus Plastik befreite, in das der Wal sich verwickelt hatte. Anschließend war er augenscheinlich so glücklich, dass er in Bootsnähe aus dem Wasser schoß und Kapriolen schlug.
.
Zurück zum „Urvertrauen“, in theoretischer Hinsicht hat es nur noch metaphorische Bedeutung: Urmensch, Urhorde, Ursäuger, Urschrei – Sie füllen oder füllten provisorisch Lücken in einer Entwicklungsgeschichte bzw. Evolutionskette. Aber praktisch verstand jeder, was mit „Urvertrauen“ gemeint war, seitdem die Seefahrer auf kleinen Inseln im Meer immer wieder auf Tiere gestoßen waren, die keine Freßfeinde kannten – und mehr als „zahm“ waren. Von der Insel Süd-Trinidad z.B. wurde 1913 berichtet, dass sich die dort lebenden Seeschwalben auf den Köpfen der Männer im Walfischboot niederließen und ihnen neugierig ins Gesicht schauten. Die Albatrosse von Laysan gestatteten den ersten Naturwissenschaftlern in ihren Kolonien umherzuwandern und erwiderten den höflichen Gruß ihrer Besucher mit ernsten Verbeugungen. 1935 entdeckte ein Ornithologe, dass die Habichte auf den Galapagos-Inseln sich ohne weiteres berühren ließen und dass die Fliegenschnäpper sich bemühten, Haare von den Köpfen der Männer als Material für ihren Nestbau auszuzupfen. Die Meereswissenschaftlerin Rachel Carson zitiert in ihrem Buch „Geheimnisse des Meeres“ (1952) aus dem Bericht des englischen Ornithologen: „Es ist ein seltsames Vergnügen,“ schrieb er, „zu erleben, wie die Vögel der Wildnis sich einem auf die Schultern niederlassen, und dieses Vergnügen könnte ein sehr viel häufigeres sein, wären die Menschen weniger zerstörerisch.“ Inzwischen ist dieses „Urvertrauen“ auch auf der letzten Insel so gut wie verschwunden. Von den Berichten darüber wanderte der Begriff in die (amerikanische) Psychoanalyse, durch Erik. H. Erikson wurde er 1975 auch in Deutschland als „Urvertrauen“ bekannt. Was in den USA dann bis zur „Urschrei“-Therapie gedieh, machte hier der Soziologe Dieter Claessens im ersten Lebensjahr des Kindes fest. In dieser Zeit muß es laut Wikipedia lernen, „Vertrauen zu irgendetwas zu entwickeln (also ein künftighin wirkendes „Vertrauen in Vertrauen“).
.
Heute ist es oft so, wenn jemand sagt „Vertrau mir!“ dass dann selbst die Vertrauensseligsten mißtrauisch werden. Im Grunde sind inzwischen alle Berichte in den Massenmedien über Korruption, Verbrechen, Überfälle etc., alle Polizeiberichte- und – warnungen, und auch die täglichen „Tatort“-ähnlichen TV-Krimis nichts anderes als eine permanente Mißtrauensschulung. Dass man in eine Kneipe kommt und als erstes ein Schild liest: „Vorsicht Taschendiebe. Paßt auf eure Taschen auf!“ – das gab es bis vor kurzem noch nicht. Auch nicht, das es in den Medien heißt: „Deutsche Bank fleht um Vertrauen.“ Ein von dieser Bank enttäuschter Kunde erklärte: „Das Urvertrauen ist weg.“ Das geht anscheinend vielen so.
.
Der Diplom-Psychologe Merkle gibt ihnen zu bedenken: „Bei manchen Menschen kann sich daraus eine regelrechte Verbitterungsstörung entwickeln, denn wer nicht vertraut, findet auch kein Vertrauen.“ Das gilt laut „Die Zeit“ ebenso für „Beziehungen“. Im Tunnel Stadtmitte zwischen der U2 und der U6 raten die Zeugen Jehovas: „Vertrau auf Gott allein!“ Ein Fahrgast hielt ihnen Bertolt Brecht entgegen: „Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird“. Dem wurde jedoch widersprochen.
.
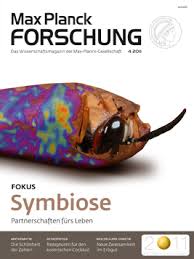
.
4. Nachhaltiger Wald
Der bei der Weltrettung engagierte Soziologe Harald Welzer führte auf dem 18. „Philosophicum“ in Lech aus, dass die Ökobewegung – inklusive Parteien, Lehrstühle, NGOs, Umweltbundesamt- und -ministerien – seit der berühmten Studie „Die Grenzen des Wachstums“ (1972) eine enorme „Karriere“ gemacht habe. Gleichzeitig werde jedoch jedes Jahr „ein neues Weltrekordjahr im Material- und Energieverbrauch“ angezeigt. Anscheinend hat das auf Wachstum setzende kapitalistische System seine Wachstumskritiker, die „Degrowth-Scene“, gründlich integriert. Die linke Zeitschrift „konkret“ kritisierte an Welzers daraus resultierender Forderung, wonach vor allem die westlichen Gesellschaften ihre „mentale Infrastruktur“ umbauen müssen: „Diese Verlagerung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung aufs Kampffeld kultureller Wertvorstellung erinnert an die Strategie der Neuen Rechten…“
.
Man kann auch sagen, dass es nicht das schmutzige System ist, das die saubere Ökobewegung integriert hat, sondern eher umgekehrt: So kritisiert der Ökologe Josef Reichholf z.B. an den Naturschutzgebieten, dass dort zwar die Bürger nicht rein dürfen, wohl aber die Hobby-Jäger und -Angler, letztere brauchen bloß einen Angelschein, während die Profi-Naturforscher eine Sondergenehmigung beantragen müssen.
.
Bei der Auseinandersetzung um den Nationalpark Wattenmeer meinte ein friesischer Bauer gegenüber dem „Spiegel“: „Die Grünen sind schlimmer als die Gutsherren einst.“ Dem gegenüber schrieb der Ethnologe Werner Krauss – in seinem Bericht „Die goldene Ringelgansfeder“, dass sich der Kampf der Grünen gelohnt habe. Heute werde das verbliebene Kulturland vom renaturalisierten Land durch eine weiß-rote Schranke abgetrennt: „In dieser Schranke steckt die ganze Vermittlungsarbeit. Sie trennt Gänse von Bauern. Die Vögel haben nun einen Rastplatz und die Bauern bekommen für den ‚Wildschaden‘ eine Kompensation von der EU,“ dazu gehören ein spezielles „Hallig-Entschädigungsprogramm“ und „verbilligte Karten für die Schranke“. Der „Ringelgansschutz“ ist laut Krauss eine „Erfolgsstory des Naturschutz“: Der Bestand der sibirischen Ringelgänse ist auf 280.000 angewachsen, sie sind weniger scheu geworden, d.h. ihre „Fluchtdistanz“ verringert sich, und es wurde mit den Staaten auf ihrer Zugroute ein „Ringelgansmanagementplan“ verabschiedet.
.
Einige ökologisch engagierte Forstwissenschaftlerinnen empört es besonders, dass zwar immer mehr Wälder in Bayern unter Schutz gestellt werden, aber die Abholzungen darin weiter gehen. Dazu heißt es im Zentralorgan des Waldbauernverbands „Die Waldbauern“: „Stillgelegt kann Wald kein Klima schützen“ (nur ein mit Vernunft und Augenmaß genutzter). Bereits in den Achtzigerjahren gab es gegen solch ein lobbyhaftes Denken die Aktion „Robin Wood packt den Schwarzwald ein“, bei der die Wald- und Klimaschützer eine Fichtenschonung mit einer riesigen Plastikplane abdeckten.
.
In Masse und Macht schreibt Elias Canetti: „Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer: es war der marschierende Wald. In keinem modernen Land der Welt ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in Deutschland. Das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das Herz des Deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er sucht den Wald, in dem seine Vorfahren gelebt haben, noch heute gerne auf und fühlt sich eins mit den Bäumen.“ Auch das hat jedoch die „massive forstwirtschaftliche Nutzung“ der deutschen Wälder nicht aufgehalten, fügt der Autor Harry Walter (im Merkur 16/3) hinzu.
.
Mit Homer begann unsere abendländische Kultur, bei ihm hieß es bereits – über eine Gruppe von Holzfällern im Gebirge: „Und nun zogen sie aus mit holzzerhauenden Beilen, Mit gewundenen Seilen und vorn an der Spitze die Mäuler;…Sobald sie die Schluchten des quelligen Ida erstiegen, Fällten sie rüstig sogleich mit scharfem schneidenden Erzhieb Himmelragende Eichen; laut krachend stürzten sie nieder. Drauf zerspalteten sie die Männer Achaias und luden Auf die Tiere das Holz…“
.
400 Jahre später berichtet Platon schon über die Verkarstung der Berge infolge ihrer Abholzung: „Holz hatte es reichlich auf den Bergen…Die Dachgebälke großer Häuser hat man aus den Bäumen der Berge hergestellt. Daneben gab es auch viele veredelte Fruchtbäume…Ferner erfreute sich das Land durch Zeus eines jährlichen Regenergusses, der ihm nicht wie jetzt durch Abfluß über den kahlen Boden weg verloren ging…“ Weiter schreibt der Ur-Öko in seinem „Kritias“: „Übriggeblieben sind nun im Vergleich zu damals nur die Knochen eines erkrankten Körpers, nachdem ringsum fort geflossen ist, was vom Boden fett und weich war, und nur der dürre Körper des Landes übrigblieb.“
.
Mit der Erfindung der Motorsäge geht das nun alles noch mal so schnell. Dieser Tage knattern sie auch in Berlin wieder wie blöd.
.

.
5. Landluft macht frei!
Wenn in der Stadt eine Motorsäge jault, verziehen die Passanten das Gesicht: Schon wieder wird ein Baum gefällt – von Arbeitern in Schutzanzügen. Wer aufs Land zieht wird früher oder später selbst einen Baum pflanzen, aber auch einen oder mehrere fällen. Der Semiologe Roland Barthes unterschied die Metasprache, die in der Stadt gesprochen wird, von der Objektsprache auf dem Land. „Die erste Sprache verhält sich zur zweiten wie die Geste zum Akt: Die erste Sprache ist intransitiv und bevorzugter Ort für die Einnistung von Ideologien, während die zweite operativ und mit ihrem Objekt auf transitive Weise verbunden ist.“ Zum Beispiel der Baum: Während der Städter über ihn spricht oder ihn sogar besingt, da er ein ihm zur Verfügung stehendes Bild ist, redet der Dörfler von ihm – gegebenenfalls fällt er ihn auch. Und der Baum selbst? Wenn der Mensch mit einer Axt in den Wald kommt, sagen die Bäume: „Sieh mal! Der Stiel ist einer der Unsrigen.“ Dies behaupten jedenfalls die Waldarbeiter.
.
Mit der Bewegung aufs Land, in „die Natur“, zur Selbstversorgung ging es auf und ab. Immer mehr Berliner möchten heute einen Schrebergarten haben, aber seit etwa 10 Jahren werden immer mehr „Kolonien“ enteignet. Zuletzt wurde in Pankow eine riesige Anlage (mit 300 Gärten) in der Schönholzer Heide für 2,5 Millionen Euro an einen Spekulanten, der dort „Baumaßnahmen“ durchführen will, sobald Tegel geschlossen wird. Die Betroffenen ärgern sich, dass sie keine Genossenschaft gründeten, um das Land selbst zu privatisieren. Die „Morgenpost“ interviewte „Wutgärtner zwischen Pankow und Wilmersdorf“. Es gibt hier noch 1000 Kolonien, nicht zuletzt so viele, weil in Ostberlin die Industriebetriebe verpflichtet waren, für ihre Mitarbeiter Gartenland bereit zu stellen.
.
„Das Land denen, die es bewirtschaften!“ gilt nicht mehr. Aber nach wie vor das, was der tschechische Dissident Ludvik Vaculik über die Zeit nach 1968 (nach dem Einmarsch der Roten Armee) sagte: „Der Garten, das war das Einzige, was mich vor dem Verrücktwerden bewahrt hat.“ Es gibt jedoch viele Bewirtschaftungsweisen, um sich dort „gesund“ zu erhalten. Eine „tiefsinnig, sensible“ Person kann „im Garten den Frieden empfinden“, den sie „in der Stadt vermisst“; eine „rohe oder egoistische“ Person kann „unterdem Einfluss dessen, was wächst und von ihrer Pflege abhängig ist, verfeinert werden und Hilfsbereitschaft lernen,“ schrieb die Gründerin des Schwedischen Naturschutzbundes Anna Lindhagen 1916 in ihrem Buch „Schrebergärten“. Quer dazu gibt es dort die Einen, die wie blöd ackern und ständig am Zupfen und Ausrupfen sind; und die Anderen, die sich vom „Streß“ erholen und „die Natur“ genießen wollen, z.B. die vielen Singvögel.
.
Zu den letzteren gehörte Olga Kaminer, die einen Schrebergarten in der Siedlung „Bornholmer Hütte“ pachtete. Ihr Mann, Wladimir, schrieb einen Roman darüber, den die Süddeutsche Zeitung als quasi wegweisend bezeichnete. Wahrscheinlich, weil die Kleingärten in München „Oasen zum Anpacken“ heißen, während es den Kaminers eher um Ausruhen und Grillen ging. Ein Gutteil des Romans besteht darin, sich vor Ort über das streng-deutsche Engagement bei der Bearbeitung von gärtnerischen Kleinflächen im Rahmen von noch aus der Bismarckzeit stammenden Gesetzen und Statuten für Arbeitergartenvereine russisch zu wundern.
.
Irgendwann langte ihnen die Pflicht – z.B. 80 Prozent Nutzpflanzen zu ziehen: Sie kauften sich eine große Datsche mit Bootsschuppen an einem märkischen See (auch darüber schrieb Wladimir Kaminer einen Roman). Andere erwarben eine Scheune hinter Oranienburg, die sie ausbauten, wieder andere ein Vorwerk bei Neuruppin, manche sogar ein Bauernhaus in Polen. Allein aus der Oranienstraße zogen zwölf Übriggebliebene aus Hausbesetzerkollektiven in ein „Datschen-Dorf“ im Oderbruch (und das BKA gleich mit). Die Ex-taz-Redakteurin Imma Harms bloggt aus ihrem Teil-Gutshof im Speckgürtel, daneben veröffentlichte sie „Geschichten vom Land“. Junge TU-Wissenschaftlerinnen bauen ihre uckermärkischen „Hide-Aways“ listig mit EU-Geldern zu Kongreß- und Eventzentren aus. In Steinhöfel „beetet“ der Verein „LandKunstLeben“ für Städter, die keine Zeit haben. Der nach Vorpommern gezogene taz-Ost-Mitgründer André Meier veröffentlichte eine Fibel: „Landleben von A bis Z“. In Marzahn initiierte der taz-West-Mitgründer Benny Härlin das Agrarexperiment „Weltacker“: 2000 Quadratmeter, die ausreichen sollen, um einen Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Für die urbanen jungen Leute ist das aufs Land ziehen oder einen Schrebergarten pachten meist ebenfalls ein Experiment – d.h. auf einige Jahre begrenzt, analog zu einem wissenschaftlichen „Forschungsprojekt“ über die „Objektsprache“.
.

.
6. Gender-Unterschiede
Es hat sich herumgesprochen, dass Frauen eine größere „soziale Kompetenz“ haben als Männer, und nicht nur das, diese findet auch zunehmend Eingang ins Geschäftliche und wird Qualifikationsmerkmal, d.h. wird „nachgefragt“. Die Basler Philosophin Angelika Krebs hat den Frauen auch noch eine größere „dialogische Kompetenz“ attestiert, die aber eigentlich zum Gelingen einer Beziehung für beide Beteiligten unabdingbar wäre. Dazu erklärte sie: „Viele Frauen lernen das schon im Mädchenalter. Warum reiten sie so gern? Sie haben mit dem Pferd bereits ein Verhältnis zu dem anderen, während Kraftsport diese Kompetenz nicht entwickelt. Da gibt es einen klaren Gender-Unterschied.“
.
Zu dem an diesem Kompetenzvorsprung beteiligten „Pferd“ erschien gerade ein Buch des Marburger Literaturarchiv-Leiters Ulrich Raulff: „Das letzte Jahrhundert der Pferde: Geschichte einer Trennung“. Zwar denkt der Autor dabei auch an die Trennung einer Beziehung, aber primär geht es ihm um das Verschwinden des Pferdes als Nutztier (in der Landwirtschaft, im Transportwesen, bei Polizei und Militär), weswegen der Satz des nationalsozialistischen Staatsrechtlers Carl Schmitt – „Reiten heißt herrschen“ – nicht mehr zutrifft. Heute heißt es höchstens: „Pferde sind aus Chrom und Stahl gemacht und kleine, dicke Männer reiten sie“.
.
Ulrich Raulff kommt aber mehrmals auch auf das Reiten als äußerst beliebten Sport junger Mädchen zu sprechen. „Amazonen“ nennt er sie. In Berlin hat man einer dieser vermeintlich historischen Phänomene sogar ein bronzenes Denkmal in Originalgröße am Tiergarten gewidmet. Ulrich Raulff, der ein Photo von der Amazone abgedruckt hat, erwähnt, dass sie mit nacktem Hintern auf ihrem Pferd sitzt. Es sieht zwar friedlich und nett aus, stellt aber eine komplett-komplexe „Kampfmaschine“ dar.
.
Zahlreich sind die Schilderungen der Verbindung „Pferd-Steigbügel-Reiter-Bogen“, die mit den mongolischen Nomaden für kurze Zeit sogar zur Weltgeltung gelangte. Isaak Babel konnte sich in Budjonnys Roter Reiterarmee nicht genug darüber wundern, wieviel Zeit die Kosaken mit ihrem Pferd verbrachten. Mit der Eingliederung und Einreihung ihrer fast autonomen Reitereinheiten in die Armee veränderte sich jedoch ihr „ganzer Eros des Krieges“, wie Deleuze/Guattari schreiben: „Der auf das Tier orientierte Eros des Reiters“ wird dabei durch einen „homosexuellen Gruppeneros ersetzt“ (der besonders in der preußischen Armee gedieh, weswegen die Westberliner Schwulenzeitung nicht zufällig „Siegessäule“ heißt). Der spätere Panzergeneral Guderian zog aus dem 1. Weltkrieg den Schluß, die Reiter vom Pferd auf Motorfahrzeuge umsteigen zu lassen. Anfang 1918, bei der 2.Offensive in Flandern, waren die Pferde bereits zum langsamsten Glied in der Kette des Aufmarsches geworden, so dass man sie kurzerhand mit 150 Bussen an die Front schaffte.
.
Das „Freizeitreiten“ blieb jedoch – wenigstens für Gottfried Benn: „Sodomiterei als Rasensport“. Dennoch war ich auf einem Lesewettbewerb der 5. und 6. Klassen in einer Steglitzer Schule erstaunt, dass alle Mädchen romantische Pferdegeschichten vorlasen. Die meisten waren auch schon auf einem Reiterhof in Brandenburg gewesen. Dort wird nicht selten (das weiß ich von ihren Müttern) die sich gerade im Verkehr mit dem Pferd oder Pony entwickelnde „soziale Kompetenz“ ihrer Töchter übel ausgenutzt: Sie bekommen nichts als Müsli zu essen, müssen die Ställe ausmisten, die Pferde endlos striegeln und Hilfsdienste auf dem Hof leisten, so dass sie kaum zum Reiten kommen und ihre Eltern dafür trotzdem viel Geld bezahlen müssen.
.
Führt man die Amazonengedanken des Kulturwissenschaftlers und die der Philosophin über „dialogische Liebe“ zusammen, dann ist die größere „soziale Kompetenz“ der Mädchen gegenüber den Jungen eine Freizeiterrungenschaft, während die Männer ihre Pferde zuvor jahrhundertelang in schmutzigen Kriegen und Frieden asozial vernutzten. Um diesen „Gender-Gap“ noch zu vertiefen, hat das Sportpferdeland Niedersachsen jetzt „das Voltigieren zum Abiturfach“ erklärt. Dabei handelt es sich um eine Turnübung mit und auf einem Pferd, das laut SZ die aus Niedersachsen stammende Verteidigungsministerin von der Leyen empfohlen hatte, weil es den Mädchen ermögliche, „eine perfekte Kombination aus Akrobatik, Harmonie und Vertrauen“ einzuüben – für die „soziale Kompetenz“ – im multinationalen Wirtschaftsleben.
.

.
7. Alles wächst und wird Grün
Die dem „Verein Berliner Wertpapierbörse“ gehörende „Berliner Börse“, deren Domizil einem Gürteltier nachempfunden wurde, bietet laut eigener Angabe „eine einmalig große Auswahl an internationalen Titeln. Rund 10.000 Aktien aus 120 Ländern stehen zur Auswahl. Schwerpunkte liegen u.a. auf Aktien aus Amerika, Australien, Osteuropa und China.“ Man unkt, noch vor einigen Jahren wären amerikanische „Spielcasino-“ und „Privatgefängnis“-Aktien die Renner gewesen. Heute zählt man dort u.a. die Aktien der „Umweltbank“ zu den „umsatzstärksten“. Als Neuheit bietet die Börse via Internet „kostenlose Realtime-Kurse“ an. Ein Banker erzählte kürzlich dem Fernsehpublikum: „Früher wurden Aktien Jahre gehalten, heute oft nur noch Stunden, sogar nur Minuten. Die Privatanleger sind meistens die Verlierer, es gewinnt, wer die schnellsten Rechner hat, mitunter entscheidet weniger als eine Sekunde.“
.
Die „Umweltbank AG Nürnberg“ setzt sich für den „Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere für klares Wasser, reine Luft und eine gesunde Umwel“ ein. Das ist doch mal eine klare Ansage, mögen sich viele gedacht haben, weswegen die „Nürnberger Nachrichten“ schrieben, sie „stürmt seit 15 Jahren von Rekordergebnis zu Rekordergebnis“. Zwar zeigt das Börsenbarometer beim Trend nun etwas nach unten, aber das tut erfreulicherweise auch die „CO2-Bilanz“, die der „Umweltbank“ als „Gradmesser ihres ökologischen Erfolges“ dient. Die taz hat ein Journal namens „zeozwei“ und berichtete 116 Mal über „Deutschlands grüne Bank“. Fast hat man den Eindruck, die Redaktion steht heute eher den fränkischen Bankern als den Bundesgrünen nahe. Erstere „emittieren“ gerade ihren „ersten grünen CoCo-Bond“ – zur „weiteren Stärkung des haftenden Eigenkapitals und damit als Grundlage für das zukünftige Wachstum.“ Wachsen wollen wir alle. Die taz kritisierte zuletzt, dass die Umweltbank ihren angestellten Werkstudenten bezahlten Urlaub und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall verweigert habe – und damit gegen geltendes Arbeitsrecht verstieß. Das taz-Aufsichtsratsmitglied Hermann-Josef Tenhagen kritisierte in der Zeitschrift „Finanztest“ der gemeinnützigen „Stiftung Warentest“, die Bank habe Anlegern mit falschen Werbeaussagen riskante Beteiligungen an Windparks verkauft. Zudem sollen langjährige Investitionen in Windparks zur Altersvorsorge empfohlen worden sein. Anlegern bei ihren geschlossenen Fonds, die Verluste erlitten hatten, klagten: die Umweltbank habe sie bewusst über die Risiken der Windfonds getäuscht.
.
Wikipedia ergänzte: „Nach einer Klage der Verbraucherzentrale gegen die Umweltbank unterlag diese vor dem OLG Nürnberg. Nach Ansicht des Gerichts durfte die Bank nicht auf die Vorteile (hohe Genussrechtszinsen) hinweisen, ohne auch die Risiken entsprechend darzustellen.“ Desungeachtet tickerte der „Solarserver“ aus der „nach-gesellschaftlichen Projektewelt“ zum Jahresende: „Das Geschäftsvolumen der Umweltbank überschreitet die 3-Milliarden-Euro-Marke; Solar-Projekte haben größten Anteil am grünen Kreditportfolio.“
.
Parallel zu den „Windfonds“ – für den Bau neuer und zur Aufrüstung alter Windkraftanlagen (WKAs), gründeten sich deutschlandweit etwa 80 Bürgerinitiativen gegen weitere „Windparks“. Sie nennen sich „Rettet die Uckermark“, „Gegenwind Ettlingen“ usw.. Neuerdings werben sie gemeinsam für ein „Moratorium gegen Windkraftanlagen in Europa“ und haben sich dazu eine „European Platform“ geschaffen.
.
Berliner BIs – z.B. gegen den Ausbau der WKAs in Buch und Malchow, sind nicht dabei. Dafür um so mehr aus dem Umland, wo die „Windparks“ 15% des Strombedarfs von Berlin und Brandenburg decken. Wie man ihrer „Liste“ (auf Wikipedia) entnehmen kann, sind nicht wenige große Aktiengesellschaften ihre Besitzer, u.a. die Bremer WKA-Entwicklungs-AG „Energiekontor“, deren Aktie laut Berliner Börse im vergangenen Jahr wieder stieg, nachdem sie sich bei ihrer Standortplanung wiederholt auf falsche „Wind-Prognosen“ verlassen hatte, aber „2015 alle gebauten Projekte erfolgreich ins Ziel brachte,“ wie „aktiencheck.de“ meldete. Die taz berichtete zuletzt, dass die Energiekontor AG „mehr als 500 Windräder in 86 Parks errichtet hat“, weitere seien geplant.
.
Alle wollen wachsen. „Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle,“ meint demgegenüber der Ökologe und Gründer von „Earth First“ Edward Abbey. Die BZ titelte am Sonntag: „Krebs, die Geisel der Menschheit“, weil nämlich gerade David Bowie gestorben war.
.

.
8. Grüne Woche
Mit einem lachenden Mädchen und dem Spruch „Laß Deine Phantasie blühen“ warb die Grüne Woche 2015 auf ihren Plakaten. Haben sie jetzt vielleicht den Widerspruch im Agrar-Ministerium zwischen (industrieller) Landwirtschaft und (gesunder) Ernährung/Verbraucherschutz mit einem jugendlichen Lachen einfach übersprungen? Zuvor war der Leiter der Grünen Woche, der Agrarkrimiautor Hans-Jürgen Petersen, nach 35 Jahren in Rente gegangen. Ein neuer Anlauf also nun? Als ich das letzte Mal auf der Grünen Woche war, gefiel mir vor allem die Verwissenschaftlichung der ehemaligen Messe. So zeigten einige Forschungsinstitute z.B. Filme über Schadinsekten und wie sie von anderen Insekten vertilgt werden. Achtjährige schnibbelten Obst und Gemüse klein, um in Reagenzgläsern die Vitamine zu isolieren. Am Stand der „Freunde der Erde“ konnte man anhand zweier nahezu identisch aussehender Mittagsgerichte raten, wie viele Kilometer Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Nachtisch und Rotwein zurückgelegt hatten. Das eine Gericht wurde im Umland Berlins zusammengekauft, das andere in einem Supermarkt. Ersteres summierte sich auf 400 Kilometer, letzteres auf 35.000. Der Stand der Landjugend bestand aus einem Buswartehäuschen.
.
Die Grüne Woche heißt so, weil die Besucher in den Zwanzigerjahren zumeist aus Förstern und Bauern bestanden, die grüne Lodenmäntel trugen. Ihr Logo – zwei gelbe Ähren auf grünem Grund – stammt aus dem Jahr 1935. Damals war von Scholle, Erbhöfe, Ernährungsschlachten, Volk braucht Raum, Wehrbauern im Osten und gesundem Bauernstand die Rede, aber viel auch von „modernster Agrartechnik“. Besucher bekamen einen „Amtlichen Katalog und Führer“. 1938 mußte die Messe wegen der grassierenden Maul- und Klauenseuche ausfallen, zwei Jahre später erneut – diesmal kriegsbedingt. Erst 1948 fand wieder eine statt – bald sprach man von einer „Fressmesse“, denn die Teilnahme von Ländern wie Indien, Ägypten, Marokko usw. wurde von der Bundesregierung subventioniert, so dass sie freigiebigst die Früchte ihrer Länder an die „Berliner“ verteilten – Bananen und Orangen u.a.. Der Anteil von Landwirten aus der DDR an den Besuchermassen nahm bis zum Mauerbau immer mehr ab. 1990 war erstmalig – in der Ökohalle der Grünen Woche – eine LPG mit einem Stand vertreten: der Tierproduktionsbetrieb „Florian Geyer“ Saarmund. Die LPG Schmachtenhagen mietete dann eine ganze Halle. Hinzu kamen Stände und halbe Hallen von Polen, Armenien, Russland und der Ukraine z.B. Aus Marokko beteiligten sich bis heute immer mehr Genossenschaften (und Frauen) mit Ständen an der Messe. Die europäischen Bauern unter den Besuchern wurden dagegen immer weniger, teils weil jährlich zigtausende ihre Landwirtschaft aufgaben und teils, weil es inzwischen auch auf dem Land genug Informationsmöglichkeiten und Abwechslung gab bis hin zu Landbordellen. Früher machten die Prostituierten in Westberlin ihr Hauptgeschäft während der Grünen Woche. Laut Wikipedia ist jetzt der Begriff der Bioökonomie das neue Leitbild der weltweiten Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung – und bestimmt damit auch die „Themen“ der Grünen Woche. Dazu fiel mir dort jetzt auf: Die Halle „Lust aufs Land“ mit Spielmöglichkeiten; die Halle mit dem „Netzwerk Ländliche Räume“, in der auch die Bundeswehr in grünen Uniformen („Wir. dienen. Deutschland“) einen Stand hatte, neben einem roten Feuerwehrwagen. „Ferien auf dem Bauernhof“. Dann vier Alpakas, ein Gehege mit fünf Rentieren, daneben ein „Jagdlehrpfad“ mit ausgestopften Tieren – Motto: „Mit Jägern die Natur entdecken“. In der Heimtierhalle stieß man auf „Reptilien live“, es gab einen Werbestand für „Golf“ (als letzte Fruchtfolge?), eine ganze Halle für „Vegetarier und Allergiker“ und eine „Bio-Halle“ voller „Lebensmittel mit Charakter“.
.
Ich sah angeekelt, dass die Traktoren jedes Jahr noch amerikanischer – d.h. immer größer – werden, analog zu den süßen Stückchen in den „Backshops“, während die Bauern immer kleiner werden, bis dahin, dass sie bloß noch Heimarbeiter der Agrarindustrie sind (es gibt Nebenerwerbslandwirte (Mondscheinbauern), die bereits mehr PS als Morgen haben). Aber noch abstoßender war ein Raiffeisen-LKW für Tiertransporte – mit der Aufschrift: „Wir transportieren Naturschutz“. Denn so war es fast überall: In der einen Hälfte der Messe hatte man ausschließlich das Wohl der Natur bzw. der Nutztiere und -pflanzen im Auge, bei gleichzeitigem Versprechen, sie effektiv zu vernutzen, und in der anderen Hälfte wurden sie bereits als Eingemachtes, als Würste oder Schinken vermarktet.
.
Es gab mal vor der „weltgrößten Agrarmesse“ kleine Stände mit Kritikern der „Giftgrünen Woche“, diese wurden dann in die „Öko-“ und „Bio-Hallen“ quasi heimgeholt. Dafür findet nun seit fünf Jahren zu Beginn der Messe eine große Agrardemonstration gegen die industrielle Landwirtschaft in Berlin statt – „Wir haben es satt!“ genannt. 50.000 Menschen beteiligten sich heuer daran, viele mit Traktoren. Die vom „Bauernlegen“ der EU bisher verschonten Landwirte gehen anscheinend vermehrt zur Demo statt zur Grünen Woche. Dafür werden die Länder immer mehr: Jugoslawien hat sich standmäßig ebenso vervielfacht wie jetzt auch die Ukraine.
.

.
9. Im Vorfeld der Grünen Woche
Bereits eine Woche vorher war eine Gruppe von Bauern, Aktivisten des „Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter“ (BDM), nach Berlin gekommen – für eine „symbolische Aktion“ zum Auftakt der „Grünen Woche“: Sie schütteten einen Milchpulverberg vor die Tür des Milchindustrieverbandes (MIV). Ihre Aktion wurde von der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ (AbL) unterstützt, die zum „Bündnis ‚Meine Landwirtschaft'“ zählt, das heute erneut eine „Großdemo“ gegen „Tierfabriken, Gentechnik und TIPP“ veranstaltet (ausgehend vom albernen Potsdamer Platz).
.
Der BDM kämpft vor allem gegen die Molkereikonzerne, die den Bauern zu wenig für ihre Milch zahlen („weniger als 30 Cent pro Liter). Zudem fürchtet ihr Gründer, der Allgäuer Milchbauer Romuald Schaber, dem es 2008 – während der „Milchkrise“ (taz) – gelang, einen „Milchstreik“ gegen die Molkerei- und Supermarktkonzerne zu organisieren, dem sich tausende seiner Kollegen anschlossen, dass von der „Liberalisierung“, dem Wegfall der Milchquoten ab März, nur wieder die Molkereien profitieren werden. Sein BDM setzt nicht mehr nur auf Einfluß und Aufklärung u.a. bei den EU-Politikern. Der Gründer des „AbL“, der friesische Bauer und Agrarprofessor Onno Poppinga, hatte ihn deswegen bereits in der taz kritisiert: „Immer nur Quoten fordern? Langweilig.“ Romuald Schaber schreibt in seinem Buch „Blutmilch“: „Die Brüsseler Spitzenbeamten sagen zu Recht: ‚Macht uns nicht verantwortlich für die Ausrichtung der Politik. Es sind eure nationalen Regierungen, die uns vorgeben, wie wir zu handeln haben. Wir als EU-Beamte haben sie umzusetzen.‘ Umgekehrt sagen aber auch die nationalen Politiker: ‚Da können wir nichts machen, das wurde in Brüssel so entschieden‘.“ Schaber nennt das ein „Schwarzer-Peter-Spiel“.
.
Um daneben auch noch ernsthafte Politik – von unten – zu betreiben, hat der BDM vor einiger Zeit eine eigene Milchvertriebskette: „Faire Milch“ aufgebaut. Diese Idee hatten vor ihm auch schon andere Milchbauern – wenn auch oft nur in kleinen Gruppen oder als Individuen – indem sie z.B. Bioläden, kleine Firmen und sogar einzelne Haushalte direkt beliefern und zudem ihren Hofverkauf ausbauen. In etwas größerem Stil haben sich auch einige umgewandelte LPGen so ein Vertriebsnetz aufgebaut: z.B. die sich heute „Ökodorf Brodowin GmbH & Co. Vertriebs KG“ nennende, die inzwischen für ihre Milch in Flaschen auf Plakatwänden in Berlin wirbt. Oder die umgewandelte LPG „Völkerfreundschaft“ in Schmachtenhagen bei Oranienburg: Weil die Berliner Molkerei in Neukölln ihr nach der Wende nur einen unanständigen Literpreis anbot, vermarktet sie seit 20 Jahren ihre etwa 4.000 Liter täglich selbst – mit einer eigenen Molkerei, die 1,5 Millionen Mark kostete. Mit den Milchprodukten werden sämtliche Kitas des Berliner Bezirks Marzahn sowie auch einige Krankenhäuser und Schulen in anderen Bezirken direkt beliefert. Für die Schulen ließ ihr Geschäftsführer Siegfried Mattner sogar extra vierzig Milch- und Schoko-Automaten entwickeln. Außerdem richtete er in einigen Berliner Bezirken komplette „Wochenmärkte“ aus und auf dem LPG-Gelände selbst einen „Bauernmarkt“, der an den Wochenenden von rund 5000 Berlinern besucht wird. Inzwischen gibt es sogar eine eigene Bahnstrecke von Oranienburg auf den Hof. Als der BDM gerade seine Marktidee „Faire Milch“ umgesetzt hatte, und in mehreren Bundesländern um Mitmacher warb, titelte „topagrar“ – ein Organ der Agrarindustrie: „NRW: Faire Milch ist endgültig gescheitert.“ Schaber: „Die Wirtschaft verfolgt knallhart ihre Interessen.“
.

.
10. Das koloniale Erbe als Jobmaschine
Das Humboldt-Schloß wird jede Menge Arbeit für Akademiker und Journalisten schaffen – keine Domestikenjobs diesmal. Alles, was dort hinkommt, jedes der 500.000 ethnologischen Objekte und etwa 1000 Schädel bzw. Knochen von Ostafrikanern, muß recherchiert werden: Ist das Teil fies erbeutet oder ordentlich erworben worden? Selbst beim kostbaren Perlenthron aus Kamerun, den der Sultan von Bamun dem Berliner Häuptling Wilhelm II. „schenkte“ (die Berliner Zeitung schrieb dieses Wort bereits in Anführungsstrichen), ist man sich unsicher, ob nicht Zwang dahinter stand. Die Deutschen hatten nach 1884 auf ihrem Unterwerfungsfeldzug durchs Land „etliche Ethnien massakriert, Dörfer verwüstet und Überlebende zur Sklavenarbeit verpflichtet.“ Um seinem Sultanat dieses Schicksal zu ersparen, stellte Ibrahim Njoya den Deutschen Soldaten für ihre „Strafexpeditionen“ zur Verfügung und trennte sich von seinem Thron, wobei er ein entsprechendes Gegengeschenk von Wilhelm II. erwartete. Er bekam jedoch nur eine Kürassier-Uniform und ein Orchestrion. Unter dem Aspekt des Warentauschs, bei dem es um Äquivalente geht, ein mindestens fragwürdiger Deal. Da der Sultan zudem unter Druck stand, liegt ein Vergleich mit den „preisgünstigen“ Arisierungen von jüdischem Eigentum nahe.
.
Unter dem Aspekt des Geschenketauschs, der nur die Verpflichtung zur Erwiderung der empfangenen Gabe – womit auch immer – beinhaltet, geht dieser asymmetrische Austausch aber eventuell in Ordnung. Bei den meisten Objekten ist die Sachlage weniger verzwickt. So gehörte zum Troß des schädelsammelnden Herzogs von Mecklenburg auch der Ethnologe Hans Fischer; er hat geschildert, wie sie an ihre „Beute“ kamen: Sie gingen immer dann in die Dörfer, wenn die „Eingeborenen“ nicht da waren – ungeniert betraten sie deren Hütten und nahmen sich, was ihnen wertvoll erschien. Dafür hinterließen sie die üblichen europäischen „Gegengeschenke“ (Tabak, Eisennägel, kleine Spiegel). Die Schädel und Knochen buddelten sie aus den Gräbern aus.
.
Der holländische Autor Frank Westermann erwähnt in seinem Buch „El Negro“ eine nach Europa verschleppte Afrikanerin, die so genannte „Hottentotten-Venus“ – Saartjie Sara Baartmann, die zuerst lebend auf Völkerschauen in Europa ausgestellt wurde und dann, nachdem sie in Paris gestorben war, der Wissenschaft diente. Kein geringerer als der Begründer der Rassenanatomie George Cuvier, der eine Skala vom „geistig schwerfälligen Neger“ bis zum „innovativen“ weißen Europäer aufstellte, erwarb ihre Leiche – nicht zuletzt wegen ihres sensationell ausladenden Hinterteils und ihrer an den Beinen herunterhängenden Schamlippen. Letztere präsentierte er während eines Vortrags stolz in Spiritus konserviert: „Ich habe die Ehre,“ so schloß Cuvier seine Rede, „der Akademie der Wissenschaften die Genitalien dieser Frau anzubieten“. 2002 wurden Saras Überreste – Skelett, Geschlechtsteile und Gehirn – an Südafrika zurückgegeben und beigesetzt.
.
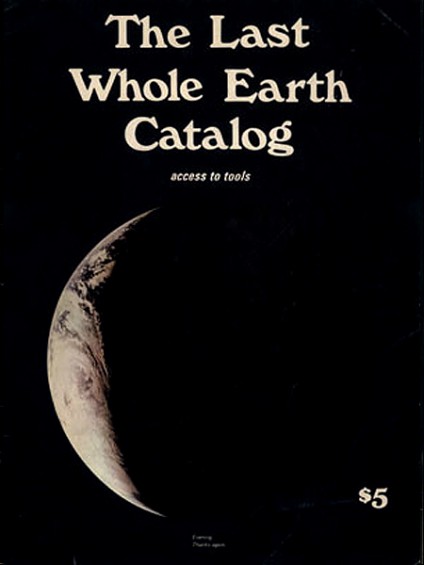
.
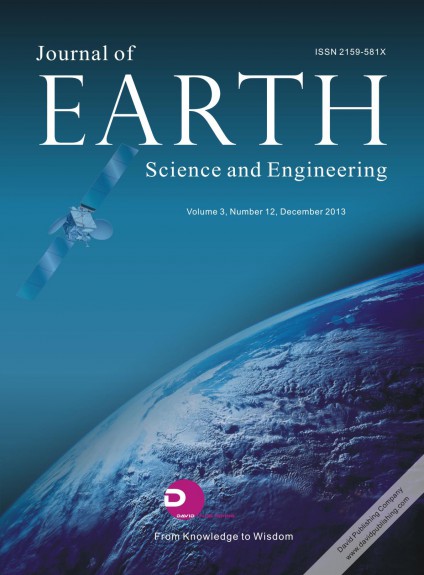
.
11. Egoismus-Altruismus
„Solche Geschichten erzählen Außerirdische ihren Kindern, damit sie BWL studieren.“ (Thomas Kapielski)
Das Mitleid wurde in dem Moment begrifflich gefaßt, von Aristoteles, als es mit der Durchsetzung des Geldverkehrs gesellschaftlich an ihr mangelte. Es wird sich deswegen als Problem vielleicht auch erst mit dem Ende dieses abstrakten gesellschaftlichen Verkehrsmittels erledigen. Im Neoliberalismus kann eine Genetikerin und Nobelpreisträgerin, Christiane Nüsslein-Volhard, noch heute mit der Behauptung durchkommen, „dass auch die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Zu dieser bösen Verblendung hatte der Semiotiker Roland Barthes bereits 1957 angemerkt, dass der Bourgeoisie immer und überall daran gelegen ist, ihre historische Klassenkultur in universelle Natur zu verwandeln, indem sie Geschichte in Mythos einmünden läßt: „Der Mythos leugnet nicht die Dinge, seine Funktion besteht im Gegenteil darin, von ihnen zu sprechen. Er reinigt sie nur, er macht sie unschuldig, er gründet sie als Natur und Ewigkeit.“ Und so haben kürzlich z.B. einige „US-Wissenschaftler“ in einem Großversuch an mehreren tausend eineiigen Zwillingen festgestellt, dass auch politische Einstellungen und überhaupt alle Meinungen genetisch bedingt sind. Jegliche Aufklärung und Agitation ist mithin vergebliche Liebesmüh, wir müssen auf die nächste Mutation warten.
.
Eine Studentin namens Jana, die Betriebswirtschaft an der „Eliteuniversität Viadrina“ in Frankfurt/Oder studiert, empörte sich: „Stellt euch vor, neulich sagte der Professor zu uns: ‚Wenn ich andern Gutes tue, tu ich mir selbst nichts Gutes…‘ Und das haben alle brav mitgeschrieben!“
.
Durch dieses BWL-Denken filtern sogar die Verhaltensforscher inzwischen ihre Beobachtungen. Ständig reden sie von „Brutgeschäft“, „Energiebilanz“, „Nahrungs-Konkurrenz“, „Wettbewerb“, „Reproduktionsraten“, „Win-Win-Situationen“ – die Natur ist auch für sie längst eine blühende kapitalistische Wirtschaft; eine „Innovation“ das selbe wie eine „Mutation“ und unter der „unsichtbaren Hand“ des Adam Smith verstehen sie „Selektion“.
.
Einer der Hemmungslosesten in dieser Hinsicht ist der israelische Ornithologe Amoz Zahavi, der anscheinend gar kein Verhalten mehr erforscht, sondern bloß noch die Ergebnisse seiner Kollegen neoliberal uminterpretiert, so dass z.B. aus dem von ihnen beobachteten „altruistischen Verhalten“ ein „egoistisches“ wird. Zahavi, der über die „Hilfe beim Nestbau und beim Füttern von Lärmdrosseln“ schreibt, sowie auch über den „angeblichen Altruismus von Schleimpilzen“, ist dabei zwar auf nichts Neues gekommen, aber er verkauft diese fast klassischen Fälle von Kooperation nun als „ein selbstsüchtiges Verhalten“, das er im BWL-Jargon durchspielt: „die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren…Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen.“ Es ist von „Werbung“, ja sogar von der „Qualität des Investors“ sowie von „Motivationen“ und „Chancen“ die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen auf eine Art egoistisches Gen zurück, indem die „individuelle Selektion“ eben „Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen“ begünstige, der „Selektionsmechanismus“ aber ansonsten erhalten bleibe.
.
Der englische Darwin-Propagandist Richard Dawkins fundierte Derartiges, indem er sogar eine Konkurrenz der Gene um ihre Verteilung in der nächsten Generation postulierte – in seinem Buch „Das egoistische Gen“. Sein langjähriger Mitstreiter für das Darwin-Weltbild, der Harvard-Ameisenforscher Edward O. Wilson, hatte zuvor die nationalsozialistische Soziobiologie wieder salonfähig gemacht, indem er Gesellschaften als Populationen faßte, deren (statistische) Verhaltensweisen sämtlichst stammesgeschichtlich erklärbar seien. Dawkins wie Wilson und mit ihnen zigtausend kleinere Geister in den angloamerikanisch dominierten „Hard Sciences“ wollten mit einem solchen materialistischen Reduktionismus die Sozialwissenschaften überflüssig machen. Warum, das hat der Biotech-Unternehmensberater William Bains erfrischend klar in der Zeitschrift „Nature Biotechnology“ formuliert: „Die meisten Anstrengungen in der Forschung und in der biotechnologischen industriellen Entwicklung basieren auf der Idee, dass Gene die Grundlage des Lebens sind, dass die Doppelhelix die Ikone unseres Wissens ist und ein Gewinn für unser Zeitalter. Ein Gen, ein Enzym, ist zum Slogan der Industrie geworden…Kann das alles so falsch sein? Ich glaube schon, aber ich bin sicher, das macht nichts. Denn die Hauptsache ist, dass es funktioniert: Manchmal funktioniert es, aber aus den falschen Gründen, manchmal wird es mehr Schaden anrichten als Gutes tun…Aber die beobachtbare Wirkung ist unbestreitbar…Wir müssen nicht das Wesen der Erkenntnis verstehen, um die Werkzeuge zu erkennen…Inzwischen führen die Genom-Datenbanken, die geklonten Proteine und anderes Zubehör der funktionalen Genetik zu Werkzeugen, Produkten, Einsichten, Karrieren und Optionen an der Börse für uns alle.“
.
Der Kulturwissenschaftler Niels Werber hat jetzt dieses ganze Hin und Her zwischen Ameisen- und Menschenforschung, die sich ständig gegenseitig befruchtet, in seinem Buch „Ameisengesellschaften- Eine Faszinationsgeschichte“ auf faszinierende Weise auseinanderklamüsert.
.
Mit der anschwellenden Kritik am Neoliberalismus wurde jedoch auch eine gewisse Gegenbewegung sichtbar: In der Affenforschung des Leipziger Max-Planck-Instituts wurde die Empathiefähigkeit von Schimpansen erforscht, wobei sie ihnen allerdings nur „schwache“ Kooperationsbereitschaft und Mitgefühle attestierten. In einem anderen Experiment verglichen sie diese „Gefühle“ mit denen von Hunden. Letztere zeigten bedeutend mehr Einfühlungsvermögen – in bezug auf den Menschen wenigstens. In Australien sind dagegen die Rudel der (verwilderten) Haushunde den schon lange dort wild lebenden Dingo-Rudeln in „sozialer Hinsicht“ weit unterlegen, wie Dingoforscher herausfanden.
.
Selbst dem Ameisenforscher Wilson kamen plötzlich Bedenken – und er überwarf sich mit Dawkins, indem er einen „Altruismus Krieg“ vom Zaun brach mit seinem Alterswerk „Die soziale Eroberung der Erde“, in dem er nachzuweisen versuchte, dass nicht der individuelle bzw. familiäre Egoismus, sondern die soziale Gruppe die treibende Kraft der menschlichen Evolution ist. Noch einen drauf setzte kürzlich der renommierte New Yorker Philosoph Thomas Nagel – mit seinem Essay „Geist und Kosmos“, in dem es ihm darum geht – und wie es auch schon im Untertitel heißt: „Warum die materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist.“ Damit z.B. das „Bewußtsein“ zu erklären, sei „ein heroischer Triumph ideologischer Theorie über den gesunden Menschenverstand“. Da ging ein Aufschrei durch die angloamerikanische Forschungselite: Wäre sie der Vatikan, würde sie es auf den Index setzen, hieß es.
.
Desungeachtet wird inzwischen schier überall nach „Empathieverstärkern“ gesucht (früher sagte man „Solidarität“). Die „Hertie-Stiftung“ mit ihrem „Hertie Forum Berlin“ spricht in ihrem „Informationsportal“ von einem „neuen Schwerpunktthema“ und zählt dazu mehrere Fragestellungen auf: „Gibt es ein Empathie-Gen“, kann man dem „Mitfühlen“ neurobiologisch auf die Sprünge helfen, sind „Spiegelneuronen“ dafür verantwortlich, hilft die „Theory of Mind“ weiter, gibt es „geborene Gedankenleser“ und „herausragende Empathieforscher“?
.
Im Berliner Atelier des dänischen Künstlers Olafur Eliasson fand 2011 ein „Workshop“ statt zur Beantwortung der Frage, wie sich Mitgefühl trainieren läßt: „How to Train Compassion“. Herausragende Empathieforscher, Künstler, Psychotherapeuten und buddhistische Mönche nahmen daran teil. So viel wurde dabei klar: Das Mitgefühl läßt sich nicht einpökeln wie Salzheringe. „Der Buddhismus lehrt Mitempfinden schon seit Jahrtausenden,“ westliche „Wissenschaftler“ haben dagegen erst jüngst „begonnen, sich damit auseinanderzusetzen,“ schreibt das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft in seiner neuesten Ausgabe, in der es auf ein Buch hinweist, das aus den Beiträgen des Empathie-Workshops bei Olafur Eliasson besteht und von der Max-Planck-Gesellschaft herausgegeben wurde. Es heißt „Mitgefühl – in Alltag und Forschung“, hat 557 Seiten und kann kostenlos im Internet runtergeladen werden – unter: „www.compassion-training.org“. Es enthält großteils leider nur Beiträge objektivistischer Psychologen. Die Kognitionsforscherin Tania Singer, die zusammen mit dem Leipziger „Neuro-Labmanager“ Matthias Bolz die Aufsatzsammlung redigierte, hat daneben noch mit Olafur Eliasson einen Film über den Workshop herausgegeben, der „Raising Compassion“ heißt. Sie gehen also davon aus, dass das Mitgefühl zunimmt und sich sogar noch steigern läßt, die linken Sozialforscher sind dagegen eher davon überzeugt, dass das Mitgefühl sich kontinuierlich abbaut. Und zudem unberechenbar ist – in seiner Objektwahl.
.
So kam z.B. die taz-Lokalredakteurin vor lauter Mitgefühl fertig von einem Außentermin am Brandenburger Tor zurück, wo eine Gruppe von Asylbewerbern für bessere Bedingungen in den hiesigen Flüchtlingslagern in einen Hungerstreik getreten war. Während einem ihrer Öko-Kollegen die Tränen kamen, weil es ihm nicht gelang, einen kleinen, abgestürzten Mauersegler sich wieder in die Luft erheben zu lassen. Und ein Wirtschaftsredakteur der FAZ geriet in tagelange Verzweiflung, weil „sein“ Fußballverein, der HSV, erneut verloren hatte.
.
„Rathe ich euch zur Nächstenliebe? Lieber noch rathe ich euch zur Nächsten-Flucht und zur Fernsten-Liebe!“ schrieb Friedrich Nietzsche einst – in nationalistischen Zeiten. Die reiselustig gewordenen Deutschen nehmen seinen Rat nun mehr und mehr an. Das gilt auch für den Berliner Empathie-Workshop-Initiator Olafur Eliasson. Er hat eine solarbetriebene Taschenlampe entworfen, die Menschen in Entwicklungsländern ohne Zugang zu Strom Licht spenden soll. Seine „Little Sun“ testete er im fernen Äthiopien. Anschließend meinte er – in einem Interview eines Online-Lampen-Shops: „Wir haben ein Verkaufsmodell entwickelt, bei dem Leute vor Ort die Lampe weiterverkaufen. Wir machen selbst wenig Profit. Je näher man aber zum Endverbraucher kommt, desto größer wird der Profit. Außerdem wollen wir mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, die Lampen von uns kaufen und diese verteilen.“ Aufklärung light.
.
Um Empathie ging es 2013 auch auf einem Kongreß im Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, allerdings primär um die in der ästhetischen Theorie, wo sie „Einfühlung“ genannt wird. Am weitesten ging in dieser Richtung der New Yorker Kunsthistoriker David Freedberg mit seinem Plädoyer für die Aufwertung der körperlichen Einfühlung beim ästhetischen Urteil. In einem Artikel über diese Tagung schreibt die FAZ: „Das Empathieprinzip hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Karriere verzeichnet. Im Angesicht der freigelegten Marktkräfte wuchs das Verlangen nach mehr Miteinander; es fehlte nicht an Autoren, die mit wissenschaftlichen Belegen die Wende zum Guten einläuteten. Der amerikanische Stichwortsoziologe Jeremy Rifkin rief das Zeitalter der Empathie aus, ein Paradies auf Erden, in dem sich alle Menschen in den Armen liegen und das, wenn man Mobbing, Mord und Totschlag einmal vergisst, in greifbarer Nähe liegt. Die Empathie betrat als weltrettende Macht die Bühne, die von der Vernunft die Weltregie übernimmt und den drohenden Zivilisationskollaps noch einmal abwendet. Die Naturwissenschaften hatten in dem niederländischen Primatenforscher Frans de Waal ihren Evangelisten des universellen Mitgefühls. De Waal empfahl den neu entdeckten (allerdings schon von Kropotkin um 1900 behaupteten) Altruismus im Tierreich als Korrektiv des Sozialdarwinismus und als Leitbild einer besseren Menschengesellschaft.“
.
P.S.: Thomas Nagels Essay „Geist und Kosmos“ wurde nicht zuletzt auch deswegen von den Neodarwinisten scharf kritisiert, weil er ihnen gegenüber sogar dem „Intelligent Design“ und dem „Kreationismus“ etwas abgewinnen konnte. Für uns sind dagegen Neodarwinismus und Intelligent Design nur die zwei Seiten einer sektiererischen Komplementärideologie. Charles Darwin selbst hat das bereits in seinem umfangreichen Werk über die „Verschiedenen Einrichtungen Durch Welche Orchideen Von Insecten Befruchtet Werden“ nahegelegt, als er seinen Lesern im Vorwort versicherte, dass sowohl die Anhänger der Evolution als auch die eines Schöpfergotts Gewinn aus seiner Studie ziehen werden.
.
P.P.S.: Soeben erschien im Neofelis Verlag ein Buch der Wiener Philosophin Susanne Magdalena Karr über „Verbundenheit – Zum wechselseitigen Bezogensein von Menschen und Tieren“. In einem Interview sagte sie im „Humanistischen Pressedienst – hpd“:
„Wir haben selbstverständlich für unser Sprechen immer nur die eigene Welterfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies schließt auch tradiertes menschliches Wissen ein. Wir können aber andere Welten für uns erschließbar machen, indem wir uns anderen zuwenden und von ihnen und ihren Wahrnehmungen affizieren lassen, ein Teil der „anderen“ annehmen, „becoming“ heißt es auf Englisch vieldeutiger. [Deleuze/Guattari sprechen in diesem Zusammenhang von „Werden“] Es gibt keine Gewissheit wie eine „letztgültige Wirklichkeit“, die sich uns erschließt. Wir agieren von unserem Ort aus, machen uns aber über Kommunikation, Verbundenheit und letztlich einen metaphorischen Gestaltwandel einen weiteren Horizont auf.
.
Insofern jegliche Kommunikation ein Austausch unter Subjekten ist, die dadurch zugleich – vielleicht auch nur temporär – mehr sind, als sie vor der Begegnung waren, kann man den Vorgang als Bereicherung des Eigenen bezeichnen. Gleichzeitig wird aber auch etwas vom Eigenen weitergegeben, Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Die Kommunikation über Einfühlung ist besonders dann auf den Plan gerufen, wenn verbaler Austausch nicht möglich ist – etwa bei anderen Spezies oder kleinen Kindern. Das Eintauchen in diese “Sphäre des anderen” ermöglicht so ein Erfassen oder doch Erahnen seiner Befindlichkeit. Möglicherweise gilt es, den Egoismus-Vorwurf gelassen zu nehmen: lieber mehr zu wissen, als unberührt, unaffiziert emotionslos und einsam zu sein.“
.
Die letzte in dem hpd-Interview gestellte Frage an Susanne Magdalena Karr lautete: „Was würden Sie Thomas Nagel letztlich entgegnen, der die Frage, woher können wir wissen, „‚wie es ist, eine Fledermaus zu sein.‘ schließlich für unbeantwortbar hält?“
Antwort: „Ich würde ihm zustimmen. Wir können nur versuchen uns anzunähern. Dies allerdings ist ein lohnenswertes Unterfangen.“
.

.
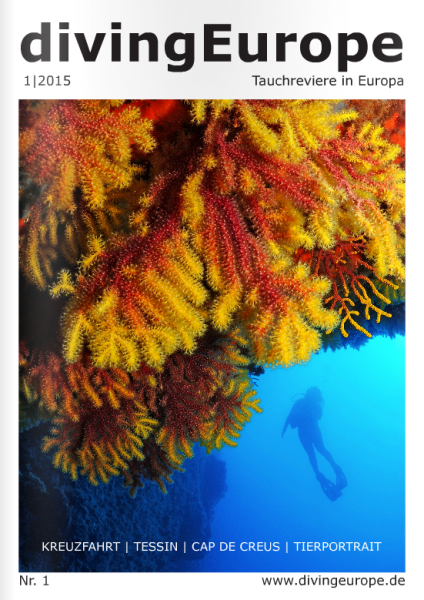
.
12. Einige Natur-Lexika
Neben meinem taz-Schreibtisch steht eine zehnbändige Ausgabe von „Brehms Tierleben“ aus den Jahren 1909 – 1919, die ich von der wunderbaren Ärztin Dorothea Ridder quasi geerbt habe. Ich brauche dieses Lexikon aber gar nicht, denn zum Einen gibt es im Internet eine ältere Ausgabe von „Brehms Tierleben“, in die noch keine Naturwissenschaftler reingepfuscht haben und zum Anderen kann man darin die Zitate, die man benötigt, einfach kopieren und übertragen.
Es gibt jedoch einige neue, kleinere Nachschlagewerke – wie z.B. das „Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen“ von Arianne Ferrari und Klaus Petrus. Sie und ihre über 100 Autoren kommen großteils aus dem hierzulande erst noch durchzusetzenden Forschungszweig „Human Animal Studies“, der sich aus den Feminismus- und den Gender-Studies entwickelte. In ihrem Lexikon – von A wie Anarchismus bis Z wie
Zoophilie - gibt es die unterschiedlichsten Stile, einige erinnern noch an Einträge in "Meyers Konversations-Lexikon". Die allgemeine Stoßrichtung des 480-Seitenwerkes ist der Tierschutz. Mehrere Autoren, darunter die Herausgeberin der Berliner Zeitschrift "Tierstudien" beteiligten sich auch noch an einem anderen Lexikon - aus einem bereits etablierten Forschungsbereich: der Kultur- und Medienwissenschaft. Es heißt schlicht "Tiere" und will ein "Kulturwissenschaftliches Handbuch" sein. In ihm hat z.B. der "Tierschutz" nur eine Eintragung, die, ebenso wie die über "Tierversuche" und "Zoo", relativ ausführlich aber oft etwas schematisch deren "Geschichte" thematisiert. Herausgeben hat es der Literaturhistoriker Roland Borgards, die Eintragungen stammen von 26 Autoren, von denen sich etliche schon länger mit "Cultural Animal Studies" beschäftigen, was leider nicht zwingend eine Beschäftigung mit realen Tieren bedeutet. Auch die lexikalische Geschichte "Ornithomania" des Schriftstellers Bernd Brunner handelt nicht von Tieren, sondern von Tiernarren, genauer gesagt: Es sind Kurzporträts von mehr oder weniger exzentrischen Vogelliebhabern (siehe blo-eintrag v. 5.11.2015 und taz v. 16.2.2016: „Der Vogelbeobachter-Beobachter“). Dem Autorenkollektiv des "Wörterbuchs kinematografischer Objekte" blieben die Tiere dagegen nicht erspart. Eine Anekdote daraus über den Umgang mit ihnen im Film kann das bereits verdeutlichen: "Warum sie denn keine echten Kühe benutzen, fragt der Streber Martin Prince in einer Episode der Simpsons einen Requisiteur, der auf einem Set ein weißes Pferd mit schwarzen Farbflecken bemalt. 'Kühe sehen im Film nicht wie Kühe aus, da muss man Pferde nehmen', lautet die Antwort. Und was macht man denn, wenn man tatsächlich Pferde filmen will? 'Da binden wir meistens nur ein paar Katzen aneinander'." Inzwischen sind über die Massenmedien derartig viele Tiere namentlich bekannt geworden, dass Karen Duve und Thiess Völker ein ganzes "Lexikon der berühmten Tiere" zusammenstellten. Das Spektrum reicht von Lassy, Fury und Flipper bis zu Winnie-the-Pooh, Yogi Bär und Micky Maus. Hier wird also nicht mehr zwischen vermeintlich realen und virtuellen Tieren unterschieden. Der Deutschlandfunk schrieb: "Ein Tier, so kann man nach 670 Seiten durchaus erschöpfender Lektüre sagen, ist kein Tier, sondern ein veränderbares Konzept." Das scheinen die Politiker auf ihren Weltkonferenzen auch vom "Klima" anzunehmen. Die Klimaforscher des Helmholtz-Zentrums Geesthacht, u.a. der Mitbegründer des deutschen "Donaldismus", warnen bereits vor einer "Klimafalle" - in der ein Teil der Klimaforscher der bürgerlichen Politik beratend auf den konzeptuellen Leim geht. Nun hat jedoch die Geographin Sybille Bauriedl ein "Wörterbuch Klimadebatte" herausgegeben, in dem das Vokabular dieses neuen Forschungsfeldes „festgeklopft“ wird - ausdrücklich gegen jede "neoliberale Klimapolitik". Abschließend sei noch das "Handbuch des kleinen Zoosystemikers" von Louis Bec erwähnt. Der provencalische Autor erklärt darin die Begriffe und Aufgaben des Zoosystemikers, der "geheime 'hypofizielle' zoologische Systeme zu entdecken und erforschen hat." Sein Lexikon ist ein "Manual": Dabei "muß unbedingt alles unternommen werden," heißt es darin unter Punkt 1.10, "um in den Augen der Mitmenschen das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen und vernunftbegabten Menschen aufrechtzuerhalten." Desungeachtet muß es der angehende Zoosystemiker, wie es unter Punkt 4.2 heißt: "stillschweigend und gelassen hinnehmen, von den Wächtern über die 'Eigenarten', den großen Vertretern des Wissens, den bedingungslosen Anhängern des Mythos vom Kunstschaffenden mit dem abgeschnittenen Ohr, von den sehr ehrenwerten Kunstkritikern und sogar von den Medizinstudenten im zweiten Studienjahr ausgebuht zu werden." Daneben sollte er (Punkt 5.6) "mit der Fähigkeit begabt sein, Expeditionen in die vagen und konturlosen Zwischenreiche einer atopischen Zoogeographie vorzubereiten." ..
13. Logisch!
Eintrag auf der Internetseite der Salafisten: „Du fragst, warum ich mich Allah zugewendet habe… Weil er auf alles eine logische Antwort hat.“ Mir kommt jedoch gerade der Koran besonders „unlogisch“ vor. Man nehme nur die Sure 24: „Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet: Die Lampe ist in einem Glas; das Glas gleicht einem funkelnden Stern. Angezündet (wird die Lampe) von einem gesegneten Ölbaum, der weder östlich noch westlich ist, dessen Öl beinahe leuchten würde, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu Seinem Licht, wen Er will.“
Im freundlichsten Fall ähnelt das der Beschreibung des Glühbirnensystems von Wolfgang Schivelbusch – in seiner „Geschichte der künstlichen Helligkeit“: „Der Glaszylinder, in dem die Flamme eingeschlossen war, präludierte den Glasmantel der Glühlampe; der Dochtmechanismus den Lichtschalter; die Flamme, die durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr so sehr in ihrer Lichtintensität gesteigert war, den Glühfaden.“
Aber was ist eigentlich „logisch“? Für den Salafistensprecher gehört das Wort „Logik“ entweder zu seinem „Jugendjargon“ (im Sinne einer Sohn-Antwort auf die Mutterfrage „Hast du dir auch frische Socken angezogen?“ – „Loogisch!“) oder er gebraucht das Wort ähnlich unreflektiert wie amerikanische Wissenschaftler.
Schon „die klassische Logik versteht sich selbst als Wissenschaft von den Gesetzen des menschlichen Denkens, die vom Logiker nicht konstruiert, sondern im menschlichen Denkvermögen angelegt sind“, schreibt der marxistische Erkenntnistheoretiker Rudolf Müller (in: „Geld und Geist“ 1977). Die Logik ist, mindestens seit Aristoteles, das Prinzip der Identität (A gleich A). Sie war zunächst wesentlich „Ontologik“, insofern das Sein durch sie begriffen wurde. Mit diesem Begriff des „Seins“ – von Parmenides, der ihn noch als Geschenk der Göttin Dyke empfing, beginnt laut Hegel die Philosophie. Für den Gräzisten Bruno Snell hat sie die Durchsetzung bestimmter Artikel bei der Substantivierung von Verben und Adjektiven (wie Das Sein z. B. ) zur Voraussetzung: ein Abstraktionsvorgang, dessen Übersetzung ins Lateinische z. B. nur um den Preis seiner Rekonkretisierung (einer umständlichen Umschreibung) gelang. In „Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen“ (1947) schreibt Snell, dass „das Griechische in der Naturwissenschaft den Logos aus der Sprache entbunden hat…Nur hier sind die Begriffe organisch der Sprache entwachsen. Nur in Griechenland ist das theoretische Bewußtsein selbstständig entstanden, alle anderen Sprachen zehren hiervon, haben entlehnt, übersetzt, das Empfangene weitergebildet.“
Der Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler fügte ausgehend von Snells Studien hinzu, „daß die griechischen Buchstaben seit etwa 450 v. Chr. eine zweite, arithmetische Bewandtnis annahmen: Alpha stand zugleich für Eins, Beta für Zwei, Gamma für Drei usw.. Zum erstenmal in aller Mediengeschichte entsprangen die Zeichen für Kardinalzahlen der Reihung oder Ordinalität eines Alphabets.“ Dieser „sogenannte Stoichedon-Stil im archaischen Athen“ war eine der „Möglichkeitsbedingungen von Wissenschaft überhaupt“. Kittler wandte sich mit seiner These „Schrift, Zahl und Ton im Medienverbund“ explizit gegen jeden marxistischen Versuch, Mathematik und die abstrakten naturwissenschaftlichen Begriffe ihre Zeitlosigkeit zu nehmen und sie aus der Ökonomie – konkret: aus der Einführung des Geldes im griechischen Warenhandel (etwa 500 vor Chr. in Ionien) – abzuleiten.
Aber wie auch immer: Ich stimme der Physikerin zu, die auf einer Tagung der Akademien der Wissenschaften und der Künste über Gemeinsamkeiten und Gegensätzlichkeiten von Kunst und Wissenschaft meinte: Es gehe doch im Kern um den Satz der Identität in der Logik – A gleich A: „Da endlich raus zu kommen, darauf käme es doch wohl an.“
Der Salafistensprecher wollte dagegen partout da rein. Er will einen mathematischen Glauben – ähnlich vielleicht dem der Pythagoreer. Diese Sekte, die übrigens bereits im 6. Jhd. v. Chr. den „Euro“ erfand, gibt es jedoch längst wieder – seit fast 100 Jahren in Russland und zwar in Form einer umfassenden Genieförderung frühbegabter Mathematiker, allerdings ohne Glauben an Gott oder Götter – an reine Logik nur noch. Kein Wunder, dass die deutschen Spitzenmathematiker alles Sowjetrussinnen sind.
Worum es im Kern geht: Wir sind Tag und Nacht von hautnah bis weitestentfernt von auf Mathematik basierenden Dingen und inzwischen sogar Lebewesen umgeben. Diese Zweite Natur drängt die Erste, die nicht-mathematische, in Nischen (Reservate, Nationalparks, Schutzzonen, Zoos, Botanische Gärten etc.), die bald Inseln gleichen, die jedoch ebenso wie ihre Bewohner ebenfalls noch gefährdet sind. Aus dieser Entwicklung raus zu kommen, scheint unmöglich. Zumal sie sich täglich beschleunigt, dazu innoviert und effektiviert wird.
Georg Lukacs hatte diesen Befund bereits als das Wesen der Moderne ausgemacht – als eine „Angst“, die aus „transzendentaler Unbehaustheit“ resultiere. Wir haben uns da mählich von etwas abgekoppelt.
In der Heidelberger Universitätszeitung schreibt der Philosoph Martin Gessmann: „Diese [Abkopplung] geht nach Heidegger schon soweit, dass wir den Kontakt zur Welt, wie sie von sich aus wirklich ist, bereits verloren haben, indem wir unsere Gitternetze der Verrechnung und möglichen Vernutzung über sie legen und überhaupt nur als wirklich akzeptieren, was sich wissenschaftlich explizieren lässt. Als mögliche Therapie schlägt der frühe Heidegger eine radikale Sprachkritik vor, in der die modernen Schichten der sprachlichen Verstellung solange abgetragen werden, bis wir wieder auf den ontologischen Grund einer scheinbar intakt gebliebenen „Lebenswelt“ stoßen. Der späte Heidegger wird sich eingestehen, dass diese „Destruktion“ eine herkulische und zuletzt unlösbare Aufgabe ist, die keinem Denker der Moderne mehr gelingen kann. Aus der Ernüchterung folgt, dass man sich mit einer internen ‚Verwindung‚ des Technik-‚Gestells‚, in dem wir allseits gefangen bleiben, begnügen muss.“
Für Gessmann war diese Heideggersche Opposition zur modernen Wissenschaftsgläubigkeit „der entscheidende Impuls“ für das Philosophieren von Gadamer und Derrida, die sich darüber immer wieder zerstritten. Letzterer hielt desungeachtet in Heidelberg die Trauerrede für den ersteren, und sollte dann in Heidelberg dessen Leerstelle füllen, starb aber kurz davor.
Zwei Zitate aus Band 76 der Gesamtausgabe der Schriften von Martin Heidegger:
„…aller Biologismus ist eine ‚Technisierung‘ der Lebendigkeit des Menschenlebens. Daß das ‚organische‘ stillschweigend gleichgesetzt ist in dem, was aus einer fortschreitenden ‚Organisation‘ erwacht und dem ‚Organisierten‘ gemäß ist, gibt nur einen groberen, aber sicheren Fingerzeig auf die wesensmäßige Zusammengehörigkeit von Biologismus und Technik.“
„Die neuzeitliche Biologie und der Biologismus vollends sind die Wesensfolge der Technik als dem metaphysischen Grundgefüge des Seienden.
Die wesentliche Zerstörung, die im Aufkommen des Biologismus liegt, sofern er jede Möglichkeit eines Erfahrens des Da-seins untergräbt.
Die Verwüstung, die in der Biologie liegt, wird darin sichtbar, dass gerade sie den Anschein der Gesundung und der Kraftsteigerung erweckt, wenn ihr gemäß Züchtungsmaßnahmen getroffen werden.“
.
 .
.
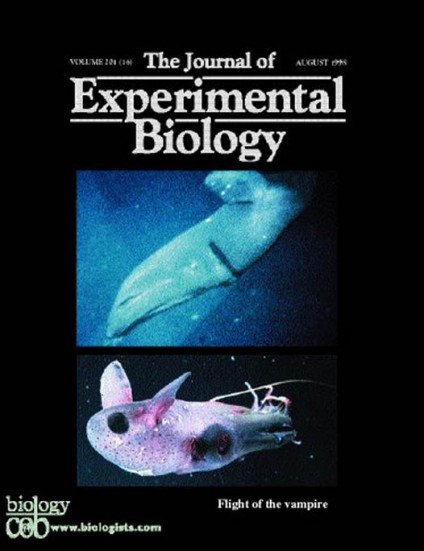 .
.




