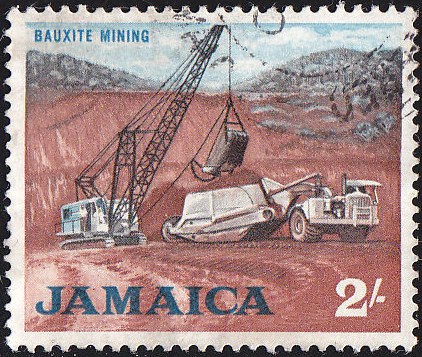Braunkohle-Abbau in der Wetterau nach dem Krieg
Uranbergwerk Wismut
„Ich bin Bergmann/Wer ist weniger?“
Pötzlich kamen mir nur noch Geschichten über Bergwerke unter. Erst mal die „Wismut“, beginnend mit Werner Bräunigs tragischem Werk „Rummelplatz“ – über das Uranbergwerk „Wismut“ im Erzgebirge, der einst weltweit viertgrößten Uran-Abbaustätte, wo zu Hochzeiten über 100.000 Leute arbeiteten. Sie lieferten der deutsch-sowjetischen Aktiengesellschaft Uran für den Bau der sowjetischen Atombombe. Tragisch war für Bräuning, dass sein Werk über die Wismut in der Diskussion der Partei über den Kurs der sozialistischen Kunst 1965 beispielhaft kritisiert wurde, im Neuen Deutschland war von „Beleidigung der Werktätigen und der sowjetischen Partner“ die Rede. Das Manuskript verschwand ungedruckt und auch unüberarbeitet in seiner Schreibtischschublade, vergeblich bot die Wismut ihm jegliche Unterstützung an. Ich hätte Bräunings Buch eher wegen seiner ausufernden politisch-ideologischen Dialoge nicht zum Druck empfohlen.
.

.
Es erschien erst 2007 im Westverlag „Aufbau“, in einem ausführlichen Nachwort heißt es über den Autor: 1953 war er als Fördermann bei der Wismut in Johanngeorgenstadt tätig und wurde im gleichen Jahr wegen Schmuggels nach Westberlin zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung 1954 arbeitete er bis 1955 im VEB Papier- und Kartonwerk Niederschlema, 1956 kurzzeitig als hauptamtlicher Instrukteur der FDJ-Kreisleitung Schneeberg und 1956 bis 1958 als Heizer in der Stadtwäscherei von Schneeberg. In diese Zeit fielen erste Schreibversuche. Bräunig wurde Volkskorrespondent der Karl-Marx-Städter Zeitung „Volksstimme“. 1957 wurde er in die Arbeitsgemeinschaft junger Autoren (AJA) der Wismut AG aufgenommen und hatte erste Publikationen. 1958 trat er der SED bei. Er studierte 1958 bis 1961 am Literaturinstitut „Johannes R.Becher“. 1959 verfasste er in Vorbereitung der 1. Bitterfelder Konferenz gemeinsam mit Jan Koplowitz den berühmten Aufruf »Greif zur Feder, Kumpel!«. Es ging auf der Konferenz um die „Vereinigung von Kunst und Leben, von Künstler und Volk/Gesellschaft“.
.
Einige Zitate – aus Bräunigs 700-Seitenroman: „Atomenergie – das war Leben oder Tod“/ „Die Wismut ist ein Staat im Staate und der Wodka ist ihr Nationalgetränk“/ „Auf dem Rummelplatz tranken sie, wenn die Gläser leer waren, akzisefreien Bergarbeiterfusel aus mitgebrachten Flaschen“/„Im Berg war es still geworden. Berg, der in Gängen Erz führt: Kobalt, Nickelblüte, Wismut, Silber, Uran, Bleiglanz und Zinkblende weiter östlich, Wolfram und Molybdänit, natürlich Zinn“/ „Wer aber Glück hat, kann vielleicht einen Topas finden.“/ „Die 200 Meter Gestein über seinem Arbeitsplatz bedrückten ihn nicht“/ „Aber das heulende Elend packte einen, wenn man nichts weiter hat als seine vier Barackenwände und seine acht Stunden mit der Schaufel am Stoß…Schachtkoller nannte man das. Als ob es nur der Schacht wäre! Es war das ganze Elend dieses verpfuschten Lebens, dieses Lebens ohne Aussicht, das einen herumstieß…“/ „Auch Hermann Fischer hatte angefangen, in den Begriffen der Wismut zu denken. Ich bin Bergmann, wer ist mehr, und was gibt es Wichtigeres auf der Welt als den Erzbergbau? Dagegen ist alles andere zweitrangig“.
.
Über eine besonders Engagierte – Ruth, die keinen Freund hat, schrieb Bräunig: „Und hatte es doch gewußt…Immer, wenn die Frauen für sich selbst sprachen,wenn sie, nicht einmal gegen die Männer, sondern mit ihnen, neben ihnen, gleichberechtigt ihr Leben leben wollten, immer dann brach alle Zwietracht auf“/ In der Kneipe am Samstagabend: „Gespräche und Gläserklang, denn man hat ein ungeheures Bedürfnis, nachzuholen, was man versäumt glaubt, ein ungeheures Bedürfnis nach Mätzchen“.
.
„Die Brigade wurde ein Alptraum“/ „Die Schleimer und Phrasendrescher finden einander immer. Die Schleimer und Phrasendrescher sind die stärkste Partei“/ „Das ist das harte Gesetz des Lebens“/ Der Brigadier der neuen Jugendkomplexbrigade wurde auf der Hängebank, als niemand von seinen Leuten dabei war, angerempelt: Lohndrücker! Russenknecht!“/ „Ich bin nicht für den Schacht gemacht, für das ewige dawai-dawai-dawai, und den Plan im Genick“/ „Erst besser arbeiten, dann besser leben. Oder so ähnlich. Stand ja jeden Tag in der Zeitung“/ „Ja bei uns, in der Wismut. Bei uns tragen sie 1000 Mark nach Hause und 1500 und 2000…In der Steinkohle sind sie schon froh, wenn sie für die gleiche Knochenarbeit 600 Mark rauskriegen oder 700…Oder ein Arbeiter in der Papierfabrik, die verdienen 300 oder 400 oder auch bloß 200, und manch einer noch weniger“.
.
„Für neue Wohnungen reichte es nicht – aber sie bauten Hochschulen und Arbeiter-Fakultäten, da schickten sie ihre Jugend hin; um die Köpfe von morgen kümmerten sie sich, wo es an Händen fehlte für heute, penetrante Weitblicker und Weltverbesserer allesamt. Und es fehlte an Fleisch und Butter, fehlte an festen Schuhen und festen Dächern…“/ „Sie wollten sich bestätigt fühlen und ließen keine Vernunftgründe gelten. Jahrhundertelang waren sie untertan gewesen aller Obrigkeit und ausgebeutet von allen, und nur eins hatte noch unter ihnen gestanden: ihre Haustiere – und ihre Frauen. Und nun erlebten sie, wie die Frauen ihnen ebenbürtig werden wollten, ihren Platz beanspruchten.“/ „…in dumpfer Wut saßen sie da, eingesperrt in ihre Männerwelt, eingesperrt in den Horizont von Vorurteilen, von Egoismus, von uralten Sprüchen.“
.
„Und plötzlich begriff Ruth das ganze Leben der Frauen von Wolfswinkel, der Frauen des Dorfes, der Arbeiterfrauen, der Kleinbürgerinnen, der Ehefrauen und Mütter im ganzen Land und überall auf der Welt.“/ „Du mußt durchhalten, du mußt! Hier wartet ein Kochtopf, ein Wirtschaftsgeld und ein Schlafzimmer. Draußen aber wartet die ganze Welt.“ [Ähnlich dachten laut David Peace auch die englischen Bergarbeiterfrauen 1984/85, als sie gegen den Widerstand ihrer Männer versuchten, deren Streik „draußen“ organisiert zu unterstützen.]
.

.
„Hinter den Ereignissen, hinter dem Leben, hinter ihren Männern her, ihren Ernährern, ihren Mittelsmännern zur Welt.“/ „Unter den [letzten] Flüchtlingen [nach Westdeutschland bzw. Westberlin] waren mindestens drei, vier Maschinenführer, ferner zwei Werkführer, der Ingenieur Gerber und der technische Direktor, der Betriebsleiter Kautsky und der kaufmännische Direktor.“
.
„Eines Tages wird dann Hiller abgeholt. Eines Tages wird Kocialek verknackt zu zwei Jahren drei Monaten…Man erfährt eines Tages, dass es ein Delikt gibt, genannt Boykotthetze…Eines Tages zieht ein Wismutfahrer ein mit dem Delikt der Zunft: Benzindiebstahl.“/ „Da war es wieder wie damals im Schacht, als sie eingeschlossen lagen auf dem Unglücksbruch, und als alle standhielten und alle bestanden, bis auf zwei: einen alten – und einen Jungen. Ja, dachte er: Leben ist immer eine Aufgabe. In jedem Alter. Und zu jeder Zeit.“/ „Wer besser leben will, muß besser arbeiten, das versteht jeder.“
.
Die Münchner Philologin Angela Drescher fragt sich am Ende ihres Nachworts über die Entwicklung des vorbestraften Gelegenheitsarbeiters auf Rummelplätzen zum vielbeachteten DDR-Arbeiterschriftsteller Werner Bräunig: „War es Mimikry, war es eine wirkliche Wandlung?“
.

.
Auf dem Forum „untertage“ der Grubenarchäologischen Gesellschaft (GAG) findet sich der Hinweis auf die Schriftenreihe der Traditionsstätte für den sächsisch-thüringischen Uranbergbau im Kulturhaus ‚Aktivist‘, Bd. 2, Schlema: 1998 und darin G. Bretschneider Aufsatz: „Verbotene Kunst. Zum Schicksal des Wismut-Romans ‚Rummelplatz‚ von Werner Bräunig und anderen Kunstwerken“ .
.
Einer der Forums-Teilnehmer schreibt: „Zu den frühen Wismut-Sachen muß man unbedingt den Roman „Der Glückssucher“ (1973) des Niederlausitzer Sohn eines Bergarbeiters und Schriftstellers Herbert Jobst zählen, wobei der Teil einer Reihe ist (1. Teil: „Der Findling“). Von 1945 bis 1947 arbeitete er als Kriegsgefangener in Tscheljabinsk, Sibirien, im Steinkohlebergbau (Lager 8). Von 1948 bis 1956 arbeitete er für die Wismut, zu Beginn als Hauer und Fördermann. Nachdem er 1952/53 ein Studium an der Bergakademie Freiberg absolviert hatte, hatte er den Posten eines Steigers inne. Nach ersten Schreibversuchen wurde er 1956 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren, seit 1957 arbeitete er als freier Schriftsteller in Flöhe Sachsen.“
.
Zu den Wismut-Romanen zählt außerdem: „Kumpel Sepp Wenig. Aus dem Leben eines unserer besten Bergarbeiter“ von Hans Gert Lange (1954), „es ist etwas ideologielastig, aber trotzdem lesenswert. Ferner aus unserem tschechischem Nachbarland: ‚Die Männer vom unterirdischen Kontinent‘ von Josef Frais.“ Frais erlernte den Beruf des Bergmanns und arbeitete dann als Hauer, Schleifer und Heizer. Sein Roman spielt jedoch nicht im tschechischen Uranbergbau, sondern im Kohlerevier von Ostrava (Mährisch-Ostrau).
.

Wismut-Arbeiter unter Tage
.
Vom sächsischen Steinkohlebergbau handelt der Roman „Wetterleuchten um Wadrina“ (1954) des DDR-Schriftstellers Wolfgang Neuhaus. Der Roman „‘Glück auf, Kumpel‘ von Georg A. Oedemann (1938) „spielt ebenfalls im Oelsnitzer Revier, der Autor geht das Thema ideologisch aber von der anderen Seite an, wobei es für ein Buch aus der Nazizeit noch relativ harmlos ist. Im ganzen sehr Oelsnitzlastig, Zwickau kommt kaum vor, obwohl es das größere Revier war. Mir ist aber noch ein Roman in Erinnerung, der den Grubenbrand von 1952 und 1955 auf dem Martin-Hoop-Werk thematisiert – von Rudolf Fischer: „Martin Hoop IV“ (1958). Schließlich das Kinderbuch: „Perle Pfiffikus“ von Horst Neubert, es behandelt das Ende des Steinkohlenbergbaues in Oelsnitz aus der Sicht eines 11-12jährigen Jungen.“
.
Bereits Anfang der Achtzigerjahre wurde ein Teil des „Karl-Liebknecht-Schachtes“ zum Bergbaumuseum Oelsnitz umgebaut, einem der größten technischen Museen in der ehemaligen DDR. Der 50 m hohe Förderturm ist weithin sichtbares Wahrzeichen von Oelsnitz. Die Halde des „Gottes-Segen-Schachtes“ in Lugau wird als Motocross-Strecke genutzt. Auf der Halde der Deutschlandschächte wurde 2000 der Glückaufturm errichtet, heute ein beliebtes Ausflugsziel.
.
„Und dann gibts da noch die beliebten „Kuhlbröckle“ (Kohlebröckchen) von Gustav Nötzold, dessen Thema ist der Zwickauer Steinkohlenbergbau im weitesten Sinne, beliebt vor allem deshalb, weil der Autor in erzgebirgischer Mundart schreibt. Nötzold war Steiger beim Steinkohlenwerk ‚Estav‚ Zwickau ,lebte danach bis zu seinem Tode in Budenheim am Rhein. Er war pro-Nazi, wobei man nicht sagen kann, wie er sich angesichts des WK II und der Naziverbrechen verhalten hätte, da er 1935 verstarb. Anhand seiner Geschichten hätte ich ihn eher als deutsch-konservativ und königstreu eingestuft.“
.
Ebenso wie Bräunigs Wismut-Roman verschwand zunächst auch der Spielfilm über den Uranbergbau der „SDAG Wismut“ von Konrad Wolf: „Sonnensucher“ aus dem Jahr 1958, der wegen zu kritischer Darstellung der Zustände in der Wismut und des lokalen Parteisekretärs erst 1972 in die Kinos kam. Die Dreharbeiten der Außenaufnahmen wurden hauptsächlich in Johanngeorgenstadt durchgeführt, wo der Uranbergbau 1956 eingestellt worden war. Aufgrund der Filmaufnahmen nahm man einige der Bergwerksanlagen noch einmal in Betrieb. Der Film ist heute als DVD für 4 Euro 90 zu haben. Es geht vor allem um eine schöne junge aber schon oder noch bittere „sozial Verwahrloste“, die Unter und Über Tage von Verehrern umzingelt wird.
.
Den Wismut-Roman „Sankt Urban“ schrieb ein Bergarbeiter: der 1925 im Erzgebirge geborene Bergmannssohn Martin Viertel. Er arbeitete von 1946 bis 1956 in der Wismut unter Tage, zuletzt als Steiger (eine Art Aufsichtsperson) in Johanngeorgenstadt. Hier war er laut Wikipedia Mitglied der Redaktion des Kulturspiegels. „Von 1956 bis 1959 war er Student am Literaturinstitut ‚Johannes R.Becher‘ in Leipzig. Anschließend wirkte er im kulturpolitischen Bereich der Wismut-AG, deren Arbeitertheater er auch leitete. Ab 1962 lebte er als freier Schriftsteller in Gera. Martin Viertel, der in den frühen 1950er Jahren mit dem Schreiben begonnen hatte, wurde bekannt durch seinen Roman „Sankt Urban“, ein Werk parteitreuer Arbeiterliteratur, in dem die Besetzung der sächsischen Uranerzbergbau-Region durch die Rote Armee1945 und die ersten Jahre der Wismut-AG geschildert werden. Martin Viertel erhielt 1960 den Kunstpreis der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, 1969 den Literaturpreis des FDGB und 1970 den Heinrich-Mann-Preis. Im Dezember 1989 gab er die ihm verliehenen Verdienstmedaille der DDR, den Vaterländischen Verdienstorden in Bronze und Silber sowie den Orden Banner der Arbeit Stufe 1 zurück.“ Im GAG-Forum heißt es ergänzend: „Wer Martin Viertel erwähnt, darf seinen Roman „Bollerbock“ (1986) nicht vergessen.“
.

.
In Schlema, nun wieder Bad Schlema, gibt es heute ein kleines „Museum Sächsisch-Thüringischer Uranerzbergbau“, verbunden mit einem Besucherbergwerk – „Für alle, die gern einmal selbst in einen Schacht einfahren und sich hautnah über die Arbeit unter Tage informieren möchten.“ Guntram Vesper, der es besucht hat, fand es zu „DDRlastig“ wie man die Gedanken der Nicht-Wendehälse und „Unverbesserlichen“ im Westen nennt.
.
Und dann ist da noch die Sanierungsgesellschaft Wismut GmbH, deren Hauptsitze sich bei Aue, Chemnitz, Ronneburg und Bad Schandau befinden. Sie teilt auf ihrer Internetseite mit: „Seit 25 Jahren wird die Sanierung der vom Uranerzbergbau geschädigten Regionen in Sachsen und Thüringen vorangebracht. Das Ende der Kernsanierung ist an manchen Standorten erreicht und an den meisten in greifbare Nähe gerückt.
.
Bisher hat das bundeseigene Unternehmen für die Sanierungsaufgaben in Sachsen und Thüringen rund 6 Milliarden Euro eingesetzt. Aktive Nachsorge, Überwachung der ehemaligen Bergbau- und Aufbereitungsstandorte und vor allem das Wassermanagement werden Aufgaben für die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte sein. Das Wismut-Programm beinhaltet diese Ewigkeitsaufgaben und hat diese mit dem Sanierungsprogramm 2015 definiert. Sie sind nicht weniger anspruchsvoll und benötigen weiterhin das volle Engagement, die Kompetenz und den Einsatz neuen Know-hows. Die dafür benötigten Mittel stellt die Bundesregierung weiterhin zur Verfügung.“
.
Einige weitere Milliarden wurden und müssen noch den an Krebs erkrankten Wismut-Bergarbeitern gezahlt werden. Die Ärzte-Zeitung schrieb 2012: „Die Zahl der durch Uranerzbergbau an Lungenkrebs erkrankten ehemaligen Wismut-Mitarbeiter ist höher als erwartet. Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die in Dresden eine Bilanz vorlegte, wurden seit 1991 insgesamt 3700 Lungenkrebs-Fälle als Berufskrankheit bestätigt. Hinzu kämen 120 Menschen mit Kehlkopfkrebs sowie 2750 Menschen mit Silikose.
.
Mit einer so hohen Zahl an Lungenkrebs-Fällen sei nicht gerechnet worden, sagte DGUV-Hauptgeschäftsführer Joachim Breuer. Bis 1990 waren bereits 5500 Fälle der zumeist tödlich verlaufenden Krankheit festgestellt worden – so dass die Zahl der durch den Uranerzbergbau in Sachsen und Thüringen verursachten Lungenkrebs-Fälle nicht mehr weit von der 10.000er Marke entfernt ist. Besonders die von Fachleuten als „wilde Zeit“ bezeichnete Anfangsphase der 1940er und 1950er Jahre galt für die Kumpel als extrem gefährlich, weil es damals keinerlei Schutzmaßnahmen gab.
.
Die DGUV hatte vor 20 Jahren eigens eine Betreuungsstelle eingerichtet. Mehr als 165.000 noch lebende Ex-Wismut-Beschäftigte waren nach der Wende ausgemacht worden. Allen habe man das medizinische Untersuchungsprogramm angeboten, aber nur rund 55.500 hätten schließlich daran teilgenommen. Um nachweisen zu können, dass die Erkrankungen auch wirklich durch die frühere Tätigkeit im Uranerzbergbau verursacht wurden, wurden laut Breuer 940 Tätigkeiten und 250 Arbeitsorte nachgestellt und analysiert. Die sogenannte Berufskrankenrente sei im Durchschnitt etwa 1400 Euro hoch und werde den Betroffenen bis ans Lebensende gezahlt, fügte Breuer hinzu. Für bemerkenswert hielt er den Umstand, dass 73 Prozent der Entschädigten in Sachsen, 22 Prozent in Thüringen und nur fünf Prozent im Rest der Republik lebten. Dies sehe er als Beleg für eine Besonderheit: ‚Die Leute, die bei der Wismut gearbeitet haben, haben eine außergewöhnlich intensive Bodenständigkeit‘.“
.

.
Der studierte Landwirt und Umweltaktivist Michael Beleites veröffentlichte 2013, als die „organismische Biologie“ drauf und dran war zugunsten der Laborbiologie (Genetik und Molekularforschung) abdanken zu müssen, umfangreiche „Grundzüge einer organismischen Biologie“. Sein Werk, das im Arnshaugk Verlag Neustadt an der Orla erschien, hat den lamarckistisch anmutenden Titel „Umweltresonanz“ (ich berichtete darüber – leider zu kurz – im Band 10 der „Reihe Kleiner Brehm“: „Fische“ 2016). Im Zusammenhang der hier thematisierten „SDAG Wismut“ hatte der in der kirchlichen Friedens- und Umweltbewegung von Gera aktiv gewesene Michael Beleites 1991 im Berliner Verlag Basisdruck das Buch „Untergrund. Ein Konflikt mit der Stasi in der Uran-Provinz“ veröffentlicht. Diese „Stasi-Dokumenten-Sammlung und -Kommentierung“ zeichnete die Wirkungsgeschichte seiner 1988 illegal gedruckten Dokumentation „Pechblende“ nach, mit der er seine Recherchen über die Umwelt- und Gesundheits-Gefahren des Uranbergbaus im Süden der DDR publik gemacht hatte.
.
Das MfS reagierte darauf mit „umfangreichen Offensivmaßnahmen“, der „operative Vorgang“ gegen ihn bekam den Decknamen „Entomologe“, es wurden ihm verschiedene Aktivitäten untersagt. Nach 89 und nach Auflösung des MfS führte er Gespräche mit den Protagonisten des „Vorgangs“. So sagte ihm der „verantwortliche Stellvertreter des Leiters der Stasi-Dienststelle Gera“, das er bereits vor dem Gespräch mit ihm, Beleites, viele Schriften des sogenannten „gefährlichen politischen Untergrundes“ kannte: „Als ich 1988 erstmalig die ‚Pechblende‘ las, ging ich davon aus: ein ‚Pamphlet‘ ohne wissenschaftliche Grundlage. Wir haben dann ja auch einiges unternommen, um es als solches in der Öffentlichkeit darzustellen. Gleichzeitig führten wir aber Untersuchungen mit Experten und mußten nach und nach feststellen, dass Wismut und SAAS (das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz) ihre Kontroll- und Überwachungspflichten grob vernachlässigt hatten.“
.
Da Beleites damals „Funktionen im Kulturbund“, in der Gesellschaft für Natur und Umwelt, hatte, welche sich im Museum für Naturkunde befand, bekam dessen Direktorin sowie auch deren Vorgesetzte, die Direktorin der Museen der Stadt Gera, von der Stasi quasi Weisungen, wie sie sich gegenüber Beleites zu verhalten hatten, u.a. durften sie ihm nicht wegen irgendwelcher Dienstvergehen kündigen, das tat dann zum Ärger der Stasi Beleites selbst. Während die Leiterin der Geraer Museen „ihrem“ Stasi-Offizier zu bedenken gab, ob das MfS nicht seine, Beleites, Wirkmacht überschätze, warf dieser der Leiterin vor, dass sie ihn „absolut unterschätze“. Die Direktorin war hin und her gerissen. Dass die Stasi politisch-polizeilich viel sensibler war als sie, merkte sie u.a. daran, als „ihr“ Offizier sie wegen einer kleinen Sonderausstellung im Museum für Naturkunde über „Probleme des Natur- und Umweltschutzes“ zur Rede stellte, weil darin eine Photo gezeigt wurde, das stark rauchende Schornsteine zeigte: „Dieses Photo gehöre nicht in die Ausstellung. Als Direktorin wäre es meine Pflicht gewesen, das selbst festzustellen.“
.
In seiner Stasi-Akte fand Beleites sauber aufgelistet alle westdeutschen Medien und Nachrichtendienste, die über seine Dokumentation „Pechblende“ berichtet hatten – unter Überschriften wie „Pechblende – Mehr Geld, aber auch mehr Krebs“/“Studie des kirchlichen Forschungsheimes Wittenberg über tödliche Folgen des Uranabbaus in der DDR“/“Der real existierende Strahlentod“ etc.. Das MfS entnahm diesen Veröffentlichungen, „dass in den Uranabbaugebieten der DDR angeblich überdurchschnittlich hohe Krebstodesfälle bei Erwachsenen, Leukämie bei jungen Menschen, Hodenkrebs bei jungen Männern sowie Lungenkrebs und Haarausfall bei Bergarbeitern auftreten.“ Und dass in den Veröffentlichungen der Westpresse „Auszüge“ aus Beleites „Machwerk wiedergegeben werden“. Die Partei und das MfS gaben mehrere „Gutachten zur ‚Pechblende‘ in Auftrag. Zu Beleites Gegengutachtern zählte dann u.a. auch der unglückliche Leiter der radiologischen Abteilung der Wasserwirtschaftsdirektion Gera, von dem Beleites besonders viele Informationen für seine Dokumentation bekommen hatte. Schließlich erklärte man, „es wäre in der DDR alles ausreichend untersucht; die Unbedenklichkeit des Uranbergbaus sei wissenschaftlich erwiesen.“ 2016 kam er noch einmal in einem größeren Zusammenhang auf die Wirkungsgeschichte seiner Studie „Pechblende“ zurück – in: „Dicke Luft: Zwischen Ruß und Revolte: Die unabhängige Umweltbewegung in der DDR“ (Schriftenreihe des Sächsischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen)
.
Erwähnt sei hier auch noch ein neues im Selbstverlag erschienenes Buch aus Westberlin – mit dem Titel „Halbwertzeit [half-life] – Protokolle des Zerfalls“ von Udo Zawierucha, mit dem ich 1971 eine zeitlang in der Wannseekommune zusammen wohnte. In seinem Beipackzettel schreibt er: „In essayistisch-poetischer Gestalt wandert der Autor durch die Gefühlswelt, die in ihm Naturbeobachtung und technologisch-naturwissenschaftliche Studien, Erfahrungen in der Industrie und letztendlich die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl hervorgerufen haben. Radioaktivität und die Informatik nahmen darin einen besonderen Platz ein.“ Udo Zawierucha hat ab 1966 Maschinenwesen und Philosophie studiert, arbeitete dann als „Systemanalytiker“ im Control Data Institut und schließlich in der Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH. Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 zeichnete sich für ihn das „Ende“ seiner „industriellen Karriere“ ab. In „Halbwertzeit [half-life]“ beschreibt er nun „Wirkung und Einfluß des Radioaktiven auf sein biologisches Leben.“ Seine Begrifflichkeit reicht darin von „Autopoiese“ und „Atombombe“ über „Goethe“, „Kant“ und „künstliche Intelligenz“ bis zu „Uran“ und „Verlust“. Es finden sich darin Sätze wie „Diese Erde ist eine Probe auf den Verstand“/„Die Experimente in einem Labor beweisen nichts. Sie zeigen lediglich, dass unter bestimmten Bedingungen bestimmte Ereignisse zu erwarten sind“/ „Als Plasmid fühlt es sich an, als wäre alles Plasmid“/“Wilhelm schlackst die Schlossstrasse entlang“…Gemeint ist hier die Westberliner Schlossstrasse, wo der Autor in der Nähe wohnt. Sein Buch hat er im übrigen mit schönen, sehr persönlichen Farbphotos bestückt, es beginnt mit seinen Beobachtungen einer Kreuzspinne auf dem Balkon.
.

.
Auch eine neue Biographie eines Uranbergarbeiters gibt es: „Karl-Heinz Bommhardt schreibt über ein Leben für die Wismut“ titelte die ostthüringische Zeitung 2012. Der Autor hatte ein Buch „über seine Dienstjahre über und unter Tage herausgebracht“. Die Zeitung interviewte ihn aus diesem Anlaß. „Der Rücken mache ihm schon einige Probleme, erwähnt Karl-Heinz Bommhardt nebenbei. Ansonsten gehe es ihm gesundheitlich ganz gut, auch wenn sich angeblich hin und wieder Gedächtnislücken auftun würden, sagt der 76-Jährige.
.
Wenn Karl-Heinz Bommhardt aus seinem Leben und vor allem aus seinen 36 Dienstjahren bei der Wismut erzählt, ist alles wieder da. Als wäre es gestern gewesen. Vielleicht auch, weil er zu diesem Thema gerade das Buch „Uranbergbau Wismut 1946-1990“ geschrieben hat, das Ende Dezember 2011 im Thüringer Verlag Rockstuhl erschienen und somit das Kramen in den Erinnerungen noch ganz frisch ist. Momentan ist er für dieses Buch, übrigens sein zweites, viel auf Lesereise an jenen Orten, wo er selbst Spuren hinterlassen hat. 1936 wird Karl-Heinz Bommhardt geboren. Die alleinerziehende Mutter – sein Vater kehrt aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zurück – wohnt mit den beiden Söhnen auf der Heidecksburg, hoch über der Stadt. Der wird zum Abenteuerspielplatz in seiner Kindheit. Nach dem Abitur findet sich für den jungen Mann, der sich bis dato aus dem gesellschaftlichen Leben herausgehalten hatte, kein Studienplatz, kein Arbeitsplatz – ein Unding zu DDR-Zeiten. Er sucht selbst und entscheidet sich 1954 im Kalikombinat Werra Bergmann zu werden. ‚Ein durchaus angesehener Beruf. Aber meine Vorstellungen unterschieden sich doch sehr von der Realität. Das Gehalt lag bei weniger als 500 Mark netto und ein Familienanschluss war nahezu unmöglich,‘ erzählt Karl-Heinz Bommhardt. Als sich 1955 die Gelegenheit bietet, bei der SDAG (Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft) Wismut anzuheuern, die für den Uranabbau fieberhaft Leute sucht, zögert der damals 19-Jährige nicht.
.
Er kommt in den Schacht 356, ein Bergwerk, das gerade entsteht und technologisch auf niedrigem Niveau ist. Übertage gibt es zu dieser Zeit noch den kleinen Ort mit fast 300 Einwohnern und einer Kirche. Zehn Gehöfte und der Gasthof waren für die Schachtverwaltung allerdings schon geräumt. In der Tiefe werden währenddessen – um die Förderkapazität zu erhöhen – fieberhaft vier Rundschächte gemauert, in einer Größenordnung, die es bis dahin bei der Wismut noch nicht gibt.
.
Von Gelegenheitsarbeiten über das Reinigen der Strecke und das Schieben der Hunde macht Karl-Heinz Bommhardt zu diesem Zeitpunkt alles, auch eine Ausbildung zum Hauer, für die es zu dieser Zeit noch nicht einmal genügend Aufgaben gibt. Und als sich nach dem Weggang der Rotarmisten 1955, die bis dahin die geophysikalischen Arbeiten übernahmen, die Gelegenheit zur Fortbildung bietet, ergreift der junge Bergmann erneut die Gelegenheit und drückt die Schulbank. „Ich bin in den Qualifizierungsstrudel hineingeraten und nach Breitenbrunn im Erzgebirge, der Kaderschmiede für Ingenieure und Techniker, gekommen.“ Als Nichtgenosse werden ihm Steine in den Weg gelegt. „Schwere drei Jahre“, blickt der Autor auch in seinem Buch zurück.
.
Als er 1959 nach Schmirchau zurückkommt, ist der Ort verschwunden. Während seiner Abwesenheit war der letzte Bauer nach Linda umgesiedelt, die Toten umgebettet und die Kirche gesprengt worden. Aus seinem alten Schacht ist „eine tolle Anlage geworden, sehr modern mit Loks, die 30 große Hunde ziehen konnten“, gerät er immer noch ins Schwärmen.
.
Doch die Technikbegeisterung des Bergmanns soll nicht über die harten Arbeitsbedingungen hinwegtäuschen. Er hat tödliche Unfälle erlebt. Er hat Kumpel mit Staublunge oder an Krebs sterben sehen. Dazu kommt, dass Bommhardt nach seiner einjährigen Assistenzzeit 1960 in die Brandschutzzeche versetzt und mit den schlechtesten und schwierigsten Arbeitsbedingungen konfrontiert wird. ‚Es gab durch Selbstentzündung der Lockermassen unzählige Brände im alten Schmirchauer Schacht. Gefährliche Feuer, die der Luft den Sauerstoff entzogen und extrem gefährliche Gase freisetzten‚. Zur Bekämpfung wird damals sogenannte Pulpe eingesetzt, eine ‚ekelhaft stinkende Lehmbrühe, die obendrein die Strecken verunreinigten und deren Einsatz nicht gern gesehen war‚, erzählt Karl-Heinz Bommhardt weiter.
.
Als er zum Jahresende den Betrieb verlassen will, bietet man ihn als Steiger Bergarbeiten im ehemaligen Sicherheitspfeiler des Schachtes 356 an. Dort sind die Vorräte der oberen Sohlen bereits abgebaut, aber auf der 120-Meter-Sohle stehen noch begehrte Restvorräte an. Wieder sind die Arbeitsbedingungen extrem, und die Erinnerung von Karl-Heinz Bommhardt glasklar. Obwohl der 76-jährige Familienvater, Großvater, Rentner und Buchautor mit seiner Frau seit vielen Jahren im sächsischen wohnt, und obwohl mit der Renaturierung der Tagebaulandschaft eine neue Landschaft entstanden ist, kennt Bommhardt die Gegend wie seine Westentasche, weiß die Standorte der alten Schächte exakt zu benennen. ‚Manches tut einem Bergmann schon sehr weh‚, sagt er. ‚Alles, was wir im Revier 6 ausgebaut haben, wurde anschließend nochmals im Tagebau überbaggert. Um wie viel billiger und einfacher wäre es gewesen, hätte man gleich im Tagebau das Erz gefördert‚, fragt er sich rückblickend.
.
Langsam wird Karl-Heinz Bommhardt weichgekocht – er tritt 1961 doch in die SED ein. Und tatsächlich verbessern sich umgehend seine Arbeitsbedingungen und Fortbildungmöglichkeiten. Er wird Projektant im Wissenschaftlich-Technischen Zentrum der Wismut. Währenddessen wird im Elbtalgraben weiteres Uran gefunden und im sächsischen ein neues Bergwerk aufgebaut. Er kehrt der alten Heimat nun den Rücken und wendet sich den neuen Herausforderungen in zu, baut eine Projektierungsgruppe auf, wird Haupttechnologe, zeitweise sogar Leiter der Abteilung Projektionslenkung. ‚Mit meiner Karriere ging es rasend schnell steil nach oben.‚
.
1990 erarbeitet er noch das Sanierungskonzept für die Wismut mit, bevor er mit 55,5 Jahren endgültig in den Ruhestand geht. Zwei Jahrzehnte ist das her. Doch auch nach dieser Zeit spricht aus dem großgewachsenen und schlanken Mann nach wie vor der Kumpel, der für seine Arbeit brennt, der um die Gefahren bei der Urangewinnung weiß und sie beiseite schiebt. Allerdings lässt ihn der Bergbau auch im Ruhestand nicht los. Mit seinem Einblick über die vielen Bereiche über und unter Tage in Thüringen und Sachsen soll er 1995 eine Wismut-Chronik zusammentragen. Er sammelt, durchforstet Akten, baut Kontakte auf, schreibt nieder. Die Arbeit bringt ihn auf die Idee, auch seine eigenen Erlebnisse festzuhalten – ja sogar sein ganzes Leben. Fünf Bände sollen es sein. Zwei sind bereits auf dem Markt, die folgenden ‚in Gedanken schon fertig‘. Etwas für die Ewigkeit will er schaffen, für die Kumpels, für die Nachwelt.
.
Auf der Schmirchauer Höhe, höchste Erhebung und heute Aussichtspunkt, hat Karl-Heinz Bommhardt schon andere bleibende Spuren hinterlassen. Die Nummer 1168 trägt sein Erinnerungsstein, der, gemeinsam mit denen vieler anderer Bergleute, wie die Abbaukonturen des alten Ronneburger Erzfeld angeordnet ist.“
.

.
Frohburg
Nicht weit weg vom Uranbergwerk Wismut befindet sich zum sächsischen Braunkohletagebau-Gebiet hin der Ort Frohburg. Und so heißt auch die große Kleinstadt-Chronik von Guntram Vesper, die zugleich eine Familiengeschichte des Ich-Erzählers ist, die bis zu seinem Ururgroßvater zurückreicht. Der Autor wurde 1941 in Frohburg geboren, der Vater war Arzt, unter seinen Patienten befanden sich viele Bergarbeiter, mitunter war er auch in der Wismut selbst ärztlich tätig, die Familie hatte ein Dienstmädchen, ein Kindermädchen und eine Praxishelferin, 1957 flüchte sie in den Westen – nach Gießen.
.
Der Karl-May-Verehrer Guntram Vesper hat über ein Jahrzehnt an seinem 1000-Seiten-Werk gearbeitet, eigentlich sein Leben lang, denn er hat schon als Kind Tagebuch geführt, alle um ihn herum ausgefragt und alles mögliche gesammelt. Die Ausdauer hat sich gelohnt, wenn es allerdings politisch wird, d.h. das größere Ganze streift, läßt er nur den reaktionären Zonenflüchtling, der er selber ist, zu Wort kommen. Das soll einen aber nicht stören. Ebensowenig wie Werner Bräunigs ausufernde ideologisch-revolutionäre Dialoge.
.
Vespers „Frohburg“-Geschichten und Schichten haben als Motto ein Fontane-Zitat: „Für etwaige Zweifler also sei es ein Roman“. Einige Zitate daraus: „Was im nahen Erzgebirge der widerborstigen Erde entrissen, mit Preßlufthämmern aus ihr herausgebrochen wurde, von 100.000 Arbeitern in Hunderten von Schächten, kam mit 5.000 Kilometern Umweg zu uns zurück, als Megabombe.“/ „55 muß das gewesen sein, in der Ausgabe des Stern stieß ich auf eine gezeichnete Karte der Sowjetunion, auf der die Standorte von Atomraketen eingezeichnet waren, ich war so angekurbelt, dass ich, obwohl die Hefte zurückgegeben werden mußten, die Seite herausriß.“
.
Erwähnt sei hier auch noch eine Ausgabe des Stern 1980, in dem eine Karte der Atomminenlager im Westen entlang der Grenze zur DDR abgedruckt war, diese Lager gab es offiziell gar nicht; Jörg Schröder hat darüber sowie über die Friedensbewegung in Oberhessen ein Buch geschrieben: „Cosmic“ (1982).
.
„Die Orte der Kreise Schwarzenberg, Aue, Zwickau und Annaberg. vor dem Krieg waren das die am dichtesten besiedelten Ecken ganz Europas, nun erst recht.“/ „unwillkürlich wird man selber ein bißchen zum Russen…“/ „…jeder zweite, der ein Unterkommen für die Nacht suchte, war ein Russe, wer weiß woher, wer weiß wohin, Auskunft bekam man selten, ein dichtes Netz aus Kasernen, Dienststellen und Garnisonen überzog das Land…da waren täglich Tausende Sowjetbürger in Uniform und Zivil unterwegs, auf Komandirowka. Aber auch Landsleuten war keinesfalls durch die Bank zu trauen…“
.
Einer der hochrangigen Russen in der Kommandantur, Kassanzew, war seinem Arztvater einen Gefallen schuldig: Nachdem er beim Karpfenschießen seinen Dolmetscher erschossen hatte, „mußte Vater ihm helfen und ihm, der Tote würde so oder so nicht wieder lebendig, einen Schwächeanfall attestieren, in dessen Verlauf sich der Schuß gelöst hatte.“/ Ostern 1955 fuhr der Autor mit dem Fahrrad „37 Kilometer nach Leipzig, quer durch die qualmende stinkende Braunkohlenwüste mit den quietschenden polternden Abräumern und Förderbrücken in den Tagebauen und mit den giftschwitzenden Schwelereien an der Straße.“/ „Sein Arbeitseinsatz in der Braunkohle bei Kahnsdorf beispielsweise, mit der Schaufel in der Hand. Was habe er aus dem halben Tag in der Produktion, im Tagebau, genau genommen zweieinhalb Stunden, nicht alles an Aufbaupathos herausgeholt.“ – Sagte der Schriftsteller Erich Loest zu dem mit ihm befreundeten Erzähler auf einer Geburtstagsparty von Günter Grass. An anderer Stelle bekommen der Schriftsteller Walter Kempowski sein Fett ab, obwohl oder weil Vesper mit ihm befreundet und von ähnlicher Sammelleidenschaft getrieben war.
.
„…Die Textilfabrik in Frohburg, damals aus voller Kraft arbeitend, heute abgerissen, spurlos verschwunden, wie nie dagewesen.“/ „So erstaunlich genau sich oft Lebensetappen von Studenten, Adligen, Handlungstreibern und Besitztitelinhabern nachzeichnen lassen, so spurlos verschwinden sie bei kleinen Leuten. Da heißt es nur noch, die Spinnerei hatte soundsoviel Spindeln, soundsoviel männliche und weibliche Beschäftigte, aber wo sind die Namen, die Gesichter, die Unverwechselbarkeiten.“/ „Ich wußte nicht, hatte keine Ahnung davon, dass die Stadt in Wahrheit vor allem aus den Küchen, den Wohnstuben, den Schlafkammern bestand, dort spielte sich das wahre, das gnadenarme Leben ab.“/ „Am 1.Januar 1990 war ich auf Anregung Manfred Bissingers, jetzt können Sie doch für Merian über die Braunkohlebene und Ihr Frohburg schreiben, in der Messestadt angekommen.“/ „…da ist alles aneinandergebunden, ineinandergestrickt, in eins verwoben, wo anfangen, wo aufhören, ohne die Sache zurechtzubiegen, abzukappen, zu beschädigen oder zur Schwindelei zu machen.“/ „Sie dürfen nicht vergessen, dass wir viele Jahre im allerinnersten Wismutgebiet gelebt haben. Krethi und Plethi, Lagerinsassen und Bewacher, Sklaven und Sklavenhalter, der Schütze Arsch und der Oberst, alles, alles, was man sich denken kann, da wurde viel gewußt, da gab es viel zu hören, die Saufnächte waren endlos lang, der Alkoholpegel mußte nur hoch genug sein, dann brachen die Dämme…“/ „…nicht nur in Johanngeorgenstadt und Aue, sondern auch in Chemnitz waren nicht selten betrunkene Wismutarbeiter in ganzen Horden unterwegs…“/ 2015 fuhr der Autor, „zum wievielten Male“, in das Hotel „Sachsenbaude“ oberhalb von Oberwiesenthal – dort „wollte ich schreiben und nachmittags Erkundungsfahrten über die vier oder fünf Steinwürfe entfernte Grenze machen, zu den tschechischen Uransiedlungen bei Joachimsthal, Albertham und Schlackenwerth und zu den überwucherten Schutthaufen der erst entvölkerten, dann abgerissenen böhmischen Dörfer und Weiler…“/ „einmal drang durch das Jaulen und Knattern des Störsenders hindurch Freddy Quinn, ‚Brennend heißer Wüstensand fern so fern dem Heimatland“.
.
„…Nicht auf die Schwäche, die Schande gucken, auf den innerörtlichen Dreck und Verfall, der in erstaunlichem Gegensatz zu den wie geleckt wirkenden Datschensiedlungen stand, die sich innerhalb weniger Jahre überall, in Flußtälern, auf Naherholungshängen, an Stadträndern ausgebreitet hatten.“/ „Vater hatte beim Mittagessen erzählt, dass die Ortsgruppe des Kohrener Kulturbunds den kleinen Barockpark der Familien Crusius und Münchhausen herzurichten versucht hatte, Sandsteinfiguren abschrubben, Hecken stutzen, wieder einmal, sagte Vater, aber ein Park, so ein park braucht mehr, viel mehr als einen Subbotnik alle paar Jahre, der braucht Zuwendung und Treue und auch ein bißchen Professionalität.“/ „Selbst die Schwäne auf dem Schloßteich hatte man längst abkassiert.“/ „Oben im Sperrgebiet fehlte ein Arzt für die Bergarbeiter, Vater fuhr mit der Bahn über Zwickau und Aue nach Schwarzenberg. Je weiter der Zug Richtung Erzgebirgskamm in das Urangebiet vordrang, desto enger wurde es im Waggon, vor allem ab Schlema, wo die ersten Gruben waren.“/ „Nicht selten wurden vom Vater 120 oder sogar 130 Patienten in sechs Stunden verarztet, zwei, drei Zigarettenpausen eingerechnet…Kurz nach drei startete er seine Besuchstour durch die Kleinstadt und über die Dörfer, meist kam er um neun, halb zehn zurück.“/ „ich bin Bergmann, wer ist mehr, zitierte auf Deutsch der Russe, der dem verbündeten Befehlsampfänger entgegenkommen wollte…“/ „…wir sind noch im Jahr 1946 und bei der seltsamen Erfahrung der Familie Spiel: Die Stadt [Chemnitz] war weg, aber die Verwaltung funktionierte.“/ „So verlief die erste Schleusung. Der Bergingenieur, um den es ging, in Joachimsthal aufgebrochen, vor der Uranarbeit aus der tschechischen Sperrzone geflüchtet, wollte weiter zu den Eltern seiner Frau in Fischerhude bei Bremen.“/ „Außerdem hatte ich eine Briefmarkensammlung, eine Ansichtskartensammlung, eine Heftchensammlung, eine Lesebuchkollektion, eine Natursammlung, eine Steinsammlung und eine Waffensammlung“ und nicht zu vergessen eine 30bändige Karl-May-Ausgabe. Als die Uranförderung langsam auslief, wurden die freigesetzten Arbeiter, die man nicht in den Lausitzer Braunkohletagebau umgesetzt hatte, „in Betrieben beschäftigt, die die Planungsbehörden im Gebirge ansiedelten.“ Die Treuhandanstalt liquidierte sie nach der Wende fast alle, „seitdem wanderte mehr als die Hälfte der Bewohner ab, selbst die ‚Randfichten‘ [eine volkstümliche Musikgruppe aus Johanngeorgenstadt] machten, dass sie fortkamen.“
.
Nahe Frohburg gab es den Ort Heuersdorf. Dessen ehemalige Bewohner schreiben auf ihrer Internetseite: „Die historisch einmalige Ortschaft Heuersdorf südlich von Leipzig ist wegen des Braunkohle-Tagebaus Vereinigtes Schleenhain zum Betrieb des Kraftwerks Lippendorf überbaggert worden. Die Sächsische Staatsregierung und die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag – im Besitz des Prager Energieunternehmens EPH und der Prager J&T Investment Advisors, die kürzlich auch noch die Braunkohlesparte von Vattenfall erwarben) haben die bergbauliche Inanspruchnahme von Heuersdorf durchgesetzt, in dem bis vor kurzem die aus dem 13. Jahrhundert stammende Emmauskirche, die Taborkirche im Ortsteil Großhermsdorf sowie zahlreiche Wohngebäude unter Denkmalschutz gestanden haben. Der Ort wurde bis Mitte 2009 abgesiedelt und anschließend zerstört. Horst Bruchmann, der seit 1992 in Heuersdorf als Bürgermeister gedient hat, gab gegenüber der Tageszeitung Die Welt zu Protokoll: “Ich bleibe dabei, die Umsiedlungen sind Verbrechen!” In einem Vortrag zum Thema „Zukunft statt Braunkohle“ führte er aus, dass die Entschädigungen nicht ausreichen, um an den neuen Wohnorten gleichwertiges Eigentum wieder zu schaffen. Die Heuersdorfer wurden im wesentlichen an drei Standorte umgesiedelt: nach Frohburg und in zwei Ortsteile von Regis-Breitingen.
.

.
Schwarzenberg
Ein Bergbau-Ort im Erzgebirge, über den Stefan Heym 1984 ein Buch schrieb.“Sein Roman basiert auf einem realen Hintergrund. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht 1945 wurde das Gebiet um Schwarzenberg weder von amerikanischen noch von sowjetischen Truppen besetzt. Stattdessen organisierte sich der Ort selbst – mit der Bildung eines antifaschistischen Aktionsausschusses, der die Region provisorisch leiten sollte,“ schreibt Wikipedia. „Der Roman wurde in der DDR bis zum Zusammebruch der SED weder öffentlich zur Kenntnis genommen noch erhielt er eine Druckgenehmigung. Erst im Jahre 1990 konnte er erscheinen.“
.
Auf „freie-republik-schwarzenberg.de“ heißt es: „In 21 Dörfern und Städten des Westerzgebirges nehmen Antifaschistische Aktionsausschüsse die Macht in ihre Hand. Niemand hat den Frauen und Männern den Auftrag dazu erteilt. Es gibt in der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg im Frühjahr 1945 keine Zentralgewalt mehr, statt dessen existieren 21 „unabhängige Republiken“. Jede erscheint mit einer eigenen Proklamation, zuerst wird die der alten Silberbergbaugemeinde Raschau veröffentlicht.
.
Das täglich Brot für eine halbe Million Menschen hatten die selbst ernannten Machthaber zu garantieren. Sie verhandelten mit den Russen in Annaberg und den Amerikanern in Zwickau, sie bekamen Passierscheine und Fahrgenehmigungen für Eisenbahn und Lastkraftwagen. Sie besorgten Getreide, Teigwaren, Fleisch und Kartoffeln. Sie schafften Arzneimittel heran. Und sie verfolgten Nazis, darunter den Gauleiter von Sachsen, der sich am Kriegsende bei seinem Freund Krauß in Schwarzenberg versteckt hielt, während die von ihm geleitete sächsische Staatskanzlei in Oberwiesenthal saß. Von Oberwiesenthaler Antifaschisten wird er gefangengesetzt. Rotarmisten sind sofort zur Stelle und bringen Hitlers sächsischen Statthalter in ihre Gewalt. Bevor er in Sibirien verschwand, wurde Martin Mutschmann barfuß öffentlich an den Pranger gestellt.
.
Keine eigene Republik, aber eigene Postmarken. Oberpostinspektor a. D. Hugo Böttger hat 1945 Schwarzenberger Briefmarken entworfen, die in zwei verschiedenen Arten verwendet wurden. Und eigenes Geld hat es in Schwarzenberg gegeben, vier verschiedene Banknoten kamen am 18. Mai in Umlauf und wurden sowohl in der sowjetischen als auch in der amerikanischen Besatzungszone als Zahlungsmittel akzeptiert. Erstaunlich, daß die Geldnoten im Wert von fünf, zehn, zwanzig und fünfzig Reichsmark bereits drei Wochen vor Kriegsende hergestellt wurden. Erstaunlich auch, dass Landrat Hähnichen – ein korrekter Beamter -, der noch am 8. Mai 1945 in der sächsischen Staatskanzlei um Anweisungen für die Zeit nach der Kapitulation bittet, dass gerade dieser Mann aus eigenem Antrieb Geld drucken ließ.
.
Viele Autoren haben seither versucht, Licht ins Dunkel der westerzgebirgischen Nachkriegszeit zu bringen. Stefan Heyms Roman „Schwarzenberg“ bündelt die utopischen Hoffnungen und liefert zugleich den Nachweis, warum der Traum von einer „Freien Republik“ niemals hat stattfinden können. Dennoch geht von diesem Mythos eine immer größer werdende Faszination aus, die uns auf die Suche nach Wahrheiten treibt.“
.

.
Ilmenauer Bergbau
Das „GoetheStadtMuseum“ in Ilmenau wirbt für seine Sammlung „Der Ilmenauer Bergbau“ mit den Worten: „Bereits im Mittelalter war der Bergbau im Ilmenauer Raum von Bedeutung, er zählte zeitweise zu den wichtigsten Erwerbsquellen. Im 14. Jh. existierten mehrere Eisengruben, seit 1444 wurden Kupfer- und Silbererze abgebaut. Ab dem 17. Jh. ist der Abbau von Braunstein nachweisbar.
.
Die Sammlung und Ausstellung im GoetheStadtMuseum richtet ihren Fokus vor allem auf den Bergbau in der Goethezeit. Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1756-1828) strebte die Wiederbelebung des Kupfer- und Silberbergbaues ab 1776 an, nachdem dieser seit 1739 ruhte. Der bedeutende Bergbaufachmann Vize-Bergbauhauptmann Friedrich Wilhelm Heinrich von Treba hatte zuvor in einem Gutachten den Erfolg des Unternehmens in Aussicht gestellt. Im Jahr 1776 holte der Herzog den 7 Jahre älteren Johann Wolfgang von Goethe an seinen Hof. 1777 wurde die Bergbau-Kommission gegründet, deren Leitung Goethe später übernahm. Ihr oblag die administrative, rechtliche und finanzielle Absicherung des Vorhabens. Im Februar 1784 wurde nach achtjähriger Vorbreitungszeit der neue Bergbau eröffnet. Bis zur Förderung der ersten Tonne Kupferschiefer im September 1792 verhinderten jedoch zahlreiche Wassereinbrüche die Arbeiten im Schacht. Am 22. Oktober 1796 ereignete sich ein neuer Wassereinbruch, ein Teil des Entwässerungsstollens war gebrochen. Das Grubenwasser stieg im Schacht auf. Es dauerte eineinhalb Jahre bis zur völligen Aufwältigung des Stollenbruchs. In dieser Zeit ließ der Großteil der noch verbliebenen Gewerken seine Geschäftsanteile (Kuxe) verfallen, für einen Fortbetrieb reichte das Geld der „Restgewerkschaft“ nicht aus. 1814 wurden die Schächte verfüllt, der Betrieb endgültig aufgegeben. Die Gesamtkosten des Unternehmens beliefen sich auf rund 76.000 Taler, nachdem zu Beginn lediglich 20.000 Taler veranschlagt waren.
.
Die Sammlung zum Bergbau entstand seit 1873 je nach Intention der Museumsbeauftragten und beinhaltet neben wenigen Gegenständen in erster Linie Kartenmaterial, schriftliche Zeugnisse und Druckwerke der Ilmenauer Berbautätigkeit. In der neuen Ausstellung vermitteln Funktionsmodelle die außerordentlichen technischen Lösungen des Bergbaues zu Goethes Zeit und dessen wesentlichen Anteil an diesem Geschehen.“ Er war Bergbauminister. In Ilmenau gibt es neben der Museumssammlung auch noch einen „Goethe-Wanderweg“, der am Goethe-Brunnen (aus dem „Weltgoethejahr“ 1932), am Goethe-Denkmal (aus der Nachwendezeit) und am Goethehäuschen auf dem Kickelhahn vorbeiführt. Das Bretterhäuschen bekam den Namen, weil Goethe im Sommer 1831 dort mit dem Bergrat Mahr hingewandert war, mit dem er wie stets das Elend mit dem Ilmenauer Bergbau besprach.
.
Das „Deutsche Ärzteblatt“ hat aus dem sechsstündigen Inspektionsritt des Weimarer Bergbauministers nach Ilmenau 1776, um zu sehen, wie es um „den darnieder liegenden Bergbau steht“, einen Reisebericht gemacht: „…Goethe besichtigt auftragsgemäß die Reste des Ilmenauer Bergbaus. Nebenbei kommt er Korruption und Misswirtschaft der Stadtoberen auf die Spur. Diese Inspektionsreise nach Ilmenau ist die erste große berufliche Herausforderung des jungen Johann Wolfgang Goethe (das „von“ kommt erst später). Er ist 26, seit etwa einem halben Jahr steht er in Carl Augusts Diensten. Die beiden jungen Leute wollen etwas erreichen. Man hat große Pläne musischer Art, doch das Herzogtum ist knapp bei Kasse. Goethe gelingt es innerhalb weniger Jahre, die Ilmenauer Finanzen zu sanieren. Das große Geld aber soll vom Bergbau kommen. Der wird Goethe 20 Jahre lang beschäftigen, immer wieder nach Ilmenau führen und in einer Katastrophe enden. 1776 reifen die ersten Pläne, schon im Juli 1776 ist Goethe, diesmal mit Carl August, wieder in Ilmenau. 1784 eröffnet Bergbauminister J. W. Goethe den Schacht „Neuer Johannes“, 1796 versäuft die Anlage nach einem Wassereinbruch. Eine lohnenswerte Ausbeute, man hatte auf Kupfer gehofft, gab es nie. Etwas Gutes hatten diese Lehrjahre: Goethe lernte viel über Geologie – und erwanderte den Thüringer Wald mit seinen „dampfenden Tälern“ und schroffen Felsen.“
.
Als Bergbauminister hat Goethe auch die Salzmine Groß Salze (heute Wielkiczka) bei Krakau besucht. In einer Reportage der Süddeutschen Zeitung heißt es: „Der 53jährige Stanislav Dzidek führt täglich mehrere Touristengruppen durch die alte Salzmine Wieliczka, ungefähr 15 Kilometer vor den Toren Krakaus. Um das Jahr 1275 habe man hier mit dem Abbau von Steinsalz begonnen, berichtet Dzidek. Die Salzmine von Wieliczka ist eine der ältesten Europas. Bereits seit 1718 ist das Bergwerk zu besichtigen, und schon einige berühmte Persönlichkeiten seien hier gewesen: Balzac, Chopin und Goethe zum Beispiel, seinerzeit als Bergbauminister. Heute wird hier kein Salz mehr aus dem Berg geholt. Dafür kommen am Tag manchmal bis zu 6000 Besucher, im Jahr sind es rund eine Million. Die UNESCO hat das Salzlabyrinth 1978 zum Weltkulturerbe erklärt.
.
Zu jeder Kammer würde Dzidek gerne noch mehr erzählen, aber die Zeit drängt. Der Weg biegt nach rechts ab, und plötzlich schaut der Besucher von oben in die gewaltige Kapelle der heiligen Kinga, ein echter Hingucker in 101 Metern unter der Erde. Die Kanzel, der Altar, die Heiligenbilder an der Wand – alles haben die Bildhauer aus Salz geschaffen. Auch Gottesdienste werden hier abgehalten, für rund 300 bis 500 Gäste. In der Kapelle haben schon viele Paare geheiratet.“
.

.
Romantik und Bergbau kamen vor allem im Werk Friedrich von Hardenbergs (1772 – 1801), genannt Novalis, zusammen. Die Kulturwissenschaftler der Marburger Universität folgten seinen Spuren bis in ein Bergwerk, anschließend stellten sie ein Exkursionsprotokoll ins Internet. Dort heißt es: „Im Werk von Novalis überschneiden sich naturwissenschaftliche Forschung und poetisch-philosophische Konzepte der deutschen Frühromantik. Die komplexen Bezüge von Literatur, Naturwissenschaften, Poetik und Technik, wie sie für Novalis und andere Romantiker von Bedeutung waren, hat eine Gruppe von 34 Studierenden der Neueren deutschen Literatur im vergangenen Semester im Verlauf einer Exkursion unter Leitung von Professor Jutta Osinski vor Ort und unter Tage erfahren. Die enge Verknüpfung der poetischen und naturwissenschaftlichen Diskurse in der Romantik wurde schon beim ersten Exkursionsstopp im Romantikerhaus Jena offenkundig. In der dortigen Ausstellung finden sich nicht nur Manuskripte und Erstdrucke romantischer Poesie, sondern ebenso Versuchsanordnungen zur Untersuchung des Galvanismus und das Modell eines Bergwerksschachtes. Die dreitägige Exkursion führte u. a. zur Forschungsstätte und Spezialbibliothek in Novalis‘ Geburtshaus im sachsen-anhaltinischen Oberwiederstedt, zum Salinenwerk in Bad Dürrenberg, wo Novalis wirkte, und zur TU Bergakademie Freiberg, wo er Bergbau und Geologie studiert hat. Dort bildeten der Besuch der Mineraliensammlung und des Lehr- und Besucherbergwerks „Reiche Zeche“ den Abschluss und Höhepunkt der wissenschaftlichen Reise. Die praktische Erfahrung „vor Ort“ an einer historischen Abbausituation ergänzten Vorträge über „Fragen der Geologie um 1800“ und über „Romantische Naturphilosophie“. Entwickelt wurde das Programm in enger Zusammenarbeit mit der Internationalen Novalis-Gesellschaft in Oberwiederstedt und dem Institut für Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU Bergakademie Freiberg.“
.
An der TU Freiberg, so erfuhr ich im Stahlwerk Eisenhüttenstadt, sollen inzwischen hauptsächlich Russen studieren (nicht wenige haben anschließend einen Arbeitsplatz im Stahlwerk bekommen). Auf Wikipedia erfuhr ich: „Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kamen unverzüglich sowjetische Experten ins Land. Anlaufstelle in Sachsen war zuerst Freiberg mit dem Bergarchiv und der Bergakademie. Obwohl viele Uranvorkommen in Sachsen bekannt waren, gab es keine entsprechenden wirtschaftlichen Betrachtungen zur Größe der Vorkommen. Zwei Professoren an der Bergakademie erstellten im Auftrag der Sowjetunion eine Analyse zu den Uranressourcen des Erzgebirges und kamen zu einem ernüchternden Ergebnis von gerade einmal achtzig bis neunzig Tonnen Uran für Johanngeorgenstadt als Ort mit dem höchsten zu erwartenden Potential.“ Die Sowjets erschlossen sich daneben jedoch weitere Uranvorkommen im Erzgebirge, ihre dafür Verantwortlichen richteten in Freiberg ihren Hauptsitz ein: „Während 1946 schon 15,7 t Uran gefördert wurden, stieg das Ausbringen 1947 bereits auf 145 t Uran an.“
.
Die Erzgebirgsstadt Annaberg entwickelte sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu der nach Freiberg zweitgrößten Stadt Sachsen und damit zu einer der größten Städte im deutschen Sprachraum, weil dort eine reiche Ausbeute des Silberbergbaus zu einem starken Zuzug von Bergleuten. Etwa 1522 zog es laut Wikipedia Adam Riese nach Annaberg, „der hier bis zu seinem Lebensende als Rechenmeister und Bergbeamter tätig war. Im Jahr 1945 wurden die beiden Städte Annaberg und Buchholz auf Anweisung des sowjetischen Stadtkommandanten vereinigt. Die Förderung von Uran für die Wismut ab 1947 und besonders in den 1950er Jahren führte zu einem Wiederaufleben des Bergbaus und zu einem starken Anstieg der Bevölkerung. Nachdem bereits Ende der 1940er Jahre größere Unternehmen enteignet worden waren, wurde 1972 ein Großteil der noch in Privatbesitz verbliebenen Firmen verstaatlicht. Nach der politischen Wende 1989/90 wurden viele Unternehmen in Privathand zurückgeführt,“ aber die Doppelstadt „Annaberg-Buchholz“ blieb. Dort gibt es heute ein Bergbaumuseum mit einem der insgesamt 20 Besucherbergwerke im Erzgebirge, in dem die mehr als 800-jährige Bergbaugeschichte vom Silber- über den Steinkohle- bis zum Uranbergbau dargestellt wird. Die Bergbaureviere Annaberg und Marienberg entstanden um 1600.
.
Über den Roman „Die Fundgrube Vater Abraham“ von August Peters oder auch Elfried von Taura heißt es im Forum „untertage“ der GAG: „Eine sehr bemerkenswerte Beschreibung des Marienberger Bergbaus und der Stadt Annaberg. Es wird unter anderem erzählt wie angeblich die ersten Wetterlampen zum Einsatz kamen und wie die erste Dampfmaschine in MAB errichtet wurde.
.

.
Waldenburg/Walbrzych
Arte berichtete 2015 über den schlesischen Bergbau: „In Polen besitzen zwei staatliche Bergbaukonzerne, die KHW und die Kompania Weglowa, sämtliche Bergwerke des Landes. Im Januar 2015 blockieren massive Streiks die Kohleproduktion in ganz Schlesien. Die Angestellten haben aus den Medien erfahren, dass es in der Kompania Weglowa massive Umstrukturierungen geben soll. Das erklärte Ziel des größten Kohleproduzenten in der EU mit 60.00 Angestellten: Die Hälfte seiner 15 Zechen sollen in den nächsten fünf Jahren geschlossen werden.
.
Polen gewinnt fast 90 Prozent der Elektrizität aus Kohle. Damit sicherte das Land seine energiewirtschaftliche Unabhängigkeit. Lange Zeit wagte keine Regierung, die alten Bergwerke aus der Ära des Kommunismus anzutasten – obwohl diese bereits seit 25 Jahren rote Zahlen schreiben. Doch nun bricht der Bergbau in Polen endgültig zusammen. Massive Streiks begleiten den Untergang der staatlichen Bergwerke – die jahrhundertalte Tradition des Bergbaus verschwindet. 130 Jahre Bergbau, und dann ist plötzlich alles vorbei. Am Ende der langen Liste mit Bergwerken, die stillgelegt werden, steht Kazimierz-Juliusz. Auch diese Zeche wird wegen mangelnder Rentabilität geschlossen.
.
Alles beginnt im August 2014. Die Löhne lassen auf sich warten – das Bergwerk Kazimierz-Juliusz ist mit 100 Millionen Zlotys (25 Millionen Euro) im Minus – 20 Millionen Zlotys schuldet es seinen Angestellten. Es ist Sommer, und auch unter Tage erhitzen sich die Gemüter: „Wir spürten, dass sich die finanzielle Lage der Zeche von Tag zu Tag verschlechterte“, berichtet Wlodzimierz, der dort seit 27 Jahren als Bergwerks-Elektriker arbeitet. Angesichts der drohenden Pleite weigern er und seine Kumpel sich schließlich, wieder über Tage zu gehen.
.
Eine viertägige Sitzblockade in den staubig-heißen Stollen – das muss man erst einmal wagen. Durch den Protest wird die Produktion blockiert. 832 Bergarbeiter beschließen, an diesem Tag unter Tage zu bleiben – trotz des Risikos, deswegen entlassen zu werden: „Wir hatten nichts zu verlieren, wir hätten unseren Job sowieso verloren.“ Obwohl sich die Lage unter Tage mit jedem Tag verschlechtert, reagiert die Verwaltung zunächst nicht.
.
Schließlich gibt es einen Kompromiss mit der staatlichen Aktiengesellschaft Katowicki Holding Węglowy (KHW), zu der auch Kazimierz-Juliusz gehört. Die Zeche wird geschlossen. Dafür bekommen die 815 Angestellten die Garantie, eine Stelle in einem anderen Bergwerk der Holding in der Region zu bekommen.“
.
Wenn man aber demnächst alle Zechen schließt, wo will man sie dann als Bergarbeiter beschäftigen?
.

.
Auf niederschlesischen Kohleflözen liegt der Ort Waldenburg, der heute Walbrzych heißt. Dort spielen die bisher drei Romane der zu Recht vielgelobten polnischen Philosophin Joanna Bator, die dort 1968 geboren wurde und aufwuchs. In ihrem ersten Roman „Sandberg“ (2011) geht es um eine Neubausiedlung für verheiratete Bergleute, wobei sich die Autorin auf eine Familie und ihre Nachbarn in einem Hochhaus konzentrierte. Der aus Walbrzych hinausführende Lebensweg der Tochter wurde dann Thema ihres nächsten Romans „Wolkenfern“ (2013). In Joanna Bators drittem Werk „Dunkel, fast Nacht“ (2016) kehrt die Icherzählerin nach langer Abwesenheit als Journalistin – beruflich quasi – nach Walbrzych zurück, wo sie sich in ihrem alten Haus einquartiert, das seit dem Tod des Vaters leer steht. Die Journalistin recherchiert von dort aus einige ungeklärte Vorkommnisse, u.a. im nahen Schloß Fürstenstein, dem größten in Schlesien, in dem bis 1943 die englische Fürstin von Pless, Daisy genannt, ihre berühmten Feste feierte. Sie war aber zugleich sozial engagiert – auch und vor allem zugunsten der Bergarbeiter und ihren Frauen; der Fürst besaß mehrere Gruben in der Region. Ihre Memoiren, von denen sie gleich drei veröffentlichte, betitelte die Fürstin Daisy mit „Tanz auf dem Vulkan“.
.
Joanna Bators drei Walbrzych-Romane habe ich in eins weggelesen, zuletzt noch eine „Daisy“-Biographie von John W. Koch, erschienen 1991 im Verlag „Books by John W. Koch“, um nachzusehen, ob die Autorin sich die Fürstin nicht ausgedacht hat. Die Philosophin, die lange in Japan lebte und dort ihren ersten Roman über Walbrzych schrieb, hat das, was Adorno den „bösen Blick“ nannte, den er seinen Studenten für die Zukunft anempfahl, weil sie sonst – in ihrer zukünftigen Arbeits- und Lebenswelt – verloren seien. Ohne einen solchen „bösen Blick“ wäre vielleicht auch Joanna Bator nie aus Walbrzych rausgekommen – und ihre Roman-Heldin Dominika sowieso nicht.
.
Die durch die Stillegung der Bergwerke und Hüttenbetriebe arbeitslos gewordenen Frauen haben die schlesische Hauptstadt Breslau inzwischen zur „europäischen Striptease-Metropole“ gemacht, wie die FAZ 2016 berichtete. Während die arbeitslosen Bergarbeiter, die in Walbrzych und Umgebung (ebenso wie die arbeitslos gewordenen Bergarbeiter in einigen ukrainischen Kohlerevieren) zunächst in schon lange aufgegebenen oder stillgelegten Schächten auf eigene Rechnung Kohle geschürft hatten (Biedaszyby genannt), die sie zentnerweise verkauften, eine neue Möglichkeit fanden, wieder Unter Tage zu kommen („Ich bin Bergmann – Wer ist mehr?“), indem sie ab 2015 dem Gerücht nachgingen und -gehen, dass dort gegen Ende des Zweiten Weltkriegs riesige Mengen von Gold vergraben wurden. Die „Tagesschau“ berichtete: „Sagenhafte 300 Tonnen Gold sollen die Nationalsozialisten mitsamt eines Panzerzuges in Polen vergraben haben. Seit Monaten erlebt das Land deswegen eine Schatzsuche. Wissenschaftler gießen nun Wasser in den Wein: Sie konnten bis zuletzt keine Spur des angeblichen ‚Nazi-Goldzugs‚ finden. Der Legende zufolge hatte die Wehrmacht auf ihrer Flucht vor der Roten Armee Anfang 1945 in Niederschlesien einen mit Gold beladenen Zug im Untergrund versteckt. Die polnische Eisenbahn PKP hatte zuletzt eigens ein Waldstück an einer Bahnstrecke nahe der Stadt Walbrzych (Waldenburg) gerodet, um die Untersuchungen zu ermöglichen. Die Forscher verwendeten für ihre Suche ein Messgerät, das winzige Verzerrungen im Erdmagnetfeld feststellen kann. Zusätzlich kamen Metalldetektoren und Bodenradar zum Einsatz. Die Geologen kamen aber zu dem Schluss, dass sich zu wenig Eisen im Boden befindet, um auf einen Zug schließen zu können. Das alles wird die Legende aber sicher nicht sterben lassen.“Nun, im Sommer 2016, melden sich wieder die „Hobbyschatzsucher“ zu Wort und zur Tat: Mit 40 Helfern, großen Baggern und einer kleinen Drohne suchen sie den Nazi-„Goldzug“ an der Bahnlinie im Nordosten Waldenburgs. Und im Internet berichten sie laufend mehrsprachig mit Videos über ihre „Suchfortschritte“ (FAZ).
.
Auf „welt.de“ findet sich ein Video, das von „Roman Janiszek“ handelt: „Er ist einer von 40 Männern, die bei Walbrzych in Polen metertiefe Tunnel graben, um Kohle abzubauen und zu verkaufen. Dabei riskiert er Ärger mit der Polizei — und sein Leben. „
.
Der Vater der Icherzählerin im dritten Walbrzyna-Roman von Joanna Bator, ein Ingenieur, kaufte laufend Geheimpläne, die ihn dem “Hitler-Schatz“ Unter Tage näher bringen sollten, den er in dem weitverzweigten Tunnelsystem vermutete, das zum Schloß Fürstenstein gehört, in dem die Fürstin Daisy lebte. Ihre berühmte Perlenkette soll ebenfalls irgendwo bei Waldenburg versteckt worden sein. Das unterhalb des Schlosses beginnende Tunnelsystem, zu dem ein 50 Meter tiefer Schacht hinführte, erstreckte sich über zwei Kilometer. Gegraben hatten es für die SS mehr als 3000 Zwangsarbeiter, die z.T. aus dem KZ „Groß-Rosen“ südwestlich von Breslau kamen, in dem auch etliche Waldenburger inhaftiert waren. Nach dem Krieg requirierten zunächst die Russen das Schloß, dann war es Sitz der Direktion für Kohleindustrie.
.
Von den 9000 Beschäftigten des Fürsten von Pless waren 5000 Bergarbeiter in seinen nieder- und oberschlesischen Kohlegruben gewesen. In seinem Schloß kam dann der polnische Verband für Arbeitsgenossenschaften unter. Ab 1971 war es Sitz des Kreiszentrums für Sport, Touristik und Erholung in Wałbrzych, von 1986 bis 1990 Sitz des wojewodschaftlichen Kultur- und Kunstzentrum ‚Zamek Ksiaz‘ und ist seit 1990 als eigenständige GmbH Eigentum der Stadt Wałbrzych. Der gesamte Schlosskomplex einschließlich der Terrassen, der Wirtschaftsgebäude, des Gestüts und in Teilen auch des Tunnelsystems wurde laut Wikipedia öffentlich zugänglich gemacht.
.
Während die Fürstin Daisy ein soziales Projekt nach dem anderen durchführte, hatte ihr Mann, Fürst Hans Heinrich XV. von Pless das Schloß erweitern lassen. Zuletzt hatte es 500 Zimmer und war damit das größte in Schlesien. Und das brauchte der Fürst auch: Wie fast alle schlesischen Adligen war sein Hauptinteresse die Jagd, dazu war er wie fast alle anderen auch höchlichst daran interessiert, dass der Kaiser, Wilhelm II., zu ihm als Jagdgast aufs Schloß kam. Und der kam jedesmal mit einem so großen Gefolge, dass nur die „Magnaten“ mit den größten Schlössern ihn einladen konnten. In einem der gräflichen Schlösser stand in der Halle eine Glasvitrine mit einem Handschuh darin auf einem Kissen, die Gräfin hatte ihn getragen, als der Kaiser dort Jagdgast war und einen Handkuß angedeutet hatte, ihr weißer Handschuh war dadurch zu einer Reliquie geworden. Der Kaiser kam oft in das dem Fürsten von Pless gehörende Schloß „Fürstenstein“, u.a. weil er sich gerne mit der Fürstin Daisy unterhielt, die sich als Engländerin wenig untertänig gab; bei manchen ihrer sozialökonomischen Projekte für die Armen fand sie durchaus Gehör bei ihm. Sie ließ sich 1922 von ihrem Fürsten scheiden und zog in das Gesindehaus des Schlosses, schließlich nach Waldenburg, wo sie 1943 verarmt, aber nicht unglücklich starb. Ihr 1910 geborener Sohn starb 1984 auf Mallorca.
.
Der Sanierer etlicher heruntergewirtschafteter Güter des schlesischen Adels, Alfred Henrichs, beschreibt in seiner Arbeitsbiographie „Als Landwirt in Schlesien“ (die 2003 von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG veröffentlicht wurde), wie die Kaiserjagd dort vor sich ging: „Zunächst erschienen [z.B. auf dem Schloß des Grafen Johannes von Franken-Stierstorpff, der eine amerikanische „Milliardärstochter“ geheiratet hatte] einige Herren aus der jagdlichen Suite des Kaisers, um die Verhältnisse an Ort und Stelle zu studieren: war das Gelände geeignet, wie war der Wildbestand, wie waren die Schusslisten der letzten Jahre usw.. Auf die Einladung des Kaisers zur Jagd folgten, wenn seine Jagdprüfer ihm positiven Bericht erstatteten, „als nächste Inspizienten kaiserliche Kriminalbeamte, um das Schloss und die Umgebung im Hinblick auf die Sicherheit zu prüfen. Dann rückten Beamte des Hofmarschallamtes an und begutachteten die dem Kaiser im Schloß zugedachten Räume, in unmittelbarer Nähe mußten auch die Zimmer für seine Kammerdiener liegen. Außer seinem Jagdpersonal und den Kriminalbeamten kamen in der Regel auch die Chefs oder deren Vertreter nebst Hilfspersonal der Reichskanzlei, des Zivil-, Militär- und Marinekabinetts mit, die ebenfalls Diener im Gefolge hatten, denn die Regierungsmaschinerie durfte ja nicht stille stehen.
.
Nun wurden Skizzen vom Jagdgelände angefertigt, in die die einzelnen Treiben, die Stände der Schützen und vor allem die des Kaisers eingetragen wurden. Waren auch diese von Berlin aus genehmigt, dann schickte der Jagdherr seiner Majestät die endgültige Einladung mit Angabe der anderen einzuladenden Gäste. Hierbei behielt sich der Kaiser vor, Streichungen und Änderungen vorzunehmen. Es war auch mitzuteilen, wer die Nachbarstände des kaiserlichen Gastes einnehmen sollte, denn ihre Besetzung galt als besondere Ehre. Am Schluß kam dann noch eine Kommission des kaiserlichen Marstalls, um die Pferde und Wagen zu besichtigen, deren sich der hohe Herr bedienen sollte. Genügten sie nicht, wurden Pferde und Wagen aus Berlin herbeigeschafft. So kam es dann endlich zur definitiven Zusage des Kaisers und zur Festlegung des Jagdtermins. [Woraufhin der „Goldfasanenmeister und der Karnickeldirektor“ informiert wurden, wann und wo sie die mit sehr viel Geld aufgezogenen Tiere frei zu lassen hatten.] Der Fasan spielte in Schlesien eine große Rolle.
Inzwischen setzte sich der Küchenchef des Gastgebers mit der Hofküche in Berlin in Verbindung, um zu erfahren, welche Speisen der Kaiser bevorzuge und wie sie zuzubereiten seien. Der Haus- und Hofmeister erkundigte sich in Berlin, welche speziellen Wünsche der Kaiser für seine Räume habe, die Stellung des Bettes zum Licht, Bettwäsche, Zudecke usw. Dann hatte er zu ermitteln, welche Weine, Zigarren oder Zigaretten der Kaiser bevorzuge usw..
.
Unmittelbar vor der Jagd waren die Schützenstände, eine Art ebenerdige Kanzeln, für den Kaiser herzurichten, für die es genaue Vorschriften gab. Sie bestanden zunächst aus einer Vorderwand, aus Fichtenzweigen geflochten, und ihre Höhe, breite und Dicke war genau vorgeschrieben. Seitlich schlossen sich zwei Nebenwände an, ebenfalls mit festgelegten Ausmaßen. In die Vorderwand waren zwei Astgabeln einzulassen, auf die der Kaiser die Flinte legen konnte. Auch deren Ausmaße waren genau vorgeschrieben. Sie mußten aus Buchenholz sein, das die sauberste Rinde hat. Der Fußboden der Kanzel war auf einige vorgeschriebene Dezimeter auszuheben, zuunterst mit Schlacke auszufüllen, worauf am Morgen des Jagdtages eine Schicht trockenen Sägemehls kam, damit es keine kalten Füße gab. Die Wege von einem Treiben zum zum anderen wurden mit frischen Fichtenzweigen ausgelegt, und da im dortigen Revier [Buchenhöh des Grafen Johannes] nur wenig Fichten standen, ließ man einige Tage vor dem großen Ereignis mehrere Waggons Fichtenreisig aus dem Riesengebirge kommen.
.
Wie mir der Wildmeister Urner und der Rentmeister Jendryssek dort sagten, war Wilhelm II., ein Meisterschütze, obwohl er wegen seines verkrüppelten linken Armes nur einarmig schießen konnte. Hinter ihm standen stets zwei Büchsenspanner. Er bekam selbstverständlich den besten Stand und hatte oft die größte Strecke.“ Wenn nicht, korrigierte man die Abschußliste zu seinen Gunsten. Alfred Henrichs erwähnt die Strecke einer fünfköpfigen Jagdgesellschaft des Grafen Schaffgotsch: „2500 Kreaturen“ an einem Tag. Nach seinen Schilderungen der Wirtschaftsweisen des schlesischen Adels kommt er zu dem Schluß: „Diese aristokratische Lebensweise war nur bei einem unendlich niedrigen Lebensstandard der Arbeiterschaft möglich.“
.
Der schlesische Schriftsteller August Scholtis, der als Jugendlicher zunächst in der Verwaltung des Fürsten Lichnowsky eine Anstellung als Schreiber fand, berichtet in seiner Autobiographie „Ein Herr aus Bolatitz“ (1959), dass „die illustren Gäste des Schlosses sich an späten Nachmittagen auf die Rehbockpirsch zu begeben pflegten“. Der Fürst meinte einmal zu ihm: „Wenn der Kaiser noch mal zur Jagd auf mein Schloß kommt, bin ich bankrott.“
.
Der Schriftsteller Horst Bienek erwähnt in seinem Buch „Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien“, dass der letzte Kaiser, „der gern zum Fürsten von Pless in das alte Oberschlesien reiste, um dort in den großen weiten einsamen Wäldern zu jagen, einmal mit seinem ganzen Jagdtroß umkehren mußte, weil er durch die aufgeweichten, lehmigen Chausseen nicht durchkam. Verständlich, daß Hitler gleich eine Reichsautobahn quer durch ganz Schlesien bis an die polnische Grenze plante, aber die ist nur bruchstückweise fertig geworden, dann kam der Krieg. Übrigens sagt man vom Fürsten Pless, daß er reicher als der Kaiser gewesen sei.“
.
Es gibt neben diesen absurden Jagden der Reichen auch jagende Arbeiter und Kleinbauern. Der englische Schäfer James Rebanks schreibt – bezogen auf die adlige Fuchsjagd – in seinem Buch „Mein Leben als Schäfer (2016): „Bei uns im Lake District ist die Jagd keine vornehme Angelegenheit, bei der man sich ins rote Jackett wirft wie in den alten Grafschaften. Hier laufen Arbeiter zu Fuß einer Meute ausgebuffter Berghunde hinterher, doch auf unserem zerklüffteten Terrain kommt der Fuchs oft mit dem Leben davon. Auf den nächstgelegenen Straßen verfolgen scharfäugige alte Männer die Jagd vom Auto aus mit dem Fernglas…In meiner Kindheit versammelten sich gegen Ende der Lammzeit die Männer noch einmal und streiften durch die Wälder, um Krähen zu schießen – nach den aufreibenden Arbeitswochen wieder ein gemeinsames, geselliges Unternehmen.“ Seitdem die Krähen als Singvögel ganzjährig geschützt sind und die Region außerdem zu einem Nationalpark erklärt wurde, wird heute die Krähenjagd dort wahrscheinlich nur noch heimlich und durch Einzelne stattfinden.
.
Die Aufsatzsammlung „Alphabet der polnischen Wunder“ (2007) erwähnt unter dem Eintrag „Krähen“, dass die Saatkrähen vor allem in Schlesien ständig und massenhaft von jedem, der eine Knarre besaß, abgeschossen wurden. Ähnliches berichtet Guntram Vesper in seinem Roman „Frohburg“ aus dem einstigen Wismut-Sperrgebiet im Erzgebirge. Dort waren die deutschen Wachleute, die kurz zuvor noch Wehrmachtssoldaten gewesen waren, froh, als die Russen sie mit Gewehren ausrüsteten und sie endlich wieder schießen durften statt langweilige Berichte zu verfassen: auf Rabenvögel, die sich wegen der vielen Abfälle, die überall herumlagen und in den Bächen und Kloaken angeschwemmt wurden, enorm vermehrt hatten.
.
Kürzlich waren erneut die Abschüsse von „Rabenvögeln“ – im Nahen Osten diesmal – Thema, da antwortete nämlich der ehemalige US-Drohnenpilot Brandon Bryant vor dem „Geheimdienst-Untersuchungsausschuß“ auf die Frage, ob die bei den Drohneneinsätzen völkerrechtswidrig Ermordeten „Einzelfälle“ waren oder ob das der „Regelfall“ war: „Ziemlich. Drei Kennzeichen: Männer in militärischem Alter. Dann Raben und Krähen. Das waren Frauen und Mädchen. Sonst Männer in militärischem Alter, d.h. über 12 Jahre. Das waren legitime Ziele.“
.

.
Das Schachtsystem der Kohlebergwerke in und um Waldenburg wurde einmal Ausgangspunkt für einen Arbeiter-Film, indem ein Grubenunglück, das dort stattfand, in Berlin zu einem Drehbuch verarbeitet wurde – vom Großneffen des russischen Anarcho-Fürsten Peter Kropotkin: Graf Alexander Stenbock-Fermor. Er war zunächst Freiwilliger der weißen „Baltischen Landwehr“, 1920 ging er von Riga nach Deutschland, wo er ein Ingenieurstudium begann. Als Werkstudent lernte er im Ruhrgebiet Bergarbeiter kennen, währenddessen wandelte er sich vom Antikommunisten zum Kommunisten und wurde Schriftsteller, wenig später Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. 1928 veröffentlichte er seinen Bericht „Meine Erlebnisse als Bergarbeiter“ (Auszüge daraus finden sich in dem Sammelband 1 „Wir sind die rote Garde“ 1980), ferner schrieb er „Deutschland von unten. Reise durch die proletarische Provinz“ (1930). Drei Jahre später wurde er verhaftet , laut Wikipedia, „als im Zuge einer Großrazzia die Künstlerkolonie in Berlin-Wilmersdorf durchsucht wurde. 1945 machte man ihn zum Oberbürgermeister von Neustrelitz. 1947 wurde er Cheflektor des neuen Verlags ‚Volk und Welt‘.“ Als Drehbuchautor arbeitete er für die DEFA, u.a. an deren Film „Grube Morgenrot“. Die Handlung dieses Films geht auf reale Ereignisse des Jahres 1930 im schlesischen Waldenburg zurück.
.
Weite Teile des Films wurden 1947-48 aber nicht in Waldenburg (bzw. Walbrzych), sondern in den Gruben Estav in Zwickau und Gottessegen in Oelsnitz gedreht. Zahlreiche Statisten des Films waren Bergleute. ‚Grube Morgenrot‘ war der erste Film der DEFA, dessen Handlungsmittelpunkt Arbeiter waren, er hatte 1948 Premiere:
„Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs liegt die Waldenburger Kohlegrube „Morgenrot“ brach. Von der Besatzungsmacht hat der Arbeiter Wagner die Erlaubnis erhalten, die Grube unter der Leitung der Arbeiter neu zu eröffnen. Die einstigen Kumpel der Grube versammeln sich gespannt auf dem Grubengelände. Wagner wird einstimmig zum Leiter der Grube ernannt, man wartet jedoch noch auf den Genossen Rothkegel, der vielen Kumpeln früher ein großes Vorbild war. Als wenig später ein junger Arbeiter Zweifel äußert, ob Arbeiter allein eine Grube leiten können, erzählen ihm die älteren Kumpel, wie es bereits 1931 zu einer ähnlichen Situation gekommen war.
.
Das Jahr 1931: Die Weltwirtschaftskrise beherrscht das Land und macht auch vor der Kohlenförderung nicht halt. Weil die Grube „Morgenrot“ zu wenig Kohle gibt und somit nicht mehr rentabel ist, soll sie geschlossen werden. Die Kumpel lehnen sich gegen die geplante Schließung und damit Entlassung auf. Der Direktor der Anlagen sieht nur einen Ausweg: Bei gleichen Betriebskosten müssen mehr Kohlen gefördert werden. Der Arbeiter Wagner hatte bereits früher eine Schrämmaschine entwickelt, durch die mehr Kohle in kürzerer Zeit gefördert werden kann. Sie erhöht jedoch auch das Risiko eines Kohlensäureausbruchs, der unter Tage eine potenzielle Lebensgefahr für die Kumpel darstellen würde. Die Entscheidung, die gerade wegen ihrer Gefahr für Menschenleben verbotenen Schrämmaschine einzusetzen, liegt bei Ernst Rothkegel.
.
Rothkegel ist gerade erst zum Steiger ausgebildet worden und zurück zur Grube „Morgenrot“ gekommen. Er ist zunächst gegen den Einsatz der Schrämmaschine. Als jedoch seine schwangere Schwester Hertha und ihr Freund, der Kumpel Fritz, angesichts drohenden Arbeitsverlustes einen Selbstmordversuch begehen, erkennt Rothkegel, wie wichtig es ist, die Arbeit in der Grube für alle Kumpel zu erhalten. Er stimmt dem Einsatz der Schrämmaschine zu. Die Abbauzahlen der Kohle steigen innerhalb kürzester Zeit. Als der erschöpfte Fritz eines Tages die Überwachung einer Grubenlampe übernehmen soll, über die ein möglicher Kohlensäureausbruch bemerkt werden kann, bricht er kurze Zeit später neben der Lampe zusammen. Ernst Rothkegel bemerkt dies erst, als es zu spät ist: Beim plötzlichen Kohlensäureausbruch verlieren 151 Kumpel ihr Leben, darunter Fritz. Rothkegel hingegen kann gerettet werden.
.
Das Opfer der Bergleute ist umsonst: Die Direktion beschließt die endgültige Stilllegung der Grube, die durch die Betriebspolizei durchgesetzt werden soll. Die Arbeiter jedoch widersetzen sich der Räumung des Geländes und ziehen sich unter Tage zurück, wo sie in Hungerstreik treten. Das Werksgelände selbst wird von den Frauen und Kindern der Arbeiter besetzt. Die Aktion der Arbeiter erregt Interesse im ganzen Land und zahlreiche Zeitungen berichten davon. Die Direktoren der Grube sehen durch die negative Berichterstattung eine mögliche Subvention rentabler Gruben von 20 Millionen Reichsmark in Gefahr und entschließen sich schließlich einfach, die Grube den Arbeitern zu schenken. Während sich die Kumpel als Sieger fühlen, weiß Ernst Rothkegel, dass der Betrieb der Grube für die Arbeiter nicht machbar sein wird. Er versucht, den Kumpel die Übernahme der Grube auszureden, wird jedoch von ihnen nun als Gegner angesehen. Er geht.
.
Im Jahr 1945 wissen die Kumpel nun, dass Rothkegel recht gehabt hatte, da sie damals nur 71 Tage lang die Grube halten konnten, bevor sie wegen Geldmangels schließen musste. Rothkegel, der wegen seiner sozialistischen Einstellung unter den Nazis in einem KZ gefangen gehalten wurde, kehrt zu seiner alten Grube „Morgenrot“ zurück. Er spricht zu den Kumpel – diesmal stehe er hinter der Übernahme der Grube durch die Arbeiter, weil es eine wirkliche Übernahme und kein schlechtgemeintes Geschenk sei. Zudem seien inzwischen alle Gruben in den Händen der Arbeiter. Kohle wiederum ist ein nützliches Gut – in dieser Zeit mehr denn je.“
.

.
Karpaten-Gold
Im Magazin für Reportagen „weltseher.de“ berichtet Eva Konzett: „Das kanadische Bergbau-Unternehmen Gabriel Resources ist in den 1990er Jahren ins siebenbürgische Dorf Rosia Montana im Apuseni-Gebirge, einen Ausläufer der Karpaten, gekommen. Hier, 430 Kilometer von der rumänischen Hauptstadt Bukarest entfernt, verspricht der Investor der verarmten Gemeinde seitdem eine goldene Zukunft. Wenn sie nur ihre Berge für eine Mine opfern. Für die einen kommen die Kanadier als letzte Rettung, die anderen glauben den salbungsvollen Worten nicht. Sorin Jurca gehört zu der zweiten Gruppe. Die Nachbarin nicht. In Roṣia Montana bedeutet dies über Jahre den Bann von Freundschaften. Den Verlust von Kollegen und Stille in den Familien.
.
In dem Gestein rund um Rosia Montana lagern heute noch die größten Gold- und Silbervorkommen Europas. Bereits in der Antike haben die Menschen hier Stollen in den Berg getrieben. [Die dortigen Bevölkerung wurde von den Römern u.a. für den Bergbau verklavt, noch heute spürt Rumänien eine gewisse Nähe zu Italien.] Im Mittelalter kennt halb Europa das Gold aus dem Osten. Jahrhunderte später mühen sich die Minenarbeiter in Roṣia Montana für den Ruhm der Habsburger ab. Erst in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen schuften die Menschen in Rosia Montana in den eigenen Säckel, bevor die Minen unter dem kommunistischen Regime verstaatlicht werden.
.
Doch auch der Kommunismus ringt dem Berg nicht alle seine Schätze ab. Geschätzte 3000 Tonnen Gold und 1600 Tonnen Silber schlummern noch immer in der Region. Auf sie hat es Gabriel Resources abgesehen. In einem Joint-Venture mit dem Staat, der Roṣia Montana Gold Corporation (RMGC), wollen die Kanadier den Berg mit Zyanid anbohren. Die Edelmetalle haben verschiedenen Schätzungen und je nach Goldpreis einen Wert von sieben bis 30 Milliarden Dollar. Ende der 1990er Jahre erhält das Joint-Venture eine erste Tagebaulizenz. 2002 wird der erste Bebauungsplan vorgestellt.
.
Doch die Dorfbewohner fürchten das Zyanid, welches das Gold aus dem Stein waschen soll. Sie glauben den Versprechungen von RMGC nicht vorbehaltlos, die in ihren Hochglanzprospekten von Umweltstandards sprechen. Sie wissen um die tödliche Kraft des Zyanids.
.
Mehr als hundert Meter hoch soll die Staumauer des Abklärungsbecken werden, in dem sich der zyanidhaltige Schlamm sammelt. Ein ähnliches Becken ist 2000 im 200 Kilometer entfernten Baia Mare gebrochen. Zyanid, wenn auch in höherer Konzentration als in Roşia Montana vorgesehen, vergiftete die Böden und das Grundwasser. Es war eine der größten Naturkatastrophen Südosteuropas.
.
2013 sind es noch rund 30 Familien, die sich dagegen sperren, ihre Häuser zu verkaufen. Doch 30 Familien reichen aus, um den Projektablauf hinauszuzögern. Denn nach bestehendem rumänischem Recht können sie nicht von einem privaten Unternehmen enteignet werden. Eine Hürde, die die sozialdemokratisch geführte Regierung trotz Eigeneinsatz nicht schleifen kann. Mehrfach greift sie in diesem Jahr mit ihren projektfreundlichen Gesetzesentwürfen in die parlamentarische Leere, weil einige sich nicht an den Fraktionszwang halten, als draußen Tausende Rumänen auf die Straße gehen.
.
Die Menschen demonstrieren für den Umweltschutz und gegen das Projekt und die Machenschaften, die sie dahinter vermuteten. Millionen Euro, die RMGC in landesweite Werbekampagnen steckt, versickern. Die schwarz-weiße Botschaft von Fortschritt oder Untergang im strukturschwachen Apuseni-Gebirge kommt bei den Rumänen immer weniger an. Selten hat Bukarest mehr versammelte Bürger gesehen. [Wir erinnern uns: Die Bergarbeiter waren zu sozialistischen Zeiten materiell privilegiert, in Bukarest gingen sie im Vorfeld der Wende militant gegen die „Kritiker des Ceaucescu-Regimes“ vor.]
.
Der inzwischen neu gewählte rumänische Präsident Klaus Iohannis hat das Projekt aber bereits im Sommer als „misslungene Privatisierung“ bezeichnet, die nur dem Investor zu Gute komme. Unterstützung hört sich anders an. Da hat der Investor schon mit einer Milliardenklage gedroht.“
.
Das Forum „stop-ttip.org“ meldet: „Der Kampf um Rosia Montana geht in die nächste Runde: Am 21. Juli hat der kanadische Bergbaukonzern Gabriel Resources einen Antrag auf ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Rumänien beim ICSID (dem International Centre for Settlement of Investment Disputes der Weltbank) eingereicht. Damit hat der Streit um die geplante Goldmine im rumänischen Roșia Montană einen neuen Höhepunkt erreicht.“
.
Dazu schreibt „power-shift.de“: „Vertreten wird Gabriel Resources bei seiner Klage gegen Rumänien übrigens von der Kanzlei White & Case. Die Kanzlei ist ein alter Hase bei Investor-Staat-Schiedsgerichtsklagen (ISDS) und hat allein 2014 39 ISDS-Klagefälle vertreten. Eine der höchsten Entschädigungssummen überhaupt erstritt die Kanzlei bei einer Klage eines kanadischen Goldbergbaukonzerns gegen Venezuela. Das lässt nichts Gutes hoffen für den Fall Gabriel Resources gegen Rumänien.
.
Um die Mine zu ermöglichen sollte das Parlament ein neues Gesetz verabschieden. Kurz vor der Abstimmung über dieses Gesetzes im November 2013 drohte der CEO von Gabriel Res., Jonathan Henry, Rumänien bereits mit einer Investor-Staat-Schiedsgerichtsklage (ISDS), sollte die Mine verhindert werden. Hier nannte er die mögliche Klagesumme von vier Milliarden Dollar, die als Entschädigung gefordert werden könnten. Das wären rund zwei Prozent von Rumäniens BIP, und entspricht dem jährlichen Budget des Landes für Bildung. Dieser Einschüchterungsversuch blieb angesichts des breiten Drucks der Öffentlichkeit jedoch ungehört: Das Parlament lehnte das neue Gesetz ab, die Goldmine war vorerst gestorben.
.
Unklar ist noch aufgrund welches bilateralen Investitionsschutzabkommen (BIT) geklagt werden wird. Naheliegend wäre das BIT zwischen Rumänien und Kanada. Möglich wäre aber auch das Abkommen zwischen Rumänien und den Niederlanden, da Gabriel Res. eine Zweigstelle in den Niederlanden hat. Der Konzern wird wohl genau prüfen, welches BIT für ihn vorteilhafter ist. Es gibt auch noch keine Informationen darüber, auf welche Klausel man sich bei der Klage berufen wird. Vorstellbar ist aber die „Fair and Equitable Treatment“-Klausel, also die faire und gerechte Behandlung (FET). Diese erlaubt Investoren eine sehr weitreichende Auslegung darüber, was „fair und gerecht“ ist. Konzerne berufen sich deshalb besonders häufig bei ihren Klagen auf die FET-Klausel und sind damit auch besonders erfolgreich: Bei 75% der von US-Konzernen gewonnenen Klagen wurde mit einer Verletzung der FET-Klausel argumentiert.“
.

.
El Salvador Gold
Auf „amerika21.de“ berichtete Svenja Riebow über einen Bergbaukonzern, der El Salvador verklagt: „Die Regierung von El Salvador stellte Gold-Bergbauprojekte wegen schwerer Umweltschäden ein. Konzern reicht Klage vor Schiedsgericht ein. Der kanadisch-australische Bergbaukonzern OceanaGold verklagt den Staat El Salvador vor dem Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) auf 301 Millionen US-Dollar Entschädigung. Als Grund nennt das multinationale Unternehmen die Verweigerung der Regierung zu einer weiteren Abbaugenehmigung und die ihm dadurch entgangenen Profite. Die Entscheidung des Schiedsgerichtes wird in den kommenden Wochen erwartet.
.
Der salvadorianischen Basisorganisation CRIPDES zufolge habe der Goldabbau in El Salvador bereits 90 Prozent des Trinkwassers vergiftet. Nun sollten „die Menschen dafür bezahlen, dass sie ihr Trinkwasser schützen“, so Bernardo Belloso, Leiter von CRIPDES, in einer Pressemitteilung der Christlichen Initiative Romero (CIR).
.
Die Bergbau-Gegner kritisieren vor allem die Wasser- und Umweltverschmutzung durch den Goldabbau und verweisen auf das Recht der lokalen Bevölkerung auf sauberes Trinkwasser. Auch die Menschen in den betroffenen Gemeinden lehnen die Goldförderung ab. Bei Volksbefragungen im März haben sich drei dieser Gemeinden mit deutlicher Mehrheit dagegen ausgesprochen. 2009 fror die Regierung sämtliche aktive Bergbauprojekte ein.“
.

.
Kolumbien Gold
Das Internetmagazin „finanzen100.de“ berichtet: Ein US-Konzern wollte im Regenwald Gold abbauen. Kolumbiens Regierung verbot das und wird jetzt auf 16,5 Milliarden Dollar verklagt.
.
Kolumbien liefert uns dieser Tage einen bitteren Vorgeschmack auf die dunklen Seiten von Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA. Die Südamerikaner haben ähnliche Abkommen mit den USA und Kanada geschlossen – und die könnten sie jetzt teuer zu stehen kommen.
.
Denn der US-Konzern Tobie Mining and Energy und der kanadische Konzern Cosigo Resources verklagen den kolumbianischen Staat auf 16,5 Milliarden Dollar Schadenersatz – weil sie nicht im Regenwald Gold abbauen dürfen.
.
Die Klage vor einem US-Gericht ist dabei erst einmal nicht ganz so lächerlich, wie sie auf den ersten Blick scheint. Die beiden Konzerne hatten nach eigenen Angaben 2007 eine Minenkonzession in einem Gebiet im Regenwald nahe der Grenze zu Brasilien beantragt. Sie sagen, sie hätten diese Konzession auch im Dezember 2008 bekommen. Allerdings habe es bis zur finalen schriftlichen Ausarbeitung noch bis April 2009 gedauert. Dann sei eine „unerklärliche fünfmonatige Verzögerung“ eingetreten, bis der Vertrag schließlich im Oktober 2009 unterzeichnet wurde.
.
Das Dumme: In der Zwischenzeit hatte Kolumbiens Regierung das Gebiet nahe der Grenze zu einem Nationalpark erklärt – was sämtliche Minenaktivitäten darin untersagt.
.
Die Konzerne fühlen sich nun erstens veräppelt – was man ihnen wohl kaum verübeln kann – und zweitens um Gewinne betrogen. Schließlich hatten sie sich hohe Profite von den Minen versprochen.
.
Deswegen klagten sie bereits vor mehreren kolumbianischen Gerichten auf Schadenersatz, unterlagen jedoch zuletzt auch beim Obersten Gerichtshof. Die Gerichte konnten kein Fehlverhalten der Regierung feststellen.
.
Nun gehen die Konzerne also vor ein US-Gericht. Das Freihandelsabkommen mit Kolumbien erlaubt ihnen das. Dreist ist aber die Summe, die sie verlangen: 16,5 Milliarden Dollar wollen sie haben oder doch die Konzession erhalten.
.
In der Klage wird die Summe nicht genau begründet, sie soll lediglich „den fairen Marktwert des Projektes“ abbilden – obwohl das ja nicht einmal gebaut ist.
.
Die Klage wurde bereits im Februar eingereicht. Sie wurde jetzt publik, weil kolumbianische Journalisten ein Auskunftsersuchen an die Regierung gestellt hatten, die daraufhin alle Prozesse im Rahmen von Freihandelsabkommen offenlegen musste. Die Regierung hat sich bisher noch nicht zu dem Fall geäußert.
.

.
Peru Gold
In Cajamarca, Nordperu, protestieren die Indio-Frauen gegen die dortige Kupfer- und Goldgrube „Conga“, die Regierung ist mit ihren bewaffneten Einheiten natürlich gegen sie, aber die Frauen, die eine Vergiftung ihrer Wasserquellen befürchten, lassen nicht locker und haben vor Ort auch nationale sowie internationale Unterstützung. Außerdem schickten sie eine Delegation in die Hauptstadt Lima, um dort auf die zuständigen Politiker einzuwirken und um die Öffentlichkeit auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Der US-Konzern Newmont Mining Corporation – auf der Gegnerseite – verspricht, dort 150 Millionen Dollar zu investieren. Die Bergbaufirma aus Colorado betreibt weltweit Goldbergwerke und gilt in der Branche als der zweitgrößte Konzern. Er kann anscheinend den Hals nicht vollkriegen.
.
Chilenische Salpetergruben
Salpeter war bis zur Entdeckung der Haber-Bosch-Synthese von Ammoniak die einzige Quelle für größere Mengen von Stickstoff-Verbindungen, insbesondere für Nitratdünger und zur Herstellung von Sprengstoff und Munition, wovon immer mehr benötigt wurde. Er wurde weltweit verschifft. Daher ergaben sich Wikipedia zufolge „bis ins 20. Jahrhundert Konflikte um diesen Rohstoff, z.B. der Salpeterkrieg in Südamerika 1879 bis 1884. Mehrere Bauernaufstände im Hotzenwald führten im 18. und 19. Jahrhundert zu den Salpeterunruhen. Das Salpeterversprechen, ein Vertrag zwischen Carl Bosch und der Obersten Heeresleitung von 1914, sollte die synthetische Herstellung von Salpeter im industriellen Rahmen ermöglichen.“ Als das auch anderswo gelang, sank die Salpeterförderung in Chile bis dahin, dass immer mehr Salpetergruben aufgegeben wurden.
.
In der chilenischen Atacamawüste wurde und wird z.T. noch Kupfer, Silber und vor allem Salpeter gefördert. Der chilenische Autor Hernán Rivera Letelier hat mehrere Bücher über die Bergarbeitersiedlungen geschrieben. Eins heißt „Lobgesang auf eine Hure“. Es geht darin um die Prostituierten in den nordchilenischen Salpeterstädten. Dort teilte sich die Hure ein Zimmer mit einem der Salpeterarbeiter. Er durfte dafür umsonst mit ihr vögeln. An Zahltagen, wenn sich eine Schlange vor ihrem Zimmer bildete, schlief er woanders. Ähnlich wie während der Streiks der Drucker des Westberliner „Tagesspiegels“, denen die Prostituierten in der Potsdamer Straße dann einen Preisnachlass gewährten, konnten auch die Salpeterarbeiter im Arbeitskampf bei den „Pampamädchen“ anschreiben. 43 Jahre verbrachte Letelier in der Atacama-Wüste, wo er laut Klappentext „den Niedergang der chilenischen Salpeterindustrie am eigenen Leib erlebte.“
.
In Deutschland gab es den Beruf des Salpeterers: Er kratzte in den Ställen der Bauern das Salpeter von den Wänden und unter den Böden weg – und war dazu zum Ärger der Bauern auch vom Staat beauftragt. Salpeter war wichtig für Schießpulver. Einer aus dieser Salpeterer-Familie gründete später die „Saliter-Molkerei“, sie wurde schnell durch „haltbare Milchprodukte“ bekannt und ist inzwischen die älteste in Bayern, jetzt hat sie auch noch eine Bank, die kleinste in Bayern.
.

.
Lausitzer Braunkohlerevier
Volker Brauns vorletzte Arbeit „Machwerk oder Das Schichtbuch des Flick von Lauchhammer“ (2008) ging vom Braunkohle-Tagebuch in der Lausitz aus, es geht darin um die Arbeitsbeschaffungsmaßahmen (ABM/MAE) für den Havariemeister Flick aus Lauchhammer und seinen arbeitslosen jungen Enkel Ludwig, einem Heavy-Metall-Fan. Trotz der Verarschung durch das Arbeitsamt (Ein-Euro-Jobs) kommen die beiden gut rum: von dem sich vergeblich gegen seine Abbaggerung wehrenden Dorf Horno in der Lausitz über die „glücklichen Arbeitslosen“ in der Volksbühne bis zur polnischen Erntebrigade in der Toscana: 48 „Schwänke“ insgesamt – bis der alte Havariemeister schlußendlich in die Grube fährt („mit ihm ist eine Zeit zuendegegangen“) – und ein anderer „Experte ‚ganz ruhig‘ die Arbeitsagentur Nord“ betritt und den „Tisch der Sachbearbeiterin mit einem 5-Liter-Kanister Spiritus in Brand setzt. Die erleidet daraufhin einen Schock; aber auf dieses Mittel setzt Verf. nicht,“ wie Volker Braun abschließend bemerkt.
.
Horno
Gegen die Zerstörung des sorbischen Dorfes Horno in der Lausitz durch die Braunkohlebagger von Vattenfall hatte sich schon vor der Wende Widerstand geregt. Er schwoll an, als die brandenburgischen Politik, allen voran Stolpe, den Hornoern versprachen: „Wenn ihr nicht weg wollt, dann müßt ihr auch nicht.“ Dem war jedoch nicht so, im Gegenteil: Mit Stolpes Zuarbeit wurde sogar im Landtag eine Lex-Horno verabschiedet, das den Weg für seine Abbaggerung frei machte. Dabei wurde mit Arbeitsplätzen und Energiesicherheit argumentiert. Die Widerstandsbewegung schwoll desungeachtet an. Die Denkmalspfleger stellten Horno unter Denkmalschutz. Von Indien bis Südamerika kamen Solidaritätsadressen. Aber es gab auch das Gegenteil: So demonstrierten z.B. die Bergarbeiter des Braunkohletagebaus mit ihrer Gewerkschaft IG BCE – Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie gegen die Weigerung der Hornoer, ihr Dorf der Braunkohleförderung zu opfern. Nachdem die Dörfler fast alle gerichtlichen Schritte unternommen hatten, gaben sie auf – und ließen sich – bis auf das alte Gärtnerehepaar Domain – umsiedeln: nach Neuhorno bei Forst, auch die zivilen und die Soldaten-Toten der beiden Hornoer Friedhöfe kamen dort hin. Die Kirche wurde gesprengt. Die Domains aber gaben – zusammen mit ihrem Mieter: den englischen Schriftsteller Michael Gromm – den Kampf nicht auf. Der Leipziger Anwalt von Vattenfall drohte: „Wir können auch andere Saiten aufziehen!“
.
Die Historikerin Anjana Shrivastava meinte, das ist ja der reinste „Faust“, der da inszeniert wird: Zu der Zeit wurde in Weimar gerade „Faust 2“ aufgeführt. Der zuständige Wessi-Regisseur ließ darin die letzten Opfer des Teufelspakts, Philemon und Baucis, als „zwei lamentierende Ost-Rentner“ auftreten. In der Goetheschen Originalfassung ist es ein altes Ehepaar, das einen jungen Wanderer bei sich aufgenommen hat: Unglücklicherweise steht ihr Haus samt Lindenhain einem Faustischen Großeingriff in die Landschaft im Wege, d.h. nicht direkt im Weg, aber das kleine Anwesen stört Fausts Aussicht auf seinen „gradgeführten Kanal“ und dessen künstliche Uferlandschaft. Er will sie deswegen umsetzen lassen: „Da seh ich auch die neue Wohnung,/ Die jenes alte Paar umschließt,/ Das, im Gefühl großmütiger Schonung,/ Der späten Tage froh genießt“.
.
Die beiden Alten und ihr neuer Mieter wollen jedoch nicht weichen. Faust ruft ärgerlich nach Mephisto, der sogleich eine dreiköpfige Schlägerbande mitbringt. Bereits nach kurzer Zeit kann sie stolz dem Umsetzungsauftraggeber Vollzug melden, wenn auch etwas zerknirscht: „Verzeiht! es ging nicht gütlich ab./ Wir klopften an, wir pochten an,/ Und immer ward nicht aufgetan…“
.
Um es kurz zu machen: Sie zündeten dem Rentnerehepaar einfach die Hütte an. Dieses fiel – ohnmächtig – den Flammen zum Opfer, während der junge Wanderer sich mit allem, was er hatte, zur Wehr setzte, weswegen sie ihn extra niederstechen mußten. Faust verflucht das Mordkommando und schreit: „Tausch wollt ich, wollte keinen Raub.“
.
Der Chor, die Bild-Zeitung, antwortet: „Das alte Wort, das Wort erschallt:/ Gehorche willig der Gewalt!/ Und bist du kühn, und hältst du Stich,/ So wage Haus und Hof und – Dich.“ Um Mitternacht hebt darob eine große faustische Selbstkritik an, die mit seinem Tod in den Armen der Lemuren und einem letzten utopischen Ausblick auf ein lebendiges Gemeinwesen endet: „Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,/ Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.“ Aus diesem Zweizeiler über das „Ende der Geschichte“ machte die DDR später eine in Stein gemeißelte Losung für ihr sozialistisches Wiederaufbauprogramm in der Berliner Stalinallee. Aber das führt zu weit…Dann müßte man auch noch erwähnen, was ein Betriebsrat der Kalibergarbeiter im thüringischen Bischofferode quasi am Schluß ihres Widerstands gegen die Schließung der Grube meinte: „Es sieht nicht gut aus. Das ist hier ein so genanntes Drama!“
.
So war es schließlich auch in Horno: die Domains mußten zuletzt doch klein beigeben – und sich umsiedeln lassen. Zuvor hatte eine von Vattenfall beauftragte Firma noch alle Obstbäume in ihrem Garten umgesägt – „irrtümlich“, wie der schwedische Stromkonzern erklären ließ. Die Bild-Zeitung fragte in einem Interview frech: „Was machen Sie nun mit dem vielen Geld, Her Domain?“
.
Am 2.11.2005 hatte vor dem Oberverwaltungsgericht in Berlin die letzte Runde im Kampf um die Erhaltung des sorbischen Dorfes Horno stattgefunden. Es soll dem Braunkohleabbau des schwedischen Konzerns Vattenfall weichen. Die meisten Hornoer waren bereits umgesiedelt und ihre Häuser zerstört worden. Einzig das Gärtnerehepaar Domain und ihr Mieter Gromm weigerten sich, da mitzuziehen. Sie wollten notfalls bis vors Bundesverfassungsgericht gehen, aber am 2.11. stimmte Werner Domain dann doch einem Vergleich zu. Er bekam 330.000 Euro für seinen Hof, den er bis zum 24.11. räumen mußte. Mit seiner Frau Ursula zog er in ein kleines Häuschen nach Mulknitz bei Forst.
.
Sein Mieter Michael Gromm stellte unterdes einen umfangreichen Bericht zusammen über den 13jährigen Widerstand der Hornoer. Sein Fazit darin lautet: „Es gibt keinen effektiven Rechtsschutz für die Betroffenen, weil der zu spät greift. Und die Richter räumen dem Bundesberggesetz eine größere Bedeutung ein als dem Grundgesetz. Die Enteignungsgründe im Bundesberggesetz erfüllen nicht annähernd die Erfordernisse des Artikels 14 im Grundgesetz (Recht auf Eigentum) für eine Enteignung, insbesondere dann nicht, wenn diese zu Gunsten eines privaten Bergbauunternehmens erfolgen soll. Das ganze Procedere ist einfach nur ein abgekartetes Spiel.“
.

.
Zwar verabschiedete das brandenburgische Parlament nach der Wende extra ein „Sorbengesetz“, das dieser slawischen Minderheit, die wegen der Braunkohle bereits mehr als 70 Dörfer verloren hat, einen „Siedlungsschutz“ garantierte, kurz darauf wurde jedoch auch noch ein „Hornogesetz“ verabschiedet, dass es dem Lausitzer Braunkohlekonzern ermöglichte, das Dorf trotzdem zu vernichten.
.
Der Stromkonzern Vattenfall gab 2015 bekannt, dass er seine Braunkohlegruben und -kraftwerke in der Lausitz verkaufen will. Der RBB meldete 2016: „Die zwei tschechischen Unternehmen Chech Coal und EPH haben konkrete Kaufangebote für Vattenfall eingereicht – in welcher Höhe, ist unbekannt. Der größte tschechische Interessent CEZ hatte mit Verweis auf die unklare Zukunft der Braunkohle in Deutschland kein Angebot abgegeben – steht aber nach eigenen Worten für weitere Gespräche bereit.
.
Der einzige deutsche Interessent, die STEAG aus Essen, ging mit einer anderen Vorstellung in das Verfahren. Ein Vattenfall-Kauf wird auch hier abgelehnt, dafür will die STEAG als Geschäftsbesorger für eine privatrechtliche Stiftung auftreten, die Vattenfalls Tagebaue und Kraftwerke umfassen könnte. Geldgeber wäre ein australischer Fonds. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hofft auf eine rasche Entscheidung des schwedischen Staatskonzerns…Die Gewinne, die sich mit der Lausitzer Kohle noch machen lassen, sollen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung über diese Stiftung gezielt in Projekte rund um erneuerbare Energie gesteckt werden. Zudem sollen so die Milliarden für die spätere Abwicklung der Braunkohle erwirtschaftet werden, ohne die rund 8000 Jobs in Brandenburg und Sachsen zu vernichten.
.
Unter den als Stadteil „Neu-Horno“ nach Forst umgesiedelten Hornoern sterben unterdes nicht nur die Alten weg, sondern erschreckenderweise auch die Jungen, wie mir ein Mitarbeiter des Sorben-Museums in Bautzen mitteilte, der in einem Orchester mitspielt, das gelegentlich im Neuhornoer Dorfgemeinschaftshaus gastiert. Anders dagegen die Westberliner Morgenpost 2007 in einer Reportage über Neu-Horno: „Wie relativ schnell sich nämlich auch die erste, die vertriebene Generation in neue Bedingungen einleben kann, beweist Neu-Horno am Rande von Forst – eine Umsiedlung, nur unweit weg von den jetzigen Auflassungsgebieten. Auch Horno machte damals Schlagzeilen. Atterwasch, Kerkwitz und Grabko sind ja keine einmaligen Fälle. Im Gegenteil, die „Rote Liste der verheizten Heimat“, wie der BUND seine Aufzählung nennt, weist 130 Ortschaften auf, die den Baggern von Vattenfall oder im Westen, in NRW, Rheinbraun zum Opfer fielen – Siedlungen mit „zum Teil Jahrtausende alter Siedlungskontinuität“. Horno, die neue, ebenso moderne wie freilich auch steril erscheinende Siedlung also als Anschauungsunterricht, um den Schmerz in Atterwasch und Umgebung zu relativieren?
.
Keine Chance dafür im Augenblick [bei den Bewohnern der anderen Dörfer, die dem Braunkohle-Tagebau als nächstes weichen sollen]. Die Mehrheit ist voller Zorn über das Schicksal, das mit alttestamentarischer Strenge über sie hereingebrochen zu sein scheint. Der Schock über die erst kürzlich zwischen Landespolitik und Wirtschaft getroffene Entscheidung sitzt tief. Man will zu allen erdenklichen Gegenmitteln greifen. Schon gibt es erste Baumbesetzer. Für die Grünen ein gefundenes Fressen, das Ganze. Und so sehr sich die meisten Bewohner mit ihnen wie den Baumbesetzern liieren – an deren Wirksamkeit glauben sie nicht, wie sie nicht glauben, dass Zwillen für die Vertreibung hungriger Löwen oder Tiger ausreichen. Es ist diese Hilflosigkeit, die die Menschen so böse macht. „Das nahe Naturschutzgebiet mit Braunkohle ohne Ende bleibt für ein paar olle Vögel unangetastet“, schimpft ein Rentner aus Grabko, „aber uns Menschen kann man ja verjagen wie Hunde.“ Diese Ohnmacht, dieses Ausgeliefertsein macht die künftigen Baggerflüchtlinge in der Lausitz fertig – über Zorn und Wut hinaus. Rachegelüste machen sich breit. Noch existiert kein Bauverbot; also werden Veränderungen, Verschönerungen – Wertsteigerungen vorgenommen. Natürlich weiß man, dass Vattenfall sich als großzügig erweisen wird. Man kennt das von Neu-Horno, wo für 130 angebliche Angler eigens ein Teich angelegt wurde, der ursprünglich nicht vorgesehen war, wie für Kegler eine hochmoderne Bahn. 150 Millionen Euro hat sich Vattenfall diesen Umzug angeblich kosten lassen – eine Summe, die das Unternehmen nicht kommentiert. Aber man sieht ja den Luxus. Statt verfallener alter Zäune modisch schwarze, schmiedeeiserne neue; statt herkömmlicher Dächer teure Platten mit ausgefuchster Solartechnik. Und überhaupt die hübschen Häuser. Sogar der Friedhof wurde umgesiedelt. Optisch dennoch für den Durchreisenden, der vom ersten Eindruck lebt, kein Genuss, dieses neue Horno: ein Ort wie Legoland, ohne Patina, ohne Stil, Stimmung und Flair; künstlich entstanden, nicht gewachsen: ohne Dorfkrug, Laden und Reklame.“
.
Nicht nur die Hornoer starben und sterben. In der Einladung zur Trauerfeier hieß es: „Liebe Freunde von Michael Gromm, die meisten haben schon erfahren, dass er am 31.10. 2015 friedlich im Diakonie-Hospiz Lichtenberg gestorben ist. Seine Beisetzung findet auf dem Französischen Friedhof II statt. Michael hat viele wunderbare Menschen zusammengebracht: Im Leben, im Kampf und auch jetzt, im Tod. Dafür wollen wir ihn feiern.“
.
Der an Krebs gestorbene 65jährige Engländer arbeitete zunächst bei einem Steuerprüfer in Soho. In Deutschland machte er sich dann mit einer Sprachschule bei Heidelberg selbständig. Als seine Firma pleite ging, zog er nach Berlin. Er lebte von Übersetzungen. Nicht selten übersetzte er komplizierte Gutachten von Umweltexperten. Er war nicht krankenversichert, zur Not ließ er sich im Bundeswehrkrankenhaus behandeln. Von Berlin zog er nach Guben. Dort erfuhr er vom Widerstand der Hornoer, dem er sich anschloß. Dabei erfuhr er quasi nebenbei, dass er von Sorben, ganz in der Nähe auf der anderen Neißeseite, abstammte, was ihm ein Gericht später bestätigte. Michael Gromm organisierte den Protest unter Schülern in Potsdam, knüpfte Kontakte zu den dortigen Parteien und hielt Reden auf Versammlungen. Die Hornoer wandten sich sogar an den schwedischen König. Die Lausitzer Braunkohle gehörte inzwischen dem schwedischen Konzern „Vattenfall“ und laut seines Titels war Carl XVI Gustaf u.a. auch „König aller Sorben und Wenden“. Er trennte sich daraufhin von diesem Titel. Aber die schwedischen Grünen machten im Parlament aus „Horno“ einen Tagesordnungspunkt. Hernach rückte das schwedische Fernsehen in Horno an. Sie interviewten auch Michael Gromm, der eine Demonstration mit Catering in Horno organisierte hatte. Da war das Dorf schon fast weggebaggert und der Friedhof umgesetzt. Nur das alte Gärtnerehepaar Domain leistete noch Widerstand, indem es immer weiter prozessierte – zusammen mit seinem Untermieter Gromm. Eigentlich wohnte Michael in einer schönen Wohnung in der Dunckerstrasse. Dort verdiente er sein Geld mit Übersetzungen und gab es aus für Bücher über die Hornoer. Das letzte hieß „Horno. Verkohlte Insel des Widerstands“. Marina Achenbach schrieb in ihrer Rezension für den „Freitag“: „Mit wem alles hat Gromm sich angelegt, gemeinsam mit dem manchmal zaudernden Dorf! Mit der Landesregierung, den Parteien, Gerichten, Gewerkschaften, der Rheinischen RWE, der brandenburgischen Energiewirtschaft, zuletzt Vattenfall.“ Über Gromms Entwicklung dort hin schrieb sie: Er „wird Ehrenbürger Hornos, erwirbt ein dreieckiges Wiesenstück, eine Kreuzung im Ort mit drei Ahornbäumen, entdeckt seinen sorbischen Vorfahren, den Müller Gromm im ehemals sorbischen Dorf Niemaschkleba in Polen, meldet mit Erfolg seinen Anspruch auf Heimat vor Gericht an und wird Sprecher der ‚Horno-Allianz‘, die aus Gruppen besteht, die Horno unterstützen.“ Als der Kampf verloren ist und die Hornoer ihre von Vattenfall errichteten neuen Häuser in „Neuhorno“ bei Forst beziehen, zieht er sich ganz nach Berlin zurück. Zusammen mit einem Argentinier und mir besuchte er jedoch einmal im Monat die immer noch ausharrenden Domains – bis diese schließlich auch wegzogen (nachdem man zuvor ihren Garten verwüstet hatte). Michael kochte gerne, gelegentlich lud er mich dazu ein. Ansonsten trafn wir uns regelmäßig in einem Weinlokal am Helmholtzplatz. Dann unregelmäßig und schließlich gar nicht mehr. Erst vom Wirt des Lokals erfuhr ich von seiner Erkrankung, dann von seinem Tod. Da wo Horno auf einem Berg, umgeben von Wald, war, klafft heute ein großes Loch. Die politisch durchgesetzte Einstellung der Braunkohleförderung kam für Horno zu spät.
.

.
Juli 1997: „Ich mache meinen frieden“, sang 1993 der Baggerfahrer Gerhard Gundermann aus Hoyerswerda, „mit jedem samurai mit jedem kamikaze/mit jedem grünen landei und auch mit jeder glatze/die die welt nicht bessern können aber möchten/mit viel zu kurzen messern in viel zu langen nächten“. Wie in vielen Regionen des Niedergangs richteten sich die Erwartungen – auch in der Lausitz – zunächst auf den Aufstieg der lokalen Fußballmannschaft. Der FC Energie-Cottbus gehört zu den wenigen – im Osten übriggebliebenen – Profifußball-Vereinen. Mit „Hotline“, „Fanartikel-Shop“ und dem letzten DDR-Nationaltrainer, Eduard Geyer, als prominentem Coach: „Die Leute hier, „sagt er, „mußten alle schwer arbeiten, also wollen sie auch ehrliche Arbeit auf dem Platz sehen“.
.
Der Tagebau Cottbus-Nord bei Dissenchen: In diesem Ort befindet sich der Trainingsplatz des FC Energie-Cottbus. Aus dem Tagebau soll einmal – beginnend mit seiner baldigen Flutung – das Naherholungs- und Ausflugsgebiet „Cottbuser Ostsee“ werden. Die Internationale Bauausstellung (IBA), die zuletzt an der Umgestaltung des Ruhrgebiets mitbeteiligt war, hat den See inklusive der kostenbaren Uferimmobilien bereits auf seiner Karte des neuen „Fürst-Pückler-Landes – 2000 bis 2010“ eingezeichnet. Die Hannoveraner „Expo 2000“, nahm es daraufhin in ihre Liste der „Korrespondenzregionen“ auf. Die Umwandlung der Braunkohle-Folgelandschaften in eine Lausitzer Seenplatte mit Bauerwartungsland am Ufer ist der vorläufig letzte Kapitalisierungsversuch dieser Region – als Großprojekt. Es kostet 1,2 Milliarden jährlich und geschieht vornehmlich auf Basis von ABM bzw. SAM (Struktur-Anpassungs-Maßnahmen) – mit den arbeitslos gewordenen und noch werdenden Bergarbeitern. „Der Umbruch, der dort in wenigen Jahren passierte, für den hat man im Ruhrgebiet über 40 Jahre gebraucht,“ gab der Brandenburgische Umweltminister Mathias Platzeck 1996 zu bedenken. Die Expo spricht von „Verwandlung“.zu 3: Eine Studie der TU Dresden, die u.a. das „Bleibeverhalten“ Jugendlicher untersuchte, kam 1998 zu dem Ergebnis, daß es im ländlichen Osten – und speziell in der Lausitz – ein „Auswanderungspotential“ von etwa 60% gäbe, in vergleichbaren westlichen Regionen wäre es dagegen nur ein Drittel. Wobei es die Mädchen eher als die Jungen schaffen, ihrem Heimatort auch tatsächlich den Rücken zu kehren.
.
Oktober 1979: Derzeit befindet sich die Haidemühler „Umsiedlungsaktion“ in ihrer „heißen Phase“ – es ist „die größte seit dem Ende der DDR“.Zur gleichen Zeit bietet die LAUBAG den „Braunkohlevertriebenen“ an, in den vom Bagger verschont gebliebenen Dorf-Teilen ihre leerstehenden Häuser billig wieder zurück zu erwerben. Dies ist z.B. bei den „Geisterdörfern“ Klingmühl und Pritzen der Fall. Die Abriß- und Bauwut in der Lausitz hat etwas Gespenstisches. Ganze Kirchen, Kriegsdenkmäler und sogar uralte Linden sind auf Wanderschaft. Und überall wird gekachelt, was das Zeug hält. Im halb weggebaggerten Ort Grötsch, wo ebenfalls an allen Ecken und Enden gebaut wird, gehört der schönste Hof inklusive der Dorfkneipe Friedrich Halke. In diesem Jahr wird er 92. Das erste Mal verließ er sein Dorf 1924. Das war zum Turnfest nach Köln. Halke gehörte damals dem von einem Tuchfabrikanten gesponsorten Cottbuser Turnverein „Friesen“ an, der dann in Köln 13 Preise gewann. Anschließend ging die Fahrt weiter zu Besuch bei Kunden des Tuchfabrikanten – in Wiesbaden und Koblenz: „Das war das größte Ereignis bis zu meiner Einberufung“. Halke spricht sorbisch. Deswegen mußte er bereits im Ersten Weltkrieg für die im Dorf einquartierten russischen Gefangenen dolmetschen. Einer blieb acht Jahre auf dem Hof: „Dann hat mein Vater ein Grundstück zum Bauen für ihn gekauft“. Halke wurde 1936 eingezogen, er nahm am Ostfeldzug teil, 1945 gelangte er mit dem Schiff von Ostpreußen nach Kiel, von wo aus er zu Fuß nach Hause ging. Seine Eltern waren krank und „alles war ausgeräubert“. Er faßte jedoch Mut und fing wieder neu an – kaufte eine Kuh und einen alten BMW, außerdem heiratete er. Alles lief gut – bis er zusammen mit seiner Frau auf der Rückfahrt vom Finanzamt in Forst einen schweren Autounfall hatte. Später wurde Halke Mitglied in der „LPG Wiesengrund Grötsch“. Zuletzt saß er noch im Aufsichtsrat der nach der Wende umgewandelten LPG. Von seinem Land mußte er in dieser Zeit sechs Hektar Wiesen und zwölf Hektar Wald an das Braunkohle-Kombinat verkaufen. Er bekam dafür 333 Mark Entschädigung ( 3 bis 9 Pfennig pro Quadratmeter): „Das war katastrophal“. Überdies gingen durch die Grundwasserabsenkung bald alle Kirschbäume des Dorfes ein und der Bagger fraß sich immer näher an das Kriegerdenkmal heran: „Wir waren mal ein schönes Dorf. Mein Vater war Schlachter, seine Würste verkaufte er in der Schänke. Es kamen viele Leute von außerhalb. Wir haben ein wunderbares Leben geführt. Das Wasser kam von Forst, wir hatten gute Wiesen – mit Kleegras. Das war einmal: jetzt kommt das Wasser künstlich im Rohr. Durch die Kohle ging langsam alles kaputt. Der Tagebau hat uns das Genick gebrochen. Die Frauen waren alle für den Umzug“. Halkes Sohn ist heute Chef im Kraftverkehr Cottbus und die Schwiegertochter arbeitet bei einem Westsubunternehmen der LAUBAG, ihr Chef hat sich ebenfalls gerade ein Grundstück in Grötsch gekauft, auf dem er bauen will.
.
Halkes Frau Lissy ist eine Zugezogene, sie spricht nicht sorbisch. Aber sie erinnert sich, daß einmal, kurz nachdem sie geheiratet hatten, 1945, eine Frau ankam, die sagte, sie sei eine Sorbisch-Lehrerin und auf der Suche nach überlebenden Sorben. Die Halkes gaben ihr ein Zimmer. Sie besuchte nacheinander alle alten Leute. Dann wollte sie nach Horno weiter. Die Halkes fuhren sie mit ihrem BMW hin. Der Bürgermeister dort wollte sie jedoch nicht aufnehmen: „In Horno spricht niemand mehr wendisch!“ Das Ehepaar Halke konnte ihn aber überreden: „Sei doch bloß vernünftig,“ sagten sie zu ihm, „damals sind viele Leute in den Westen abgehauen, es standen Wohnungen leer. In eine durfte sie dann einziehen. Das war die sorbische Überführung nach Horno, wo sich jetzt der Widerstand gegen die weitere Wegbaggerung sorbischer Siedlungen konzentriert“. 78 wendische Dörfer wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts vollständig weggebaggert, und 39 teilweise, dabei wurden insgesamt 25.600 Menschen umgesiedelt. Im Mai 1940 schlug der Reichsführer SS Heinrich Himmler sogar vor, die Sorben zur gänze nach Osten zu deportieren, wo sie „als führerloses Arbeitsvolk…für besondere Arbeitsvorkommen (Straßen, Steinbrüche, Bauten) zur Verfügung stehen“ sollten. Ihr 1912 in Hoyerswerda gegründeter Dachverband aller sorbischen Kulturvereine, die Domowina, war bereits 1937 verboten worden. Als die Rote Armee einmarschierte, gehörte dieser Dachverband zu den ersten wieder zugelassenen Organisationen. Auch die SED unterstützte dann die sorbische Minderheit großzügig. Die BRD zahlt jetzt der sorbischen Stiftung 15 Mio DM jährlich, zwei Sprachschulen (in Milkel und Dissenschen) wurden jedoch geschlossen, ebenso das einzige Lehrerausbildungsinstitut.
.
Ebenfalls 1997 veröffentlichte eine Projektgruppe des Instituts für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität eine von der Laubag und der Sorbischen Stiftung finanzierte Feldforschungs-Studie über die südbrandenburgische „Lebenswelt im Umbruch: Skizzen aus der Lausitz“ (im Böhlau-Verlag, Köln), u.a. geht es darin um die „sorbische Identität“.
.
1998: Auf dem Vorfeld des Tagebaus Jänschwalde bei Grötsch demonstrierten 5000 Bergarbeiter mit einer kilometerlangen Menschenkette – für die Abbaggerung Hornos! Ihr Arbeitgeber gab ihnen dazu frei und argumentierte: Wegen des egoistischen Widerstands der Hornoer seien ihrer aller Arbeitsplätze gefährdet. Von einstmals 130.000 Bergarbeitern arbeiten in der Laubag und in der Mibrag derzeit noch etwa 10.000 – weitere Massenentlassungen wurden jedoch bereits angekündigt. Ebenso bei der VEAG, woraufhin 1000 Mitarbeiter in Berlin und Potsdam für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrierten.Die Lausitzer sitzen in der Zukunftsfalle – mit ihren immer üppiger ausgebauten und eingerichteten Häusern und den verschwindenden Arbeitsplätzen in der Braunkohleindustrie sowie der Energiewirtschaft. „Gott schuf die Lausitz, der Teufel gab die Kohle dazu,“ heißt es bereits in einem alten sorbischen Lied.
.
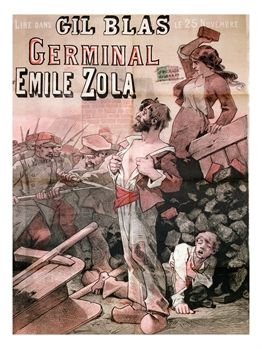
.
Es begann harmlos – Mitte des 19.Jahrhunderts, als man entdeckte, daß sich aus der Braunkohle durch Verschwelung Paraffin gewinnen läßt, mit dem sich billig Kerzen herstellen ließen. Plötzlich winkten „ungeheure Gewinne“ und überall wurden Fabriken gebaut. Reich wurde damit vor allen anderen der zum Unternehmer aufgestiegene Bergarbeiter Adolf Riebeck – mit seinen „Montanwerken“. Nachdem es gelungen war, die nasse Braunkohle kostengünstig zu trocknen und als handliche Briketts auf den Markt zu bringen, kam es ab 1890 zu einem zweiten Boom im Braunkohlerevier. Als Großabnehmer trat schon bald die energie-intensive Chemieindustrie auf den Plan. Die AEG und Agfa z.B. errichten ihre neuen Werke direkt auf der Kohle. Mit dem Großkapital kommt es bald zu immer neuen Fusionen in der Braunkohle, um im Preiskrieg überleben zu können. Im Westen entsteht daraus die „Rheinbraun“ von Paul Silverberg. Im Osten bleiben schließlich die „Riebeckschen Montanwerke“ übrig, hinter denen die böhmischen Braunkohle-Industriellen Eduard Weinmann und die Gebrüder Petschek sowie der Berliner Bankier Carl Fürstenberg stehen. Aber dann erwirbt Hugo Stinnes das bankrotte Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk in Essen – RWE. Und das bietet nun den Kilowatt-Strom statt wie alle anderen Werke für 60 Pfennig für konkurrenzlose 40 und sogar für nur 32 Pfennig an. Bald hat die RWE derart viele Großkunden, daß Stinnes neue Kraftwerke bauen läßt: direkt auf der Braunkohle. Im Osten beschert der Erste Weltkrieg den Gruben die Auslastung: Wegen der englischen Seeblokkade sind die Deutschen vom chilenischen Salpeter abgeschnitten, den sie zur Sprengstoffherstellung benötigen. Es gelingt den Chemikern jedoch, Salpeter synthetisch herzustellen.
.
Dazu werden bald riesige Kalkstickstoffwerke gebaut, sowie die dafür notwendigen Großkraftwerke. Wenig später kommen auch noch Kunstdünger -Ammoniak – Werke (von der BASF) hinzu sowie eine Aluminium-Fabrik. Auch das Heizöl für die deutsche Flotte wird aus Braunkohle hergestellt. Nach dem Krieg erwirbt Hugo Stinnes die Riebeckschen Montanwerke. Als er stirbt, wird sein Konzern jedoch von den Großbanken zerlegt. Einzig seine RWE überlebt, die Riebeck-Aktien werden von der IG Farben erworben, zu denen auch die BASF gehört. Es ist ihr Standbein zur Benzinherstellung aus Braunkohle. Das „Kunstbenzin“ ist jedoch zu teuer. In ihrer Not wendet sich die Konzernleitung an den zukünftigen Reichskanzler Adolf Hitler – und der verspricht: Deutschland braucht die Kohlehydrierung, um von Ölexporten unabhängig zu bleiben. Diese mündliche Zusage reicht den Wirtschaftsführern: es kann losgehen. „nun läuft ein Wirtschaftskrimi an, der die Machtverhältnisse auf dem Braunkohlemarkt so entscheidend verändert, daß die ‚Folgekosten‘ heute noch auf die neuen Bundesländer durchschlagen,“ schreibt der Energiehistoriker Günter Karweina.
.
Der Drahtzieher dabei ist Friedrich Flick. Er schafft es, daß das RWE in einer Verschwörung gegen seinen eigenen Chefaufseher Silverberg die Rheinbraun erwerben kann – und er dafür die Aktien der Harpener Bergbau bekommt. Silverberg wandert wenig später – als unerwünschter Jude – aus. Auch die Besitzer der besten Braunkohlegruben im Osten gelten plötzlich als Juden – dazu noch Ausländer: die Petscheks. Die expandierenden IG Farben fordern die „Übereignung“ ihrer deutschen Gruben – und sprechen persönlich bei Hermann Göring vor. Doch als die Arisierungs-Drohung endlich greift, hat Friedrich Flick bereits Görings Vetter mit einer fünfstelligen Summe bestochen – und bekommt den Petschek-Konzern, der IG Farben verkauft er anschließend einen – für sie günstig gelegenen – Tagebau. Und dann kann es losgehen mit der erneuten Kriegsproduktion – auf der Braunkohle. Nach Gründung des Friedensstaates DDR ging es dann jedoch wieder andersherum. Nachdem die Sowjetunion ihre Ölkontingent für die DDR reduzierte, Anfang der Achtzigerjahre, wurde die Braunkohle-Förderung aber auch dort wieder kräftig forciert. Schließlich deckte der heimische Tagebau 90% des Energiebedarfs des Landes. Mit Auflösung der DDR stellte Kanzler Kohl sofort und höchstpersönlich die Flickschen Zustände wieder her, indem er die gesamte ostdeutsche Stromversorgung einem Konsortium unter Führung des Branchenriesen RWE zuschanzte: Ohne diesen Stromvertrag sei die Wiedervereinigung nicht zu haben, machte der Übergabeminister Krause den anfangs widerständigen Ost-CDUlern klar. Wenig später erwarb die RWE-Tochter „Rheinbraun“ bzw. deren Ost-Neugründung „Laubag“ auch noch den größten Teil der ostdeutschen Braunkohleindustrie. Sie beanspruchte sogar Anteile an der für die Rekultivierungs- und Umwandlungsarbeiten an den stillgelegten Gruben, Brikettfabriken und Kraftwerken sowie für ihre Vermarktung zuständigen Lausitz-Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), die 2000 Mitarbeiter hat (davon 700 Lehrlinge) und derzeit noch 5.000 ehemalige Bergarbeiter – auf SAM-Basis – beschäftigt. Zudem trug sich die Laubag noch mit dem Gedanken, das angloamerikanische Konkurrenzunternehmen in Sachsen-Anhalt, die Mibrag, zu erwerben. Die Finanzzuschüsse zum Bau neuer Braunkohlekraftwerke in Brandenburg wurden unterdes von der EU als „unerlaubte Subventionierung“ moniert. Und der deutsche Berater von General Electric, Karl-Gustav Ratjen, kritisierte: „Monopole dieser Art werden hierzulande immer noch durch gesetzliche Regelungen aus den Dreißiger Jahren gestützt“.
.
Dennoch ist nun alles in Bewegung geraten: Wegen der Fusionierungen unter den Stromkonzernen drängte das Kartellamt die RWE, sich aus der Laubag zurückzuziehen. Gleichzeitig haben die VEAG-Eigner unter Führung der RWE jetzt auch noch diesen Braunkohle-Verstromer zum Verkauf ausgeschrieben: die US-Firma Southern Energy und die Berliner Bewag haben bereits Kaufinteresse signalisiert, ebenso der schwedische Konzern Vattenfall und die Hamburger HEW. Die Belegschaft fürchtet in jedem Fall Massenentlassungen, zumal wenn auch noch die Subventionierung des zu teuren Braunkohlestroms wegfällt und die zur Zwangsabnahme verpflichteten ostdeutschen Kommunen abspringen. Außerdem will man Laubag und VEAG nun wieder – wie zu DDR-Zeiten – kostensparend zusammenfassen.
.
Obwohl die RWE-Rheinbraun sich von der Laubag trennen muß, beteiligt sich der Energiekonzern an immer neuen Braunkohle-Unternehmen – vor allem in Osteuropa: in Ungarn, Polen und Tschechien. In den USA stockte er darüberhinaus gerade seine Beteiligung am Kohlekonzern Consol auf 96% auf. Die RWE-Rheinbraun-Laubag ist derzeit der größte Braunkohle-Produzent der Welt, und Deutschland liegt bei der Braunkohle-Nutzung denn auch weltweit an erster Stelle – mit 200 Mio Tonnen jährlich, gefolgt von Rußland (92 Mio) und den USA (79 Mio). Bis zu 2/3 des Stroms wird hier immer noch aus der Braunkohle gewonnen.Bei dem ostdeutschen Stromproduzenten VEAG (Vereinigte Energiewerke AG) – mehrheitlich im Besitz von RWE, Preussenelektra und Bayernwerk – summieren sich die Verluste „aus der Differenz zwischen Produktionskosten und sinkenden Marktpreisen“ jetzt schon auf einen Betrag, „in dreistelliger Millionenhöhe“. Im November 1999 senkte die VEAG ihre Strompreise bereits zum zweiten Mal um 15%. Bei weiter sinkenden Preisen kann es passieren, daß auch die LAUBAG, wem immer sie demnächst gehört, das „Bauernopfer“ Horno zugunsten der Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Region nicht mehr erzwingen will oder kann. Schon jetzt entschied das Landesverfassungsgericht, daß die geplante Teilabbaggerung der Nachbargemeinde Grießen nicht rechtens sei – weil sie deren „Zukunftsplanung“ verhindere. Damit ist der Braunkohleplan für den Tagebau Jänschwalde zumindestens in Teilen verfassungswidrig. Am Kampf – „Horno must survive“ – beteiligen sich u.a. auch Universitätsinstitute und Umweltschutz-Organisationen: den aktuellen Stand erfährt man u.a. auf den Webseiten – „www.braunkohle.org“.zu 9: Blick von Horno auf das Kraftwerk Jänschwalde – Juli 1997.
.

.
Der sorbische Schriftsteller Jurij Koch ebenso wie die Hornoer Pastorin machten neulich auf den Widersinn aufmerksam, daß es bei der Wegbaggerung von Horno gar nicht um die Braunkohle da drunter geht, „das ist nur eine dünne Schicht“, sondern um den Lehm der Endmoräne, mit dem die LAUBAG das Restloch billig verfüllen will. Sie müßte die etwa 50 Mio Kubikmeter ansonsten teuer im Ausland einkaufen. Der Brandenburgische Ministerpräsident Stolpe, der noch halb im Wende- und Demokratietaumel den Hornoern einst versichert hatte „Wenn ihr nicht weg wollt, dann müßt ihr auch nicht!“ kam einige Jahre später ebenfalls zu dem Schluß: „Horno muß fallen!“ Dazu schickte er seine Arbeitsministerin Regine Hildebrandt ins Dorf – und in die Kirche der Pastorin Wellenbrink: „Ja, seid ihr denn ein Kindergarten?!“ schalt Frau Hildebrandt die Anwesenden. „Horno oder Arbeitsplätze – so verlogen kam das von der rüber,“ erinnert sich die Pastorin, die der Regierung vorwirft, „nicht politisch verantwortlich mit dem Problem umzugehen, und sich stattdessen von der Wirtschaft unter Druck setzen zu lassen“. Weil dann auch noch das brandenburgische Verfassungsgericht gegen Horno argumentierte – schützenswert sei das sorbische Siedlungsgebiet an sich, nicht aber die einzelnen Gemeinden für sich – strengten die Hornoer Gemeinde und ihre Kirchengemeinde eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an. Diese wurde jedoch Anfang Juni abgewiesen. „Die Laubag hat uns immer nur verschaukelt,“ klagt die Pastorin, erwähnt aber auch, daß manche meinen: „Die Hornoer sind besonders schlau, die treiben durch ihren Protest nur die Grundstückspreise hoch“. Im Falle einer Niederlage würden die meisten wohl nach Forst ziehen wollen. Horno hat derzeit noch 350 Einwohner, vor zwei Jahren feierten sie das 650jährige Bestehen ihrer sorbischen Siedlung Rogow (Horno). In der Festbroschüre schreibt der nur noch ehrenamtlich tätige Bürgermeister Bernd Siegert: „Unser Rezept ist klar – Zusammenhalt und Solidarität“. Dann „wird der Kohlebagger vor dem Hornoer Berg stehenbleiben“. Noch steht er aber nicht!
.
Als der Lausitzer Baggerfahrer Gundermann noch mit seiner „Brigade Feuerstein“ durch die Reviere tourte, gaben sie u.a. eine deutsche Version des Rolling Stones Liedes „Honky Tonk Woman“ zum Besten. Darin hieß es: „jetzt fügt sie sich still in jede pflicht/ wenn ich ihr sage, was gott mit ihr noch alles geplant hat/ lacht sie böse und sie glaubt mir nicht/ das sind die nicht mehr so jungen/ kleinen blassen frauen/ die finden kein glück“.
.
Lorenz Kienzle, mit dem ich unterwegs bin, photographiert Ilona Kupstat und Elvira Richter im Versorgungszelt, das für jene Brigaden aufgestellt wurde, die im Sommer 1997 an der Komplexinstandsetzung der Abraumförderbrücke im Tagebau Jänschwalde beteiligt wurden. Angestellt sind die beiden Frauen als Billiglohn-Arbeitskräfte beim Dienstleistungsunternehmen Dussmann, das sich nach der Wende in Berlin niederließ – und dort vor allem durch sein „Kulturkaufhaus“ berühmt-berüchtigt wurde. Der Heidelberger Unternehmer Peter Dussmann tritt in der altneuen Hauptstadt auch immer wieder gerne in Talkshows auf, wo er sich der vielen von ihm neu-geschaffenen Arbeitsplätze rühmen darf. Er begann mit einer kleinen Putzkolonne. 1998 beschäftigte er bereits 37.000 Deklassierte in 17 Ländern. Der Unternehmer residiert abwechselnd in einem kleinen Schloß bei Berlin und in einer Villa bei Hollywood. Außerdem besitzt er noch ein Firmen-„Trainings-Center“ in Zeuthen. Die meisten seiner Mitarbeiter sind „pauschal“ bzw. „geringfügig“ Beschäftigte. In einem Flugblatt für bei Dussmann um Arbeit Nachsuchende heißt es: „wichtig: unser Auftritt nach außen. Er ist dezent und intelligent“. Demgegenüber meint man in der Düsseldorfer Zentrale der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen über den Dienstleistungs-Diskreditierer Dussmann: „Der ist ganz einfach schrecklich und dumm!“
.
Sommer 1998: Ein Bagger sucht nach Findlingen in den Abraumbodenschichten des Tagebaus Welzow. Übersehene Findlinge könnten eine Havarie bei den nachfolgenden Schaufelbaggern bewirken. Die geborgenen Findlinge werden überall in der Lausitz für Gedenkstätten und Straßen-Einfassungen verwendet. Auch die Künstler der „Europa-Biennale“, die 1995 auf der halbverlassenen Halbinsel Pritzen und drumherum stattfand, bedienten sich bei ihrer Land-Art gerne der Findlinge. Gegenüber der gigantischen Kulturarbeit, die von der Braunkohle-Großtechnik im Tagebau Greifenhain in all den Jahren davor geleistet wurde, wirkten jedoch ihre zumeist die Naturelemente und das Weibliche verherrlichenden Arrangements eher albern. Der internationalen Künstlerschar hatte man zur Assistenz jede Menge arbeitslose Bergarbeiter – per Zeitvertrag – beigeordnet. Auch das kam nicht gut an. Der bulgarische Landartist Ognjan Atanasov beklagte sich in der Lausitzer Rundschau über die mangelnde Motivation seiner „Helfer: Sie denken wegen der bevorstehenden Entlassungen nicht weit, sehen nicht die Zukunft. Ihnen fällt es schwer, den Sinn ihrer Arbeit hier zu begreifen“. Der Westberliner Regisseur einer Oper, die am Grubenrand bei Altdöbern – vis à vis von Pritzen – aufgeführt wurde, mußte sich von einem arbeitslosen Bergarbeiter sagen lassen: „Ihr tanzt auf unserer Leiche!“ Immerhin kam bei der Aufführung noch einmal die Großtechnik stundenweise zum Einsatz, ebenso ein Kleinbagger, der eine Sängerin bekämpfte oder umgekehrt: „zwischen männern und frauen und maschinen/entsteht alles“ – sang Gundermann 1988. Die Altdöberner Jugend durfte dabei – auf ABM-Basis – eine altsorbische Ernteprozession abgeben. Und sogar eine ganze Schafherde mußte mitspielen – umrundet von schweren LKWs. Die übereinandergestapelten Findlinge nicht zu vergessen, von denen aus die Sängerin schließlich ihre Schlußarie schmetterte.
.
Gegen die großindustrielle „Land-Art“ kommt keine Kunst an. Bereits der DDR-Landschaftsplaner Otto Rindt schwärmte: Was Pückler, „einer der ersten Erdbeweger seiner Zeit“, noch teuer bezahlen mußte (der Fürst ging mit seinen Parkprojekten mehrmals pleite), bekommen wir heute dank der riesigen Bagger als „Gratisgabe“. Dazu ist die Bodenbewegung heute noch „um ein Vielfaches“ gesteigert. Bereits in den Sechziger Jahren hob die Umwandlung der durchgesiebten Landschaft in Naherholungs- und Naturschutzgebiete an – mit dem Spremberger Spree-Stausee und dem Senftenberger See. Mit dem neuen „Fürst-Pückler–Land“ der IBA- und Expoplaner werden noch einmal 6000 Hektar Wasserflächen und 27.500 Hektar Festland „neu geschaffen“. Dazwischen schlängelt sich dann ein nach Pückler benannter „Weg“, der etliche touristische Hotspots miteinander verbindet. Dazu gehört – in Analogie zur Bauhaus-Idee für das mitteldeutsche Braunkohlerevier: „Ferropolis“ – die kurzerhand zum Expo-Symbol erklärte „größte Förderbrücke der Welt“: F 60 am Bergheider See. Außerdem die frischrenovierte Bergarbeiter-Gartenstadt „Marga“ bei Senftenberg sowie die rekonstruierte halbweggebaggerte Gartenstadt „Ilse“. Im riesigen Restloch des Tagebaus Meuro entsteht ein „Eurodrom“: eine 5 Kilometer lange Formel-1-Rennstrecke inklusive Freizeitpark – für 310 Mio DM. Dem Cottbuser Regionalplaner Alois Seewald gilt der „Lausitz-Ring“ gar als Herz des zukünftigen „Fürst-Pückler-Landes“. Sein Westberliner Implanteur, der Wirtschaftsanwalt Werner Martin, verspricht: Es werde einen „Menschenstrom“ in die Lausitz pumpen, „der geradezu alles Vorstellbare sprengt“. Ein CSU-Politiker, Alois Huber, nannte die von Stolpe besonders geförderte Rennstrecke dagegen eine „unerträgliche Verschwendung“ von Steuermitteln. Mit dem „Eurodrom“ sollen einmal 1700 neue Arbeitsplätze entstehen. Aber auch an eher intellektuellen Vergnügungen interessierte Planer können im Fürst-Pückler-Land „visionieren“. So beispielsweise der IBA-Leiter Professor Rolf Kuhn: „Es ist durchaus realistisch, davon zu träumen, mit einem Hausboot von Berlin über den Spreewald in die industrielle Seenplatte der Lausitz zu fahren, und dort entweder ruhig zu entspannen und ein Auto- oder ein Bootsrennen zu verfolgen, zeitweilig in einer modernen Wasserpyramide“…wohnend. Fürst Pückler hatte sich bereits eine Pyramide in seinem Park bei Cottbus als letzte Ruhestätte errichten lassen . Übrigens damals schon quasi auf ABM-Basis. Auch die vielen neuen „Aussichtspunkte“ der LAUBAG, die einen Blick auf ihre aktiven Tagebaue erlauben, sind pyramidal angelegt. Kurzum: die Lausitz braucht bald den Vergleich mit Ãgypten nicht mehr zu scheuen.
.
Die taz meldete Ende April 2016: „Das Klimaabkommen von Paris macht deutlich: Wer es ernst meint mit Klimaschutz, muss aus der Kohle schnellstmöglich aussteigen. Doch in Deutschlands zweitgrößtem Braunkohlerevier – in Brandenburg und Sachsen – stehen die Zeichen weiterhin auf Kohlestrom. Der neue Eigentümer der deutschen Vattenfall-Braunkohlesparte, der tschechische Energieversorgungskonzern EPH, möchte Tagebaue und Kraftwerke weiter betreiben. In der polnischen Lausitz plant der polnische Energieversorgungskonzern PGE ebenfalls den Tagebau Gubin-Brody zu erschließen und ein Kraftwerk zu bauen. Doch auf beiden Seiten der Grenze regt sich Widerstand. Bereits 2014 wurde mit der Anti-Kohle-Kette ein starkes Zeichen gesetzt. Dieses Jahr werden die Protestformen noch vielfältiger: Neben dem Lausitzer Klimacamp und einer großen Demonstration werden am Pfingstwochenende Hunderte Menschen mit „Ende Gelände“ die Tagebaue blockieren.“
.
„…und die wunderliche Welt dreht sich weiter“
In diesem Jahr bespielen die feministischen Künstlerinnen der „Endmoräne“ das 2010 aufgegebene Naturkundemuseum in Cottbus. Die Gruppe wurde 1991 nahe der Endmoräne Seelower Höhe gegründet und ist auf verlassene Immobilien abonniert. Die diesjährige Ausstellung fällt mit ihrem 25jährigen Bestehen zusammen, weswegen viele Leute aus nah und fern zur Eröffnung kamen. Dazu hatte die Gruppe ihre Arbeiten in den 30 Räumen der 1720 gegründeten Wollgarnspinnerei um einen Weißen Würfel (für ihre Videodokumentationen) im Foyer des Cottbuser Kunstmuseums nebenan erweitert, wo dann auch noch eine Jubiläums-Party stattfand.
Wie noch jedes Jahr setzten sich die 25 Künstlerinnen in ihren Arbeiten mit einem verlassenen Ort und seiner Umgebung auseinander. Letzeres war hier vor allem die vom Braunkohle-Tagebau aufgewühlte Lausitzer Landschaft um Cottbus mitsamt ihren vielen zerstörten sorbischen Dörfern. Patricia Pisanis Arbeit bestand aus einer papierenen Abrißbirne. Im Tagebau Jänschwalde fand man einige Mammutknochen, sie landeten im Berliner Naturkundemuseum. Das Kunststück von Rotraud von der Heide bestand aus einer – leider vergeblichen – Suche nach den Knochen. Renate Hampke stellte Gummistücke aus dem Tagebau Welzow aus zusammen mit Photos von einer Gummischlauch-Performance. Dorothea Neumanns Installation „King Coal“ besteht aus einem Thron, zusammengesetzt aus gold angestrichenem Holz und schwarzer Kohle, d.h. Briketts der Marke „Union“ und „Heiz Profi 15“. Während Ka Bomhardts Raum „Schwindel“, dessen Wände und Fußboden von ihr heftig schwarz bepinselt wurden, nach einem leeren Kohlelager aussieht. Angela Lubic setzte sich mit dem Plan auseinander, das riesige Tagebauloch Cottbus Nord zu fluten, es „Ostsee“ zu nennen und aus Cottbus eine Hafenstadt zu machen. Undine Giseke warb daneben für den Entwurf der „Internationalen Bauausstellung Fürst-Pückler-Land“, den Tagebau Welzow Süd („Wüste Welzow“) so zu lassen, wie er ist, und nur zu sehen, was da passiert (wächst). Susanne Ahner hat, wie auch schon an anderen Orten, in ihrer Arbeit „Wasserwege“ aufgezeichnet, wie die Spree in Cottbus ihren Weg gesucht hat am Schloßberg entlang und um die Mühleninsel herum.
Antje Scholz formte aus Ästen eine Kugel – „Moloch“ von ihr genannt. Die Äste sind mit einer dicken Schicht Gelbflechte (Xanthoria parietina) bedeckt, an den unteren hängen Algen wie dünne grüne Lappen. Je näher für den Konzern Vattenfall in Cottbus der endgültige Ausstieg aus der Braunkohle kommt, desto weniger Schwefel ist in der Luft – und desto besser gedeiht die Flechte, die inzwischen die Gehölze dick und vollständig umkleidet hat, „so dass kein Austrieb mehr möglich ist und sie verkümmern.“ Die Fadenalge (Zygnema) „bildet sich vorrangig in künstlich angelegten Gewässern. Sie vermehrt sich dort ohne Feind und reißt alles Leben an sich.“ Am beeindruckensten fand ich im größten Raum des Gebäudes die Arbeiten von Varsha Nair und Karla Sachse: „Horizon – Lost and Found“ und „geSCHICHTENsammlung“. Erstere dachte sich zarte Lausitz-Zeichnungen auf einer Linie in Brusthöhe an den Wänden aus. Letztere arbeitete als Lehrerin in der Lausitz und zeichnete Baggerführer in der Grube Klettwitz, kletterte Sonntags auf die Bagger, die den Bergheider See bereiteten, klebte Bilder mit sorbischen Kindern in Hoyerswerda, schlief in der Kirche von Horno, bevor diese zusammen mit dem Friedhof und dem ganzen Dorf weggebaggert wurde und schlich um das Haus des frühverstorbenen Sängers und Baggerführers Gundermann. Aus all dem stellte sie Mappen zusammen, die sie auf an die Decke gehängte Tischplatten auslegte.
Überhaupt hängen die Künstlerinnen der Gruppe „Endmoräne“ ihre temporären Arbeiten oft und gerne mit dünner Angelschnur an den Decken auf – statt sie auf Tische mit stabilen Beinen zu platzieren. Gunhild Kreuzer drapierte allerdings in ihrer „Amtsstube“ die Leitz-Aktenordner auf dem Fußboden, dazu erklärte sie, dass das Leitz-Papier inzwischen in China hergestellt wird. In ihrer „installativen Performance“ über „das ordentliche Leben von Karl-Heinz Scholle“ thematisierte sie dann – z.T. gesungen – „Abheften“, „Förderband“ und „Beförderung“ und das „Einstempeln und Ausstempeln der Belegschaft“.
Erwähnt sei noch der Cottbuser Dezernent Thomas Bergner, der den Künstlerinnen das Grußwort der Stadt übermitteln sollte; er dachte sich dabei: „Endmoräne? – Das ist bestimmt so eine Arbeitsgruppe von Geologen: das mach ich.“
Die Ausstellung „…und die wunderliche Welt dreht sich weiter“ ist noch bis zum 7.8. im ehemaligen Naturkundemuseum neben dem dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus, Am Amtsteich 15, zu sehen. Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Katalog über 25 Jahre „Endmoräne“ kostet 25 Euro.
.

.
Kalischacht „Thomas Müntzer“ Bischofferode
Der Widerstand der ostdeutschen Belegschaften gegen die Abwicklung ihrer Betriebe durch die Treuhandanstalt gipfelte 1993 im Hungerstreik der Kalibergarbeiter in Bischofferode. Sie wurden u.a. unterstützt von der ostdeutschen Betriebsräteinitiative, während sie von „ihrer“ Gewerkschaft – der IG Bergbau – bekämpft wurde. Ähnliches galt für die Betriebsräteinitiative. Einerseits wurde sie in Wort und Tat von IG Metall, IG Chemie usw. bekämpft, Walter Momper von der SPD gründete sogar eine Gegen-Betriebsräteinititative, andererseits wurde sie vom DGB mit Räumen und Briefmarken unterstützt. Die Betriebsräteinitiative hatte es gewagt, ohne die Funktionäre zu fragen, sich selbst zu organisieren – DDR-weit und branchenübergreifend. 1994 waren die Betriebsräte davon derart zermürbt, dass sie sich wieder zerstreuten. Dem Betriebsratsvorsitzenden des Batteriewerks Belfa in Schöneweide wurde dann – sofort nach der Privatisierung seiner Firma durch zwei Münchner BWL-Schnullis – gekündigt, mit der Begründung: „Wir brauchen Sie nicht mehr, Herr Hartmann, der Klassenkampf ist beendet! (inzwischen ist auch sein Werk dicht). Als Nachrücker von Stefan Heym gab Hartmann daraufhin ein kurzes PDS-Gastspiel im Bundestag – und wurde dann arbeitslos. Der Betriebsratsvorsitzende von Krupp Stahlbau Karl Köckenberger schaffte sich ein zweites Standbein an – indem er vier Kinderzirkusse namens „Cabuwazi gründete. Dafür bekam er gerade das Bundesverdienstkreuz am Bande. In Ostberlin wurde erst die Firma „B-Stahl abgewickelt und dann auch Krupp Stahlbau: Kurz vor Fertigstellung des letzten Großauftrags rückte um Mitternacht die Geschäftsführung mit Lkws an, um heimlich alle Teile und Maschinen nach Hannover zu schaffen. Der Belegschaft und Köckenberger gelang es zwar noch, den Abtransport mit einer Menschenkette zu verhindern. „Aber danach war trotzdem Schluss! Ähnlich kriminell ging es auch bei der Elpro AG in Marzahn zu, einst eines der DDR-Vorzeigeunternehmen. Beim Versuch, sich gegen den Plattmachwunsch von Siemens zu wehren, landeten am Ende einige Geschäftsführer vor Gericht und einer im Knast. Und die Elpro AG wurde immer kleiner, irgendwann war sie so gut wie verschwunden – ihr Betriebsrat Jürgen Lindemann wurde arbeitslos. Zudem hatte er sich wie auch Hanns-Peter Hartmann von seiner BR-Abfindung eine Eigentumswohnung in Kassel zugelegt, die unvermietbar war, so daß er bald auch noch einen Haufen Schulden hatte. Heute ist er in der Initiative Berliner Bankenskandal aktiv. Der Betriebsratsvorsitzende von Narva, Michael Müller, ein gelernter Schweißer, kuckte sich erst in Lateinamerika nach einem Job auf einer Finka um, dann nahm er jedoch eine Stelle als Hausmeister auf dem ehemaligen Narva-Gelände, das jetzt „Oberbaum-Citty heißt, an. Zwei seiner Kollegen in Oberschöneweide, vom Kabelwerk (Aslid) und vom Transformatorenwerk (Tro), versuchten der Abwicklung ihrer Werke mit kleinen Ausgründungen zuvor zu kommen: beide scheiterten. Der eine verschwand, der andere wurde verrückt. Unauffindbar ist auch der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Orwo, Hartmut Sonnenschein, der aus Wolfen wegzog, sowie der Betriebsratsvorsitzende der DDR-Reederei DSR, Eberhard Wagner: Angeblich soll er jetzt in Bremerhaven für eines der dortigen Forschungsschiffe verantwortlich sein. Die zwei weiblichen Betriebsräte des Werks für Mikroelektronik in Frankfurt/Oder fanden Jobs in einem Sozialbetrieb.
.
Ähnlich hat sich auch der Betriebsratsvorsitzende der Kaligrube von Bischofferode, Gerhard Jütemann, der bis 2002 für die PDS im Bundestag saß, umorientiert, nebenbei züchtet er noch Tauben. Der Betriebsratsvorsitzende des Werks für Fernsehelektronik in Oberschöneweide, Wolfgang Kippel, pflegte nach der Übernahme des WF durch Samsung zu sagen: „Wer es schafft, bei Samsung reinzukommen, der verlässt den Betrieb als Rentner. Aber dann machte der koreanische Konzern das Werk doch plötzlich dicht. Einer der nie so optimistisch war, aber dennoch immer noch als Betriebsrat wirkt, ist Gerhard Lux. Er arbeitet in einem AEG-Werk in Marienfelde. Auch die AEG wurde inzwischen abgewickelt, aber sein Betriebsteil übernahm ein französischer Konzern: „Wie lange das gut geht, weiß ich nicht, meinte er auf der letzten 1.Mai-Demo der Gewerkschaften. Und schlug dann ein Treffen aller bis 1994 in der ostdeutschen Betriebsräteinitiative Engagierten vor. Die o.e. sind nur ein Teil davon und selbst bei ihnen fehlen uns Adressen und teilweise sogar die Namen.
.
In Ostdeutschland waren die Bergarbeiter dagegen die letzten, die sich dem proletarischen Widerstand gegen die Okkupanten, in diesem Fall die Treuhandanstalt, anschlossen. Dafür kämpften sie dann jedoch äußerst ausdauernd. Nachdem die Treuhand ihre Privatisierungsarbeit begonnen hatte, waren die frischgewählten Betriebsräte in der Ex-DDR vor allem damit beschäftigt, die immer wieder neu von oben verfügten Entlassungsquoten „sozial verträglich“ abzufedern, d.h. neu zu selektieren. Dabei konnten sie es höchstens schaffen, daß dieser oder jener Mitarbeiter nicht – dafür aber ein anderer entlassen wurde, der dann in der Regel in einer Beschäftigungsgesellschaft landete. Der Widerstand der Betriebsräte gegen diese von der Treuhand verfügten und von ihr sogenannten „Großflugtage begann im Berliner Glühlampenwerk Narva, wo man – nachdem von 5000 Leuten 4000 entlassen worden waren, befürchtete, bald überhaupt nicht mehr produzieren zu können. Der Widerstand begann jedoch zunächst woanders.
.
Bereits im September 1989 trafen sich fünf DDR-Oppositionelle in Ostberlin und diskutierten über die Frage: »Was wird aus den Betrieben und Gewerkschaften?« Schon bald überschlugen sich die Ereignisse. Die Bürgerbewegten gewannen an Boden, die Wirtschaftsprobleme gerieten dabei immer mehr an den Rand. Eine Gruppe – um Renate Hürtgen und ihrer Tochter Stefanie -, inzwischen auf zwölf Leute angewachsen, gründete eilig eine »Initiative für unabhängige Gewerkschaften«. In Vorbereitung der Kundgebung am 4. November auf dem Alexanderplatz verfaßten sie einen Redetext, in dem sie – „basisorientlert – dazu aufriefen, unabhängige Gruppen in den Betrieben zu bilden. Damit wandten sie sich über das Maxim-Gorki-Theater an den Arbeitsausschuß zur Vorbereitung des 4. November, der jedoch seine Rednerliste schon voll hatte und überdies nicht am Thema interessiert war. Ein paar Tage später schlichen sie sich – „selbstbewußt genug, um nicht aufgehalten zu werden – in das Theater-Cafe, in dem die Redner saßen, darunter auch Heiner Müller und Stefan Heym. Einem von beiden wollten sie den Aufruf geben. Sie entschieden sich für den bereits deutlich weniger als Stefan Heym von den „Ereignissen“ enthusiasmierten Heiner Müller, der den Text dann auch gleich las und sich sofort bereit erklärte, ihn an Stelle seiner eigenen Rede am 4. November vorzutragen. Eine Passage, die sich kritisch mit der Gewerkschaft beschäftigte („Was hat der FDGB in 40 Jahren für uns entschieden?“) kürzte er. Wichtiger für Müller war der im Aufruf thematisierte grundsätzlichere „Zusammenhang zwischen Arbeitern und Intellektuellen, der nicht zuletzt aufgrund von Privilegien für die letzteren völlig zerstört worden sei, den es jedoch unbedingt (wieder)herzustellen gelte. Die Rede fiel aus dem Rahmen der allgemeinen Aufbruchsstimmung auf dem Alexanderplatz. Es gab Buhrufe und nur vereinzelt Beifall, als er sagte, die nächsten Jahre werden kein Zuckerschlecken sein, und man brauche jetzt dringend selbstgeschaffene Interessensvertretungen. In einem ND-Artikel wurde Heiner Müllers Rede anschließend als einzige abfällig beurteilt. Er bekam hernach etliche böse Briefe. In einem Artikel in der „Tribüne verteidigte er sich später: Die nicht von ihm stammende Rede sei wichtig und richtig gewesen, der FDGB brauche eine wirkliche Konkurrenz. Seine Rede hatte als einzige den Wirtschaftsbereich thematisiert. Wenn er den Aufruf der Initiative für eine unabhängige Gewerkschaft nicht vorgetragen hätte, hätte er irgendetwas aus seinem „Fratzer“ genommen.
.
Im Berliner Glühlampenwerk Narva ging es dann dergestalt weiter, daß der parteilose Einrichter in der Abteilung Allgebrauchslampe, Michael Müller, Stefan Heym einlud, vor der Belegschaft eine Rede zu halten. Auch er legte ihnen dann die Notwendigkeit einer innerbetrieblichen Interessensvertretung dar, die eine Reorganisation und damit Rettung de Betriebes mitzutragen hätte. Bei der anschließenden Wahl eines Betriebsrates wurde Michael Müller zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Und das blieb er auch- bis zum Schluß, d.h. zuletzt war er Liquidator der letzten Reste der Narva-Umqualifizierungsgesellschaft „Priamos (Jetzt ist er Hausmeister des zu computerisierten Büros umgebauten und in „Oberbaum-City umbenannten Narva-Objekts). Als erstes mußte der neugewählte zwölfköpfige Betriebsrat jedoch gegen die komplette Stillegung des Werkes angehen – zusammen mit der Betriebsleitung. In der Treuhand hatte die von Siemensmanagern dominierte Betriebsbewertungsgruppe Narva auf ihre Abwicklungsliste gesetzt. Nach Protesten stufte der Treuhandchef Detlef Rohwedder den Berliner Renommierbetrieb wieder als „sanierungsfähig ein. Nach seinem Tod wurde in der Treuhand jedoch erneut eine „reine Immobilienlösung für Narva gesucht – und gefunden: in Form dreier übelst beleumdeter Westberliner Investoren, die sich jedoch derart in Lügen und Tricks verwickelten, daß der Betriebsrat nahezu die gesamte Berliner Presse gegen sie mobilisieren konnte. Zusätzlich gab ich im Auftrag des Betriebsrates die zuvor eingestellte Narva-Betriebszeitung „Lichtquelle“ wieder heraus, um die Belegschaft über den Stand der Auseinandersetzungen zu informieren. Der Verkauf an die drei Immobilienspekulanten wurde schließlich von der Treuhand wieder rückgängig gemacht. Unterdes war aus dem Narva-Betriebsrat und einigen mit ihm solidarischen Betriebsräten aus anderen Großbetrieben eine „Berliner Betriebsräteinitiative entstanden, die sich bald mit einer ähnlichen Gruppe in Rostock zur „ostdeutschen Betriebsräteinitiative verband. Für letztere stellte ich in unregelmäßigen Abständen das Info „Ostwind zusammen, das einige Male der taz beigelegt wurde.
.
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit der Treuhand versammelte unser „Arbeitsausschuß allwöchentlich 40 Betriebsräte aus allen möglichen DDR-Großbetrieben und diskutierte Widerstandsformen gegen die flächendeckende Abwicklung der ostdeutschen Industrie. Wiewohl die meisten Westgewerkschaften diese „basisorientierte Initiative“ bekämpften, tagte sie doch stets in Räumen des DGB. Publizistisch begleitet wurde sie primär vom „Neuen Deutschland. Und den weitaus klügsten Artikel über die Hintergründe des Arbeitskampfes der Bischofferöder Kali-Bergarbeiter veröffentlichte dann Gregor Gysi – im „N.D. Um der PDS dieses Feld nicht allein zu überlassen, gründete auch Walter Momper noch schnell eine Betriebsräteinitiative, die im SPD-Haus tagte. Sie war jedoch nur eine Verdopplung der ersten Initiative – und auf Berlin beschränkt. Hier holte sich dann u.a. Rolf Hochhuth Informationen für sein Wendestück „Wessis in Weimar, während meine Darstellung der Kämpfe des Berliner Glühlampenwerks gegen Treuhandanstalt, Siemens und das Elektrokartell IEA in Pully bei Lausanne u.a. von Günter Grass in seinen Wenderoman „Ein weites Feld eingearbeitet wurde.
.
Nach 1993 rekrutierte die PDS etliche Betriebsräte und Aktivisten aus der Initiative als Bundestags-Abgeordnete: Gerhard Jütemann vom Kaliwerk Bischofferode, Hanns-Peter Hartmann vom Batteriewerk BAE/Belfa in Oberschöneweide (als Nachrücker für Stefan Heym), ferner Pastor Willibald Jacob von der Gossner-Mission und den Westberliner Vorsitzenden der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Manfred Müller. Das Logo und die Losung auf zwei Transparenten der Betriebsräteinitiative malte uns der Chefdekorateur der DDR-Staatsoper.
.
Der Kontakt zu ihm kam über Konstanze Lindemann zustande: Die Berliner Vorsitzende der IG Medien versuchte später – Anfang 1994 – auch die Reste der Initiative im Rahmen ihrer Gewerkschaft noch eine Zeitlang zusammenzuhalten. Zuvor beteiligte sie sich aktiv am Arbeitskampf der Bischofferöder, weswegen diese umgekehrt der Betriebsräteinitiative Ende 1993 14 000 DM aus ihrem Solldaritätsfonds zukommen ließen. Und später noch einmal 400 DM, um den Bürgermeister von Guernica nach Berlin zu einer IG Medien-Ausstellung über den spanischen Bürgerkrieg einladen zu können. Im Hintergrund half auch immer wieder die »Stiftung Menschenwürde und Arbeitsplatz«, die der ehemalige BMW-Betriebsrat Bernd Vollmer mit einer Erbschaft ins Leben gerufen hatte. Dazu gehört noch der FU-Politologe Bodo Zeuner. Zuerst finanzierte ihre Stiftung einen Betriebsrätekongreß, dann die Berichte der Betriebsräteinitiative unter dem Titel „Berliner Ökonomie – Prols und Contras“ und zuletzt ein Buch über DDR-Industriepfarrer, das Willibald Jacob initliert hatte.
.
Motor der ostdeutschen Betriebsräteinitiative war der maoistische Münchner Historiker Martin Clemens, der mit einer wunderbaren japanischen Gynäkologin verheiratet ist, die unsere Ausschußsitzungen stets mit kleinen handgeschnitzten Gemüse- und Obst-Stücken sowie Reisbällchen versorgte, beim Belfa-Hungerstreik leistete sie medizinischen Beistand. Mit Überschreiten des Höhepunkts der Betriebsräte-Mobilisierung gegen die Treuhand-Polltik gerieten Martin Clemens‘ Aktivitäten jedoch zunehmend zur Revolutionsmechanik, d.h. sie wurden derart unpersönlich, daß die Betriebsräte ihn sowie ein paar andere „intellektuelle Sympathisanten schließlich ausschlossen. Zusammen mit der o.e. „Initiative für unabhängige Gewerkschaften, die sich inzwischen mit einigen Grünen zu einer „Initiative kritischer GewerkschafterInnen“ umformiert hatte, gründeten diese daraufhin eine zweite Betriebsräteinitiative im Weddinger DGB-Jugendhaus, wo sie dann ihrerseits Jakob Moneta und mich, die wir von der ersten Initiative dorthingeschickt worden waren, ausschlossen. Jakob Moneta meinte, mich auf dem Flur anschließend trösten zu müssen: „Nimm es nicht so schwer, ich bin schon aus meinem Kibbuz, aus der IG Metall und aus der SPD ausgeschlossen worden!« Einige Zeit später trat der alte trotzkistische Diamantenschleifer auch aus dem PDS-Vorstand wieder aus. Die Betriebsräteinitiative führte etliche Demonstrationen (u. a. eine nach Bonn) durch, sowie drei große Konferenzen (sie wurden von Martin Clemens alle fein säuberlich, mit Pressespiegel usw., dokumentiert).
.
Auf der 2. Konferenz 1992, die im ehemaligen WF-Kulturhaus in Oberschöneweide stattfand, das zwischenzeitlich ein kurdisches Kulturzentrum geworden war, sprach Jakob Moneta über das bisher Erreichte, wobei er von einer Gewerkschaftstags-Rede des IGMetall-Vorsitzenden Steinkühler ausging, in der dieser die ostdeutsche Betriebsräteinititive kritisiert hatte: „Nachdem Steinkühler uns erst einmal eine ganze Reihe von Komplimenten gemacht hatte, meinte er, daß er es durchaus versteht, wie unsere Lage ist, daß er versteht, daß man sich wehrt und sich zusammenschließt, aber er meinte, das könne man doch alles auch unter dem Dach der Gewerkschaft tun. Unter dem Dach der IG Metall. Da liegt meiner Ansicht nach der Hauptfehler, zu glauben, daß man in einer einzelnen Gewerkschaft das leisten kann, was wir eben im Ansatz geleistet haben. Daß wir praktisch Schluß gemacht haben damit, daß jeder Betrieb und jede Branche für sich allein stirbt, und daß wir stattdessen versuchen, gemeinsam dagegen anzukämpfen. Nun möchte ich aber doch noch einmal zurückkommen auf die Frage, was ist dabei bisher herausgekommen? Darauf haben wir keine klare Antwort gegeben. Ich meine, das Entscheidende dabei war das gewachsene Selbstbewußtsein der Menschen, die selber für ihre Sache einstehen. Das ist nicht nur Theorie. Ich will aus dem Bericht, den der Spiegel gebracht hat, von unserer Bonn-Fahrt und dem Besuch bei der CDU, folgendes vortragen: Dort gab es ja den Herrn Grünewald, den Staatssekretär in Waigels Finanzministerium, der begann die Treuhand zu verteidigen. Er sagte: ‚Wo gehobelt wird, da fallen Späne‘, und behauptete schließlich, daß kein einziger Betrieb in der ehemaligen DDR plattgemacht worden sei, solange Aussicht auf Sanierung bestanden hat. Und da brach ein Tumult los. Es war eine CDU-Betriebsrätin, die ins Saalmikrophon rief. Ich bin nicht bereit, mir weiter diese Unverschämtheiten anzuhören! Daraufhin erhielt sie donnernden Applaus. Ein anderer, der sich ebenfalls als CDU-Betriebsrat vorstellte, sagte: ‚Herr Staatssekretär, ich möchte Sie herzlich bitten, uns nicht weiter zu provozieren!‘ Und ein dritter sagte: ‚Die Revolution vom Herbst 89 ist unblutig verlaufen, das kann jetzt noch anders werden‘.“
.
Das Selbstbewußtsein der bis Ende 89 zumeist „unpolitische Arbeiter bzw. Techniker und Ingenieure gewesenen Betriebsräte in der Initiative speiste sich vor allem aus ihrer gewählten Funktion – als verantwortungsbewußte Sprecher ihrer Belegschaft, aber auch als die eigentlich und einzig legitimierten Geschäftsführer ihrer Betriebe. Sprachmächtigkeit gewannen sie bei ihren vielen öffentlichen Auftritten, sowie aus dem Erfahrungsaustausch auf den wöchentlich stattfindenden Initiativ-Diskussionen, denen Schilderungen über den Stand der Dinge in den Betrieben (meist die Privatisierung und die Sozialauswahl beim Arbeitsplatzabbau betreffend) vorausgingen. Oft wurden dazu Gewerkschafter und Arbeitsrechtler eingeladen, die z. B.. über ein regionales Wirtschaftskonzept (in und um Finsterwalde etwa) oder über die „Durchgriffshaftung bei Konzernen“ referierten, aber auch konkrete Informationen beschafften: z. B. über den für Treuhand und IG Metall zugleich tätig gewordenen schwäbischen Anwalt Jörg Stein, der fast alle in Ostdeutschland an den Treuhand-Großflugtagen Entlassenen in seinen Beschäftigungsgesellschaften „zwischenparkte“: allein in Sachsen über 20 000. Später übernahm Jörg Stein auch noch den größten Teil der Bremer Vulkan-Belegschaft in eine extra dafür erworbene Parkraumbewirtschaftungs-Firma „MyPegasus. Sein Job-Beschaffungsprogramm funktionierte nach Art eines „Piloten-Spiels. Der für viele Betriebsräte neue Einstieg in wirtschaftliche Details und Probleme unter dem Gesichtspunkt ihrer Mitbeeinflussung gewann jedoch – bedingt durch die notwendige ständige Abwehr von Treuhand-Initiativen in ihren Betrieben – keine Systematik.
.

.
Das verhinderten nicht zuletzt auch die permanent auf „Kampf“-Aktionen drängenden intellektuellen Sympathisanten, für die ein Betrieb bzw. eine Belegschaft erst dann interessant wurde, wenn sie sich so gut wie im Ausstand befand. Martin Clemens entfaltete in solchen Fällen stets eine derart beeindruckend-umsichtige Aktivität, daß ihn z.B. die Belegschaft des Batterewerks Belfa mehrmals darum bat, Durchhaltereden in der Kantine zu halten, als sie einen Hungerstreik gegen Ihre endgültige Treuhand-Abwicklung organisierte. Auch wir anderen aus der Betriebsräteinitiative unterstützten Belfa: beim Transparente-Malen und -Aufhängen und bei ihrer Pressearbeit etwa, aber nur Martin Clemens‘ zündende Worte („Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren!“ etwa) verwischten den Gegensatz von „wir“ (die Unterstützer) und „ihr“ (die im Betrieb Beschäftigten, die im Falle einer Niederlage ihre Entlassung riskierten). Die Initiative machte danach einfach weiter – und unterstützte z.B. die nächste Belegschaft „in ihrem Kampf“.
.
Das war dann in Bischofferode, wo die Kali-Kumpel ebenfalls einen Hungerstreik begonnen hatten, nachdem der Kali-Kartellexperte der Bremer Universität Peter Arnold ein Flugblatt über die bevorstehende Schließung ihrer Grube und die Kartellmarkt-Gründe dafür am Werkstor verteilt hatte. Dort waren dann große Teile der Betriebsräteinitiative so engagiert, daß es schon fast einen regelrechten PKW-Shuttle von Berlin aus gab. Einige beteiligten sich sogar am Hungerstreik: Pfarrer Harald Meslin von der Gossner-Mission und Klaus Wolfram vom Basisdruck-Verlag beispielsweise. Der in der Zwischenzeit entlassene Belfa-Betriebsratsvorsitzende Hanns-Peter Hartmann hielt auf dem Bischofferöder „Aktionstag eine Rede, in der er einige Lehren aus „seinem“ Hungerstreik zog, der nach einer Spaltung seiner Belegschaft nur noch halb gewonnen werden konnte. Durch Martin Clemens‘ Engagement im Kaliwerk und sein Einwirken auf den Betriebsrat kam es zu einem Konflikt dort. Der später zurückgetretene Betriebsratsvorsitzende Heiner Brodhun hängte am 27. August 1993 eine Erklärung an das Schwarze Brett, in der er seine zuvor öffentlich geäußerte Distanzierung von „Hobbyterroristen noch einmal präzisierte: „Gemeint waren damit Leute, die unseren Arbeitskampf für ihre parteipolitischen Zweck mißbrauchen wollen: Rechtsextreme haben versucht, Bischofferode zu ihrem Tummelplatz zu machen, Marxisten-Leninisten haben ihren privaten Krieg gegen die PDS geführt, und als mir ein Vertreter der ostdeutschen Betriebsratsinitiative in einer Sitzung ‚Verrat an den Kollegen‘ vorgeworfen hatte, da ist mir der Geduldsfaden gerissen.“ In einem ZDF-Interview hatte Heiner Brodhun dazu bereits ausgeführt: „Eindeutig wurde hier versucht, innerhalb des Betriebsrates einen Keil reinzutreiben.“ ZDF: Kann es sein, daß diese Leute aus irgendeinem Kartell kommen? Brodhun: „Das bezweifle ich.“ ZDF: In welchem Niemandsland sind diese Leute denn vorzufinden? Brodhun: „Niemandsland insoweit, wie ich auch gesagt habe, die woanders eine Revolution verloren haben und hier versuchen, diese fortzuführen.“ ZDF: Wo haben sie denn eine Revolution verloren? Brodhun: „Oder ihre Revolution nicht gewonnen haben, zum Beispiel in anderen Betrieben, wo sie aufgetreten sind und nicht zum Ziel gekommen sind. Denn, bevor man solche Äußerungen macht, erkundigt man sich. Und das habe ich auch getan.“ (Anmerkung von Martin Clemens: Mit den „anderen Betrieben“ meint Heiner Brodhun wohl Belfa.)
.
Durch Vermittlung von Konstanze Lindemann und dem damaligen Betriebsratsvorsitzenden der Deutschen Seereederei, Eberhard Wagner, gelang es dann, den Bischofferöder Betriebsrat wieder mit der Berliner Initiative zu versöhnen, nachdem auch der „Sprecherrat (der Hungerstreikenden), von dem der Verratsvorwurf zuerst gekommen war, den Betriebsratsvorsitzenden dazu gedrängt hatte, seine halbe „Kapitulationserklärung gegenüber der Geschäftsleitung“ zurückzunehmen. Heiner Brodhun verfaßte dann sogar zusammen mit Martin Clemens einen gemeinsamen Text: „Nach einem offenen und freundschaftlichen Gespräch teilen wir mit, daß die Vorwürfe (Hobbyterrorist u.dgl.) vom Tisch sind. Die Sache ist vorbei. jetzt gilt es nach vorne zu schauen, damit der Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze in Bischofferode und anderswo gewonnen wird.“
.
Damit aber genau das nicht passierte, bekamen z. B. gleich im Anschluß an die Bischofferöder Arbeitskämpfe etliche West-68er, die Anstellungen in ostdeutschen Universitäten gefunden hatten, üppige „Drittmittel aus Westdeutschland für ihre „Transformationsforschung“, in der sie „ohne Hemmungen“ sogar konkrete Handlungsanleitungen für die Politik – in Form von „Aufruhrpräventions-Konzepten bei Betriebsschließungen“ – lieferten. Dies berichtete uns der Leipziger Philosoph Peer Pasternak, der widerum seine Doktorarbeit über diese „Transformationsforscher“ schrieb, auf einer Veranstaltung des Berliner ABM-Netzwerks Wissenschaft. Auch weite Teile der Westpresse, bis hin zur taz, hatten nur Verachtung für die dumpf-proletarischen Giftdünger-Produzenten im Eichsfeld übrig. Gleichzeitig pilgerten jedoch immer mehr Bergarbeiter von Rhein und Ruhr, arbeitslos oder krankgeschrieben, mit Solidaritätsspenden nach Bischofferode. Ein Teil davon wurde wie bereits erwähnt später an die Berliner Betriebsräteinitiative weitergeleitet – zur Unterstützung ihrer „Ostwind“-Redaktion. Und bis heute fühlen viele von uns sich mit den Aktivisten aus Bischofferode freundschaftlich verbunden, und verbringen z.B. ihren Urlaub im Eichsfeld, der sich dort locker mit Recherchen und Gesprächen über den Stand der Dinge verknüpfen läßt. Auch zu anderen Betrieben bzw. Betriebsräten, von denen jetzt viele Geschäftsführer sogenannter Beschäftigungsgesellschaften geworden sind, ist der Faden nie ganz gerissen: erwähnt seien Orwo, Otis, das Werk für Fernsehelektronik, das Frankfurter Halbleiterwerk, die DSR, Gerhard Lux vom AEG-Werk Marienfelde und Ulrike Ahl vom Narva-Sozialkombinat »Brücke«. In Bischofferode ist vor allem die Pastorin Christine Haas noch aktiv: Mit einigen Eichsfelder Bürgerinitiativen zusammen versuchte sie erfolgreich, die Umwidmung stillgelegter Kalischächte in gefährliche Sondermüll-Deponien zu verhindern. Brodhuns Nachfolger Gerd Jütemann wurde dann zwar PDS-Abgeordneter in Bonn geworden, er hielt sich aber weiter – über den Bischofferöder Tauben- und den Angelverein etwa – auf dem laufenden, z.B. was die einst von der Landesregierung versprochenen Ersatz-Arbeitsplätze betraf. Mit seinem Nachfolger Walter Ertmer zusammen erwarb er überdies vor einiger Zeit die Poliklinik des Kaliwerks, die zum neuen Domizil der bereits fast betriebsratslosen und mehrheitlich schon arbeitslosen Kalikumpel umgebaut wurde.
.
Martin Clemens‘ bisweilen allzu kompromißloses – kaltes – Überengagement korrespondierte merkwürdigerweise mit der allzu distanzierten Analytik eines FU-Soziologen: Martin Jander, die Ende September 1993 ebenfalls zu seinem Ausschluß aus der Betriebsräteinitiative – als teilnehmender Beobachter – führte: In der westdeutschen Gewerkschafts-Oppositionszeitung „links“ hatte er einen längeren Artikel über die bisherige Arbeit der Initiative veröffentlicht, in dem es u. a. hieß: „Erkennbar hohe Spenden für die Initiative stammen von der PDS und anderen Parteien. Außerdem wird mit abnehmender Bedeutung der Initiative die mediale Präsentation fast ausschließlich vom Neuen Deutschland gewährleistet. Sie werde dadurch immer mehr in eine Teilgruppe der „Komitees für Gerechtigkeit“ verwandelt. Dem versuche einzig der Bündnis 90/Grüne-Sprecher Eberhard Wagner gegenzusteuern, der ihren Arbeitsausschuß stärken und das Instrument Initiative wieder zu einer Initiative von Betriebsräten machen will. Wie eine eigene Zeitung dann finanziert werden soll, wer in ihr schreibt, wer das Sekretariat führt etc., das alles hat die Dritte Betriebsrätekonferenz offengelassen. Diese Fragen werden damit wohl nicht-öffentlich zwischen PDS und Bündnis 90/Grüne entschieden.“
.
In der Arbeiterbewegung kreist man anscheinend unausweichlich – wenn abstrakte Gesellschaftsanalyse politisch-konkret „zugespitzt“ werden soll oder umgekehrt – um „Verschwörung“ und „Verrat“. Meiner etwas genaueren Kenntnis und Erinnerung nach hatte die Initiative eigentlich nie Geld. Mehrere „Ostwind“-Ausgaben, die jeweils für ca. 3000 DM bei der taz gedruckt und ihr an einem Tag beigelegt wurden, finanzierten wir über einige Treuhand-Großbetriebe – indem die betreffenden Betriebsräte kurzerhand Anzeigen über „ihre“ Marketing-Abtellungen besorgten. Das für mich merkwürdigste Geld-Problem entstand einmal bei der Anmietung einer Kongreßhalle (für 4000 DM): Als es darum ging, wer aus der Initiative am nächsten Tag den Mietvertrag dafür unterschreiben sollte, breitete sich peinliches Schweigen unter den etwa zwanzig anwesenden Betriebsräten aus. Ohne dem näher auf den Grund zu gehen, erklärte ich mich rasch zu der albernen Unterschrift bereit – mit der Bemerkung: „Ihr werdet mich ja wohl nicht hängenlassen!“ Wovon ich überzeugt war – und blieb. Der FU-Soziologe Martin Jander schreibt weiter: Der aktionistische Anti-Treuhand-Protest der Initiative transportiere undemokratische und antihumanitäre Parolen: „So hing z.B. auf dem Kongreß ein riesiges Transparent an der Wand: ‚Wer von der Treuhand nicht reden will, der soll von Rostock schweigen!‘ Keiner der Anwesenden protestierte gegen diese glatte Rechtfertigung des Pogroms in Rostock. Verzweifelte ‚Avantgarden‘ ohne Massen und hilflose Betriebsräte scheuen sich offenbar nicht, mit Pogromen zu drohen. Das Transparent wurde von mir für eine Demonstration der Betriebsräteinitiative gegen die Treuhand-Polltik bereits im Dezember 1992 angefertigt, und keiner aus der Initiative sah etwas Verwerfliches in diesem abgewandelten Horkheimer-Zitat, das original in etwa »Wer vom Kapitalismus nicht reden will, der soll vom Faschismus schweigen“ lautete.
.

.
„Bischofferode ist überall“
Bevor Volker Braun Philosophie studierte, arbeitete er im Bergbau, heißt es in einer Biographie über ihn. 2014 war er in dem Aufsatzband „Kaltland“ – über die Ausländerfeindlichkeit in der DDR und danach – mit zwei kurzen Beiträgen vertreten. Der eine handelt von der Vertreibung afrikanischer Asylbewerber aus dem Bergarbeiter-Ort Hoyerswerda durch Rechtsradikale: „hasskalte Fressen…Ich gehörte noch zu ihnen.“ Auch in seinem zweiten Text spricht der Autor noch von „Wir“. Darin geht es um Asylbewerber, die in „unserem 400 Seelen Ort mit Bahnanschluß“ untergebracht wurden, aber nicht bleiben wollen.
.
Zuletzt veröffentlichte Volker Braun eine längere Erzählung mit dem an die verlorenen Bauernkriege gemahnenden Titel: „Die hellen Haufen“. Es geht darin vornehmlich um die Bischofferöder Kalikumpel, die sich 1992/1993 vergeblich mit einem Hungerstreik gegen die Schließung ihrer nach wie vor profitablen Grube „Thomas Müntzer“ wehrten. Die ebenfalls in Brauns neuem Roman vorkommende Pastorin Haas, die sich an den Aktionen der Bergleute beteiligte, meinte 1995 mir gegenüber: „Während der Auseinandersetzungen, so anstrengend sie waren, ging es fast allen gut. Danach fiel alles auseinander. Viele wurden krank, vier starben sogar.“ Traurig sei auch, „daß jetzt nach der Niederlage so viel rückwärtsgewandtes Zeug im Eichsfeld passiert: Schützenvereinsgründungen, Traditionsumzüge und sogar Fahnenweihen…“
.
Die jungblonden Rezensenten der westdeutschen Intelligenzpresse haben Volker Braun übel genommen, dass er die Bischofferöder in seiner Erzählung nicht aufgeben läßt. Ihren Protesten schließen sich sogar noch andere von Privatisierung und Arbeitslosigkeit bedrohte Belegschaften an – u.a. die Leuna- und Orwo-Arbeiter. Das Ganze nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an.
.
Das hatte es auch schon in Ansätzen, als die Bischofferöder 1993 tatsächlich massenhaft Unterstützung fanden, u.a. von westdeutschen Bergarbeitern und der Ostberliner Betriebsräteinitiative. Ihre „Bischofferode ist überall!“-T-Shirts gingen weg wie warme Semmeln.
.
Der Dichter Braun gibt zu, „die Geschichte, ginge sie ordentlich fort, erzählte Beschäftigungsmaßnahmen. Fortbildungen; Unnütze, damit ihr/unnütz bleibt, werden wir euch/umschulen.“ Das aber will er diesmal nicht. Nun geht es ihm um das „Nichtgeschehene“ (1994f) – um es „auszumalen braucht es Geduld und Genauigkeit.“ Daraus resultiert, dass alle Personen und Orte (nur unwesentlich verquatscht) vollkommen real sind und es auch bleiben. Seine nichtgeschehene Geschichte läuft darauf hinaus, dass sie, die die ganze Zeit „Keine Gewalt!“ riefen, „begriffen, daß ihnen Gewalt geschah“: Es wurde dann sogar auf sie geschossen, die Einsatzkräfte setzten Hubschrauber ein, deren Rotoren die Menge „wie ein kochender Teig auf der Herdplatte wegschabte“.
.
Wir bekommen es bei dieser Erzählung erneut mit der problematischen Balance (?) zwischen Literatur und Leben zu tun. Volker Braun schreibt abschließend: „Die Geschichte hat sich nicht ereignet. Sie ist nur, sehr verkürzt und unbeschönigt, aufgeschrieben. Es war hart zu denken, daß sie erfunden ist; nur etwas wäre ebenso schlimm gewesen: wenn sie stattgefunden hätte.“
.
Ebensowenig wie er sich wünscht, dass die Arbeitsämter abgefackelt werden, möchte er, dass nötig oder unnötig Blut vergossen wird – in Wirklichkeit. Die Alternative dazu wäre – wie bereits von ihm verworfen: nur zu erzählen, was wirklich geschah.
.
Dazu gibt es neuerdings zwei Ansätze, die dies aus Gewerkschaftsperspektive unternehmen – von unten und von oben quasi: Für letztere klapperte die Publizistin Annette Jensen noch einmal die ostdeutschen Industriestandorte ab – für ihr ungenaues und ungeduldiges Buch „Im Osten was Neues. Unterwegs zur sozialen Einheit“. Darin berichtet sie, was aus den Betrieben wurde. Den anderen Erzählband stellten nach einer Tagung über diese Betriebe die Historikerin Ulla Plener und ihre Referenten zusammen – darunter der ehemalige Bischofferöder Betriebsratsvorsitzende und PDS-Abgeordnete Gert Jütemann, der auch schon in Volker Brauns „Hellen Haufen“ eine Rolle spielt. In „Die Treuhand – der Widerstand in Betrieben der DDR – die Gewerkschaften (1990 – 1994)“, so der Titel von Ulla Pleners Buch, in dem neben weiteren Betriebsgeschehen auch noch „Dokumente“ veröffentlicht wurden – u.a. von der ostdeutschen Betriebsräteinitiative, die versuchte, einen betriebsübergreifenden Widerstand gegen die Massenentlassungen zu entwickeln. Sie spaltete sich nach Beendigung des Arbeitskampfes der Bischofferöder und löste sich auf – im Maße der Widerstand im Osten resignierte oder sich ab 1993 nationalistisch wendete. Auch Volker Brauns Roman „Machwerk“ hat inzwischen seine (journalistische?) Fortsetzung gefunden: mit „27 Reportagen aus dem Alltag“ von „1-Euro-Jobbern“, die von der ehemaligen Landtagsabgeordneten in Brandenburg, Esther Schröder, zusammengestellt wurden. Ihr Buch heißt „Vermittelt, Verwaltet, Vergessen“.
.

.
Einige der Kalikumpel in Bischofferode fanden nach Schließung der Grube noch eine Weile Arbeit bei der Verfüllung der Schächte. Ich rekapituliere:
Bischofferode war überall
Rechts neben dem Eingang zum Kaliwerk stand 1996, als ich drei Jahre nach Schließung der Grube wieder einmal dort war, noch die Büste Thomas Müntzers, mit dem eingemeißelten Spruch „Die Gewalt soll gegeben werden dem gemeinen Mann“. Dies sei leider zu wörtlich genommen worden, erklärte der letzte Betriebsratsvorsitzende Walter Ertmer mir: „Die Allergemeinsten haben jetzt die Macht!“ Er dachte dabei an all jene Politiker, Staatsbeamte und Konzernmanager, von deren Versprechungen und Bemühungen die zuletzt noch rund 500 Kali-Bergarbeiter abhängig waren: „Es sieht schlecht aus; das ist hier ein sogenanntes Drama!“ fügte Ertmer damals hinzu. Darauf deutete auch bereits das große Schild links neben dem Werkseingang hin: „Westschrott“ – so hieß ausgerechnet die Firma aus dem Ruhrgebiet, die den Auftrag bekam, die Übertage-Betriebsteile in Bischofferode abzureißen. ‚,Westschrott, diesen Namen muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen,“ meinte Gerd Jütemann, der seit seiner Wahl zum PDS -Bundestagsabgeordneten nur noch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender war. „Dabei war unsere Technik immerhin noch so gut, daß sie die Untertage-Großgeräte, wie Bohrwagen und Brecher- sowie Bandsteuerungs-Anlagen, gleich in den Westen geschafft haben, auch komplette Absetzer haben sie demontiert. Und jetzt wollen sie sogar von den Westgruben aus das Thüringer Kali abbauen.“
.
Das Drama von Bischofferode begann mit dem sogenannten „Fusionsvertrag“ der Treuhandanstalt, in dem der westdeutschen BASF-Tochtergesellschaft ‚,Kali&Salz“, Kassel, 1992 ihre Monopolstellung durch Schließung sämtlicher ostdeutscher Kaligruben, bis auf eine in Unterbreizbach, zugesichert wurde, zusammen mit einem Verlustausgleich von 1,044 Milliarden DM.
.
Bereits im April 1992 warnte der Kali-Experte der Bremer Universität, Peter Arnold, auf einer Betriebsrätekonferenz in Rostock vor dem Einfluß der Kassler Kalimanager in der MDK, d.h. in der „Mitteldeutschen Kali AG“, Sondershausen. Der auf der Rostocker Tagung anwesende Vizepräsident des Bundes Deutscher Industrieller, Tyll Necker, unterbrach ihn: „Bei Kali gibt es keine Marktwirtschaft – Ende der Durchsage!“ In einem Gutachten für die thüringische Landesregierung führte Arnold dann aus, daß der spezielle Kali aus Bischofferode, der zu 90% exportiert werde, insbesondere für die Düngemittelhersteller aus Finnland und Frankreich wichtig sei, wo man nach dem Mannheimer-Verfahren produziere. Die mit dem sogenannten Kieserit-Verfahren arbeitende BASF würde durch die Schließung der Bischofferöder Grube einen enormen Wettbewerbsvorteil gewinnen.
.
Anfang April 1993 faßte Peter Arnold seine Analyse in einem Flugblatt zusammen, das er vor dem Werkstor in Bischofferode verteilte. Mit der Spätschicht gelangte dann das Schriftstück auch Untertage, wo es quasi sofort einen Arbeitskampf auslöste. Dieser eskalierte in einer Werksbesetzung und einem mehrmonatigen Hungerstreik, an dem sich auch Pfarrer und Bürgerrechtler aus anderen Städten beteiligten. Gleichzeitig fuhren die Kalikumpel mit den inzwischen privatisierten Buslinien, die sie vordem täglich zur Arbeit gebracht hatten, zum Kanzler nach Bonn, zur Treuhand nach Berlin und zur Landesregierung nach Erfurt, um dort gegen die Schließung zu protestieren.
.
„Bischofferode ist überall“, hieß ihre Parole. In Berlin und Erfurt mischte die Polizei Provokateure in Zivil unter die Demonstranten aus dem Eichsfeld. Der zuständige Treuhand-Manager Schucht erklärte dem Spiegel: Der Hungerstreik in Bischofferode „hat eine gewaltige Wirkung auch auf die Betriebe im Westen“. Wenn man den nicht bricht, „wie will man dann in Deutschland noch Veränderungen bei den Arbeitsplätzen durchsetzen?“ Täglich fanden sich bis zu 500 Sympathisanten von überall her in Bischofferode ein, vor allem Bergleute von der Ruhr, die sich dafür krank schreiben ließen oder Urlaub nahmen. Spenden von fast einer Million DM gingen ein. Von der PDS kam juristische und publizistische Unterstützung, was den Kanzleramtsminister Bohl zu der Bemerkung veranlaßte: Das sind „Verbrecher“. Im August 1993 baten die mehrheitlich in der CDU organisierten katholischen Betriebsräte des Kaliwerks den Papst um eine Audienz, die ihnen auch gewährt wurde. Sechs Arbeiter fuhren daraufhin zusammen mit der evangelischen Pastorin Haas und dem katholischen Dechant Klapproth nach Rom und übergaben Johannes Paul II. eine Bittschrift: „Voll Vertrauen in Ihr Verständnis für die Menschen, die in Abhängigkeit von den Mächtigen in Wirtschaft und Politik leben, kommen wir zu Ihnen. Überall in der Welt haben Sie sich zum Fürsprecher der Ratlosen und Ausgelieferten gemacht. Das ermutigt uns, Ihnen auch unsere Not zu klagen. Wir sind Bergleute, die in der 4. Generation Kalisalz aus der Erde bringen. Jetzt droht unserer Grube das Ende und uns die Arbeitslosigkeit – nicht weil die Vorkommen abgebaut wären, oder weil es keine Abnehmer unseres Produkts mehr gäbe, sondern weil der große Konzern BASF uns als Konkurrenten ausschalten will. Es kennzeichnet die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in unserem wiedervereinigten Land, daß dieser mächtige westdeutsche Konzern sich dabei der Regierung und der von ihr eingesetzten und geleiteten Treuhandanstalt bedient, um uns als ostdeutschen Kalibetrieb zu schließen – den letzten Großbetrieb in unserer Region. Diese Ungerechtigkeit empört uns und viele in unserem Land zutiefst… Wir sehen in der biblischen Geschichte von David und Goliath eine Entsprechung zu unserem Kampf.“
.
Der Kampf endete am 31. 12. 1993 mit der Annahme des „Fusionsvertrags“ und der Unterzeichnung einer zweijährigen Arbeitsplatzgarantie, die der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Handel Banken und Versicherungen, Ramelow, im Auftrag des Betriebsrates ausgehandelt hatte. Eigentlich wäre dies Aufgabe der IG Bergbau und Energie gewesen, aber die hatte auf dem Höhepunkt des Kampfes der Kalikumpel sogar eine Gegendemonstration in Kassel organisiert, auf der die Schließung der Grube im Eichsfeld gefordert wurde. „Die Bischofferöder sind leider aus der Solidarität ausgeschert,“ hatte dazu der IGBE-Vorsitzende Hans Berger erklärt (einige Jahre später sagte er Ähnliches zu den Bewohnern des Lausitzdorfes Horno, die sich weigerten, der Abbaggerung ihres Ortes durch den Braunkohlekonzern Vattenfall zuzustimmen). Obwohl der Bochumer Gewerkschafts-Multifunktionär 1995 die Ersatzarbeitsplatzbeschaffung für die Bischofferöder zur „Chefsache“ erklärte, konnte von einer Unterstützung durch seine Gewerkschaft keine Rede sein: So bekam z.B. der 1993 wütend aus der IGBE ausgetretene Schlosser Helmut Beier eine Kündigung von der dem Finanzminister unterstellten Gesellschaft zur Verwahrlosung und Verwertung stillgelegter Bergwerke (GVV), die das Kaliwerk in Abwicklung verwaltete und seinen Umbau in einen „Industrie- und Gewerbepark“ vorbereiten sollte. Wegen einer Kündigungsschutzklage wollte Beier rückwirkend wieder in die IGBE eintreten. Dies wurde ihm aber nicht gestattet, woraufhin erneut die Gewerkschaft HBV einsprang.
.

.
Ab 1996 beschäftigte die GVV von den bis dahin 500 Kalikumpeln nur noch 146 weiter, die meisten Untertage, wo sie die Verfüllung bestimmter Schächte vornahmen. Die restlichen 350 Mitarbeiter sollten bis Ende 1996 in neuangesiedelten Drittfirmen unterkommen. Etwa 200 von ihnen befanden sich noch bis zum Jahresende in Umschulungen, ihre Praktika in Fremdfirmen der Umgebung bezahlte die GVV. Die Landesregierung bekräftigte gleichzeitig ihre Zusage, alle bis dahin nicht in Daueranstellungen untergekommenen Bergarbeiter weiter zu beschäftigen: mindestens bis Ende 1997 – über die Arbeitsämter nach § 249 h des Arbeitsförderungsgesetzes. Auf einer Veranstaltung mit dem thüringischen Wirtschaftsminister Schuster im Mai 95 hatte dieser jedoch auch schon Einschränkungen gemacht: die angebotenen Arbeitsplätze dürften nicht wegen Unzumutbarkeit ausgeschlagen werden, auch könne man dabei nicht in jedem Fall auf einer bestimmten Lohnhöhe bestehen. Gerd Jütemann kommentierte das Ministerangebot an Ort und Stelle: „Die Leute sind um ihre Arbeitsplätze betrogen worden und jetzt werden sie noch einmal bestraft.“
.
Für die Umwandlungskonzeption zur Ansiedlung neuer Firmen war die ,,Entwicklungsgesellschaft Südharz/Kyffhäuser“ (ESK) in Worbis zuständig. Sie wurde von einem Treuhand-Manager, dem ehemaligen CDU-Landrat und dem Ende 1993 ausgeschiedenen Betriebsratsvorsitzenden des Kaliwerks Heiner Brodhun, geleitet. Die Akquisition neuer Investoren oblag der Landesentwicklungsgesellsehaft und der Wirtschaftsförderung Thüringens. Es meldeten sich jedoch fast nur unseriöse Projektemacher. Dafür gab es in der ersten Zeit mehr als 40 Ausgründungs-Ideen in der Belegschaft selbst, übrig blieben davon nur ein Management-Buy-Out im Stahlbau, mit 15 Beschäftigten und ein Transport- und Abriß-MBO mit 7 Arbeitsplätzen, bei dem der Betriebsrat Lothar Wedekind einer der Geschäftsführer wurde. Außerdem übernahm der alte Bischofferöder Kohlenhändler Kielholz die Übertage-KFZ-Werkstatt für sein neues Speditionsunternehmen, darüberhinaus beteiligte er sich noch bei einer auf dem Werksgelände ansässig gewordenen Fahrzeugbau-Firma, die 12 Leute beschäftigte, als Gesellschafter. Sein Neffe, der einen Sanitär-Betrieb gegründet hatte, siedelte sich ebenfalls auf dem Gelände des Kaliwerks an. Hinzu kam noch eine kleine Werkstatt, in der Steintröge hergestellt wurden. Das ehemalige Kulturhaus des Kaliwerks, sowie die Gaststätte samt Kegelbahn übernahm eine Speditionsinhaberin aus dem Ort, deren Mann im Kaliwerk arbeitete. Die ehemalige Poliklinik inklusive Sauna kaufte der Betriebsrat, als „Kali-Verein e.V.“ – mit dem Rest der Solidaritätsspenden. Dort wollte man zum einen die Bergwerks-Tradition pflegen und zum anderen den Zusammenhalt der Kalikumpel auch nach der vollständigen Zerstreuung von Belegschaft und Betriebsrat aufrechterhalten.
.
Unterdes zogen viele jüngere bereits nach Westdeutschland. Während der Kanzleramtsminister, Bohl, die Radikalität der Kalikumpel für die eigentliche Ursache des Fernbleibens der Investoren hielt, war der ESK- Geschäftsführer, Werner Dietrich, dem für seine Planungsaufgaben 22,9 Millionen DM aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Ost zur Verfügung standen, eher enttäuscht vom unternehmerischen Elan der Kalikumpel selbst. „Wir hatten mit mehr Ausgründungen gerechnet. Aber die Bergarbeiter waren sehr privilegiert, die wurden mit Bussen von zu Hause abgeholt und nach der Arbeit wieder dort hingebracht und brauchten sich um nichts zu kümmern.“
.
Weil die Region Nordthüringen damals ohnehin schon eine Arbeitslosenquote von 25 % hatte (30 000 als arbeitslos gemeldete und 20 000 in ABM bzw. Umschulung), erhoffte er sich einen größeren Beschäftigungsschub vor allem durch den geplanten Autobahnbau zwischen Halle und Fulda. Ansonsten sah er die Aufgabe der ESK erst dann beendet, wenn es keine Arbeitslosen im Eichsfeld mehr gäbe: „Und das wird dauern!“
.
Anfang Januar 1997 verschickte der MdB Gerd Jütemann eine wütende „Pressemitteilung“, in der er darüber informierte, daß die Bischofferöder Beschäftigungsgesellschaft, in der die Kalikumpel bis zu den von der Landesregierung versprochenen „Ersatzarbeitsplätzen“ aufgefangen werden sollten, schon wieder 71 Arbeitsplätze gestrichen hatte. Der Betriebsratsvorsitzende Walter Ertmer war inzwischen nicht mehr freigestellt, weil seine Belegschaft bereits auf unter 300 „abgespeckt“ worden war. Ich fragte ihn 1996, wen Günter Grass in seinem Roman „Ein weites Feld“ mit dem „Vikar Konrad bei den Kalikumpeln in Bischofferode“, der ihm nie ganz aus den Sinn gegangen sei, gemeint haben könnte. ,,Damit kann er eigentlich nur Christine Haas gemeint haben“.
.
Die evangelische Pastorin aus Großbodungen, die auch die protestantische Minderheit in Bischofferode seelsorgerisch betreut, gehörte 1993 zu den engagiertesten Unterstützern des Kampfes der Kalikumpel. Dafür wurde sie noch lange danach gelegentlich in ihrer Gemeinde kritisiert: „Die Bauern sagen, den Bergleuten ging es besser als allen anderen und dann hat sich auch noch die ganze Welt um sie gekümmert. Erst wenn das alles vorbei ist, hört hier die Zweiklassengesellschaft auf, dann sind wir wieder alle gleich.“
.
Inzwischen hat die christliche Bürgerrechtlerin Haas erkannt, daß sie damals nicht nur gegen Treuhand und BASF kämpften, sondern auch gegen die Müll-Mafia, die an neuen Untertage-Deponien interessiert ist. Dagegen entstanden dann mehrere Bürgerinitiativen im Eichsfeld. Der Bischofferöder Betriebsrat hielt sich hierbei aus Gründen der Arbeitsplatz-Schaffung jedoch eher zurück. Bei einem dann abgeschmetterten Plan einer Gießener Firma, oberhalb der Kaligrube am Ohmberg den Kalkstein abzubauen, wobei 15 Bergarbeiter Arbeit gefunden hätten, geriet die Pastorin sogar mit einigen Kalikumpeln aneinander: „Es ist aber auch eine schwierige und deprimierende Situation jetzt“, sagte sie, „in den Kämpfen kam so etwas wie eine Ganzheitlichkeit zustande, das ist danach alles wieder auseinandergefallen“.
.
„Während der Auseinandersetzungen, so anstrengend sie waren, ging es fast allen gut. Danach fiel alles auseinander. Viele wurden krank, vier starben sogar.“ „Wer nur ein bißchen beweglich ist, zieht weg von hier“, ergänzte der mit Aufräumarbeiten unterbeschäftigte Bergmann Ide, der selbst jedoch gerade sein Haus renoviert hatte. Nicht einmal die in Bischofferode angesiedelten Rußlanddeutschen wollten bleiben.
.
„Die Arbeitslosigkeit geht durchs Land als ein neues Regime der Furcht, das keine Stasi braucht, um die Menschen einzuschüchtern“, schrieb Heiner Müller. Doch die Kalibergarbeiter in Bischofferode (Thüringen) kämpften dann so ausdauernd gegen die Schließung ihrer Grube gerade aus Furcht vor Arbeitslosigkeit – und „es wurde der härteste Arbeitskampf, den das Land je erlebt hat“, daraus, wie das Wochenmagazin Freitag 2003 rückblickend schrieb.
.
Zum Brechen wurden nicht nur Zivilpolizisten als Provokateure eingesetzt und die völlig korrupten Führer der Gewerkschaften IG Bergbau und Energie sowie IG Chemie mobilisiert, es kamen auch Politiker aller Couleur nach Bischofferode, die völlig haltlos und verlogen „große Investitionen“, „neue Arbeitsplätze“ usw. versprachen. Und es rückten westdeutsche Dumpfjournalisten en masse an, die hernach – wie z. B. Henryk M. Broder – schrieben: Man hätte den Kalikumpeln sagen müssen, dass es „für eine Arbeit, bei der Produkte hergestellt werden, die niemand kaufen will, kein Naturrecht gibt“.
.
Nein, aber man hätte den Kalikumpeln vielleicht den Wiedervereinigungsplan von Doktor Friedrich Ernst aus dem Jahr 1959 zeigen sollen. Der Ministerialdirektor a.D. Dr. Friedrich Ernst starb 1960, kurz vor Fertigstellung seines „Plans“. 1919-31 arbeitete der Jurist im preußischen Handelsministerium. Anschließend wurde er Reichskommissar für das Bankgewerbe. 1935 ernannte ihn der Führer zum Reichskommissar für das deutsche Kreditwesen. 1939-41 war er für die Verwaltung des „feindlichen Vermögens“ verantwortlich, dazu arbeitete er die „Richtlinien“ zur Wirtschaftsführung in den „neubesetzten Ostgebieten“ aus. Diese Instruktionen – Hermann Görings berühmte „Grüne Mappe“ – waren dann Grundlage für die Tätigkeit des „Wirtschaftsstabes Ost“: das Drehbuch für die Ausplünderung der Sowjetunion.
.
Dr. Ernst nahm daran nicht mehr aktiv teil, er wurde 1941 Teilhaber einer Hamburger Bank. 1949 holte man ihn erneut in ein öffentliches Amt. Bis 1957 half er, das Wirtschaftswunder anzukurbeln: erst als Verwaltungsratsvorsitzender der Berliner Zentralbank, seit 1951 auch noch als Leiter des Kabinettsausschusses für Wirtschaft – damit war er der Vordenker in Adenauers „Wirtschaftsnebenregierung“. 1952 wurde er überdies Vorsitzender des „Forschungsbeirates für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands“. Es ging um eine detaillierte Zusammenstellung „der bei der Wiedervereinigung voraussichtlich erforderlichen Sofortmaßnahmen“. Die Arbeit gipfelte in einer „Empfehlung zur Einfügung der ,volkseigenen‘ Industriebetriebe der SBZ in die nach der Wiedervereinigung zu schaffende im Grundsatz marktwirtschaftliche Ordnung“. Einen Monat nach dem Tod von Dr. Ernst wurde die Empfehlung abgeschlossen. Im Einzelnen wurde darin u.a. vorgeschlagen: 1. die VEB als potentiell selbständige Unternehmen zu „modifizieren“, 2. von diesen „modifizierten VEB“ eine DM- „Eröffnungsbilanz zu verlangen, und 3. mit dem Übergang eine „Obere Behörde“ (Treuhandanstalt) zu betreuen. Diese obere Behörde sollte Aufsichtsräte einsetzen und die „modifizierten VEB“ gemäß marktwirtschaftlicher Einschätzungen teilen oder mit anderen vereinen können. Mit Staatsmitteln errichtete Werke sollten von der oberen Behörde verkauft werden. Für die LPG sah die Empfehlung vor, sie nach einer Phase als „Übergangsgemeinschaften“ aufzulösen. Als Prinzip galt: Rückgabe vor Entschädigung. Dabei würde es zu Arbeitslosigkeit kommen, deswegen wurde empfohlen, gleichzeitig Vorsorge für einen reibungslosen Übergang von landwirtschaftlicher zu anderer Beschäftigung zu treffen (Massen-Umschulung und -ABM). Auch die „Altschulden“-Frage wurde vom Forschungsbeirat bündig geregelt, sowie die Währungsumstellung auf 1:1 – mit Einschränkungen. Außerdem war man bereits 1960 davon ausgegangen: Es gibt jetzt schon in der „sowjetisch besetzten Zone bei Kali Kapazitäten, die im Falle der Wiedervereinigung eine Ausweitung nicht erfordern“, da sich „Überkapazitäten für Gesamtdeutschland ergeben würden“. Dr. Ernst hatte also bereits damals „Bischofferode“ fest im Blick: Unglaublich!
.
Sein Nachfolger Dr. Gradl erinnerte 1965 die interessierte Öffentlichkeit noch einmal daran: Wir müssen auf die Wiedervereinigung vorbereitet sein, „wie wenn sie morgen geschähe. Hierzu im wirtschaftlichen und im sozialen Bereich beizutragen ist der Sinn des Forschungsbeirates“ – und des Wirkens von Friedrich Ernst gewesen. Dessen praktische Wiedervereinigungs-Empfehlungen waren 1960 bereits so ausgereift, daß sie noch dreißig Jahre später als „Masterplan“ der Treuhand-Privatisierungspolitik taugten. Detlev Rohwedder wollte diesen Masterplan 1991 modifizieren – vielleicht wurde er deswegen umgebracht. Als Nachfolger griff man sich dann erneut jemanden aus einem Hamburger Bankhaus.
.
Dem letzten DDR-Botschafter in Jugoslawien, Ralph Hartmann, gebührt der Verdienst, die Ernstsche „Urfassung“ wiederentdeckt zu haben. Vgl. dazu sein Buch „Die Liquidatoren“ (Verlag Neues Leben, Berlin 1997).
.

.
Schlesische Bergbaufolgeprojekte
2015 flammte in Thüringen der Streit um die 1993 erfolgte Schließung des profitabel gewesenen Kalibergwerks „Thomas Müntzer Schacht“ in Bischofferode durch die Treuhandanstalt zugunsten der BASF-Tochter „Kali+Salz“ noch einmal auf, weil ein thüringischer „Assange“ den hochgeheimen „Kalifusionsvertrag“ ins Netz stellte – dadurch kam heraus, dass „Kali+Salz“ neben der Schließung mehrerer ostdeutscher Konkurrenz-Kalibergwerke, die andernfalls eine Überproduktion herbeigeführt hätten, noch anderthalb Milliarden Euro obendrauf bekommen hatte. Die Schächte des Bischofferöder Kalibergwerks waren unterdes geflutet worden.
.
Ganz anders gehen die Polen im Bergbaugebiet Oberschlesien mit ihren vielen erschöpften oder stillgelegten Stollen um: Sie werden geradezu liebevoll gepflegt – und nach und nach neuer Nutzung zugeführt – u.a. um sie für den Tourismus zu erschließen. In Kattowitz/Kattowice, wo es zu sozialistischen Zeiten allein im Stadtgebiet 23 Bergwerke gab, von denen heute noch 12 Kohle fördern, hat man auf einem Bergwerksgelände eine Philharmonie und ein riesiges „Schlesisches Museum“ gebaut, wobei Reste der Über und der Unter Tage Anlage verbunden wurden.
.
Im ehemaligen Silberbergwerk von Tarnowskie Gory (Tarnowitz) hat man für die Touristen einen Schacht unter Wasser gesetzt, den sie nun mit einem Boot besichtigen können. Er wird „Stollen der Schwarzen Forelle“ genannt und ist zwischen den Lichtschächten „Ewa“ und „Sylwester“ befahrbar. In den niedrigen Seitenstollen wurde mit lebensgroßen Puppen die Arbeit der Bergarbeiter nachgestellt. Nun im gleißenden Scheinwerferlicht, anfänglich arbeiteten sie bei Kerzenlicht. Unser Fährmann und Führer war ein ehemaliger Bergarbeiter: Neben Polnisch und Deutsch sprach er noch Schlesisch – eine im Bergbau mit tschechischen Wörtern angereicherte Sprache, die für ihn so etwas wie eine Geheimsprache geworden war nach 1945.
.
In Zabrze (von 1915 bis 1945 Hindenburg O.S. genannt) hat man die riesige Waschkaue der Bergarbeiter des Schaubergwerks „Guido“ (benannt nach dessen Besitzer Guido Henckel von Donnersmarck) einheimischen Künstlergruppen zur Nutzung überlassen. An den Wänden hängen nun mehrere hundert Bilder. Früher wurden die Laien-Malzirkel großzügig gefördert. Unter Tage hat man 2008 die ersten 1,4 Kilometer der 320 Meter tiefen Sohle eröffnet. Gezeigt wird unter anderem ein 800 Tonnen schwerer Kohlesammelbehälter, eine Sohlebahn und die Simulation eines Bergewerkunfalls mit dazugehöriger Rettungsaktion. Die Kohleförderung wurde bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eingestellt.
.
Im Bergwerk Ignacy (Hoym) des Rybniker Kohlereviers, das unsere Journalistengruppe besuchte, führt man dem Besucher die gewaltigen Schrämmaschine im Stollen vor, wie sie sich in den Kohleflöz frißt – aber nur für eine Minute pro Besuchergruppe. In einem anderen Stollen befindet sich ein großes Restaurant und ein Clubraum? Man kann dort Hochzeitsfeiern buchen. Die Anreise geschieht noch mit dem alten Aufzug, in dem die Bergarbeiter zur Schicht fuhren und ein ehemaliger Bergarbeiter – nunmehr Dienstleister – bedient ihn auch. Auch einige Bergarbeitersiedlungen hat man quasi mit ihren Bewohnern musealisiert: u.a. die Arbeitersiedlung Nikiszowiec (Nikischschacht) in Kattowitz und die Arbeiterwohnkolonie Ficinus in Ruda Śląska-Wirek (Antonienhütte).
.
Die Warschauer Journalistin Malgorzata Szejnert erzählt in ihrem Buch „Der Schwarze Garten“ (2015) die Geschichte der Bergarbeitersiedlungen Gieschewald (Giszowiec) und Nikischschacht (Nikiszowiec). 2011 las die Autorin daraus während der Literaturtage an der Neiße im Schlesischen Museum zu Görlitz, 2008 veröffentlichte sie im Berliner „Blättchen – der Zweiwochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft“ einen Bericht: „Reise in den ‚Schwarzen Garten'“, dieser Bericht stammte aus: »Czarny Ogród« (Kraków 2007) und »Nowe Ksiazki« Heft 4/2008, und war von Gerd Kaiser ausgewählt und übersetzt worden; als alter „Blättchen“-Autor gehe ich davon aus, dass die Autorin, die Redaktion und Gerd Kaiser nicht dagegen haben, wenn ich Malfgorzata Szejnerts Bericht hier noch einmal veröffentliche:
„Es war in den Jahren des Ausnahmezustands, ich hatte die Redaktion der Wochenzeitung Literatura verlassen müssen. Da bot der Neurologe Professor Ignacy Wald mir, der auf die Straße gesetzten Reporterin, eine halbe Planstelle im Warschauer Institut für Psychiatrie und Neurologie an. (Der international renommierte Arzt und Wissenschaftler hatte von 1943 an in der Polnischen Volksarmee als Panzerfahrer gekämpft, an der Befreiung Warschaus teilgenommen und nach dem Krieg Medizin studiert. G. K.) Im Institut redigierte ich die Krankenberichte.
Eines Tages schickte Ignacy Wald mich nach Katowice – in der Staszic-Siedlung, die von allen Einwohnern Giszowiec genannt wurde. Zuvor war es eine Bergarbeitersiedlung gewesen. Als Gartenstadt konzipiert und zu Anfang des 20. Jahrhunderts im Obersten Oberschlesien, im ehemaligen Drei-Kaiser-Eck, dort wo Rußland, Österreich-Ungarn und Deutschland aneinandergrenzten, als Bergarbeitersiedlung des Montanunternehmens Gieschewald erbaut, nannte man sie ab 1919 Giszowiec, ab 1939 wiederum Gieschewald und ab 1945 schließlich erneut Giszowiec; teilweise wurde sie in die erwähnte Siedlung Staczice umbenannt, bis dieses Fleckchen Erde schließlich in Katowice aufging.
Die Bergarbeiterfamilien hatten in Einfamilienhäusern gewohnt, zwar ohne Bad, aber zur Gartenstadt hatte ein öffentliches Stadtbad gehört. In der Schule wurde zuerst in deutscher Sprache unterrichtet, dann in polnisch, dann wieder deutsch und – bis heute – erneut in polnisch. In der Schulchronik, geschrieben in den markanten Schwabacher Schriftzügen, habe ich oft gelesen; der erste polnische Schuldirektor, der nach der Abstimmung in Oberschlesien (1921 – G. K.) ins Amt gekommen war, hatte die deutschsprachigen Aufzeichnungen nicht herausgerissen, sondern die Schulchronik in polnischer Sprache weitergeführt.
1968 hatte der damalige Wojewodschaftssekretär der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei entschieden, daß diese Gartenstadt abzureißen sei, um auf der abgeräumten Fläche Wohnblöcke zu errichten. Die Entscheidung war ideologisch begründet. Ureigentlich ging es darum, ein derart schönes Zeugnis nicht nur deutscher, sondern auch noch kapitalistischer Alltagskultur aus der Welt zu schaffen. Ich kam seinerzeit nach Giszowiec, als die Planierraupen schon einen Teil der Gartenstadt plattgemacht hatten.
Erste Wohnblöcke standen. Bald nachdem sie erbaut, begannen sie Ruinen zu ähneln.
Dort lernte ich Leute kennen, die man heute Vertreter der Zivilgesellschaft nennen würde. Sie waren sich zwar bewußt, daß die überlieferten materiellen Zeugnisse nicht zu erhalten seien, bemühten sich jedoch, die historisch gewachsenen sozialen Bindungen zu bewahren, mehr noch, neue soziale Bindungen zu knüpfen. Eine dieser neuen Bindungen war mit der Entstehung eines Zentrums für geistig behinderte Kinder verbunden. Das hat mich tief beeindruckt.
Eben an diesem historisch gewachsenen Ort war eine Rehabilitationseinrichtung für Kinder mit schweren neurologischen Schädigungen entstanden. Ich hatte einen Bericht über die Arbeit dieser klinischen Einrichtung für eine Konferenz im Warschauer Institut zu schreiben, und Ignacy Wald rechnete damit, daß ich auch die sozialen Bedingungen berücksichtige, unter denen diese Rehabilitationsklinik entstanden war. Giszowiec übte einen unvergleichlichen Eindruck auf mich aus. Die Klinik war hervorragend ausgestattet und organisiert, im Haus herrschte eine Atmosphäre der Hochherzigkeit.
Die ursprüngliche Gartenstadt, bereits zersiedelt und zersetzt von Wohnblöcken, verteidigte sich noch mit erhaltenen Bindungen, dem einen oder anderen Laubengang, einem Flur, einem zerstörten Dach, mit Zeugen vergehender Schönheit. Menschen, die dieses Fleckchen Erde als ihre geistige und materielle Heimat betrachteten, taten alles um zu erhalten, was zu erhalten war.
Nachdem es Ende der achtziger Jahre zu den tiefgreifenden Veränderungen gekommen war, wandte ich mich, nunmehr bereits in Rente, wiederum diesem historischen Ort zu, einem Landstrich, in dem Ethnien unterschiedlicher Prägungen, Polen, Deutsche und ein Volksstamm, der sich »Slazaci« auf engem Raum in einem Landstrich und eben auch in Gieschewald/Gieszowice zusammenlebten. Ich stieß auf die dicke Geschichte der Bergwerkgesellschaft Georg von Giesches Erben, in der die zweihundert Jahre lange Geschichte dieses Unternehmen beschrieben wird. Über das Buch Das Haus am Ring von Clara Schulte fand ich die Wohnstätte eines Teils der Familie Giesche am Breslauer Markt. Frau Schulte war die Gattin des Generaldirektors des Unternehmens Giesches Erben, der, wie Walter Laqueur und Richard Breitmann herausfanden, die Alliierten über die deutsche Vernichtungspolitik unterrichtete.
Viel Zeit verbrachte ich im Bergbaumuseum in Zabrze, in dem vielfältige Zeugnisse des Alltagslebens der Bergarbeiterfamilien bewahrt werden. In den Heimatstuben von Giszowiec sah ich, wie die Küchen aussahen, welche Stickereien den Bergarbeiterfrauen von der Hand gegangen waren. Ich zeichnete Gespräche auf, verschriftlichte sie später, arbeitete im Staatlichen Archiv Katowice und einer Reihe weiterer Archive. So entstand Schritt für Schritt und im Laufe der Zeit mein Buch Der Schwarze Garten.
In diesem Landstrich veröffentlichten die Reichsbehörden im März (1941 – G.K.) die Volksliste. Die Bergarbeiter, die 1939 acht Stunden untertage arbeiteten, hatten 1940 acht und eine dreiviertel Stunden zu arbeiten, ab 1941 elf Stunden. Sie waren schlecht versorgt. Die Bewohner Oberschlesiens wurden in vier Nationalitätengruppen aufgeteilt. In die Volksliste 1 kamen Deutsche, die sich bereits vor dem Krieg aktiv am Leben der deutschen Minderheit beteiligt hatten, und zwar in politischer Hinsicht. Zu dieser Gruppe gehörte beispielsweise der Schulinspektor Andreas Dudek. Zur Volksliste 2 gehörten Einwohner, die sich bereits vor dem Krieg als Deutsche gaben, aber sich politisch gleichgültig gezeigt hatten. In diese Liste eingetragen wurde Tomasz Wróbel, der Mann der Waleska – einer meiner Interviewpartnerinnen –, der im Ersten Weltkrieg Putzfleck bei einem Offizier gewesen war und als Weltkriegsveteran sich irgendwann einmal dem Kriegerverein angeschlossen hatte. Die in diese beiden Volkslisten 1 und 2 Eingetragenen wurden als Angehörigen deutscher Nationalität betrachtet, das gab ihnen das Recht, sich als Staatsbürger des Dritten Reiches zu bewerben.
Zur Volksliste 3 gehörte die Schicht des bodenständigen Mittelfelds, die (aus der Sicht der deutschen Machthaber) polonisiert waren – wie die Familien Gawlik, Kasperczyk, Kilczan –, auf die aber die Wehrmacht und die Wirtschaft des Dritten Reiches nicht verzichten konnten. Bei ihnen wurde von ihrer schrittweisen »Eindeutschung« ausgegangen. Menschen, die in diese Gruppen einsortiert worden waren, dachten bei sich zumeist: »Wenn sie wollen, dann schreibe ich, was gewünscht wird. Soll sie doch der Teufel holen, ich bin ja sowieso polnisch.« Zur Volksliste 4 gehörten bodenstämmige Slazacy, die (wie die Waleska) voll und ganz polonisiert waren.
Und schließlich gab es auch Landeskinder, etwa zwei Prozent der Oberschlesier, die wie meine Interviewpartner Konstanty Prus und Anna Kilczanowa zu keiner der vier Gruppen gehörten. Sie hatten sich bereits vor dem Krieg und nun erst recht zu Polen bekannt und hatten deshalb nichts Gutes zu erwarten.
PS: Kaziemierz Kutz, der große Regisseur – unter anderem spielt sein Film Perlen in der Krone im oberschlesischen Bergarbeitermilieu – urteilte über die Reise in den Czarny Ogrod (das ist der Schwarze Garten): »Für alle die von dorther stammen, ist der Schwarze Garten wie ein Vergrößerungsglas, weil es Orte wie Giszowiec multum in Oberschlesien gibt«.“
.
Zurück zu unserer Oberschlesien-Reise: Während wir von einem Event-Bergwerk zum nächsten fuhren – bewegten wir uns auf der „Straße technischer Kulturdenkmäler in der Woiwodschaft Schlesien“, die von dem Museum für Streicholzherstellung und dem Museum für Bahngeschichte in Częstochowa (Tschenstochau) bis Zywiec (Saybusch), in den Beskiden nahe der slowakischen Grenze reicht, wo es ein Museum in einer Brauerei gibt, die von den Habsburgern gegründet wurde und heute dem holländischen Heineken-Konzern gehört. Überhaupt gehört in Polen sehr viel Industrie ausländischen Unternehmen, den Deutschen u.a. viele Medien, die meisten EU-Agrarsubventionen für Polen bekommen der schwedische Konzern „Absolut Vodka“ und der französische „Pernod-Ricard“-Konzern – für die dort von ihnen aufgekauften Schnapsbuden, einschließlich der vielen alten Destillerien, in die die Bauern ihren Roggen liefern. 2008 erwarb Pernod-Ricard auch noch Absolut Vodka.
.
Mitunter machten wir eine Pause, u.a. im Restaurant der modernen auf Massen von Besuchergruppen eingerichteten Großbrauerei „Tyskie“ in der Stadt Tychy (Tichau) nahe Auschwitz. Vis à vis der hochmodernen Brauerei befindet sich ein Museum für Bierbraukunst. Der nächste Brauereistop war in einer alten, nur zum Teil musealisierten Brauerei, wo man für uns einen Vortrag über die Braukunst mit einem deftigen Essen verband. Leider habe ich vergessen, wie der Ort und die Brauerei hieß. Am Interessantesten war es in der bei laufender Produktion sich musealisierenden Glashütte von Zawiercie (von 1941 bis 1945 Warthenau genannt), in der die Glasbläser Schüsseln und Wasserkannen mit einer derartigen Artistik formten, dass die Photographiererei kein Ende nehmen wollte. Außerdem machten wir noch Halt am musealisierten „Sender Gleiwitz“ und besichtigten das Kunstmuseum in der Fabrikantenvilla Caro in Gliwice.
.
Als wir in Kattowitz im noblen Hotel „Monopol“ ankamen, erfuhren wir, dass Rod Stewart gerade 56 Zimmer gemietet hatte, weil er in einer Halle am Stadtrand ein Konzert geben wollte. Der im ganzen Ostblock bis hin in die Mongolei bekannte deutsche Sänger Thomas Anders begnügte sich derweil mit sieben Zimmern dort, auch er gab ein Konzert in Oberschlesien. Vielen Bergarbeitern, deren Gruben geschlossen wurden, bleibt nichts anderes übrig, als sich zu Tode zu amüsieren, was sie jedoch nicht lustig finden. Das Hotel „Monopol“ war old-fashioned renoviert worden, zuvor hatten wir einmal in einem brandnew-fashioned Hotel auf einem Berg übernachtet, das der junge Besitzer für die Gewinner der Marktwirtschaft als Wellness-Tempel in einen Felsen hineingebaut hatte.
.
Die Mutter des Geschäftsführers vom Kattowitzer Hotel „Monopol“, der sich um uns Journalisten kümmerte, hatte sich am Warschauer Aufstand vom 1. August bis zum 3. Oktober 1944 beteiligt und war dann als Kriegsgefangene in ein Moorlager im Emsland gekommen, wo sie und ihre Kameradinnen schließlich von einer polnischen Brigade der englischen Armee befreit wurden. Ihr Sohn wußte nicht, dass es darüber einen Dokumentarfilm mit Interviews der Beteiligten gibt: „Konspirantinnen. Polnische Frauen im Widerstand 1939-1945“; gedreht hat ihn der „weichende Erbe“ der Papenburger Meyer-Werft Paul Meyer, der zuvor bereits einen Film über ein anderes emsländisches Moorlager gedreht hatte. Ich schickte dem Geschäftsführer des Kattowitzer Hotels „Monopol“ später eine Kopie des Films über die Widerstandserlebnisse und die Gefangenschaft seiner Mutter. Sie sagt in dem Film: „Der Aufstand konnte nicht nicht losgehen.“ Und: „es war die schönste Zeit in meinem Leben. Wir waren doch alle so jung.“
.

.
Es gibt in Polen einen deutlichen Hang zum „Untergrund“. Schon 1988 wunderten wir uns in Warschau, dass sich alle Studentenclubs in Kellern mit schwarzen Wänden, Decken und Böden befanden (während sie in Westdeutschland gerade durchgehend weiß und hell „gestylt“ worden waren). Und jedesmal, wenn ich danach Polen bereiste, landete ich früher oder später in einer Kellerkneipe oder einem Gewölberestaurant. Als ich das letzte Mal mit einer Journalistengruppe in Schlesien unterwegs war und wir täglich in rustikalen Kellergewölben einkehrten, äußerten wir die Vermutung, dass dies mit den ruhmreichen Perioden der polnischen Geschichte zusammenhänge, in denen das Land okkupiert war und nahezu die gesamte Gesellschaft in den Untergrund ging, mitsamt Behörden, Schulen, Universitäten usw., um sich von dort aus zu sammeln und einen Aufstand vorzubereiten… Kaum befreit und auf ihren Nationalstolz reduziert, drohte die polnische Gesellschaft aber auch schon wieder zu verzagen. Die Kellerrestaurants und -clubs wirken dabei als eine Art geselliges Gegengift. Zu dieser Vermutung paßte, dass ein polnischer Journalist aus Zielona Gora (Grünberg – früher zu Schlesien gehörend, heute zur Woiwodschaft Lebus) uns versicherte, in der Stadt gäbe es eine sehr lebendige „Underground-Scene“ und dieser „Untergrund“ sei es, der die Gesellschaft immer wieder vorangebracht habe, nicht die Unternehmer und das Bürgertum.
.
Als der polnische Untergrund im Zweiten Weltkrieg anfing, mit Waffen gegen die deutsche Okkupation vorzugehen, kam es in der Hauptstadt zu zwei Aufständen: den Ghettoaufstand und den Warschauer Aufstand. Beide Male entstand unterhalb des Untergrunds (in den Kellern der Häuser, die man miteinander verbunden hatte) ein weiterer Untergrund – in der Kanalisation der Stadt. Über den darüber sich erstreckenden Keller-Untergrund interviewte die Gaseta Wyborcza 2005 einen ehemaligen deutschen Soldaten, dessen 46.Sturmbrigade damals an der Seite der ersten Partisanenbekämpfungseinheiten, der SS-Brigade Dr. Dirlewanger und der Brigade Kaminski, kämpfte. U.a. war der junge Soldat an mehreren Nahkämpfen mit dem Messer – „in Kellern“ – beteiligt: „Die Keller waren das zweite Warschau. Wenn man in Kellern kämpfte, ist es still, man sieht nichts,“ erzählte er.
.
Der Regisseur Andrej Wajda hat 1957 das noch dunklere dritte Warschau mit seinem Film „Der Kanal“ erhellt. In die Kanalisation trauten sich die Deutschen nicht rein, Aber ihre nahe Anwesenheit bestimmt das Verhalten der mit einem „Passierschein“ in die Kanäle sich zurückziehenden Kompanie der Armia Krajowa – die zu dem Zeitpunkt noch aus einundvierzig Männern und einem jungen Melder sowie zwei weiblichen Meldegängerinnen besteht. Der Film zeigt die letzten Stunden ihres Lebens. Er handelt von den Existentialien Liebe, Mut, Feigheit, Verrat – und rührte äußerst wirkungsmächtig an ein Tabu der polnischen Kommunisten: Sofern sie nicht ins Londoner Exil geflüchtet waren, hatte man die Angehörigen der Heimatarmee (AK), die den Aufstand befehligt hatten, der auch gegen die Rote Armee gerichtet war, nach dem Krieg zunächst als „Verräter“ und „Diversanten“ diffamiert und sogar strafrechtlich verfolgt – so dass Wajdas „Kanal“ auch einen anderen Umgang mit diesem aus kommunistischer Sicht „dunklen Kapitel“ der polnischen Geschichte, die er erhellte, einleitete. 2004 strahlte das deutsche Fernsehen ein Interview der ARD-Korrespondentin in Warschau mit der ehemaligen Meldegängerin Wanda Stawska aus, die dabei auch auf „die schönen Momente des „Warschauer Aufstands“ zu sprechen kam: Alle Jungs seien in die Kämpferinnen verknallt gewesen: „Wir waren doch alle so jung. Und es entstand eine so unglaubliche Solidarität und Nähe in dieser ganzen Aussichtslosigkeit.“
.
Im Januar 1943 hatte Emilia Landau das Signal zum Ghettoaufstand gegeben, indem sie eine Handgranate in eine Gruppe deutscher Soldaten warf. „Das wesentliche Merkmal des Aufstands im Warschauer Ghetto besteht darin“, schreibt der polnische Essayist Jan Josef Szczepanski, daß es hierbei „nicht um eine Vorahnung der unvermeidlichen Niederlage ging, sondern um eine bewusst angenommene Gewißheit“. Dies unterscheide den Ghettoaufstand vom Warschauer Aufstand, der im August 1944 begann – und ebenfalls nach drei Monaten scheiterte. Nur wenigen Kämpfern gelang danach die Flucht durch die Kanalisation – in die Wälder zu den (bäuerlichen ?) Partisanen. Unter ihnen befand sich damals neben einigen hundert anderen Juden auch wieder der Führer des Ghettoaufstands Marek Edelman. Einen ersten knappen Rechenschaftsbericht über den „Ghettoaufstand von 1941-1943“ verfaßte er gleich nach dem Krieg. Berühmt wurde vor allem ein Interview, das die polnische Schriftstellerin Hanna Krall 1979 mit ihm führte: „Dem Herrgott zuvorkommen“. Edelman versucht darin das Heldentum (der bewaffneten Kämpfer) zu relativieren – im Vergleich zu dem Mut, mit dem viele Menschen im Ghetto nahezu klaglos ihrer Vernichtung entgegengingen: „Schießend stirbt es sich viel leichter“.
.
Den Philosophen Zvetan Todorov brachten Edelmans Gedanken in seiner Studie „Angesichts des Äußersten“ (1993) zu einem Vergleich des Warschauer Aufstands mit dem Ghettoaufstand, wobei er sich auf die Äußerungen von Marek Edelman und von General Bor-Kormorowski bezog. Todorov schlug vor: Man sollte in bezug auf Bor-Komorowski „von heroischen Tugenden reden und bei den von Edelman überlieferten Fällen von Alltagstugenden…Dort wird der Tod zu einem Wert und einem Ziel, weil er das Absolute besser als das Leben verkörpert. Hier ist er das Mittel, nicht der Zweck. Er ist die letzte Zuflucht des Individuums, das seine Würde bewahren will.“
.
2001, erschien eine Studie über den Warschauer Aufstand von Wlodzimierz Borodziej. Der Historiker zitierte im Vorwort das „Informationsbulletin“ der Heimatarmee, das bereits einen Tag nach der Kapitulation „vor eiligen Schlüssen über die letzten 63 Tage“ warnte: „die Rechnung‘ sollte lieber der Geschichte überlassen bleiben“. Borodziej kommt am Ende seiner Studie auch auf Tzvetan Todorov zu sprechen, der den Warschauer Aufstand im Gegensatz zum Ghettoaufstand für eine „Entfesselung“ hält, die niemandem geholfen hat: „weder damals noch später, weder vor Ort noch anderswo“. Todorov irrt hier eventuell, schreibt Borodziej, denn „es liegt schließlich im Bereich des Möglichen, daß ohne die Niederlage des – hoffentlich letzten – großen Aufstands die Polen weder 1980 eine legale antikommunistische Gewerkschaft erfunden hätten, noch den ‚Runden Tisch‘ neun Jahre später, mit dem die friedliche Entmachtung des Regimes eingeleitet und der Weg in die Freiheit beschritten wurde“.
.
Diesen „Weg“ leben die Polen jetzt im „zweiten Warschau“, in den Kellerlokalen nicht nur von Warschau, symbolisch nach, wenn sie dort verkehren. Dass die Frauen auch heute noch die wahren Helden sind, fand die Soziologin Malgorzata Irek in einer dreijährigen Untersuchung heraus, die 1998 im Verlag „Das Arabische Buch“ erschien: „Der Schmugglerzug Warschau-Berlin-Warschau“. Eine in Berlin lebende polnische Freundin, Sonja, arbeitete damals in einem Elektronik-Import-Export-Geschäft in der Kantstraße. Sie hatte dort einen Tagesumsatz von 100.000 DM, es gab allein in ihrer Gegend etwa 30 solcher Läden – für polnische Schmuggler, von denen die meisten Frauen waren.
.
Erstmalig in einen heldischen Kontext gestellt hat sie Andrej Waida 1957 mit seinem weltberühmten Film „Der Kanal“, wobei er sich vor allem auf die kanalerfahrene Meldegängerin mit dem Decknamen „Gänseblümchen“ konzentrierte. An die Heldin „Gänseblümchen“ und all die anderen „in Gefahr und größter Not“ über sich selbst und die Männer hinausgewachsenen weiblichen Verbindungssoldaten erinnerten 2005 noch einmal die beiden Künstler Darek Foks und Zbigniew Libera mit einer Ausstellung in Katowice (Kattowitz), Bytom (Beuthen) und Paris (Paris). Sie beschäftigten sich in ihrer Arbeit „Was tat die Meldegängerin?“ mit dem (polnischen) Bildgedächtnis und ganz allgemein mit dem Begriff der Rekonstruktion historischer Ereignisse. Sie nahmen die ikonisch gewordenen Zeitungsphotos vom Warschauer Aufstand und montierten anstelle der Gesichter echter Melderinnen Bilder von Anita Ekberg, Sophia Loren, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot und anderen Filmstars hinein. Die Pin-up- und Spind-Ästhetik soll eine Verbindung zwischen Eros und Krieg herstellen. Darek Foks meinte, es müsse in einer Kriegserzählung immer auch eine Liebesgeschichte geben. Wenn man attraktive Frauen hineinnehme, würden sich die Leser eher für die Geschichte des Warschauer Aufstands interessieren. Auch Wajda tat dies in gewisser Weise, indem er für seinen „Kanal“ besonders „schöne Melderinnen“ engagierte und eine sogar die Hauptrolle spielen ließ.
.
2002 organisierte das polnische Kulturinstitut in Berlin erstmalig ein polnisches Filmfestival. Nicht nur ein Film befaßte sich dort mit polnischen Jugendlichen in Plattenbausiedlungen, die sich auf ein Leben im Untergrund einstellen. Der Schriftsteller Krzysztof Maria Zaluski meinte: „Wir lieben das Illegale!“ Ich verstand ihn so: Weil der Staat Polen immer mal wieder wie auf Rädern hin- und hergeschoben oder sogar ganz aufgelöst wurde – und dann nur noch in der Illegalität existierte, wo es ganz genaue Anweisungen gab, wer, wann, wie mit dem Feindsystem kollaborieren durfte – deswegen ist der Sartresche Existenzialismus nur die Pariser Haute Couturisation des polnischen Realismus. Die Illegalität wird dabei fast zu einem Synonym für „freies Leben“. Sartre sagte es folgendermaßen: „Nie waren wir freier als unter der deutschen Besatzung.“
.
2009 leitete die Ethnologin Stefanie Peter an der FU ein Seminar über den polnischen Untergrund. Damals gab es bereits die ersten Anzeichen, dass man die schlesischen Bergwerke, deren Schließung so gut wie angeordnet war, einer anderen Funktion zuführen würde: als eine Art viertes Warschau – für den Notfall, wobei man die Stollen bis dahin als Kneipen, „Show-Rooms“, Versammlungssäle und touristische Attraktionen sowie zur grubenarchäologischen Forschung nutzen wollte. Das Seminar an der FU beschäftigte sich jedoch erst einmal nur mit den zurückliegenden Ernstfällen in der polnischen Geschichte. Derweil erfuhren wir von Jana Barkowski, einer Studentin an der neuen „Viadrina“, der Universität in Frankfurt/Oder und Slubice (auf der rechten Flußseite), was sich inzwischen an der Oberfläche tat: „Neulich sagte der BWL-Professor zu uns: ,Wenn ich andern Gutes tue, tu ich mir selbst nichts Gutes…‘ Und das haben alle brav mitgeschrieben!“
.
Die amerikanische Touristiktrendforscherin Faith Popcorn meint laut taz, dass sich „Reisende zukünftig nach neuen, immer extremeren Erlebnissen sehnen“. Die Architektur von Luxushotels muß dem Rechnung tragen und wird sich „dramatisch verändern“. Als Beispiel dafür erwähnt die taz „das InterContinental Songjiang Quarry Hotel in China. Es wird derzeit in einem 90 Meter tiefen Steinbruch umweltfreundlich mit Solarenergie und Geothermie gebaut. Unterwasserzimmer inklusive.“ Da haben wir also schon mal eine Synthese von Unter-Wasser- und Unter-Tage-Bergbau – und das rein als Touristenattraktion!
.

Gemälde von Waldemar Pieczko: Kattowice
.
Nach der Pressereise durch Oberschlesien auf der Straße technischer Kulturdenkmäler, fand eine Gruppenreise durch Niederschlesien statt, die von „taz-reisen“ organisiert worden war und vor allem soziale und künstlerische „Ankerpunkte“ hatte. Unser Basislager befand sich im Dreiländereck in Zittau, wo sich gleich hinter der Stadt der riesige Braunkohle-Tagebau Turow auf polnischer Seite ausbreitet; den Tagebau auf der deutschen Seite hat man vor einigen Jahren stillgelegt, wobei man auch dort einiges an Großgerät musealisierte. Im nahen Görlitz besuchten wir das „Schlesische Museum“; auf der polnischen Seite, in Zgorzelec, entdeckten wir danach am Ufer der Neiße einen Gedenkstein, mit dem darauf hingewiesen wurde, dass dort einige hundert Griechen Exil fanden, nachdem ihr kommunistischer Aufstand 1949 mit Hilfe der Engländer niedergeschlagen worden war. Auf der deutschen Seite hatten sich nach dem Krieg 40.000 Vertriebene bzw. Flüchtlinge aus Schlesien angesiedelt. Als nächstes ging es in Richtung Riesengebirge in den sanierten Kurort Bad Warmbrunn (Cieplice), der heute Ortsteil von Jelenia Gora (Hirschberg) ist. Dort besichtigten wir im „Langen Haus“ das Naturkundemuseum, in dem sich die Reste der üppigen Sammlungen des Grafen Schaffgotsch befinden. Er sammelte so ziemlich alles, vor allem auch Bücher, ähnlich wie der Schriftsteller Guntram Vesper, nur hatte er als Gruben- und Fabrikbesitzer mehr Geld dafür. Bis 1945 befand sich der gesamte schlesische Teil des Riesengebirges wie auch des Isergebirges im Besitz der Familie Schaffgotsch.
.
Von Cieplice ging es durchs Hirschberger Tal nach Agnetendorf (Jagniatkow), wo Gerhart Hauptmann sich eine seiner Villen bauen ließ, heute ist es ein Museum. Um Hauptmann herum entstand dort eine Künstlerkolonie – bis 1945, die heute neu entsteht, unter anderem im nahen Szklarska Poreba (Schreiberhau), wo den Künstlern ein weiteres Haus von Hauptmann als Galerie zur Verfügung steht, auch das kuckten wir uns an.
.
Es war ja eine Dreiländertour, die deswegen auch noch in die tschechische Republik führte. In Böhmen wartete auf uns eine linke Aktivistin des Netzwerks „Antikomplex“, die uns in Liberec (Reichenberg) etwas über die Vertreibung/Umsiedlung der Sudetendeutschen und die Ansiedlung von Roma im Grenzgebiet erzählte, während wir den Stadtberg hinaufkurvten, auf dessen Spitze sich ein Hotel mit Wetterwarte befindet. Ab da war ich für den Rest der Böhmenstrecke selbst zuständig, wobei ich mich in den letzten Jahren so viel mit tschechischer Geschichte und Literatur beschäftigt hatte, dass ich mir das zutraute. Wenn sich nicht gerade ein Besserwisser in der Reisegruppe befand. An der Elbe nahmen wir noch die Barockstadt Decin (Teschen) mit und dort einen Imbiß ein.
.
In der Lausitz stand u.a. das Völkerkundemuseum der Brüdergemeine in Herrnhut auf dem Programm. Die Herrnguter gehen zurück auf die „Böhmischen“ und „Mährischen Brüder“ und diese auf „Hussiten“, die 100 Jahre vor Luther die Reformation einleiteten, wobei sie geschickter als Thomas Müntzer und Florian Geyer waren, indem es ihnen gelang, mit ihrer modernen bäuerlichen, an die ukrainische Machnobewegung erinnernden Kriegstechnik, fünf mit Söldnern kämpfende Kreuzzüge des Adels und der Päpste zu schlagen. Während in Deutschland die Hussiten als so etwas wie Terroristen begriffen werden, werden sie in Tschechien verehrt, ihrem Feldherrn Jan Zizka errichtete man in Prag das größte Reiterdenkmal der Welt, der in Konstanz verbrannte Jan Hus bekam ein Denkmal auf dem Wenzelsplatz. Auf dem Sockel steht sein letzter Satz „Die Wahrheit wird obsiegen“. Dies Motto steht auch auf dem Banner des Präsidenten der Republik.
.
Neben den Herrnhutern sollte auch noch den Sorben in Bautzen die nötige Aufmerksamkeit gewidmet werden, die unter Bismarck und Hitler diskriminiert und drangsaliert wurden und nun aus ihren Dörfern vertrieben werden, weil diese dem Braunkohleabbau weichen müssen. In Bautzen besuchten wir das „Sorbische Museum“. Wir hatten dort eine wunderbare Führerin, die uns die sorbische Geschichte und Kultur mit einer halb-melancholisch halb-ironisch gefärbten Stimme nahe brachte.
.
Bei all diesen „Topoi“ wurde mir langsam klar, dass das „Dreiländereck“ seit mindestens 600 Jahren eine Region der Flüchtlinge, Umsiedler und Auswanderer ist – und also quasi brandaktuell. Ständig wurden dort irgendwelche Religionsanhänger, Ethnien und Nationalitäten hin und hergeschoben. Die Polen, Tschechen und Deutschen sind sich nach den letzten großen Verschiebungen noch immer nicht grün, obwohl man sie zu einer „Euroregion“ zusammenpackte. Jahrhundertelang haben sich die Deutschen dort als Herrenvolk aufgespielt, nun kommen sie den Polen und Tschechen plötzlich als „moralische Großmacht“.
.
Seit etwa 18 Jahren gibt es einen Exodus von Roma aus der Slowakei nach Böhmen und einen von tschechischen Roma ins westliche Ausland, weil der Rassismus – Rechtsradikalismus – z.B. in Usti nad Labem (Aussig) – zunimmt, ebenso der in Dresden – gegenüber Flüchtlingen. In Dresden endete die Tour. Sie nannte sich „Reise in die Zivilgesellschaft“, was ich etwas übertrieben fand. Eine knappe Mehrheit der 18 Teilnehmer an der Reise fand hingegen, ich hätte mehr erklären sollen – mindestens zwischen den Etappenzielen im Bus. Ich war von mir ausgegangen, der Gerede über Lautsprecher nur in homöopathischen Dosen ertragen kann.
.
Lesen und schreiben ist jedenfalls leiser: Für das Hirschberger Tal in Niederschlesien hatten mich zwei Mitarbeiterinnen des Kreuzberg-Museums, die dort einen zweiten Wohnsitz haben, mit drei je ein Kilo schweren Katalogen ausgerüstet. Darin fand sich allerdings nur wenig über den schlesischen Bergbau, dafür viel über die Künstlerkolonie und die Schlösser und Herrenhäuser des schlesischen Adels, dem die Bergwerke und die Industrie zum großen Teil gehörte.
.
1937 erschien eine sozialkritische Erzählung über oberschlesische Bergarbeiter: „Die Front unter Tage“ vom schlesischen Arbeiterschriftsteller Josef Wiessalla, geboren 1898, gestorben im März 1945 bei den Kämpfen um Breslau. 1919-21 war er in Oberschlesien „Grenzschutzkämpfer gegen aufständische Polen“, dann Mitglied des „Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller.“ Er veröffentlichte seine Geschichten zunächst in der Zeitschrift „Der Oberschlesier“.
.
In der Vertriebenzeitung „Unser Oberschlesien“, die seit 2005 „Oberschlesien“ heißt, publizierte der oberschlesische Literaturhistoriker Arno Lubos in der Ausgabe 8/2005 einen Artikel über Leben und Werk des „überzeugten Deutschen“ Josef Wiessalla. Es gab nach 1900 auch eine polnische Zeitschrift „Gornoslazak“ (Der Oberschlesier), die der polnische Politiker Adalbert Korfanty gegründet hatte, daneben auch noch die „Oberschlesische Grenzzeitung“ auf Deutsch von ihm sowie einige zweisprachige Blätter. Bei der Volksabstimmung 1921 war er der polnische Plebiszit-Kommissar für Oberschlesien. Er versprach allen, die bleiben würden und für Polen stimmten „eine Kuh und Ackerland“, am Ende wurde daraus jedoch „nur eine Ziege für die armen Häusler – die ‚Korfantykuh‘ genannt wurde.“ Schon bei den Sejmwahlen 1928 trat die Regierungspartei mit der Parole „Kampf gegen das Deutschtum“ an, dem fiel dann u.a. der „Versöhnler“ und „Separatist“ Korfanty zum Opfer, weil er zuletzt die Autonomie für Oberschlesien wollte – er ging ins Exil. Für seine Forderung sprach Einiges. 1961 erinnerte sich der seit 1938 im norwegischen Exil gebliebene Literaturwissenschaftler Max Tau, der in Beuthen (Bytom) aufwuchs: „In meiner Heimat sollte die Volksabstimmung vorbereitet werden. Ein Fanatiker, Wojciech Korfanty, der für die polnische Seite schreiend Propaganda machte, schreckte vor nichts zurück.“ Max Tau gelangte dann aber durch die Recherchen des Schriftstellers Horst Bienek zu einem anderen Korfanty-Bild. Bis die Polen am 22.6. 1922 in das ihnen zugeteilte Gebiet einmarschierten, hatte Bieneks Familie in Lublinitz, das fortan Lubliniec hieß, gewohnt, danach waren sie nach Gleiwitz gezogen, das dann bis 1939 Grenzstadt war.
.
Das Ziegengeschenk wiederholte sich in Polen Ende der Neunzigerjahre. Dort hatte die EU und die polnische Regierung den Kleinbauern versprochen, keinem werden es nach dem EU-Beitritt Polens mit den üppigen Agrarsubventionen schlechter gehen als vorher. Dabei hatte man in Brüssel quasi eingeplant, dass von 4 Millionen polnischen Kleinbauern mindestens die Hälfte ihre Landwirtschaft aufgeben müsse. Wo es wegen der Auflösung der staatlichen Güter in bestimmten Gegenden besonders viele Arbeitslose auf dem Land gab, die langsam verelendeten, initiierte die Akademie für Landwirtschaft 2008 ein Pilotprojekt: Ziegen anstelle von Sozialhilfe – unter wissenschaftlicher und filmischer Begleitung. Und so lebten dann einige der neuen Landarmen fortan mit Ziegen. Einer nahm seine sogar mit in die Kneipe. Der Film lief in Berlin auf dem Polnischen Filmfestival.
.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sprachen viele Deutsche in Schlesien polnisch, aber nur wenige Polen dort Deutsch. Heute ist es genau umgekehrt. Als nach der auf die Abstimmung folgenden Teilung Gleiwitz zur deutschen Grenzstadt geworden war (so wie seit 1945 das halbe Görlitz), zogen rund 7000 Schlesier aus dem deutsch gewordenen Teil in den polnischen, und umgekehrt zogen viele aus dem polnischen Teil u.a. nach Gleiwitz, wo sie in „Flüchtlingsbaracken“ unterkamen (nicht wenige sprachen „ausschließlich wasserpolnisch, nur die Jüngeren radebrechten deutsch“), der polnische Adel übernahm die Güter der deutschen Adligen, der dafür von der Reichsregierung erst „entschädigt“ wurde und sie dann 1939 im Gefolge der Wehrmacht wieder in Besitz nahm. Einige hatten bereits im Gleiwitzer Hotel „Haus Oberschlesien“ auf den „Ausbruch des Krieges gewartet, um ihre Ländereien wieder zu holen.“1945 hatten sie dann aber erneut „alles“ verloren – und dafür dann noch einmal auf Entschädigung gedrängt – diesmal bei der Bundesregierung.
.
Schon eine Zeit vor der „Gleiwitz-Lüge“, mit der man einen Vorwand für den „Polenfeldzug“ schaffte, wurde alles Polnische geächtet, in den Straßenbahnen hingen Schilder „Hier wird nur Deutsch gesprochen“, in den Schulen wurde der Unterricht auf Deutsch abgehalten, viele ließen ihre polnisch klingenden Namen eindeutschen und in Gleiwitz wurden etliche Straßen umbenannt.
.
Die heutige Zeitschrift „Oberschlesien“ erscheint einmal monatlich im deutschen Teil von Görlitz, es gibt daneben aber auch schon wieder einen polnischen Verlagsort: St. Annaberg – mit Beilagen und Lokalteilen für die „Heimatkreise Kattowitz, Königshütte, Gleiwitz, Hindenburg OS, Beuthen, Oppeln, Schwientochlowitz und Laurahütte“. Es ist ein Revanchistenorgan, und es gibt auch wieder etliche Deutsche, die sich dort im Gebirge auf polnischer und tschechischer Seite eingraben – und z.T. auch schon wieder eine große Fresse riskieren. Auf der tschechischen Seite des Erzgebirges verlangten sie in einem Dorf sogar eine deutsche Selbstverwaltung.
.
Arno Lubos faßt die Handlung von Wiessallas Bergarbeitergeschichte „Die Front unter Tage“ in der Zeitschrift „Oberschlesien“ so zusammen: „Es ist die dramatische Ballade von der Arbeitsschlacht und dem Todeskampf des Bergmanns, eine Ballade der Kameradschaft und ein Affront gegen die industriellen Herren, denen das Menschenleben nicht so schwer wiegt wie ihr Kapital. In 800 Meter Tiefe werden 17 Bergleute von einem Gebirgsschlag verschüttet, davon 7 gerettet…“ Die Geschichte endet damit, dass der Protagonist Prohaska, ein alter Häuer, in die Barbara-Kapelle auf dem Zechengelände geht und ein Dankesgebet spricht. „Schon als Katholik war man benachteiligt, Katholiken waren nur die Armen. Die Lehrer und Beamte kamen aus Preußen und waren Protestanten.“ In Schlesien wird auch heute noch viel gebetet, es wurden viele neue, z.T. riesige Kirchen ab den Neunzigerjahren gebaut und die Priester sind auch wieder obenauf.
.
Der Beuthener Schriftsteller Max Tau schrieb über den Anlaß zu dem Drama: „In meiner Heimatstadt Beuthen geschah ein schweres Grubenunglück. Als ich in den Zeitungen darüber las, hörte ich den Schrei der Sirenen, und ich sah die Gesichter der Menschen, die vor dem Gitter auf die Botschaft des Lebens oder des Todes warteten. Ich telegrafierte Josef Wiessalla, seine Zeit sei gekommen.“ Von da an las Tau „die Zeitungen mit anderen Augen. Überall, wo ein Grubenunglück geschah, fühlte ich mich mitschuldig.“ Heute stürzen wegen des einstigen Bergbaus reihenweise die Häuser in Bytom (Beuthen) ein. Tau zog bald nach Berlin und wurde dort später Cheflektor des Bruno-Cassirer-Verlags, 1938 floh er als Jude nach Oslo, 1944 wurde ihm in London durch die norwegische Exilregierung die norwegische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Außer ihm erhielt sie nur noch Willy Brandt. 1945 kehrte Max Tau nach Oslo zurück und arbeitete bis zum Lebensende dort weiter als Verlags-Lektor. 1961 veröffentlichte er wie o.e.: „Das Land das ich verlassen mußte“. Seine Darstellung beginnt mit Beuthen, wo es ihn in jungen Jahren „immer wieder zum Feuer der Schmelzöfen“ hinzog, „Eines Tages durfte ich einem Freund, der seinem Vater das Essen zur Grube brachte, in den Vorraum folgen. Er nannte den Namen seines Vaters, der Aufseher schaute auf eine Tafel und sagte: ‚Nummer 351‘. Ich konnte nicht verstehen, dass ein Mensch nur eine Nummer sein sollte. Mein Freund klärte mich auf: Jeder, der in die Grube einfährt, bekommt eine Nummer, und man weiß dann ganz genau, wo er sich befindet, nach der Ausfahrt muß er diese Nummer abgeben. Aber ich konnte trotz dieser Erklärung nicht so bald wieder froh werden“ – erst als er sich in die Literatur stürzte.
.
Einer der Teilnehmer am „forum untertage“ der Grubenarchäologischen Gesellschaft in Stendal erwähnt einen Bergarbeiterroman aus Beuthen: „Meine Jugend“ (1947) von Hans Marchwitza, dessen Vater schon Bergarbeiter in Beuthen war. Bereits mit 14 Jahren war Marchwitza 1904 selbst unter Tage tätig, heißt es auf Wikipedia, und weiter: „1910 ließ er sich als Bergarbeiter ins Ruhrgebiet anwerben. Doch schon zwei Jahre später wurde er wegen der Teilnahme an einem Streik arbeitslos. Bis er 1915 zum Militär eingezogen wurde, verdiente sich Marchwitza seinen Lebensunterhalt als Hilfsarbeiter. Bis 1918 diente er als Soldat an der Westfront. Aus dem Krieg zurückgekehrt, wurde er noch im selben Jahr Mitglied der Soldatenratswehr.
.
1919 schloss sich Marchwitza der USPD an. Im darauf folgenden Jahr kämpfte er als Zugführer der Roten Ruhr-Armee gegen Kapp-Putsch, Freikorps und Reichswehr. 1920 trat er auch in die KPD ein. Inzwischen war er als Streikteilnehmer wieder arbeitslos geworden. In diese Zeit fallen auch seine ersten schriftstellerischen Versuche. Alexander Abusch, ein Redakteur beim Ruhr-Echo, unterstützte und förderte Marchwitza und veröffentlichte dessen erste Arbeiten. Ab 1924 konnte Marchwitza in den kommunistischen Zeitungen Rote Fahne und Rote Front ebenfalls veröffentlichen.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg machte er Karriere in der DDR, u.a. gründete er 1950 die Akademie der Künste mit. Er starb 1965, sein Grab befindet sich auf dem „Sozialistenfriedhof“ in Friedrichsfelde.
.
Gleiwitz/Gliwice
Über die Bücher des in der Beuthener Nachbarstadt Gleiwitz aufgewachsenen Schriftstellers Horst Bienek, mit dem Max Tau ebenfalls korrespondierte, schrieb er: „Kein Dichter seiner Generation beschreibt so eindringlich, was diese Generation erlebt, erfahren und erlitten hat. Ich scheue mich nicht, den Zyklus ‚Gleiwitzer Kindheit‘ als eine der großen Schöpfungen heutiger Dichtung zu bezeichnen…Das ist die Chronik Oberschlesiens und zugleich das Requiem für eine verlorene Provinz.“
.
Wiessallas Bergarbeiter-Ballade, die dieser aus dem Beuthener Grubenunglück machte, konnte ich lange nicht käuflich erwerben, laut der Zeitschrift „Oberschlesien“ sollte es noch etliche Exemplare in den Antiquariaten von Görlitz geben. Dort haben die westdeutschen Schlesier sich nach der Wende der barocken Stadtmitte bemächtigt, sie mit Kamelhaarpinseln renovieren lassen (von polnischen Arbeitern?!), mit einem besonders üppigen Schlesien-Museum getoppt und nun geben sie sich dort als wohlhabende Pensionäre der Kultur hin – während drumherum in den Plattenbautensiedlungen die arbeitslosen Neonazis tanzen.
.
2014 fanden in Görlitz „Literaturtage an der Neiße“ statt, im Görlitzer „Gerhart Hauptmann Theater“. Dazu heißt es im „Silesia Newsletter“ des Schlesischen Museums zu Görlitz: „Ob Literatur wirklich verbindet, darüber sprachen Olga Tokarczuk und Christoph Hein – Gäste der Eröffnung der Literaturtage. Beide Autoren stammen aus Schlesien, auch wenn die eine Polin und der andere Deutsche ist. Sie und er beschäftigen sich mit der Thematik der Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg, die sie persönlich berührt: Christoph Hein verließ Schlesien als Kind, die Familie von Olga Tokarczuk kam aus Ostpolen nach Schlesien. Die Lesung unter dem Titel ‚Doppelte Landnahme‘ wurde von Dr. Andreas Kossert – wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung – moderiert.“
.
Olga Tokarczuk wurde 1962 in Zielona Gora (Grünberg) geboren und war nach einem Psychologie-Studium in Warschau ab 1986 als Psychotherapeutin in Waldenburg/Walbrzych tätig (wo nun die drei Romane der Philosophin Joanna Bator spielen). Heute lebt sie bei dem nicht weit entfernten Ort Nowa Ruda (Neurode) in einem Grenzdorf, vielleicht in Pietno?, wo man Samstags die Musik der Diskothek aus dem tschechischen Ort Sonow hören kann. Ihrem Buch „Taghaus, Nachthaus“ zufolge sitzt sie oft mit ihrer Nachbarin Marta zusammen, und hilft ihr z.B. beim Erbsen pulen, wenn man jedoch ihrem letzten Buch „Unrast“ folgt, dann ist sie eigentlich ständig unterwegs, also kaum zu Hause in Niederschlesien.
.
„In Tokarczuks Roman ‚Taghaus Nachthaus‘ (2001) geht es um Polen in Schlesien, die in Häusern leben, wo die Geister der vertriebenen Deutschen spuken,“ heißt es in einer BRD-Rezension. Ich habe davon nichts gefunden in ihrem Buch, das aus kleinen Stücken – Alltags-Einfällen – besteht, wobei die Autorin immer wieder auf Pilze zu sprechen kommt, einschließlich Pilzrezepte. „Wir bekamen Besuch von Bekannten aus Walbrzych, und ich kochte Pilze für sie.“ Daneben hat sie es mit Träumen, schreibt sogar aus dem Internet gefischte Träume von Unbekannten auf. Statt der deutschen „Geister“ spukten vielen in Schlesien ansässig gewordenen Polen deutsche „Schätze“ im Kopf herum. Olga Tokarczuk schreibt: „Manchmal kam es vor, dass jemand beim Aufräumen des Kellers oder beim Umgraben im Garten etwas Besonderes fand. Eine Holzkiste voller Porzellan oder ein Glas mit Münzen oder ein in Wachstuch gewickeltes versilbertes Besteck. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Dorf, und bald träumte jeder davon, einen Schatz zu finden, den die Deutschen hinterlassen hatten.“
.
Im Frühsommer tauchten bei ihr in der Gegend neuerlich die Deutschen auf, die meisten waren weißhaarig. Sie „ergossen sich aus Autobussen, die verstohlen auf Seitenwegen stehenblieben, um nicht auszufallen. Sie gingen in kleinen Gruppen oder Paaren, meistens in Paaren.“ (Ich habe einen Film von einer Regisseurin, die solch einen Reisebus mit alten „Schlesierdeutschen“ begleitet hat, den zeigte ich der „Dreiländereck“-Reisegruppe in unserem Zittauer Hotel – unserem Basislager, von wo aus wir morgens in die drei Länder – Niederschlesien, Nordböhmen und Oberlausitz aufbrachen.) „Wo die Deutschen auch hingingen, am Ende fanden sie sich immer vor dem Laden wieder, wo kleine Kinder sie erwarteten und die Hände um Bonbons ausstreckten. Das empörte manche, und es wurde immer ein wenig ungemütlich.“ Die Erwachsenen fühlten sich „in solchen Momenten sogar als Polen“. Ähnlich unangenehm war es, wenn man die Deutschen zu einem Tee ins Haus einlud „und sie uns ein paar Mark in die Hand drücken wollten.“
.
Die Siedlung Pietno, nordwestlich von Nowa Ruda, gehörte dem Graf von Goetzen, dessen letzte Sprösslinge sich 1945 nach Bayern absetzten. Berühmt berüchtigt wurde Gustav Adolf von Goetzen – als Gouverneur von Deutsch-Ostafrika. 1905 kam es dort zum „Maji-Maji-Aufstand, den er blutig niederschlagen ließ, wobei über 100.000 Aufständische ums Leben gekommen sein sollen. 1913 wurde wegen dieser „Heldentat“ ein Dampfschiff nach ihm benannt, die heutige Liemba. Sie wurde laut Wikipedia in der Papenburger Meyer-Werft gebaut und auf den Namen Goetzen getauft. Anschließend wurde sie in Einzelteile zerlegt und am Tanganjikasee in Afrika wieder zusammengesetzt. Sie wurde zwischenzeitlich versenkt, wieder gehoben und verkehrt heute noch auf dem See. Olga Tokarczuk erwähnt ein paar Mal das Schloß der Familie von Goetzen.
.
2007 veröffentlichte Olga Tokarczuk nebenbeibemerkt einen Roman, in dem ihr der (polnische) Untergrund zu (römisch-katholischen) Katakomben wurde: Ihre Heldin „steigt hinunter, ganz hinunter, unter die Stadt, wo in Dunkelheit und Feuchtigkeit ihre Zwillingsschwester über die Toten herrscht. Niemand kehrt von dort zurück, aber mit Hilfe ihrer ergebenen Dienerin und Freundin, der Väter, der Mutter und des Ehemanns, der sich – unfreiwillig – opfern muss, gelingt es, Inanna wieder ins Reich der Lebenden zurückzuholen, die sie, ein spezieller Dreh Tokarczuks, nicht einmal vermisst haben,“ schreibt „deutschlandradiokultur.de“ in einer Rezension.
.
In ihrem „Tierschützerroman“, wie die FAZ Tokarczuks „Gesang der Fledermäuse“ (2011) nennt, schreibt sie an einer Stelle: „Plötzlich war mir klar, warum die Hochsitze, die doch mehr an die Wachtürme eines Konzentrationslagers erinnern, Kanzeln genannt werden. Auf einer Kanzel stellt sich ein Mensch über die anderen Lebewesen und erteilt sich selbst die Macht über ihr Leben und ihren Tod.“ Auch hier geht es um eine eigenwillige Frau, eine ältere alleinstehende Brückenbauingenieurin, in einem niederschlesischen Dorf. Mit der neuen polnischen Regierung hat es Olga Tokarczuk nicht leicht: Als sie 2016 in das polnische Institut nach New York eingeladen wurde, strich man der Autorin kurzerhand die Reisekosten, ebenso einem Historiker: Solche eigenwilligen, kritischen Stimmen sollen nicht mehr das Polenbild im Ausland bestimmen.
.
Christoph Hein wurde 1944 im niederschlesischen Heinzendorf (Jasienica) geboren und nach dem Krieg mit seiner Familie „umgesiedelt“ (nach der Wende benutzte er auch gelegentlich das Wort „vertrieben“). Sie kamen nach Bad Düben bei Leipzig; eine Kleinstadt (mit heute 8000 Einwohnern) am rechten Ufer der Mulde, einem sächsischen Nebenfluß der Elbe, der aus dem Zusammenfluß der Zwickauer und der Freiberger Mulde entstand und entsteht. Heins Roman „Landnahmen“ handelt von einer Familie, die 1950 aus Breslau in eine Kleinstadt an der Mulde umgesiedelt wird. Der Mann ist Tischler, hat aber nur einen Arm. Als „Deutscher“ in sowjetischer Kriegsgefangenschaft hatte er „in einem Straflager bei Perm im Ural unter Tage arbeiten müssen,“ wo bei einem Unfall sein linker Arm zerschmettert wurde. Die Familie hat es nicht leicht als dem Ort zugewiesene Vertriebene; der Vater bekommt als fremder Tischler und zudem Einarmiger, nur wenig Aufträge, man zündet ihm seine Werkstatt an und seinem noch in Breslau aufgewachsenen Sohn erdrosselt man den Hund. Dieser zieht später einige Zeit als Karusselbesitzer durch die DDR, bringt es dann aber zur größten Tischlerei im Ort und spricht nach der Wende als Unternehmer ein noch gewichtigeres Wort als zuvor schon in der Lokalpolitik mit. Erzählt wird seine Geschichte aus den Erinnerungen einer Handvoll von Leuten, die ihn mehr oder weniger lange gekannt haben, wobei sie ausführlich auch über sich erzählen.
.
Im Newsletter des Schlesischen Museums heißt es: „Christoph Hein stellte seinen Roman ‚Landnahme‘ vor. Er handelt von einem Jungen, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie seine Heimat verlassen musste. Allein, ohne Freunde, ohne eigene Wohnung wird er von den neuen Schulkameraden verspottet; ein Deutscher aus Schlesien, ‚Polacke‘ in einem fremden Land. Ein Junge, der aus Wrocław kommt, obwohl er in Breslau geboren wurde. Christoph Hein beschreibt das Schicksal der Vertriebenen ohne Pathos, sondern als eine Geschichte eines durchschnittlichen Menschen.
.
Olga Tokarczuk erzählt in ihrem Essay ‚Das Schneewittchen-Syndrom und Andere niederschlesische Träume‘ über ihre ‚kleine Heimat‘, die Schlesien ist. In ihrem Werk beschäftigt sie sich mit der Frage der Identität. Sie versucht ihre Heimat als das Einzugsgebiet der Oder zu definieren. Sie berührt die Thematik der Vertreibung, aber aus einer anderen Perspektive als Christoph Hein. Sie beschreibt die Geschichte eines Mädchens, das in ein fremdes Land umgesiedelt wurde und sich mit der neuen Wirklichkeit konfrontieren musste.“
.

.
Das selbe „Thema“ bzw. Bewegungsschema behandelt auch der Roman „Katzenberge“ (2012) von Sabrina Janesch: Hier ist es der Großvater der Icherzählerin, der von den Sowjets zusammen mit 12 anderen Bauern aus ihrem polnischen Dorf Zdzary Wielki (das dann ein ukrainisches Dorf namens Zastavne war) vertrieben und schließlich in einem niederschlesischen Dorf bei Obernigk wiederangesiedelt wurden, wo sie fortan die Höfe der Deutschen bewirtschafteten. „Großvater sagte, die Überquerung des Bug sei die einzige Rettung gewesen. Östlich von seinen Ufern sei alles, was Polnisch sprach, Freiwild gewesen.“ Von dort gelangten sie nach Schlesien. Hier ließ der Großvater später seine Tochter [die Mutter der Icherzählerin] im Gegensatz zu ihren Brüdern studieren, unter der Bedingung, „dass er mit ihr studieren“ könne.
.
Auch in diesem Schlesienroman sind die Bücher ein Ausweg. Auf seiner Beerdigung sagt einer der Brüder des Großvaters zur Enkelin, „in mir habe alles zusammengefunden: das galizische Blut meiner Großeltern, die kommen mußten, und das deutsche Blut der väterlichen Familie, die gehen mußte.“ Sabrina Janesch ist „halb Deutsche halb Polin“, wie ihr Verlag schreibt, sie wurde 1985 in der Lüneburger Heide geboren, studierte in Hildesheim und in Krakau und lebt heute in Münster, u.a. war sie Stadtschreiberin von Gdansk (Danzig). In ihrem Roman fährt sie nach der Beerdigung des Großvaters in sein ukrainisches Dorf. „Diesmal nicht nur als Halb-Deutsche in Polen, sondern als Halb-Polin nach Galizien.“ Ihr Begleiter rät ihr, besser nicht polnisch zu reden. „Die Leute würden dort nach wie vor keine Polen mögen.“ Das ukrainische Dorf grenzte ebenfalls an einen Wald, aber „dieser hier war der große Bruder des Waldes in Schlesien.“ Was dem Großvater in Schlesien als erstes in den Höfen des neuen Dorfes aufgefallen war: In Galizien baute man zuerst den Ofen und dann das Haus quasi drum herum, in Schlesien war es umgekehrt. Es hing ein Fluch über dem Ort, aber die Großeltern wissen noch genug heidnische Praktiken, um die Geister zu bannen, „irgendwann haben wir uns zu Hause gefühlt.“ Im Roman spukt es allerdings ein bißchen zu viel. „Irgendetwas hatte den Krähen die Kehlen durchgebissen.“ Die Ich-Erzählerin wird wiederholt „Gänseblümchen“ genannt – so hieß auch die Heldin, eine Meldegängerin, in Wajdas Film „Der Kanal“ mit Decknamen. Sabrina Janesch ist insofern auch eine Meldegängerin, weil sie von hier nach da und dort berichtet, aus Galizien kann sie der Familie in Schlesien und ihrer Mutter in der Lüneburger Heide wahrheitsgemäß mitteilen, dass der dunkle Fleck in der Biographie des Großvaters aufgeklärt ist: Er steht jetzt in unserer Erinnerung ohne einen „Verdacht“ noch besser da als früher.
.
Eher das Umgekehrte kennzeichnet die noch wahrere Geschichte von Kolja Mensings Großvater, die er in seinem Buch „Die Legenden der Väter“ (2011) erzählt hat: Sein polnischer Großvater Josef Kozlik arbeitete als Zugabfertiger im oberschlesischen Industriegebiet und lebte in Lubliniec. Die Deutschen stuften ihn als Fast-Deutschen ein und ließen ihn erst weiter bei der Eisenbahn arbeiten, schickten ihn aber dann als Soldat an die Westfront. In Frankreich desertierte er angeblich und schloß sich der den Engländern unterstellten polnischen Armee an, mit der er mehrere Heldentaten beging. 1945 kam er als Besatzungssoldat mit der norddeutschen Tischlertochter Marianne in Kontakt, mit der er ein uneheliches Kind zeugte: Kolja Mensings Vater. Sein Sohn, Kolja, hat seinen Großvater nie kennengelernt, er war früh gestorben. Auch Mensings Vater traf ihn nur ein einziges Mal, aber sie korrespondierten all die Jahre miteinander.
.
Der 1971 im Oldenburgischen geborene Kolja Mensing, begann seine Großvater-Recherche anläßlich eines Stipendiums in Krakau, von dort fuhr er nach Lubliniec, wo die Schwester seines Großvaters ihn empfing und mit Erinnerungen an ihren gestorbenen Bruder bewirtete. Verkompliziert wurde Kolja Mensings auch finanziell umfangreiche Großvater-Vater-Recherche dadurch, dass er aus den Erzählungen seines Vaters über Josef Kozlik, Koljas Großvater, und dessen erhalten gebliebenen Briefen ein ganz anderes Bild von ihm hatte. Josef Kozlik war ein Aufschneider, kam mehrmals ins Gefängnis, trank unmäßig und starb kläglich. Auch der Ort, Fürstenau, wo der Vater mit seiner cholerischer Mutter, Marianne, aufgewachsen war, veränderte sich für den Autor, der aus den väterlichen Erzählungen ein ganz anderes Bild vom Ort gehabt hatte. Kennengelernt hatte Marianne Josef Kozlik in einem Teil des Emslandes, das im Englischen Sektor unter polnischer Verwaltung stand, wo er eine große Nummer war und alles besorgen konnte. „Josef hat Talent für den Schwarzmarkt.“ (Er muß das in unmittelbarer Nähe gelegene Gefangenenlager für die polnischen Kämpferinnen aus dem Warschauer Aufstand gekannt haben, über das der Papenburger Filmemacher Paul Meyer 2006 einen Film drehte.) Als jedoch alle Heirats- und Berufspläne von Josef Kozlik nach dem Abzug der Polen aus dem Emsland scheitern, geht er 1951 zurück nach Schlesien, wo ihm Selbstbild und Wirklichkeit immer mehr auseinanderklaffen. Das begann bereits damit, dass er zunächst für 14 Monate ins Gefängnis kam, „weil er als ehemaliger Angehöriger der Exilarmee im neuen Polen als Verräter galt…Nach seiner Entlassung bemühte er sich, die Rolle, die die kommunistischen Machthaber für ihn vorgesehen hatten, auch auszufüllen.“ Aber sein Spielraum beschränkte sich zunehmend auf Hilfsarbeiter-Anstellungen, und dann mußte er immer wieder ins Krankenhaus. Kolja Mensings Recherchen führen bis zu Josefs Vater, Augustyn Kozlik, er war Bergarbeiter in der Michal-Zeche von Siemianowitz (Siemianowice) gewesen, nicht weit von Beuthen (Bytom) entfernt, die 1939 von Deutschen besetzt worden war. Am Schluß bedankt der Autor sich u.a. bei Jan Rydel, dessen geschichtswissenschaftliche Arbeit „Die polnische Besatzung im Emsland 1945 bis 1948“, erschienen im fibre Verlag Osnabrück 20013, ihm anscheinend eine große Hilfe war.
.
.
1990 erwähnte der Oberschlesier Horst Bienek, das die Niederschlesier ein Erinnerungs-Museum in Hannover planen, während die Oberschlesier sich eines in Hösel bei Ratingen bauten. Der Landsmannschafts-Vorsitzende der ersteren war damals Herbert Hupka, der der letzteren Herbert Czaja. „Gemeinsamkeit, ja, so etwas wie Zusammengehörigkeit haben die Schlesier (Nieder-, Mittel- und Ober-) erst im Exil entwickelt.“ Die revanchistische Vorsitzende aller Vertriebenen heißt heute Erika Steinbach, sie soll angeblich noch im Beratergremium des Schlesischen Museums zu Görlitz sitzen. Zuvor hatte sie eine Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ initiiert; als diese ihre Arbeit aufnahm, ein Museum und ein Denkmal plante, mußte sie jedoch auf Druck der polnischen Seite das Kuratorium des „Vertriebenen-Zentrums“ verlassen. Gleichzeitig sorgte man in Polen dafür, dass dem riesigen Schlesischen Museum auf der deutschen Hälfte von Görlitz/Zgorzelec ein mindestens ebenbürtiges Schlesienmuseum in der Bergarbeiterstadt Kattowitz/Kattowice – mit vier Etagen Über Tage und drei Unter Tage – gegenübergestellt wurde. „Wie viel deutsche Kultur verträgt eine polnische Dauerausstellung zur Geschichte Oberschlesiens? Über diese Frage wurde in den vergangenen Jahren im Schlesischen Museum in Kattowitz so heftig gestritten, dass bereits mehrere Museumsdirektoren gehen mussten. Jetzt ist Eröffnung,“ berichtete das Deutschlandradio Kultur 2015.
.
Auf unserer Pressereise durch Oberschlesien hatten wir im Jahr zuvor die noch leeren oberirdischen Museumshallen besichtigt und dort erfahren: Das Museum wurde schon 1929 gegründet. 1936 wurde dann mit der Errichtung des Museums begonnen. Die Eröffnung war für 1940 vorgesehen. Auf Vorschlag des Direktors des Landesmuseums Beuthen wurde nach dem „Einmarsch der Deutschen in Polen“ das fast fertige Gebäude „als Denkmal des polnisch-jüdischen Hochmuts“ abgerissen. Die dafür vorgesehenen Exponate kamen zum Teil als Beute nach Beuthen in das dort ansässige Oberschlesische Landesmuseum. 1984 gab man dem Wunsch weiter Teile der Bevölkerung nach und gründete das Schlesische Museum neu, größtenteils nun mit neuen Exponaten.
.
Es lohnt sich, das nun eröffnete Schlesische Museum in Kattowice mit dem 2006 bereits eröffneten Schlesischen Museum in Görlitz zu vergleichen. In diesem betritt man quasi als erstes einen Saal der Vertreibung und in jenem ein multimedial aufbereitetes Bergwerk. Es ist auch auf und aus einem der 12 stillgelegten Bergwerke von Kattowice entstanden. Die an Exponaten und Texten umfangreiche Dauerausstellung führt durch die ganze schlesische Geschichte, die nach heute hin immer genauer und stoffreicher wird. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber im Schlesischen Museum zu Görlitz ist genau das Gegenteil der Fall. Darin exponiert sich noch einmal das mit der preußischen Eroberung den industriellen und kulturellen Fortschritt nach Schlesien bringende deutsche Bürgertum. Hier die wohlhabende protestantische Ober- und Mittelschicht, dort die arme katholische Unterschicht. Das geht im Kattowitzer Museum bis dahin, dass ein ganzer Saal der Laienkunst von Bergleuten gewidmet ist. „The Gallery of Non-Professional Art“, wird er im vorläufigen Katalog genannt. Im deutschen Museum, das im edelsten Gebäude von Görlitz untergebracht wurde, erinnert man sich nostalgisch der deutsch-schlesischen Kopfarbeiter und ihrer einst „fortschrittlichen Rolle“, während im Kattowitzer Museum auf dem umgewidmeten Bergwerk (der dunkle laute Förderturm ist nun ein stummer angestrahlter Aussichtsturm) des polnischen Handarbeiters gedacht wird, der den ganzen Reichtum der Region schuf. Dazu gibt es auch noch Säle mit Kirchenkunst, mit Bürger-Porträts, Gesellschaftskritischer Kunst, mit Bühnen- und Kostüm-Entwürfen für das avantgardistische polnische Theater, sowie Seminarräume und eine Bibliothek. Und es gibt noch jede Menge Erweiterungspläne.
In seiner Präsentation vor allem der historischen Ereignisse und der damit verbundenen Exponate ist das deutsche Museum in Görlitz moderner und prächtiger – seinem Renaissancebau quasi verpflichtet. Etwas schön Gewordenes, dafür an Ideen arm, der Tenor ist: Preußen erobert Schlesien – „Staat und Verwaltung wurden modernisiert, die Vormacht der Stände gebrochen.“ Das ist doch schon längst nicht mehr „modern“? Das polnische Museum ist dagegen „supermodern“, d.h. in architektonischer Hinsicht und ob seiner Größe beeindruckend. Man kann sich leicht vorstellen, dass es im „Werden“ bleibt. Man sollte sich mithin beide Museen angucken, sie fechten erneut einen schlesischen West-Ost-Wettbewerb kulturell aus (der erste endete damit, dass das deutsche schlesische Museum in Beuthen das gerade eröffnete in Kattowice als „jüdisch-polnischen Hochmut“ angriff und 1940 von KZ-Häftlingen abreißen ließ).
Dessen ungeachtet gibt es – von den beiden heutigen Museen nicht thematisiert – auch noch eine andere „schlesische Teilung“, auf die der Heimatdichter August Scholtis in den Dreißigerjahren hinwies: Links der Oder, wo nach dem Ersten Weltkrieg eine „Bodenreform“ stattfand, siedelten die Gegner des Feudalismus, die freie Bauern und Handwerker sein wollten – seit den Tagen des Jan Hus bereits, während auf der rechten Oderseite noch „ein mittelalterlicher Feudalismus ungebrochen am Ruder“ war.
.

.
Im Internet-Antquariat fand ich später die Bücher von Horst Bienek, die von seiner oberschlesischen Bergarbeiterstadt Gleiwitz (heute Gliwice) handeln: die drei Bücher Gleiwitzer Kindheit (1965), Reise in die Kindheit. Wiedersehen mit Schlesien (1988), Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien (1990), und den sogenannten „Gleiwitz-Zyklus“ – ein vierteiliger Roman in Fluß: Die erste Polka (1975), Septemberlicht (1977), Zeit ohne Glocken (1979), Erde und Feuer (1982), mit einem etwas komischen Abschlußroman „Königswald“ (1984). Während seiner Recherchen fielen etliche „Dokumente“ und vorläufige „Aufzeichnungen“ an, die er dann zu einem weiteren Gleiwitz-Buch verarbeitete: „Beschreibung einer Provinz“ (1983). Darin schreibt er – z.B. über seinen Vater: „Er war asthmakrank, früh pensioniert worden, saß den ganzen Tag zu Haus, las den ‚Berschlesischen Wanderer‘ von hinten nach vorn und schlug bei jeder Gelegenheit und ohne Grund die Kinder und oft genug seine Frau mit einem Kleiderbügel, wenn sie wieder mal die Milch hatte überkochen lassen, was beinahe jeden Tag passierte, und er davon einen Hustenanfall bekam. Er schimpfte auf die Regierung in Berlin, auf die Polacken hinter der Grenze und schwärmte von der Schlacht am Annaberg und von der Erstürmung der Höhe 110…Eine politische Meinung hatte mein Vater nicht.“ Horst Bieneks Mutter und er hassten ihn, sie versuchte immer etwas dazu zu verdienen, sie gab Klavierunterricht und „soll sogar mit Immobilien spekuliert haben.“
.
Es finden sich in Bieneks „Aufzeichnungen“ auch Kommentare zu seinen Gleiwitz-Büchern – u.a. ihre Wirkung betreffend: „Heftiger Sturm der Vertriebenen-Presse gegen ‚Die erste Polka‘. Jeden Tag kommen Briefe mit Protesten.“ Vor allem stört sie, „dass ich ein radikal anderes Korfanty-Bild entwerfe als das überlieferte…Stelle mich in Düsseldorf im ‚Haus des Deutschen Ostens‘ der Diskussion…Dumpfes Gezeter… Ich hätte das nicht machen sollen.“ Lob kommt vom Sekretär der internationalen Eichendorffgesellschaft, Bienek erwähnt den oberschlesischen Dichter Joseph von Eichendorff oft, beinahe jeder Schlesier kannte Gedicht von ihm auswendig, sie sind „Volksgut“.
.
Sein Roman „Die erste Polka“ wurde 1979 verfilmt, mit Maria Schell, er sah sich ein paar Mal die Dreharbeiten an. Unterdes arbeitete er schon an seinem nächsten Gleiwitz-Roman. „Ich lebe eigentlich seit 7 Jahren zwei Leben: jenes in Gleiwitz und das gegenwärtige…Und ‚Kotik‘ bekommt immer mehr autobiographische Züge, das spüre ich.“ Die Bemerkungen über seine Gleiwitz-Bücher gehen dann mit den ersten Streiks, in oberschlesischen Kohlengruben, der Gründung von „Solidarnosc“ und der Ausrufung des Kriegsrechts 1981 in Anmerkungen über das gegenwärtige Polen und die polnische Politik von unten und oben über. „In der Grube Wujak bei Kattowitz streiken 1200 Bergleute unter Tage. Sie drohen, bei Erstürmung durch die Miliz die Stollen zu fluten. Die Behörden lassen Frauen und Priester einfahren, sie sollen die Streikenden zum Aufgeben überreden.“ Zuletzt ließ die Regierung in der Zeche schießen: „7 Tote, 100 Verletzte“. Als 1945 beim Herannahen der Roten Armee Stadtverwaltung, Polizei und Parteileute geflohen waren, hatten auch schon die Priester die notwendigen „Anordnungen“ erteilt, „und alle fügten sich bereitwillig.“ Nachdem 1982 der vierte und eigentlich letzte Gleiwitz-Roman „Erde und Feuer“ erschienen war, mit „schönem Einband“, notiert er: Aus dem Schriftstellerverband ausgetreten/ In die Marcel-Proust-Gesellschaft eingetreten.“
.
Das „Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit“ in Gliwice hatte 2003 eine Konferenz über ihn als „Stadtpoet von Gleiwitz“ veranstaltet: „Die Popularisierung des Schaffens des deutschen Gleiwitzers sollte eine Sache des Herzens und des Geistes werden, besonders deshalb weil Bienek, ein Mensch des deutsch-polnischen Grenzgebietes, allem Trotz entgegen eine Annäherung der Deutschen und Polen in Oberschlesien anstrebte,“ heißt es in einer Auswertung des Kongresses.
.
Heute spricht man von der „Opelstadt Gliwice“, die Opel-Fabrik ist die größte Industrieansiedlung in der Sonderwirtschaftszone Gleiwitz, deren „Fläche 981 ha beträgt, wobei 378 ha in den Grenzen der Stadt liegen, es handelt sich dabei um ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebiete. Die Gelände sind größtenteils flach und frei von Einflüssen der Bergbautätigkeit.“ Seit 2013 wird dort von knapp 3000 Mitarbeitern der Opel Cascada montiert.
.

.
1945 wurde der 1930 geborene, damals also 15jährige Horst Bienek, der beim Herannahen der Front nicht mit seinen Schwestern „auf die Flucht“ gehen wollte, und stattdessen mit den Nachbarn, wie der „weitaus größte Teil der Gleiwitzer“ auch, im Luftschutzkeller ausharrte, als Deutscher aus dem polnisch gewordenen Gliwice halb freiwillig ausgewiesen – alle seine Bücher mußte er da lassen. Während seiner Gleiwitzer Zeit befand sich im Osten der Stadt u.a. das Steinkohlebergwerk „Gleiwitzer Grube“. Fast die Hälfte der Arbeiter in Gleiwitz lebten mit ihren meist großen Familien in kleinen Zweiraumwohnungen. „Im Hüttenviertel wohnten viele Kommunisten,“ schreibt Bienek, die Mehrzahl der Arbeiter habe jedoch „die neue [Nazi-]Zeit begrüßt. Die Löhne der Bergarbeiter wurden kräftig erhöht.“ Ansonsten seien „Kohlengrube, Wirtshaus, Kirche, Bett die vier Pfosten des oberschlesischen Baldachins.“ Nach 2003 wurde der Gebäudekomplex des ehemaligen Bergwerks in das Projekt „Nowe Gliwice“ einbezogen, d.h. es wurde in ein „Bildungs- und Geschäftszentrum“ umfunktioniert, in die sanierte „Lohnhalle“ zog eine private Fachhochschule für Betriebswirtschaft.
.
1922 war Oberschlesien nach den „drei polnischen Aufständen“ zwischen Deutschland und Polen aufgeteilt worden. „Gleiwitz, Hindenburg und Beuthen“ waren laut Wikipedia „die wenigen Städte des Oberschlesischen Industriegebiets, die beim Deutschen Reich verblieben, und Gleiwitz wurde zur (deutschen) Grenzstadt. Lange Zeit gab es Pläne, die drei Städte zum Städtebund Gleiwitz-Hindenburg-Beuthen zusammenzuschließen,“ danach bis 1944 Pläne für einen Großflughafen GHB. 1924 schlossen sich erst einmal deren Theater zum ‚Oberschlesischen Theater‚ zusammen. Das Gleiwitzer Theater wurde 1944 renoviert, 1945 von sowjetischen Soldaten niedergebrannt, heute dient es als sogenannte „permanente Ruine“ kulturellen Zwecken.
.
Ein buchstäblicher Höhepunkt der deutsch-polnischen Auseinandersetzungen in der Vorkriegszeit war der St. Annaberg (Góra Świętej Anny – der wichtigste katholische Wallfahrtsort Oberschlesiens). Auf Wikipedia heißt es: „Der St. Annaberg hatte auch eine hervorgehobene politische Bedeutung. Bei der Volksabstimmung in Oberschlesien vom 20. März 1921 über die staatliche Zugehörigkeit stimmten knapp 60 % der Wähler für einen Verbleib Oberschlesiens bei Deutschland. In der Gemeinde Annaberg stimmten fast 82 % der gültigen Stimmen für Deutschland; im übergeordneten Wahlkreis Groß Strehlitz jedoch eine knappe Mehrheit für einen Anschluss an Polen.“ In dem von Korfanty organisierten Dritten Polnischen Aufstand versuchten polnische Freischärler mit Unterstützung französischer Truppen, die Teile Oberschlesiens, die beim Abstimmungsergebnis eine polnische Mehrheit hatten, Polen zuzuschlagen. Deutschland war durch die Bestimmungen des Versailler Vertrags und den Druck der französischen Siegermacht offiziell daran gehindert, gegen die Aufständischen vorzugehen. Inoffiziell wurde der deutsche Widerstand jedoch massiv unterstützt.“ Z.B. durch den Gleiwitzer Bergmann Paul Hrabinsky, der 1921 auf dem St. Annaberg sein Bein verlor: „Auf Hehe 130, als wir mit Freikorps Oberland gerade anfingen zu stürmen, hat mich doch getroffen Schrapnell eines polnischen Insurgenten. Ältere Leute, die ihn schon lange kannten, behaupteten allerdings, das Bein sei ihm bei einem Grubenunfall in der ‚Concordia‘ abgequetscht worden,“ schreibt Horst Bienek in „Septemberlicht“.
.
In der „Reise in die Kindheit“, die er nach seinen vier Gleiwitz-Romanen mit einem polnischen Fernseh-Regisseur unternahm, fragt er sich: „Was also ist Wirklichkeit? Jetzt bin ich dabei, meine erfundene Wirklichkeit mit der wirklichen Wirklichkeit zu vergleichen.“ Dazu gehört auch ein Besuch des Annabergs. „Viermal bin ich in meiner Kindheit zum Annaberg gewallfahrtet.“ Und in Gleiwitz war er mitunter „mehr in der Kirche als zu Hause.“ Wenn er sich zwischen Hitlerjugend-Treffen und Don-Bosco-Gruppe entscheiden mußte, entschied er sich meist für letzteres. Im Gespräch mit einem Mitglied des polnischen Parlaments erfährt er während seiner Film-Reise, dass die Luftverschmutzung in Oberschlesien sie stärkste in Europa ist, und dass die polnischen Ressourcen an Kohle noch für 20 Jahre reichen. Ein hoher Beamter der Warschauer Regierung, der gerade eine Inspektionsreise durch Oberschlesien beendet hat, sagt ihm: „Oberschlesien stirbt.“
.
Aus dem „Victoriabad“ ist inzwischen ein „Spielsalon“ mit Musikbox geworden. Als Bienek mit einigen Besuchern ins Gespräch kommt, erfährt er von den jungen Arbeitern, dass sie sich dort die Zeit vertreiben, „bis sie mit dem Bus zur Nachtschicht in eine der nahegelegenen Kohlegruben fahren.“ Es sind auch Arbeitslose darunter, die zwar ein Dokument bei sich haben, das sie als Bauarbeiter ausweist, aber „in Wirklichkeit leben sie vom Devisenhandel“ – meistens mit westdeutschen „Heimat“-Touristen. Sie machen sich über die Kumpel lustig, die so eine dreckige Arbeit unter Tage angenommen haben, wenig Geld dafür bekommen und eine Staublunge riskieren.
.
Aber am Schluß seiner [Film-]“Reise in die Kindheit“ (1988) heißt es: „Man kann sich das nicht vorstellen. Die Stadt meiner Kindheit, Gleiwitz, hat sich nicht verändert…Die verlorenen Paradiese sind die wirklichen Paradiese, schrieb Marcel Proust.“
.
Im Sommer 1939 begann der deutsche Überfall auf Polen – mit der sogenannten „Gleiwitz-Lüge“. Horst Bienek schreibt – in „Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien“ (1990), dass man damals in Gleiwitz von dem angeblichen „polnischen Überfall“ auf den Sender so gut wie nichts mitbekam: „Erst zwei Tage später erfuhren wir davon aus den Zeitungen.“Aber im ersten Roman seiner Tetralogie „Die erste Polka“ (1975) erzählt er über weite Strecken, dass alle vom baldigen Krieg sprachen, dass immer mehr Soldaten und Waffen in die Stadt gebracht wurden („Ach nichts, sagte Josel, die Panzer stehn hier nur…weil doch die Poler uns überfallen wolln.“), dass die Straßenlampen blau übermalt wurden, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen mußten, weil Soldaten dort einquartiert wurden, und dann auch, wie seiner Meinung nach der vorgetäuschte Überfall auf den Sender Gleiwitz stattfand („Draußen ist allerhand los, die Wilhelmstrasse ist voll mit Menschen…Wir sind so spät dran, weil wir dabei waren, wie der neue Sender überfallen wurde, sagte Ulla.“). Es gab einen Toten: Laut Wikipedia „den 41-jährigen Oberschlesier Franciszek (Franz) Honiok. Seine Leiche sollte als Beweis für einen angeblichen polnischen Überfall in der Sendeanlage dienen.“ Über die merkwürdige Propaganda im Vorfeld heißt es bei Bienek: „Ich kenne mich da nicht mehr aus, sagte der Obersteiger Kotulla, einmal sind wir Grenzland und Kampfland, dann sind wir Grenzland und Brückenland und jetzt wieder Grenzland und Kampfland.“ Es wurden heimlich Flugblätter verteilt: „Katholiken! Deutsche und Polen in Oberschlesien! Lasst euch nicht gegenseitig in einen Krieg hetzen. Euer Feind ist nicht jenseits der Grenzen. Das ist der Atheismus.“ Aber „das Radio und die Zeitungen hatten die Menschen hier seit Wochen in eine Stimmung hineingetrieben, in der sich jeder vom Krieg die Lösung seiner Probleme erhoffte.“ Als die in Gleiwitz stationierten Truppen in Polen einmarschierten und erste Geländegewinne machten, ließen sich wohlhabende Bürger mit dem Taxi an die Front fahren, dem Fahrer sagten sie: „Fahren Sie mich dahin, wo der Krieg ist, ich will den Krieg sehen.“ Bereits kurze Zeit nach dem Überfall auf Polen ließ Hitlers Adjudantur verlauten: „Für die Dauer des Krieges/Gebt dem Führer keine Blumen.“
.
Gegen Ende des Krieges sah er einmal, wie durch die „Bergwerkstrasse“ KZ-Häftlinge aus dem nahen Auschwitz getrieben wurden. „Wenn ich heute zurückdenke an das letzte Jahr, dann ist es Resignation, ja, und vor allem das Gefühl der Lähmung, das uns damals alle ergriffen hat. Mit den Siegesfeiern war es schon lange zu Ende, auf der Landkarte im Flur der Schule hat niemand mehr seit Stalingrad die Fähnchen verändert, dort also siegten wir nicht mehr, aber der Verlust wurde gar nicht mehr registriert.“ Zuletzt traute sich kaum noch jemand aus dem Haus, immer mehr Leute flüchteten heimlich – sie meinten, auf die anderen Seite der Oder in Sicherheit zu sein, in Gleiwitz nahmen derweil die Überfälle zu, die Polizei hatte sich nach Westen abgesetzt oder war untergetaucht und die ausländischen Zwangsarbeiter wurden immer „freier“ und damit bedrohlicher.
.
1985 hatte Bienek in einem Fernsehfilm über seine Heimatstadt mitgewirkt, darüber berichtete er 1988 in seiner „Reise in die Kindheit. Wiedersehen mit Schlesien“ . 1989, ein Jahr vor seinem Tod, besuchte er Gleiwitz noch einmal, auch das Haus seiner Kindheit: Nichts hatte sich dort in den letzten 44 Jahren verändert, es gab sogar noch den „abgewetzten Sisal-Läufer“ auf der Steintreppe. Er geht durch die Stadt, erinnert sich, dass er als Junge einmal zu Fuß nach Flössingen zum Schloß gegangen war, davor traf er den gleichaltrigen Sohn des adligen Besitzers, der zwei edle Hunde ausführte. Die Klassenschranke zwischen den beiden Jungen verhinderte ein Gespräch zwischen ihnen. Beim nächsten Schloß – Rauden – war er dann gar nicht erst in die Nähe gekommen, der Wächter hatte ihn weggescheucht. „So ging ich lieber in die [großenteils kommunistische] Hudschinsky-Siedlung, da fand ich eher Freunde, die liefen ebenso barfüßig herum wie ich, und ihre Fußsohlen waren geschwärzt von der Kohle. War der Vater besoffen, gingen sie abends gar nicht nach Hause, denn dann schlug er alle, die Mutter und die Kinder. Und so warteten sie bis spät in die Nacht, bis der Vater im Suff eingepennt war. Manchmal nahm ich auch einen kleinen Freund mit nach Hause und ließ ihn bei uns auf dem Küchensofa schlafen.“ An anderer Stelle erwähnt er, dass „die Bergleute mit der schmalspurigen Kleinbahn, die private Gesellschaften bis zu den kleinsten Industrievororten gebaut hatten, zu ihren Arbeitsplätzen in der Königin-Luise-Grube, in der Concordia, in der Grube Oehringen oder gar nach Bobrek-Karf fuhren.“ Und dass ihre Frauen sie Samstags, wenn es Lohn gab, vom Werkstor abholten, damit sie das Geld nicht gleich in der Kneipe versoffen.
.
Das „Niederschlesische“ lernte er erst dadurch kennen, dass sich ein Soldat aus dem Waldenburger Revier, der seine Militärzeit in Gleiwitz abdiente, in Bieneks Schwester Traut verliebte, die er dann bei sich zu Hause in Waldenburg heiratete.
.
In „Die erste Polka“ hofft Josels Vater, der für den Gruben- und Großgrundbesitzer Graf von Ballestrem in dessen Laboratorien in Gleiwitz, Oppeln und Breslau gearbeitet hatte, dass es dem Sohn später gelingen werde, seinen Traum zu verwirklichen: weiter als er, mindestens bis nach Köln, zu kommen, „noch bevor er heiratete. Denn die Frauen dieser schwarzen Erde waren es, die noch aus dem lehmigsten Boden Kartoffeln und Rüben zogen, in den schmutzigen Flüssen badeten, die häßlichsten Kirchen mit ihren Gebeten in Kathedralen verwandelten, und diese schwarze Erde, die ihre Männer zu Sklaven machte, segneten: Darz Panboczek tej czornej ziemi! Gesegnet sei diese Erde!, sie konnten es in beiden Sprachen sagen.“ Aus Angst vor einer Verhaftung flieht Josel dann auf einem Güterwaggon nach Westen, er kommt aber nur gerade über die Oder. Als sein Vater stirbt, gesteht er ihm auf dem Totenbett, dass er bei seiner Flucht an ihn gedacht habe. Der Vater wird „an der besten Stelle vorn am Hauptweg begraben, nicht im Ostteil, wo die Leute aus der Bergarbeitersiedlung begraben wurden,“ schreibt Bienek in „Septemberlicht“ (1977), dem 2. Band seiner Tetralogie.
.
Horst Bieneks nicht in der Ich-Form geschriebene Gleiwitz-„Tetralogie“ beginnt 1939 und endet 1945. Anfang 1945 nahm die Rote Armee – von Tschenstochau kommend – die Stadt ein. Sein vierter und letzter Roman der Tetralogie – „Erde und Feuer“ (1982) – handelt von ihrem Näherkommen und ihrem Einzug in Gleiwitz, aus der Sicht jener Deutschen, die sich nicht getraut hatten, einfach nach Westen abzuhauen, die kaum noch auf Hitlers „Wunderrakete“ hofften, die sich nicht von ihrem hart erarbeiteten Besitz, ein Glasschrank, ein 13teiliges Porzellanservice und die Gesammelten Karl-May-Bände, mit Widmung zum Teil, trennen konnten, die in den letzten überfüllten Zügen keinen Platz mehr fanden – und also weiter ausharrten, vor allem Mütter mit Kindern, Kriegsversehrte und alte Leute; bis sie sich zuletzt bei 20 Grad minus nur noch den „Flüchtlings-Trecks“ auf endlosen Landstrassen, beschossen von russischen Flugzeugen, anschließen konnten. Für die wenigen zu Hause bzw. im Luftschutzkeller gebliebenen Deutschen kam einige Monate später die „Aussiedlung“ aus Polen (und Tschechien) – „Umsiedlung“ in der DDR genannt.
.
Bieneks Roman konzentriert sich im Wesentlichen auf die Bewohner des Mietshauses, in dem seine Familie wohnte sowie auf eine mit seiner Familie befreundete Familie, und beschäftigt sich gegen Ende ein bißchen viel mit Gerhard Hauptmann, der nicht in Oberschlesien, sondern im Hirschberger Tal in Niederschlesien, lebte. Bienek läßt ihn Anfang 1945 noch nach Dresden fahren, wo Hauptmann Zeuge der Bombardierung der Stadt am 13. Februar wird – und danach zurück nach Agnetendorf in seine Villa „Wiesenstein“ fährt, wo er eigentlich nie wieder hin wollte.
.
Was Bienek nicht mehr erzählt: Dort starb Hauptmann ein Jahr später – beschützt die ganze Zeit von den Russen, die zuletzt auch noch einen Sonderzug bereitstellten, der den Sarg und alle Wertsachen aus Hauptmanns schlesischer Villa in seine Villa auf Hiddensee brachte. Mit diesem beschützten Zug gelangten auch die letzten Mitglieder der Künstlerkolonie im Hirschberger Tal in den Westen. Laut Wikipedia wird in dem Dokumentarfilm „Hauptmann-Transport“ von Matthias Blochwitz die Fahrt des Zuges rekonstruiert. Einige aus Hauptmanns unmittelbarer Umgebung, die aus der Künstlerkolonie Friedrichshagen am Müggelsee (wo Gerhart Hauptmann in der Nähe, bei Erkner, ebenfalls eine Villa besaß) ins Hirschberger Tal gezogen waren, hatten sich zuvor schon aus Schlesien abgesetzt, der angesehene Autor darwinistisch-populärwissenschaftlicher Naturgeschichtsbücher und Mitbegründer der Berliner „Volksbühne“ Wilhelm Bölsche war bereits 1939 im Hirschberger Tal gestorben und der individualanarchistische Philosoph John Henry Mackay 1933 in Berlin.
.
Mackays Schriften schätzte der Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner eine zeitlang neben denen des Jenaer Biologen Ernst Haeckel besonders, und umgekehrt konnte Mackay den Grafen Carl Wilhelm von Keyserlingk in Schlesien für Rudolf Steiners Ideen erwärmen. Kayserlingk war Verwalter von 18 rund 7 500 ha umfassenden Gütern, die zu der Zuckerfabrik „Vom Rath, Schoeller und Skene“ südlich von Breslau gehörten. Er lud Rudolf Steiner Pfingsten 1924 in sein schlossartiges Haus des Gutshofs Koberwitz ein, um vor versammelten schlesischen Gutsverwaltern und Großagrariern und für ein mehr als großzügiges Honorar eine Reihe von Vorträgen zu halten über das, was ihm zu einer ökologisch inspirierten „anthroposophischen Landwirtschaft“ einfalle. Kayserlingks Enkel, Graf Alexander von Kayserlingk, spricht in dem von ihm 1985 herausgegebenen Buch „Koberwitz 1924“ von der „Geburtsstunde einer neuen Landwirtschaft“. Rudolf Steiner dozierte dort tagsüber auf dem Gutsschloß und hielt abends Vorträge auf der Pfingsttagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Breslau. Die „Landwirtschaft“ war sein letzter Gegenstand, den er anthroposophisch zu durchdringen versuchte, bevor er 1925 ausgezehrt im anthroposophischen Zentrum in Dornach starb.
.
Horst Bienek kam zuletzt noch einmal auf die Bergarbeit zu sprechen – in seiner Erzählung „Workuta“. Er hatte als Zwangsarbeiter vier Jahre – mit 300 weiteren Deutschen – in der Bergarbeiterstadt im Ural gearbeitet. In der Spätschicht der Komsomolzenbrigade „Roter Banner“ des Schachts 29, von wo aus es 1953 zu einem fünftägigen Streik kam, den laut Bienek „natürlich die mutigen Aserbaidschaner anführten“. Ihr Widerstand endete mit 30 toten und 400 verletzten Bergarbeitern. Die kurze Erzählung „Workuta“ wurde erst 2013 veröffentlicht, Horst Bienek war bereits 1990 – Sechzigjährig – in München gestorben. Zuvor hatte er sich bereits in vier Büchern mit dem Thema „Gefangenschaft“ auseinandergesetzt, als er das letzte, „Die Zelle“ (1968) veröffentlichte, schien ihm „das Thema ausgeschritten, vielleicht sogar bewältigt.“
.
Zwischendurch hat Bienek sich auch noch um die Neuherausgabe der Romane von August Scholtis bemüht, die er z.T. dann auch benachwortete. Der 1901 im (heute wieder zu Tschechien gehörenden) Hultschiner Ländchen – im Städtchen Bolatitz – geborene Scholtis arbeitete in etlichen oberschlesischen Kanzleien und Bergwerken der Fürsten – u.a. in Kattowitz, Gleiwitz, Beuthen und Waldenburg. Zuletzt veröffentlichte er einen Bericht über seine „Reise nach Polen“ (1962). Berühmt war Scholtis mit seinem Schelmenroman: „Ostwind“ (1932) geworden, der in der Zeit der polnischen Aufstände und der anschließenden Volksabstimmung spielt, als Deutsche, Polen und sogenannte Wasserpolen bzw. Wassermähren (die sich mehreren Völkern zugehörig fühlten) nationalistisch auseinander dividiert wurden. Es ist ein „eminent politischer Roman“ schrieb die FAZ zur Neuherausgabe 1986. Die Heimatvertriebenen waren erbost. „Ein erzürnter Berufsschlesier lief damals, laut Scholtis, mit der Reitpeitsche in Berlin herum – auf der Suche nach dem ‚Ostwind‘-Autor,“ schrieb der Spiegel. Für Scholti siedelten links der Oder, „absteigend von den Höhenzügen der Sudeten“ (wo nach dem Ersten Weltkrieg eine „Bodenreform“ stattfand) , die Gegner des Feudalismus (wozu auch seine „mährischen Preußen“ gehörten), die freie Bauern und Handwerker sein wollten – seit den Tagen des Jan Hus bereits, während auf der rechten Oderseite bis in Scholtis‘ Zeit hinein noch „ein mittelalterlicher Feudalismus ungebrochen am Ruder“ war. Insgesamt zählten in Schlesien die Protestanten zu den Wohlhabenden und die Katholiken zu den Armen. Nach der Teilung traten einige Magnaten, deren Gruben und Werke sich fortan auf polnischem Gebiet befanden, zum Katholizismus über, auch „die protestantischen Beamten ließen sich in Scharen taufen.“ Nach der Eroberung der zum Habsburger Reich gehörenden Provinz Schlesien durch die Preußen war es umgekehrt gewesen: Dass sich die „Katholiken in Scharen zum Protestantismus bekehrten.“
.
Hier einige Zitate aus Scholtis Roman „Ostwind“: „Das Land ist von Deutschland aus mit bodenlosen Halunken versaut worden.“/ „Es ist ein Kampf der bodenständig Besitzlosen gegen die landfremden Besitzenden“ (Korfanty zitierend)/ „Meinen Sie die Ausbeutung der eingesessenen Bevölkerung durch wilhelminische Feudalherren?“/ „In der Schule lautete der unumstößliche Kodex auf Abgrenzung. Abstand. Achtung vor einem Lehrer, einem Wesen, das ohnehin den Nimbus der deutschen Sprache mit sich herumtrug, der deutschen Sprache, die die Jungen wie auch die Alten als den Schlüssel, als das Prädikat für allerlei Vorrechte betrachteten und heißhungrig erlernen wollten.“/ „Es handelt sich darum, das gesamte Gebiet für eine Aktivierung zu formieren.“/ „Ob wir deutsch oder ob wir polnisch sind, Bauern und Industriearbeiter, spielt keine Rolle. Dass wir Proleten sind, sollten wir nicht vergessen.“ Dieser Satz wurde gerne von den Rezensenten zitiert. Sie wollten damit beweisen, dass Scholtis trotz großer Deutschheimat-Verbundenheit ein linker Schlesier war. Was eigentlich niemand bestritten hat. Die Teilung der Industriegebiete verlief laut Scholtis folgendermaßen: „War das Grubengebiet noch von Polen besetzt, die Schächte jedoch bereits in deutscher Hand, behielten die Deutschen die leeren Schächte ohne Kohle und die Polen die Kohlenfelder ohne Schächte.“
.
Horst Bienek schreibt im Nachwort zu Scholtis „Ostwind“: Der Häuslersohn, der nur die Volksschule besuchte, „kam von der Grenze, und er wußte sein Lebtag nicht, wohin er wirklich gehörte.“ Als Motto für seinen Roman wählte er einen Satz von René Schickele, einem Elsässer: „Mein Herz ist zu groß für ein Vaterland, und zu klein für zwei.“ Der schlesisch-mährische Fürst Lichnowsky, dem die „Herrrschaft Pleß“ gehörte, stellte den Hütejungen Scholtis zunächst als Kanzleischreiber ein, „später wurde Scholtis Redakteur in Waldenburg und Gerichtsreporter in Gleiwitz. Er hat die Versammlungen der Hakatisten besucht, und die des Wojciech Korfanty, er war bei den Aufständischen wie bei den Freikorps-Kämpfern, nahm an den Grubenstreiks teil und an der Abstimmung. Dann ging er nach Berlin, wo er, arbeitslos, im Nachtasyl lebte und Hamsunsche Hunger-Erfahrungen durchmachte.“ Seine Bücher, die er nach „Ostwind“ während der Nazizeit schrieb – „Baba und ihre Kinder“ (1934) und „Jas, der Flieger“ (1935) – veröffentlichte er bei Bruno Cassirer, einem jüdischen Verlag, wo Max Tau bis 1938 als Cheflektor arbeitete. Laut Bienek erhielt Scholtis wenig später Schreibverbot. Und nach 1945 wollte man von schlesischer Heimatliteratur nichts mehr wissen, schon gar nicht in der DDR und in Polen. Das änderte sich erst wieder mit den Büchern von Horst Bienek.
.
Diese erschienen aber bereits, als sich die Industrialisierung im Bergbau absehbar dem Ende näherte. Während Scholtis „Heimatromane“ noch davon handeln, wie – in Oberschlesien – die alte feudal und patriachalisch geprägte Kleinbauernwirtschaft unterging- zugunsten der Industrie: „Das ist die Ebene, in der alle vergangenen Dinge verwischt sind und ausgelöscht, das Schloß und der Park und das Dorf, zergangen in einen einzigen Wald von Schornsteinen und in ein einziges Häusermeer,“ heißt es am Schluß seines Romans „Das Eisenwerk“ (1939 in der Büchergilde Gutenberg erschienen). Es geht darin um ein Dorf, das der Latifundienbesitzer verkauft, woraufhin die nahen Rothschildschen Hüttenwerke in Bitkowitz auf dem Gemeindeland Bergwerke errichten, die Arbeiter aus Galizien, Polen und Mähren anziehen. Scholtis beschreibt den Untergang einer Welt und das Aufkommen einer anderen. „Das ist Mitteleuropa“.
.
August Scholtis schrieb in seinem erfolgreichen ersten Roman „Ostwind“ (1933) wie oben erwähnt: „Ob wir deutsch oder ob wir polnisch sind, Bauer und Industriearbeiter, spielt keine Rolle. Daß wir Proleten sind, sollten wir nicht vergessen.“ Das Dorf Bolatitz, in dem der Landarbeitersohn aufwuchs, im Hultschiner Ländchen (zwischen Russisch-Polen, Preußisch-Schlesien und dem habsburgischen Mähren), stand auch in seinen nachfolgenden Romanen „Jas der Flieger“ (1935), „Baba und ihre Kinder“ (1934), „Ein Herr aus Bolatitz“ (1959) und posthum „Schloß Fürstenkron“ (1987) immer gewissermaßen im Mittelpunkt, wobei es um die Umwandlung von Kleinbauern im Dienste des bodenbesitzenden Fürsten zu Fabrikarbeitern in den umliegenden Berg- und Hüttenwerken ging. Scholtis hatte das Glück, dass „sein“ Fürst Lichnowsky ihn förderte. Nachdem er in verschiedenen Berufen gearbeitet hatte, u.a. unter Tage, ging er als Schriftsteller nach Berlin, wo er immer wieder am unteren Existenzminimum lebte. In all seinen wunderbaren Büchern hat er eigene Erfahrungen „verarbeitet“. Der Übergang von der feudalen Güterwirtschaft zur modernen Industrie war auch einer vom Land in die Stadt. Von den 14 Kindern der Melkerin „Baba“ gingen die Jungs in die Bergwerke und die Mädchen in Haushalte nach Westdeutschland. Mit der Industrie kommen die Landarmen langsam zu Geld, aber ihre engere „Heimat“ fällt ihr zum Opfer. So wie noch heute die sorbischen Dörfer in den Braunkohlegebieten Ostdeutschlands.
Erzwungen durch den deutschen Überfall auf Polen und die anschließende Vertreibung/Umsiedlung aller „Deutschen“ haben sich nach 1945 die Geschichten aus Schlesien quasi auseinandergelebt. Sinnbild dafür ist die Existenz zweier schlesischer Museen – in Görlitz und Kattowice. Man sollte ihr „Schlesienbild“ einmal vergleichen. Aber vorerst mag die deutsche und die polnische Literatur darüber genügen. Ganz hervorragend ist die große Studie von Malgorzata Szejnert „Der Schwarze Garten“ (2015). Die ehemalige Leiterin der Reportageabteilung der Gazeta Wyborcza rekonstruiert darin zwei um 1900 erbaute moderne Bergarbeitersiedlungen bei Kattowice – die Geschichte ihrer Erbauer, Besitzer, Bewohner und deren Schicksale. Es handelt sich dabei um die Siedlungen Gieschewald (Giszowiec) und Nickischschacht (Nikiszowiec). Dabei bekam sie u.a. heraus, dass schon die zweite Generation der dort untergekommenen Bergarbeiter bedeutend weniger Kinder bekam. Der letzte Generaldirektor der oberschlesischen Gieschewerke war Dr. Eduard Schulte, wegen seiner vielen Geschäftsreisen u.a. in die Schweiz, konnte er dort den Alliierten 1942 die geheim gehaltene Judenvernichtung in Auschwitz verraten. Schulte mußte dann aus Deutschland fliehen. Als er 1966 starb und „seine Witwe für die Verluste im Osten staatliche Entschädigungsleistungen beantragte, verweigerten die Richter das unter Hinweis auf die von ihnen als Straftat gewertete Weitergabe von Informationen an die Alliierten, also als Verrat,“ heißt es auf Wikipedia. Malgorzata Szejnert beruft sich diesbezüglich in ihrer Studie auf das Buch der Historiker Walter Laqueur und Richard Breitman „Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt vom Holocaust“ (1986) erfuhr.
.
Soeben erschien aus Schlesien der in Polen vielgelobte Heimatroman „Drach“ von Szczepan Twardoch auf Deutsch. Er spielt in einem ähnlichen Milieu wie das von dem Malgorzata Szejners große Mikrohistorie handelt. Ist aber leider viel zu verkunstet, durchgehend in ein und dem selben Ton gehalten, und viel zu sehr auf die Sexualgewohnheiten seiner kleinbäuerlichen und bergarbeiterlichen Hauptfiguren fixiert. Dennoch oder gerade deswegen scheinen die Rezensenten von FAZ, SZ und Spiegel Twardows Roman bei weitem der Studie von Szejner vorzuziehen. Was ich mir nur mit Schlesien-Desinteresse erklären kann.
.
Scholtis Förderer, der Fürst Lichnowski, war mit der Schriftstellerin Mechthilde Lichnowski verheiratet, die Scholtis hier und da ebenfalls lobend erwähnt. Sie veröffentlichte etliche – etwas verplauderte – Romane, die großteils autobiographisch gehalten sind und von ihrer Tierliebe zeugen. Die Fürstin gab sich als emanzipierte Bürgerliche und reiste viel. Scholtis erwähnt neben den Dichter Joseph von Eichendorff, der auf einem Schloß in der Nähe seines Dorfes Bolatitz lebte, den schlesischen Schriftsteller Gustav Freytag, den man heute höchstens noch wegen seines umfangreichen Kaufmannsromans „Soll und Haben“ kennt. Im Wallstein-Verlag veröffentlichte der Literaturwissenschaftler Bernt Ture von zur Mühlen gerade eine Biographie über Gustav Freytag. „Diese erste umfassende Biographie zeichnet den Lebensweg des gebürtigen Schlesiers und preußischen Patrioten nach: Privatdozentur in Breslau, frühe Erfolge als Dramatiker, Kauf der Zeitung ‚Grenzboten‘, sensationeller Aufstieg zum führenden deutschen Romancier, gescheiterte Karriere als Reichstagsabgeordneter, Berater des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Der 200. Geburtstag Gustav Freytags ist Anlass, sich mit Leben und Werk des umstrittenen Mannes zu beschäftigen.“
.
Schlesische Berichte und Erzählungen von Bergarbeitern (Grubjorsch) gibt es nicht viele, die „Schlesien-Literatur“ ist dagegen fast unüberschaubar. Unbedingt erwähnenswert ist noch Rudolf Virchows sozialhygienischer Bericht über die Flecktyphus-Epidemie in Oberschlesien, wo er sich 1848 (!) auf die von der Epidemie am stärksten betroffenen Landkreise Pless und Rybnik (Zentrum des Rybniker Kohlereviers) konzentrierte. Allein im Kreis Pless hatte die Epidemie 7000 Opfer unter der ländlichen Bevölkerung gefordert. Virchows Abhandlung hat den Titel: „Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhusepidemie“. Auf der Internetseite des Geschichtsvereins „luise-berlin.de“ schreibt Bernhard Meyer: „Virchows Schrift gilt als eine der ersten und grundlegenden Schriften der Sozialmedizin. Die Vorgänge in Oberschlesien und das Verhalten des preußischen Staates erklären auf medizinisch-sozialem Gebiet anschaulich bürokratisches und volksfremdes Denken der Beamtenschaft. Der entschiedene Demokrat und Republikaner Virchow schrieb: ‚Das Gesetz war da, die Beamten waren da, und das Volk – starb zu Tausenden Hungers und an Seuchen.‚ (S. 322) Wen verwundert es daher, daß das Volk ‚in der Aristokratie oft genug seine gebornen Gegner‚ (S. 322) erkannte.“ Freunde in der preußischen Regierung machte Virchow sich mit seiner Schrift nicht, aber sie machte ihn berühmt. Horst Bienek urteilte: „Da beschreibt einer diese Provinz (im Jahre 1904), als ob er sich in Neu-Guinea befinde.“
.
1868 unternahm Theodor Fontane eine Reise in die schlesischen Bergwerks-Reviere. In seinen „Reisetagebüchern“ berichtete er darüber; daneben veröffentlichte er 1890 einen Vorabdruck in der „Gartenlaube“ aus seinem Schlesien-Roman „Quitt“, dessen Handlung in Wolfshau bei Krummhübel im Riesengebirge beginnt, der Protagonist ist ein junger Stellmacher, der sein Glück gerne in Amerika machen würde. Auf Wikipedia heißt es: „Die Handlung, soweit sie im Riesengebirge spielt, wird flankiert von einer skizzenhaften Nebengeschichte um den Berliner Rechnungsrat Espe und seine Familie, die sich als Urlaubgäste in Krummhübel aufhalten und den Mordfall Opitz am Rande mitverfolgen.“
.
All das wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn nicht 2014 eine Konferenz der „Fontane-Gesellschaft“ in Breslau stattgefunden hätte, die zu dem selben Schluß kam: „Von den Dünen bei Świnoujście nach Breslau“ war ihr Titel. Anschließend hieß es im Konferenzbericht: „Der zweite Teil der Vorträge war der Frage nach dem Hier und Jetzt, also Theodor Fontanes Verbindung mit Schlesien gewidmet. Denn einige der Orte, die er damals besuchte, sind heute noch vorhanden und zu besichtigen. Was eine Gruppe von Studenten auch nachvollzogen hatte. Sie waren seinen Spuren durch Schlesien gefolgt und vermittelten nun den Zuhörern mithilfe einer Fotopräsentation einen visuellen Eindruck davon. Anschließend begaben sich die Teilnehmer der Konferenz selbst auf die Reise: ein Stadtspaziergang auf den Spuren Fontanes. Er hatte 1872 viereinhalb Stunden in Breslau zugebracht und alle für Preußen wichtigen Orte besucht. Die Geschichte Schlesiens interessierte ihn eher wenig, er wusste nicht viel darüber, was sich auch in den Notizen über den Breslauaufenthalt niederschlug.“
.