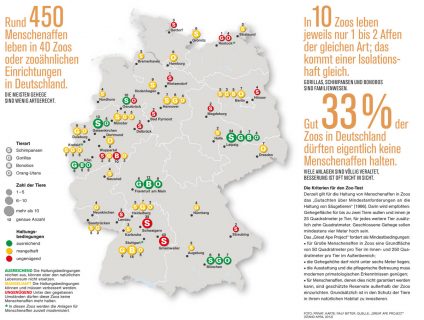Als kürzlich von den Volksbühnenkünstlern Guillaume Paoli und Jürgen Kuttner eine „Volksbühnenbewegung“ initiiert wurde, um die drohende Abwicklung der Ost-Volksbühne durch einen West-Spaßmacher mit PR-Wortschatz zu verhindern (zuvor war Ähnliches bei der Staatsoper passiert), kam einigen Leuten die Idee einer „Tierparkbewegung“, die sich gegen die selbe Intention nahezu der gleichen Westler richtet, deren Wirken bzw. Nichtwirken im Tierpark einer schleichenden Abwicklung und kollektiven Demoralisierung resp. Demütigung gleich kommt. U.a. geht es darum, den Tierpark, dessen GmbH-Status die Aktiengesellschaft des Westzoos unlängst wieder kassierte, ihn mithin geschluckt hat, wie früher beim Kultursenat anzusiedeln (die Zoo-AG, der Westberliner Zoo, ist beim Finanzsenat untergebracht), und ferner darum, bei der neuen Koalition im Berliner Senat eine Bestandsgarantie einzufordern.
.
Es geht dabei nicht um die Frage: Gehören die Zoos und Tierparks nicht überhaupt abgeschafft, mindestens transformiert? – Da doch die Biologen so gut wie kein Interesse mehr an ihnen haben und generell die „organismische Biologie“ quasi hinter sich lassen. Die Gelder – Milliarden Dollar – fließen jetzt in die Genetik und in die Neurobiologie. Dieser blog-eintrag versucht einigen Zoodirektoren und Zoologen bis dahin zu folgen. Die Genetiker versprechen nebenbeibemerkt, statt Zoos und Tierparks als Asyl für die letzten einer aussterbenden Tierart, dass sie neue und sogar bessere Tiere herstellen, die sie ersetzen werden. „Mit der Gentechnik beginnt das Zeitalter der wahren Kunst – erst mit ihr sind selbstreproduktive Werke möglich,“ so sagte es der brasilianische Philosoph Vilem Flusser. Der Tierschützer Colin Goldner bemüht sich in seinen Zookritiken seit Jahren, das unwürdige lebenslange Einsperren von Wildtieren als Repräsentanten ihrer Art, nur um gelangweilte Kleinfamilien am Sonntag zu belustigen, anzuprangern. Die Tiere sollen wieder in die Freiheit entlassen und die mit Zigmillionen subventionierten Zoos geschlossen werden. Da jedoch ihre natürlichen Habitate nach und nach verschwinden, ist eher davon auszugehen, dass noch viel mehr Tierparks in den nächsten Jahrzehnten eröffnet werden, um „die letzten ihrer Art“ wenigstens noch eine Weile am Leben zu erhalten.
.
Was sieht man jetzt noch im Tierpark Friedrichsfelde? Vor dem Eingang befindet sich links ein hell erleuchteter „Tierpark-Shop“ mit einem aufrecht stehenden Bären aus Pappe und einem ebensolchen Tiger davor, und rechts ein – 2006 verglastes – Außengehege („Felsenanlage“ genannt) für Bären, in dem ich aber nur einmal einen Bären gesehen habe. Es ist ein Amerikanischer Schwarzbär, las ich. Es hängt dort auch noch eine Ehrentafel für den ersten und letzten Tierparkdirektor Heinrich Dathe (1910 – 1991). Die Photographien wurden bis auf eins im Ostberliner Tierpark aufgenommen.
.

Es gibt noch ein weiteres verglastes Bärengehege („Bärenschlucht“ genannt) im Tierpark – mit einem Brillenbär (siehe Photo unten). Es müssen aber mehrere da drin sein, denn Mitte 2013 berichtete der Verband der Zoologischen Gärten e.V. auf seiner Internetseite, dass die Brillenbärin „Julia“ Nachwuchs bekommen hätte, ein Weibchen, mit dem sie sich bereits draußen sehen lasse. Der Vater kam 1997 im Westberliner Zoo zur Welt, er lebte dann 16 Jahre im Zoo Aschersleben, 2012 kam er im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms in den Ostberliner Tierpark Friedrichsfelde, wo er sich mit der ein Jahr jüngeren „Julia“ verpaarte. Experten der Tierschutzorganisation „Peta“ wollen beobachtet haben, dass die Bären in der Freianlage „nur im Wechsel gezeigt werden“ und dass der Vater bereits „extreme Verhaltensstörungen (Stereotypien) zeigt“. Der Brillenbär auf dem Photo wühlte die ganze Zeit, da ich ihn beobachtete, das Laub vor der „Frontverglasung“ auf – völlig stereotypienfrei, wie mir schien, aber man weiß ja inzwischen: Die Hysterie steht am Anfang jeder Wissenschaft.
.
Zoologen und Zoodirektoren
Die deutschen Pioniere für neue Methoden in der biologischen Forschung wurden fast alle im 19. Jahrhundert oder kurz nach 1900 geboren. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz (geb. 1903) mußte sich erst von seinem späteren Lehrer Oskar Heinroth (geb. 1871) sagen lassen, dass seine intensive Beschäftigung mit allerlei Tieren, im Elternhaus bereits, ernsthafte Wissenschaft sei. Diese Generation Zoologen und oft auch ihre Ehefrauen haben längst ihre „Erinnerungen“ veröffentlicht und sind inzwischen gestorben. Vielen gelang eine erste Karriere im Nationalsozialismus. Anders die nächste Zoologen-Generation, die Zwerge auf den Schultern von Riesen, wenn man so sagen darf, die 1945 noch zu jung für das „letzte Aufgebot“ gewesen waren: Sie sind aber inzwischen als berentete Lehrstuhlinhaber oder Institutsdirektoren ebenfalls im Memoirenalter angekommen. Erwähnt seien die „Erinnerungen“ des Leiters des neurobiologischen Instituts der Freien Universität Berlin, Randolf Menzel (geb. 1940), er gab ihnen den Titel: „Die Intelligenz der Bienen“ (2016), sie wurden von ihm gemeinsam mit dem Schriftsteller Matthias Eckoldt verfaßt. Ferner der Sektionsleiter Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München Josef Reichholf (geb. 1945), er fand für seine Erinnerungen den Titel „Mein Leben für die Natur“ (2015) passend; während der Leiter der Vogelwarte Radolfzell Peter Berthold (geb. 1939) seine: „Mein Leben für die Vögel“ (2016) nannte. Der Ökologe Reichholf schreibt in seiner Autobiographie, dass die Ökologie immer stärker von einer fakten- und wissensbasierten Forschung zu einer Arbeit an Computermodellen reduziert werde. Damit zusammen hänge eine unselige Anglifizierung dieses Faches und seiner Begriffe. Überhaupt könne er sich heute mehr und mehr für die deutschen Biologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begeistern: Was und wie die alles schon erforscht haben!
.
Noch radikaler sah das die DDR-Biologin Carmen Rohrbach (geb.1946). Sie arbeitete ab 1977 vom Westen freigekauft als Verhaltensforscherin am Max Planck Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen, wo Konrad Lorenz von 1961 bis 1973 Direktor war und das immer mal wieder organisatorisch mit Bertholds Vogelwarte Radolfzell verbunden wurde. Im Auftrag des Instituts erforschte Carmen Rohrbach in den Neunzigerjahren ein Jahr lang das Verhalten der Meerechsen auf einer der Galapagosinseln. Bei der Abreise war sie sich sicher: „In meinem Beruf als Biologin werde ich nicht weiterarbeiten. Zu deutlich ist mir meine fragwürdige Rolle geworden, die ich als Wissenschaftlerin gespielt habe.“ Sie erlebte zwar ein wunderbares Forschungsjahr auf „ihrer“ kleinen unbewohnten Insel, „doch ich habe es auf Kosten der Meerechsen getan, gerade dieser Tiere, die die Friedfertigkeit und das zeitlos paradiesische Leben am vollkommensten verkörpern. Ausgerechnet diese Tiere mußte ich mit meinen Fang- und Messaktionen verstören und belästigen. Da ich nun einmal diese vielen Daten gesammelt habe, werde ich sie auch auswerten und zu einer Arbeit zusammenstellen. Diese Arbeit wird zugleich der Abschluss meiner Tätigkeit als Biologin sein, denn ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe. Und erst recht könnte ich es nicht mehr verantworten, Tiere in Gefangenschaft zu halten und womöglich sogar mit ihnen zu experimentieren…Ich werde nach Deutschland zurückkehren und versuchen, eine Aufgabe zu finden, die mir sinnvoll erscheint.“ Diese selbstgestellte „Aufgabe“ bestand dann darin, dass sie eine Reiseschriftstellerin wurde, die extremtouristische „Destinations“ aufsucht und anschließend darüber Berichte veröffentlicht. Erwähnt seien ihre Bestseller über Feuerland/Patagonien, die Anden,das Himalajagebirge, die Namibwüste/Namibia, den Jemen und die Wüste Gobi/Mongolei. „Unterwegs sein ist mein Leben,“ meint sie. Aber gerade ihrem Reisebuch über die Mongolei, die ich selbst mehrmals bereiste (und dabei die Wüste Gobi als wirklich lebenswerte Region empfand), merkt man an, dass sie sich inzwischen einer neuen Disziplin unterworfen hat: Nämlich jedesmal aufs Neue alle für ein erfolgreiches Reisebuch obligatorischen Aspekte einer Gegend abzuhaken – und sich dabei nicht zu schonen, wobei sie sich erlebnishungrig in einem hippiesken Gefühlsfeminismus gefällt. Auf diese Weise werden ihre Berichte immer mehr zu dem, was man in der DDR „Sekretärinnen-Literatur“ nannte (dazu zählten z.B. die Bücher von Ruth Kraft – u.a. über ihre schöne Zeit als „Rechenmädchen“ in Peenemünde während der Nazizeit).
.

Ostafrikanischer Weißohr-Turako, eine Kuckucksvogelart
……………………………………….
Generationenübergreifend lassen sich etliche der „Alten“ von der Vogelwarte Rossiten an der Kurischen Nehrung und vom nahen Königsberger Institut des Zoologen Otto Koehler herleiten, der 1936 die „Zeitschrift für Tierpsychologie“ gründete. Auch der „Papst der Ornithologie“ Erwin Stresemann (geb. 1889), der am Berliner Naturkundemuseum arbeitete und das „Journal für Ornithologie“ herausgab, gehört sozusagen zu den Riesen unter den deutschen Zoologen. In Königsberg lehrte ab 1940 der berühmteste: Konrad Lorenz, allerdings nicht bei den Zoologen, sondern auf dem Kant-Lehrstuhl, wo er die „synthetischen Urteile a priori“ biologisch auf Mutation und Selektion zurückführte – um dergestalt den Kantschen Dualismus mit der Evolutionstheorie zu überwinden. 1944 geriet er in sowjetische Gefangenschaft. Von dort aus brachte er laut seinem Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt (geb.1928) einen gezähmten Raben und ein fertig ausgearbeitetes „Russisches Manuskript 1944 – 48“ mit: seine Theorie der vergleichenden Verhaltensforschung: „Die Naturwissenschaft vom Menschen“ auch genannt. Dem KGB mußte er eine Kopie da lassen. Sein Manuskript wurde erst 1992, drei Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht.
.
Die Vogelwarte Rossiten – später Ausgangspunkt für die ersten Tierfilme von Heinz Sielmann (geb. 1917) – wurde an der Königsberger Universität vom Ornithologen Johannes Thienemann (geb. 1863) gegründet, weil dort Millionen Zugvögel Rast machten. Von 1926 bis 1936 war der Leiter des Aquariums am Berliner Zoo, der Ornithologe Oskar Heinroth (geb. 1871), daneben auch noch formeller Leiter der Vogelwarte „Sie war die erste ornithologische Forschungsstation der Welt und erlangte durch ihre Pionierarbeit Weltruf,“ heißt es auf Wikipedia. Wahre Heerscharen von Biologen pilgerten seit ihrer Gründung an die Kuhrische Nehrung. Ihre Arbeit wird seit der Evakuierung 1944 durch die Vogelwarte Radolfzell am Bodensee für das „Max-Planck-Institut für Ornithologie“ fortgesetzt. Eine russische Vogelwarte im jetzigen „Rybatschi“ sieht sich indes in der Nachfolge der deutschen Vogelwarte Rossitten vor Ort. Sie wird von der „Heinz Sielmann Stiftung“ finanziell unterstützt. In dieser Stiftung ist der Leiter der Vogelwarte Radolfzell Peter Berthold aktiv.
.
In seiner Autobiographie „Mein Leben für die Vögel“ erwähnt Berthold die „Krähenbeißer“ – „Krajebieter – auf der Kuhrischen Nehrung: So nannte man laut Wikipedia die Fischer dort, weil sie im Herbst während des Vogelzugs mit ihren Netzen Krähen fingen: „Gefesselte zahme oder frisch gefangene Vögel und ausgeworfene Fischabfälle lockten die Krähenzüge an. Das im Sand getarnte Schlagnetz wurde von einer kleinen Reisighütte aus bedient. An einem guten Zugtag konnten mehr als 60 Krähen gefangen werden. Ein Biss in die Schädeldecke ließ sie sofort verenden. Sie wurden eingepökelt und dienten als Winternahrung. Die sogenannten ‚Nehrungstauben‘ wurden auch an große Gaststätten und Hotels verkauft und erschienen als Delikatesse unter ihrem eigenen Namen auf der Speisekarte. Im Königsberger Hotel ‚Continental‘ gab es noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein Nebelkrähen als Spezialität des Hauses.“
.

Kolkrabe. Der größte unter den Rabenvogel-Arten. In der Voliere am Berg leben zwei Kolkraben. Das 2010 geborene Weibchen wurde noch im selben Jahr vom Tierpark erworben und das etwas größere Männchen 2011. Früher hielt auch der Zoologische Garten in Charlottenburg noch Kolkraben in einer Voliere. Zum Spielen haben die zwei in der Voliere des Tierparks Friedrichsfelde u.a. einen quietschgelben Plastikball. Ich sah sie jedoch noch nie damit spielen.
„Bis zum Mittelalter war der Kolkrabe, im Sagenschatz der Deutschen als Wotansvogel wegen der an ihm beobachteten geistigen Regsamkeit mit Recht hoch eingestuft, in Europa recht häufig. Er nährte sich vor allem von Schlachtabfällen, die auf den Luderplätzen vor jeder Gemeinde zusammengeworfen wurden. Ich sah vor dem Kriege an solchen Plätzen in Griechenland Trupps von 30 und mehr Kolkraben. So wie bei uns durch Einführen von Schlachthöfen und Abdeckereien das Nahrungsangebot nachließ, verminderte sich der Bestand dieses herrlichen Vogels. Das Auslegen von Gifteiern gegen Raubwild tat ein übriges.“ (Heinrich Dathe, „Erlebnisse mit Zootieren“, Berliner Tierpark-Buch Nr. 22, 1978) Der amerikanische Rabenforscher Bernd Heinrich lebte zurückgezogen in einer selbstgebauten Hütte auf einem Berg in Maine – um dort das Zusammenleben von Kolkraben zu studieren. Er meint: „Wilden Raben kann man nicht folgen. Bumms sind die weg, in zehn Sekunden sind die abgehauen.“ Seine Bücher über sie, die er im Wald immer wieder mit riesigen Mengen Fleisch anlockte, das er jedesmal den Berg hochschleppte, handeln dann auch fast ebenso viel von seinen Mühen und Entbehrungen (vor allem im Winter) wie von den Raben. Er entdeckte dabei, dass die Kolkraben aus Vorsicht erst einmal andere von einem Kadaver oder Fleischstück fressen lassen. Sie wittern ständig Unrat und Gefahr. Er zieht jedoch nicht in Erwägung, dass dieses Verhalten eventuell daher kommt, dass die weißen Siedler lange Zeit die Kolkraben mit vergiftetem Fleisch getötet haben. Auf der Müllkippe am Berliner Wannsee, wo besonders viele Kolkraben in den nahen Bäumen nisteten, war dieses übervorsichtige Verhalten jedenfalls nicht beobachtet worden.
An einer Stelle schreibt Bernd Heinrich: „Die Evolution bringt nichts ‚Überflüssiges‘ hervor, weil alles, was sie produziert, seinen Preis hat“…Und: „Der einzige Grund, weshalb die Evolution Beziehungen erhalten würde, ist der, dass sie nützlich sind.“ Abgesehen von seinen fragwürdigen Begriffen aus der warenproduzierenden Gesellschaft bzw. dem darwinistischen Utilitarismus schreibt er an anderer Stelle – über die verschiedenartigen Spechte in „seinem“ Wald: „Trotz all meiner wissenschaftlichen Erklärungsversuche glaube ich, dass sie im Grunde aus schierer Lebensfreude singen, hämmern oder tanzen.“ Auch „seine“ wilden Raben probieren alles neugierig aus und spielen. Nachdem Heinrich eine Schar in Formation fliegender Kanadagänse beobachtet hat, bemerkt er über „seine“ Raben: „Sie jagen und necken einander, bummeln, kreisen, führen Loopings aus, sie krächzen oder kreischen oder geben rasselnde Geräusche von sich. Sie machen alles mögliche, nur in [nützlicher energie-ökonomischer] Formation fliegen tun sie nicht.“
Heinrich zitiert den Biologen Mark Pavelka, der das Verhalten von Raben für die amerikanische Umweltbehörde United States Fish and Wildlife Service untersuchte: „Bei anderen Tieren kann man gewöhnlich 90 Prozent der Geschichten, die man hört, vergessen, weil sie übertrieben sind. Bei Raben ist es umgekehrt. Mag die Geschichte noch so komisch oder seltsam klingen, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es irgendwo Raben gibt, die so etwas tatsächlich getan haben.“ Das liegt daran, fährt Heinrich fort, „dass Raben Individuen sind, und Ameisen z.B. nicht.“
Der Verhaltensforscher Otto Koehler veröffentlichte 1949 einen Aufsatz über das „vorsprachliche Denken“ und das Zählvermögen (bis 7) seines Kolkraben „Jakob“ – in einer Festschrift zum 60.Geburtstag des Ornithologen Erwin Stresemann.

—————————————————-
Über Vögel erfährt man in Peter Bertholds Chronik seines „Lebens für die Vögel“ nur wenig. Dafür jedoch sehr viel über Personalpolitik in der Max-Planck-Gesellschaft. Ständig mußte er darum kämpfen, dass „seine“ Vogelwarte Radolfzell nicht einem anderen Institut zugeordnet oder untergeordnet oder wohlmöglich gänzlich abgewickelt wurde. Auch gegen so manche andere Behörde und sogar gegen den BUND mußte er – vogelschützerisch – vorgehen. Seine Autobiographie enthält ferner einen Nachruf auf seinen frühverstorbenen Studienfreund und Ornithologen-“Kumpan“ Eberhard Gwinner (geb. 1938), der seine Doktorarbeit über gefangen gehaltene Kolkraben schrieb. Anscheinend leistete er sich laut Berthold später einige Fehlentscheidungen bei seiner Karriereplanung. Es gibt nur ein paar Aufsätze von Gwinner über seine Rabenvogelforschung. Dennoch bezeichnet ihn das Zentralorgan der amerikanisierten Darwinisten „Nature“ als „one of the most influential ornithological researchers of the second half of the twentieth century“. Der Tierpsychologe Heini Hediger kritisiert ihn in seinem Buch „Tiere sorgen vor“ (das 1973 von einem Schweizer Versicherungskonzern herausgegeben wurde): „Bei seinen Untersuchungen über den Einfluß des Hungers auf die Versteckaktivität von Kolkraben war Gwinner zu dem unerwarteten Ergebnis“ gekommen, dass 1. hungrige Raben, wenn sie Futter bekommen, intensiver Stücke verstecken als satte, und 2. dass Raben mit Nestjungen besonders gerne fettreiches Fleisch und Insekten verstecken, was doch gerade ihre Jungen benötigen. Gwinner nahm also an, dass der Hunger die Versteckaktivitäten stärkte und dass dies ein besonders „zweckmäßiges Verhalten“ sei, insofern sie besonders im Winter auf zufällig anfallendes Futter angewiesen seien. Hediger hält das, ausgehend vom Verhalten der Rabenvögel (Eichelhäher und Tannenhäher), die in Zeiten des Überflusses große Nußvorräte für den Winter anlegen, für überhaupt nicht zweckmäßig – wenn Kolkraben in der Not anfangen zu sparen, und fragt sich, ob es nicht möglich sei, „dass bei diesen gescheiten Übervögeln das ursprünglich zweckmäßige Vorsorgeverhalten irgendwie ins Unzweckmäßige übergeschnappt ist im Sinne vielleicht eines Konflikts zwischen Instinkt und Intellekt?“
.
In einem anderen Buch („Tiere verstehen“ – 1980) kommt Hediger noch einmal auf Kolkraben zu sprechen, weil man herausbekommen hat, dass sie ein Fremdgeräusch als Eigenname (Ausruf- oder Anrufname) durch individuelles Lernen übernehmen können. Dazu zitiert Hediger den Königsberger Zoologen Otto Koehler: „Eberhard Gwinners Kolkrabenmännchen bellte wie der Hund, sein Weibchen ahmte Truthahnkollern nach. War er entflohen, bellte sie; als man sie in eine entfernte, ihm bekannte Voliere versetzte, hat er von der Ecke seines Behältnisses, die auf ihre Voliere Ausblick hatte, nach ihr gekollert. Statt der persönlichen Note des erstangeborenen Rufs wird hier der persönlich erworbene Fremdlaut sozusagen zum Eigennamen, mit dem man einander anredet.“ Dem Begriff „Eigennamen“ hat Hediger in seinem e.e. Buch ein ganzes Kapitel gewidmet, darin sammelt er weitere Belege dafür, dass die Tiere sich beim Namen rufen. Hediger war ein Schüler des Basler Biologen Adolf Portmann (1) . Als Zürcher Zoodirektor ließ er sich, wenn er auf Reisen war, vom Pavianforscher Hans Kummer (1) vertreten. Diese Biographeme verdanke ich dem heutigen Zürcher Zoodirektor Alex Rübel (1955), den man vielleicht als Schüler von Hediger bezeichnen könnte. 2009 veröffentlichte er eine Biographie über ihn: „Heini Hediger 1908 – 1992“.
.
1990 hatte Hediger selbst eine Autobiographie veröffentlicht: „Ein Leben mit Tieren im Zoo und in aller Welt“. An einer Stelle beklagt er sich darin, dass der Zoovorstand ihm mit 65 kündigte und nicht, wie er gehofft hatte, mit 70 in Pension schickte: „Vielleicht lag diesem Entschluß die Überlegung zugrunde, dass es bei der Universität [wo er weiter lehren konnte] auf eventuell präsenile Erscheinungen bei Dozenten nicht so sehr ankomme, dass jedoch im Zoo ein derartiges Risiko auszuschließen sei. Zudem hatten verschiedene Mitglieder des Zoovorstands offensichtlich genug von Zoodirektor Hediger, der immer mit neuen Wünschen hinsichtlich der Ergänzung des Personalbestandes, der Beschleunigung von Sanierungs- und Erweiterungsbauten usw. auftrat. Hediger war ein unbequemer Mann, zugegeben, aber ich hatte nicht in erster Linie Menschen zu dienen, sondern die Interessen der Tiere zu vertreten und der Tiergartenbiologie in der Praxis zur Anerkennung zu verhelfen,“ schreibt er.
.

Sibirische Tiger in einem der Außengehege des Alfred-Brehm-Hauses. Man beachte die chinesischen Götterbäume, die sich in vielen Zoos ausbreiten – anderswo zählen sie zu den invasiven Schädlingspflanzen.
.

3 von 5 Sibirischen Tigern in einem anderen Außengehege des Alfred-Brehm-Hauses.
.

Sumatra-Tiger in einem der kleinen Außengehege des Alfred-Brehm-Hauses
……………………………………………
Zu Peter Bertholds Karriere als Wissenschaftler gehörten auch Vorlesungen an der Universität Konstanz, wo um 1970 „die Studenten fast alles“ durften – was er immer noch beklagt. Ähnlich negativ über die damaligen „68er“-Zustände an den Unis äußert sich auch der FU-Bienenforscher Randolf Menzel (geb. 1940) in seiner Arbeitsbiographie. So viel wird in ihren Autobiographien klar: Für Vögel bzw. Bienen bringen die beiden mehr Verständnis auf als für antiautoritäre Studenten, Klassenkampf und Revolution. Berthold schreibt: „Ich lebte wochenlang Tag und Nacht meist mutterseelenallein in der Natur, umgeben von tausenden von Vögeln. Dabei begann ich, mich in diese Geschöpfe hineinzudenken wie nie zuvor, fühlte mich selbst oft fast wie ein Vogel und erfuhr auf alle Fälle meine bislang stärkste Prägung auf die Gefiederten.“ – Davon bemerkt man jedoch nur wenig in seinem Buch. Im letzten Kapitel „Ausblick“ erinnert er daran, schon 1990 im „Ausblick“ seines damaligen Buches „Vogelzug“ von der Gefährdung vieler Zugvogelarten gesprochen zu haben. Heute, 25 Jahre später, „ist unsere Vogelwelt so verarmt, dass man bei uns ein breit gefächertes Grasmückenprogramm, wie wir [Eberhard Gwinner und er] es 1968 begonnen haben, gar nicht mehr starten könnte.“ Das Kapitel hat die Überschrift „Immer mehr globale Forschung, aber immer weniger Vögel“.
Das selbe ließe sich auch über die globale Bienenforschung und die lokalen Bienen sagen. Je mehr sich das Wissen über Bienen erweitert, desto schlechter geht es komischerweise den Bienen. Jedenfalls den Hochleistungsbienen in der westlichen Welt. Zu den heute bekanntesten Bienenforschern zählt der Würzburger Soziobiologe Jürgen Tautz (geb. 1949), er ist Leiter der „Honeybee Online Studies“ (HOBOS). Dabei wird ein Bienenvolk mit Kameras und Sensoren von allen Seiten überwacht, was „endlose Datenströme“ über die Bienen, das Wetter und die Vegetation liefert. Die Daten werden ausgewertet – u.a. im Hinblick auf Langzeittrends im „komplexen Gefüge zwischen dem Superorganismus Bien und dessen Umwelt,“ wie Jürgen Tautz in seinem neuen Buch „Die Erforschung der Bienenwelt – neue Daten, neues Wissen“ (2015) schreibt.
Ähnlich „online“ forscht auch Randolf Menzel, in: „Die Intelligenz der Bienen“ berichtet er, wie sie in seinem Institut erst die Bienen kennzeichneten, dann mit Sendern ausstatteten (die wie kleine Funkmasten auf ihren Rücken aufragten), dann ein fahrbares Radargerät anschafften, um ihre Flüge zu verfolgen, und sich schließlich mit noch mehr Geräten „Einblicke ins Bienengehirn“ verschafften. Aber irgendwann ging es nicht weiter. Deswegen schlossen sich die Bienenforscher um Randolf Menzel der Arbeitsgruppe von Martin Göpfert in Göttingen an, „die über Apparaturen verfügte, mit denen man in jene Dimensionen von einem Millionstel Millimeter vordringen konnte.“
Danach bauten sie sich selbst ein Hightech-Gerät. Die Pressestelle der FU meldete: „Biologen und Informatiker haben einen Bienenroboter entwickelt, der ihnen bei der Entschlüsselung der komplexen Bienensprache hilft. Die ‚RoboBee‘ war im Bienenstock bereits erfolgreich: Bienen folgen ihren Signalen und fliegen an den beschriebenen Ort…Neben neuen Informationen zur Sprache der Bienen gewinnen die Wissenschaftler dabei vor allem grundlegende Erkenntnise zur Hirnforschung. So kommen sie zum Beispiel dem Rätsel auf die Spur, wie ein winziges Bienenhirn seine weitläufige Umwelt verarbeitet.“
Etwa zur gleichen Zeit gaben einige Wissenschaftler an der Harvard-Universität bekannt, dass sie zusammen mit dem Monsantokonzern „Hightech-Drohnen“ entwickelt hätten – sogenannte „Mobees“. Sie sollen als Arbeitsbienenersatz bei der Bestäubung von Nutzpflanzen eingesetzt werden, wenn das „Bienensterben“ anhalte. (Gleichzeitig arbeitet man in Kalifornien an der Entwicklung von Ernte- bzw. Pflückrobotern, um die zunehmend streikfreudigeren mexikanischen Saisonarbeiter zu ersetzen. Das aber nur nebenbei.)
Für den Bienenforscher Jürgen Tautz entstehen auf diese Weise jedenfalls langsam aber sicher „gläserne Bienenvölker“, die die „Bienenpersönlichkeit in all ihren Facetten enthüllen.“
.

Löwin im Westzoo, photographiert von Susanne Memarnia mit Handy. Die Löwen des Tierparks, so hörte ich, wurden an den Eberswalder Zoo „abgegeben“. Nach der Französischen Revolution verlangte die Nationalversammlung von den Verwaltern der königlichen Menagerie, dass der Löwe fortan nicht mehr als „König der Tiere“ gelten dürfe. Der Revolutionshistoriker Michelet träumte zur selben Zeit republikanisch gesinnt davon, die dort gefangen gehaltenen Löwen und Tiger wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die wahre Naturgeschichte vorzutragen. Nach der Russischen Revolution träumten sowjetische Dichter Ähnliches. In Kornej Tschukowkijs Poem „Das Krokodil“ heißt es: „Wir zerbrechen unsere Gewehre/Wir vergraben unsere Kugeln/Und ihr feilt euch/Die Krallen und Hörner ab!“ In der Berliner Zeitschrift „Tierstudien“ (7/2015) erwähnt die Slawistin Dagmar Burkhart weitere. Ich muß sagen, dass ich selbst das (poetische) Abfeilen der Krallen und Hörner niemandem zumuten möchte, bei den Kleinkatzen versuche ich stattdessen jedenfalls, ihnen das schmerzhafte Festkrallen durch ehrliches Aua-Schreien abzugewöhnen – und es funktioniert. Bei den Geparden ist das übrigens nicht nötig. Und von einem Bauern, Matthias Stührwoldt aus Holstein, ist es ähnlich: Er will jetzt seine „enthornten“ Kühe durch solche mit Hörnern ersetzen – und hat deswegen den Stall umgebaut und, weil er deswegen seine Herde reduzieren mußte, einige Hektar Pachtwiesen zurückgegeben.
Im Tierpark quartierte man anfangs die Löwen im Schloß Friedrichsfelde ein. Ist das nicht eine wunderbare sozialistische Volte? 1955 sprang jedoch die Löwin „Sonja“ aus dem Fenster des 1. Stocks in den Garten – als ein Tierarzt sie behandeln wollte. Dabei brach sie sich ein Bein. „Ihr Pfleger, Willy Freimuth, wachte damals Tag und Nacht bei seinem eingegipsten Liebling, bis dieser über die Krise hinweg war,“ erinnerte sich Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (1969, Berliner Tierpark-Buch Nr.8).
……………………………………….
In der Weimarer Republik fehlte es den Zoos in Deutschland zunächst an Geld, mehrere mußten schließen, aber ab 1933 ging es wieder aufwärts, überdies wurden etwa 10 neue geschaffen, gleich mehrere im Ruhrgebiet (!), besonders üppig bedachten die Nazis den neuen – „im Stil der völkischen ‚Heimatschutzarchitektur‘ errichteten“ – Nürnberger Zoo, die Presse bezeichnete ihn nach der Eröffnung 1939 als „schönsten Tiergarten Deutschlands“. In mehreren Zoos wurde besonderen Wert auf die Sammlung deutscher Tiere gelegt, im Berliner Zoo wurden als Hinweis auf diese Tiere kleine Hakenkreuze an ihre Gehege angebracht. „Die fortdauernde Propaganda der Nazis sorgte dafür, dass der sonntägliche Familienausflug in den Zoo zum unverzichtbaren Teil der deutschen Alltagskultur wurde,“ heißt es weiter in Colin Goldners Bericht über „Die deutschen Tiergärten zwischen 1933 und 1945 (in den „Tierstudien“ 7/2015 zum Thema „Zoo“). Der Psychologe und Tierrechtler Colin Goldner hat mehrere zookritische Bücher herausgegeben. Für sein Buch „Lebenslänglich hinter Gittern – die Wahrheit über Gorilla, Orang-Utan & Co in deutschen Zoos“ hat er die Lebensumstände aller hier im Land gehaltenen Menschenaffen studiert. Er hält fast alle Käfige und Gehege der etwa 450 deutschen Menschenaffen für mangelhaft. Überdies würden die Zoos die Menschenaffen „geradewegs in den Wahnsinn“ treiben, insofern sie deren menschenähnliche Bedürfnisse auf ein Minimum reduzieren und sie mit Psychopharmaka traktieren.
.
.
Die Giordano-Bruno-Stiftung stellte Goldners Buch 2014 auf einer Pressekonferenz vor, auf der u.a. die Politologin Laura Zimprich zu Wort kam. Sie berichtete über ihre Mitarbeit als Tierschützerin an der Erstellung des staatlichen „Säugetiergutachtens“. Die Zoodirektoren wehrten sich in diesem Expertengremium am vehementesten gegen eine Erweiterung der Gehege für Menschenaffen über die bisherigen 50 Quadratmeter im Haus und 50 Quadratmeter davor im Freien – für eine Orang-Utan-Familie z.B.. Den Zoos geht es laut Laura Zimprich in erster Linie um zahlendes Publikum, denen sie eher mit der „Disneylandisierung“ ihrer Einrichtungen entgegenkommen wollen. Überdies würden viele Direktoren noch wie Lutz Heck denken, der den Berliner Zoo von 1932 bis 1945 leitete, und einer Besucherin einmal erklärte: „Wir bieten unseren Tieren lebenslängliche Versorgung, einen Arzt, wenn sie krank sind, freie Wohnung, Schutz gegen böse Feinde, kurzum, lebenslängliche Pension und Versicherung. Wie viele Menschen haben eine so gesicherte Zukunft vor Augen?“
.
In seinem Aufsatz über „Nazi-Zoos“ hat Goldner sich auf die Zoodirektoren-Dynastie der Hecks konzentriert. Nebenbei erwähnt er noch, dass auch die „Verwaltungsräte der deutschen Großzoos spätestens seit 1937 ausnahmslos der NSDAP und/oder sonstigen Gliederungen des NS-Staates angehörten.“ Bei den Hecks verfolgte schon der Vater Ludwig Heck (geb. 1860) und dann auch seine Söhne Lutz (geb. 1892) und Heinz (geb. 1894) die Idee eines „Deutschen Zoos“. Nach dem Krieg wurden die Hecks aus dem Verband Deutscher Zoodirektoren (VDZ) ausgeschlossen – mit der Begründung, dass sie sich aktiv in den Dienst der Nazi-Ideologie gestellt hätten, „die Söhne als Mitglieder der NSDAP und Fördermitglieder der SS,“ zudem hatten sie, ebenso wie ihr Vater, enge Beziehungen zu den höchsten Naziführern geknüpft. In einem Jubiläumsband des Münchner Tierparks Hellabrunn, wo Heinz Heck von 1927 bis 1969 Direktor war, steht das Gegenteil: „Heinz Heck war der einzige deutsche Zoodirektor, der bis zuletzt nicht Mitglied der NSDAP wurde.“ Colin Goldner schreibt: „Eine wirkliche Aufarbeitung der Verstrickung der deutschen Zoos in den Nationalsozialismus wurde bis heute nicht vorgenommen.“
.
Auch wenn es um „artgerechte“ Haltung geht, sind die Zoodirektoren wie erwähnt nicht besonders kritisch, höchstens die Tierpfleger, aber sie äußern sich darüber, wenn überhaupt, nicht öffentlich. Oder kaum. In einem Dokumentarfilm über Menschenaffen: „Nénette“ von Nicolas Philibert geht es um vier Orang-Utans im Pariser Jardin des Plantes, vor allem um „Nénette“ – eine 40jährige Orang-Utan-Frau. Vor ihrem Käfig befinden sich die Kamera, Pfleger und Besucher, von letzteren kommen einige jeden Tag, erzählen ihr Wissen über Nénette, ebenso die Affenpfleger, einer betreute sie 35 Jahre lang. Weil Nénette mit ihrem Sohn Tubo zusammen lebt, bekommt sie die Antibabypille. Geboren wurde sie 1969 auf Borneo, 1972 kam sie in den Jardin des Plantes. Eine Zuschauerin fragt sie: „Willst du mit mir reden?“ Eine Pflegerin meint: “So lange in Gefangenschaft zu sein, ist natürlich schrecklich, wir fühlen uns hier alle schuldig.” Weil einige Besucher sich küssten, machten es irgendwann die Orang-Utans nach. Bei rothaarigen Besucherinnen machen sie Kußgesten zu ihnen hin…
Inzwischen redet die kritische Forschung bereits nicht mehr von „artgerecht“, sondern von „Tierwohl“ (manchmal auch von „Wohlbefinden“), was insofern ein kleiner Fortschritt ist, als damit eine zunehmende Individualisierung der Tiere in der Wahrnehmung stattfindet und damit auch die „tierliche Freude“ in das Zentrum rückt, wie Philipp von Gall aus der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim kürzlich in einem Vortrag im Rahmen der Berliner Ausstellung „Animal Lovers“ ausführte. In Hohenheim erforschen Veterinäre neuerdings z.B. die „Freude“ von Mastschweinen in ihren Ställen. Ein anderer Vortrag, von Sven Wirth – aus der Berliner „Human-Animal-Studies-Gruppe ‚Chimaira'“, thematisierte den Begriff „Agency“, was so viel wie Handlungsmacht und Wirkmacht bedeutet. Wenn Nutztiere ernsten Widerstand „leisten“, z.B. auf oder vor einem Schlachthof, bekommen sie, auch wenn sie zuletzt erschossen werden, einen Namen – aber erst dann. Halbernsten Widerstand zeigen u.a. Hunde ständig – indem sie z.B. bei jedem Baum nicht mehr weiter gehen wollen. Eigentlich hat man als Tierhalter oder Tierpfleger täglich mit „tierlichem Widerstand“ zu tun, den man bricht oder versucht zu verhandeln oder erfreut zur Kenntnis nimmt: Auf „Youtube“ findet man dazu bereits tausende von Videoclips. Sven Wirth meinte abschließend, es gehe sowohl um eine Analyse der Herrschaftsverhältnisse, in denen die Tiere stecken, als auch um ihre „Agency“, die die feministische Biologin Donna Haraway sogar den Labortieren nicht absprechen will.
.
Am Berliner Zoo stand ein Flakturm, deswegen wurde er trotz der von den Nationalsozialisten extrem verschärften Tierschutzgesetze und der großen Anstrengungen seines Direktors Lutz Heck, aus „seinem“ Tiergarten einen deutschen „Tierhag“ zu machen, von den Alliierten in Grund und Boden bombardiert. „Am späten Nachmittag des 1. Mai 45 stürmten Soldaten der Roten Armee den Berliner Reichstag. Am 2. Mai setzte sich der überzeugte Nazi, Lutz Heck (der im Zoo geboren worden war) mit einigen seiner engsten Mitarbeiter ab und ließ den völlig zerstörten Zoo führungslos zurück.“ Die Russen fahndeten nach ihm, weil er Tiere aus den von Deutschen besetzten Teilen der Sowjetunion entführen ließ. Zuvor hatte er mit seinem Bruder, der Direktor des Münchner Tierparks war, verschiedene Rinderrassen auf den ausgestorbenen Auerochsen hin zurückgezüchtet. Da ihnen das nur näherungsweise gelang, nennt man die Nachkommen heute „Heck-Rinder“. Die im Berliner Zoo wurden durch das Bombardement getötet, „Die Zeit“ sprach dabei von einem „Artensterben“. Einige Heck-Rinder müssen jedoch überlebt haben, denn kürzlich ließ ein englischer Bauer einige Tiere seiner „Heckrinder-Herde“ töten, woraufhin die Bild-Zeitung titelte: „Zu aggressiv: Sieben ‚Nazi-Kühe‘ mussten sterben.“
.
Nachdem der „berühmt-berüchtigte Lutz Heck“, wie Hediger ihn nennt, verschwunden war, „übernahm nach hitzigen politischen Debatten schließlich der Zoo-Chauffeur die Führung und ließ sich sein Amt als Leiter der Aufräumarbeiten vom Bürgermeister des Bezirks Tiergarten bestätigen. Ende Juni erschien ein zweiter Leiter auf der Szene, ein Aushilfskellner des Hauptrestaurants, der sich vom Hauptmagistrat die Anweisung hatte geben lassen, sich des Zoos anzunehmen. Natürlich gab es Machtkämpfe zwischen den beiden Leitern, die lautstark ausgetragen wurden, und bald beschwerten sich die Besatzungsmächte beim Magistrat wegen Trunkenheit der beiden Herren, worauf der Magistrat diese ab- und die Biologin Frau Dr. Katharina Heinroth als kommissarische Leiterin einsetzte.“
.
Sie hatte ihre Doktorarbeit über die Gliederfüßerklasse „Springschwänze“ verfaßt und dann mit ihrem Mann Tauben gezüchtet. Vier Wochen zuvor erst war er gestorben. Katharina Heinroth schreibt in ihren „Erinnerungen“: „Sein Lebenswerk war vernichtet. Er wollte nicht weggehen, sondern dableiben. ‚Lieber möchte ich mit allem untergehen,‘ sagte er. Zuletzt wollte er immer wieder geküsst werden, dann sank sein Kopf mit den Worten ‚Ach ist das schön!‘ zur Seite…Er kam nicht mehr zu Bewußtsein, flüsterte aber anscheinend angstvoll: ‚Die Pferde, die Pferde!'“ – Seltsame letzte Worte eines berühmten Vogelforschers, dem es besonders die Enten angetan hatten.
.
Der sowjetische Kriegsberichterstatter Wassili Grossman ging damals etwa zur selben Zeit durch den zerstörten Berliner Zoo. In seinem Kriegstagebuch notierte er: „Hier hat es Kämpfe gegeben. Zerstörte Käfige. Leichen von Affen, tropischen Vögeln und Bären. Die Insel der Paviane, junge Äffchen, die sich mit winzigen Händchen an ihre Mütter klammern. Gespräch mit einem alten Mann, der die Tiere seit 37 Jahren pflegt. Im Käfig ein toter Gorilla. Ich: ‚War er böse?‘ Er: ‚Nein, er hat nur laut gebrüllt. Die Menschen sind böser‘.“
.

.
Während Wassili Grossman dabei vielleicht an die verfluchten Nazis dachte, hatte der Tierpfleger eher plündernde Wilderer im Sinn. „Bei allen Kriegsgreuel war dies das Schrecklichste,“ schreibt Katharina Heinroth, die zuvor zwei Mal von Soldaten vergewaltigt worden war. Über den Gorilla, der dann, wie auch viele andere tote Tiere, im Zoo vergraben wurde, heißt es in ihren „Erinnerungen“: „August Liebetreu, der stadtbekannte Affenwärter, trauerte vor allem um den eben erwachsenen Gorilla Pongo, den er mit zwei Stichen in der Brust tot im Käfig vorfand, zusammen mit zwei erschossenen Schimpansen.“
.
Ihr 26 Jahre älterer Mann, Oskar Heinroth, hatte sich bereits Anfang der Zwanzigerjahre um eine Wiederansiedlung von vernichteten Tierpopulationen bemüht. Über die der Schwäne schrieb er: Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Schwäne, die den preußischen Königen gehört hatten und die sie durch Abnehmen der Hand zeitlebens flugunfähig machen ließen, in Berlin und auf den umliegenden Havelseen nahezu verschwunden,“ man hatte sie und auch ihre Eier „gestohlen“ – und aufgegessen. Die neue Republik wollte nach Krieg und Monarchie den Schwanenbestand wieder auffüllen, 1922 beauftragte die Potsdamer Stadtverwaltung Oskar Heinroth damit. Dieser unternahm daraufhin eine längere Dienstreise und stahl dann in Ostpreußen eine Anzahl bebrüteter und frischer Höckerschwan-Eier am Lucknainer See. Von den daraus geschlüpften Schwänen ließ er jedoch nur noch einer Hälfte „die Hand eines Flügels abnehmen“, dem anderen Teil beließ er die „Flugkraft“. Weil die Schwäne zusätzlich auch noch durch ein neues Gesetz ganzjährig geschützt wurden, gelang Heinroth schließlich die „Neubesiedlung der Potsdamer Gewässer“:
„Wer Sinn für die Schönheit eines Tiers hat, konnte sich dann wieder an Schwänen erfreuen, die zwei vollständige Flügel haben, also nicht so unnütz und stark verstümmelt sind, wie man dies leider fast immer sehen muß. Auch das herrliche Flugbild und der wunderbare Flugklang der dahinziehenden Höckerschwäne wird wieder ein Bestandteil der Volksseele, wie es in alten Zeiten war.“
.

Trauerschwäne. Der aus Australien stammende Trauerschwan (Black Swan) wird dort relativ leidenschaftlich erforscht. Die Zoologen der Universität Melbourne z.B. wollten Genaueres über das Paarungsverhalten von schwarzen Schwänen wissen. Dazu untersuchten sie einige Jahre lang 250 von ihnen gekennzeichnete Vögel, die im Albert Park Lake leben. Im Ergebnis kam dabei heraus: Eins von 20 Paaren trennt sich nach einiger Zeit wieder, unabhängig davon ist ihr Hang zur Untreue groß (etwa 15% aller jungen Schwäne werden unehelich geboren). Wenn einer der Elterntiere stirbt, sucht sich der andere nach etwa einem Monat einen neuen Partner. Dabei haben angeblich die Männchen , deren Federn stark „gekräuselt“ sind, größere Chancen als die eher glatt gefiederten. Das aber nur nebenbei. Um weitere Erkenntnisse über die „Trauerschwäne“ zu gewinnen, bittet das australische Trauerschwan-Forschungsprojekt um die Mitarbeit der Bevölkerung – und spricht dabei von „Citizen Scientists“. Der Wissenssoziologe Bruno Latour hatte zuvor bereits von „Mitforschern“ gesprochen, die wir, spätestens jetzt – in unserer verwissenschaftlichten Welt – alle werden müssen. In den Zoos gehören dazu in erster Linie die Tierpfleger – wozu es sogenannte „Keeper-Talks“ dort gibt (der Begriff wird deswegen auf Englisch verwendet, um den deutschen Zoodirektoren und ihren Beratern verständlich zu bleiben.
Die schwarzen Schwäne führen ein „weitgehend nomadisches Leben“. Damit man ihre Wege und Aufenthalte wenigstens im Bundesstaat Victoria kennt, braucht das australische Projekt („myswan.org.au“) möglichst viele Beobachtungsteilnehmer. Um sie empathisch zu motivieren, werden auf „Facebook“ laufend Neuigkeiten über einen Trauerschwan namens „Dane“ veröffentlicht und wer wissen will, ob es ein Leben nach der Scheidung auch unter den Schwänen gibt, für den haben die Schwanforscher den Facebook-Eintrag „the Albert Park divorcée“ eingerichtet. Im Band Vögel 1 von „Grzimeks Tierleben“ (1968) fand ich die Bemerkung bzw. Beobachtung, dass die schwarzen Schwäne die einzigen unter den sieben Schwanarten sind, bei denen sich Männchen und Weibchen beim Brüten abwechseln, auch seien die Größenunterschiede zwischen ihnen geringer als bei den anderen. Wikipedia fügte nun hinzu: Diese Art habe „außerdem den längsten Hals aller Schwäne“. Bereits in „Brehms Tierleben“ aus dem Jahr 1911 (Band 6 Vögel 1), das noch acht Schwanarten erwähnt (eine ist inzwischen ausgestorben), war man voll des Lobes über den „Trauerschwan“ gewesen: „Schon im Schwimmen ziert er ein Gewässer in hohem Grade, seine eigentliche Pracht aber entfaltet er erst, wenn er in höherer Luft dahinfliegt…In stillen Mondscheinnächten fliegen die Trauerschwäne von einer Lache zur andern und rufen sich dabei beständig gegenseitig zu, zur wahren Freude des Beobachters.“ Im übrigen „hängen“ auch die Trauerschwan-Paare wie alle anderen „mit treuer Liebe aneinander, und eine einmal geschlossene Ehe gilt für das ganze Leben.“ Das war jedoch wie erwähnt zu vorschnell geurteilt bzw. die christliche Paartreuemoral auf die Tiere projiziert. Im Tierpark Friedrichsfelde hingen die beiden Trauerschwäne desungeachtet ständig zusammen, aber seit ein paar Monaten sehe ich nur noch einen. Vielleicht wurde der andere vom selben Fuchs geholt, der auch etliche Flamingos im Tierpark riss. Zu Dathes Zeiten lebte einmal für lange Zeit ein Fuchs im Tierpark, der zum Jagen nach draußen ging. Man sagt, dass Raubtiere und auch Greifvögel nie in ihrem Revier jagen. Der derzeitige Fuchs im Tiergarten beweist, dass das ebenfalls keine Regel ist. Im Gegensatz zu der, dass Jäger ausschließlich in ihrem eigenen Revier wildern.
.

Unzertrennliche (Love Birds): kleine Papageien, die in der afrikanischen Savanne leben und ebenfalls eine starke Paarbindung haben sollen. Der Verband der Zoologischen Gärten teilt auf seiner Internetseite mit: „Die Gattung Agapornis umfasst 9 Arten. Mit Ausnahme des Grünköpfchens (A. swindernianus) werden alle Arten in VdZ-Zoos gezeigt.“ Während der Balz und der Brut füttert das Männchen das Weibchen – wenn auch mitunter fast nur symbolisch. „Dies kann als Gebärde der Paarbekräftigung gedeutet werden,“ schreibt Roger Alfred Stamm vorsichtig geworden in seiner Doktorarbeit „Aspekte des Paarverhaltens von Agapornis personata Reichenow“, die auf „Gefangenschaftsbeobachtungen“ basiert.
………………………………………………………….
Die Dozentin für interdisziplinäre Tierforschung Mieke Roscher und die Umwelthistorikerin Anna-Katharina Wöbse, beide von der Universität Kassel, haben sich mit den zwei Berliner „Zoos im Wiederaufbau und Kalten Krieg 1955 bis 1961“ beschäftigt (in: „Tierstudien“ 7/2015), die ihnen als „Projektionsflächen des Kalten Krieges“ gelten . Im Westberliner Zoo sollte mit dem 1955 errichteten neuen Elefantenhaus „eine andere Verbindung zwischen Tier und Mensch“ ermöglicht werden, „indem die Tiere nur durch einen Graben von den Besuchern getrennt wurden.“ Der zwei Jahre später ins Amt gekommene Direktor Heinz-Georg Klös wollte dann einen ganzen Zoo aus einem Guß „nach eigenen Plänen neu entstehen lassen“ – es dem Tierparkdirektor Heinrich Dathe nachmachend. Zu dem Zeitpunkt war die „Konkurrenz im Osten der Stadt“ bereits bedrohlich geworden. Der Finanzsenator, dem der Zoo unterstand und immer noch untersteht, schimpfte oder klagte 1959: „Die Ostzonalen Behörden haben aus politischen Gründen, d.h. um die Bevölkerung der Zone und Ostberlins vom Besuch des Zoos abzuhalten, unter dem größten materiellen Aufwand in Friedrichsfelde einen Tierpark eingerichtet, der ständig weiter ausgebaut wird.“ Wohl an die Adresse der Bonner (Berlinhilfe-)Regierung und der Westalliierten gerichtet, hieß es: Alle Anzeichen würden darauf hindeuten, „dass die Sowjetregierung keine Kosten scheut, um dieses Unternehmen zu einer Institution hochbedeutsamen Charakters zu machen.“ Der Zoodirektor Klös legte bei der Tierbeschaffung laut den beiden Autorinnen „sein Hauptaugenmerk auf die Publikumsmagneten“, die Auswahl der Tiere wurde aber auch „stets mit Blick auf die Konkurrenz im Osten getroffen.“ So führte Klös vor dem Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses 1959 aus, „man solle sich auf die Zucht und Haltung von Affen konzentrieren. Diese seien im Osten aufgrund fehlender Devisen nicht so leicht zu bekommen.“ (Gleich nach der Wende wurden die dann später doch vom Ostberliner Tierpark angeschafften Menschenaffen als erstes in den Westen rüberentführt!) Während im Westzoo Tiere von Unternehmern gespendet und dann auch nach ihnen benannt wurden, bekam der Osttierpark finanzielle Unterstützung durch Betriebsbelegschaften. Hinzu kamen hier freiwillige Aufbaustunden im Rahmen des „Nationalen Aufbauwerks“ – von Direktor Dathe initiiert, dennoch lebten die Tiere im Tierpark noch bis 1960 in provisorischen Unterkünften. Ungeachtet der Tatsache, dass der eine Zoo wiederaufgebaut und der andere neugebaut werden mußte, zeichneten sich beide Einrichtungen „durch einen rasanten Zuwachs ihres Tierbestandes“ aus. Überhaupt boomte der Tierhandel in der Nachkriegszeit, fast alle deutschen Zoos wollten ihre Tierbestände wieder auffüllen.
.
Die DDR-Zoos litten dabei nicht nur an Devisenmangel, sondern mußten bei den Tierhändlern im Westen auch erheblich mehr als die Westzoos zahlen. Der Leiter des Aquariums im Meeresmuseum Stralsund z.B., Karl-Heinz Tschiesche, war deswegen ab 1983 fast schon systematisch von Seeleuten der Handelsflotte mit Korallenfischen versorgt worden, wie er in seinen Erinnerungen „Seepferdchen, Kugelfisch und Krake“ (2005) schreibt. Weil er im Westen für eine Garnele, die 18 DM kostete, bis zu 250 Mark der DDR zahlen mußte, für einen Schmetterlingsfisch gar 1000 Mark, griff er die Idee eines Matrosen auf, sich Fische aus dem Roten Meer, wo die Schiffe stets eine längere Liegezeit hatten, mitbringen zu lassen. Er rüstete daraufhin zwei Schiffe mit je zwölf Aquarien aus. Am Anfang waren die Verluste hoch, weil die Offiziere und Mannschaften keine Erfahrung mit den anspruchsvollen Korallenfischen hatten, aber dann kamen die Ehefrauen der Offiziere, die alle zwei Jahre mit auf Fahrt gehen durften, darauf, sich während der fünfmonatigen Reise, da sie nichts zu tun hatten, der Tiere anzunehmen. Seitdem „war der Gesundheitszustand der Fische bei ihrer Ankunft in Rostock immer ausgezeichnet“. Und Tschiesche sparte zigtausend Mark. Zudem profitierten auch noch die Aquarianer von den Fängen.
.
Angeblich war der „Gesundheitszustand“ der Tiere auch im Ostberliner Tierpark ziemlich gut – und mit 12% Todesfälle im Jahr 1959 sogar im internationalen Maßstab der Zoologischen Gärten, in denen 16 bis 36% der Tiere im Vergleichszeitraum starben, sehr gut. Mitunter versuchte man im Westen diese Erfolge politisch zu boykottieren: Als der Tierpark eine französische Poitou-Eselsstute erwarb, wurde ihr der Transit durch Westdeutschland verboten. Die Stute mußte umständlich nach Antwerpen und von dort per Schiff in die DDR gebracht werden, auf dem sie seekrank wurde, wie Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (1969) berichtete. Im Ost-West-Wettbewerb zählten auch die Besucherzahlen. Der Osttierpark und der Westzoo veröffentlichten – quasi zum Systemvergleich – laufend ihre diesbezüglichen Zuwächse, wobei der Ostberliner mit den Jahren immer besser abschnitt. Das änderte sich erst nach der sogenannten Wende, allerdings mit äußerst gemeinen Mitteln von Seiten des Westens, wie in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter auszuführen sein wird. Der neue Direktor von Zoo und Tiergarten, Knieriem, macht gerade seine Vorstellungstour durch die Hauptstadt-Medien, auch die taz will er mit einem Besuch ehren. Im Tierpark mißfällt einigen Beschäftigten, dass er statt eines täglichen Rundgangs nur gelegentlich mit dem Auto die Hauptwege entlangfährt. Niemand wird diesem Veterinär vorwerfen, dass er ein echter Tiernarr ist.
.

Poitou-Esel. Sie sind eine gefährdete Großeselrasse, die nach dem westfranzösischen Gebiet Poitou benannt und vor allem für die Feldarbeit gezüchtet wurde. Die oben von Dathe erwähnte Eselstute wurde von seinem Kölner Kollegen, Dr. Windecker, aus Paris vom Kabarett „Lido“, wo sie allabendlich mit leichtbekleideten Mädchen zusammen aufgetreten war, abgeholt und bis Antwerpen begleitet. Das DDR-Schiff geriet dann im Skagerrak in einen Sturm. Als es der Eselstute immer schlechter ging, funkte der Kapitän nach Rügen: „Erbitte Genehmigung, dem Sturmzentrum ausweichen zu dürfen, seekranker Esel an Bord.“ Rügen funkte zurück: „Verbitten uns alberne Anfragen, haben zur Zeit andere Sorgen.“ Der Kapitän blieb jedoch hartnäckig und es gelang ihm, die Rügener Leistelle zu überzeugen, was dann durch den Umweg dazu führte, dass die Eselstute erst drei Tage später als geplant in Rostock ankam. Aber es ging ihr wieder besser. Im Ostberliner Tierpark gebar sie ab 1963 mit dem Eselhengst „Goliath“ mehrere Fohlen. Die „Reproduktion“ – das ist ja in den Zoos immer das Wichtigste – sie gilt ihnen dort sogar als der Indikator für eine optimale Haltung der Tiere.
……………………………………………..
Zurück zu den Autobiographien. Der Veterinär und spätere Direktor des Zoos in Frankfurt/Main Bernhard Grzimek (geb. 1909) hat seine Autobiographien aufgeteilt – in den einen geht es um seine Erlebnisse und Erfahrungen mit Tieren, in der anderen – „Auf den Mensch gekommen“ (1974) geht es genaugenommen darum, wie er mit List und Tücke all das durchsetzte, was dann als sein „Lebenswerk“ galt, d.h. bei welchen wichtigen Personen und Institutionen er mit allerlei Tricks Erfolg hatte. Alles im Dienste der Tiere! Seine große Neugier, sie alle kennen zu lernen, brachte ihn sogar dazu, einmal eine gemischte Raubtiergruppe als Dompteur in einem Zirkus vorzuführen. Auch als Nazi-Beamter schaffte er sich noch laufend neue Tiere an, um sie privat zu studieren und zu zähmen. Wie selbstverständlich ging er davon aus, dass seine Frau sie zu Hause versorgte. In ihren biographischen Tierbüchern erwähnt sie es gelegentlich – mit leisem, ironisch abgefederten Vorwurf.
.
Das Ehepaar Grzimek hatte seine zwei Rhesusaffen, die es in seinem Eigenheim in Berlin-Johannisthal hielten, rechtzeitig – 1944 – in den Hallenser Zoo evakuiert, die beiden Tiere hatten den Krieg dort auch einigermaßen überstanden, wurden dann aber beim Einmarsch der Russen als Kriegsbeute beschlagnahmt – für den Zoo in Kiew, der ebenfalls wieder aufgebaut werden mußte, nachdem die Deutschen ihn zerstört und geplündert hatten. Schon im Ersten Weltkrieg hatten sie dort die meisten Tiere gestohlen und wahrscheinlich aufgegessen.
.

Gelbbrust-Kapuziner, tagaktive Baumbewohner aus Brasilien, die in größeren Gruppen leben. Im Tierpark haben sie seit 2001 eine große Freianlage am Affenhaus. Seit 2004 beteiligt man sich dort am Erhaltungsprogramm für diese Tiere. Ich halte sie für die aufmerksamsten Tiere gegenüber den Besuchern. Aber mehr als die Menschen interessieren fast alle Tiere die (angeleinten) Hunde.
………………………………………………..
Der Direktor des Berliner Zoos, Lutz Heck, hatte 1944 ebenfalls seine Tiere in bombensichere Zoos untergebracht, die Mehrzahl nach Mülhausen in den dortigen Zoo. Insgesamt wurden 750 Tiere ausquartiert. „Davon kehrte acht Jahre nach dem Krieg lediglich die Giraffenkuh ‚Rieke‘ aus Wien zurück,“ wie Heinz-Georg Klös, Hans Frädrich und Ursula Klös in ihrer „tiergärtnerischen Kulturgeschichte von 1844 bis 1994“ (1994) berichten.
.
Die Grzimeks hatten vor dem Zweiten Weltkrieg u.a. versucht, einen Wolf zu zähmen. Bernhard Grzimek hatte ihn beim Händler bestellt und war dann auf Dienstreise gegangen. Hildegard Grzimek hatte er nur gesagt: Wenn das „Wölfchen“ kommt, nimm es aus dem Kistchen und pack es in den Wäschekorb. Es kam dann aber ein „ausgewachsener Wolf“. In „Mein Leben für die Tiere“ (1964) berichtet Hildegard Grzimek: Die Transportarbeiter wuchteten ihn in seiner Kiste in den Keller bis vor einen offenen Käfig. Als sie die Kiste öffnete, wollte der Wolf nicht rauskommen. Also nahm sie allen Mut zusammen und kroch in seine Kiste: „Er machte keine Miene mich anzugreifen, und da – packte ich ihn kurzentschlossen um den Leib und schleppte ihn mit großer Anstrengung aus der Kiste in den Käfig. Da waren wir nun! Er stand und ich saß flach vor ihm auf dem Käfigboden.“ Vorsichtig rutschte sie rückwärts zur Käfigtür. „Ein Satz, und draußen war ich. Rasch machte ich die Käfigtür zu und hing das große Schloß vor.“ Als ihr Mann nach ein paar Tagen zurückkam, erzählte sie ihm, was geschehen war: „Er verfärbte sich im Gesicht, wurde aschgrau und mußte sich setzen. ‚Das ist ja eine tolle Geschichte,‘ entfuhr es ihm. ‚Das war nicht Mut, das war bodenloser Leichtsinn; noch dazu ganz allein im Keller. Glück hast du gehabt, unvorstellbares Glück.“ Er drehte einfach ihren Vorwurf um.
.
In seinen eigenen Erinnerungen „Tiere, mein Leben“ (1984 – dem Jahr, in dem seine Frau starb) beschreibt Bernhard Grzimek das Geschehene quasi ordnungsgemäß: „Als die Riesenkiste ankam, versammelte sich die ganze Straße um die gewaltige Behausung, die einen stattlichen Löwen einschließen könnte. Es ist sehr still darin. Nachdem wir die Kiste an den Käfig stellen, von vorn mit Fleisch locken und von hinten mit einer Stange stochern, kommt ein ansehnlicher Bursche heraus. Er steht den ausgewachsenen Wölfen im Berliner Zoo an Größe kein bißchen nach, stelle ich mit leisem Unbehagen fest. Als Tierbändiger wollte ich mich eigentlich ja nicht betätigen.“ Das tat er dann aber doch – und aus dem Wolf wurde schließlich ein „liebenswürdiger ‚Hauswolf’“. Später spielte er – „Dschingis“ genannt – eine Rolle in dem dramatischen Film „Tiefland“ , den Leni Riefenstahl in den Dolomiten drehte. Dort starb er durch ein Mißgeschick der Filmleute.
.
Auf andere Weise seltsam ist das Verhältnis von Realgeschichte und Erinnerung in der „Biographie“ von Gudrun Baroness von Uexküll (geb. 1878) über ihren Ehemann, den Biologen Jakob von Uexküll (geb.1864). Sie erwähnt darin ein Duell ihres Mannes in jungen Jahren, das große Bedeutung für ihn gehabt habe. Der Medizinhistoriker Florian Mildenberger las ihr Buch „Jacob von Uexküll – eine Welt und seine Umwelt“ (1964) im Rahmen seiner Forschung über Uexküll. Im „Universitätsgerichtsarchiv der Universität Dorpat“ (heute: Tartu), wo Uexküll einst studiert hatte, suchte er dann jedoch vergeblich nach einem Hinweis auf den Vorfall – und kam zu dem Schluß: „Das Duell hat nie stattgefunden.“ In Uexkülls eigenenen biographischen Aufzeichnungen, ich glaube in „Niegeschaute Welten. Die Umwelten meiner Freunde. Ein Erinnerungsbuch“ (1936), fand ich eine bemerkenswerte Eintragung, vielleicht ist sie ebenfalls unwahr: Auf ihren estländischen Latifundien beschäftigte sein Vater unter vielen anderen auch einen Schäfer, zu dem sich der junge Jakob von Uexküll besonders hingezogen fühlte. Einmal standen sie irgendwo zusammen und unterhielten sich, als jemand dazu kam, den der Schäfer gut kannte, aber nicht erkannte, obwohl er ausgezeichnet sehen konnte. Er entschuldigte sich Jakob gegenüber mit den Worten: „Meine Schafe kann ich alle voneinander unterscheiden, aber bei Menschengesichtern gelingt mir das nicht so gut.“ – Ein Tierpfleger nach meinem Herzen. „Über Tiere habe ich immer mehr gewußt als über meine engsten menschlichen Freunde,“ schrieb aber auch der Mitbegründer der Ethologie Konrad Lorenz. Ähnlich meinte die Schriftstellerin Doris Lessing, dass sie immer mehr über ihre gestorbenen Katzen als über ihre verstorbenen Freunde und Verwandte getrauert habe.
.

Baumstachler, auch Neuweltstachelschweine genannt, gehören zu den Nagetiere.
………………………………………………
Im Westberliner Zoologischen Garten hatten 91 Tiere den Krieg überlebt. Katharina Heinroth (geb. 1897) und die wenigen noch vorhandenen Mitarbeiter machten sich zusammen mit etwa 200 „Trümmerfrauen“ sofort an den Wiederaufbau – bis sie von einem Juristen, der zuvor am „Volksgerichtshof“ tätig gewesen war und 1956 Aufsichtsratsvorsitzender der Zoo AG wurde, abgemahnt und 1957 entlassen wurde. Auch die anderen „Honoratioren“ im Aufsichtsrat „überboten sich mit Schikanen gegen sie,“ wie die Biologiehistoriker Ekkehard Höxtermann und Armin Geus in ihrem Beitrag „Abwicklung im Reich der Tiere“ für ein Symposium über Heinrich Dathe schreiben, der später veröffentlicht wurde (siehe unten).
.
Dem stramm antikommunistischen Aufsichtsrat der Zoo AG mißfiel an der ersten weiblichen Zoodirektorin in Deutschland (daneben gab es noch eine in Bern und in San Diego), nicht zuletzt, dass sie gelegentlich Tiere mit dem Direktor des Ostberliner Tierparks Heinrich Dathe Tiere tauschte und ihm überhaupt freundlich verbunden war. Ihre Entlassung begründete der Aufsichtsrat des Zoos laut Katharina Heinroth damit, „dass sie den weiteren Aufbau des Zoos nicht einer Frau anvertrauen wollten. Falls es schief ginge, müßten sie sich schuldig fühlen, eine Frau ans Ruder gelassen zu haben, einem Mann könnte man dagegen die Schuld zuschieben.“ Zuvor hatten die Aufsichtsräte Katharina Heinroth ein von ihr geplantes zoobiologisches Verhaltensforschungsinstitut, „unverzichtbar für einen wissenschaftlich geleiteten Zoo,“ verweigert. Vorgedacht hatte dieses bereits der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger (geb. 1908), verwirklicht wurde dann ein solches Institut ab 1958 von Heinrich Dathe (geb. 1910) – als Teil seines Tierpark-Projekts. Einige haben es ihm übel genommen, dass er sich dort auch noch zum Leiter kürte.
.
Kürzlich erschien aus Anlaß des 125jährigen Bestehens des Verbandes der Zoodirektoren (VDZ) ein üppiger Band: „Gärten für Tiere. Erlebnisse für Menschen“. Er enthält neben Kurzdarstellungen von 62 VDZ-Mitgliedzoos, Porträts von ebenso vielen Verbands-Funktionären und -Mitgliedern, und eine Galerie „Berühmter Tiergärtner“. Den angesehenen Ostberliner Tierparkdirektor Heinrich Dathe sucht man darin vergeblich. Wohl weil er 1. „nationalsozialistisch belastet“ war und 2. einem „kommunistischen Regime“ an prominenter Stelle diente. Ersteres gilt allerdings mindestens auch für die in der „Galerie“ gewürdigten Zoodirektoren Geheimrat Ludwig Heck (Berlin) und seinen Sohn Professor Lutz Heck (Berlin) sowie für Dr. Bernhard Grzimek (Frankfurt/Main), um nur diese drei zu nennen. Wahrscheinlich waren damals fast alle deutschen Biologen, sofern sie nicht Juden waren, überzeugte Anhänger des ersten sich biologisch fundierenden Staates: Es taten sich für sie dadurch Karrieren ohne Ende auf. Die Ignoranz der Funktionäre des Verbandes der Zoodirektoren in bezug auf Heinrich Dathe wird noch unerträglicher, wenn man weiß, dass ihr „offizielles“ Verbandsorgan „Der Zoologische Garten. Zeitschrift für die gesamte Tiergärtnerei“ jahrzehntelang von Heinrich Dathe herausgegeben wurde – zur Vertiefung und Verbreitung zoobiologischer Erfahrungen, Erkenntnisse und Fortschritte in der Tierhaltung.
.
Der estländische Biologe Jakob von Uexküll (geb. 1864), der den Begriff der „Umwelt“ in die biologische Forschung einbrachte und 1925 Leiter des Hamburger Aquariums wurde, aus dem dann sein „Institut für Umweltforschung“ entstand, veröffentlichte bereits 1920 und dann noch einmal 1933 ein wegweisendes Buch mit dem Titel „Staatsbiologie: Anatomie-Physiologie-Pathologie des Staates“. Er entwarf darin das Ideal eines im organischen Sinne „gesunden“ politischen Gebildes. Im gleichen Jahr unterzeichnete er das „Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler“. Thomas Mann urteilte bereits 1921 über ein anderes Buch von ihm: „Ich las in der ‚Theoretischen Biologie‘ von Uexküll. Stellte fest, daß die Beschäftigung mit biologischen Dingen, auch wenn sie neuer, geistfreundlicher, antidarwinistischer Art ist, in politicis konservativ und streng macht. Ähnliches lag bei Goethe vor.“
.
Der Biosemiotiker Andreas Weber meinte 2003 in seinem Buch „Natur als Bedeutung“ über die „Staatsbiologie“ des baltischen Barons: „Auch Jakob von Uexküll ist damit ein Beispiel für die Verzauberungskraft, die von völkischen Idealen auf die holistischen und romantischen Tendenzen der Wissenschaft in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausging.“ Andere Freunde des Umwelt-Begriffs und der Blindenhundschule von Uexküll sprechen von seiner „Verirrung“. Das „Berliner Institut für Faschismus-Forschung und Antifaschistische Aktion“ schreibt: „In seinem Buch ‚Staatsbiologie‘ machte er für die ökonomischen und politischen Krisen des Kaiserreichs und der beginnenden Weimarer Republik ‚Parasiten am Gemeinschaftskörper‘ verantwortlich, und zwar insbesondere ‚Fremdrassige‘, die ‚in einem kranken Staate, der nur noch schwach auf ihre Eingriffe reagiert‘, gut gedeihen könnten. ‚Solange der Betrieb des Staates geregelt weiterging‘ (im alten Kaiserreich), habe der Staat ‚die Möglichkeit (gehabt), den einzelnen Arbeitsfeindlichen durch einen Arbeitswilligen zu ersetzen, der wohl stets vorhanden war. Sobald aber eine größere Zahl Arbeiter aus der Arbeitskette zurücktrat und streikte, stand das betroffene Staatsorgan vor dem Untergang‘. Deshalb forderte er ein staatliches ‚Streikverbot‘.“ (2013 streikten übrigens die Mitarbeiter der beiden „Großstadtzoos“ für „artgerechte Löhne“, sie fühlten sich wie „Scheißeschipper“ behandelt: 1100 Euro netto – das ist zu wenig, sagten sie. Im Leipziger Zoo verdienten ihre Kollegen 1000 Euro mehr im Monat.)
.

Azara-Aguti, ebenfalls Nagetiere – aus Mittel- und Südamerika.
…………………………………………………
Während der Nazizeit forderten Biologen noch ganz anderes als Uexküll zuvor. Dem Bienenforscher Karl von Frisch drohte Berufsverbot: Ernst Bergdolt, ein im „Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund“ organisierter Botaniker am Münchner Institut für Zoologie, wo von Frisch Direktor war, schrieb 1936 in einem Brief an das Reichserziehungsministerium: „Professor von Frisch hat ein unübliches Talent, seine Forschungsergebnisse für propagandistische Zwecke zu missbrauchen, ein Talent, das wir von jüdischen Wissenschaftlern kennen. Dagegen fehlt ihm völlig die Fähigkeit, seine Wissenschaft von einem weiteren Gesichtspunkt zu überschauen oder gar, was doch bei seinem speziellen Arbeitsgebiet, den Bienen, so nahe liegend und leicht wäre, Beziehungen zu finden zu der naturgegebenen Einrichtung eines völkischen Staatswesens.“
1941 wurde Karl von Frisch (geb. 1886), dem man 1973, zusammen mit dem einstigen Nazi-Biologen Konrad Lorenz den Nobelpreis verlieh, als „Mischling zweiten Grades“, „Vierteljude“, eingestuft – und aus seinem Institut entfernt. Als dann aber der Schädling „Nosema apis“, ein „Sporentierchen“, unter den deutschen Bienenvölkern wütete, über dessen Bekämpfung von Frisch schon 1927 publiziert hatte, setzte man ihn nach „Intervention eines hochrangigen Fürsprechers“ als „Sonderbeauftragten“ ein, wie der Anthropologe Hugh Raffles in seiner „Insektopädie“ (2013) schreibt – und das Ernährungsministerium verschob von Frischs „Entfernung aus dem akademischen Milieu ‚bis nach Kriegsende‘.“ (Seine autobiographischen Bücher kann man übrigens z.T. im Internet runterladen.)
.
Bei dem „Fürsprecher“ handelte es sich um den Veterinär Dr. Bernhard Grzimek: Der „Gefolgsmann“ arbeitete seit 1933 als Unterabteilungsleiter erst im Landwirtschaftsministerium und dann in dessen Massenorganisation „Reichsnährstand“, wo er für „Eierüberwachung, Schlachtgeflügel und Bienenhaltung“ zuständig war. Um Unterstützung für Karl von Frisch hatte ihn sein Förderer Otto Koehler, damals Direktor des Zoologischen Instituts und Museums in Königsberg, gebeten. Grzimek schrieb daraufhin laut seiner Biographin Claudia Sewig dem Kultusministerium „mit dem Briefbogen des Ernährungsministeriums“, dass Karl von Frischs Bienenforschung außerordentlich wichtig sei, „um die Honigerträge zu erhöhen und die deutsche Ernährung zu verbessern“.
.
Mit dem Hinweis auf diesen Brief unterstützte Otto Koehler nach dem Krieg wiederum Bernhard Grzimek selbst, als der wegen verschwiegenem NSDAP-Mitgliedsantrag seine Anstellung als Direktor im Frankfurter Zoo verlor. Auch in diesem Fall war das Schreiben hilfreich. 1941 war Karl von Frisch nicht nur weiterbeschäftigt worden, man erweiterte sogar „die Nosema-Aufgabe um den Forschungsauftrag, Bienen zu veranlassen, um einer Rationalisierung der Bestäubung willen, nur ökonomisch wertvolle Pflanzen aufzusuchen. Jahrzehnte zuvor hatte von Frisch bereits mit Duftorientierung experimentiert – indem er Bienen dressierte, auf einen bestimmten Geruch anzusprechen, bevor er sie freiließ, damit sie die entsprechende Blume aufsuchten -, doch es war ihm nicht gelungen, kommerzielles Interesse zu wecken.“ Das änderte sich mit dem sich ausweitenden Krieg und den Autarkiebestrebungen des deutschen Reiches. Raffles schreibt: „Diesmal, wachgerüttelt durch eine sich abzeichnende Misere, nationale Begeisterung und Neuigkeiten über ein breitangelegtes sowjetisches Forschungsprogramm ähnlichen Zuschnitts, drängte sogar die Reichsfachgruppe Imker auf Unterstützung seiner Arbeit.„
.
Arabische Oryx-Antilope, sie sind an eine Umwelt mit wenig Wasser angepaßt. Die Arabische Oryx war 1972 in ihrem Habitat ausgerottet, wurde aber dort wieder angesiedelt. Dank Zuchtprogrammen und Auswilderungen gab es 2011 wieder circa 1000 wildlebende Exemplare auf der Arabischen Halbinsel. Was Wikipedia optimistisch berichtet, sieht man im Tierpark eher pessimistisch, anläßlich der Geburt einer Oryx-Antilope im Mai 2016 heißt es auf seiner Internetseite: „Das lässt hoffen. Und macht wehmütig zur gleichen Zeit. Denn in freier Wildbahn leben nur etwa 1.000 Tiere ihrer Art.“
……………………………………………………….
Das sowjetische Forschungsprogramm hatte nicht zuletzt Karl von Frisch selbst durch seine Schriften befördert, die vom sowjetischen Biologen Jossif Chalifman ins Russische übersetzt worden waren. In seinem „Kleinen Bienenbuch“, das in den Fünfzigerjahren in der DDR erschien, schreibt Chalifman: „Die Methode der Bienendressur verbreitete sich schnell“ in der Sowjetunion. Dies geschieht mittels einer Zuckerlösung, die mit dem Duft der entsprechenden Blüte versehen wird. Damit konnte man die Tiere sogar dazu bringen, „Blüten auch solcher Pflanzenarten zu besuchen und erfolgreich zu bestäuben, auf denen sie nicht einmal süße Nektarnahrung fanden.“ Neben Flieder erwähnt Chalifman Weinreben: „Auf der Krim beobachteten Imker, wie die dressierten Bienen in Massen mit Höschen aus Blütenstaub vom Wein zu den Stöcken zurückkehrten. Niemals hatten Bienen den Wein besucht, und hier besuchten die mit Sirup aus den Blüten der [georgischen] Rebe ‚Tschausch‘ gefütterten Bienen nur diese Sorte. Unfehlbar fanden sie diese unter Dutzenden anderer Sorten heraus. Die Bienen erwiesen sich als fähig, die Weinsorten zu unterscheiden.“
1930 hatte Karl von Frischs Kollege Gustav A. Rösch „Eine bienenkundliche Reise durch Sowjetrussland“ unternommen und dort vor allem Bienenzucht-Versuchsstationen besucht. Damals wurden analog zu den Kolchosen und Sowchosen überall „Kollektivimkereien“ und „Staatsbienenstände“ eingerichtet. Die Honigproduktion sollte damit, nicht zuletzt für den Export, gesteigert werden. Rösch fand die Chancen dafür außerordentlich gut, denn zum Einen wurde das Land noch nicht so wie in Westeuropa von intensiver Landwirtschaft genutzt und zum Anderen gab es für die Bienen große Trachtquellen: Buchweizenfelder, Sonnenblumenfelder und Lindenwälder z.B.. Ausführlich befaßt sich der Autor in seinem Reisebericht mit dem „Rotkleeproblem“ der UDSSR: Es gab dort für die Befruchtung dieser Pflanze seltsamerweise nicht genug Hummeln. Rösch konnte nicht herausfinden, warum, aber im Kaukasus lebte eine Bienenrasse – die mingrelische – mit einer für die Kleeblüten ausreichenden Rüssellänge. Diese nun im übrigen Russland für den Rotklee einzusetzen, darüber forschte insbesondere eine Versuchsstation nahe Moskau, die zu diesem Zweck zunächst 70 „Rotkleebeobachtungsstationen“ über das Land verteilt eingerichtet hatte.
Die Nachkriegsdirektorin des Westberliner Zoos, Katharina Heinroth, hatte bei Otto Koehler in Königsberg promoviert – über das Hörvermögen von Reptilien. Währenddessen lernte sie an ihrer Universität Breslau den Bienenforscher Gustav A. Rösch kennen, mit dem sie nach München zog, wo die beiden heirateten und sie dann ebenfalls über Bienen forschte. 1933 wechselte sie nach Halle, wo sie sich mit Springschwänzen beschäftigte, sich von Rösch scheiden ließ – und den Ornithologen Oskar Heinroth heiratete.
.

Hauskaninchen, domestizierte Wildkaninchen
.

Schafe im Streichelzoo
…………………………………………
Über den erst jüngst wieder im Westen „nationalsozialistisch belasteten“ Zoologen Heinrich Dathe und sein „Lebenswerk“, den Ostberliner Tierpark, fand 2010 ein Kolloquium in seinem vogtländischen Geburtsort Reichenbach statt, dessen Vorträge 2015 als Buch erschienen: „Heinrich Dathe – Zoologe und Tiergärtner aus Leidenschaft“ betitelt. Der 1910 geborene Dathe hatte bereits als Jugendlicher ornithologische Berichte veröffentlicht, wenig später wurde er Mitglied eines Ornithologischen Vereins, nach Gründung der DDR und Auflösung der Vereine leitete er im Kulturbund der DDR die Fachgruppe der Vogelkundler und gab die Zeitschrift „Beiträge zur Vogelkunde“ heraus. Einer Journalistin erzählte er in den Achtzigerjahren: „In den schlimmsten Situationen, wenn ich ganz auf der Nase lag, war da immer irgendwo ein Vogel, der meine Aufmerksamkeit erregte und mich auf andere Gedanken brachte.“ Als Biologiestudent trat er bereits frühzeitig, 1932, der NSDAP bei, 1936 schrieb er seine Doktorarbeit – über den Penis der Meerschweinchen; auch das erste Tier in „seinem“ neuen Ostberliner Tierpark 1955 war dann ein Meerschweinchen – mit Namen „Hansi“ (sein letzter Kontrahent, der Direktor des Zoologischen Gartens in Westberlin, Heinz-Georg Klös, schrieb nebenbeibemerkt seine Veterinär-Doktorarbeit 1953 über den Uterus der Meerschweinchen). Aber schon bald rollten die Tiertransporte an, der erste „große“ kam von Hagenbeck aus Hamburg.
.

Hausmeerschweinschen, domestiziertes Nagetier aus Südamerika
.

Hellbraunes Wieselmeerschweinchen. Die ersten Exemplare des Hellbraunen Wieselmeerschweinchens wurden in der Provinz Cochabamba in Brasilien gefunden. Erst 2004 wurde dem Hellbraunen Meerschweinchen (auch Münstersches genannt) der Artstatus zuerkannt.
.

Kleine Maras, man nennt sie auch kleine Pampashasen – eine Unterart der Meerschweinchen. „In den Zoos ist der Kleine Pampashase gegenüber dem Großen Pampashasen (Dolichotis patagonum) eher selten zu sehen,“ behauptet Wikipedia. Garantiert sind all diese apodiktischen Einträge von Biologiestudenten – als Seminararbeit – angefertigt worden: So jetzt kann niemand mehr über Kleine und Große Maras etwas Nichtobjektivistisches mehr auf Wikipedia verbreiten. Neulich korrigierte eine Freundin einen Eintrag über weibliche Ejakulation: Es gibt sie. Drei Mal mußte sie daraufhin die Rückkorrektur von Biologiestudenten im letzten Semester: Alles Einbildung – wieder löschen, bis sie sich endlich durchsetzen konnte.
.

Große Maras – im Freigehege bei den Vikunjas. „Der Große Pampashase ist nach dem Capybara (Wasserschwein) – dem größten lebenden Nagetier – der größte Vertreter der Meerschweinchen. Der Körperbau der großen Pampashasen wird als hasenähnlich beschrieben, was vor allem an den langen Beinen und den großen Ohren liegt. Bis auf diese beiden Merkmale ähneln sie anderen Meerschweinchen.“ (Wikipedia) Ergänzend heißt es auf „tierdoku.com“: „Die trockene Pampa ist ihr natürlicher Lebensraum. Insbesondere grasige Wiesen mit spärlichem Strauch- und Baumbewuchs werden von den Tieren bevorzugt. Dichte Wälder und andere geschlossene Habitate werden strikt gemieden.“ Wie man auf dem Photo sieht, sind sie mit diesen Umweltvorlieben im Vikunjagehege richtig. Ob sie dort auch die selben Freßfeinde wie in der Pampa haben – Füchse und größere Greifvögel wie Eulen und Adler – kann man noch nicht sagen. Ich nehme aber an, Nachts kommen sie sowieso in ihren Stall.
.

Auf der Vikunjawiese leben auch noch einige Darwinnandus.
………………………………………………….
Nach dem Studium wurde Dathe Assistent im Leipziger Zoo, obwohl er in jungen Jahren die Zoos immer für „Tiergefängnisse“ gehalten hatte. 1939 zog man ihn zum Wehrdienst ein. Wegen einer Schußverletzung kam er ins Lazarett, wo sich eine junge Krankenschwester um ihn kümmerte: Elisabeth Friedrich. 1943 heirateten die beiden, kurz darauf wurden ihre drei Kinder geboren. Elisabeth Dathe veröffentlichte 1966 das Buch „Bäreneltern wider Willen“ und steuerte dann für Heinrich Dathes Buchreihe „Im Tierpark belauscht“ gelegentlich launige Berichte bei. Gegen Kriegsende geriet ihr Mann in britische Gefangenschaft und wurde bis 1947 bei Rimini interniert, wo er baden konnte und einige Mittelmeertiere erforschte (u.a. Seepferdchen), daneben hielt er im Lager zoologische Vorträge, was mit einer Zusatzverpflegung honoriert wurde. Als ehemaliges Mitglied der NSDAP verlor er nach der Rückkehr zunächst – ähnlich wie Bernhard Grzimek – seine Arbeitsstelle (im Leipziger Zoo). Es dauerte zweieinhalb Jahre, während der er als Aushilfspfleger im Zoo und als Vogelstimmenimitator beim Rundfunk arbeitete und gegen Honorar ornithologische Aufsätze verfasste, bis man zu der Überzeugung gelangte, dass er „trotz des frühen Eintritts in die NSDAP und späterer gelegentlicher Stellungnahmen für die Partei die NS-Ideologie kaum verinnerlicht hatte,“ wie der Leipziger Zoologe Lothar Dittrich in seinem Symposions-Beitrag ausführte. Danach durfte Dathe wieder im Leipziger Zoo arbeiten und wurde dort stellvertretender Direktor. Der Biologe Karl Max Schneider (geb. 1887), der 1934 Direktor des Leipziger Zoos geworden war, den er bis 1954 derart „modernisierte“, dass er „Weltgeltung“ erlangte, wurde ähnlich entnazifiziert wie sein Assistent Dathe. Schneider wurde laut den Mitteilungen des Verbandes der Zoologischen Gärten attestiert, „dass er, obwohl Parteimitglied, Distanz zum nationalsozialistischen Regime hielt,“ das erlaubte ihm, seine Position auch nach dem Krieg beizubehalten. Er wurde dann der bekannteste Zoodirektor der DDR, „beliebt bei Groß und Klein“, außerdem als Nationalpreisträger sowie mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber geehrt und konnte als Leiter einer Kommission beim Ministerium für Kultur die Entwicklung der Tiergärten in ganz Ostdeutschland fördern.“ Er bekam dann auch noch eine regelmäßige Tiersendung im Fernsehen. Zu seinem Glück starb er vor der Wende 89. Dathe brachte posthum etliche seiner Zootier-Erlebnisse als Buch heraus.
.
Im Zuge des „Neuen Kurses“ nach dem Aufstand am 17.Juni 1953 kam in der SED die Idee eines Tierparks in der DDR-Hauptstadt Ostberlin auf, wofür man Heinrich Dathe gewann. Der Publizist Knut Holm, der zwei Bücher über Heinrich Dathe veröffentlichte („Glanz und Elend des Prof.Dathe“, 1991, und „Leben und Erbe Prof. Dathes“, 1996), die aber nahezu identisch sind), meint, der Grund für die Gründung des Tierparks war die im Westen durchgeführte „Währungsreform“, danach konnten sich die Ostberliner die neuen DM-Eintrittspreise des Westberliner Zoos nicht mehr leisten, woran auch die dortige Einführung einer „Ostmarkkasse“ wenig änderte. Dathe machte sich dann für das Gelände um den Schloßpark Friedrichsfelde stark: „Das Schloß gefiel mir“. Sowohl den Zoologischen Garten in Charlottenburg als auch den Schloßpark in Friedrichsfelde hatte einst Peter Joseph Lenné gestaltet. Für die Zwecke des Tierparks wurde das 160 Hektar große Areal von der Gartenarchitektin Editha Bendig und ihrem Kollektiv behutsam umgestaltet, später auch noch das im Krieg zerstörte Schloß und renoviert. Ab 1954 „warb Dathe in öffentlichen Veranstaltungen für sein Tierparkprojekt, das beim Lichtenberger Kulturamt angesiedelt war. Rundfunkserien und Fernsehsendungen haben ihn, den Tierpark und seine Tiere fest in der Erinnerung mehrerer Generationen verankert,“ heißt es im Symposiums-Beitrag des Bezirksverordneten von Lichterfelde, Jürgen Hofmann. 1956 gründete Dathe zudem eine „Gemeinschaft der Förderer des Tierparks“ sowie eine „Bärenlotterie“, die bald zu einer der Haupteinnahmequellen wurde. Außerdem beteiligten sich viele Ostberliner ehrenamtlich am Aufbau des Tierparks – mit insgesamt 272.903 Stunden. Daneben stifteten nicht wenige Betriebe Tiere: der VEB Kälte z.B. einen Eisbären, das Ministerium für Staatssicherheit sinnigerweise Stachelschweine, der VEB Malerei und Glaserei fünf Guanakos. Auch viele Zoos im Westen und im Osten schenkten der neuen Einrichtung Tiere. All das gab der Anlage in Friedrichsfelde den Charakter eines (proletarischen) „Volkstierparks“ – und stand im Gegensatz zu dem 1848 von bürgerlichen und adligen Honoratioren auf Aktienbasis gegründeten Zoologischen Garten in Charlottenburg. Der mußte dann auch nach Eröffnung des Tierparks erst einmal erhebliche Einahmeeinbußen hinnehmen – vor allem dadurch dass die Ostberliner fortan „ihren“ Tierpark besuchten. Bereits am Tag der Eröffnung war die antikommunistische Westberliner Kampfpresse dagegen in Stellung gegangen. „Die Welt“ schrieb: „Mit dem heutigen Tag gibt es zwei Zoologische Gärten in Berlin. Das Bestreben, die Ostbewohner von der mit einem Zoobesuch verbundenen Fahrt in die Westsektoren abzuhalten, hat zu diesem Kuriosum geführt…Hier dominieren Konkurrenzabsichten.“ Nur dass die „Ostberliner Bauherren“ es billiger als die im Westen gehabt hätten: „Über 100.000 unbezahlte Arbeitsstunden mußten von ‚freiwilligen“ Aufbauhelfern geleistet werden. 125.000 Ostmark mußten Ostberliner Schulkinder in Klingelfahrten an den Wohnungstüren auftreiben. 3000 private Handwerker führten kostenlose Reparaturen aus, für die ihnen der Baustab nicht einmal das Material zu stellen vermochte. Auch der in den letzten Wochen eingetroffene Tierbestand fiel zu Lasten von Betrieben und Verwaltungen.“ Wenig später hieß es in der „Welt“, dass da „mit Tieren Politik gemacht wird“ und dass man das Schloß Friedrichsfelde abreißen wolle: „Stattdessen werden die Ostberliner in den nächsten Jahren ein HO-Café an gleicher Stelle vorfinden“. Das Gleiche schrieb dann auch der Tagesspiegel.
.
Schon 1911 hatte Carl Hagenbeck vom Kaiser die Erlaubnis erhalten, auf 40 Hektar in der Jungfernheide im Wedding einen „Volks-Tierpark“ zu errichten – für die dortige Arbeiterbevölkerung, Eine Konkurrenz zum Zoologischen Garten sah der Kaiser darin nicht. Weil Hagenbeck aber 1913 starb, kam sein Projekt zum Erliegen. 1929 gründete sich ein „Verein zur Förderung eines Volkstierparks in Groß-Berlin“, woraufhin die Vossische Zeitung den „Volkstierpark“-Gedanken erneut propagierte, einige Jahrzehnte zuvor hatte sie sich bereits für einen Vorschlag zur Abschaffung des Eintrittsgeldes beim Zoologischen Garten erwärmt und dabei seine „Gemeinnützigkeit für alle“, seinen „stillen erheiternden Naturgenuß für Arm und Reich“ und „schönen Zweck einer wahren Volksbelehrung“ herausgestrichen. Es kam noch hinzu, dass die Aktiengesellschaft Zoologischer Garten während der Inflationszeit 1922-23 „die Tore verriegelt“ hatte“, wie Knut Holm schreibt. Der Magistrat erklärte sich bereit, den Zoo zu übernehmen, aber die Aktionäre zogen es vor, stattdessen einen Teil des Tierbestands und des Zoogeländes zu verkaufen: „So entstand der UFA-Palast am Zoo“ und später das „Bikini-Haus“ (1984 kam jedoch – nach hinten raus, über den Landwehrkanal – wieder Gelände hinzu). Obwohl SPD und KPD sich 1929 für einen „Volkstierpark“ stark machten, und etliche Künstler ihren Antrag unterstützten, u.a. Käthe Kollwitz und Alfred Döblin, wurde er im Stadtparlament abgelehnt. Als Dathe die Idee dann 1955 realisierte, versprach er im „Neuen Deutschland“ den zukünftigen Besuchern: Sie würden dort „spüren, was das Wort Tierpark im eigentlichen Sinne bedeutet: vollkommene Harmonie von Landschaft und Tier.“ Den Tierphotographen versprach er: „Aussparungen im Gitterwerk der Gehege, damit sie ihre großen Objektive hindurchstecken können.“ Gleichzeitig garantierte er, „daß es niemandem, sooft er auch kommen mag, langweilig im Tierpark wird, weil unsere Schauspieler – die Tiere – immer wieder neue Inszenierungen bringen.“
.
Der „Volksbildungsauftrag“ gilt nahezu unverändert bis heute. Im Ostberliner Tierpark, der in der Wende als erster DDR-Betrieb eine Arbeitervertretung wählte, noch mehr als im Westberliner Zoo, weswegen es im Tierpark eine Vielzahl von Anbindungen an Forschungs- und Bildungseinrichtungen gab, eine begründete Dathe selbst: Die Forschungsstelle für Zoo- und Wildtierforschung. Dazu wurde auch die Ausbildung der Tierpfleger von ihm erstmalig wissenschaftlich organisiert (bis dahin waren sie bessere Ausmister gewesen). Heinrich Dathe hatte den Begriff „Volkstierpark“ bereits gleich zu Anfang benutzt, zuletzt sprach er jedoch davon, das sein Ostberliner Tierpark ein „Wissenschaftszoo“ sei und der Westberliner ein „Schauzoo“.
.

Nepal-Uhus. Sein Lebensraum sind die niederschlagsreichen Waldregionen des Himalaya, Indochinas und Malaysias. Aufgrund seines auffälligen, menschenähnlichen Rufes wird der Nepal-Uhu in einigen Regionen Sri Lankas auch als „Teufelsvogel“ bezeichnet. Aha.
………………………………………………..
Schon gleich nach den für die CDU-Ost so erfolgreichen Märzwahlen in der DDR 1990 bahnte sich Dathes Ende an. Er merkte schnell, dass da ein „böses Spiel“ mit ihm getrieben wurde. Als auch die Öffentlichkeit davon erfuhr, kamen einige tausend Ostberliner zusammen und demonstrierten für sein Bleiben im Tierpark. Ähnlich wie 1958 halb Zürich mit einem Fackelzug für den Verbleib ihres Zoodirektors Heini Hediger gegen den Kündigungsbeschluß des Aufsichtsrates demonstrierte, aber dort war der Protest erfolgreich. Hier bekam Dathe 1990 zwar noch die „Konrad-Lorenz-Medaille“ des Wiener Volksbildungswerkes verliehen, aber wenig später erhielt er schon die Kündigung vom neugewählten Ostberliner Magistrat, konkret von der Stadträtin für Kultur, Irina Rusta, die dabei ihrem Westberliner Berater und Stellvertreter Richard Dahlheim folgte, der wiederum vom Direktor des Zoologischen Gartens, Heinrich-Georg Klös, dahingehend motiviert wurde. Dazu gibt es ein, wie Knut Holm es nennt: „fatales Telefongespräch“, das der Reporter Boris Brock von der inzwischen abgewickelten „Neuen Berliner Illustrierte“ zehn Tage nach dem Tod Dathes mithörte – zwischen dem Westberliner Zoodirektor Heinz-Georg Klös und dem stellvertretenden Stadtrat Richard Dahlheim, in dem es um Dathe ging. Brock hatte ein Interviewtermin mit Dahlheim und wartete im Vorzimmer, dessen Tür offen stand. In dem aufgeräumten Telefongespräch sagte Dahlheim – lachend: „Jetzt bin ich hier der Totengräber. Dabei war es doch ein Akt der Barmherzigkeit, den endlich in Ruhestand zu schicken…“ Dahlheim: „Na, wir teilen uns die Last an seiner Leiche…“ Wieder lachend. Dahlheim: „Übrigens kommt gleich dieser Reporter, den müssen wir mal recherchieren lassen, was unser Freund Dathe während der Nazizeit gemacht hat. Ihren Namen lasse ich natürlich raus.“ Ende des Telefongesprächs. Freundlich bittet Dahlheim dann den Reporter in sein Zimmer. Ihm erzählt er, er habe es satt, sich als „Mörder“ abstempeln zu lassen, und es müsse doch auch mal gesagt werden, dass der Professor Dathe am Schluß „total senil“ gewesen sei. Gerade habe er mit Professor Klös vom Westberliner Zoo telefoniert – wirklich ein exzellenter Fachmann, auch der hätte ihm dringend geraten, den Dathe endlich aus dem Rennen zu nehmen. Das Pech sei eben, dass der Professor Dathe zum „passend unpassenden Zeitpunkt verstorben“ sei, und ihm grause jetzt schon davor, dass er jetzt bestimmt auch noch als „Fachmann“ gewürdigt werde, der „uns allen fehlen wird“. Dabei habe er doch bei vielen als „Ceaucescu des Tierparkwesens“ gegolten.
.
All das schrieb der Reporter Brock in seinem NBI-Artikel, aus dem die „Berliner Zeitung“ dann einen Tag vor der Trauerfeier für Dathe die wichtigsten Passagen in einem Kommentar mit dem Titel „Der Superlativ von ‚herzlos'“ übernahm. Er wurde am 16. Januar 1991 veröffentlicht. Am 11.März erschien an gleicher Stelle eine Gegendarstellung von Dahlheim. Darin beteuerte er, kein „Abwickler“ zu sein, der altersbedingte Ruhestand von Professor Dathe sei im Einigungsvertragn festgeschrieben worden, der Magistrat habe sogar die Amtszeit von Dathe bis zum Jahresende 1990 verlängert. Nie hätte er Dathe „höhnisch hinterhergeredet“. Die aus dem Telefongespräch zitierten Sätze seien „frei erfunden“. Er habe sogar häufig seine Betroffenheit über den Tod von Dathe geäußert. Zuvor, am 25.Januar, hatte bereits „Die Zeit“ den Fall aufgegriffen: „Dieser Dahlheim hielt es anscheinend für seine Pflicht, noch über den Tod hinaus abzuwickeln. Heinrich Dathe, über den viele sagten, er sei an gebrochenem Herzen gestorben, weil er die Abschiebung in den Ruhestand und die drohende Zerstörung seines Zoos nicht verkraftet hatte, wurde von Richard Dahlheim noch posthum verhöhnt und geschmäht.“ Mitte 1991 meldete die „Morgenpost: „Der Countdown läuft. Heinz-Georg Klös verläßt die Kommandobrücke von Berlins Arche Noah – er ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender des Tierparks Friedrichsfelde.“ In seinem ersten Buch über Dathe hatte Knut Holm dazu bereits eine Zoobesucherin, Marie Nehmer, die als 40jährige mit ihrem Mann geholfen hatte, das Schloß im Tierpark zu renovieren, zitiert: „Nun haben sie es geschafft. Das war von Anfang an sein Ziel und seine Absicht. Sie neideten Prof. Dathes Weltruhm. Wer kannte denn Klös?“ 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, 2010, kam auch der „Spiegel“ noch einmal auf den „Fall Dahlheim“ zu sprechen.
.
Ich ergänze: 1993 forderte eine Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung Lichtenberg, das Schloß aus dem Tierpark herauszulösen, was dem Senat schriftlich empfohlen wurde. Zu dieser Mehrheit gehörte auch die CDU, einer ihrer Bezirksverordneten war damals Thomas Ziolko. Er ist Gründungsmitglied der Freunde und Förderer vom Schloß Friedrichsfelde“ und seit 2004 auch noch Vorsitzender der „Gemeinschaft der Förderer von Tierpark Berlin und Zoologischem Garten Berlin e.V.“. Sollte er etwa ein U-Boot in dieser „Massenorganisation“ sein? Oder hatte er sich – im Gegenteil – in der Stadtverordnetenversammlung sogar für die Zugehörigkeit des Schlosses zur Tierparkkonzeption, wie sie von Dathe einst geplant worden war, eingesetzt, und sich darüberhinaus aktiv um den Erhalt und den Ausbau des Tierparks gekümmert, was er auch weiterhin tue, wie mir dort jemand sagte?
.

Ellipsenwasserböcke. „In der Familie der Wasserböcke gibt es eine Art, die dem Beobachter sofort ins Auge fällt: Es sind die Ellipsen-Wasserböcke. Du erkennst sie an ihrer weißen kreisförmigen Zeichnung auf dem Hinterteil, die diesen Tieren ihren Namen gegeben hat. Der zweite Teil ihres Namens verrät, wo sich diese Tiere gern aufhalten: nahe am und auch häufig im Wasser! Ihr Fell hat eine wasserabweisende Ölschicht, die sie vor Feuchtigkeit schützt,“ heißt es auf der Internetseite der „Serengeti Park GmbH“ in Hodenhagen.Gibt es im Tierpark ein Wasserbecken für sie? Ich kann mich grad nicht erinnern.
……………………………………………….
Klös und Dathe mochten sich nie: „Der Dathe ist dem Klös um so vieles überlegen gewesen“, gab Jennifer, die Tochter des indischen Großtierhändlers Munro, der mit beiden Zoo-Direktoren Geschäfte machte, nach dem versuchten „Schlangenraub“ zu bedenken. „Klös hätte besser Manager als Zoologe werden sollen“, meinte ein ehemaliger Tierpfleger. Zur Verabschiedung Dathes, von der dieser zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht in Kenntnis gesetzt worden war, hatte Klös im November 1990 eine Rede gehalten. Sie ließ bereits Schlimmes erwarten: „Und wenn ich Ihnen, Herr Kollege, an diesem Ehrentag bekenne, dass vieles im Tierpark Friedrichsfelde mich so begeistert, dass ich es mir auch zwischen Kudamm und Landwehrkanal vorstellen kann, dann werten Sie es bitte als Ausdruck höchsten Respekts“. Professor Dathe verstand ihn sofort! Er hatte sowieso trotz gegenteiliger Bekundungen offizieller Vertreter Berlins schon „begründete Befürchtungen, dass in Berlin Pläne geschmiedet wurden, im Zuge der Vereinigung der Stadt die Bedeutung des Tierparks aus Gründen der Kosten und der Stadtpolitik herunterzufahren, ‚abzuwickeln’…Solchen Absichten stand der aufrechte Mann zweifellos im Wege. Und nun gelang es einer skrupellosen Verwaltung, den alten Mann durch kaltschnäuzige Schreiben, durch anmaßende Stellungnahmen, durch Indiskretionen und Gerüchte so unter psychischen Druck zu setzen, daß seine Physis versagte,“ schrieb der Direktor des Zoos Hannover Lothar Dittrich nach Dathes Tod..
.
All das kam auf dem Kolloquium in Reichenbach zur Sprache. Dathe bekam nicht nur eine sofortige Kündigung zugestellt, er mußte auch binnen vier Tagen sein Büro räumen und zwei Wochen später seine Dienstvilla. Danach, d.h. eine Woche später, starb er. Mit ihm entließ man auch 170 seiner Mitarbeiter, die Verbliebenen 286 kamen zunächst in eine „Warteschleife“, dann wurden schwäbische Stechuhren für sie installiert. Kein Witz! Die Lehrlingsausbildung wurde beibehalten, jedoch nach Westberlin verlagert. Die Menschenaffen wurden ebenfalls in den Westen verschafft. Als man das dann auch noch mit der „Schlangenfarm“ und den Aquarien machen wollte (d.h. mit einem Viertel des Tierbestandes), kam es erneut zu massiven Protesten in Ostberlin, koordiniert vom Tierpark-Betriebsrat, mit dem sich der Zoo-Betriebsrat solidarisierte. All dies bewirkte, dass man vom „Schlangenraub“ wieder Abstand nahm. Hier waren die Ostberliner also erfolgreich. (2) Die für diesen Abwicklungsvorstoß verantwortlich gewesenen Aufsichtsräte der Zoo AG und der Tierpark GmbH waren 13 Westberliner Männer – und was für welche: Heinz-Georg Klös – Aufsichtsratsvorsitzender des Tierparks, Hans Frädrich – Direktor Zoo Berlin und Aufsichtsrat Tierpark, Theodor Strauch – Staatssekretär Finanzen, Peter von Jena – Commerzbank, Ernst-August Pistor – Immobilienfirma Drostel, Hubertus Moser -Landesbank Berlin, Detlef Orwat – Staatssekretär Gesundheit, Dr. Sigart Räthel, Dr. Wilhelm Tegethoff, Dr. Hans Witz-Gall, Heinz Strick – Ex-Finanzsenator, Ingo Treudelenburg – Oberfinanzdirektions-Präsident, Karlheinz Wuthe – Bauplanungsfirma. Nach dem Aufruhr, den ihr „Schlangenraub“-Beschluß im Osten verursacht hatte, wurden schnell noch zwei flexible Ostpolitiker ohne Amt in den Aufsichtsrat gewählt: Ex-Premier Lothar de Maiziere und Ex-Bürgermeister Theo Schwierzina. Zusammen beschlossen sie die „Vereinigung“ von Zoo und Tierpark zum Jahresende 1993, indem der Zoo laut Knut Holm „lächerliche 800.000 DM für sämtliche Anteile am Tierpark zahlte, nicht mehr also, als eine neue Schlangenfarm kosten sollte,“ Grund und Boden sowie Immobilien blieben landeseigen. Die auf Druck der Ostberliner zurückgenommene Übersiedlung auch der Fische in den Aquarien des Tierpark-Restaurants wurde einige Jahre später nachgeholt. Die leeren Becken wurden mit Photos aus den glanzvolleren alten Tierparktagen zugeklebt. Und als zwei „Big Spender“ aus dem Westen, die dem Tierpark wiederholt Geld und wertvolle Tiere geschenkt hatten, der Schlangenfarm eine Kragenechse zukommen lassen wollten, winkte der nach Dathe bestellte Tierparkdirektor Blaszkiewitz ab, „er hatte nicht einmal einen Termin für sie frei,“ schreibt Knut Holm. Darauf kann ich mir keinen Reim machen, und Blaszkiewitz antwortet auch nicht.
.

.
Unterdes war der Tierpark als GmbH also der Aktiengesellschaft Zoologischer Garten angegliedert worden. Um den Westzoo attraktiver zu machen, kam der Plan auf, ein gigantisches Riesenrad dort aufzustellen. Dann wurde im Zoologischen Garten eine „Stiftung Freunde der Hauptstadtzoos“ gegründet, die seitdem von dem ehemaligen CDU-Bürgermeister Eberhard Diepgen geleitet wird. Im Kuratorium sitzen die Söhne von Dathe und Klös (Kuratoren im Tiergarten bzw. im Tierpark), ferner eine Prinzessin von Preussen, ein Vorständler der Stadtreinigung und der Geschäftsführer eines Altenpflegekonzerns. Aufsichtsratsvorsitzender der Zoo AG ist der Finanzvorständler der Berlinwasser Holding GmbH. Auf der Internetseite der Stiftung hat es den Anschein, als wäre die Dathesche „Gemeinschaft der Förderer des Tierparks“ auch bereits in der Diepgen-Stiftung aufgegangen.
.
Bei der Vorstellung der Stiftung vor dem Nilpferdbecken des West-Zoos sagte Eberhard Diepgen: Es ginge dabei zuvörderst um die Finanzierung eines neuen Vogelhauses, eines Nashornhauses und eines Tapirhauses im Zoologischen Garten (für rund 22 Millionen Euro insgesamt), und die Presse möge da bitteschön „mitarbeiten: Wir wollen dem Bürger die Chance geben, sich zu beteiligen. Die Stiftung soll eine Art Bürgerinitiative sein. Ein weiterer Schritt in die Zukunft.“ Es zirkulierte bereits ein „Geheimplan“ zur Modernisierung von Tiergarten und Tierpark: Sie sollten „zeitgemäß“ aufgehübscht und mit mehr „Merchandising“ verknüpft werden. Zu dem Zeitpunkt war der Biologe Bernhard Blaskiewitz (geb. 1954) Direktor beider Zoos geworden. Er war dagegen: Er wolle keinen „Spaß-Zoo“, ihm gehe es um „Zuchterfolge statt Erlebnispark“, Aufgabe der Tiergärten sei es, „Naturschutz zu betreiben“. Dazu gehöre es eher, die Anlagen zur Haltung der Tiere in Gefangenschaft immer „artgerechter“ zu gestalten. Die BZ konterte: „Es geht für den Tierpark auch ums Überleben. Die Modernisierung spart nicht nur Zuschüsse.“ Die „Zoo-Fachfrau“ der Grünen, Claudia Hämmerling, verwies in diesem Zusammenhang auf die erfolgreichen Modernisierungen der Zoos in Hannover und Leipzig. „Besonders der Tierpark wirkt etwas altbacken. Da muss sich schnell etwas ändern,“ erklärte sie der Presse. Auch die Süddeutsche Zeitung fand dann den Tierpark prompt „trostlos“. Andere „Hauptstadtjournalisten“ verwiesen auf den Leipziger Zoo, wo eine 67 Millionen Euro teure „Tropenerlebniswelt Gondwanaland“ mit integriertem Restaurant gebaut wurde. Blaszkiewitz erklärte dazu auf der Pressekonferenz der neuen Stiftung: Bei solch einem Bauvolumen würde er nicht mehr ruhig schlafen können, das jetzige Vorgehen, in kleinen Schritten gewissermaßen, sei sinnvoller. Dazu zitierte er seinen Vorgänger – Heinz-Georg Klös (geb.1926): „Ein Zoo wird niemals fertig.“
2005 hatte Bernhard Blaszkiewitz, zunächst in seiner Eigenschaft als Direktor des Ostberliner Tierparks (davor war er Kurator im Westberliner Zoo gewesen), einen 400seitigen Photoband, mit knappen Erläuterungen versehen, herausgegeben: „50 Jahre Tierpark Berlin“, in dem sowohl die im Laufe der Zeit dort „eingebürgerten“ Tiere als auch der Bau ihrer Gehege, Käfige und Volieren dokumentiert wurden. Da dieses Buch schnell vergriffen war, veröffentlichte Blaszkiewitz, nunmehr Direktor von Tierpark und Zoo, fünf Jahre später eine erweiterte Neuauflage. Für den interessierten Besucher ist dieses anschaulich gemachte Werden des Tierparks, dazu gehören auch viele Photos vom Nachwuchs der dort lebenden Tiere, bis zu den „Umbauarbeiten in der Schlangenfarm“ 2009, sehr hilfreich. Auch die Neuauflage hieß noch immer „Tierpark Berlin“, jetzt heißt er „Tierpark Friedrichsfelde“ – für seine Demontage ist ihnen nichts zu blöd.
.

Gemse, eine in Europa und Kleinasien beheimatete Art der Ziegenartigen. Sie kommen in vielen Bergregionen Europas vor, ihr größtes Revier befindet sich im Hochschwabgebiet in der Steiermark. „Der Tierpark pflegt Alpengemsen aus den Zoozuchten von Innsbruck und Verona,“ heißt es im „Wegweiser durch den Tierpark“ (2013). Was könnte ihr Tierpfleger alles über sie erzählen?! Zu DDR-Zeiten sprach Heinrich Dathe jeden Sonntag im Rundfunk (1774 mal insgesamt) über ein Tier in „seinem“ Tierpark – zusammen mit der Reporterin Karin Rohn. „Im Tierpark belauscht“ hieß ihre Sendung. Für Karin Rohn war jedes Tierparkgespräch eine Überraschung: „Vorher wusste ich nie, zu welchem Tier wir fahren werden“. Das letzte Tierparkgespräch fand im November 1990 statt, kurz nach Dathes 80. Geburtstag – wenige Wochen vor seinem Tod. Danach arbeitete die Reporterin alleine weiter – im Tierpark und im Zoo: „Das Tierparkgespräch mit Karin Rohn“ nannte sie ihre Sendung. Es gibt sie glaube ich nicht mehr. In Dathes populärer „Tierpark-Buch“-Reihe, die ebenfalls „Im Tierpark belauscht“ hieß, schrieb er in der Nr. 8 (1969): „Jeder, der mit offenen Augen, und wenn möglich, auch mit einem bißchen Sinn für Situationskomik in einem Tiergarten arbeitet, hat beinahe täglich mit Menschen und Tieren irgendwelche Erlebnisse, die wert scheinen, festgehalten zu werden.“ Warum diskutierte er dann aber nicht mit einem Tierpfleger statt mit der Rohn, die eingestandenermaßen keine Ahnung von Tieren hatte. Einmal sagte Dathe ihr, sie würden zu der Harpyie fahren. „Was ist denn das für ein Vieh?“ dachte sie – und machte sich schnell kundig, indem sie sich „Brehms Tierleben“ kaufte, das fortan ihre Bibel war. Einige Fernsehredakteure haben sich auch schon gedacht: Warum eigentlich nicht Tierpfleger? .Es gibt inzwischen regelmäßige Sendungen aus verschiedenen Zoos, die aus Berlin heißt: „Panda, Gorilla & Co“ – beides Tierarten, die sich im Westzoo befinden, wo auch der Sender mittlerweile sitzt, demnächst strahlt er die 342. Folge aus. Aus dem Frankfurter Zoo und dem Opel-Zoo kommt eine weitere Sendung: „Giraffe, Erdmännchen & Co“. In beiden Sendungen geht es jedesmal um konkrete Tiere, wobei nicht einer der Zoodirektoren oder Kuratoren, sondern der mit dem Tier praktisch befaßte Tierpfleger zu Wort kommt, manchmal auch noch eine Tierärztin. Der Leipziger Zoo hatte eine Internetseite „Elefant, Tiger & Co“, die den Alltag der Tiere und ihrer Pfleger zum Thema hatte und dann vom MDR als Fernseh-„Format“ übernommen wurde.
Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die Tierpfleger in den Zoos das meiste Wissen über „ihre“ Tiere haben. Statt den verantwortlichen für Gemse befragte ich den ehemaligen Elefantenpfleger im Tierpark, Patric Müller, er sah das so: „Elefanten sind eine Tierart, mit der man einen direkten Kontakt hat, jedenfalls mit den meisten. Also es ist kein geschützter Umgang, wie es selbst bei den Menschenaffen der Fall ist. Mein Lieblingselefant war die Leitkuh. Sie ist aber in den Graben gestürzt und gestorben. Es gab bauliche Fehler in den Tierhäusern. Hinterher ist man natürlich immer schlauer, und die Erkenntnisse, die man weiterhin gewinnt, werden ja meistens auch zugunsten des Tieres umgesetzt. Aber in dem Fall war das leider nicht so, weil der Tierparkdirektor, Dathe, der hat die Gräben, die Tiergräben, also den Trennungsraum zwischen Tieren und Besuchern nach dem Leipziger Prinzip gestaltet, das war schon damals überholt und es gab durchaus Erkenntnisse, dass diese tiefen Gräben mit auch noch der Heizung unten drin…zwar praktisch waren und für die Besucher unsichtbar, aber es hat sich da keiner Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn sich ein Elefant von der Kette losreißt, und der nicht durch Gitterabsperrungen getrennt ist vom Graben, dass der dort runterfallen kann und nicht von selbst wieder rauskommt. Wenn das Nachts passiert, wie es ja passiert ist, dann ergibt sich erst einmal das Problem, dass die Heizung kaputt geht und der Elefant in heißem Wasser liegt. Dies wurde damals noch verändert, also dass wurde noch in den Problemkatalog mit aufgenommen und schnell umgebaut, d.h. die Heizung wurde woanders hinverlegt. Die Gräben wurden aber leider erst nach dem Unfall mit Sand aufgefüllt, so dass sich keine Elefanten da mehr einklemmen konnten. Die Deckenkonstruktion war leider so gestaltet im Elefantenhaus, dass dort keine Laufkatzen an der Decke angebracht werden konnten, sondern nur einzelne Haken, die aber von der Statik her gar nicht in der Lage waren, einen Elefanten schräg wieder aus dem Graben zu ziehen. Der Graben war auf der Tierseite höher als auf der Besucherseite, um den Elefanten imposanter wirken zu lassen. Also die tiergärtnerische Komponente und die alte Menagerie-Vorstellung – das Tier so prächtig wie möglich zu präsentieren, die kamen sich da in die Quere. Das hat nicht funktioniert. Wir Elefantenpfleger haben dann Änderungsvorschläge gemacht, aber das wurde nicht umgesetzt. Wir – im Kern 4-5 Leute – haben da schon während des Baus drüber geredet. Ich war noch Lehrling und habe während der Lehrzeit dort freiwillige Aufbaustunden geleistet, weil ich eine Genossenschaftswohnung hatte, wofür man Aufbaustunden leisten mußte. Die konnte ich dort abarbeiten.
Ich kenne keinen Tierpfleger, der nicht Initiativen für seine Tiere entwickelt. Wir haben einfach nur Hinweise geben wollen, oder uns kooperativ zeigen wollen, um Fehler zu vermeiden. Z.B. waren die Türen in dem Haus so angebracht, dass man da nicht mit der Schubkarre durch kam…Der Elefant hat, wenn er erwachsen ist, keine wirklichen Fressfeinde. Wir Pfleger haben aber einmal den Besen aus dem Mähnenwolf-Haus, der natürlich entsprechend roch, den Elefanten zum Riechen gegeben. Und deren Erregung war enorm, da war gleich Panik. Panik in Hinsicht auf die Erregungszustände, die ein Elefant zeigen kann: Tröten, Urinieren…Wir Elefantenpfleger waren sehr viel zusammen – und haben uns gut verstanden. Natürlich gibt es wie immer auch Reibereien und Auseinandersetzungen, aber wir saßen nach Feierabend immer noch im Tierparklokal gegenüber dem Haupteingang zusammen. Da wurden dann am Biertisch auch alle Probleme angesprochen, die sich um die Elefanten drehten. Wir haben die Elefanten nur beim Namen genannt, weil es ging immer um ein konkretes Problem mit einem konkreten Tier, oder wie die Herdenstruktur gerade ist, was vorgefallen ist am Tag oder in der letzten Zeit, was zu erwarten ist, wie wir die Gruppe positionieren können im Stall oder auf der Anlage, wer mit wem zusammenkommt. Wir wollten immer mehr mit den Tieren machen, viel mehr arbeiten. Das war unser Idealismus. Z.B. das Rausgehen mit den Elefanten. Oder dass wir Äste haben wollten für die Elefanten, damit sie beschäftigt sind, sie kauen sich die Zähne ab, spielen damit und können sich damit kratzen. Also eine ganze Menge an Verhaltensweisen werden dadurch hervorgerufen, die sonst nicht stattfinden würden. Aber es ist schwierig, so etwas durchzusetzen – weil die Äste z.B. extra besorgt werden mussten.
Es gibt auch noch größere Elefantenpflegertreffen. Vor 89 trafen sich natürlich nur die Pfleger aus den DDR-Zoos, die Elefanten hielten. In Rostock gab es das erste Elefantenpflegertreffen und das wurde dann nach der Wende immer mehr. In Amerika gab es damals schon lange so etwas. Die Treffen gibt es immer noch, alle zwei Jahre finden die statt, von Pflegern, aber mittlerweile unterstützt auch von den Zooleitern. Also inzwischen sind diese Treffen etabliert, das war dann nicht mehr aufzuhalten. Sie nennen sich ‚International Elephant Management Conferences’ oder ‘Meetings’. Das ist eine Art Globalisierung im Kleinen, die dazu geführt hat, dass sich die Haltung den Pflegern gegenüber verändert hat. Innovationen und Know-how haben da Einzug gehalten und viele überdenken ihre Haltungsbedingungen oder Gruppenstrukturen und es wird viel gezüchtet. In der ‘First European Elephant Management School’, die es in Hamburg seit 2003 gibt, wird so etwas auch gelernt. Das ist die erste, die es gibt in Europa. In Amerika existieren viele solcher Einrichtungen, Workshops und Schulungszentren für Elefantenpfleger durch alte Elefantenpfleger. Aber hier: Wenn sich schon die Elefantenpfleger nicht treffen sollten, dann waren natürlich gemeinsame Schulungen für sie erst recht nicht erwünscht. Weil, je mehr Wissen sie haben, umso mehr haben sie natürlich auch die Möglichkeit, kompetent mit den Wissenschaftlern zu diskutieren und möchten dann anschließend auch Sachen durchsetzen, die vorher z.B. als unmöglich galten. Die Kommunikation dafür, diese Ebene, die gibt es inzwischen.“ Patric Müller wechselte dann von der Hand- zur Kopfarbeit, indem er ein Biologiestudium begann – bei Professor Elefant an der Humboldt-Universität, seine Arbeit schrieb er später ebenfalls über Elefanten.
.
Sudan-Gepard. In dem relativ großen Freigehege am Alfred-Brehm-Haus für Raubtiere leben zwei Geparde. Mit der Eröffnung dieses großen Hauses entwickelte sich der Tierpark zur „meistbesuchten Kulturstätte der DDR“. Der neue Direktor der beiden Hauptstadtzoos, Andreas Knieriem, bezeichnete kürzlich das Raubtierhaus im Charlottenburger Zoo und die 14 „Buchten“ für Großkatzen im denkmalgeschützten Alfred-Brehm-Haus des Tierparks, die „Mitleid und kein Interesse erzeugen“, als „Sündenfall: Nackte Fliesen und Gitter, das ist schon lange nicht mehr zeitgemäß“. Eberhard Diepgen, Vorsitzender der „Stiftung für die Hauptstadtzoos“, erwiderte darauf in der BZ: „Neue Raubtiergehege stehen schon seit längerem auf der Tagesordnung. Gut, dass der Neue das aufgreift und mit neuen Vorstellungen zur artgerechten Tierhaltung bereichert. Mit drastischen Formulierungen will er offensichtlich den Geldhahn der Haushaltspolitiker öffnen. Ich wünsche Erfolg.“ Über die Geparde heißt es auf der Internetseite des Tierparks: „Die Tiere, zwei Männchen, sind Nachzuchten und kamen 2013 aus dem Zoo Chester. Außer in Berlin kann man diese eleganten Tiere in Deutschland nur noch im Zoo Landau bewundern. Sie sind geselliger als die meisten anderen Katzen. „
…………………………………………………...
Inzwischen liegen auch für den Tierpark Friedrichsfelde Modernisierungspläne vor: „Reise durch die Evolution“ genannt – beginnend mit einer „Erlebniswelt Galapagos“ und einer „Manati-Unterwasserwelt“ bis hin zu einer neuen „Event-Gastronomie“ (die bereits der „Mövenpick“-Konzern übernommen hat). Alles in allem werden dafür 80 Millionen Euro veranschlagt. Die Weitläufigkeit des „Landschaftstierparks“, einst der flächenmäßig größte der Welt, inspirierte die Planer zu seinem Umbau in einen „Entdecker-Tierpark“: „Um die Attraktivität der Präsentation der Tiere zu steigern und den Erlebnischarakter des Tierparks weiter zu betonen, können Besucher Beobachtungen von verschiedenen Aussichtspunkten (Lodges, Brücken, Unterstände, Baumhäuser) vornehmen.“ Beim Finanzsenator begrüßte man diese Pläne, bezeichnete sie jedoch gleichzeitig als zu aufwändig und zu „kostenintensiv“. Auf der Pressekonferenz nahm die Wirtschaftsjuristin Gabriele Thöne, kaufmännischer Vorstand der Zoo AG, dazu kurz Stellung: „Wir entwickeln gerade einen neuen ‚Masterplan‘ für den Tierpark.“ Das hörte sich nicht gut an. Das Schlußwort des Vorstandsvorsitzenden der Berlinwasser Holding AG, Frank Bruckmann, war dafür umso zwingender: „Ohne Tiere gibt es keinen Zoo.“ (3)
.
Kurze Zeit nach der Pressekonferenz der Stiftung – 2009 – wurde dem ersten Nachwende-Direktor für beide Zoos, Bernhard Blaszkiewitz, der sich gegen jede Amüsier-Konzeption ausgesprochen hatte, gekündigt. Er nahm 2010 an dem Dathe-Kolloquium teil. Ebenso wie Katharina Heinroth und Heinrich Dathe – hatte man ihn unehrenvoll entlassen. Mit Katharina Heinroth hat er zudem gemeinsam, dass beiden ein Finger von einem Schimpansen abgebissen wurde.
.
Statt des Zoologen Blaszkiewitz wurde dann ein Veterinär aus München berufen – und prompt ging das Verschleppen von Tieren aus dem 160 Hektar großen Tierpark in den kleinen, 34 Hektar umfassenden Zoologischen Garten weiter: Statt Schlangen wurden nun die Fische nach Westen verbracht – angeblich um neue, runde Aquarien im Tierpark-Restaurant einzubauen, aber eine Kellnerin ist skeptisch: „Ob das jemals passiert?!“ Ähnlich ist es beim leerstehenden Löwengehege. Außerdem stehen immer mehr Käfige und Volieren leer. Ich erfuhr ferner, es ist eine „Flugschau“ geplant, gleichzeitig wurde jedoch der Vogelbestand, der ein Alleinstellungsmerkmal des Tierparks unter den deutschen Zoos war, auf die Hälfte reduziert. Auch der Bestand an Reptilien wurde um 20 % reduziert. Hinzu kommt der Verlust an China-Leoparden, Amur-Leoparden, Schwarzer Leopard, Puma, Oman-Falbkatze, Salzkatze, Fischkatze, Braune Hyäne, Vielfraß, Brazza-Meerkatze, Husarenaffe, Faultiere, Wildschweine, Maskenschweine, Schwäbisch-Hällische Schweine, Graue Heidschnucke u.a..
.

Japanmakaken, auch Schneeaffen genannt, sie leben auf drei der vier japanischen Hauptinseln. 2003 bekamen sie ihre jetzige große Anlage mit Felsrückwand.
………………………………………….
Zur sukzessiven Reduzierung des Tierbestandes kommt noch hinzu, wie mir mitgeteilt wurde, dass angekündigte Umbauten am Alfred-Brehm-Haus, welches bereits 2016 fertiggestellt werden sollte, noch nicht einmal angefangen wurden, auch bei der groß angekündigten neuen Anlage für Malaienbären wurde noch nicht einmal der erste Spatenstich getan. Und bei den neuen geplanten Großaquarien wurde jüngst erst einmal festgestellt, dass das Fundament des 1964 errichteten Restaurants zwei so große mit Wasser gefüllte Glaszylinder gar nicht trägt. Ein Vorwand?
.
Gegenwärtig gibt es eine Unterschriftenaktion im Tierpark, an der sich bereits über 70 Mitarbeiter beteiligt haben, die sich gegen die Personal-Entlassungen des neuen Direktors der beiden „Hauptstadtzoos“ wendet. Das Wort „Zoo“ hat man im Tierpark immer tunlichst vermieden: „Man sagt auch nicht ‚Bot‘ zum Botanischen Garten“ (Heini Hediger). Unter dem Vorgänger Dr. Blaszkiewitz wurde während seiner 23jährigen Direktorentätigkeit in beiden Einrichtungen nicht ein Mitarbeiter gekündigt, sein Nachfolger sprach bereits 13 Entlassungen im Tierpark aus.
.
Selbst die Internet-Informationen über den Tierpark werden immer dünner. Abgänge und Zugänge werden schon lange nicht mehr öffentlich gemacht. Von einer Tierparkmitarbeiterin erfuhr ich, dass der neue Direktor auch den „Tierparkführer“, der dringend auf den neuesten Stand gebracht werden müßte, nicht finanzieren wolle. Kurz vor seinem Tod hatte Heinrich Dathe diese „sanfte Abwicklung“ bereits kommen sehen. In einem Interview sagte er: „Der Tierpark wird wohl weiterbestehen, aber vielleicht als eine Art Hirschgarten, der keine Konkurrenz für einen Zoo darstellt.“ Diese pessimistisch-realistische Einschätzung hat ihn umgebracht. Der Hannoveraner Zoodirektor Lothar Dittrich, der 1955, als Heinrich Dathe von Leipzig nach Berlin ging, dessen Assistentenstelle im Leipziger Zoo übernommen hatte, schrieb in seinem Nachruf auf ihn in seiner Hauszeitschrift „Der Zoofreund“: „Noch zum 80.Geburtstag im November 1990 im Vollbesitz seiner Kräfte, brachte ihn eine menschenverachtende Behandlung ab Mitte Dezember ins Grab. Nicht genug damit, ihn am Ende seines Lebens tief verletzt zu haben, trug die Berliner Verwaltung dazu bei, ihn noch nach seinem Tode in den Medien mit angedeuteten Halbwahrheiten und Verdächtigungen über seine Rolle in der ostdeutschen Kulturpolitik ins Zwielicht zu rücken. Vielleicht kann man in Westberlin nicht akzeptieren, dass auch hinter der Mauer ein besonders begnadeter Mann eine Leistung vollbringen konnte, die weltweit Beachtung fand.“
.

Geierfelsen in der Freiflugvoliere. Lange Zeit war sie die größte der Welt – 60 Meter lang, etwa 27 Meter breit und 9 Meter hoch.
……………………………………………..
2014 druckte die „Online-Zeitung aus dem Berliner Osten ‚Lichtenberg Marzahn’“ einen offenen Brief an die SPD-Senatoren für Finanzen und für Stadtentwicklung von einigen CDU-Abgeordneten ab, in dem diese eine „umfassende Transparenz“ beim beabsichtigten „Geländeverkauf im Tierpark Berlin“ forderten und stattdessen die „Entwicklung alternativer Lösungsansätze“ verlangten, um „den langfristigen Erhalt des Tierparks zu sichern…Eine Insolvenz oder gar Schließung des Tierparks ist für uns keine Option“, schrieben sie im Namen der CDU-Fraktion. Die „Online-Zeitung“ erklärte dazu: „Der Tierpark, der kaum Eigenkapital hat und zu wenig Besucher zählt, um wirtschaftlich arbeiten zu können, benötigt jedes Jahr Zuschüsse vom Land. Zudem drohen laut dem Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem etwa 2,4 Millionen Euro Kosten, die bei der Entsorgung kontaminierten Erdaushubs anfallen würden. Das könnte der Tierpark aus eigenen Mitteln nicht leisten.“ Das war alles nicht mehr „sanft“.
Am Kiosk des Fördervereins im Tierpark meinte ein älterer Lichtenberger mit Dauerkarte über den neuen Direktor der beiden „Hauptstadtzoos“: „Der ist das größte Unglück, das uns bisher widerfahren ist.“ Eine Busreisegruppe mit Zoofreunden aus München pflichtete ihm bei, fügte aber hinzu: „Wir sind ja so glücklich, dass wir ihn endlich los sind.“ Sie schüttelten nur den Kopf, als sie erfuhren, dass er angeblich für eine Million Euro jährlich zwei Pandabären für den Zoo in China leasen würde und im Tierpark jede Menge Bambus anpflanzen ließ, der da überhaupt nicht hingehöre, bisher habe man sich alle Anpflanzungen genau überlegt. 20 Millionen Euro habe man ihm insgesamt für Neuerungen zugesichert, „die hätten mal Blaszkiewitz zur Verfügung stehen sollen…“
.
Wenn ich früher über das eine oder andere Tier im Ostberliner Tierpark Genaueres wissen wollte – für einen Artikel z.B., dann rief ich dort an und mir wurde der dafür verantwortlichen Tierpfleger genannt, mit dem ich mich dann in Verbindung setzte. Heute landet man beim Kurator des entsprechenden Reviers und der entschuldigt sich: „Das geht jetzt alles über unsere Pressesprecherin.“ Diese sitzt aber im Westberliner Zoo. Als ich ihr mitteilte, dass ich gerne die Pflegerin der zwei Kolkraben im Tierpark interviewen würde, bekam ich zur Antwort: „Da unsere Tierpfleger primär mit ihren Tieren zu tun haben, würde ich Sie bitten, uns Ihre Fragen per Mail zu schicken.“
.
Ähnlich reagierte der Betriebsratsvorsitzende des Tierparks: Er verwies mich absurderweise ebenfalls an die Pressestelle. Und der aus der CDU-Lichtenberg kommende Vorsitzende der „Gemeinschaft der Förderer von Tierpark Berlin und Zoologischem Garten Berlin e.V.“ schrieb mir, wenn ich bei seinem Verein, der 4000 Mitglieder hat, nur eine Stimme daraus zu Wort kommen lasse, werde ein allzu einseitiger Blick auf die Entwicklung des Tierpark seit 2014 vermittelt. „Allein die Mitgliederzahl des Vereins, die sich seit 2014 mehr als verdoppelt hat, macht doch deutlich, wie viele Berlinerinnen und Berliner mittlerweile die Weiterentwicklung von Zoo und Tierpark gleichermaßen unterstützen…Aus meiner Arbeit als Vorsitzender seit 2004 kann ich nicht ansatzweise Ihre tendenziöse Ost-West-Darstellung nachvollziehen. Zoo und Tierpark sind in den letzten Jahrzehnten deutlich zusammengerückt und werden zunehmend als eine Einheit in der Öffentlichkeit wahrgenommen.“ Kurzum: Es ist alles in Ordnung im Tierpark! Und es wird immer besser!
.
Die dortigen Kolkraben würde man übrigens gerne in die Freiheit entlassen – aber das gestatten die Naturschutzbehörden nicht. Warum eigentlich nicht? Sie sind im Gegensatz zu den im Frankfurter Zoo inhaftierten nicht zahm. Vielleicht kriege ich das noch raus, bisher bin ich bei allem bloß auf eine Mauer von Phrasen gestoßen und abgewiesen worden. Die erbärmliche Position des Tierparks Friedrichsfelde gegenüber dem Westberliner Zoo hat an sich nichts mit den zwei Kolkraben im Tierpark zu tun, aber ihretwegen bin ich in diesen nachhaltigen Ost-West-Konflikt reingeraten (angefangen mit der Mail dieser Zoo-Pressesprecherin) und habe mich daraufhin erst einmal mit Zoologen und Zoodirektoren beschäftigt. Eigentlich ging es mir jedoch nur darum, Material (Geschichten) zu sammeln für den nächsten Band (11) der Reihe „Kleiner Brehm“, der von „Rabenvögeln“ handelt. Nun thematisierten zwar viele der hier von mir zitierten oder sonstwie behandelten Tierforscher auch gelegentlich „Raben“ und „Krähen“, aber deswegen lohnte sich kaum der Lektüreaufwand, abgesehen von den Texten einiger expliziter Rabenforscher, auf die hier noch zurückzukommen sein wird. (4)
.

Grauer Honigdachs aus Ostafrika. Im New Yorker Museum erfuhr Heini Hediger über die ihn so faszinierende „Symbiose zwischen Honiganzeiger und Honigdachs – jene einzigartige Partnerschaft zwischen Vogel und Dachs bzw. zwischen Vogel und Mensch, die selber zu sehen mir in Afrika leider nie möglich war.“ In dem südafrikanischen Film „Die lustige Welt der Tiere“ (1974) ist zu sehen, wie die nachhaltige Beziehung zwischen Honiganzeiger und Honigdachs von ersterem angebahnt wird. Die deutsche Presse veröffentlichte neulich einen reißerischen Bericht über eine ebensolche Beziehung des Honiganzeigers zu honigerpichten Menschen – wenn kein Honigdachs zur Stelle ist. Ähnlich verhalten sich viele Kolkraben in den USA, wo es so gut wie keine Wölfe mehr gibt, und auch keine Indianer, mit denen sie jagten, dafür aber jede Menge Hobbyjäger, die zudem den größten Teil ihres erlegten Wildes liegen lassen. Kann es nicht sein, dass dieses Liegenlassen erst einmal das Mißtrauen der Raben erregt? Wölfe und Indianer schneiden sich nicht nur die Steaks raus.
Die in Asien und Afrika verbreitete Marderart ist nicht ungefährlich, laut Wikipedia greifen Honigdachse, wenn sie sich bedroht fühlen, selbst Tiere von der Größe eines Rindes oder eines Büffels an. In dem von konservativ-amerikanisierten Naturwissenschaftlern und Forschungsassistenten dominierten Wikipedia heißt es weiter: „Entgegen wissenschaftlicher Belege ist der Irrglaube weit verbreitet, dass der Honigdachs eine Symbiose mit einem kleinen Spechtvogel, dem Honiganzeiger (Indicator indicator), eingeht.“
Diese Symbiose und der Wechsel des Vogels vom Honigdachs zu den Menschen, die er dann ebenfalls zu einem Bienennest führt, um anschließend von ihnen ein Stück Wabe mit Honig zu bekommen, wurde ausführlich beschrieben von Herbert Friedmann und Heini Hediger (von letzterem in: „Tiere verstehen“ – 1980). Überhaupt geben die Darwinisten nur ungerne zu, dass es überhaupt „Symbiosen“ im Tier- und Pflanzenreich gibt, in der DDR war schon das Wort „Symbiose“ wegen der unseligen Dominanz der genetischen Biologie, die nur Mutation, Selektion und erbarmungslose Konkurrenz „zuläßt“, verpönt.
.

Weißer Honigdachs.
.
.
Anmerkungen
(1) Zu Adolf Portmann: Die Schweizer Biologin Florianne Koechlin (geb. 1948) schrieb in einem Artikel über ihren Lehrer Adolf Portmann (geb. 1897): „Seine Tiersendungen waren legendär. Portmann, der Autor von Büchern wie ‚Alles fliesst‘ oder ‚Biologie und Geist‘, ist 1982 im Alter von 85 Jahren gestorben, doch seine holistische Biologie ist aktueller denn je. ‚Portmann war einer der grössten Biologen des zwanzigsten Jahrhunderts‘, sagt der Basler Biologe Markus Ritter. ‚Ihn interessierte die stupende Vielfalt der lebenden Welt. Er versuchte, Lebewesen in einem ‚ganzheitlichen‘ Sinn zu erfassen‘. Ritter spinnt den Faden von Portmanns Geschichte weiter: ‚Die Biologie der Kriegsperiode von 1931 bis 1945 war eng mit dem politischen Weltbild des Nationalsozialismus verschränkt.‘ In Mode war ein simpler Neodarwinismus: Die Tüchtigsten überleben; die Schwachen sterben aus. Portmann widersprach dezidiert und führte seine Gestaltenlehre an: Warum, so fragte er, sind maritime kleine Hinterkiemerschnecken derart farbenprächtig und warum haben sie eine so unglaubliche Formenvielfalt? Das kann durch simple Selektionstheorien allein nicht erklärt werden.
.
In den sechziger Jahren kam die Molekularbiologie auf. Euphorische Töne um die genetische Verbesserung des Menschen zogen die Wissenschaftswelt in ihren Bann. 1962 fand in London das berühmte Ciba-Symposium mit dem Titel ‚Der Mensch und seine Zukunft‘ statt. Thema war die genetische Manipulation und Verbesserung des Menschen. Die damals bekanntesten GenetikerInnen – unter ihnen einige Nobelpreisträger – entwarfen dort ihre kühnen Visionen zur Planung des Menschen: Menschen sollten intelligenter sein, älter werden, weniger Schlaf benötigen, grössere Gehirne haben. Portmann war schockiert: ‚Da betreiben wir heute einen wahren Götzendienst und tun, als sei wirklich der Schlüssel zu allem Erbgeschehen gefunden. Wer in Hinsicht auf das Erbgeschehen die Proportion zwischen gesichertem Wissen und noch unbekannten Vorgängen auch nur einigermassen ahnend vor Augen hat …, der kann gegenüber dem Optimismus mancher genetischer Planung nur ein kategorisches Nein aussprechen‘.
.
Die Molekularbiologie eroberte auch Basel. In den sechziger Jahren entstand die Idee, ein spezielles Institut für Molekularbiologie und Genetik zu gründen, das spätere Biozentrum. Damit begann ein Kulturkampf: Die Zukunft gehörte fortan der Molekularbiologie und der Genetik, also den exakten Wissenschaften, die das Leben von den Bausteinen her zu erklären versuchten. Dahin sollten die Finanzströme fliessen, nicht in die als altmodisch empfundene Vielfaltsforschung. Portmann wurde kaltgestellt und aus fachwissenschaftlichen Kreisen ausgegrenzt.“
.
Später heißt es in einem Flugblatt des Basler Biologie-Lehrgangs: „Die Biologie an der Uni Basel ist heute immer noch schwergewichtig auf die Molekularbiologie und das Biozentrum ausgerichtet. Doch seit drei Jahren gibt es ein interdisziplinäres Biologie-Curriculum, das allen Biologiestudierenden eine breite Ausbildung ermöglicht: Angehende Molekularbiologinnen sollen nebst Genen auch ganze Organismen und Ökosysteme kennen lernen; angehende Zoologen die Grundlagen der Molekularbiologie rudimentär beherrschen. Das Curriculum gilt als innovativ und pionierhaft…Ein umstrittener Sparbeschluss des Unirates könnte diese Entwicklung nun torpedieren. Der Unirat will eine Botanik-Professur streichen und einen Teil der Botanik aus dem Departement Integrative Biologie herausnehmen. Das würde die integrative Biologie massiv schwächen, während die ohnehin starke Molekularbiologie nochmals aufgestockt würde.“
.
Adolf Portmann war, ebenso wie sein Schüler Heini Hediger und sein Biograph, der Biologe Joachim Illies, gläubiger Christ und nicht zuletzt aus diesem Grund Anti-Darwinist. Portmann war einer der wenigen, der versuchte, stets die Scheidelinie zwischen gesichertem Wissen und Glauben bzw. Projektionen zu wahren. Er stammte aus einem sozialistisch-proletarischen Elternhaus und wußte, „daß man im Grunde politisch sein muß“. Sein Interesse, vermittelt nicht zuletzt über seine vielen Auftritte bei allen möglichen Institutionen, wie Volkshochschulen und Jugend forscht Gremien, ging dann auch immer mehr zum Menschen: „was wird aus ihm?“ – gefolgt von entwicklungspsychologischen Ratschlägen und politischen Einsprüchen – gegen gentechnisch Machbares z.B. oder indem er den Auftritt eines „bekannten deutschen Nobelpreisträgers“, der in Basel im Auftrag des Reiches einen Vortrag halten sollte, mit einer Saalblockade verhinderte sowie als Berater der französischen Universitätsregierung in Freiburg bei der Neubesetzung von Lehrstühlen, wo er „auch politisch Belasteten half“, weil er sie „für wissenschaftlich wertvoll hielt“. Schließlich setzte er sich dafür ein, dass die deutschen Wissenschaftler wieder in den internationalen Dachverband der Universitätsgelehrten aufgenommen wurden. Heini Hediger setzte sich – ebenfalls erfolgreich – für die Aufnahme der deutschen Zoodirektoren in den internationalen Verband der Zoodirektoren ein.
Der letzte Direktor des Westberliner Zoos und des Ostberliner Tierparks, Bernhard Blaszkiewitz, ist im Gegensatz zu den beiden Schweizern und Illies ein bekennender Katholik und Darwinist, in einem Interview mit dem „Welt“-Journalisten Michael Miersch sagte er: „Darwin selbst war Theologe und glaubte an Gott. Als Schöpfer aller Dinge hat Gott auch die Naturgesetze erschaffen. Der evolutionäre Prozess mit Mutation, Selektion und allem was dazu gehört, ist Gottes Werk. Durch Gott sind die Naturgesetze vernünftig.“ Außerdem meinte er: „Konrad Lorenz hat einmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Demutsgeste der Wölfe der Aufforderung Jesu entspricht, die andere Wange hinzuhalten. Der unterlegene Wolf hält dem anderen die Kehle hin, doch der wendet sich ab.“ Dem widersprach Tierparkdirektor Heinrich Dathe: „Ich weiß nicht, wie die Beobachtung aussah, die dieser immer wiederholten, geradezu zu einem Lehrsatz gewordenen Feststellung zugrunde lag, ich weiß jedenfalls aus vielen Erfahrungen heraus, dass diese Regel keine ist, dass sie keinesfalls stimmt…Übrigens hat auch kürzlich der verdiente Schweizer Zoologe Dr. Schenkel, einer der besten Wolfskenner, ebenfalls dem genannten ‚Lehrsatz‘ mit guten Gründen widersprochen.“ Der „Lehrsatz“ geht auf Konrad Lorenz zurück, dem schon Heini Hediger vorwarf, gelegentlich allzu schnell verallgemeinert zu haben.
.
Portmanns antidarwinistische Rede z.B. von der „Innerlichkeit und „Selbstdarstellung“ – als eine dem Lebendigen eigentümliche Dimension oberhalb der mechanischen Funktion“ löste laut Illies bei seinen „Standesgenossen“ die typische „fachspezifische Allergie gegen Abweichler von der Grundlinie“ aus – das, was man neuerdings „Mobbing“ nennt. Diese Grundlinie – ein grober Darwinismus – findet man heute in fast allen Biologen-Büchern – es ist ihr Credo. Erschwerend kam bei Portmann hinzu, dass seine „Aussagen“, obwohl aus strengster empirischer Forschung resultierend, „ihrem Wesen nach ins Unbeweisbare, Unmeßbare zielen, also der ‚Objektivität‘ im trivialen Sinne entzogen sind“ und sich „in die Bereiche des Subjektiven, gar des Intuitiv-Emotionalen“ begeben, was von ihm jedoch als „wissenschaftliche Wahrheit“ vorgetragen wurde. „Er mag die Grundfragen der Wissenschaft noch so ernst nehmen – wenn er nicht gleichzeitig auch ihre Methodik bejaht, sind seine Antworten unerwünscht.“ Das galt mehr und mehr auch für Joachim Illies Arbeiten selbst, die aus seiner jahrzehntelangen Erforschung der Ökologie des kaum einen Meter breiten und vier Kilometer langen Breitenbachs, einem Nebenflüßchen der Fulda, entstanden. Seine vielleicht weltweit kleinste limnologische Forschungsstation gehörte der Max-Planck-Gesellschaft und befand sich in Schlitz. 2006, einige Jahre nachdem ihr Leiter, Illies, emiritiert worden war, ließ die Gesellschaft die Station schließen, versprach jedoch, sie durch eine Internetseite mit Archiv zu ersetzen, diese gibt es aber 2016 noch immer nicht.
.
Mähnenwolf. Ihn suche ich in seinem dreigeteilten Gehege im Tierpark immer als erstes, das Photo entstand, als ich ihn das zweite Mal darin entdeckte. Angeblich sollen seit 2014 sogar zwei Mähnenwölfe im Tierpark leben. Die ehrenamtliche Besuchergruppenführerin Annett Bartsch schreibt auf ihrer Internetseite: „Seine Heimat ist Südamerika (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Peru. In Uruguay nur noch in Randgebieten)… Anders als die übrigen großen Hundearten leben Mähnenwölfe nicht im Rudel, sondern nur paarweise. Ein Paar teilt sich ein Territorium, es besteht aber keine besonders enge Paarbindung, ausgenommen während der Paarungszeit und zur Jungenaufzucht…Sie sind Nacht- und dämmerungsaktiv. Trotz ihrer Größe schlagen Mähnenwölfe keine großen Beutetiere sondern leben von Kleintieren und Pflanzenmaterial. Im Tierpark bekommen sie Meerschweinchen, weiße Ratten und Mäuse, Eintagsküken, Tauben, Eier, frisches Obst und Zusatzfutter auf Getreidebasis mit Vitaminen und Mineralstoffen.“ Alles objektive Fakten – von Subjektivem über den obigen Mähnenwolf kein Wort.
……………………………………………..
Das Problem der „Objektivität“ haben die Biologen als Naturwissenschaftler geradezu zwingend, alles Nicht-Objektive ist für sie anekdotisch, wenn nicht esoterisch. Mit ihren Methoden schaffen sie allgemeingültige „harte Fakten“, während die anderen – Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften – bloß „weiche Fakten“ produzieren. Hinter dieser Trennung steckt eine gehörige Portion Konservativismus und Wissenschaftsgläubigkeit, der Glaube nämlich, dass man mit den Methoden von Mathematik, Physik und Chemie auch Lebewesen objektive Daten entlocken, oder erfoltern kann. Marxistische Erkenntnistheoretiker können diese unterschiedlichen Wahrheitsbegriffe von Sozial- und Naturwissenschaften nicht akzeptieren: einmal einen historischen, die Befindlichkeiten und Befunde von Gesellschaften, Teilgesellschaften oder Individuen betreffend, und ein andern Mal zeitlose, ewig gültige Wahrheiten: eben das, was wir Naturgesetze nennen. Auch diese müssen historisch-materialistisch erklärt werden! Der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro weist zudem auf die regionale Beschränktheit des naturwissenschaftlichen Denkens hin: Im Westen ist ein „Subjekt“, so sagt er, der herrschenden „naturalistischen Auffassung“ gemäß – „ein ungenügend analysiertes Objekt,“ während in der animistischen Kosmologie der amerikanischen Ureinwohner genau das Gegenteil der Fall ist: „Ein Objekt ist ein unvollständig interpretiertes Subjekt.“ Der französische Wissenssoziologe Bruno Latour hat in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, von einem “Multinaturalismus” auszugehen – statt weiterhin von „der Natur”, die in einem Gegensatz zu „der Gesellschaft” und “der Wissenschaft” steht. Wir müßten dazu noch vor die Moderne wieder zurück – in die Zeit vor dem “epistemologischen Bruch”, den Hobbes und Locke mit der Trennung von Natur und Kultur (Gesellschaft), Objekt und Subjekt, Fakt und Fetisch vollzogen.
.
Adolf Portmann hat sich mit seinem Begriff der „Innerlichkeit“ nicht auf Jakob von Uexkülls „Innenwelt“ bezogen, was nahe gelegen hätte, zumal der Umweltforscher Uexküll für ihn „Wegbereiter einer neuen Biologie“ war, sondern auf den „anerkannten Begründer der Entwicklungsphysiologie“ Wilhelm Roux, den laut Portmann „wohl niemand verdächtigen wird, so sonderbare Ansichten zu vertreten wie ich sie zuweilen geäußert habe.“ Obwohl Roux „dem darwinistischen Klima angepaßt“ war, wie Illies meint, und mit „den taktischen Zwängen der Wissenschaftspolitik seiner Zeit“ wohl vertraut (weswegen er z.B. seine Zeitschrift „Archiv für Entwicklungsmechanik“ nannte), wußte er doch gleichwohl, „dass es hinter allem Mechanischen, Physiologischen, Zweckmäßigen noch etwas anderes“ gibt. „Es ist das,“ so bekannte er, „was man unklar als Innerlichkeit der Lebewesen bezeichnet,“ was nichts anderes bedeutet als den Lebewesen ein eigenes Selbst zuzugestehen. Portmann spricht von „psychischen Vorgängen“, er wählte damit „also die Seele“, schreibt Illies.
.

Chaco-Pekari, neuweltliche Wildschweine. Für viele Waldindianer Südamerikas ist die Jagd auf Pekaris fast die einzige Möglichkeit, an Fleischnahrung heranzukommen. Der Tierpark meldet 2016 auf seiner Internetseite: „Nach langer Renovierung ist das neue Heim für die Chaco-Pekaris endlich fertig. Seit Herbst letzten Jahres wurde die Anlage im Tierpark Berlin umgestaltet. Die Metallzäune wurden durch Trockengräben ersetzt und landschaftlich wurde der Bereich dem natürlichen Lebensraum der Nabelschweine-Art nachempfunden. Die Anlage ist in zwei Bereiche aufgeteilt, die durch einen Trockengraben getrennt werden und jeweils eine Familiengruppe der Pekaris beherbergen. Die beiden Populationen mit einer Gruppe aus 10 und einer aus 6 Tieren stammen ursprünglich von Zoos aus Los Angeles, Phoenix und San Diego.“
…………………………………………..
Zu Hans Kummer: Der Zürcher Anarchist und Ethnopsychoanalytiker Paul Parin (geb. 1916) besuchte einmal auf seinen Afrikareisen den Schweizer Pavianforscher Hans Kummer (geb. 1930) im Hochland von Äthiopien. Gemeinsam schauten sie dem Treiben auf dem Schlaffelsen der „Djellabas“ zu. In seiner Geschichte „Kurzer Besuch bei nahen Verwandten“ schrieb Parin: „Es war uns vergönnt, dabeizusein, wie sich eine Vermutung der Forscher erstmals bestätigte. Zwei ältliche Junggesellen – ihre Namen müßte ich verschweigen, wenn ich sie nicht vergessen hätte – lebten seit langem zusammen und schliefen eng aneinander in einer Felsspalte. An jenem Abend jedoch, in der Stunde der Geselligkeit, näherte sich ein schlanker Jüngling dem einen der gesetzten Herrn, kraulte ihm verstohlen das Fell und bot ihm, wenn der Freund des Alten nicht hinsah, sein hellrotes Hinterteil. Der Strichjunge, wie wir ihn nannten, hatte Erfolg. Dem Freund des Verführten waren die Zärtlichkeiten der beiden nicht entgangen. Jetzt war es zu spät. Aus den Augenwinkeln schielte er hinüber, wie sich sein Freund mit dem Gespielen einließ. Verlegen blickte er zu Boden. Traurig – das sah man seinen müden Bewegungen an – turnte er schließlich den Felsen hinauf und fand einen Platz für seine einsame Nacht. Als es dunkelte, hatte auch das ungleiche Paar genug vom sinnlichen Spiel. Die beiden setzten elastisch hinauf zum gewohnten Schlafplatz der Freunde“.
.

Djellabas, eine Pavianart. Im Tierpark gelangen diese Primaten vom Affenhaus über Baumstämme auf die auf dem Photo zu sehende Insel.
……………………………………………
Mir hat an Parins Geschichte besonders der Satz gefallen: „Zwei ältliche Junggesellen – ihre Namen müßte ich verschweigen, wenn ich sie nicht vergessen hätte“: So weit sind wir also schon, dass wir die Affen nicht nur benamen, sondern ihnen ihr „Coming-Out“ als Schwule auch selbst überlassen, wenn sie nicht gerade Personen von öffentlichem Interesse sind, was bei diesen drei Pavianen anscheinend nicht der Fall war. Hierzu hat der Wissenssoziologe Bruno Latour gemeint: „Die Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“(Wie wäre es mit „Biosoziologie“, die, als das Gegenentwurf zur nationalsozialistisch-amerikanischen Soziobiologie, alles Biologische sozialwissenschaftlich „auflöst“? Das ist nicht so weltfremd, wie es sich anhört, denn die „organismische Biologie“, von den Genetikern und Mikrobiologen schnöde fallen gelassen, wird derzeit geradezu massenhaft von mehr oder weniger naturschützerisch motivierten Künstlern und Kulturwissenschaftlern aufgegriffen, in Berlin entstand aus diesen Kreisen heraus bereits eine erste Zeitschrift: die „Tierstudien“ und an der Humboldt-Universität ist ein Forschungsverbund „Animal Studies“ geplant.)
.

Binturong, auch Marderbär genannt, eine Schleichkatze aus Südostasien.

Die selben Tiere in ihrem Innenkäfig.
…………………………………………………..
(2) Das Fernsehen zeigte weinende Ost- Tierpfleger: „Ich verstehe nicht, wie 32 Jahre Arbeitsergebnisse plötzlich willkürlich zerstört werden.“ Der Leiter der Schlangenfarm, Klaus Dedekind, sagte wütend: „Auf keinen Fall werde ich das Angebot, in den Westen überzuwechseln annehmen.“ Es zeigte auch zum Kampf um den Erhalt des Tierparks wildentschlossene Rentnerinnen aus beiden Stadthälften, die in kürzester Zeit 30.000 Unterschriften sammelten und ein Spendenkonto einrichteten (Kennwort „Rettet die Schlangen“). Der Tierpark Friedrichsfelde war der erste DDR-Betrieb, in dem nach der Wende ein Betriebsrat gewählt wurde. Dieser koordinierte den Widerstand gegen die schleichende Abwicklung.
.
Zunächst waren die Menschenaffen in den Westzoo verbracht und – wie im Zoo – das Mitbringen von Hunden in den Tierpark verboten worden. „Das haben wir aber abschmettern können“, erzählte die Betriebsratsvorsitzende Ursula Rahn. Es wurde jedoch auch investiert: zum Beispiel 200.000 DM in die Schlangenfarm (deren Insassen man nun in das Aquarium des Westzoos – und zwar „hinter die Kulissen“ bringen will) und 15.000 DM in die Aquarien (die 2015 ihrer Fische entleert wurden). Der damals regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen ließ verlauten, ein Tieraustausch sei zwar Sache der Zoo-Leitungen, aber man müsse bei diesem Thema besondere Rücksicht auf die Befindlichkeiten der betroffenen Menschen im Ostteil nehmen.
.
Selbst der neue Zoo/Tierpark-Direktor Blaszkiewitz war durch den „Tausch“-Beschluß brüskiert worden: „Sie haben ihn vor die Tür geschickt und dann wie einem dummen Jungen das Ergebnis verkündet“, weiß eine der Frauen am Tierpark-Lotteriestand. Als Kurator im Zoo war Dr. Blaszkiewitz insbesondere bei den älteren reichen Damen („unseren Gönnern“ im Zoo-Jargon) beliebt gewesen. Von diesen zog er etliche mit in den Tierpark rüber. Eine, Inge Fischer, findet sich – mit 35.000 DM – im Tierpark-Jahresbericht 1992 an erster Stelle und mit Foto auf der „Spender“-Liste. Eine andere, Ilona Albert, initiierte nicht nur eine Öffentlichkeitskampagne gegen den Aufsichtsratsbeschluß, sie schrieb auch bitterböse Briefe an alle Verantwortlichen: „Die Ostberliner können nicht verstehen, dass ein Gremium von 13 Westberliner Männern beschließt, die Reptilien zu deportieren. Kein Mensch versteht, warum der kleine Zoo West auch noch diese Tiere haben muß. Umgekehrt wäre es allen Menschen begreiflich, weil der Tierpark Ost sehr groß ist. Ein Gleichnis drängt sich auf: Ein reiches Kind sieht, dass ein armes Kind eine schöne, bunte Murmel hat, und nimmt ihm diese mit der Begründung weg, dass es dafür eine schickere Schachtel hat …“ Das Ehepaar Liebau, „Zoo-/Aquariumsaktionäre und Tierparkspender“, forderte öffentlich die „Abwahl des Aufsichtsrates“ und machte erst mal auf die Geldverschwendung im Zoo aufmerksam: „Erst Renovierung des Dienstwohnhauses vom ehemaligen Revierpfleger Herrn Walther – dann Abriß“ – zum Beispiel. Im Osten gibt es indes noch weit mehr ältere Besucherinnen des Tierparks, die bereit sind, für seinen Erhalt auf die Barrikaden zu gehen. Zwischen 1955 und 1970 leisteten Tausende von Menschen viele „Aufbaustunden“ für das beliebteste „Nationale Aufbauwerk“ (NAW): die Umwandlung bzw. Erweiterung des ehemaligen Schloßparks Friedrichsfelde zu einem Tierpark. Damals beteiligten sich auch etliche in Berlin arbeitende Frauen und Männer aus der Sowjetunion daran. Und noch heute besuchen viele „Russen“ den Tierpark.
.

Dromedar mit Pflegerin, einmal saß ich in einem Flugzeug neben einer Frau, die ihre Tochter auf Kuba besuchen wollte, sie erzählte mir, dass sie einst beim Freiwilligeneinsatz im Rahmen des „Nationalen Aufbauwerks“ für den Tierpark das Dromedar- und Kamelgehege mitgestaltet hätte. Sie besitze noch ihr NAW-Arbeitsbuch von damals.
………………………………………………
So sammelten z.B. Mitglieder des Lichtenberger Tierschutzvereins („Es geht hierbei nicht um artgerechte Haltung, das ist eine Abwicklungsfrage“) und die Bürgerinitiative „Frankfurter Allee Süd e.V.“ Protestunterschriften und Geldspenden „für die Modernisierung der Schlangenfarm in Eigeninitiative“. Eine von ihnen, Kerstin Bodnar, schrieb an Professor Klös: „… dass Sie in Afrika keine Giftschlange biß, liegt sicher nur daran, dass diese nichts von Ihrem Aufsichtsratsbeschluß und der ‚Verschleppung‘ unserer Tierparkschätze in den Zoo wußten … Aber die Protestwelle beweist, dass er falsch war. Alle Berliner hat das zutiefst erschüttert und fassungslos, aber zum Glück nicht handlungsunfähig gemacht.“ Eine andere, Cläre Mausser, schrieb in einem offenen Brief: „Der Schlangenfarm-Pfleger Klaus Dedekind soll vom Zoo (West) übernommen werden. Und er hat abgelehnt mit den Worten: ‚Ich lasse mich nicht kaufen!‘ – Dass es noch solche Menschen gibt!! Dieser einfache Mann sollte vielen ein Vorbild sein. Bei aller Verbitterung, die uns Ossis immer mehr erfüllt, richtet dieser Mann uns auf, und wir sind stolz auf ihn, genauso wie auf die gegen ihre Abwicklung hungerstreikenden Kalikumpel von Bischofferode …“Einer anderen Frau aus der Bürgerinitiative versicherte eine CDU-Politikerin kurz darauf im Rathaus: „Na nun wird er ja abgewickelt der Tierpark. Doch, doch, da können Sie sicher sein.“
.
Die Aquariumspflegerin Carla Ruß, die den Rotschwanz-Wels „Charly“ aus der Hand füttert, ging noch weiter als Dedekind: „Nie wieder werde ich einen Fuß in das Zoo-Aquarium setzen!“ „Die Zusammenarbeit zwischen Zoo und Tiergarten hat ihren Tiefpunkt erreicht“, berichtete denn auch der Zoo-Betriebsrat dem Bürgermeister, den mittlerweile Protestschreiben vom San Diego Zoo bis zum Potsdamer Universitätsinstitut für Zoologie erreicht hatten. Einer der Wissenschaftler dort, Dr. Weber, hatte sich besonders über eine Radiosendung zum Thema „Schlangenfarm“ geärgert. Die gewachsenen Bindungen des SFB, aber auch des Immobilienhändler-Senders 100,6 (Eigentum verflechtet!) lassen einen guten Überblick auf das Gesamtsendegebiet nicht zu. In diesem Fall gipfelte die journalistische Unbefangenheit in dem Wunsch: „Das ‚olle Schlangenhaus‘ und die Ostberliner Meckerstimmen mögen bald der Zoogeschichte angehören.“ Dr. Weber fand das „makaber“ und gab Nachhilfeunterricht. Die größte Giftschlangenfarm Europas stammt ursprünglich aus einer Serumfabrik bei Dresden. Als diese geschlossen wurde, brachte der „legendäre“ Pfleger, „Vater (Fritz) Kraus“ die Tiere mit in den Tierpark. Sein Nachfolger wurde dann Dr. Petzold und schließlich Klaus Dedekind. Kurator der Farm ist der Dahte-Sohn Falk. Der Schlangenraub – das sei „kein Ruhmesblatt für die Berliner Kulturpolitik“. Die hatte damit jedoch nichts zu tun, eher schon der Finanz- und der Gesundheitssenator, deren Vertreter im Aufsichtsrat saßen. Die Proteste gegen die Verkleinerung des Tierparks hatten zunächst Erfolg. Außerdem wurde die Schlangenfarm in zwei Bauabschnitten weiter modernisiert. Mit Spenden und aus Landesmitteln. Aber dann – im Jahr 2002 – verkündet der Senat doch, unter Hinweis auf die angespannte Finanzsituation, dem Tierpark Mittel zu streichen. Seitdem werden sie immer mal wieder gekürzt – und die Diskussion um eine Zusammenlegung von Zoo und Tierpark bleibt. Bis dahin, dass es Vorstöße gab, Teile der Tierparkfläche an Immobilienhändler zu verkaufen, also nicht nur die Tierparktiere, sondern auch seine Fläche sukzessive zu verringern. Die Bürgerinitiative wollte zusammen mit einigen Künstlern eine Erinnerung an den Kampf um das Schlangenhaus schaffen – in Form einer „Spendenkeramik“. Tierparkdirektor Blaszkiewitz unterstützte dieses Projekt, gleichzeitig erklärte er jedoch einem Reporter, „er sei völlig sicher, dass ein Dathedenkmal oder eine -Gedenktafel nie im Tierpark zu sehen sein würde,“ das las ich in Knut Holms Recherche (siehe oben).
.
Nicht genug mit dem versuchten Schlangenraub 1993, es gab damals auch noch einen gelungenen Eisbärenraub: Hieran war die Schwiegertochter von Heinz-Georg Klös beteiligt: Es ging um die „weltberühmte Nummer“ mit fünf Eisbären von Ursula Böttcher. Sie hatte sich beim Staatszirkus der DDR von der Putzfrau zur Raubtierdresseurin hochgearbeitet, arbeitete mit Löwen – bis der Generaldirektor sie vor die Wahl stellte: „Entweder übernehmen Sie die alten Bären – oder Sie kriegen eine Hundenummer!“ Die Löwen hatte sie von ihrem Kollegen, den Löwendompteur Georg Weiß, der immer in Schlips und Anzug und mit Brille auftrat, übernommen. Er schrieb über seine Raubtier-Nummern in seiner Autobiographie „Mit meinen Tieren auf du und du“ (1973), Ursula Böttcher berichtete in ihrer Autobiographie „Kleine Frau, bärenstark“ (1999) u.a. über Georg Weiß.
.

.
Nach der Wende wollte der „Circus Busch-Roland“ mit der Bärennummer von Ursula Böttcher auf Tournee gehen, auch Zirkus Krone hätte sie fünf Jahre unter Vertrag genommen, aber der Treuhand-Liquidator des Staatszirkusses verkaufte die Eisbären an verschiedene Tiergärten, zwei übernahm der Westberliner Zoo, und Ursula Böttcher wurde „aus betriebsbedingten Gründen“ gekündigt: „Nach 47 Jahre Zirkus und einer Weltkarriere eineinhalb Zeilen“. Laut der Berliner Zeitung kombinierte der Pressesprecher des „Circus Busch-Roland, der vergeblich gegen den Bärenverkauf geklagt hatte: „Des Liquidators engste Liquidierungsberaterin heißt Ursula Klös. Schwiegertochter des früheren Berliner Zoodirektors und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden von Zoo und Tierpark, Heinz-Georg Klös. Ihr Mann wiederum arbeitet in leitender Stellung im Zoo…“ Hinzugefügt sei, was der „Zoo Berlin“ kürzlich vermeldete, dass der Eisbärenkurator „Heiner Klös“ heißt – Sohn von Heinz-Georg Klös.
.
Die Bärin Tosca wurde zunächst an den Zoo Nürnberg verkauft, dann kam sie in den Westberliner Zoo, wo sie 2006 ein männliches Junges bekam, das sie aber nicht annahm und das deswegen von seinem Pfleger per Hand aufgezogen wurde. Den jungen Eisbären nannte man Knut. er wurde zusammen mit seinem Pfleger so beliebt, dass der Westberliner Zoo Millionen mit ihm verdiente – und seitdem mehr Besucher hat als der Ostberliner Tierpark. Knut starb vierjährig 2011, sein Pfleger im Jahr darauf. Der Regierende Bürgermeister gestand: „Wir alle hatten den Eisbären ins Herz geschlossen. Er war der Star des Berliner Zoos.“ Auch der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Wolfgang Apel, äußert sich betroffen, zugleich übt er Kritik an der Haltung des Tiers. „Das kurze und qualvolle Leben von Knut zeigt erneut, dass Eisbären nicht in den Zoo gehören, auch wenn sie Knut heißen.“ Der Liquidator hatte zuvor den Verkauf der Zirkus-Eisbären an verschiedene Zoos mit der Notwendigkeit einer „artgerechten Haltung“ rechtfertigt. Die FAZ schrieb über den jungen Eisbären Knut: „Schlecht erging es ihm, als ihn die Zoo-Leitung mit den drei jeweils über 20 Jahre alten Eisbärinnen auf den großen Bärenfelsen ließ. Es gab Schlagzeilen und Berichte über einen traurigen, von dem Damen-Trio gemobbten Bären.“
.

Eisbär im Tiergarten. Ich sah immer nur einen dort. Am 5.11. 2016 meldete die Presse aus dem Tiergarten: „Eisbären-Mutter Tonja hat Zwillinge geboren. Noch sind sie taub, blind und groß wie Meerschweinchen. Seit zwei Wochen führte der erste Gang der Tierpfleger zum Eisbärenrevier. Jeden Morgen derselbe prüfende Blick auf den installierten Überwachungsmonitor und die Frage, wann ist es soweit? Nach 22 Jahren gibt es damit erstmals wieder Eisbären-Nachwuchs im Tierpark. Eltern der Zwillinge sind die sechsjährige Tonja und der vierjährige Wolodja. Die Pfleger hoffen, dass die Babys überleben. Denn die Sterblichkeit bei neugeborenen Eisbären liege bei rund 50 Prozent.“ Auch immer mehr Tierparkbesucher hoffen am Gehege, dass sie die jungen Eisbären sehen, wenn sie das erste Mal raus dürfen, ähnlich scheint es dem sich alleine langweilenden und lustlos mit Plastik spielenden Vater zu gehen. Muß er bald jedesmal rein, bevor die anderen drei raus dürfen?
…………………………………………………
Konrad Lorenz hat zu Beginn seiner Karriere als Verhaltensforscher einmal gesagt: „Wir vermenschlichen nicht die Tiere, im Gegenteil, wir vertierlichen die Menschen!“ Das gilt auch z.B. für den Raubtierdompteur in der 3.Generation, Tom Dieck Junior, der heute im Zirkus Busch-Roland mit Tigern und Löwen arbeitet. Die Löwen kommen aus belgischen Zoos, die Tiger aus Schweizer Zoos. Dem Deutschlandradiokultur erzählte er während eines Gastspiels in Berlin: „Dompteure gibt es nicht nur im Zirkus. Ich habe letztens eine Doku gesehen über den Chef von Trigema („Trikotwarenfabrik Gebrüder Mayer“) – das ist vom Psychologischen eigentlich genau wie eine Raubtiernummer. Der läuft den ganzen Tag durch die Fabrik und schaut jedem auf die Finger und alle sind auf den Zehenspitzen und es klappt auch immer, weil der Chef könnte ja jeden Augenblick vorbeikommen und so und genauso ist es eigentlich auch beim Dressieren, man muß immer zeigen, dass man da ist. Und dass man ein Auge drauf hat auf alle.“ Daneben bekümmert sich der Trigema-Chef als Naturliebhaber und Jäger aber auch noch um Affen. Deswegen will er zukünftig nicht mehr mit einem lebenden Schimpansen für seine Mode werben, sondern mit einem computeranimierten.
.

Gibbon, die baumbewohnende Primaten aus Südostasien, mit denen Toyota warb. Der Anthropologe Adolph Schultz und der Primatologe C.R.Carpenter unternahmen 1937 eine Gibbon-Expedition nach Burma, in ihrem Bericht beschrieben sie die außerordentliche Schwierigkeit, überhaupt an Gibbons im Wald heranzukommen. Erst als sie ihr Lager an einem buddhistischen Tempel aufschlugen, boten sich ihnen vorzügliche Möglichkeiten zur Beobachtung. Hediger schreibt: „Buddhistische Priester und Pilger haben begreiflicherweise ein völlig andere Einstellung zum Tier als Menschen, die Tiere jagen – eine Tatsache, die auch für andere Religionen und Naturreligionen in vielen Länder der Erde gilt und zuweilen zu einer bedeutenden Zahmheit freilebender Wildtiere führt.“
Der Berliner Biologe Cord-Riechelmann hat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in der er fast regelmäßig über Tiere schreibt, kürzlich einen längeren Artikel über Gibbons veröffentlicht – mit einem schönen Photo von einem der Gibbons im Tierpark. Über die vermeintlich monogam – also in „Kleinfamilien“ lebenden Primaten, die der Zoologe Ernst Haeckel (geb. 1834) für die nächsten Verwandten des Menschen hielt, schreibt Riechelmann: Als die ersten Erforscher freilebender Gibbons nach Erschießen einer „Kleinfamilie“ feststellten, dass es sich bei den Eltern eines jungen Gibbons um zwei Männchen handelte, bekam diese Spießer-Projektion „erste Risse“. Spätere Freilandforschungen in Thailand ergaben, „dass es bei Begegnungen zwischen benachbarten Paaren immer wieder zu Kopulationen außerhalb des Paares kommt und dass es auch in Gibbonfamilien externe Vaterschaften gibt.“ Diesen Befund findet man inzwischen „bei allen scheinbar in Paaren monogam lebenden Tieren.“ Nachdem er auch noch über die „angeborenen Gesänge“ der Gibbons berichtet hat, kommt Riechelmann zu dem Schluß, dass ihre „nervöse Schönheit“ begeistert und ihre „Wachheit sie fundamental vom aktuellen Menschen unterscheidet.“
.

Weisshand-Gibbon vor seiner Hütte im Tierpark, sie ist über Baumstämme mit einer Insel verbunden. Der Tierpark berichtet auf seiner Internetseite: „Sie leben in den Regenwäldern Südostasiens und ihre komplexen Rufe sind maßgeblich für den hohen Geräuschpegel im Dschungel verantwortlich: Gibbons. Durch illegale Jagd und die Zerstörung ihres Lebensraumes sind fast alle der 19 Gibbonarten vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet. Für eine Art ist es wahrscheinlich schon zu spät, vom Hainan-Gibbon existieren nach Schätzungen nur noch 28 Tiere, was sie zur seltensten Menschenaffenart der Welt macht. Die Forschergruppe für Kleine Menschenaffen SSA (IUCN Primate Specialist Group Section on Small Apes) der Weltnaturschutzorganisation IUCN hat daher das Jahr 2015 zum Jahr des Gibbons erklärt. Die kleinen schwanzlosen Affen mit den langen Armen ernähren sich in ihrer Heimat Südostasien hauptsächlich von Früchten und gelten dadurch als wichtige Samenverbreiter.“ Heutzutage stellt man alle Lebewesen so gut es geht als „nützlich“ dar – „man“: die Darwinisten, mit deren Utilitarismus die entscheidende Rolle der Selektion in ihrer Evolution steht und fällt.
.

Anscheinend war die Hütte an ihrer Insel für die Gibbon nur ein Sommerhäuschen, denn seit November sind sie in einem Käfig im Affenhaus des Tierparks. Im Bremer Tierpark war es jedenfalls so.
Dort gehörte es anfänglich morgens zu meinen ersten Aufgaben, zwei junge Orang-Utans aus ihrem viel zu kleinen und dunklen Käfig zu nehmen und mit ihnen durch den Tierpark an einen See für Wasservögel zu gehen, um sie dort mit einem Schlauchboot auf eine kleine Insel zu rudern. Diese war für Gibbon angelegt worden – aber zu der Zeit noch unbenutzt. Auf dem Weg von ihrem Käfig zum Boot nahm ich sie an die Hand, während sie ständig versuchten, in meine Gummistiefel zu beißen. Auf der Insel mußte ich erst einmal die Tür eines kleines Pfahlhäuschens aufsperren, damit sie bei Regen darin Schutz suchen konnten. Einmal sprangen mir währenddessen die beiden wieder zurück ins Schlauchboot – und ich befand mich alleine auf der Insel, während die kleinen Affen langsam über den See abtrieben. Dieser Moment der Freiheit, die Freude über ihre gelungene Tat und der Anblick meines hilflos-entsetzten Gesichtsausdrucks brachte sie wie toll zum Lachen: Vor Freude hüpften sie laut kreischend auf die Wülste des Schlauchboots, das bedenklich schwankte. Aber sie kamen nicht weit.
.

Nordamerikanische Wapitihirschkuh

Kalifornische Zwergwapitihirschkuh mit zwei Kälbern. 2012 berichtete die Leipziger Volkszeitung: „Die Stadt Leipzig hat am Südost-Ufer des Cospudener Sees ein neues Gehege eingerichtet. Die ersten Bewohner waren Wisente aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn… Inzwischen sind auf der Anlage vier kalifornische Zwergwapiti aus dem Tierpark Berlin heimisch geworden. Sie haben zwei Aufgaben – fressend Landschaftspflege zu betreiben und sich zu vermehren. Für ersteres bekommt die Truppe demnächst Verstärkung, eine Junggesellengruppe kanadischer Waldbisons wird erwartet.“ Also auch die gefangenen Tiere müssen sich „nützlich“ machen. Und sei es, um ihre Population – ihr Volk – zu vermehren – zu verbessern (weil ja in „gesunden Beständen“ nur die Fittesten ihre Gene vererben dürfen/sollen). So wie auch in der Marktwirtschaft ständig alles vermehrt werden, d.h. „enorme“ Zuwachsraten haben muß – bei Strafe des Untergangs, denn nur die Besten überleben. Wer eine wichtige „Entwicklung verschlafen“ hat, sieht alt aus. Das Schlimmste am Darwinismus ist, dass seine Anhänger sich so wenig Mühe damit geben! Es gibt kaum eine größere Arbeit von Zoologen, in der sie ihn nicht bereits in groben Zügen präambelmäßig an den Anfang stellen, um ihren Bericht zu „framen“. Nur damit scheinen sie zu hoffen, mit den Genetikern und Neurobiologen in einem Boot zu bleiben – und im Zentralorgan der Neodarwinisten, „Nature“, veröffentlicht zu werden. Diese in wirtschaftspolitischer und dogmatischer Hinsicht übelste Zeitschrift benutzte einst als Präambel für ihre erste Ausgabe ausgerechnet Goethes schwärmerischen Aufsatz „Die Natur“.
………………………………………………….
(3) Der Dichter Joachim Ringelnatz hatte sich bereits 1929 auf einer Pressekonferenz des Zoos notiert: „Der Zoodirektor erklärte leidenschaftlich: Was Tiere kosteten. Was Futter kostete. Was ein Zoo ohne Tiere sei – Und was ein Zoo mit Tieren für den Fremdenverkehr, für Volksbelehrung und Ablenkung von politischen und…“
.

Kattas, eine Lemurenart aus Madagaskar. „Die Kattas (Lemur catta) hatten 2012 fünf Zugänge zu verzeichnen. Die erfahrene „Rebecca“ brachte ein weibliches Jungtier zur Welt, und zwei im selben Jahr geborene Katta-Paare überließ uns der Zoo Sosto in Ungarn, die später an die Taman Safari Indonesia Bogor weitergegeben werden sollen.“ (Tierpark-Jahrbuch 2012)

Braune Lemuren. Im Jahresbericht 2012 des Tierparks Berlin-Friedrichsfelde GmbH heißt es gleich auf Seite zwei mit Photos unter der Überschrift „Herrentiere“ – über zwei neuangeschaffte Lemurenarten: „Erstmalig für Deutschland: ein Halsbandmaki (Lemur fulvus collaris)“ und „Erstmals wächst ein Rotbauchmaki (Lemur rubriventer) im Tierpark heran. Neben den Weißkopfmakis (Lemur fulvus albifrons), die im Niederaffenhaus zu besichtigen sind, wird nun eine zweite Unterart des Braunen Lemurs in Berlin ausgestellt.“
.

Schwarzweißer Vari, zu denen man ins Gehege geht. Sie durchstöbern gerne Handtaschen – aber nicht rüde sondern neugierig-vorsichtig. Die Varis sind ebenfalls eine auf Madagaskar lebende Lemurenart.
——————————————-
(4) Der Naturschützer und Tierfilmer Horst Stern (1922) erwarb einmal zwei Kolkraben – 1973 merkte er dazu rückblickend an: „Ich konnte dabei nicht wirklich wissenschaftliche Zwecke für mich in Anspruch nehmen, vielmehr nur meine tiernärrische Neugier auf diese sagenhaften klugen Vögel. Wie ich denn überhaupt sagen muß, dass nicht selten passionierte Tierfreunde, insbesondere Tierfotografen, mehr Schaden in der Tierwelt anrichten als dass ihre Beobachtungen und Bilder ihr nützen.“
.
Der Tierpark Friedrichsfelde hält zwei Kolkraben in einer Großvoliere, die auf dem höchsten Punkt des Geländes stand und auf deren Drahtdach sich, wie der Kurator für Vögel, Dr. Martin Kaiser, erzählte, gelegentlich wild lebende Kolkraben niederlassen. Inzwischen leben die beiden aber in einer Voliere weiter unten. Das 2010 geborene Weibchen wurde noch im selben Jahr vom Tierpark erworben und das etwas größere Männchen 2011. Früher hielt auch der Zoologische Garten in Charlottenburg noch Kolkraben in einer Voliere. Zum Spielen haben sie in ihrer nicht eben kleinen Voliere u.a. einen gelben Ball. Ich sah sie jedoch noch nie damit spielen.
.
Als ich das erste Mal vor ihrer Voliere stand, begannen sie, einen Teil ihres Repertoires vorzuführen, so schien es jedenfalls: Während der eine Rabe auf einen nahen Ast flog und laute „wrru“-Rufe ausstieß, fischte der oder die andere erst einen Zweig aus dem Wasserbecken und hebelte dann auf einem Baumstamm ein Stück Rinde ab. Sodann flog er oder sie auf einen Ast und stieß kehlige „koark“-Laute aus, was ziemlich angestrengt aussah. Der erste Vogel flog währenddessen auf die Erde, schaufelte mit halbgeöffnetem Schnabel den Sand an einer Stelle weg und zog ein angefaultes Stück Holz heraus. Das sah der „singende“ Rabe, landete hinter dem anderen und schaufelte ebenfalls den Sand an einer Stelle weg, jedoch ohne Eifer, auch schienen ihm die Sandkörner im Schnabel unangenehm zu sein. – Das fand alles innerhalb der durchschnittlichen Verweildauer eines Tierparkbesuchers vor einer Voliere statt, ich war beeindruckt. Um so mehr, da sich die meisten Tiere im Tierpark an dem kalten Frühlingstag 2016 verkrochen hatten, ein paar verharrten nahezu regungslos in der Sonne, nur einige Raubtiere liefen wie stets ruhelos in ihren Gehegen hin und her, z.B. die Asiatischen Rothunde, in deren Rudel hielt sich interessanterweise ein Dutzend Nebelkrähen auf. Die beiden Tierarten schienen gut miteinander auszukommen, die Krähen nisteten im Tierpark. Als die Nebelkrähen im Tierpark ihr „Brutgeschäft“ beendet hatten, und nicht mehr so viel Fleisch für ihre Jungen benötigten, sah man sie bei den Asiatischen Rothunden seltener. Ich entdeckte etliche Krähennester in den hohen Bäumen drumherum, überhaupt wimmelte es im Park geradezu von dort frei lebenden Vögeln. Früher nisteten auch Kolkraben im Tierpark, über die der Vorgänger des Kurators Dr. Kaiser einen Artikel veröffentlichte. Zur Brutzeit zieht es auch die im Tiergarten nistenden Nebelkrähen in den nahen Westberliner Zoo. Sie sind ebenfalls „Mitesser“ bei den gefangenen Tieren, wie man sagt, das gilt auch für viele Enten, Spatzen und vor allem Fischreiher. Insgesamt sollen Vertreter von 123 Vogelarten im Tierpark frei leben – und mitverköstigt werden, wie Heinrich Dathe irgendwo erwähnte.
.

Umschlagbild von Susanne Memarnia für das Buch „Rabenvögel“ (Nr. 11 der Reihe „Kleiner Brehm“)
.
An den besonders heißen Tagen im Juli hockten die zwei Kolkraben hechelnd in ihrer Voliere. Als es dann regnete und abkühlte, wurden sie wieder munter, sprangen von Ast zu Ast und putzten sich ausgiebig. Das Weibchen stieß gelegentlich ein halblautes „Uurk!“ hervor. Als ein Kolkrabe über die Voliere flog und Flugrufe ausstieß, wurden beide still und schauten lange in den Himmel. Kurz danach näherte sich eine Nebelkrähe auf einem nahen Baum vorsichtig der Voliere. Die beiden Kolkraben taten so, als hätten sie sie nicht gesehen. Dann fing das Männchen an, Futterstücke aus der Erde zu graben, damit kurz herumzulaufen und dann erneut in der Erde zu verstecken – vor den Augen der Nebelkrähe quasi.
.
Es sah dies alles nach einer Umkehrung der von vielen Rabenforschern konstatierten, fast zwanghaften Gewohnheit der Rabenvögel aus, heimlich Futterstücke zu verstecken – und dabei sogar das „Mind Reading“ bei ihren „Kumpanen“ in der Nähe zu beherrschen, indem sie nur so tun, als würden sie einen Futterbrocken verstecken – weil der oder die anderen auch nur so tun, als würden sie nicht hinkucken. Ich hoffte insgeheim, während ich sie allwöchentlich beobachtete, dass irgendwann der oder die Tierpflegerin auftauchen würde und ich ein paar Worte mit ihm oder ihr wechseln könnte.
.

Asiatischer Rothund, ein rudelbildender Hetzjäger, nennt ihn Wikipedia. „Der asiatische Wildhund oder Rothund (Cuon alpinus) ist ein wunderschönes grosses Mitglied der Familie der Hundeartigen. Er ist in verschiedenen Vegetationstypen Tibets, Vietnams, Bhutans, Thailands, Laos, Malaysias, Indonesiens und Indiens heimisch. Ihr Lebensraum ist in gravierender Weise zerstückelt. Heute leben noch knapp 2000 Tiere in freier Wildbahn, weshalb der asiatische Wildhund von der IUCN auf ihrer Roten Liste auch als ‚gefährdet‘ eingestuft wird.
Das Rudel von 5-10 Einzeltieren jagt normalerweise in der Gruppe: Einige Wildhunde des Rudels lauern im Hinterhalt, während ihnen die anderen Tiere die Beute zutreiben. Mit dieser Technik können sie relative grosse Tiere wie Pferde- und Axishirsche, junge Gaur-Rinder und Wasserbüffel reissen. Leider sind viele ihrer Beutetiere ebenfalls gefährdet und nur noch in kleiner Zahl vorhanden. Dies treibt den Rothund in einigen Gebieten dazu, auch Nutztiere wie Rinder oder Ziegen zu reissen. Aus historischer Sicht wurden deshalb viele Wildhunde als Bedrohung für den Viehbestand gesehen und bei Sichtung mittels Gift, Tierfallen und Erschiessen bekämpft. Es wurden auch Welpen getötet,“ heißt es auf der Internetseite der „European Outdoor Conservation Association“.
Auf der Internetseite des Tierparks wurde 2016 gemeldet: „Im April kamen acht Rothunde zur Welt, ihre Eltern sind Lady und Maru. Besonders erfreulich, denn die asiatischen Wildhunde sind mit nur noch etwa 7.500 Exemplaren in freier Wildbahn stark gefährdet.“
.

Wisentkuh mit 3 Kälbern um sich. Tierparkdirektor Dathe schreibt über seine kleine Wisentherde in seinem Buch „Erlebnisse mit Zootieren“ (1978): „Dieser Tage wurde wieder einmal ein Wisent geboren. Wenngleich allmählich mit zunehmender Bestandsstärke dieses vor 40 Jahren dem Aussterben nahen Wildrindes einer Wisentgeburt nicht mehr die Beachtung geschenkt wird, wie es noch am Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war, so freut man sich doch immer wieder über so ein braunfelliges Kälbchen, das sein Schwänzchen wie einen Henkel beim Galoppieren hochhält.“

Kinder am Bisongehege.

Weisse Pelikane am Bisongehege. Das amerikanische Pendant zu den europäischen Wisenten sind die Bison. Von den letzteren gab es Millionen in Nordamerika, beinahe wurden sie von den Weißen alle getötet. Die Indianerstämme, die sie zuvor gejagt hatten, sind tatsächlich ausgestorben, aber einige Bisons haben überlebt: aus den letzten 800 züchtete man in Nationalparks wieder größere Herden – von Wald- und Prärie-Bisons. Letztere werden z.B. im Basler Zoo gehalten. Der Bisonbulle im Tierpark in den Siebzigerjahren hieß „Justav“ und war der „Stammvater der kleinen Herde, außerdem ein Geschenk der „Berliner Zeitung“, die man gerade abwickeln will. „Justav“ brach zwei Mal aus. Zerstörte mit seinem dicken Schädel manche Bohlentür, „auf alle Fälle: er beschäftigte uns,“ schreibt Dathe. Und da er bereits etliche der männlichen Nachkommen kennengelernt hat, die immer größer werden als „Justav“, vermutete er: „Offenbar wirkt hier die Akzeleration“ – eine Entwicklungsbeschleunigung, die man auch bei jungen Menschen festgestellt hat. Es ist dies bei uns jedoch eher ein kollektiver Vorgang, der mit Macht zu tun hat: So werden die Mongolen z.B. seit Dschingis Khans Weltreich zerfiel, immer kleiner, während die US-Amerikaner immer größer werden. Inzwischen dirigieren sie übrigens auch noch die Mongolei wirtschaftspolitisch (davor waren es die Sowjets). Dathe hat bei seinen Jung-Bisons noch etwas bemerkt: Wenn mehrere Gleichaltrige da sind „fördert dies die Unternehmungslust und lockert die Bindung zu den Müttern.“ Wer von uns kennt das nicht aus eigener Erfahrung? Auch bei den Pelikanen im Tierpark hat Dathe bemerkt, „daß die jungen oft größer sind als die Alten, die noch aus der Freiheit stammen“ und dass in Gefangenschaft gehaltene Tiere auch früher geschlechtsreif werden. Gibt es demnach eine innere und eine äußere Akzeleration?

Waldbisonbulle
.

Vikunjas und Enten im Wassergraben. Das Vikunja ist neben dem Alpaka eine der beiden Arten der Gattung Vicunja und gehört wie die Lamas (eine aus den Guanakos gezüchtete Haustierform) zur Familie der Kamele. Es ähnelt dem Guanako, ist aber kleiner und schlanker. Die Inka trieben die in den Hochanden lebenden Vikunjas laut Wikipedia zu Zehntausenden in Gatter, schoren die Wolle zur ausschließlichen Verwendung durch hohe Adlige und ließen die Tiere dann wieder frei. Die Spanier setzten diese Tradition nicht fort. Sie schossen Vikunjas in großer Zahl ab und vergifteten oft auch deren Wasserstellen, zunächst um Platz für Weideland zu schaffen und erst später wegen des Fells. Heutzutage stehen Vikunjas unter Artenschutz. In Peru, Chile, Bolivien und Argentinien werden sie zur kommerziellen Nutzung freilaufend in Nationalparks gehalten, mitunter auch in weitläufigen Gehegen.
.

Asiatischer Wasserbüffel (Kerabau). Der indische Autor Aravind Adiga schreibt in seinem Roman „Der weisse Tiger“ (2010) über den Umgang mit einem weiblichen Wasserbüffel. Es heißt da – über das Dorf, die Familie und den Hof, in dem der Ich-Erzähler aufwuchs: „An der Tür steht das wichtigste Familienmitglied: die Wasserbüffelkuh. Sie war bei weitem die Fetteste in unserem Haus, und so war es auch bei allen anderen Familien des Dorfes. Den ganzen Tag fütterten die Frauen sie mit frischem Gras; das Füttern war ihre Hauptbeschäftigung im Leben. Alle Hoffnungen dieser Frauen richteten sich auf den Leibesumfang der Büffelkuh. Gab sie genug Milch, konnten die Frauen etwas davon verkaufen, und am Ende des Tages war vielleicht ein bisschen Geld übrig. Sie war wohlgenährt, ihr Fell glänzte, über ihrem haarigen Maul stand eine Ader hervor, und von ihren Lefzen hingen lange, dicke, perlmuttfarbene Speichelfäden. Den ganzen Tag lag sie in ihrem dicken Scheißhaufen. Sie war die Haustyrannin!“ So gaben die Frauen z.B. seinem Vater erst nach der Büffelkuh zu essen. Früh am Morgen band der Vater sie von ihrem Pfahl los und zusammen mit seinem Sohn brachte er das dicke Tier an einen Wassergraben, damit es sein Morgenbad nehmen konnte. „Die Büffelkuh watet hinein und kaut an den Seerosenblättern. Währenddessen geht über ihr, dem Vater, und mir und meiner Welt die Sonne auf. Es ist kaum zu glauben, aber manchmal vermisse ich diesen Ort.“
.

Zebramanguste – lebt südlich der Sahara meist in Gruppen und hat laut Wikipedia ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
.

Zwergziegen – ebenfalls sehr soziale und neugierige Tiere.
.

Weißschwanz-Stachelschweine. Die ersten bekam der Tierpark aus der Sowjetunion. „Sie sind winterhart“, versicherte Heinrich Dathe.
.

Zwergesel. So einen besaß ich einmal, ein Jugoslawischer, den ich von einem Züchter bei Verden an der Aller für 100 DM kaufte.Er lebte dann in Italien. Eigentlich sollte er nur meinem Pferd Gesellschaft leisten, die beiden vertrugen sich auch gut, aber ich stellte irgendwann fest, dass mir das Verhalten des Esels viel näher lag als das meines Pferdes.