Nordamerikanische Schneeziege – wie man sieht
Fortsetzung des vorangegangenen blog-eintrags. Ich mache meist nur einen Eintrag im Monat, aber der soll dann auch „tiefer“ als der Tag gedacht sein, auch sehr viel länger natürlich:
Der Ornithologe Oskar Heinroth starb ähnlich wie Dathe: Als Leiter des Aquariums im Zoologischen Garten in Charlottenburg mußte er mit ansehen, wie in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges auch noch „sein“ Aquariumgebäude durch eine Luftmine, die im Krokodilbecken explodierte, völlig zerstört wurde. „Lieber möchte ich mit allem untergehen“, sagte er seiner Frau – und starb (am 26. Mai 1945). Nach Katharina Heinroths Aufbauarbeit und Entlassung wurde der Veterinär Heinz-Georg Klös Zoo-Direktor, er bekam am Ende zum Dank eine üppig illustrierte Publikation im Schuber finanziert: „Die Arche Noah an der Spree“ (1994). Als Zoo-Biographie läßt sie, wenigstens vom Umfang und von den Archivdokumenten her, Nichts zu wünschen übrig – dafür jedoch die Wahrheit hier und da vermissen: So werden für den Tod des Gorillas „Pongo“ im Mai 1945, den Lutz Heck 1936 gekauft hatte, „russische Soldaten“ und nicht plündernde und wildernde Deutsche oder ehemalige Zwangsarbeiter verantwortlich gemacht. Für die Flucht des stramm nationalsozialistischen Zoodirektors Lutz Heck und seines Stellvertreters wird lediglich deren Befürchtung, „in den Wirren des Zusammenbruchs von den russischen Soldaten erschossen zu werden,“ erwähnt. Und über Katharina Heinroths skandalöse Entlassung mitten aus ihrer Arbeit heraus heißt es bloß: Als sie Ende 1965 „in den Ruhestand ging, hatte sie dem nach dem Zusammenbruch hoffnungslos darniederliegenden Zoo wieder ein sicheres Fundament gegeben. Der Tierbestand hatte wieder einen Wert von 424.000 DM. Und auch im Ruhestand kannte sie keine Resignation, sie blieb eine vorbildliche Frau…“ Das ist immer noch in dem alten, unseligenen und überheblichen Nazigeist geschrieben – fern jeder auch nur halbwegs kritischen Bearbeitung der Zoo-Geschichte. Um wieviel wahrer ist dagegen der Zoo-Roman „Abwesende Tiere“ von Martin Kluger…
.

Giraffen vor ihrem 1995 errichteten Haus. 1949 hatte der Zürcher Zoodirektor Hofmann Giraffen aus Tanganjika importiert, aber der Leiter des staatlichen Veterinäramtes Flueckiger widerrief die Einfuhrgenehmigung während die Tiere schon auf dem Schiffsweg nach Europa waren. Zuletzt wurden die Giraffen und eine Reihe weiterer Spalthufer von den holländischen Behörden getötet und ihre Leichen ins Meer geworfen. Für den Zoo war das ein Verlust von 100.000 Franken, wegen dieses „Giraffen-Skandals“ verklagte der Aufsichtsrat des Zoos Flueckiger, verlor jedoch den Prozeß. „Kurz darauf starb auch noch die letzte Giraffe im Zürcher Zoo. Seitdem gibt es dort keine mehr,“ schreibt der Hediger-Schüler und heutige Direktor des Zürcher Zoos Alex Rübel 2009 in: „Heini Hediger 1908 – 1992“.
1960 sammelten Kinder, die die Hefte der Zeitschrift „Bummi“ lasen, obwohl die Titelfigur Bummi ein aufrecht gehender gelber Bär war, 20.000 Mark für den Ankauf eines angolanischen Giraffenpaares durch den Tierpark. 1968 bekam es sein erstes Junges, es wurde „Bummi“ getauft. 1970 wurde ein zweites geboren. Als es das erste Mal ins Freigehege kam, wollte es nicht mehr der Mutter hinterher in den Stall zurückgehen. Hier hatte einmal ein Junges, auch nach dem dritten Tag noch, „keine feste Bindung an die Mutter“ aufgebaut, sonst ist es im Zoo meistens umgekehrt, weswegen so viele im Zoo geborene Tiere von den Pflegern oder den Frauen der leitenden Angestellten groß gezogen werden.
2013 informierte die Vereinspublikation der Gemeinschaft der Förderer von Tierpark Berlin und Zoo Berlin e.V., „Takin“, dass bei den Giraffen kürzlich eine Schlafforschung stattfand. Zur Messung der Stressbelastung wurde die Cortisolmetaboliten-Konzentration im Kot der Tiere analysiert. Es mußte dazu jedoch auch eine Beobachtung des Verhaltens kommen – des „REM-Schlafs“ über einen längeren Zeitraum. 645 Nächte in diesem Fall. Der Kurator für Säugetiere, Florian Sicks, behauptete, damit lasse sich „das Wohlbefinden der Tiere objektiv bewerten“. Auf der Internetseite des Tierparks heißt es, dass es sich bei den Tieren um „Rothschild-Giraffen“ handelt. Der „Erlebnis-Zoo Hannover“ ergänzt: „Sie wurde erstmalig von dem Zoologen Lord Walter Rothschild Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieben. Diese Unterart wird manchmal außerdem als Uganda-Giraffe oder als Baringo-Giraffe (benannt nach dem Baringo-See in Kenya) bezeichnet. Es leben nur noch etwa 1000 Rothschild-Giraffen in Afrika!“

………………………………………………..
Von den Ränken und Leiden des Personals des Westberliner Zoologischen Gartens berichtet die 1000seitige Studie/Story des Berliner Schriftstellers Martin Kluger. Es geht darin vor allem um den Direktor, seine wissenschaftliche Assistentin, seine verschwundene Ehefrau, seinen Pressesprecher, um etwa sieben Tierpfleger und einige weitere Zooaffine – mit dem Titel: „Abwesende Tiere“ (2002). Der Zoodirektor hatte laut Martin Kluger ein besonderes Verhältnis zu seinen Pförtnern: „Auf sie konnte er sich verlassen. Weniger auf die Besucher, von denen die meisten, ob sie es wußten oder nicht, die geborenen Tierquäler waren, Frauen und Kinder voran.“ Gleichzeitig spendeten die Frauen aber auch die größten Geldsummen für den Zoo und mußten deswegen pfleglich behandelt werden. Besonders schlimm war es dort während der Pfingstkonzerte, wenn sich „an die 300.000 Besucher durch den Garten wälzten, die Blumen platt trampelten und die Tiere steinigten, die zu diesem Anlaß extra sediert werden mußten…“
.
Das „besondere Verhältnis“ des Zoodirektors zu „seinen Pförtnern“ erinnert an das des Basler Zoologen Adolf Portmann zu „seinem“ Hausmeister in der „Zoologischen Anstalt“ der Basler Universität. Der bei Fulda lebende Biologe Joachim Illies schreibt, als „Schüler“ Portmanns, in seiner Biographie über ihn in „Das Geheimnis des Lebendigen“ (1976): Als Adolf Portmann 1933 Ordinarius an der Zoologischen Anstalt wurde, „war eine der frühen administrativen Entscheidungen die für das Institut gewiß nicht unwichtige Wahl unter den Bewerbern um das freigewordene Amt eines Hauswartes. Portmann griff auf seine Kriegserfahrungen zurück und stellte einen bewährten Kameraden seiner ehemaligen Geschützbedienung, den Kanonier Traugott Schweizer, an.“
.
Die Assistentin des Zoodirektors im Roman von Martin Kluger wollte ihre Doktorarbeit – von feministischen Animal Studies inspiriert – über die „Zwischenartliche Kommunikation“ schreiben, wobei sie u.a. an sich und den persischen Leopard „Sali“ dachte und generell über das „Interaktionsschema Pfleger-Tier“. Wiederholt wurde ihr von der Morgenrunde gesagt: Statt „Zwischenartlicher Kommunikation“ findet hier ausschließlich „Menschenobhut“ statt. Und einer der Pfleger mußte sich deswegen sagen lassen, dass er ein „Doktor-Doolittle-Syndrom“ habe. Das „dienstälteste Tier im Zoo, Überlebender zweier Weltkriege, mehrerer Vogelhausneubauten und ungezählter Lehrer und Verführer“ war ein Graupapagei (namens „Schiefhals“). Sein Pfleger meinte: „Tiere und Wissenschaft – das geht nicht zusammen, gehe nie zusammen, ebensowenig wie Menschen und Ärzte, weil es keine Sprache, keine Verständigung gebe zwischen Opfern und Tätern (so drückte er sich aus)…Und „Mitleid sei ein Trick der Täter.“ Seine frühere Freundin, mit der er fast täglich in den Zoo und ins Aquarium gegangen war, als er noch kein Tierpfleger war, sondern in einem Reisebüro arbeitete, wollte von seinen Geschichten über die Qualen des Einfangens und Einsperrens wilder Tiere nichts hören. „Natur war Natur, meinte sie zu ihm, und Kolkrabe blieb Kolkrabe.“
.
Das war zu Zeiten, als der Zoologische Garten in Charlottenburg noch einen Kolkraben in Einzelhaft hielt – zusammen mit einer „kranken Harpyie in einem winzigen Käfig“. Der Rabe hieß „Rätsel, weil er immer so geheimnisvoll tat, vergrub überall in seinem Käfig Fleischbrocken und grub sie wieder aus.“ Man verscharrte Silberpapier und Zigarettenstummel für ihn, „das machte Freude.“ In einem ebenfalls kleinen „Erkerkäfig“ lebte außerdem noch ein Kolkrabenpärchen, das ein Nest besaß, aber kein Gelege. Ihr Pfleger hatte den einzeln gehaltenen Kolkraben schon studiert, als er noch gar nicht im Zoo arbeitete. Einmal überraschte er den Dozenten einer Zooführung „mit intimen Kenntnissen über den Raben“: „Er warf Fleischbrocken in Rätsels Käfig, drehte dem Raben den Rücken zu und sagte exakt voraus, wo der Vogel die Bröckchen verstecken würde. Die Kursteilnehmer waren beeindruckt“ – der Dozent weniger: „Was soll damit bewiesen sein? Etwas mehr Ehrfurcht vor der Natur wäre angemessener.“ Die Freundin des späteren Vogelpflegers hatte den Kolkraben einmal angefaßt und war von ihm gebissen worden, was sie jedoch eher stolz als traurig gemacht hatte.
.

Harpyie, einer der größten Greifvögel, er lebt in den Wäldern Mittel- und Südamerikas.
………………………………………………
Am Rande des Kinderzoos gab es ein „Meerschweinchendorf“. Der Sohn des Direktors baute für die weißen Mäuse „Pompeji“ in ihrem Käfig nach. (1) Jedes Frühjahr gibt es im Vogel-Revier beim Suchen der wertvollen Eier von Flamingos, Kranichen etc., um sie künstlich auszubrüten, „ein Wettlauf mit den Krähen“. Der Obertierinspektor macht mit seinem Luftdruckgewehr Jagd auf sie, nachdem die Zoodirektion angeordnet hatte, „mit aller zu Gebote stehenden Härte Jagd auf diese Störenfriede und Eierdiebe“ zu machen.
.
Ansonsten hatte der Direktor bald nur noch Interesse für sein neuestes „Großprojekt: Nachttierhaus“. Eine seiner Big Spender, die in den USA lebte, wollte, dass man es nach ihrer Jugendliebe „Paul Eipper“ benamte (Eipper war ein Tiermaler und Tierbuchautor aus Stuttgart gewesen). Vorbild für das Nachttierhaus der Zoodirektors war eventuell das „Dr.Grzimek-Haus“ im Frankfurter Zoo. Die über Zooarchitekturen promovierende Kunsthistorikerin Christina Katharina May hat sich in einigen Ländern die „Nachttierhäuser in Zoologischen Gärten“ angeschaut und darüber in der Zeitschrift „Tierstudien“ (6/2014) berichtet. Das erste wurde bereits 1953 unter dem Namen „Twilight World“ im Zoo von Bristol eröffnet. Das im New Yorker Bronx Zoo 1969 eröffnete nannte man „World of Darkness“. In der Folgezeit wurde „im Gegensatz zu den bläulich beleuchteten europäischen Nachttierhäusern in den USA mit Rotlicht experimentiert.“ Die Autorin meint: „Die dunklen Kammern der Nachttierhäuser verändern die Wahrnehmung der Besucher und machen sie für andere Wahrnehmungsmöglichkeiten des Raumes außerhalb des Alltags empfänglich.“
Für mich haben sie etwas von schlecht beleuchteten Aquarien. Zudem transzendieren sie nicht die „stereotypen Gehegeformen ‚Schaukasten‘, ‚Bühne‘, ‚Park'“, wie die Szenografin Anne Hölck nach Recherchen in 17 europäischen Zoos in ihrem Artikel „Lebende Bilder und täglich wilde Szenen. Tiere im Maßstab von Zooarchitektur“ schreibt, der in der Zeitschrift „Tierstudien“ (7/2015) veröffentlicht wurde. Als „Bühne“ bezeichnet sie die Gestaltung eines Geheges als „Illusionsraum“. Mit „Park wurde ursprünglich das Jagdgehege in einem Wald bezeichnet, dessen Grenzen für Spaziergänger nicht sichtbar und nur den Jägern bekannt sind. Seit den Zoogründungen werden Gehege für heimische Tiere in die Parkgestaltung integriert…In zeitgenössischen Immersionsgehegen erscheint die gebaute Grenze zwischen Menschen und Tieren visuell weitestgehend aufgelöst, Gräben und Blockzäune sind bewachsen und nicht mehr eindeutig als Barrieren wahrnehmbar.“ Der „Schaukasten“ schließlich „präsentiert Tiere als passive Schauobjekte wie es in den Menagerien üblich war, die Tiere sind distanzlos menschlichen Blicken ausgeliefert.“ In den Nachttierhäusern überwiegen sie, in den Aquarien- und Terrarienhäusern bekommt dies manchmal den Charakter von einem Schaufensterbummel, zumal wenn viele Besucher da sind und man nicht lange vor den einzelnen leuchtend „lebenden Bildern“ stehen bleiben kann. Laut Christina Katharina May führte die Entwicklung dieser und anderer „hochtechnisierter Tierhäuser“ immerhin „zu vermehrten empirischen Verhaltensstudien, die auf einem wachsenden Interesse an Tierpsychologie beruhen.“ Konrad Lorenz hat einmal gesagt, „von meinem Aquarium habe ich mehr gelernt als in allen Biologieseminaren zusammen.“ Seins war so riesig, dass viele Zoodirektoren ihn darum beneideten, um es zu säubern mußte er darin tauchen. Neuerdings sind große mit mehreren Tier- und Pflanzenarten bestückte und begehbare Tropenhäuser bei den Zoodirektoren in Mode, für Anne Hölck „überlagern“ sich darin „häufig alle drei Situationen der Schaukasten-, Bühnen- und Parksituation“.
.
Weiter in Klugers Roman: Des Zoodirektors Sekretärin hatte eigene Personalpläne, war aber verschwiegen, „es blieb ihr auch nichts anderes übrig, wollte sie nicht als Tippse im städtischen Tierheim enden.“ Der Bürgermeister (Eberhard Diepgen? – geb. 1941) „verehrte Zebras“. Die Raubtierpfleger im Zoo galten als besonders „sensibel“, gerieten jedoch gelegentlich mit den „Affenpflegern“ aneinander. Der Direktor (Heinz-Georg Klös? – geb. 1926, ein Veterinär aus dem Tierpark Osnabrück, den Bernhard Grzimek als Nachfolger von Katharina Heinroth empfohlen hatte, nachdem er und alle anderen Zoo-Kapazitäten dankend abgelehnt hatten), dieser „Direktor“ hatte laut Martin Kluger eines seiner Bücher seinem „geliebten Orang-Utan-Weibchen gewidmet‘: ‚Für Rita – eines Tages kannst du es lesen‘.“ Er dachte oft an sie und hoffte, dass es ihr an nichts fehle. (2) Bei seinen Tierpflegern ging er davon aus, dass ihr „Zoospitalismus“ früher oder später für ihren „Abgang“ sorgen werde, er meinte damit ihre „irreparablen Schäden durch zu langen Zooaufenthalt“ (es gab und gibt im Gegensatz zum Ostberliner Tierpark anscheinend keine „Schonplätze“ für das Personal im Westberliner Zoo).
.

Ein Tierpfleger treibt die Mhorr-Gazellen in ihren Stall. Sie sind frei- oder wildlebend über West- und Nordafrika verbreitet. Reichholf kritisiert das dumme Wort „wild“-, Hediger das naive „frei“-lebend.
……………………………………………………
Auf der Jahresversammlung der „Deutschen Zoologischen Gesellschaft“ hielt der Direktor des Westberliner Zoos laut Martin Kluger den Festvortrag zum Thema „Der Zoo der Zukunft“ (das ist auch heute noch immer wieder auf den Versammlungen der Zoodirektoren das Hauptthema und ebenso war es Thema auf dem Symposium über den Ostberliner Zoodirektor „Heinrich Dathe“, weil er sich darüber ebenfalls schon Gedanken gemacht hatte). Der Westberliner Direktor dachte jedoch bei sich: „Glaubt diese dumme Gesellschaft wirklich, ich präsentiere ihnen meine Ideen über den Zoo der Zukunft schon heute?“ Ein auf dem Zoogelände forschender Neurobiologe, den der Direktor sehr schätzte, äußerte ihm gegenüber die Meinung: „Der Zoo hat keine Zukunft.“ Diese Weisheit hat er anscheinend vom englischen Wissenschaftsautor Colin Tudge, der 1991 in seinem Buch „Letzte Zuflucht Zoo“ schrieb: „Geht alles gut, werden die Zoos in wenigen Jahrhunderten an Bedeutung verlieren.“ Da es „in wenigen Jahrhunderten“ keine Säugetiere mehr geben wird, also auch keine Menschen – und damit natürlichauch keine Zoos, hat er wohl recht. (3)
.
Einer der Tierpfleger bekam bei Kluger später einen staatlichen Orden verliehen, sein Hilfspfleger wurde unterdes „geisteskrank“. Ein anderer, der Sohn des Direktors, wurde von einem Gnu getötet, worauf der Zooveterinär das Tier erschießen wollte, weil Tiere, die einen Menschen angegriffen haben, von Gesetz wegen getötet werden müssen, aber der Direktor ließ es nicht zu: „Ich bin hier das Gesetz. Fügen sie dem Tier kein Leid zu, oder ich werde sie erschießen,“ sagte er zum Tierarzt, der daraufhin das Gewehr sinken ließ. Später geschah es jedoch, dass dieser das Orang-Utan-Weibchen „Rita“ erschoß, nachdem es den Direktor in den Arm gebissen hatte, woraufhin der den Tierarzt sofort entließ. Immer wieder kam es auch zu Pöbeleien und gar Rangeleien – „Mißverständnissen“ – vor allem zwischen den Raubtier- und den Huftierpflegern.
.

.
Des Zoodirektors Assistentin entdeckte eines Tages drei kleine Löwenbabys im Käfig: Daraufhin „drohte Überpopulation im Raubtierhaus“, weswegen man sie einschläfern wollte. Alle Zoos waren mit Löwen gut versorgt und nicht daran interessiert, sie dem Berliner Zoo abzunehmen. Der Nachfolger von Zoo-Direktor Klös, Bernhard Blaszkiewitz, der zugleich Tierpark-Direktor wurde, soll angeblich einmal junge Löwen eingeschläfert haben, vorgeworfen wurde ihm außerdem, vier verwilderten Hauskatzen im Zoo den Hals umgedreht zu haben: „ein Einzelfall“ sagte er der Presse. Darüberhinaus habe er Inzucht bei den Giraffen zugelassen: „Das ist ganz normal, sollte aber auf Dauer über mehrere Generationen nicht so sein,“ meinte er. (4) Zu dem entgegengesetzten Vorwurf, unterschiedliche Arten verpaart zu haben, erklärte er: „Es ging um einen schwarzen Panther und einen Java-Leoparden. Das sind Angehörige derselben Art, wie es blonde und schwarzhaarige Menschen gibt. Aus der Verpaarung gab es drei Würfe. Den ersten hat die Pantherin nicht aufgezogen. Die übrigen waren jeweils Zwillinge, gelb mit schwarzen Flecken, die sind über Tierhändler Bode an andere Zoos vermittelt worden. Das alles hat nichts mit Tierversuchen zu tun…“ Als ihm ein Schimpanse einen Finger abbiß, machte die Presse Witze über ihn. Der Aufsichtsrat der Zoo AG rügte laut Tagesspiegel seinen „Führungsstil wie auch seine Verweigerungshaltung hinsichtlich jeglicher Modernisierungsversuche.“ – „Modernisierungsversuche“ nannte der Aufsichtsrat seine gebrainstormten Amüsierpöbel-Attraktionen. Blaszkiewitz‘ „Führungsstil“ hätte man ja noch hingenommen, aber für letzteres hatte die einflußreiche Westberliner „Geschäftswelt“, und dazu gehört auch die Finanzverwaltung, kein Verständnis. Die Berliner Zeitung wußte dagegen, er sei wegen seiner „Äußerungen zum Weihnachtsgeld und über Mitarbeiterinnen in die Kritik geraten.“ Was damit gemeint war, erklärte dann die Märkische Allgemeine Zeitung: „Blaszkiewitz setzte intern die Formel 0,1 vor die Namen von Mitarbeiterinnen, die in der Zoowelt für ‚Weibchen‘ steht, bei einigen Arten auch für ‚Zuchtstuten‘.“ Im Zoo-Roman denkt der Direktor ähnlich biologisch über seine Assistentin.
.

Java-Leopard. Die Raubtiere aller Breiten haben die Gewohnheit, „einen Überfluss an augenblicklich vorhandenem Fleisch auf Vorrat zu legen“. Der Leopard schleppt oft die Überreste einer Mahlzeit mühsam in die Kronen umstehender Bäume. Dabei geht es nicht nur um Aufbewahrung der Beute, „sondern vor allem auch um deren Sicherung vor Hyänen. Manchmal trägt er den ‚Riss‘ im Baum herum und hängt ihn ohne ersichtlichen Grund bald höher, bald tiefer hin.“ (Heini Hediger, „Tiere sorgen vor“, 1973)
In dem Taldorf Akole bei Bombay leben heute in der Umgebung der Menschen mehr als ein Dutzend Leoparden – und das sollen sie auch weiterhin. Manchmal reißen die Raubtiere einen Hund, eine Hauskatze oder eine Ziege. Sie werden von den Dörflern aber auch gefüttert, indem sie dem Gott der großen Katzen, Waghoba, ein Fleischopfer auf den Schrein legen. Für getötete Ziegen zahlt der Staat ihnen eine Entschädigung. Ein Team norwegischer und indischer Biologen hat dieses seltsame fast konfliktfreie Zusammenleben über Jahre erforscht – und darüber eine schöne Broschüre veröffentlicht: die „Waghoba Tales“. Dieses „Zusammenleben“ ist ein wichtiges Beispiel, denn die anderswo eingefangenen und in unbesiedelten Gebieten oder Schutzparks freigelassenen Leoparden waren bisher alle wieder – nur noch aggressiver – in ihre ursprünglichen Reviere zurückgekehrt. Die Dorfbewohner von Akole sind eine große Ausnahme in bezug auf den menschlichen Umgang mit Leoparden.
Der Leopard ist das „Zootier des Jahres 2016“. Dazu werden konkrete Schutzgebiete für dieses Tier unterstützt. Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift der Berliner Zooförderer „Takin“ erwähnt das „Sri Lanka-Schutzprojekt“ für den Ceylon-Leoparden und das „Iran-Schutzprojekt“ für den Persischen Leoparden. In beiden geht es erst einmal darum, mittels Kamerafallen, GPS-Halsbandsendern und Satelliten-Telemetrie herauszufinden, wo dort überhaupt noch Leoparden vorkommen, um geeignete Schutzmaßnahmen für sie zu entwickeln.
.

Der schwarze Panther ist ein Leopard (Panthera pardus), dessen Fell eine durchgehend schwarze Färbung aufweist, statt wie üblich schwarze Rosetten auf einem gold-gelben Grund. Unter günstigen Lichtverhältnissen ist die eigentlich gefleckte Fellzeichnung aber immer noch zu erkennen, meint Wikipedia. Es handelt sich bei diesen Panthern also nicht um eine eigene Art, sondern um eine Form des Melanismus.
1933 brach im Zürcher Zoo ein schwarzer Panther aus, der die ganze Stadt in Aufregung versetzte. Er trieb sich über zwei Monate in den Wäldern der Umgebung herum – bis er aufgespürt und erschossen wurde. Im Ostberliner Tierpark brachen in den ersten Jahren etliche Tiere aus, sie wurden jedoch fast alle wieder eingefangen oder kehrten von selbst zurück, erschossen wurde keins. Einige Fluchtgeschichten berichtete Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (Berliner Tierpark-Buch Nr.8, 1969).
Im Tierpark wurden 2012 Zwillinge geboren, sie wurden „Ferra“ und „Remaong“ genannt. Die Mutter heißt Angie (14) und der Vater Bromo (7). Dass er sich sich mit um die Brut kümmert, ist bei Großkatzen eher ungewöhnlich, er war sogar bei der Geburt dabei.

Panther im Außengehege
…………………………………….
Martin Klugers Geschichte der Mitarbeiter und einiger anderer Lebewesen im Westberliner Zoo reicht von der Nazizeit bis heute und wenn darin von den „zwei Schwestern“ nach dem Krieg die Rede ist, dann wird damit wahrscheinlich auf Katharina Heinroth und ihre Mutter angespielt, die sich gemeinsam nach 1945 dem Wiederaufbau des Zoos widmeten und dabei nicht wenige Tiere erst einmal in ihrer gemeinsamen Wohnung aufzogen. Kluger erwähnt einen Graupapagei, der noch eine Weile nach 45 „Heil Hitler“ („Heitler“) schrie, man hängte ein Schild an seinen Käfig: „Die Meinung dieses Vogels entspricht nicht der Meinung der Zoodirektion!“ Diese Geschichte stammt aus dem Münchner Tierpark, wo Heinz Heck Direktor war – von 1927 bis 1969. Zuletzt fragte sich Klugers Direktor: „Sind wir wirklich so viel dämlicher als…Warum sind wir nicht Heinroth?“ Und: „Wurde es nicht Zeit, nach dem Bau des Neuen Nachttierhauses das Land zu wechseln, vielleicht den Erdteil?“
.
2014 wurde bekannt, dass der neue Zoo-Direktor aus München, der Veterinär Andreas Knieriem, seinen unehrenvoll entlassenen Vorgänger im Amt, Bernhard Blaszkiewitz, auf Schadensersatz in erheblicher Höhe verklagen wolle – es geht dabei um 10.000 Tonnen Giftsand im Tierpark Friedrichsfelde, die Blaszkiewitz von einer Baufirma geliefert bekommen hatte, um damit Wege und Böden in Tiergehegen auszutauschen. Das „Problem“ ist, schrieb die Springerzeitung BZ, „muss der Tierpark das Material entsorgen, kommen auf ihn Kosten von mindestens 1,7 Millionen zu – damit droht die Pleite. Und: Laut Senatsumweltbehörde wurde inzwischen noch mehr belastetes Material gefunden, insgesamt ist von mehr als 82.000 Tonnen die Rede. “Belastetes Material“ findet man im übrigen auch jede Menge im Westberliner Zoo – nur ist es ideologisch-politischer Art und von daher nicht so leicht in Tonnen zu beziffern. Und irgendwo las ich auch, dass das mit dem kontaminierten Sand, der vom Hauptbahnhof stammt, laut einigen Entsorgungsexperten alles Unsinn sei.
.
Ende September 2016 fand bei den Kolkraben im Tierpark eine kleine Versammlung statt, d.h. auf der Bank vor ihrer Voliere. Die Gespräche verstummten jedesmal, wenn die beiden Vögel anfingen, sich mal leise und mal laut zu äußern. Es handelte sich dabei um Rabenfreunde, einige standen dem deutschen „rabenforum“ nahe, andere dem österreichischen rabenvogel-blog von Susanne Studeny. Dabei kam man auf Josef Reichholf zu sprechen. Der Münchner Ökologe Josef Reichholf (geb. 1945) ist Autor eines sehr persönlichen und schönen Rabenvogelbuches „Rabenschwarze Intelligenz“. Es handelt von seinen Erlebnissen mit einigen Dohlen sowie mit der Rabenkrähe Tommy und dem Kolkraben Mao. Das konservative Wissenschaftsportal kritisierte an dem Buch: „Eine Reihe von Begründungen basieren auf einzelnen, persönlichen Erlebnissen, niederbayerischen Anekdoten aus den 1950er und 1960er Jahren des vorherigen Jahrhunderts, und sind damit wissenschaftlich nicht sonderlich robust.“ Das Gleiche wirft man heute – u.a. im Bayrischen Rundfunk – auch den Forschungen von Konrad Lorenz vor: „Seine Beobachtungen sind zwar akribisch, aber häufig nur an einzelnen Tieren gewonnen. Dergleichen gilt heute als nahezu wertlos, weil sich solche Beobachtungen statistischen Berechnungsverfahren entziehen.“ Was für eine dumme Nachplapperei der Amiwissenschaft!
.

Flügelbeschnittene Rostgänse und Pelikane sowie frei lebende Fischreiher. Wenn zu DDR-Zeiten die Jagdsaison begann, wurde der Tierpark von Vögeln aus dem Umland geradezu ein Massenversteck.
.

Indisches Panzernashorn. „Ein zoologisches Hauptereignis des Jahres 1951 war für mich die Ankunft eines Indischen Panzernashorns,“ schreibt Heini Hediger in seiner Autobiographie. Es stammte vom Basler Großtierfänger und -händler Peter Ryhiner. der es mit seiner „charmanten indischen Frau“ schaffte, in Assam ein männliches Panzernashorn in einer Fallgrube zu fangen und nach Basel zu bringen. Er brauchte zwei Monate für den Transport – mit LKW, Flußdampfer, Ozeandampfer und Schweizer Güterzug ab Genua. Mit dem Nashornbullen „Gadadhar“ (Gadi von den Baslern genannt) wurde „der Grundstock gelegt für die erstmalige Zucht dieser Tierart in Europa und für die spätere weltweit größte Zucht, über 18 Junge dieser bedrohten Art wurden im Basler Zoo geboren.“ Im Tierpark Friedrichsfelde lebt heute der Indische Panzernashornbulle getrennt von einer Kuh mit Kalb.
————————————————-
In seinen Erinnerungen: „Mein Leben für die Natur“ erzählt Reichholf nun vor allem von seinen Reisen und was für Gedanken er sich währenddessen über die Tiere und Pflanzen, auf die er unterwegs stieß, machte. Nach Engagement im Naturschutz und Promotion (über Wasserschmetterlinge) war er seinem Vorvorgänger Hans Krieg (geb. 1888) auf die Lebensstelle in der Zoologischen Staatssammlung München gefolgt, eine der größten Sammlungen weltweit. Zuvor unternahm er noch, wie Hans Krieg, eine erste Forschungsreise nach Brasilien – in den Regenwald. Später beteiligte er sich an ornithologischen Exkursionen und Expeditionen nach Äthiopien, Italien, in die Serengeti, nach Indien, Südostasien und auf einige mehr oder weniger exotische Inseln. Der Verhaltensforscher und Zoologe Hans Krieg (geb. 1888) war Mitherausgeber der „Zeitschrift für Jagdwissenschaft“. Von 1923 bis 1938 führte er vier Expeditionen nach Südamerika durch. Seine Autobiographie beginnt mit dem Satz: „Ich habe versucht, aus meinem Leben ein Kunstwerk zu machen.“
.
Auch Reichholf, der furchtbar viele Bücher geschrieben hat, führt ein angenehmes und interessantes Leben, so sehr, dass es ihn reut: Jetzt, mit 70 und nachdem er wie wir alle einen „schweren ökologischen Fußabdruck hinterlassen“ hat, reifte in ihm die (protestantische) Erkenntnis: „Die Menschen brauchen schlechtes Gewissen.“ Er selbst fühlt sich mit seiner „Lebensweise“ schuldig, tröstet sich aber damit: „Vielleicht geht sie ja rechtzeitig vorüber, die Zeit des Menschen, bevor allzu viel Natur vernichtet ist. Dann erholt sie sich wieder. Leider haben wir, habe ich nichts mehr davon.“
.
Auf einer Reise nach Tansania fragte er sich: Warum befindet sich „die Wiege der Menschheit“ ausgerechnet in der Serengeti (die Bernhard Grzimek einst „rettete“), d.h. warum gingen bzw. liefen die „Vormenschen“ von der dortigen Savanne aus – aufrecht – in die Welt hinaus? Und was hat das mit den dort lebenden Pferden (Zebras) und ihrem seltsamen schwarz-weiß gestreiften Fell zu tun – und wie hängt das wiederum mit der dort ebenfalls „heimischen“ Tsetsefliege zusammen, die der Frankfurter Zoodirektor Grzimek den „bedeutendsten Naturschützer Afrikas“ nannte… So denkt sich das alles bei Reichholf fort und zusammen. Auch bei ihm daheim, wo er den Anhängern eines ideologisierten „Ökologismus“ vorwirft, den Faktor „Zeit“ bei ihren Einschätzungen von Entwicklung zu gering zu schätzen. So erklärt er sich z.B. den Rückgang der Schmetterlinge, deren Raupen von Kohlblättern leben, damit, dass ihm „aus der Distanz von Jahrzehnten die große Umstellung aufgefallen ist, die seit den Siebzigerjahren stattgefunden hat. Weithin. Aber regional unterschiedlich. Aus vielen, aus den meisten der früheren Gemüsegärten wurden in Stadt und Land Blumengärten.“ Wenn nicht bloß saubere Rasenflächen.
.

In der 1998 errichteten halbkugelförmigen Flugvoliere leben heute Störche, Ibisse und Nimmersatt. „Der Weiße oder Klapperstorch (Ciconia ciconia) stellt in Europa neben der Schwalbe wohl den volkstümlichsten Zugvogel dar. Er legt zweimal im Jahr eine Strecke bis zu 10.000 km zurück. Im Winter würde es ihm in seiner Brutheimat an Nahrung fehlen.“ (Heini Hediger, „Tiere sorgen vor“, 1973) In den letzten Jahren gab es jedoch immer mehr Weißstörche, die den Winter über hier blieben, z.T. wurden sie gefüttert. In Linum, einem Brandenburgischen Dorf mit vielen Storchennestern, kann man deren Brutgeschehen über eine Webcam am Bildschirme zu Hause verfolgen.
.
Ibisse gehören zur Ordnung der Schreitvögel. Es handelt sich überwiegend um ans Wasser gebundene Vögel mit langen, gebogenen Schnäbeln. Weltweit bewohnen Ibisse die tropischen, subtropischen und gemäßigt-warmen Zonen. Der typische Lebensraum sind Ufer von Seen oder langsam fließenden Flüssen, sowohl in offenen Landschaften als auch in dichten Regenwäldern. Einige Arten leben aber auch in Steppen und Savannen. (Wikipedia) Die Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach entdeckte auf Feuerland an einem Flußufer trotz Eiseskälte einige gänsegroße „Gelbnacken-Ibisse“, was sie zu der Bemerkung veranlaßte, dass ihre Verwandten in Ägypten zur Zeit der Pharaonen göttliche Verehrung genossen.
.
Die den Ibissen ähnlich sehenden Nimmersattstörche sind in Afrika südlich der Sahara und auf Madagaskar verbreitet. Sie nisten in Kolonien auf Bäumen, die sich oft in Dörfern oder Städten befinden. Der vormalige Kurator für Vögel im Tierpark Friedrichsfelde, Wolfgang Grummt, hat in dem von ihm mitherausgegebenen Buch „Zootierhaltung Vögel“ (2009) dem Nimmersatt ein Kapitel gewidmet.
Diese drei Schreitvogel-Arten eint, dass die Menschen sie mögen oder jedenfalls lange Zeit mochten, weswegen man sie fast als „Kulturfolger“ bezeichnen könnte. In ihrer Voliere hat man ihnen wie allen gefangen gehaltenen flugfähigen Vögeln ihr wichtigstes Element – die Luft – sehr eingeschränkt, obwohl sie so groß wie es finanziell möglich war gebaut wurde.
.

Waldrapp – Die Waldrapp ist ein etwa gänsegroßer Ibis. In Mitteleuropa wurden sie durch intensive Bejagung ausgerottet. Heute laufen verschiedene Wiederansiedelungsversuche, um den Waldrapp als Brutvogel in Europa wieder zu etablieren. In freier Wildbahn lebten laut Wikipedia im Jahr 2005 etwa 450 Vögel, in Gefangenschaft wurden etwa 2000 Vögel gehalten. Im Fernsehen lief unlängst eine Dokumentation, die zeigte, wie Waldrappforscher mit einem Leichtflugzeug eine Gruppe in Gefangenschaft aufgezogener junger Waldrappen zu ihren Artgenossen über die Alpen nach Italien führen, wo diese bereits ihr Winterquartier eingenommen hatten. Wikipedia schreibt: „Der Waldrapp ist ein geselliger Vogel, der sich zu Kolonien von mehreren Dutzend bis über hundert Individuen zusammenschließt. In Zoos gehaltene Einzelpaare kommen regelmäßig nicht zum Brüten. Brutstimmung entsteht erst in einer Kolonie.“
……………………………………………..
An dem heute gelehrten „Fach“ Ökologie kritisiert Reichholf: Fast alle zentralen Begriff der wissenschaftlichen Ökologie beziehen sich auf mehr oder weniger festgefügte Verhältnisse, die damit der Vorstellung Vorschub leisten, dass sie auch so sein müssen…Parallel dazu wurde die Ökologie immer stärker von einer fakten- und wissensbasierten Forschung zu einer Arbeit an Computermodellen reduziert.“ Damit zusammen hängt laut Reichholf eine unselige Anglifizierung dieses Faches und seiner Begriffe. Überhaupt kann er sich mehr und mehr für die deutschen Biologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begeistern: Was und wie die alles schon erforscht haben!
.
In jungen Jahren hat sich Reichholf selbst eine Weile an einer derartigen ökologischen Forschung beteiligt. Oft wird dieser Forschung „ein künstliches Korsett aus Zahlen und Meßgrößen übergestülpt. Denn alles, was sich in Formeln und Maßzahlen ausdrücken läßt, erweckt den Anschein von größerer Wissenschaftlichkeit…Aber wir jungen Ökologen störten uns nicht daran, denn die Modelle und die ihnen zugrunde liegende Mathematik werteten die Ökologie auf. Sie hatte damit Eingang gefunden in den gehobenen Kreis der quantitativen Naturwissenschaften.“ Sein dem am Wenigsten unterworfenes Buch – über Rabenvögel veröffentlichte Reichholf erst 2009, es löste heftige Kontroversen aus, schreibt er.
.
Wenn er jedoch ins Darwinisieren kommt, neigt auch Reichholf zu einem Betriebswirtschafts-Denken (richtiger: -Rechnen): „Im amazonischen Regenwald ist die Produktion hoch, die Produktivität aber (sehr) gering. Mit letzterem ist die Vermehrungsrate gemeint: der „erzeugte Überschuss“ (der Mehrwert). Der Nachwuchs ist für ihn „die eigentliche ‚Währung der Evolution‘.“ Ihre Anzahl ergibt zusammen mit der Zeit „die Leistung“. In Brasilien begeisterte ihn „verständlicherweise“ die Kolibribeobachtung sehr, weil diese Winzlinge als Vögel „sehr leistungsfähig waren“. Über die Fischjagd der Reiher, die aus Warten und Lauern besteht, bemerkt er: „Das kostet sie kaum mehr als die Aufrechterhaltung des Grundumsatzes an Energie.“ Während die Tauchvögel viel Energie bei der Jagd auf Fische einsetzen: „In der Bilanz muß sich dieser Einsatz lohnen, d.h. mehr bringen, als der Kraftaufwand zur Unterwasserjagd an Energie kostet.“ An anderer Stelle heißt es: „Das Angebot nimmt Einfluß auf die Nachfrage. Diese Gegebenheit ist uns aus der Wirtschaft vertraut. In der Natur verhält es sich nicht anders.“ Das klingt fast nach der Einschätzung der Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard, “dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch funktioniert“. Oder anders gesagt – mit den Worten des englischen Darwinpropagandisten Richard Dawkins: „Die Wirtschaftswissenschaft gewinnt in der Evolutionsforschung immer mehr an Bedeutung.“ – So dass die ganze Evolution jetzt schon betriebswirtschaftlich operiert.
.
Der Erforscher des Gabentauschs, Marcel Mauss, schrieb 1923/24 in seiner Studie „Die Gabe“: „Erst unsere Gesellschaften haben, vor relativ kurzer Zeit, den Menschen zu einem ‚ökonomischen Tier‘ gemacht…Es ist noch nicht lange her, seit er eine Maschine geworden ist – und gar eine Rechenmaschine.“ Bei den Biologen hat das dazu geführt, dass sie sich in Wirtschaftsforscher verwandelten – und diese umgekehrt in Biologen. Das war bereits im Darwinschen Utilitarismus angelegt.
.
Bei dem israelischen Ornithologen Amotz Zahavi ist daraus ein ganzer neoliberaler Gesellschaftsroman geworden. Er hat Lärmdrosseln („Arabian Babbler“) erforscht. Bei ihnen bekommen Paare von unverpaarten Artgenossen „Hilfe beim Nestbau und Füttern der Jungen“. Diesen schon fast klassischen Fall von Kooperation – neuerdings auch gerne Altruismus genannt – deutet er in „ein selbstsüchtiges Verhalten“ um, indem er es mit Betriebswirtschafts-Begriffen durchdekliniert: „Die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren…Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen“. Es ist von „Werbung“, „Qualität des Investors“ und „Motivation“ die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen der Vögel quasi mikronietzscheanisch auf ein egoistisches Gen zurück, indem die „individuelle Selektion“ bei den Lärmdrosseln eben „Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen“ begünstige, der berühmte Darwinsche „Selektionsmechanismus“ aber ansonsten erhalten bleibe.
.

Kuhreiher in der Voliere des Reiherhauses. Kuhreiher gibt es fast überall auf der Welt. Hediger sah eine ganze Wolke von Kuhreihern im Nationalpark von Belgisch-Kongo, sie folgten einer Büffelherde. Weil die Kuhreiher sich am Liebsten auf oder in der Nähe von großen Pflanzenfressern aufhalten, überlegte sich Heini Hediger 1965 vor dem Bau des Afrika-Hauses im Zürcher Zoo, wie er diese „Symbiose“ dort einrichten könne. Die Tiere mußten ja täglich in ihr Freigehege und dort wären die Vögel (neben den Kuhreihern auch noch die Madenhacker) vielleicht weggeflogen – z.B. auf eine Alm zu einer Schweizer Kuhherde. Und wenn er ihre Flügel beschnitten hätte, würden sie vielleicht nicht mehr auf den Rücken der großen Tiere gelangen. Mit ovalen Türen – u.a. für „sein“ Breitmaul-Nashorn – gelang es Hediger, dass die Kuhreiher im Gebäude blieben, wo sie frei herumflogen, wenn ihr „Reittier“ nach draußen ging. Hediger hält diese Lösung für eine seiner besten Ideen. Dem Widerspruch zwischen „Freiheit und Gefangenschaft“ begegnet er als Zoodirektor, der er schon als Kind werden wollte, dass er ihn für „längst überholt“ hält, denn „heutzutage (1990) sind alle Tiere einem allumfassenden, menschlichen Management unterworfen, auch jene, welche man herkömmlicherweise als freilebend bezeichnet.“
Im Yellowstone-Nationalpark hat man z.B. allen Wölfe einen Mikrochip unter die Haut transplantiert, in anderen Nationalparks in Afrika z.B. werden die „überzähligen Tiere“ regelmäßig abgeschossen, auch in den deutschen Nationalparks haben die Angler und Jäger sozusagen freien Eintritt, nur normale Bürger müssen auf den Wegen bleiben und Wissenschaftler brauchen eine Sondergenehmigung zum Forschen. Im Grunde geschieht dort das gleiche wie in den privaten Revieren der hiesigen Jäger.
—————————————–
Die Leipziger Primatenforscher attestieren ihren gefangenen Schimpansen nur eine „schwache“ Kooperationsbereitschaft und wenig Mitgefühl. Anders bei den wilden Schimpansen, die sie auf ihrer Station im Tai-Nationalpark an der Elfenbeinküste beobachteten, dort registrierten sie dagegen wiederholt, dass Schimpansinnen sich mit männlichen Artgenossen paarten, wenn diese ihre Beute mit ihnen teilten. Der „Spiegel“ erklärte die Weibchen daraufhin flugs zu listigen „Schnäppchenjägern“, die dabei nicht einmal vor „käuflicher Liebe“ zurückschrecken. Die Hamburger Witzbolde machten dabei flugs aus „Dem Handeln der Tiere“, wie die Berliner Human-Animal-Study-Gruppe „Chimaira“ ihren neuen Aufsatzband nennt, einen „Handel der Tiere“.
.
Noch weiter ging die FAZ: „Lesen Einzeller Ökonomie-Bücher? Vermutlich nicht, aber sie verhalten sich so, als würden sie es tun,“ schrieb sie – nicht etwa auf ihrer Naturwirtschaftsseite, sondern auf ihrer Wirtschaftsseite, und referierte sodann das Ergebnis einer Forschung des US-Biologen David Rapport. „Das blaue Trompetentierchen verhält sich genauso, wie es die sogenannte Haushaltstheorie der Ökonomen beschreibt: Der Einzeller [ohne Gehirn] zeigt klare Präferenzen bezüglich seines Futters und rationales Verhalten bei der Wahl seines Essens und der damit verbundenen Anstrengungen.“ Andere US-Forscher bewiesen mit Ratten und Tauben laut FAZ das „Budgetrisiko“ in der „Haushaltstheorie“, wobei sie sogar ein Geld-Äquivalent einführten: „Macht man ein Getränk teurer (indem das Tier den entsprechenden Knopf häufiger drücken muß), so sinkt bei den Probanden der Konsum des betreffenden Getränks [Root Beer oder einen „Tom Collins“-Cocktail] zugunsten des anderen, nun relativ billigeren Getränks. Gleichzeitig erhöhte man aber auch ihr Einkommen (wie oft die Tiere den Knopf drücken dürfen), so dass sie sich auch das teure leisten könnten, sie bleiben jedoch bei dem billigeren.“
.

Brillenpinguine – „Wer würde schon an Pinguine glauben, wenn er sie nicht gesehen hätte? Dieses Zitat von Conor O’Brien hat die Verhaltensforscherin und Reiseschriftstellerin Carmen Rohrbach in ihrem Buch „Patagonien“ (2008) dem Kapitel „Der Besucher aus der Kälte“ vorangestellt. Der Tierpark hält in zwei Gehegen Brillenpinguine, die von der afrikanischen Westküste stammen. Etwa 20.000 Brutpaare leben noch in freier Wildbahn. Dies bedeutet einen Rückgang von 60,5 Prozent gegenüber dem Bestand von 1979 (69.000) und einem Rückgang von 90 Prozent gegenüber 1956 (141.000 Brutpaare). Ihr Bestand ist vor allem wegen der Fischerei anhaltend abnehmend, die Brillenpinguine gelten als „gefährdete Art“. „Das Wasser ist die wahre Heimat eines Pinguins,“ schreibt die Weltreisende Carmen Rohrbach in ihrem Buch „Patagonien“ (2008).
Dort hielt sich ein Königspinguin in der Nähe ihres Zeltes auf, als sie auf einer Kiesbank des Rio Lainez kampierte. Die Königspinguine brüten nicht wie die Kaiserpinguine auf dem antarktischen Festland, sondern auf vorgelagerten Inseln, „wo es aber auch ganz schön eisig ist“. Ihr Königspinguin blieb zwei Tage bei ihrem Zelt. Als sie weiter wandern wollte und ihren Rucksack schulterte, „stieß er einen seltsamen Ton aus, der wie ein krächzendes Trompeten klang und ging, als habe er auch einen Entschluß gefaßt, an die Wasserkante, legte sich bäuchlings vom rückströmenden Wasser mitziehen und tauchte ab.“ In dem Buch von Reiner Kaltenegger über die Tierpfleger im Westberliner Zoologischen Garten: „Arbeitsplatz Zoo“ (1990) erzählt der Reviertierpfleger Herr Petersen, der für Robben, Flußpferde und Pinguine zuständig ist, „dass die Haltung von Königspinguinen ein Problem für sich sei. „Da in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet die Luft sehr sauber ist, verfügt ihr Organismus über keinerlei Abwehrmechanismen gegen unseren Großstadtmief.“ Sie werden einzeln mit der Hand von Petersen gefüttert, dabei muß er stehen bleiben und sie gemäß ihrer Rangfolge bedienen. Die Brillenpinguine seien jedoch nicht so kompliziert. Der Basler City-Zoo hält die Königspinguine zusammen mit Eselspinguinen in seinem „Vivarium“, also in einem geschlossenen Raum, jedenfalls als ich kürzlich dort war. Den Brillenpinguinen stehen dafür in Basel zwei Wasserbecken in einem Freigehege zur Verfügung.
Im Frankfurter Zoo sah ich kürzlich, dass die Pinguine, die dort ebenfalls in einem Haus leben, von zwei jungen Pflegerinnen gefüttert werden, die dabei großen Spaß hatten. Durch eine Scheibe kann man dort sehen, dass das Element der Pinguine das Wasser ist – sie können darin quasi fliegen. Carmen Rohrbach schreibt: „Königspinguine werden 13 Monate lang von ihren Eltern gefüttert, erst dann wagen sie den Sprung ins Wasser. Ab da leben sie Tag und Nacht im Meer, wo sie auch schlafen und sich von Fischen, Tintenfischen und anderen Meerestieren ernähren.“ Das berücksichtigt nicht ihre Freßfeinde – Orkas und Robben z.B., deren Nahen die Pinguine zwingt, eilig an Land zu springen und dort u.U. so lange zu warten, bis die Gefahr vorüber ist. In dem einen Gehege der Brillenpinguine im Tierpark lebt noch ein wilder Fischreiher und im anderen drei flügelbeschnittene Basstölpel. Innerhalb der Familie der Tölpel sind die gänsegroßen Basstölpel die am weitesten im Norden brütende Art. Seit 1991 ist der Basstölpel laut Wikipedia auch Brutvogel auf Helgoland.
.

Brillenpinguine

Basstölpel
—————————————————-
Konrad Lorenz begann seine Verhaltensforschung mit einer Dohle: „Ich glaube nicht, dass ich von einem anderen Tier so viel und so Wesentliches gelernt habe wie im Sommer 1926 von Tschok“, schrieb er. Im Jahr darauf zog Lorenz schon 14 junge Dohlen auf. Er nahm sie nach dem Ausschlüpfen zu sich und zog sie groß. Weil sie auf ihn geprägt waren, konnte er sie danach frei fliegen lassen. Sie kamen immer wieder zu ihm zurück – und ließen vieles mit sich machen. Er durfte sie jedoch nicht packen, um sie z.B. zu beringen – damit war er sofort ein „Dohlenfresser“ und wurde angegriffen. Ähnliches berichten auch andere Rabenvogelforscher. Sie müssen sich maskieren, wenn sie z.B. Jungvögel im Nest beringen wollen, damit sie unmaskiert weiter als Rabenfreunde von den Vögeln akzeptiert werden. Reichholf machte sich durch das unmaskierte Beringen von Schwänen in Bayern ebenfalls bei diesen Vögeln verhasst, so wie an der Nordsee auch die Nationalparkangestellten bei den Seeschwalben, die sie beringen.
.
Seine Beobachtungen der Flugkünste von Dohlen, aber auch der der anderen Rabenarten, die in Mitteleuropa leben – Kolkraben, Nebel- und Rabenkrähen, Elstern, Eichelhäher und Alpenkrähen – faßte Konrad Lorenz 1933 zu einer ersten größeren Veröffentlichung zusammen: „Der Vogelflug“ betitelt. Zwei Jahre später schrieb er – in: „Der Kumpan in der Umwelt des Vogels“ über die Prägung – u.a. von Dohlen: Sie können „in ihren sexuellen Reaktionen auf den Menschen und in denen des Zusammenfliegens in einer Schar von Saarkrähen geprägt sein. Bei der Dohle liegt die Prägbarkeit sexueller Reaktionen in einer Zeit, da der Jungvogel noch unbefiedert im Nest sitzt. Die Prägbarkeit des Nachfolgens liegt knapp vor dem Flüggewerden des Vogels, und ihr Effekt wird erst nach Tagen sichtbar, während derjenige der sexuellen Prägung erst nach zwei Jahren offenbar wird.“
.
Kurz vor dem Polenfeldzug beantragte Konrad Lorenz bei der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft eine Projektförderung im Rahmen seiner Gänseforschung. Empfehlungsschreiben von Kollegen bezeugten ihm, dass er arischer Abstammung sei, dass die „politische Gesinnung von Herrn Dr. Lorenz in jeder Hinsicht einwandfrei ist“, dass er „aus seiner Zustimmung zum Nationalsozialismus niemals einen Hehl gemacht“ habe und dass seine biologische Forschung den Ansichten im Deutschen Reich gelegen käme. Lorenz bekam das Geld und studierte daraufhin, wie sich das Instinktverhalten von Wildgänsen ändert, wenn sie zu Haustieren gezüchtet oder mit Hausgänsen gekreuzt werden. 1940 veröffentlichte er darüber in einer Psychologie-Zeitschrift den Aufsatz: „Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens“.
.
Seit Lorenz 1973 den Nobelpreis bekam, wird ihm vor allem dieser Text vorgeworfen, zuletzt in der Aufsatzsammlung „Vom Übertier“ (2006) der Kulturwissenschaftler Stefan Rieger und Benjamin Bühler. Sie wiesen dem Gänseforscher darin nationalsozialistische Forschungsziele nach – insofern ihm die „Tierzucht zum Modell für die Menschenzucht“ wurde. Bei Vergleichen zwischen Wild- und Hausgänsen hatte er fatale „Verfallserscheinungen“ bei den domestizierten Rassen festgestellt – und daraus u.a. geschlußfolgert: Auch beim Menschen sei es durch Domestikation „zur Vernichtung oder mindestens Gefährdung von instinktmäßig programmierten Verhaltensweisen wie Mutterliebe oder selbstlosem Einsatz für Familie und Sozietät gekommen“, woraus letztlich „Sozial-Parasitismus“ entstehe. Sein Lehrer, der auf Anatiden (Entenvögel) spezialisierte Oskar Heinroth, unterstützte den nationalsozialistischen Durchhaltewillen 1941, zu Beginn des „Rußlandfeldzugs“, mit einem Aufsatz, dem er den Titel „Aufopferung und Eigennutz im Tierreich“ gab. Das Thema lag sozusagen in der Luft.
.

Andenkarakara – „Im dürren Geäst eines abgestorbenen Baumes hocken zwei Geierfalken. Die „caracara“ sind etwa so groß wie Bussarde, wirken aber imposanter mit ihren hohen Beinen, dem schwarzen Schopf, den nach hinten abstehenden Federn und der puterroten Färbung im nackten Gesicht. „Krrok“ machen sie sich mit gutturalem Krächzen bemerkbar, als ich unter ihrem Ansatz vorbeigehe.“ (Carmen Rohrbach, „Patagonien“ 2008)
.

Falklandkarakara. So einen sah Carmen Rohrbach wahrscheinlich im Baum hocken. Den Andenkarakara kann man nicht einmal auf dem Photo oben richtig erkennen.
————————————-
Heinroth und seinem Schüler Lorenz ging es um den Nachweis, dass durch die Verhaustierung die Instinkte „verludern“. Und dass die Urinstinkte das Gesunde sind. In diesem Zusammenhang prägten sie u.a. den Begriff „Triumphgeschrei“ – den Gänse ausstoßen wenn sie einen in ihr Revier eindringenden Rivalen vertrieben haben. All das paßte den Nazis in ihr kriegerisches Weltbild – wenn man dem Philosophen Michel Foucault folgt: „Die Freiheit, die die germanischen Krieger genießen, ist wesentlich eine egoistische Freiheit, eine der Gier, der Lust auf Schlachten, der Lust auf Eroberung und Raubzüge…Sie ist alles andere als eine Freiheit des Respekts, sie ist eine Freiheit der Wildheit…Und so beginnt dieses berühmte große Porträt vom Barbaren, wie man es bis zum Ende des 19.Jahrhunderts und natürlich bei Nietzsche finden wird – den die Nationalsozialisten dann zu ihrem biopolitischen Vordenker erklären.“ Wobei ihre „Transformation aus der Absicht der Befreiung die Sorge um [rassische] Reinheit“ (saubere Instinkte) werden ließ.
.
Konrad Lorenz sagte es 1938 so: „Ich war als Deutschdenkender und Naturwissenschaftler selbstverständlich immer Nationalsozialist.“ Später sprach er von der „Verhausschweinung des Menschen“ als Folge des Wegfalls von natürlichen Selektionsmechanismen in den zivilisierten Gesellschaften. Als man ihn nach Entgegennahme des Nobelpreises 1973 drängte, die Auszeichnung wegen seiner Nazi-Vergangenheit zurückzugeben, gab er nur öffentlich zu, dem Nationalsozialismus positive Seiten abgewonnen zu haben. (5)
.
Der Schriftsteller Marcel Beyer veröffentlichte 2009 einen Roman mit dem Titel „Kaltenburg“, in dem es um die „Tierkenner“ Joseph Beuys, Heinz Sielmann und Heinrich Dathe geht – vor allem jedoch um Konrad Lorenz, der im Roman „Kaltenburg“ heißt. „Um niemanden, das heißt: um keines seiner anderen Tiere habe ich Kaltenburg jemals so besorgt erlebt wie um die Dohlen,“ heißt es an einer Stelle. An anderer Stelle schreibt Beyer: Kaltenburg habe sich während des Krieges, als er auf den „Kant-Lehrstuhl“ in Königsberg berufen wurde, für den späteren Zoodirektor Heinrich Dathe („Eberhard Matzke“ im Roman), verwendet. Dieser wäre KZ-Bewacher gewesen und hätte es nicht mehr ausgehalten, stattdessen durfte er dann Vögel beobachten – außerhalb des Lagers.
.
Die SS beschäftigte in Auschwitz tatsächlich einen Ornithologen. Der Schriftsteller Arno Surminski veröffentlichte darüber 2008 einen Roman: „Die Vogelwelt von Auschwitz“. Sein Ornithologe heißt darin Grote, er hat einen polnischen Assistenten, den KZ-Häftling Marek. Sie beobachten u.a. auch Gänse. In Birkenau sehen sie einen Kampf zwischen Krähen und Graugänsen, erstere waren in der Überzahl, aber letztere konnten sich halten, indem sie eine „Wagenburg“ bildeten. Als Marek Grote bittet, eine Gans abzuschießen – nicht um sie, wie die anderen Vögel zuvor, zu präparieren, sondern um sie zu essen, antwortet dieser: „Zugvögel dürfen nicht geschossen werden“. Wenig später erschießt ein Wachmann aus Versehen, wie er sagt, doch eine Gans. Grote erwirkt daraufhin „beim Kommandanten eine Verschärfung des Verbots, auf Vögel zu schießen.“ Nach dem Krieg wird Grote – so wie auch der wirkliche SS-Ornithologe – in Polen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Proteste von Ornithologen aus England und den Niederlanden bewirkten jedoch, dass seine Haftstrafe auf drei Jahre herabgesetzt wurde.
.
Der Lorenzschen Theorie von der Degeneration durch Domestikation konnte in den Zwanziger- und Dreißigerjahren u.a. auch der ins Exil vertriebene jüdische Philosoph Theodor Lessing noch etwas abgewinnen. In seinen „Tier“-Aufsätzen für das Prager Tageblatt kam er immer wieder darauf zu sprechen, dass die Züchtung die Tiere ihrem wilden Leben in Freiheit entfremdet habe – zum Schlechteren hin. So ist ihm z.B. der schon von den Indianern gezähmte Masttruthahn ein „Zerbrochener“; der „Hund ein durch jahrtausendelange Zucht geknebelter und sozusagen in sich hineingeprügelter Wolf“ und das Pferd – in seinem „Irrsinn“ – wird ihm, verglichen mit den noch ursprünglichen Zebras – schließlich zu einem Symbol jenes Weltprozesses, den er den „Untergang der Erde am Geist“ nennt. Noch der französische Philosoph Gilles Deleuze spielte 1989 die „ödipalisierten“ Haus- und Familientiere gegen die in Meuten auftretenden wilden Tiere aus. Der Berliner Biologe Cord Riechelmann merkte dazu kürzlich zustimmend an: Für Deleuze seien „diese Tiere keine Tiere mehr, sondern schon in die Menschenwelt eingepflanzt und deshalb komplett verblödet.“ Feministische „Tierkenner“ wie Donna Haraway und Katharina Rutschky würden das genau andersherum sehen: dass ihre Zivilisierung ihren Möglichkeitsradius erweitert. In den USA fand bereits ein internationaler Kongreß der Verhaltensforscher statt, auf dem das Tier als „Sozialpartner“ erörtert – und damit auch über die Zukunft des Zoos diskutiert wurde.
.

Seekuh – „Bisher hat es in der Haltung von Karibik-Nagelmanatis (Trichechus manatus manatus) im Berliner Tierpark, die seit 1994 läuft, drei Tot- bzw. Frühgeburten gegeben. Alle drei brachte das Seekuh-Weibchen ‚Lisa vom Schmausenbuck‘ zur Welt (1986 im Tiergarten Nürnberg geboren). 2001 hatte ‚Lisa‘ erneut eine Geburt. Diesmal waren es Zwillinge, eines der Kälber wurde tot geboren, das zweite lebte nur wenige Tage,“ heißt es in einem älteren Tierparkführer. Der Revierpfleger muß täglich einen Taucheranzug anziehen und die Seekühe streicheln, das erhöht ihr Wohlbefinden, erklärte mir eine Besucherin des Tierparks, die sich auskannte.
——————————————-
Der Wissenshistoriker Michel Foucault widmete sich Ende der Siebzigerjahre in seinen Vorlesungen den Herrschaftsformen, der „Gouvernementalität“. In diesem Rahmen kam er vom „Rassenkampf“ gegen Ende des 19. Jhds. auf den damals neuen „internen Rassismus“ und eine politökonomische „Biopolitik“ zu sprechen – die gegen die Anormalen und „Degenerierten“ gerichtet war. Der „moderne Rassismus“ besteht für ihn darin, dass man einen Unterschied zu machen begann, „zwischen dem, was leben, und dem, was sterben muß.“ In Westdeutschland konnte noch in den Fünfzigerjahren ein Mediziner wie Viktor von Weizsäcker, der 1940 die „Gestaltkreis“-Theorie veröffentlicht hatte und die Psychosomatik begründete („Um Lebendes zu erforschen, muss man sich am Leben beteiligen.“), das Recht der Mediziner – sowohl auf „Euthanasie“ als auch auf Menschenexperimente – verteidigen. Dass mit den Nazis und ihrer Ersetzung des Klassenkampfs durch den Rassenkrieg die Biologie quasi Staatswissenschaft wurde, haben die deutschen Mediziner, Genetiker, Psychiater und Verhaltensforscher – vorwiegend darwinistischer Ausrichtung – erst einmal begrüßt.
.
Dies galt jedoch auch – bis auf die Forscher, die emigrierten – für viele antidarwinistische „Ganzheitler“ unter den Naturwissenschaftlern und -philosophen, wie die US-Wissenschaftshistorikerin Anne Harrington in ihrer „Geschichte biologisch-psychologischer Ganzheitslehren: Vom Kaiserreich bis zur New-Age-Bewegung. ‚Die Suche nach Ganzheit'“ (2002) herausarbeitete, worin sie sich vor allem auf Jakob von Uexküll bezog. Sie erwähnt aber auch: „Die wenigen praktischen Anwendungsmöglichkeiten der ganzheitlichen Psychologie und Medizin im Dritten Reich unterlagen schließlich der militaristischen darwinistischen Ethik und den Technologien des Rassenmanagements, die die Technokraten anzubieten hatten (Rassentrennung, Sterilisation, Kastration und schließlich die Methoden der massenhaften ,Euthanasie‘).“ Jakob von Uexküll lehnte den „Rassegedanken“ zusammen mit seiner Abkehr vom „Darwinismus“ ab. So meinte er z.B. um 1900 in einem Aufsatz über die Errichtung einer Forschungsstation in Daressalaam: „An dem liebenswürdig sorglosen Character der Suhaeli und Massai wird wohl jeder seine Freude haben, der nicht das Vorurtheil der ungebildeten Classen und Nathionen theilt, wonach die weiße Haut moralische Vorzüge bedingen soll.“ Und noch weitergehender: Zwischen niedriger oder höher entwickelten Lebewesen zu unterscheiden ist falsch. Denn, so sein berühmtestes Beispiel – die Zecke: Sie reagiere von den Hunderten von Reizen, die Säugetiere geben, nur auf drei: Buttersäure, mechanischer Reiz der Hautoberfläche und Wärme. Die Umwelt der Zecke bestehe also aus drei Merkmalen und drei Wirkmalen und sie sei darin perfekt, ebenso wie in anderer Hinsicht die übrigen Lebewesen.
.
Um 1906 kam Jakob von Uexküll zur Zoologischen Station von Anton Dohrn am Golf von Neapel, wo er physiologische Studien an Seeigeln unternahm. Anton Dohrn (geb. 1840) studierte Zoologie bei Ernst Haeckel in Jena. 1870 errichtete er mit Spenden eine Meeresforschungsstation in Neapel, auf der Wissenschaftler aus aller Welt Arbeitsplätze mieten konnten und können, dazu richtete er noch ein öffentliches Aquarium ein. Seine Station ist inzwischen berühmt und Vorbild für zig weitere Forschungsstationen an so ziemlich allen Küsten geworden. Gegenwärtig sind in der Einrichtung, die als nationales Forschungsinstitut vom italienischen Forschungsministerium finanziert wird, rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Der erste Bundespräsident Theodor Heuss veröffentlichte 1940 eine sehr schöne Biographie über „Anton Dohrn in Neapel“. Jakob von Uexküll starb 1944 auf Capri.
.

Riesenseeadler – Der Riesenseeadler lebt an Flüssen und Küsten des pazifiknahen Russland. Je nach geographischer Lage ist er ein Standvogel oder ein Zugvogel, seine wichtigsten Überwinterungsgebiete liegen in Japan. Die einstigen Brutpopulationen in Südkorea gelten als erloschen, für Nordkorea wird trotz fehlender Daten das Gleiche angenommen. Ihr Gesamtbestand umfasst etwa 5000 Exemplare und nimmt weiter ab; daher wird der Riesenseeadler als gefährdete Art eingestuft.
Die Weibchen erreichen laut Wikipedia im Schnitt 11% mehr Körpergröße und 43% mehr Gewicht als Männchen. Die Körperlänge beträgt 85 bis 105 Zentimeter, die Flügelspannweite1,95 bis 2,80 Meter. Der Riesenseeadler fliegt vergleichsweise langsam mit starken, flachen Flügelschlägen und durchsetzt von kurzen Gleitphasen. Er gleitet mit nahezu geraden Flügeln und ausgebreiteten Schwung- und Steuerfedern. Seine hauptsächliche Beute sind Fische und Wasservögel.

Seeadler – „Es war im Winter in der Elbniederung bei Dessau. Da – mit mächtigen Schwingeschlägen kommt ein riesiger schwarzbrauner Vogel uns entgegen mit leuchtend gelbem Schnabel – ein Seeadler. Er hat uns noch nicht erblickt. Sein ziel ist die einzelne Ente, die ängstlich plätschernd vor ihm im mageren Pflanzenwuchs des Ufersaumes verschwinden will. Er greift erneut an und will sich auf sie werfen, da erblickt er uns, prallt zurück und schreit sein heiseres, so urig klingendes ‚krau krau krau‘ uns ärgerlich entgegen, erhebt sich jäh und rudert auf den Wald davon. Zuschauer bei einer Greifvogeljagd zu sein, gehört zweifellos zu den spannendsten Erlebnissen eines Feldbeobachters.“ (Heinrich Dathe, „Erlebnisse mit Zootieren“, Berliner Tierpark-Buch Nr. 22, 1978). Heute soll die Hälfte der gar nicht mehr so kleinen Seeadler-Population in Mecklenburg-Vorpommern laut Josef Reichholf auf Hochspannungsmasten nisten. Heinrich Dathe meinte in den Sechzigerjahren, dass die Nester der auf diesen Masten brütenden Seeadler und Störche in der DDR so abgesichert werden, dass die Vögel die Stromleitungen nicht mehr mit ihren Flügeln berühren können.
.

Weißkopfseeadler. Der US-Justizminister Robert Kennedy schenkte 1962 dem Westberliner Zoo einen Weißkopfseeadler, „als politische Ikone der USA,“ wie Roscher und Wöbse schreiben. Diese Art wäre in den Sechzigerjahren aufgrund des massiven Einsatzes von DDT in Amerika beinahe ausgestorben. Das Weißkopfseeadler-Paar im Tierpark bekam bereits Nachwuchs, es wird derzeit für eine geplante „Flugshow“ trainiert. Dies ist möglicherweise eine Form von Dressur, wie sie Heini Hediger vorschwebte – um der Verblödung von Zootieren entgegenzuwirken.
—————————————————
Während amerikanische Faschismusforscher dazu neigen, deutsche Biologen (wie den Darwinpropagandisten Ernst Haeckel, Gründer des Monistenbundes, der sich 1904 in Rom zum „Gegenpapst“ ausrufen ließ, und den Gründer der Berliner „Volksbühne“ Wilhelm Bölsche, geb. 1861, Autor des Biologiebestsellers „Das Liebesleben in der Natur“ – 1898, sowie den antidarwinistischen „Umwelt“-Forscher Jakob von Uexküll) vor allem als „abscheuliche Vordenker“ der Nazis abzuqualifizieren, ist die deutsche Biologiegeschichtsschreibung anscheinend eher daran interessiert, sie hochzuqualifizieren, indem ihr politisches Denken als nicht (mehr!) zur aktuell gültigen Biologie gehörend, quasi als ihre Privatsache, einfach unerwähnt bleibt. Das Fach bleibt damit durchgängig „im Wahren“, wie Foucault eine solche Diskursgeschichte genannt hat. Dies gilt für die Fachgeschichte der DDR-Biologen noch immer, sie sind u.a. stolz darauf, dass der Wissenschaftsorganisator Hans Stubbe (geb. 1902) ihnen als einflußreichster Genetiker der DDR die antigenetische „proletarische Biologie“ des obersten sowjetischen Agronomen Trofim Lyssenko als eine „Irrlehre“ vom Leib hielt. Dass er für die Nazis zuvor ein, wenn nicht der wichtigste „Züchtungsforscher“ war, ließ auch Christa Wolf in ihrem Stubbe-Porträt für die Zeitschrift „Sinn und Form“ unerwähnt.
.
Ähnlich verfuhr davor der sowjetische Schriftsteller Daniil Granin in seiner verlogenen Biographie des sowjetischen Genetikers Nikolai Timofejew-Ressowski: „Sie nannten ihn Ur“ (1988). Der Drosophila-Mutationsforscher stieg ab 1925 in Berlin-Buch zum wichtigsten Nazi-Biologen auf, seine „Ergebnisse und Perspektiven“ veröffentlichte er u.a. in „Der Erbarzt“. Selbst in der umfangreichen „Geschichte der Biologie“ – herausgegeben von der Naturwissenschaftshistorikerin der Humboldt-Universität Ilse Jahn, an deren letzte Auflage sich auch Wissenshistoriker aus dem Westen beteiligten – war man anscheinend daran interessiert, all diese genannten Biologen zu requalifizieren, indem ihr politisches Denken als nicht (mehr!) zu den Fortschritten des Fachs gehörend einfach unerwähnt blieb. Privatisiert wurde inzwischen auch noch etwas anderes: nämlich die (staatlichen) Eugenik – Euthanasie und Menschenexperimente. Indem jeder nun selbst entscheiden kann: Soll er bzw. sie vielleicht ein „unwertes Leben“ (z.B. mit einem „Gendeffekt“) im Frühstadium abtreiben (lassen)? Oder soll er oder sie sich z.B. auf medizinischem Wege selbst „wertvoller“ – schöner, intelligenter etc. – machen – notfalls mit neuen Organen von Armen aus der Zweiten und Dritten Welt „gespendet“? In Deutschland ist man aus naheliegenden Gründen bei dieser Eugenik auf privater Basis (noch) etwas zurückhaltender als z.B. in den USA.
.

Kamele, im Hintergrund die Flamingolagune. Eines der Kamele ging einmal in den Begrenzungsgraben, blieb aber darin stehen: Es wollte nur die Blätter am Strauch auf der Besucherseite des Grabens probieren. Im „Handbuch Zoo“ (2009) befindet sich ein Photo davon. Der englische Zoogründer Gerald Durrell berichtet in „Die Tiere in meiner Arche“ (1976), von einem Tiergarten, bei dem das neu errichtete Freigehege für zweihöckrige Kamele lediglich eine 45 Zentimeter hohe Stufe hatte, um die Tiere daran zu hindern, sich unter die Besucher zu mischen und sie wohlmöglich „zu treten und zu beißen“. Ihm wurde versichert, „dass diese Stufe völlig ausreichend wäre, da Kamele nicht gern Stufen hinuntersteigen. Aber ob die Kamele sich dieser Abneigung erinnerten, als sie schließlich in ihr neues Gehege einquartiert wurden…“ Leider erwähnt Durrell nicht, in welchem Zoo das war. In den Ländern, wo die Menschen schon seit Jahrtausenden quasi mit dem Kamel leben, dürfte eine solche Einschätzung gut begründet sein. Ähnlich verhält es sich wahrscheinlich auch mit asiatischen Elefanten, die mit den Familien ihrer Mahouts zusammenleben, -arbeiten, -feiern, -trauern usw..In Burma sah ich, dass die in den Teakholzwäldern arbeitenden Elefanten pünktlich um 15 Uhr Feierabend hatten – ausgeschirrt wurden und im Wald verschwanden. Am nächsten Morgen standen sie wieder auf der Matte.

Flamingos, im Hintergrund das Lamagehege.

Flamingos im Winterquartier. „Der Zoo in Westberlin züchtete in Deutschland die ersten Flamingos. 1964 wurde im Tierpark die Flamingolagune am Rande der Kamelwiesen fertiggestellt.“ Die Vögel begannen dort sofort zu balzen. Im Jahr darauf bauten sie bereits Schlammkegelnester. Seit 1967 zogen sie regelmäßig Junge auf, außerdem fand sich ein Mischpaar, ein Kubaflamingomann mit einem Rosaflamingoweibchen, zusammen. Flamingos sind äußerst gesellige Tiere. Besonders beeindruckend sind ihre großen Schwarmflüge, im Tierpark hat man ihnen die Flügel beschnitten. Deswegen hatte der Fuchs in den letzten Jahren auch leichtes Spiel bei ihnen. Seitdem er im Sommer 8 Flamingos riß, läßt man die Kolonie kaum noch aus ihrem Winterquartier ins Freie.“
Flamingos sind wenig kälteempfindlich, aber das Raus- und Reintreiben ist vielleicht zu aufwändig. Dabei müßte es eigentlich ganz einfach sein, der Direktor des Tierparks, Heinrich Dathe, schreibt: „Flamingos führen alle Handlungen im Kollektiv aus.“ Das Kollektiv der Werktätigen des Tierparks wird derzeit jedoch ständig demoralisiert. „Die Tierpfleger der Zoos gehen ansonsten davon aus, wer mit Tieren arbeitet, tut sein Bestes, um die materiellen wie auch die immateriellen Bedürfnisse verschiedener Tiere zu verstehen, und zwar aus dem Wunsch heraus, die Langeweile und Sinnlosigkeit der Gefangenschaft etwas zu lindern,“ meint Eugene Linden in seinem Buch „Tierisch klug“ (2001), das auf Berichte von Zootierpflegern basiert. Im Zoo von San Francisco wurden die Flamingos allabendlich eingesperrt, um nicht von den Waschbären gerissen zu werden. Im Zoo von San Antonio wurden sie ganztägig in einer „gedeckten Voliere“ gehalten, nachdem mehrere von Hagelfällen erschlagen worden waren. „Brutstimmung“ kam jedoch laut Heini Hediger erst auf, als sie wieder an ihren „flachufrigen Teich“ gelassen wurden. 1952 schlüpfte dort das erste Flamingo-Küken, es lebte jedoch nur einen Monat.
Das erste überhaupt wurde 1937 auf einem Pferderennplatz in Miami geboren. Bis dahin gab man in den Zoos „der Flügelamputation die Schuld“, mit der die Flamingo-Männchen nicht mehr die -Weibchen besteigen können. Hediger bestreitet das, weil dies bei flügelamputierten Störchen und Kranichen kein Hinderungsgrund ist. Zudem waren auch die sich in Gefangenschaft vermehrenden Flamingos in Miami flügelamputiert. Ihre dort geborenen Jungen ließ man jedoch frei fliegen, sie kehrten immer wieder zu ihrer Kolonie zurück. Ähnlich verfuhr bereits der Ornithologe Oskar Heinroth bei der Wiederansiedlung von Höckerschwänen auf den Seen zwischen Berlin und Potsdam nach dem Ersten Weltkrieg, die man alle gegessen hatte. Den Flamingos drohte schon zu Zeiten der Römer die Ausrottung, nachdem die Oberschicht des Reiches die fleischigen Flamingozungen als Delikatesse entdeckt hatte.
Heute geht man etwas anders mit ihnen um: „In einem der Naturreservate Kubas gibt es eine Zuchtstation, wo Flamingos gezüchtet werden“, erklärte die Zootechnikerin des Zoos von Almaty (Kasachstan) der Presse, „dort hat man sich bereit erklärt, speziell für unseren Zoo eine neue Gruppe aufzuziehen. Doch die ausländischen Kollegen stellten Bedingungen: Für die 20 ‚paradiesischen‘ Vögel sollten wie paradiesische Bedingungen schaffen. Früher gab es hier nur drei Rosaflamingos, die keinen Nachwuchs bekommen konnten, weil sie so wenige waren, außerdem ließen die Haltungsbedingungen Besseres zu wünschen übrig.“
Alle in Gefangenschaft gehaltenen Flamingos wurden früher nach einiger Zeit weiß – als Folge eines Ernährungsmangels. Bis der Schweizer Pharmakonzern Hoffmann-La-Roche 1956 eine künstliche Karotin-Variante entwickelte, die dann auch gleich bei den Flamingos im Basler Zoo ausprobiert wurde. 1958 schlüpfte der erste Chile-Flamingo, seit 1963 gibt es dort eine Wissenschaftlerin, die ausschließlich Zooflamingos und spanische Rosaflamingos erforscht. Es gibt wohl sechs verschiedene Flamingo-Arten auf der Welt, alle sind einander ähnlich und vertragen sich, verpaaren sich gelegentlich sogar untereinander.
Im Tierpark gibt es eine „Flamingo-Bar“, im Zoo gab es eine ähnlichen Namens. Dort lebt ein Flamingo, der heute 68 Jahre alt ist, eines der ältesten Zootiere in Deutschland, er wurde 1948 in Freiheit geboren, dann eingefangen und über Kairo nach Berlin gebracht, wie man erst vor einiger Zeit anhand seines Fußringes herausfand.
.

Afrikanischer Strauß – Wenn es, und sei es im Internet, einen Tierpark-Führer gäbe mit einer halbwegs kompletten Tier-Bestandsaufnahme und den aktualisierten Ab- und Neuzugängen, könnte ich jetzt nachsehen, woher das Straußenpaar auf dem Photo kommt – und vielleicht auch noch, wohin es (zuletzt) geht. Das Berliner Naturkundemuseum nimmt nicht mehr alle im Tierpark gestorbenen Tiere an, um sie zu präparieren. Einst waren die Menagerien und Zoologischen Gärten Wartesäle vor den Leichenhallen der Museen, wie man sagte. Zwar haben die Präparatoren gerne auch einmal ein saftiges Stück von einem toten exotischen Tier für sich zubereitet, und tun das vielleicht auch heute noch, aber im Falle des Straußenvogels gibt es inzwischen im Berliner Umland mehrere Straußen-Verwertungsfarmen. Eine z..B. von Bauer Winkler bei Oranienburg, der sich schon bald nach der Wende eine Zucht aufbaute. Dazu besuchte er extra einen Lehrgang am Rhein – beim Verband der Straußenzüchter Deutschlands e.V..
Strauße zu züchten ist nicht einfach, sagt er. Das fängt schon in der Brutmaschine an, wo den Eiern – umgekehrt wie bei Hühnern, Enten und Reptilien, deren Eier vor Austrocknung schützen. – Feuchtigkeit entzogen wird, woraufhin sich eine Luftblase im Ei bilden muss, die das Embryo 24 Stunden mit Sauerstoff versorgt. In dieser knappen Zeit muss es den Restdottersack aufnehmen, sich abnabeln und so viel Kraft entwickeln, dass es die dicke Eischale zertreten kann. Ähnlich prekär gestalten sich auch die ersten 90 Tage der Kükenaufzucht. Auf die Frage, wie er die ausgewachsenen Tiere denn schlachte, erklärte der Züchter: „Morgens gehe ich zu dem betreffenden Strauß auf die Weide und rede mit ihm darüber. Wenn er es dann eingesehen hat, fahre ich ihn zum Schlachthof.“
Der Tierparkdirektor Dathe schreibt: „Strauße sind an sich in Gefangenschaft leicht zu erhalten und können auch planmäßig in Gefangenschaft gezüchtet werden.“ Ich weiß nicht, was er mit planmäßig meinte, im Gegensatz zum Frankfurter Zoo ist die Beschilderung im Ostberliner Tierpark sehr dürftig und gibt darüber wie über so vieles keine Auskunft. Dementsprechend ist auch das Publikum in Frankfurt viel mehr an den Tieren interessiert, wie ich den Gesprächen vor den Gehegen und Käfigen dort entnehmen konnte. Hier wird mehr über Alltagsprobleme gequatscht und mehr mit Handys geknipst, es gibt mehr und bessere Restaurants, mehr und opulentere Spielplätze und Liegestühle auf den Rasenflächen, während in Frankfurt/Main lauter Überbleibsel von Zoodirektor Dr.Grzimek als „Retter der Serengeti“ auf dem Rasen stehen. Man stößt überall auf ihn im Zoo, so als hätte er ihn als Privatmann 1945 aufgebaut und seine Familie ihn derart geehrt, was nicht ganz falsch ist. Die Serengeti „rettete“ jedoch die Tsetsefliege, die Grzimek als den „bedeutendsten Naturschützer Afrikas“ bezeichnete. Dies thematisierte die Direktorin des Instituts für Landschaftsarchitektur der TU Dresden, Catrin Schmidt“, 2011 noch einmal in ihrem Buch „Eine Fliege macht Landschaft“. Im Ostberliner Tierpark werden die Hinweise auf den Gründer und Direktor der Anlage bis 1990, Heinrich Dathe, eher versteckt, seine „Verdienste“ sind jedoch nicht geringer.
Während Grzimek und Dathe auf uns – Fernsehzuschauer – früher den Eindruck machten, dass sie ständig mit irgendwelchen mehr oder weniger exotischen Tieren „Auf Du und Du“ waren, wie es in dem alten Tierpflegerlied heißt, also wahre Genies zu sein schienen – beim Verstehen des Verhaltens der unterschiedlichsten Tierarten, schreibt der Direktor des Berner, Basler und Zürcher Zoos Heini Hediger in seiner Autobiographie „Ein Leben mit Tieren“, nachdem er erzählt hat, mit was für Tieren (u.a. einen Fuchs) er seine Kindheit und Jugend verbrachte, und dass er einmal einen langen Schulaufsatz über seine letzte weiße Maus schrieb: „Derart intime Beziehungen konnte ich später als Zoodirektor und Dozent kaum mehr erleben. Administrative und wissenschaftliche Aufgaben trieben einen zunehmend breiteren Keil zwischen die Tiere und mich.“ 1955 veröffentlichte Hediger in seiner Hauszeitung einen Artikel über „Mäuse im Zoo“. Damit waren jedoch die wild lebenden „Schädlinge“ gemeint. Bei den noch schädlicheren Ratten wurde während ihrer versuchten Vernichtung auch ihr Verhalten erforscht, es kam dabei u.a. heraus, dass in einem Tierhaus zwei Rattenarten in nahezu friedlicher Koexistenz lebten, sie hatten sich das Gebäude aufgeteilt.
.

.
Hediger hat festgestellt, dass „die meisten Zoopfleger und -direktoren beruflich vor ihrem 10. Lebensjahr fixiert wurden.“ Ich habe im Bremer Tierpark und anderswo festgestellt, dass die besten Tierpfleger mehr oder weniger menschenscheu oder sogar -abweisend sind. Inzwischen finde ich das fast zwingend. Wenn sie nicht gerade Elefantenpfleger sind und vor allem mit ihrer Stimme „arbeiten“, neigen sie außerdem noch zum Verstummen, um bei den „sprachlosen“ Tieren ihre anderen Verstehens- und Verständigungsmöglichkeiten zu entwickeln, fast so wie die Blinden ihren Tast- und Hörsinn.
Im Rahmen des Kasseler „Loewe-Schwerpunkts Tier-Mensch-Gesellschaft“ entstand eine Aufsatzsammlung „Den Fährten folgen“ (2016), in dem Wiebke Reinert über die Zoo-Tierpfleger schreibt: Zwar sei der Zoo „das wohl am besten erforschte Untersuchungsfeld der Tiergeschichte“, aber „die Pfleger sind, was die Quellen anbelangt, womöglich als ebenso unterrepräsentierte Randfiguren zu bezeichnen wie die Tiere, die sie betreuten.“ Immerhin fand die Autorin eine Zoohistorikerin, Christina Wessely, die in ihrem Buch „Künstliche Tiere – Zoologische Gärten und urbane Moderne“ (2008) auch auf die Tierpfleger zu sprechen kommt: „Sie sind die einzigen Personen, die die materiellen Grenzen zwischen Tier und Mensch überschreiten und in eine intimes Verhältnis mit den ihnen anvertrauten Lebewesen treten durften.“ Dazu gehören oft auch noch ihre Ehepartner und Kinder, wenn sie das eine oder andere neugeborene Tier in ihrem Revier im Zoo bei sich Zuhause aufziehen (müssen). Neben Wessely zitiert Wiebke Reinert auch noch die Affenpflegerin des Kölner Zoos, Margret Immendorf, die gelegentlich in der „‚Diana‘ Zoo-Beilage“ Berichte veröffentlichte, in denen sie z.B. ihre Konflikte zwischen den Wünschen und Aktionen der Besucher und den Anforderungen ihrer Vorgesetzten thematisierte. Unter den amerikanischen Tierbuch-Autoren gibt es einige, die auf die Erfahrungen von Tierpflegern zurückgreifen, von den deutschen Autoren erwähnt Wiebke Reinert nur Paul Eipper (geb. 1891), „der mehrere erzählende Tierbücher veröffentlichte“ und dem „der Zoo seine wahre Heimat“ war. Ansonsten ist ihr Artikel in dem „Human-Animal-Studies“-Band leider nicht viel mehr als eine Absichtserklärung, künftig die Tierpfleger mehr zu Wort kommen zu lassen.
Bis zum Abschluß seines Zoologiestudiums und darüberhinaus unternahm Heini Hediger Sammelexpeditionen in fast alle Teile der Welt: „Ich machte mir damals noch kein Gewissen daraus, die gesammelten Tiere zu töten und in Alkohol zu stecken. Heute würde ich das nicht mehr tun – es ist aber auch nicht mehr nötig, weil wir inzwischen hinreichend wissen, welche Tierarten wo leben.“ Unterwegs nach Übersee kam Hediger durch Marseille, wo er bemerkte: „Dort fand gerade eine Messe mit allerlei Attraktionen statt, von denen mich besonders ein Mäusezirkus interessierte.“ Mich würde vor allem ein Flohzirkus interessieren, ich weiß, dass es so etwas noch gibt, die jüngeren Kollegen, denen ich davon erzähle, glauben mir das schon gar nicht mehr. Seltsamerweise kann auch das Internet sie in dieser Hinsicht nicht überzeugen.
.

Tüpfelhyäne – „Wenige Tage nach unserer ersten Ankunft in Khartum kauften wir zwei junge Hyänen für eine Mark unseres Geldes. Die Tierchen waren etwa so groß wie ein halb erwachsener Dachshund, mit sehr weichem, feinem, dunkelgrauem Wollhaar bedeckt und, obschon sie eine Zeitlang die Gesellschaft der Menschen genossen hatten, noch sehr ungezogen. Wir sperrten sie in einen Stall, und hier besuchte ich sie täglich. Der Stall war dunkel; ich sah deshalb beim Hineintreten gewöhnlich nur vier grünliche Punkte in irgendeiner Ecke leuchten. Sobald ich mich nahte, begann ein eigentümliches Fauchen und Kreischen, und wenn ich unvorsichtig nach einem der Tierchen griff, wurde ich regelmäßig tüchtig in die Hand gebissen. Schläge fruchteten im Anfange wenig; jedoch bekamen die jungen Hyänen mit zunehmendem Alter mehr und mehr Begriffe von der Oberherrschaft, die ich über sie erstrebte, bis ich ihnen eines Tages ihre und meine Stellung vollkommen klarzumachen suchte. Mein Diener hatte sie gefüttert, mit ihnen gespielt und war so heftig von ihnen gebissen worden, daß er seine Hände in den nächsten vier Wochen nicht gebrauchen konnte.
Die Hyänen hatten inzwischen das Doppelte ihrer früheren Größe erreicht und konnten deshalb auch eine derbe Lehre vertragen. Ich beschloß, ihnen diese zu geben, und indem ich bedachte, daß es weit besser sei, eines dieser Tiere totzuschlagen, als sich der Gefahr auszusetzen, von ihnen erheblich verletzt zu werden, prügelte ich sie beide so lange, bis keine mehr fauchte oder knurrte, wenn ich mich ihnen wieder näherte. Um zu erproben, ob die Wirkung vollständig gewesen sei, hielt ich ihnen eine halbe Stunde später die Hand vor die Schnauzen. Eine beroch dieselbe ganz ruhig, die andere biß und bekam von neuem ihre Prügel. Denselben Versuch machte ich noch einmal an dem nämlichen Tage, und die stöckische biß zum zweiten Male. Sie bekam also ihre dritten Prügel, und diese schienen denn auch wirklich hinreichend gewesen zu sein. Sie lag elend und regungslos in dem Winkel und blieb so während des ganzen folgenden Tages liegen, ohne Speise anzurühren. Etwa vierundzwanzig Stunden nach der Bestrafung ging ich wieder in den Stall und beschäftigte mich nun längere Zeit mit ihnen. Jetzt ließen sie sich alles gefallen und versuchten gar nicht mehr, nach meiner Hand zu schnappen. Von diesem Augenblicke an war Strenge bei ihnen nicht mehr notwendig; ihr trotziger Sinn war gebrochen, und sie beugten sich vollkommen unter meine Gewalt. Nur ein einziges Mal noch mußte ich das Wasserbad, bekanntlich das beste Zähmungsmittel wilder Tiere überhaupt, bei ihnen anwenden. Wir hatten nämlich eine dritte Hyäne gekauft, und diese mochte ihre schon gezähmten Kameraden wieder verdorben haben; indessen bewiesen sie sich nach dem Bade, und nachdem sie voneinander getrennt worden waren, wieder freundlich und liebenswürdig.
Nach Verlauf eines Vierteljahres, vom Tage der Erwerbung an gerechnet, konnte ich mit ihnen spielen wie mit einem Hunde, ohne befürchten zu müssen, irgendwelche Mißhandlung von ihnen zu erleiden. Sie gewannen mich mit jedem Tage lieber und freuten sich ungemein, wenn ich zu ihnen kam. Dabei benahmen sie sich, nachdem sie mehr als halberwachsen waren, höchst sonderbar. Sobald ich in den Raum trat, fuhren sie unter fröhlichem Geheul auf, sprangen an mir in die Höhe, legten mir ihre Vorderpranken aus beide Schultern, schnüffelten mir im Gesichte herum, hoben endlich ihre Standarte steif und senkrecht empor und schoben dabei den umgestülpten Mastdarm gegen fünf Zentimeter weit aus dem After heraus. Diese Begrüßung wurde mir stets zuteil, und ich konnte bemerken, daß der sonderbarste Teil derselben jedesmal ein Zeichen ihrer freudigsten Erregung war.
Wenn ich sie mit mir auf das Zimmer nehmen wollte, öffnete ich den Stall, und beide folgten mir; die dritte hatte ich infolge eines Anfalles ihrer Raserei totgeschlagen. Wie etwas zudringliche Hunde sprangen sie wohl hundertmal an mir empor, drängten sich zwischen meinen Beinen hindurch und beschnüffelten mir Hände und Gesicht. In unserm Gehöft konnte ich so mit ihnen überall umhergehen, ohne befürchten zu müssen, daß eine oder die andere ihr Heil in der Flucht suchen würde. Später habe ich sie in Kairo an leichten Stricken durch die Straßen geführt zum Entsetzen aller gerechten Bewohner derselben. Sie zeigten sich so anhänglich, daß sie ohne Aufforderung mich zuweilen besuchten, wenn einer meiner Diener es vergessen hatte, die Stalltür hinter sich zu verschließen. Ich bewohnte den zweiten Stock des Gebäudes, der Stall befand sich im Erdgeschoß. Dies hinderte die Hyänen aber gar nicht; sie kannten die Treppen ausgezeichnet und kamen regelmäßig auch ohne mich ins Zimmer, das ich bewohnte. Für Fremde war es ein ebenso überraschender als unheimlicher Anblick, uns beim Teetisch sitzen zu sehen. Jeder von uns hatte eine Hyäne zur Seite, und diese saß so verständig, ruhig auf ihrem Hintern, wie ein wohlerzogener Hund bei Tisch zu sitzen pflegt, wenn er um Nahrung bettelt. Letzteres taten die Hyänen auch, und zwar bestanden ihre zarten Bitten in einem höchst leisen, aber ganz heiserklingenden Kreischen und ihr Dank, wenn sie sich aufrichten konnten, in der vorhin erwähnten Begrüßung oder wenigstens in einem Beschnüffeln der Hände.
Sie verzehrten Zucker leidenschaftlich gern, fraßen aber auch Brot, zumal solches, das wir mit Tee getränkt hatten, mit vielem Behagen. Ihre gewöhnliche Nahrung bildeten Hunde, die wir für sie erlegten. Die große Menge der im Morgenlande herrenlos umherschweifenden Hunde machte es uns ziemlich leicht, das nötige Futter für sie aufzutreiben; doch durften wir niemals lange an einem Orte verweilen, weil wir sehr bald von den Kötern bemerkt und von ihnen gemieden wurden. Auch während der dreihundert Meilen langen Reise von Khartum nach Kairo, die wir allen Stromschnellen des Nils zum Trotze in einem Boote zurücklegten, wurden unsere Hyänen mit herrenlosen Hunden gefüttert. Gewöhnlich bekamen sie bloß den dritten oder vierten Tag zu fressen; einmal aber mußten sie freilich auch acht Tage lang fasten, weil es uns ganz unmöglich war, ihnen Nahrung zu schaffen. Da hätte man nun sehen sollen, mit welcher Gier sie über einen ihrer getöteten Verwandten herfielen. Es ging wahrhaft lustig zu: sie jauchzten und lachten laut auf und stürzten sich dann wie rasend auf ihre Beute. Wenige Bisse rissen die Bauch- und Brusthöhle auf, und mit Wollust wühlten die schwarzen Schnauzen in den Eingeweiden herum. Eine Minute später aber erkannte man keinen Hyänenkopf mehr, sondern sah bloß zwei dunkle, unregelmäßig gestaltete und über und über mit Blut und Schleim bekleisterte Klumpen, die sich immer von neuem wieder in das Innere der Leibeshöhle versenkten und frisch mit Blut getränkt auf Augenblicke zum Vorschein kamen. Niemals hat mir die Ähnlichkeit der Hyänen mit den Geiern größer scheinen wollen als während solcher Mahlzeiten. Sie standen dann in keiner Hinsicht hinter den Geiern zurück, sondern übertrafen sie womöglich noch an Freßgier. Eine halbe Stunde nach Beginn ihrer Mahlzeiten fanden wir regelmäßig von den Hunden bloß noch den Schädel und die Lunte, alles übrige, wie Haare und Haut, Fleisch und Knochen, auch die Läufe, waren verzehrt worden. Sie fraßen alle Fleischsorten mit Ausnahme des Geierfleisches. Dieses verschmähten sie hartnäckig, selbst wenn sie sehr hungrig waren, während die Geier selbst es mit größter Seelenruhe verzehrten. Ob sie, wie behauptet wird, auch das Fleisch ihrer eignen Brüder fressen, konnte ich nicht beobachten; Fleisch blieb immer ihre Lieblingsspeise, und Brot schien ihnen nur als Leckerbissen zu gelten.
Unter sich hielten meine Gefangenen gute Freundschaft. Manchmal spielten sie lange Zeit nach Hundeart miteinander, knurrten, kläfften, grunzten, sprangen übereinander weg, warfen sich abwechselnd nieder, balgten, bissen sich usw. War eine von der andern längere Zeit entfernt gewesen, so entstand jedesmal großer Jubel, wenn sie wieder zusammenkamen; kurz, sie bewiesen deutlich genug, daß auch Hyänen heiß und innig lieben können.“ (Alfred Brehm, „Brehms Thierleben“, Säugetiere Band 4, 1876)
Im Tierpark gibt es noch ein zweites Gehege mit Streifenhyänen. Der südafrikanische Biologe Léo Grasset meint (in: „Giraffentheater“ 2016) herausgefunden zu haben, dass weibliche Hyänen entgegen der herkömmlichen Ansicht sehr oft auf Jagd gehen, wohingegen Löwen viel mehr als sie Aasfresser sind. Sie lassen quasi andere für sich jagen – und scheuchen sie dann vom Kadaver weg. Ersteres kann Heini Hediger bestätigen, wobei er sich auf den Hyänenforscher Hans Kruuk beruft, letzteres jedoch nicht, dabei bezieht er sich auf den Löwenforscher George Schaller.
.

Sumatra-Uhu – „Dieser Nachtgeist jagt in den Dschungelwäldern Malaysias, Sumatras, Javas und Borneos kleine Wirbeltiere, die er, auf lautlosen Schwingen heranstreichend, plötzlich überfällt und mit den spitzen Krallendolchen ersticht. Mit anderen, etwa gleichgroßen Eulen – wir halten den Sumatra-Uhu z.B. mit mehreren Fischeulen zusammen – verträgt er sich. Mir scheint, dass er sich immer etwas geduckter hält als unser einheimischer Uhu. Die durch ihre feine Wellung apart gezeichnete Eulenart ist recht selten einmal in einem Tiergarten zu sehen. Über ihre spezielle Biologie wissen wir wenig,“ schreibt Heinrich Dathe in „Erlebnisse mit Zootieren“ (1978).
Heute leben zwei Sumatra-Uhus in einer Voliere des Tierparks – ohne Fischeulen. Über diese heißt es im „Milu“, den Mitteilungen aus dem Tierpark Berlin-Friedrichsfelde 2001, die vom damaligen Direktor Dr. Bernhard Blaszkiewitz zusammen mit Dr. Wolfgang Grummt herausgegeben wurde: „Die einzige jemals im Tierpark Berlin gehaltene Streifen-Fischeule, ein Weibchen, traf 1963 im Tierpark ein und lebte hier bis 1989. Eine andere Fischeule, der Gattung ‚Ketupa‘, kam 1961 von der Firma Munro/Calcutta [die vier Jahre später einen Zoo in Bremen eröffnete], der Vogel lebte im Tierpark bis 1989. 1981 erhielt der Tierpark vom Vogelpark Niendorf/Timmendorfer Strand ein ‚Ketupa ketupu‘-Männchen, das hier bis 1987 lebte.“ Abgebildet sind daneben im „Milu“ noch eine Strichel- oder Marmorfischeule im Tierpark aus dem Jahr 1984 und eine Braune Fischeule im Tierpark 1971. Zudem ein Malaien- oder Sunda-Fischuhu, den man 1970 dort photographierte. Bernhard Blaszkiewitz besuchte 1985 und 2001 den Zoo in Leningrad und sah dort den seltenen Ussuri-Riesenfischuhu „ausgestellt“.
.

Indischer Pfau – Die Pfauen laufen im Tierpark ebenso wie auf der Pfaueninsel und in vielen Zoos frei herum. Im Pankower Bürgerpark hält man sie mit Fasanen in einer dunklen Voliere. Wir hatten im Bremer Tierpark einen Ährenträgerpfau mit entsetzlich langen Sporen an den Beinen. Er lebte allein in einer Voliere. Einmal sprang er dem Pfleger, als der ihn füttern wollte, auf den Kopf und brachte ihm eine tiefe Wunde bei, die im Krankenhaus genäht werden mußte. Fortan fütterte ich den gefährlichen Vogel. Wenn ich seinen Außenbereich betrat, scheuchte ich ihn erst einmal mit einem Besen in sein Haus. Aber einmal lief er danach zu mir hin statt von mir weg, erschrocken trat ich zur Seite und der Pfau sprang aus der Tür, schwang sich in die Luft – und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Bis auf den Direktor waren alle froh darüber.
Heinrich Dathe erwähnt in seinem Buch „Erlebnisse mit Zootieren“ (1978), dass sein Terrariumsleiter und Falkner Herr Krause einmal mit einem Falken auf dem Arm eine Tasse Kaffee im „Kindercafé“ trank, als ein Pfau die beiden ansprang. Die drumherum sitzenden Tierpfleger mußten eingreifen. Einem Herrn Schell war zuvor Ähnliches passiert: Als der auf dem Fahrrad mit einem Beizhabicht in der Hand im Tierpark unterwegs war, sprang ihn eine Pfauenhenne an und riß ihn um. Im Tierpark lebten Ende der Siebzigerjahre „60-80“ Pfauen, ihr beliebtester Aufenthaltsort war nahe den Felsen der Eisbärenanlage. Dort entstand jetzt auch dieses Photo. Dathes ehemaliger Vorgesetzter im Leipziger Tierpark, Max Schneider, erzählt in seinem von Dathe redigierten Aufsatzband „Tiere haben das Wort“ (1957), dass einmal ein Pfauenhahn ein großes Fenster in der Parkschänke zerstörte, weil er in seinem Spiegelbild einen Gegner erkannte und „in Kampfhaltung“ dagegen geflogen war. Der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger bezeichnet den Pfau in einem seiner Aufsätze als einen „herrlichen Wundervogel“.
.
Burmesische Leierhirsche – Die Vorfahren dieser Gruppe erwarb Heinrich Dathe persönlich im Zoo von Rangoon. Ein männlicher Leierhirsch entwich einmal aus dem Stall ins Freie und verschwand. Ein Lehrling hatte mehrere Türen aufgelassen. Dathe hatte das Tier schon abgeschrieben, aber sein zweiter Stellvertreter blieb dabei, dass der Dschungelhirsch sich bestimmt „im östlichen noch nicht geordneten und von hoher Vegetation bewachsenen Teil des Parkes verstecke.“ Als es winterlich kalt wurde, fanden sie seine Spuren am Stall der Leierhirsche. Und wenig später fand man auch sein Lager: ein leerstehendes Gerätehäuschen. Dort konnte er wieder eingefangen werden. Der Tierpark war damals noch nicht gänzlich eingezäunt, der Leierhirsch wollte sich jedoch nicht allzu weit von seiner Gruppe entfernen. Dathe weiß sich mit dem Zürcher Zoodirektor Hediger einig, wenn er schreibt: „Der Tiergärtner hat genug Beweise, dass Tiere, die einmal entkommen sind, oft wieder freiwillig in ihr Gewahrsam zurückkehren, wenn sie können,“ denn es ist ihr „Territorium“ geworden, wie Hediger das nennt. Dathe verglich die Situation der in Gewahrsam genommenen Tiere mit seiner in einem italienischen Kriegsgefangenenlager bei Rimini, wenn er dieses, sein „Territorium“ verlassen mußten und in ein anderes Lager verschoben wurde.
.

Pfleger im Gehege der Östlichen Kiang, auch Tibet-Wildesel genannt. Man beachte die Mischung aus Fluchtdistanz und Neugier bei ihnen.
.

Mishmi-Takin. Sie gehören zur Gruppe der Ziegenartigen und bewohnen das südöstliche Tibet, den Südwesten der chinesischen Provinz Yunnan sowie die angrenzenden Landesteile.
.

Sichuan-Takin, bei denen sich 2005 die erste Nachzucht einstellte.
.

Goldtakin. „Seit dem 3. Dezember gibt es im Zoo Dresden eine neue und besondere Tierart zu entdecken. Drei Goldtakine, ein Männchen und zwei noch ganz junge Weibchen, zogen aus dem Tierpark Berlin nach Dresden,“ meldete der dortige Zoo 2013.
.
.
Anmerkungen:
(1) Im Gehege der weißen Mäuse des New Yorker Bronx-Zoos befand sich ein großer durchlöcherter Käse aus Plastik.Im Tiergarten gibt es keine weißen Mäuse oder ich habe sie noch nicht gefunden. “Ich vermöchte kaum zu sagen, wie viele Freuden ich den weißen Mäusen verdanke,” so beginnt ein Kapitel des Buches “Meine Tiere” von Theodor Lessing. Der 1933 von den Nationalsozialisten in seinem tschechischen Exil ermordete Hannoveraner Philosoph widmete es 1926 seiner Tochter Ruth. Jacques Monod und Francois Jacob – zwei französischen Genforscher und spätere Nobelpreisträger – experimentierten lange Zeit erfolgreich mit Bakterien als Modellorganismen, aber irgendwann besaßen die E.coli Bakterien für Francois Jacob nicht mehr genug Individualität, um sich ernsthaft weiter mit ihm zu beschäftigen. In seinem Buch “Die Maus, die Fliege und der Mensch” (2000) schreibt er: “Ich wollte eine Veränderung. Seit fünfzehn Jahren ließ ich nun schon ausgesuchte Bakterienpaare im Takt kopulieren. Diese Art von Übung hatte mir viel Befriedigung verschafft. Doch glaubte ich, ihre Freuden ausgekostet zu haben. Ich hatte nichts dagegen, eine Art Guru der Sexualität zu werden, aber nicht der Bakteriensexualität. Auch fingen die Bakterien an, mir ein wenig unsichtbar, ein wenig farblos zu erscheinen. Ich wollte etwas Sichtbares, mit Hormonen, Leidenschaften, mit einer Seele. Ich wollte Tiere, denen man ins Auge blicken, die man individuell erkennen, ja benennen konnte. Und die fähig waren, einem auch selbst in die Augen zu blicken.” Francois Jacob dachte dabei an weiße Mäuse, um die herum er ein ganzes Institut gründen wollte.
.

Degu, ein Nagetier aus Chile, das zur Gattung der Strauchratten gehört
…………………………………………
(2) So etwas Ähnliches war zuvor auch schon dem Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler (geb. 1887) passiert: Er hatte von 1914 bis 1920 die Anthropoidenstation der Preußischen Akademie der Wissenschaften auf Teneriffa geleitet, wo er Untersuchungen über den Werkzeuggebrauch und das Problemlösungsverhalten von Menschenaffen durchführte. 1917 veröffentlichte er über deren „kognitive Leistungen“ ein Buch mit dem Titel: „Intelligenzprüfungen an Anthropoiden“. Seine Affenforschung unternahm er z.T. unfreiwillig, weil er wegen des Kriegsausbruchs nicht von Teneriffa weg konnte: „Jeden Tag Affen, man wird schon selber schimpansoid“, klagte er. Köhler attestierte seinen sieben in Westafrika „frisch gefangenen“ Schimpansen nach einer Reihe „klassischer Intelligenzprüfungen“ eine relative „Gestaltschwäche“. Bei seinem nächsten Forschungsobjekt, dem Orang-Utan-Weibchen „Catalina“, kam Köhler jedoch zu dem Schluß: „Dies Wesen steht uns der ganzen Art nach viel näher als Schimpansen, es ist weniger ‚Tier‘ als sie.“ Und dieser Eindruck resultiere nicht so sehr „aus ihren ‚intelligenten Leistungen‘ als durch das, was man Charakter, Sinnesart o.dergl. nennt.“ Catalina hatte sich während der Experimente in Köhler verliebt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Anthropoidenstation auf Teneriffa aus Geldmangel geschlossen. Köhlers fünf Schimpansen kamen 1920 in den Berliner Zoo. Er war 1933 der einzige Professor der Psychologie, der gegen die Entlassung jüdischer Professoren protestierte, zwei Jahre später emigrierte er in die USA. Heute gibt es in Leipzig im „Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie“ ein „Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum“, in dem amerikanisch experimentiert wird. So geht es hin und her auf der „Atlantik-Brücke“.
.

Rotscheitel-Mangabe, diese Affen leben in Westafrika. Der Verband der Zoologischen Gärten e.V. teilt mit: „Die Rotscheitelmangabe ist zwar gebietsweise noch häufig, verliert aber an Lebensraum und wird nicht-nachhaltig bejagt. Die Bestände nehmen daher ab und sie wird als gefährdete Tierart geführt.“ In fast jeder solcher Kurzbeschreibungen von einer Tierart steht, stereotyp, dass sie gefährdet ist.
————————————–
(3) In „Zoologische Gärten – Gestern, Heute, Morgen“ (1977) schreibt Heini Hediger, das die „Zukunft“ der Zoos eine wissenschaftliche sei, die eng mit dem Artenschutz verbunden ist. Ansonsten gehören „biotopgerechte Unterbringung der Tiere in möglichst natürlichen Territorien und sozialen Gruppen bei möglichst natürlicher Ernährung zu den wichtigsten Wünschen des Tiergartenbiologen…Als kulturelle Institutionen haben die Zoos ihre geschäftlichen Interessen zugunsten der Förderung von Bildung und Wissenschaft in den Hintergrund treten zu lassen.“ In seiner Autobiographie „Ein Leben mit Tieren“ (1990) erwähnt Hediger den Zoo von Indianapolis, der durch einen „Zoo der Zukunft“ ersetzt werden sollte. Dazu fand eine Konferenz statt, wo u.a. Robert Beninder, „Autor des berühmten Buches ‚The Fall of the Wild, the Rise of the Zoos’“, eine Rede hielt, Hediger schreibt, dass dort die „Naturschutzaufgabe an die erste Stelle der Zielsetzung gerückt wurde.“ Er selbst sprach in Indianapolis über Aufklärungs-Schilder, Informations-Texte und -Graphiken, um den Zoobesucher „mit auf den Weg zu geben, dass er keinen Luna-Park betritt.“Als seine Kollegin, die erste europäische Zoodirektorin (in Bern): Monika Meyer-Holzapfel, den Ostberliner Tierpark besuchte, schrieb sie anschließend in das dortige Gästebuch: „So stellt man sich die Zoologischen Gärten der Zukunft vor!“
.
Der Tierfänger, Tierbuchautor und spätere Direktor des Zoos auf der englischen Insel Jersey, Gerald Durrell, meint in seinem Buch „Das Fest der Tiere“ (1992): Wir haben bewiesen, „dass ein Zoo ein wichtiges Rädchen in der Maschinerie des Naturschutzes sein kann und sein sollte.“ Mit dem „Rädchen“ meint Durrell die Zucht der vom Aussterben bedrohten Tierarten in Zoos, deren Nachwuchs dann in ihrem oder nahe an ihrem ursprünglichen Lebensraum wieder ausgewildert wird.
.

Atlashirschkuh, diese Tierart kam erstmalig 2010 in den Tierpark. Der Presse teilte man mit: „Der Atlashirsch ist eine Unterart des Rothirschs aus Nordafrika und sowohl im Freiland als auch in Zoologischen Gärten äußerst selten. Die vier Tiere – ein Männchen und drei Kühe – sind ein Geschenk des Wild Animal Parks San Diego. Beide Tiergärten pflegen seit Jahrzehnten gute Beziehungen. Die vier Hirsche wurden in eigens für sie angefertigten Kisten mit dem Flugzeug von Los Angeles nach Frankfurt am Main geflogen und von dort mit dem Lastwagen nach Berlin transportiert. Nach Ablauf der vorgeschriebenen Quarantänezeit sind alle vier Atlashirsche nun für die Besucher zu sehen – es sind derzeit die einzigen in Europa. Von den Tierpflegern erhielten die Neuankömmlinge die Namen Sidi, Khenifra, Jerada und Safi.“
.
„Heutzutage ist das Wildtier ein Kulturgut, auf welches die gesamte Menschheit einen legitimen Anspruch hat,“ meint Hediger in seiner Begründung einer „Zoobiologie“, die quasi „Zwischen den Gittern“ denkt, welche Zoo-Tiere und -Besucher trennt, wobei es darum geht, für die inhaftierten Tiere ihre freie Lebensweise annähernd nachzubilden und sie den Menschen nahe zu bringen. Die meisten Zoos müssen sich deswegen ständig modernisieren, vergrößern und ihre Arten reduzieren (um die „sozialen Tiere“ in Gruppen zu halten), viele Zoos müssen überdies aus dem Zentrum an den Stadtrand ziehen. Wenn alles mit rechten Dingen zuginge, müßte eigentlich auch der beengte Berliner City-Zoo geschlossen werden und die Tiere in den riesigen Friedrichsfelder Tierpark umziehen.
.
Die über Zooarchitektur forschende Kunsthistorikerin, Boxerin und Projektleiterin des Künstlerbundes von Mecklenburg/Vorpommern, Christina Katharina May, hat über Heini Hedigers zoobiologischen Begriff des „Territoriums“ einen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie von dem Zukunftskonzept des Zoos in Seattle ausgeht: „Landscape Habitat Immersion“. Darin heißt es: „Unter der Bezeichnung ‚Landscape Immersion‘ wurde in den 1970er Jahren in US-amerikanischen Zoos ein neues Konzept für Zooarchitektur etabliert. Nicht mehr modernistische Tierhäuser oder gepflegte Landschaftsgärten sollten den Rahmen zur Ausstellung von Wildtieren bilden. Stattdessen sollten die Tiere im Kontext einer möglichst authentisch erscheinenden, wilden Landschaft präsentiert werden…1976 wurde das Gestaltungskonzept ‚Habitat Immersion‘ als theoretische Anleitung für Natursimulationen im Zoo mit dem Masterplan des Woodland Park Zoos in Seattle eingeführt. Die immersiven Anlagen der inzwischen global verbreiteten New Zoos sollen sowohl dem Betrachter als auch dem Tier einen kohärenten, von zivilisatorischen Zeichen befreiten Landschaftsraum suggerieren. Die Techniken der Zooplaner zur Erzeugung immersiver Parkräume umfassten eine kalkulierte Dramaturgie der Weg- und Blickführung auf der Grundlage von Umweltpsychologie sowie die ortsspezifische Übersetzung der Landschaftsphysiognomie, ihrer korrelierenden Vegetations- und Bodenformen, die der Qualität der repräsentierten Landschaft entsprachen. Die Grenze zwischen Tier und Mensch, Gehege und Besucherraum sollte, zumindest für die menschlichen Rezipienten, aufgelöst werden.“
.
In einem weiteren Aufsatz „Concrete Kingdoms: Heini Hediger’s Territories at the Zurich Zoo“ geht es Christina Katharina May um die Tierhaltungskonzepte dieses Zoodirektors. Sie schreibt darin: „Hediger spielte eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der Ziele von Zoologischen Gärten, bei der Neuformulierung ihrer Aufgaben und bei Zooaufbauprojekten nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Er war der Meinung: „Jedes Tier ist ein Gefangener seiner Umwelt, seiner Umgebung, ein Gefangener in Raum und Zeit. Gruppen und Individuen sind eingezäunt von den unsichtbaren, aber wirkungsvollen Barrieren ihres Territoriums.“ Andererseits behauptete er aber auch: „Zootiere sind, ebenso wie wild lebende Tiere, keine Gefangenen, sondern Landbesitzer.“ Praktisch setzte er im Zürcher Zoo wichtige Neuerungen durch, die für andere Zoos zum Vorbild wurden. Auch einige seiner Mitarbeiter und Tierpfleger wurden diesbezüglich berühmt, sein Elefantenpfleger Ruedi Tanner z.B..
.
1993 hatten fünf Zoodirektoren sich bereits ähnliche Fragen gestellt wie die Tierhaltungskonzepte erforschende Kunsthistorikerin. Der Hannoveraner Zoodirektor Lothar Dittrich (geb. 1972), der Duisburger Wolfgang Gewalt (geb. 1928), der Heidelberger Dieter W. Poley (geb. 1935), der Alleingeschäftsführer des Wiener Tiergartens Schönbrunn, Helmut Pechlaner (geb. 1946) und der Leiter des Zoos in Kabul/Afghanistan bis 1973 Gunther Nogge (1942). Im Zoo von Kabul kam es lange nach seinem Weggang zu einem Ereignis, das diesen Zoo dauerhaft in den internationalen Medien präsent werden ließ: Dort war ein Taliban-Kämpfer in den Käfig des Löwen Marjan geklettert, um seine Tapferkeit zu beweisen, und war von Marjan getötet worden, woraufhin der Bruder des Taliban eine Granate auf ihn warf. Der Löwe war danach fast blind. 2002 starb er an Nierenversagen. Der Spiegel schrieb in seinem Nachruf: „Der Tod des einäugigen Löwen Marjan im Zoo der afghanischen Hauptstadt Kabul hat Tierfreunde in aller Welt erschüttert. Er hatte die Invasion der Sowjetunion, den Bürgerkrieg, die Taliban und zuletzt die US-Bombenangriffe überlebt. Das Tier war 1974 mit Hilfe des Kölner Zoos nach Kabul gekommen.“ Seit 2014 hat der Zoo dort wieder einen neuen Löwen: „Die Welt“ berichtete: „Er fristete ein trostloses Dasein auf dem Dach der Luxusvilla eines reichen Geschäftsmannes in Kabul – nun ist der Löwe Mardschan die neue Attraktion im Zoo der afghanischen Hauptstadt. Nach Angaben des behandelnden Tierarztes Abdul Kadir Bahawi war Mardschan fast tot, ‚er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mal mehr seinen Kopf heben. ‚Wir wussten nicht, ob er überlebt. Aber unsere Bemühungen haben Früchte getragen, und er ist heute bei guter Gesundheit, er spielt gerne und ich denke, er mag uns sehr‘.“
.

Somali-Wildesel (mit ein paar merkwürdig dünnen Zebrastreifen unten an den Beinen – die man allerdings auf diesem Photo nicht sehen kann). Die Tiere waren schon einmal ausgestorben in ihrem Verbreitungsgebiet, sie wurden dort jedoch wieder angesiedelt. Der Basler Zoo macht an ihrem Gehege bekannt, dass sie die am meisten gefährdeten Huftiere sind.
………………………………………………..
Zurück zu den fünf deutschen Zoodirektoren, die sich 1993 in ihrem Buch „Berichte aus der Arche“ Gedanken über die „Zukunft der Zoos“ machten: Nach Carl Hagenbeck, „dem Schöpfer der Freisichtanlage“ in seinem Tierpark und der Ersetzung der Schmerzdressur durch eine „zahme Dressur“ in seinem Zirkus, nach Heini Hediger, „dem Vater der Tiergartenbiologie“, würde der Zoo-Vordenker nun Michael Robinson heißen – Direktor des Nationalzoos in Washington. „Im Sprachgebrauch der Zoodirektoren auf allen Kontinenten wird nun auf Initiative M. Robinsons der Ausdruck ‚BioPark‘ verwendet, wenn ein Zoo seinen Schwerpunkt zumindest im Rahmen der Didaktik von den Tieren zu Ökosystemen verlegt.“ In ihrem „Blick ins nächste Jahrzehnt“ geht es um „Ganzheitlichkeit“, freilich in einem anderen Sinne als ihn die „Ganzheitler“ unter den Biologen einst geprägt hatten. Gemeint ist nun, dass Naturkundemuseum und Zoo, „unterstützt von moderner Technik“, und nicht zu vergessen: die „Pflanzenwelt“, mehr und mehr „verschmelzen“, um ein „modernes Naturerlebnis“ zu bieten. Dazu gehören bei den Tieren u.a. „versteckte Videokameras, um dem staunenden Besucher Einblick in die Nester und Höhlen der Tierfamilien zu bieten, ohne dass diese beeinträchtigt werden.“ Ihre intimsten Regungen sollen also heimlich überwacht werden, etwa so wie es schon bei den Würzburger Bienenforschern geschieht – und das soll gut sein, wenigstens für die Kasseneinnahmen, so machen sich auch die Zootiere noch „nützlich“. Die fünf Zoodirektoren geben jedoch bei aller Begeisterung über den möglichen Einsatz von allem Hightech, das auf dem Markt zu haben ist, zu bedenken: „Gute Zootierhaltung wird sich auch in Zukunft nicht einmal im erzieherischen Bereich durch Film und Elektronik ersetzen lassen.“ Für den „Zoo der Zukunft“ gibt es sogar schon ein „Ranking“ unter den deutschen Zoos – natürlich von einem Angloamerikaner: Anthony Sheridan, Autor des Buches „Das A und O im Zoo“, er soll jetzt angeblich den neuen Westberliner Zoodirektor aus München beraten, der im übrigen den Tierpflegern ein Redeverbot gegenüber Besuchern erteilt hat. Mit so einem dummdreisten Führungsstil wird dieser seltsame Sonnyboy jedoch nicht durchkommen. Zumal der „Keeper-Talk“ heute zu den wichtigsten öffentlichkeitswirksamen und zoopädagogischen „Einrichtungen“ moderner Zoos gehört. Hinzu kommen muß außerdem ein vielfältiges Angebot von Tierbüchern in den Zoo-Shops – das ist z.B. im Ostberliner Tierpark leider überhaupt nicht der Fall – und wäre für Berlin besonders wichtig, weil es hier, im Gegensatz zu Heidelberg und Göttingen z.B., keine einzige vernünftige Buchhandlung für biologische Literatur gibt.
.
Der erste vorsichtige Einsatz von Hightech im Zoo von Frankfurt/Main: „einfache Schilder“ – aber mit einem Photo des Fisches und einer längeren Erklärung auf einem Bildschirm, der alle Tiere im Becken nacheinander zeigt, ist eine schlechtere Lösung als die früheren bewegungslosen Schilder: Man steht davor und starrt wie in der U-Bahn auf einen Bildschirm mit Fischgesichtern – statt in das Aquarium und auf die Fische da drunter. Im Ostberliner Tierpark sieht man jetzt schon zu viele Besucher, vor allem jüngere, die die ganze Zeit beim Herumschlendern auf das Display ihres Handys starren – und nur wenn sie an einem Gehege oder einer Voliere vorbeikommen, aufkucken, um ein Handyphoto zu machen. Was machen sie damit bloß? Das wäre auch eine Besucherumfrage wert.
.
In seinem „Handbuch Zoo“ (2009) schreibt der Zoologe an der Universität Basel und Experte beim „Kompetenzzentrum Wildtierhaltung“, Jürg Meier (geb. 1954): „Die volle und unverminderte Aufmerksamkeit, Neugier und Ergriffenheit soll auch in Zukunft vom lebenden Tier hervorgerufen werden. Es ist nicht sinnvoll, diese mit allen erdenklichen Mitteln modernster Technik noch steigern zu wollen.“ Diesen Satz hat Professor Meier rot unterstrichen – und mit bezug auf die Gehege hinzugefügt: also „möglichst wenig Kunststoff, möglichst wenig Illusion.“ Bei den Pionieren der Tiergartenbiologie beginnt Jürg Meier ebenfalls mit Carl Hagenbeck und Heini Hediger, erwähnt dann den Direktor des New Yorker Bronx Zoos, Lee Crandall, der 1964 das Wissen seiner Zeit über die Haltung von Säugetieren zusammenfaßte, sowie den Leipziger Zoodirektor Karl Max Schneider, der erstmalig Löwen erfolgreich wieder in Afrika aussiedelte; ferner Bernhard Grzimek, der Zoo und Naturschutz in Westdeutschland außerordentlich populär machte, und Heinrich Dathe, der die Tiergartenbiologie weiter entwickelte; schließlich Hal Markowitz, der 1982 mit seinem Buch „Behavioural Enrichment at the Zoo“ den Gedanken der Lebensraum- und Verhaltensbereicherung bei Zootieren „zum Durchbruch verholfen hat“.
.
Im Krefelder Zoo arbeitet bereits eine „Fachfrau für Tierbeschäftigung“, Christine Peter. Sie praktiziert zwei Mal im Monat auch im Westberliner Zoo. Man kann sich in einem Zoo auch selbst helfen und etwas gegen die Langeweile der Zootiere unternehmen. In diesem Zusammenhang sind z.B. Gitter und Maschendraht vor den Gehegen und Volieren nicht immer schlecht, meint Jürg Meier: „Manche Vögel und Affenarten benutzen sie als willkommene Klettergelegenheit.“ Einige Zoos sperren Nachts Huftiere in das Freigehege von Raubtieren, da haben sie dann viel zu riechen, und die Raubtiere am nächsten Tag auch in ihrem Gehege. In Basel hält man die Bienenfresser (eine zu den Rackenvögeln zählende Art) in einer Voliere zusammen mit einem Bienenstock. Den Raubtieren zwecks Beschäftigung ganze geschlachtete Ziegen z.B. zum Fressen zu geben – lehnen zu viele Zoobesucher ab. Die Zoopresseschau meldet: „Im nächsten Tiergartenvortrag stellen Tierpfleger Richard Urban und Zoobegleiterin Nicola Ohnemus mit Schülern des Christoph-Jakob-Treu Gymnasiums Lauf ein Schüler-Seminar zur Tierbeschäftigung im Tiergarten der Stadt Nürnberg vor.“ Im „Handbuch Zoo“ heißt es: „Weil Feindvermehrung und Nahrungsbeschaffung im Zoo weitgehend entfallen und selbst die Fortpflanzung unter Zoobedingungen von Menschen ‚organisiert‘ wird (u.a. mittels künstlicher Besamung), gewinnt das Tier an ‚Freizeit‘, die sinnvoll genutzt werden muß.“ Eine etwas unglückliche Formulierung, auch mit Anführungszeichen.
.
Jürg Meier betont, je stärker wir in die Molekularbiologie „eintauchen“, desto weniger bekommen wir eine „naturwissenschaftliche Gesamtschau, der entgegenzutreten ist.“ Mich nahm kürzlich eine Biologin im Auto von Würzburg nach Berlin mit, die gleich zu Anfang erklärte, dass Tiere und überhaupt „Lebewesen“ sie nicht interessieren. „Ich forsche über ein Enzym,“ sagte sie, „und wenn ich meinen Doktor habe, für den Rest meines Lebens an zwei Enzymen.“ Unsere Autofahrt verlief daraufhin weitgehend schweigend. Wie oben erwähnt träumte der Revolutionshistoriker Jules Michelet davon, die in der königlichen Menagerie gefangen gehaltenen Löwen wie die Sklaven zu befreien – und ihnen die wahre Naturgeschichte vorzutragen. Jürg Meier zitiert Mahatma Ghandi: „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie die Tiere behandelt.“
.
Im Berliner und Wiener Tierpark bekamen einst die Tierwärter von den Besuchern ein Trinkgeld, wenn sie die Raubtiere mit Stangen derart aufstachelten, dass sie „Action“ zeigten – z.B. gegen die Gitter sprangen, und nicht bloß träge herumlagen. Dieses Problem haben die Naturkundemuseen noch heute, wie mir der Chefpräparator des Berliner Museums Detlef Matzke erklärte: „Daß man im Westen eine größere Vorliebe für Action-Präparationen hat als im Osten, liegt vielleicht an der Reizüberflutung. In Amerika hat man z.B. ganze galoppierende Herden – von Säbelantilopen etwa. Das ist, als wenn ich ein Fernsehbild anhalte. Eine eingefrorene Bewegungsphase. Wenn ich da eine Sekunde hinschaue, ist es phantastisch, und präparationstechnisch absolut genial gemacht, Hut ab auch vor der statischen Seite. Das sind ganz komplizierte Geschichten, so ein galoppierendes Tier zu zeigen. Aber es ist eine eingefrorene Phase, die eigentlich das Ding nicht bringt. Unser Auffassung, die der ‚Berliner Schule‘ kann man sagen, ist so: Wenn ich z.B. ein Reh habe und will da eine Spannung reinbringen – das Tier ist gelaufen, hat also eine Schrittfolge gehabt, dann am Boden geäst und plötzlich hat es ein Geräusch gehört, nimmt den Kopf hoch, macht sich relativ lang und hat also dieses Äugen in die Gegend, und ist dabei schon so weit gespannt, daß es im nächsten Augenblick abspringen könnte. Also man ahnt, daß jetzt gleich etwas passieren könnte, aber das Reh kann genauso gut auch im nächsten Moment feststellen: Es ist nichts – und weiter äsen. Es muß da eine Zeitebene drin sein und es muß auch eine Geschichte erzählt werden – an diesem Tier. Man möchte doch den Besucher überraschen: Was könnte aus der Sache werden. Man muß sich mit dem Tier auch identifizieren können.“
.

Vietnam-Sika. „Der Vietnam-Sikahirsch wurde in seiner Heimat fast ausgerottet, die Restbestände leben in Gattern in Nationalparks (Cuc-Phuong, Cat-Ba und Ba-Vi) und stehen jetzt unter strengem Schutz. Außerdem gibt es in Vietnam zahlreiche Sikas in Hirschfarmen,“ heißt es auf der Internetseite des Görlitzer Tierparks. In der DDR gab es fast in jeder Kleinstadt einen Zoo, ich vermute, zur Kompensation des Ausreiseverbots. Dathe schrieb, dass „sein“ Tierpark rund 120 kleine Tiergärten, die etwa zeitgleich mit „seinem“ auf dem nicht besonders großen Territorium der DDR entstanden, mitbetreute.
……………………………………………….
Der Chefpräparator Detlef Matzke hat übrigens die im Westberliner Zoo gestorbenen Pandabären Bao Bao und Yan Yan ausgestopft. „Die Luftfeuchtigkeit darf nicht schwanken und die Vitrinen müssen so dicht sein, dass an keiner Stelle ein Schädling eindringen kann“, erklärte Matzke der „Welt“, „dann können sie locker mehrere hundert Jahre alt werden.“ Der „Berliner Kurier“ berichtete kürzlich, dass der neue Zoodirektor, Knieriem, den Vertrag mit China über die Lieferung von zwei neuen Pandabären vor Ort in die Wege geleitet habe: „Auf der Agenda standen die letzten Vertragsverhandlungen und die Abstimmung der Gehegedetails“, erzählte er anschließend. „Welches Pandapärchen es tatsächlich sein wird, werden wir erst bei Vertragsunterzeichnung in den nächsten Wochen entscheiden. Dem Einzug der Pandas steht nun nichts mehr im Wege und die Besucher unseres Zoos können sich schon jetzt darauf freuen, die Pandas im Sommer 2017 begrüßen zu dürfen.“ Erst einmal müsse jedoch eine neue 5280 Quadratmeter große „Panda-Landschaft“ gebaut werden. Im Ostberliner Tierpark wird vermutet, dass Knieriem deswegen schon mal überall im Park Bambus anbauen ließ und weitere Flächen dafür nutzen wird, um weniger Futterpflanzen für das Panda-Paar aus Asien importieren zu müssen, denn eine seiner Pressesprecherinnen verriet der Zeitung: „Man denke darüber nach, im Tierpark Anbauflächen für die Pflanzen zu schaffen.“ Der Tierpark soll also kein „Hirschgarten“ werden, sondern ein „Bambushain“, das hätte sich Dathe nicht alpträumen lassen.
.
1958 hatte auch der Tierpark einen Pandabär als bis dahin „prominentesten Tiergast“ besessen: „Chi-Chi“ mit Namen. Der Pekinger Zoo hatte ihn über den Tierhändler Heini Demmer zunächst an den Moskauer Zoo geliefert, von dort kam er in den Ostberliner Tierpark, um wenig später in den Brookfield Zoo in Illinois transportiert zu werden, der Demmer das Tier abgekauft hatte. Weil aber die US-Regierung über China ein Handelsembargo verhängt hatte, das sie auch für den Pandabären geltend machte, kam er erst einmal in den Frankfurter Zoo – Bis Demmer beschloß, ihn an so viele europäische Zoos wie möglich auszuleihen, zunächst an den Kopenhagener Zoo und danach an den Londoner, wo er nur drei Wochen bleiben sollte. Dort im Tiergarten wurde er jedoch „Britain’s best-loved zoo animal“, so dass der „Londoner Zoologischen Gesellschaft“ nichts anderes übrig blieb, als ihn für 12.000 Pfund zu kaufen. Während seines kurzen Aufenthaltes im Ostberlin geschah Folgendes: Eine junge passionierte Tierfreundin, die von einer unheilbaren Krankheit befallen war, bat den Tierparkdirektor, vor ihrem Tod den Panda sehen zu dürfen: „Wir transportierten ‚Chi-Chi‘ daraufhin in einer Kiste und trugen ihn die vier Treppen eines Wohnhauses hoch. Im Krankenzimmer ließen wir ihn frei. Die geistig noch rege Frau war glücklich. Wir legten ihre Hand auf das Fell des kostbaren Tieres, das sich nicht manierlicher hätte benehmen können,“ berichtete Dathe.
.
Im Tieranatomischen Theater auf dem Biologie-Campus der Humboldt-Universität stellte der chinesische Künstler An-Chi Cheng im Rahmen einer Ausstellung über „Mensch-Tier-Beziehungen“ einen ausgestopften Pandabären und eine Graphik aus: Sie zeigte vom ersten bis zum letzten verschenkten Pandabär, was die chinesische Regierung in den Jahren ihrer „Panda-Diplomatie“, die 1982 aufgrund weltweiter Proteste von Tierschützern beendet wurde, damit alles erreicht hat, vornehmlich im „Ostblock“: an Verträgen, Handelsbeziehungen usw.. Nur einmal verursachte einer der Pandas Ärger: Als man 1980 Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Pandabärin schenkte, der sie, „Tjen Tjen“ mit Namen, an den Westberliner Zoo gab, woraufhin „Moskau intervenierte, weil Westberlin nicht Teil der BRD war.“ Der ausgestopfte Pandabär im Ausstellungsbereich „Das politische Tier“, ist das, was von „Tjen Tjen“ übrig blieb: Sie starb 1984 an einer Virusinfektion. Ob Detlef Matzke sie auch präpariert hat, weiß ich nicht. In dem Buch von Knut Holm, „Leben und Erbe Prof. Dathes“, erfuhr ich aber noch: 1958, im selben Jahr, da der Tierpark den Pandabären aus Moskau für kurze Zeit übernahm, wurde er auch „Kopfstation“ für Tierexporte aus der Sowjetunion: Große Transporte von Huftieren und Vögeln z.B. wurden in Brest von Tierparkmitarbeitern übernommen, zur Quarantäne nach Berlin gebracht, und von da aus an andere europäische Zoos weitergeleitet.
.

Möwen. Sie sind im Tierpark in gehöriger Anzahl in einer großen halbrunden Voliere nach Art eines Fullerdoms untergebracht, ob ihrer Kleinheit können sie darin gelegentlich mehrere Runden fliegen. Noch hat wohl nur der Tierpfleger darauf geachtet, ob sie zu manchen Jahreszeiten eine gewisse „Flugunruhe“ zeigen und zu anderen keine, wohingegen ihr lautes Geschrei während der Paarungs- und Brutzeit auch Tierparkbesuchern auffällt. Bei solchen Ansammlungen von Vögeln in einem Gehege oder einer Voliere sind die Hinweisschilder mit Namen, Kopfbild und Herkunft besonders mangelhaft im Tierpark, zudem oft nicht auf dem neuesten Stand. In Zoos gibt es ständig „Abgänge“, in Ostberlin kommen noch die „Entnahmen“ durch die Westberliner hinzu. „Eher mit Humor“ war dort laut Jürg Meier nur der Diebstahl einer weiblichen Köhlerschildkröte aus Südamerika durch unbekannte Täter hinzunehmen, die diese durch ein gleich großes Männchen ersetzten. „Die Sache wurde erst anlässlich einer routinemäßigen genauen Kontrolle aufgedeckt. Leider hatte man dann nur noch Männchen und an Zuchterfolge war nicht mehr zu denken.“
…………………………………………………..
Mit der Enteignung und Verbürgerlichung/Verwissenschaftlichung/Ökonomisierung der adligen Menagerien und Kuriositätenkabinette nach der Französischen Revolution entstanden – wie im Zoo Berlin, der 1841 aus der königlichen Fasanerie gebildet wurde – Tierhäuser im maurischen oder byzantinischen Stil, Ställe im Blockhausstil, Elefanten wurden in Palästen gehalten und Antilopen in einer Art Tempel. Das waren und sind Architekturen für kunstsinnige Besucher, nicht für Tiere. In den Hagenbeckschen „Freigehegen“ waren es dann vor allem als Gitterersatz gigantische künstliche Felskonstruktionen – kreiert vom Schweizer Bildhauer und Tierliebhaber Emil Eggenschwyler, der auch die Seelöwenanlage im Zoo Basel entwarf. Im Westberliner Zoo ebenso wie im Ostberliner Tierpark wurde ebenfalls nicht mit Felsformationen gegeizt – bei den Eisbären und bei den Bergziegen etwa, beliebt sind auch „Affenfelsen“ – für Paviane z.B.. Im Zoo Basel hat man eine Felsformation geteilt: eine Hälfte „bewohnen“ Schneeleoparden, die andere Affen. Jürg Meier nennt das einen „Diorama-Naturalismus“, nur eben nicht wie im Naturkundemuseum mit ausgestopften, sondern mit lebenden Tieren im Vordergrund. Hediger hat schon jede Rechtwinkligkeit beim Tierhausbau als antinatürlich abgelehnt. Heute investieren die Zoos vor allem gerne in Panzerglas, so dass man die Tiere z.B. auch unter Wasser sehen kann. Im Westberliner Zoo ist das bei den Nilpferden der Fall, im Zoo Leipzig bei den Elefanten und im Frankfurter sowie im Basler Zoo bei den Pinguinen, im Tierpark bei den Seekühen im Elefantenhaus.
.
Über den auch von Christina Katharina May thematisierten Begriff der „Habitat Immersion“ schreibt Jürg Meier: Dabei gehe es darum, dass „dass der Zoo-Besucher ganz in die Welt des Tieres eintaucht, er hält sich im Gehege auf, schwitzt z.B. in der Feuchtigkeit einer Tropenhalle und steht auf demselben Untergrund, auf dem sich auch die Tiere bewegen.“ Erwähnt wird dazu der spanische „SELWO Adventure Park“ in Estepona, wo man ein ganzes Tal mit einem Netz als Freiflughalle überdacht hat, ferner die „Nebelwaldanlage“ des Zürcher Zoos. Auch der Basler Zoo besitzt eine Freiflughalle für exotische Vögel – mit beeindruckender Bepflanzung. Es geht bei diesem Konzept auch um andere sinnliche Erfahrungen als nur Sehen, also auch in bißchen wider die „Okulartyrannis,“ wie der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann das nannte. „Der Zoo wird zum ganzheitlichen Naturerlebnis,“ so sieht Jürg Meier es kommen. Und dazu gehören auch alle möglichen „Naturschutzbemühungen“, die in der Schweiz gesetzesmäßig ja schon weit gediehen sind, auch wenn sie natürlich noch nicht an Jules Michelets Traum heranreichen, und für den Erfolg eines Zoos letztlich laut Meier „der wirtschaftliche Aspekt entscheidend ist“, also die Zahl der Besucher und Spender, die er anlockt. Zudem nützt die schönste „Habitat Immersion“ nichts, wenn die angekauften oder eingetauschten Tiere bereits eine Gefangenenmacke haben (neurotisch oder sonstwie verhaltensgestört sind). Jürg Meier erwähnt die „Bewegungsstereotypie“ eines Eisbären, der jahrelang in einem engen Zirkuswagen gehalten wurde und im Basler Zoo dann in einer geräumigen Anlage seine alte eingeschränkte Bewegung auf engstem Raum beibehielt. Zur „Habitat Immersion“ gehört desungeachtet „die Strategie, weniger Tieren mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Dabei bleibt aber die Alternative: „Universalzoo“ (von allem etwas) oder „Themenzoo“ (wie der „Vogelpark Walsrode z.B.)? Safariparks hält Meier für eine Mode, die sich schon fast überlebt hat, und den Denkmalschutz für ein Problem speziell bei Zoo-Gebäuden, denn wie beim „Alfred-Brehm-Haus“ im Ostberliner Tierpark erschwert er „sinnvolle Änderungen“ (Umbauten und Erweiterungen) und dabei verändern sich die „Vorstellungen von optimaler Tierhaltung in unserer Gesellschaft rasch.“
.
Im Hamburger Tierpark läßt man Pampashasen und Capybaras einfach frei laufen – und Pfauen sowieso. Im Zürcher Zoo und im Tierpark Cottbus veranstaltet man „Pinguinspaziergänge“. Hediger, der sich für den Schweizer National-Zirkus Knie begeisterte, empfahl Dressurübungen, damit die Zoo-Tiere nicht verblöden. Andererseits hat man aus Versicherungsgründen Kamel- und Elefantenausritte auf dem Gelände der Zoos weitgehend abgeschafft. Der Elefantenpfleger im Tierpark, Patric Müller, erzählte mir:
„Beispielsweise wollten wir mit den Elefanten rausgehen, außerhalb der Elefantenanlage. Nichts Besonderes, einfach rausgehen, diese Kippe da hinten, wo viel Wald war, da sind wir mit dem Elefantenbullen, als er noch jung war, hin. Jedenfalls sind wir rausgegangen mit dem, wie die das auch in Zürich z.B. machen, und das wurde eine Zeitlang auch mehr oder weniger inoffiziell geduldet. Wenn der Direktor Dahte Geburtstag hatte, wurde er von einem Elefanten abgeholt. Wir wollten auch weiterhin gerne und auch mit anderen Elefanten rausgehen dürfen. Wir wollten einfach die Erfahrungsmöglichkeiten der Elefanten erweitern, ihr Verhaltensrepertoire vergrößern und ihre Langeweile reduzieren. Wenn der Tierpark zu ist, keine Besucher mehr drin sind, dann ist das ja auch eigentlich kein Problem, kein Sicherheitsrisiko. Es kann natürlich immer mal was passieren, aber das haben wir dann trotzdem gemacht. Wir haben viele Dinge gemacht, die nicht mit der Leitung unbedingt direkt abgesprochen waren, die aber für uns durchaus einschätzbar waren. Die Elefanten wurden dadurch auf jeden Fall aufmerksam, aber was wir vor allem damit erreichen wollten, war, dass sie weniger schreckhaft reagierten – auf neue Sachen. Dazu wäre es z.B. auch gut gewesen, im Elefantenhaus einen Hund zu halten oder Hühner oder so etwas, ebenfalls wie in Zürich, wo sie eine Katze haben.“
.
Der Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner berichtet in seiner Autobiographie „Dicke Haut zarte Seele. Mein Leben mit den Elefanten“ (2000 ) ebenfalls von solchen quasi heimlichen Aktivitäten mit den Elefanten – z.B. „wenn unsere Vorgesetzten eine Sitzung hatten.“ In dieser „unbeaufsichtigten“ Zeit führte er u.a. „seinen“ jungen Elefanten, Thaia, durch den Zoo, an einem Vorderfuß mit dem Seil gesichert. Dabei fiel ihm auf, dass sie vor Flugzeuglärm groß Angst hatte. Weil sie auch noch Narben am Hals hatte, war er davon überzeugt, dass sie zwar in Thailand gefangen worden war, aber eigentlich aus Vietnam stammte: „Die Herde wurde mehrmals bombardiert. Deshalb hatte Thaia Angst vor Düsenflugzeugen. Durch Feuer und Entlaubung des Waldes wurde die Herde derart verängstigt, dass sie floh. Gegen Westen nach Thailand… Mit Futter und guten Worten nahm ich dem Tier die Angst vor den Flugzeugen.“
.
Der Zoodirektor sollte zwar den Unterhaltungsaspekt seiner Anlage nicht überbewerten, aber von ihm selbst werden durchaus „Entertainment-Fähigkeiten“ verlangt, Jürg Meier erwähnt den letzten Direktor der „Hauptstadtzoos“ Bernhard Blaszkiewitz „als gefragten Interviewpartner, der sich dem Grundsatz verpflichtet hat, dass der Vergleich von Gestalt und Verhalten am lebenden Tier durch nichts zu ersetzen ist und sich deshalb konsequent zum Artenreichtum im Zoo bekennt.“ Die „Immersion“ läßt sich auch als „Eintauchen“ übersetzen, deswegen wundert es, dass fast alle Zoos den Drang so vieler Tieren und Pflanzen in die Großstädte, deren ländliche Habitate zerstört werden, nicht zur Kenntnis nehmen, in dem Sinne, dass sie auf die „Zivilisierung“ dieser „Wilden“ dergestalt reagieren, dass sie eine Art nach der anderen großstädtisch „integrieren“. Bisher geschieht dies höchstens umgekehrt: dass sie die Zoobesucher in den Tierhäusern mit den Insassen zusammen lassen, wobei nur die ersteren sich durch Doppeltüren aus diesem „Kontakt“ wieder lösen können. Im Tierpark ist das u.a. bei den Vari-Lemuren der Fall (siehe oben). Diese Halbaffen eignen sich insofern aber auch gut dafür, als sie quasi von Natur aus sehr höflich sind – anders als z.B. Affen. Die Vögel und Flughunde im Raubtierhaus des Tierparks halten dagegen nach wie vor eine gewisse „Fluchtdistanz“ ein, anders im Exotenvogelhaus des Basler Zoos, wo mir z.B. ein kleiner karibischer Montserrattrupial direkt vor der Nase etwas vorsang, so lange wie ich leise pfeifend reagierte. Gerald Durrell scheint in seinem Buch „Die Tiere in meiner Arche“ (1976) solche riesigen begehbaren Vogelhäuser, „die Unsummen kosten“, nicht für ideal zu halten: Was macht man, wenn darin ein kranker Vogel gefangen werden muß? Fragte er die Verantwortlichen. Wir schießen ihn mit einem warmen Wasserstrahl herunter, wurde ihm geantwortet. „Dieses Vogelhaus ist ein typischer Bau anthropomorphischer Architektur; hinsichtlich der Zurschaustellung der Vögel ideal, und vom Standpunkt der Beschauers aus großartig. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass es auch vom Standpunkt der Vögel aus großartig war; dennoch war es angeblich für Vögel gebaut worden.“ Ja, für halbwegs gesunde, aber was spricht dagegen? Im Tierpark wurde einmal ein Kakadu, der entflogen war, von der Köpenicker Feuerwehr aus einem hohen Baum mit einem „C-Rohr“ und mit „etwa 5 Atü“ runtergeholt, wie Heinrich Dathe in seiner Aufsatzsammlung „Im Tierpark belauscht“ (1969) berichtete.
.
Die Idee des „Electronic Zoo“, wie sie der BBC-Direktor Christopher Parsons in den Neunzigerjahren entwickelte, läßt der Basler Biologieprofessor Jürg Meier höchstens als filmisches Beiprogramm für Zoos gelten, wenn damit z.B. das Leben von kleinen Insekten oder die Reproduktionskreisläufe von noch kleineren Organismen vorgeführt werden können. Auf den Agrarmessen zeigen Forschungsinstitute inzwischen schon regelmäßig Filme über z.B. Pflanzen- oder Tier-Parasiten, wie diese leben – und u.U. von anderen Parasiten bekämpft werden. Abschließend sei noch über das „Handbuch Zoo“ gesagt, dass es erwartungsgemäß allzu unkritisch ist – gipfelnd in Sätzen wie: „Für die Mehrheit der Tiere dürfte die Lebenssituation in [wissenschaftlich geführten] Zoos besser sein, als sie dies im Freileben ist,“ und: „Die Vögel faszinieren uns wohl deshalb besonders, weil sie fliegen.“ Aber genau das dürfen sie doch im Zoo so gut wie gar nicht – man beraubt sie dort ihres wichtigsten Lebenselements, selbst die teuerste „Großvoliere“ (die im Ostberliner Tierpark für Geier z.B.) erlaubt den Vögeln nur fünf, sechs Flügelschläge – von einem Ende zum Anderen. Besonders bei Geiern und anderen Raubvögeln ist dies bitter, weil sie bekanntlich am Liebsten stundenlang hoch oben in der Luft kreisen. Traurig ist das Zoodasein auch für die ganzen Zugvögel, die uns gerade deswegen „faszinieren“, weil sie riesige Strecken (zum Teil von einem Pol zum anderen und zurück) im Flug zurückzulegen. Selbst Rabenvögel (die in meiner Straße brütenden Nebelkrähen z.B.) streifen täglich über die halbe Stadt und verziehen sich bei Kälte sogar weit nach Südwesten, wenn man den Berliner Rabenforschern glauben darf. Die fromme Hedigersche Gleichsetzung von selbstgewähltem und eingekäfigtem „Territorium“ ist, mindestens aus der Sicht der meisten Vögel, sogar für Fasane, wie man sehen kann, eine bloße Zoodirektoren-Zwecklüge bzw. ein wissenschaftlicher Selbstbetrug.
.
Der Experte für Wildtierhaltung, Jürg Meier, erwähnt gleich am Anfang die „radikalen Tierschützer“, „die der Meinung sind, dass es besser sei, eine Tierart in ‚Würde‘ aussterben zu lassen, als auf mehr oder weniger künstlichem Wege zu versuchen, eine heile Welt zu suggerieren, die es so nicht (mehr) gibt.“ Bereits kurz nach Ende der Studentenbewegung riet der „Kursbuch“-Herausgeber Markus Michel uns allen bereits: „Untergehen, aber mit Würde“. Was die Tiere betrifft, ist Jürg Meier davon überzeugt, dass „Erhaltungszuchtprogramme und Wiederansiedlungen helfen, Arten vor dem Aussterben zu bewahren.“ Aber was macht man, wenn es keine halbwegs „intakten“ Wiederansiedlungsgebiete mehr für diese oder jene Art gibt? Wahrscheinlich immer mehr Zoos eröffnen, die man dann mit Nachzuchten bestückt. Laut Jürg Meier beziehen die Zoos schon heute ihre Tiere weitestgehend aus eigenen Züchtungen, sie sind sozusagen „Selbstversorger“ – und das müssen sie auch sein, weil internationale Abmachungen es nicht mehr erlauben, Tier oder Pflanzen aus ihren „natürlichen Habitaten“ zu nehmen, höchstens mit Sondergenehmigungen und nur als kleine Gruppen, um im Bestand bedrohte Arten in Zoos zu züchten und wieder auszuwildern, wie es u.a. der Zoo von Gerald Durrell auf der Insel Jersey seit Jahrzehnten vormacht: „Wir haben bewiesen, dass es geht.“ Als „Selbstversorger“ bezeichnete Heinrich Dathe früher die vielen Schreitvögel, aber auch die kleinen Pandas, die immer mal wieder Spatzen, Entenküken und sogar eine Nachtigall, die sich in ihre Gehege getraut hatten, schnappten und auffraßen.

Afrikanische Elefantenkühe

Afrikanischer Elefantenbulle. 1948 sollte Heini Hediger die Elefanten-Domestikations-Station in Gangala-Bodio im Kongo evaluieren. Sie wurde von Colonel Offermann militärisch – mit Trompetensignalen eines belgischen Unteroffiziers – geleitet. Die rund 50 Elefanten der Station wurden von 150 Männern vom Stamm der Azande betreut. „Am wertvollsten waren für die Station die großen, alten Tiere, die sogenannten ‚Moniteurs’“ – mit denen das Futter für die übrigen herangeschafft und die frisch eingefangenen beruhigt wurden, indem man sie an die zuverlässigsten „Moniteurs“ fesselte. Einige alte Bullen waren derart unleidlich, dass sie nicht mehr losgekettet wurden. Es kam oft zu Unfällen, die Station hatte einen eigenen Friedhof für tödlich verunglückte Pfleger. Junge Elefanten fing man, indem man ihre Mutter mit einem Lungenschuß „bremste“, ihr Junges an einen Baum fesselte und dann an einen der „Moniteurs“. Als der Markt für Arbeitselefanten infolge der Traktorisierung versiegte, versuchte der Stationsleiter sie an Zoos zu verkaufen, „doch auch dieses Geschäft kam nicht richtig in Gang. Einer der ersten Elefanten wurde dem Zoo in Antwerpen verkauft, wo er 1947 eintraf und gleich danach einen Tierpfleger tötete. Hediger riet in seinem Gutachten, die Elefanten-Verkaufsstation umzuwandeln in eine Zucht- und Forschungsstation mit touristischer Anziehungskraft. „Eine solche Einrichtung gab es damals auf der ganzen Welt noch nicht.“ Heute gibt es jedoch viele – fast ausschließlich in Asien. Nach 1990 baute auch einer der Elefantenpfleger des Ostberliner Tierparks sich mit einer solchen Station eine neue Existenz in Thailand auf. In Belgisch-Kongo wurde aus Hedigers Plan nichts, weil das Land wenig später selbständig wurde – und in dem darauffolgenden Bürgerkrieg viele Elefanten von Wilderern erschossen wurden. Wie man diese danach Tiere zubereitet, hat Huguette Couffignal in seinem Buch „Die Küche der Armen“ (1984) als Kochrezept beschrieben.
1950 sollte im Basler Zoo das 1891 errichtete Elefantenhaus geleert und neu gebaut werden, Hediger schreibt: „Für die letzte Bewohnerin, die Afrikanische Elefantenkuh ‚Matadi‘, zeigte Dr. Bernhard Grzimek vom Frankfurter Zoo Interesse. Er war mit aller Energie dabei, den im Krieg zerstörten Zoo wiederaufzubauen. Wir wurden bald handelseinig.“ Aber einen Tag nach ihrer Ankunft in Frankfurt starb die Elefantenkuh – an einer vorher nicht zu diagnostizierenden Krankheit. „Dieses traurige Ereignis vermochte deswegen das gute Einvernehmen mit dem später so berühmten Frankfurter Zoodirektor Professor Dr. Dr. Grzimek nicht zu trüben.“ Der Basler Zoo blieb danach vier Jahre ohne Elefanten, bis Hedigers Nachfolger 1953 vier junge Afrikanische Elefanten aus Tansania nach Basel brachte.
Der Leiter der kenianischen Nationalparks, Richard Leakey, der ständig damit beschäftigt war, mit Geldern von der Weltbank seine Wildhüter immer besser auszubilden und zu bewaffnen, damit sie den Wilderern gewachsen waren, die es vor allem auf die Stoßzähne der Elefanten abgesehen hatten, besuchte 1990 das Lager der Elefantenforscherin Cynthia Moss. Die Elefanten hatten schnell begriffen, dass sie nur außerhalb des Amboseli-Parks gejagt wurden – und wanderten deswegen nicht mehr aus dem Gebiet aus, was zur Folge hatte, dass sich die Vegetation nicht mehr erholen konnte, wie Leakey meinte. Die Naturschützer wollten die Herden deswegen dezimieren. Cynthia Moss war jedoch dagegen, für sie waren die „Veränderungen im Wanderverhalten“ der Elefanten vor allem „von der neuen Verteilung der Massai in dieser Region beeinflusst“ sowie dadurch, dass die nomadische Viehzucht sich zu einer Seßhaften-Landwirtschaft wandelte und die kenianische Bevölkerung sehr schnell zunahm. „Die dritte große, möglicherweise sogar unmittelbare Bedrohung für die Elefanten von Amboseli war und ist das Culling. Unter Culling oder Cropping (= Ernten) versteht man das kontrollierte Töten eines gewissen Teils eines Tierbestandes mit bestimmter Zielsetzung. Diese Ziele reichen von der einfachen Verringerung der Tierzahlen bis hin zum Farmen von Wildtieren im großen Maßstab, um auf Dauer einen größtmöglichen Ertrag zu erzielen,“ schreibt Cynthia Moss in ihrem Buch „Die Elefanten vom Kilimandscharo“ (1990). Jeffrey Masson und Susan McCarthy schildern in ihrem Buch „Wie Tiere fühlen“ (1997) das alljährliche „Culling“ der Elefanten im „Hwange-Nationalpark“ von Zimbabwe: „Einige Familiengruppen werden von Flugzeugen in die Richtung von Jägern getrieben, die alle Tiere bis auf die jungen Kälber abschießen. Diese werden dann zum Verkauf abtransportiert. Die Kälber irren herum, schreien und suchen nach ihren Müttern.“ Andere, nicht betroffene Familiengruppen meiden an diesem Tag ihre Weidegründe und verstecken sich in den hintersten Winkeln des Parks.“ Der Elefantenpfleger aus dem Tierpark, Patric Müller, erzählte, dass das Elefantenhaus 1989 fertiggestellt wurde, aber die Elefanten kamen schon vorher: zwei asiatische aus dem Moskauer Zoo und vier junge afrikanische aus Zimbabwe: „Dort hatte man die Herden abgeschossen, weil es zu viele geworden waren, die Jungtiere aber behalten, die waren natürlich mehr oder weniger traumatisiert, als man sie an die Zoos verkaufte, aber aus denen sind trotzdem tolle Elefanten geworden.“
.

Asiatische Elefanten im Außengehege mit zwei Handyknipsern davor. Die Asiatischen Elefanten gelten als umgänglicher und „pflegeleichter“ als die Afrikanischen, sie werden dort auch schon seit einigen tausend Jahren domestiziert. Ich habe 1967 einen Asiatischen Elefanten im Güterwaggon von Bremen nach Ostberlin in den Tierpark gebracht – und darüber in „Elefanten“ (Band 7 der Reihe „Kleiner Brehm“) berichtet. Einer der Elefantenpfleger des Tierparks suchte ihn daraufhin in den Büchern für Neuzugänge – fand ihn aber nirgends verzeichnet. Er wurde wahrscheinlich ohne Eintrag weiterverkauft, oder -getauscht. Der Tierpark hatte ihn dem Besitzer des Bremer Zoos, George Munro, für zwei Sibirische Tiger „abgekauft“, und der hatte ihn von seiner Tierhandelsstation in Kalkutta nach Bremen transportieren lassen.
In Gefangenschaft suchen sich die Elefanten ihre Pfleger selber aus, meint der Hamburger Elefantenpfleger Karl Kock. So hatten sie im Zoo Hannover z.B. eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Elefantenpfleger Ramin entwickelt. Als dieser schwer verletzt im Krankenhaus lag, mußte man ihn täglich von dort in den Zoo bringen, „damit die Elefanten angekettet werden konnten.“ Im Zürcher Zoo hält man die Tiere schon seit 1973 „das ganze Jahr über ohne Ketten“. Elefanten sind „Lerntiere“ und keine „Instinkttiere“, der dortige Elefantenpfleger Ruedi Tanner beschreibt in seiner Biographie „Mein Leben mit den Elefanten“ (2000), wie der Elefantenbulle Maxi „das Lernen lernte“. Elefanten sind zudem sehr soziale Tiere mit dauerhaften Bindungen, „aber in vielen Zoogruppen sind die Elefanten bunt zusammengewürfelt. Tiere, die sich nicht in eine Gruppe integrieren, werden von Zoo zu Zoo und vom Zirkus zum Zoo gereicht, bis sie ihre Identität verlieren. Sie erhalten mehrmals andere Namen, bis sie in keinem Tierbestandsregister mehr zu finden sind. Solche Elefanten unterliegen gravierenden Charakterveränderungen.“
Die Romanistin und regelmäßige Besucherin des Kölner Zoos, Christiane Rath, spricht in ihrem Buch „Die Elefanten zu Köln“ (2008) von zwei Arten der Elefantenhaltung. Die im Ostberliner Tierpark und in Zürich praktizierte nennt sich „hands on-Haltung“ und die neue in Köln „protected contact“ (pc), dabei bleiben die Pfleger „immer durch Schutzgitter vom Tier getrennt“. Viele Zoomanager hoffen laut Ruedi Tanner, „dass mit dem Geschützten Kontakt die selbstbewußten Elefantenpfleger durch ‚Einheitstierpfleger‘ zu ersetzen seien“ – für die die Arbeit mit Elefanten nur noch ein „Job“ ist – „mit Ferien und Feierabend“. In der asiatischen Tourismusindustrie gibt es unterdessen noch eine dritte Variante, die man „ride on-Haltung“ nennen könnte: das ist ein „Elefantenführerschein. Innerhalb von wenigen Tagen kann sich dort jeder, der dafür bezahlt, zum Amateur-Mahud ausbilden lassen.“
.
Alaska-Moschusochse. „Ich stehe am Straßenrand und suche mit meinem Fernglas die weite Tundralandschaft Nordalaskas ab. Ich befinde mich ganz im Norden Alaskas, im so genannten North Slope, der nördlichen Senke. Hier wächst kein Baum mehr, alles ist flach, eintönig. Dennoch lebt hier eines der faszinierendsten Tiere der Arktis: der Moschusochse. Die “Ochsen‘ ähneln dem Büffel oder Bison, sind aber doch mit Schafen und Ziegen verwandt. In Alaska waren die Moschusochsen Anfang des 20. Jahrhunderts nahezu ausgerottet. Erst in den 1930er Jahren wurden Tiere aus Grönland in Alaska wieder angesiedelt,“ schreibt Bernd Römmelt in seinem Reisebericht „Schatzkammer Arktis“ (2011).
————————————–
Wenn Hediger die Institution Zoo in der Nachkriegszeit theoretisch und praktisch reformierte, und das „Landscape Immersion“-Konzept des Zoos in Seattle ab Mitte der Siebzigerjahre seine Reformideen weiter entwickelte, dann ist der „Ruhr-Zoo“ der Stadtwerke in Gelsenkirchen, der sich jetzt „Zoom Erlebniswelt“ nennt und als der „beste Zoo Deutschlands“ gilt, sozusagen der Zoo-Weisheit letzter Schluß. Er ist etwa so klein wie der Charlottenburger Zoo (gut 30 Hektar) und umfaßt vier Bereiche, einer besteht aus einem Bauernhof mit Nutztierrassen. In ihrem Aufsatz „Vom ‚Ruhr-Zoo‘ zur ‚ZOOM Erlebniswelt‘ oder wie das Ruhrgebiet in der Landschaft verschwand“, schreibt Christina Katharina May: „Den Besuchern der ZOOM Erlebniswelt wird bereits durch den Namen des Gelsenkirchener Zoos vermittelt, dass sie einen besonders nahen Blick auf die Wildtiere erhalten. Von den Giraffen sind die Besucher nur durch einen flachen Wassergraben und im Schilf versteckte Elektrozäune getrennt. Im Zoo wird die Fernreise ersetzt, wobei sich die Besucher den Tieren weitaus unaufwändiger nähern können als mit einer Safari nach Ostafrika. Filmische Tierdokumentationen bieten mit dem prothetischen Sehen des Kamerazooms zwar noch nähere Einblicke, jedoch bleibt bei der medialen Vermittlung die körperliche Nähe zu den Tieren aus. Die ‚Weltreise an einem Tag‘, mit der für einen Zoobesuch in Gelsenkirchen geworben wird, führt durch die Themenwelten Afrika, Alaska und Asien, die durch Tierarten, Landschaftsphysiognomie und auch Artefakte menschlicher Kulturen den Besuchern vermittelt werden. Die künstlichen Landschaften weisen aber Brüche in ihrer Inszenierung auf, da die dicht besiedelte Gelsenkirchener Umgebung nicht vollständig auszublenden ist. Die Giraffen vor dem Hintergrund aus Hochspannungsleitung und Laubgehölz der gemäßigten Zone führen den Betrachtern deutlich vor Augen, wie verschiedene Orte, die Graslandsavanne und die Gelsenkirchener Umgebung, vermischt werden.“
.
Abgesehen von der Notwendigkeit, immer mehr Besucher anzuziehen, um die steigenden Kosten des Zoos zu minimieren, haben die Besucher anscheinend auch eine psychosoziale Funktion für die Tiere: „Weißt du noch, der harte Winter? Täglich nur 900 Besucher? Wie die Tiere fast durchdrehten?“ „Die Affen kriegten ’nen Koller ohne die Besucher, die langweilten sich zu Tode, wie wenn man den Fernseher abstellt.“ „Die Babys klammerten sich an die Pfleger.“ „Und unsere Amazonaspapageien kriegten ’nen Koller ohne die Besucher, ich weiß noch, wie sie an ihren Federn rissen und sich die Flügel kahl hackten.“ „Die Robben und Seelöwen starrten trübsinnig in den grauen Himmel.“ – So unterhielten sich die Tierpfleger im Zoo-Restaurant des Romans von Martin Kluger. Der Zürcher Tierpsychologe Heini Hediger hatte in seinem Buch „Mensch und Tier im Zoo“ (1965) bereits konkrete Beobachtungen dazu geliefert: „Es darf aufgrund sorgfältiger Erhebungen gesagt werden, dass sich die (höheren) Tiere im Zoo ohne Publikum langweilen, dass sie durch die Besucher unterhalten und angeregt werden.“ Wegen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche bei den Huftieren mußte der Zürcher Zoo mehrmals geschlossen werden, Hediger erinnert sich, wie augenblicklich die Stimmung sank: „Eine allgemeine Apathie, um nicht zu sagen Depression breitete sich alsbald im Zoo aus. Die Tiere lagen oder standen gelangweilt und langweilig herum und waren dankbar für jeden Reiz…“ Mit einer automatischen Kamera wurde das bei den Kapuzineraffen beweiskräftig gemacht. Der Gründer und Direktor des „Wildlife Parks“ auf der Insel Jersey, Gerald Durrell, beschreibt in seinem Buch „Das Fest der Tiere“ (1992) Ähnliches, als anfänglich mit Beginn der kalten Jahreszeit so gut wie keine Besucher mehr kamen.
.

Berberaffen in einem Freigehege, „Affentempel“ genannt, das Dathe mit Resten aus den im Krieg zertrümmerten Berliner Bürger- und Adelshäusern ausstaffieren ließ.
…………………………………………………
(4) Ähnlich denkt darüber auch der Zürcher Zoodirektor Heini Hediger. Er erwähnt u.a. den syrischen Goldhamster, der zwar 1839 schon entdeckt wurde, aber seitdem als verschollen galt. Erst 1930 gelang es einem Biologen, bei Aleppo ein Weibchen mit 12 Jungen zu fangen. Alle heute lebenden Goldhamster – Millionen, in Zoos, Privatwohnungen und Versuchslaboren – sind Nachkommen dieser 13 Tiere. Bei den Przewalskipferden waren es sogar nur 12 Tiere. Das gilt laut Hediger auch für Bisamratten, die sich über ganz Europa ausbreiteten und ebenso wie die Kaninchen in Australien von ganz wenigen Paaren abstammen. „Wo bleiben da die schlimmen Inzuchterscheinungen?“ Man kann noch weiter gehen, und sogar die „Evolution“, die Artenentwicklung, statt durch (zufällige) Mutationen und Selektionen durch Inzucht erklären: Es sind fast immer nur ganz wenige Individuen, manchmal sogar nur ein einziges befruchtetes Weibchen, die in neue Habitate vorstoßen – sei es, weil sie vertrieben wurden oder im Sturm z.B. auf eine Insel abtrieben, wo sie sich dann vermehrten und sich dabei den neuen Gegebenheiten entsprechend langsam veränderten, so dass sie schließlich als eine neue Art begriffen wurden, neuerdings mit gentechnischen Mitteln. Der Biologe Léo Grasset erwähnt: in seinem Buch „Giraffentheater“ (2016) ein Gegenbeispiel zu dieser segensreichen Wirkung der Inzucht: die untereinander sehr eng verwandte Löwenpopulation im Ngrongoro-Schutzgebiet Tansanias: „Die Folgen der Inzucht lassen sich bei den Männchen dort gut beobachten. Fast die Hälfte ihrer Spermien ist fehlgebildet.“ Man hat daraufhin die Löwen anscheinend alle erschossen, ohne nach einer anderen Ursache für diese, ihre „Behinderung“, zu forschen, und anschließend „mit einer Handvoll Individuen einfach eine neue Population aufgebaut.“ Es gibt ein Experiment, das dem Inzucht-Problem auf den Grund gehen könnte: 1963 entstand bei Island eine neue Vulkaninsel: Surtsey. Die Biologen verfolgten von Anfang an, welche Tiere und Pflanzen sich dort nacheinander ansiedelten. „Noch heute erreichen jedes Jahr zwischen zwei und fünf neue Arten die Insel,“ heißt es auf Wikipedia, wo allerdings nicht mitgeteilt wird, wie viele Individuen von jeder Art.
.

Chapman-Zebras, eine Unterart der Steppenzebras aus Südafrika.
……………………………………………………
(5) Noch 1968 trat der konservative Verhaltensforscher und spätere Nobelpreisträger Konrad Lorenz mit einer Kritik an den damaligen linken Bewegungen hervor, indem er von seinen Beobachtungen an Gänsen aus das Verhalten der revoltierenden Studenten biologisch interpretierte – und sich ähnlich wie Berthold und Menzel über sie mokierte. Noch dümmer äußerte sich wenig später der französische Genetiker und Nobelpreisträger André Lwoff. In seinem Buch „Die biologische Ordnung“ verglich er die aufständischen Jugendlichen mit Bakterien: „In Frankreich, im Laufe des Monats Mai 1968, wurde ein bestimmter Typ von Ordnung gestört. Ein Sturm hat die Repressoren beschädigt, die Operatoren-Gene haben die Kontrolle durch die Operons [ein Wort für eine Funktion, die er zusammen mit dem Biologen Jacques Monod entdeckt hatte] verloren. Neue Moleküle wollten den Platz der alten einnehmen und haben das System der Regulation angezweifelt. Aus alledem resultierten unerwartete Ereignisse, interessante Ereignisse und, um alles zu sagen, sehr bemerkenswerte Ereignisse. Es gibt anscheinend nichts Gemeinsames zwischen einer molekularen Gesellschaft und einer menschlichen Gesellschaft. Man kann trotzdem nicht umhin, frappiert zu sein von einer bestimmten Analogie zwischen der phylogenetischen Evolution der Organismen und der historischen Evolution der Gesellschaften.“ Wenn Naturwissenschaftler sich über die „Gesellschaft“ auslassen, kommt meistens dummes Zeug dabei raus. Bei dden „jungen“ – Berthold und Menzel – kommt dazu noch ein feiger Mut, denn nichts ist heute wohlfeiler als sich über die „68er“ zu mokieren.
.
Der Konrad Lorenz-Schüler Irenäus Eibl-Eibesfeldt hat aus des Meisters Hang zur „Vertierlichung“ des Menschen später ein ganzes Forschungsprogramm – in „seinem“ Max-Planck-Institut für „Humanethologie“ – gemacht, wobei er z.B. mit dem Unterwasserfilmer Hans Hass die „Raubtierinstinkte“ von Riffhaien und Finanzhaien erforschte. Das Institut wird derzeit abgewickelt. Dafür entstehen jede Menge neue, die, finanziell bestens ausgestattet, sich mit amerikanischer Gentechnik, Molekularbiologie und Neurobiologie befassen – praktischerweise müssen die deutschen Biologen dort ihre Forschung gleich auf Englisch debattieren und publizieren, so wurde es mindestens von der Max-Planck-Gesellschaft von oben angeordnet. Das hat wohl auch damit zu tun, dass heute in Geräte investiert wird und nicht in Arbeitsplätze, weil man nur die ersteren „abschreiben“ kann.
.

Eine Gans und drei Bennettkänguruhs. Ihre 2006 eingeweihte Freianlage kann man als Besucher betreten, die Tiere sind dann nur noch durch einen halbmeterhohen Zaun von einem getrennt. Neben dem Bennettkänguruh befindet sich dort laut der Beschilderung noch das Östliche Bergkänguruh, das Ringelschwanz-Felsenkänguruh und das Flinkwallaby – ebenfalls eine Känguruhart. Weil man davon ausging, dass das Känguruhjunge im Beutel der Mutter mit der Zitze verwachsen sei (sie blutete, wenn man es davon abnahm), wurde behauptet, dass es sich aus der Zitze entwickelt. Vor allem in Australien wollte man lange Zeit nicht glauben, dass der Embryo im Beutel „aus eigener Kraft die weite Wanderung von der Geburtsöffnung bis in das Innere des mütterlichen Beutels unternimmt, um sich dort an der Zitze festzusaugen.“ (Heini Hediger, „Tiere sorgen vor“ 1973).
.

Auf einer zweiten Freianlage nebenan leben Schwarzschwanzkänguruhs und Westliche Graue Riesenkänguruhs.
.

Indische Riesenflughunde – in der Tropenhalle des Raubtierhauses. Im Bremer Tierpark waren das die interessantesten Tiere, die ich zu versorgen hatte, in ihrem Fall mit Obstsalat, in den sie sich geradezu stürzten. In seinem „Wegweiser durch den Tierpark Berlin“ schrieb Heinrich Dathe 1983 über das riesige „Glashaus“ im Zentrum des Alfred-Brehm-Hauses: „Das Interessanteste darin sind die im dürren Geäst hängenden Riesenflugfüchse (Pteropus giganteus) aus Indien. Diese fruchtfressenden Fledermäuse sind hier endlich so ausgestellt, wie ihre Biologie es erfordert. Werden diese Tiere über lange Zeit in engeren Unterkünften gehalten, verkümmert die Muskulatur der Flughäute, es treten Hautschäden daran auf, die Flughunde beginnen zu kränkeln.“ Diese Flughunde, das waren die aus Bremen.

.
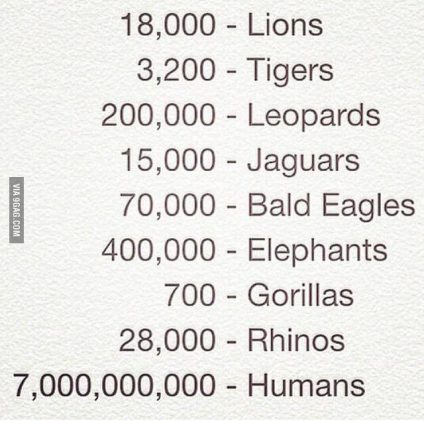
Absolute Zahlen. Über Flughunde liegen keine vor, sie sind weit verbreitet, aber acht Arten sind schon ausgestorben. Die Regierung von Mauritius hat überdies laut Wikipedia im Oktober 2015 beschlossen, 20 Prozent der Population einer dort lebenden Flughundeart zu töten, weil die Tiere angeblich die Ernte von Mangos und Litschis schädigen. Tierschützer und die Weltnaturschutzunion IUCN warnten, das könne die Art an den Rand des Aussterbens bringen.
.
.
Büchertitel:
Heinrich Dathes „Lebenserinnerungen eines leidenschaftlichen Tiergärtners“ (2002) wurden posthum von seinen Kindern herausgegeben. Die Erinnerungen des Biologen und Sektionsleiters Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung München Josef Reichholf haben den Titel „Mein Leben für die Natur“ (2015), die des Ornithologen und Leiters der Vogelwarte Radolfzell Peter Berthold heißen „Mein Leben für die Vögel“ (2016) und die der ersten Nachkriegsdirektorin des Berliner Zoologischen Gartens, Katharina Heinroth: „Mein Leben mit Tieren“ (1979). Umgekehrt nannte Bernhard Grzimek seine Autobiographie „Tiere mein Leben“ (1984) und seine erste Frau, Hildegard Grzimek, ihre: „Mein Leben für die Tiere“ (1964), während Heini Hediger zuletzt den Titel „Ein Leben mit Tieren“ (1990) wählte.
.

Temmincktragopan – eine Hühnervogelart aus der Familie der Fasanenartigen. Er ist in Südostasien beheimatet, wo er Mischwälder mit Bambus in Höhen zwischen 2500 und 3600 m bewohnt. Die Art ist in entsprechenden Habitaten relativ häufig und nicht bedroht. Sie hat von allen Tragopanen das größte Verbreitungsgebiet. Dieses grenzt im Osten und Norden an das des nahe verwandten Satyrtragopans, der in der Fasanerie des Tierparks ebenfalls vertreten ist. Ergänzend zum Wikipediaeintrag heißt es auf der Internetseite des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V.: „Droht Gefahr arlarmiert er mit einem weichen ‚Quack- quack- quack- quack‘. Nähert sich der Feind, schleicht sich der Tragopan beim leisesten verdächtigen Geräusch wie eine Katze davon. Dennoch haben Jäger oft Erfolg, wenn sie sich leise verhalten und warten.“ Diesen letzten Satz hätte ich eher auf der Internetseite des Bremer Verbandes der Südostasien-Jagdfreunde e.V. erwartet.





