Mendesantilopen (Addax) mit Pfleger im Ostberliner Tierpark. In der Geschichte „Einübung ins Paradies“ schreibt Ingo Schulze: „Was fiel einem denn früher zu Berlin ein? Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor mit der Mauer, der Pergamonaltar, der Palast der Republik und der Tierpark. Sobald ich als Kind den Fernseher einschaltete, kam dieser Tierpark-Teletreff mit Prof. Dr. Dr. Dathe und Annemarie Brodhagen. Hinter den beiden wimmelte es nur so von Besuchern. Schwenkte die Kamera auf die Tiere, schien es, als liefen diese frei herum und würden sich im nächsten Moment unter die Menschen mischen. Prof. Dr. Dr. Dathes überbordendes Wissen, seine Fähigkeit, unaufhörlich über Tiere zu sprechen, und dabei Hunderttausende durch seine Erzählung zu fesseln und zum Staunen zu bringen, so dass Annemarie – der Professor durfte unsere schönste und beliebteste Fernsehansagerin einfach nur Annemarie nennen – schließlich nur noch selig erschöpft und demütig hat lächeln können, während sich Prof. Dr. Dr. Dathe doch gerade erst warm geredet hatte und allmählich mit den eigentlich wichtigen Informationen herausrückte. Das prägte mein Bild eines Gelehrten.“
.
.
Elefanten
Die Wissenschaft ist grobschlächtig, das Leben subtil, deswegen brauchen wir die Literatur, meinte Roland Barthes. Und bei der Tierforschung brauchen wir die Erzählungen der Tierpfleger bzw. Wildhüter. Die mit Elefanten beschäftigten Pfleger gelten bei ihren Kollegen als privilegiert und die Elefantenforscher kooperieren schon lange, wenn auch manchmal notgedrungen, mit ihnen. Der Elefantenpfleger des Ostberliner Tierparks Patric Müller wechselte die Seite – von der Hand- zur Kopfarbeit: Er begann ein Biologiestudium – sinnigerweise bei Professor Elefant an der Humboldt-Universität, und forschte dann auch über Elefanten. Frühere Kollegen von ihm im Tierpark, Bodo Förster und seine Frau Lia, engagierten Mahuts und machten sich in Thailand mit einem „Elefantencamp“ selbständig. „Einmal Elefantenmann immer Elefantenmann, meint Patric Müller. Bei ihm begann das so: „Als ich 1986 in Tierpark anfing, ließ Professor Dathe ein neues Elefantenhaus bauen. Es wurde 1989 fertiggestellt, im Vorfeld kamen aber schon die Elefanten: zwei aus dem Moskauer Zoo und vier junge aus Zimbabwe. Dort hatte man die Herden abgeschossen, weil es zu viele geworden waren, die Jungtiere aber behalten, die waren natürlich mehr oder weniger traumatisiert, als man sie an die Zoos verkaufte, aber aus denen sind trotzdem tolle Elefanten geworden. Es ist dabei wichtig zu wissen, erstens dass man eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen muss, um mit denen umgehen zu können, weil Elefanten einem ja schon von ihrer Physis her überlegen sind, Masse mal Beschleunigung. Zweitens haben Elefanten eine Sozialstruktur, die hierarchisch geordnet ist, das heißt, es gibt ein Alphatier und das ist bei ihnen meistens eine Kuh. Elefanten erfordern generell eine individuelle Pflege. Ich will das nicht vermenschlichen, aber für das Vokabular, um Charaktereigenschaften bezeichnen zu können, bleibt mir ja nur das von den Menschen.“ Dieses ergibt sich bei den Elefantenpflegern auch dadurch, dass sie – anders als die Pfleger in anderen „Revieren“ – nach Feierabend immer noch im Tierparklokal zusammenkommen: „Da wurden dann am Biertisch auch alle Probleme angesprochen, die sich um die Elefanten drehten: „Was vorgefallen ist am Tag oder in der letzten Zeit und was zu erwarten ist“ – bei diesem oder jenem Tier.
.
Die Elefantenpfleger im Westen geben dabei gerne zu, dass die mit Elefanten arbeitenden Mahuts in Indien und Burma z.B. über sehr viel mehr Elefantenwissen als sie verfügen, weil die Tiere, mit denen sie tagtäglich arbeiten mit zur Familie gehören. Ihr Elefant begrüßt trompetend ihren Nachwuchs und trauert mit ihnen um Verstorbene. Verwaiste Jungtiere werden gelegentlich von den Frauen gesäugt. Für die Mahuts ist es selbstverständlich, dass es „unter den Elefanten fleißige Arbeiter gibt und solche, die sich drücken; manche haben freundliche Gemüter, und manche sind ständig schlecht gelaunt. Einige von ihnen transportieren Baumstämme, die bis zu zwei Tonnen schwer sind, ohne zu murren, und andere, die genau so stark sind, stellen sich fürchterlich an wegen eines Hölzchens,“ wie es in einem englischen Bericht heißt. Solch anthropomorphe Interpretationen von Verhalten gelten als unwisenschaftlich, „aber“, gibt die Philosophin Mary Midgley zu bedenken, „würden sie sich nicht an diesen alltäglichen Gefühlen orientieren – würden sie nicht beachten, dass ihr Elefant glücklich, verärgert, ängstlich, aufgeregt, müde, gereizt, neugierig oder wütend ist, sie würden nicht nur ihre Arbeit verlieren, sie wären sehr bald tot.“
.
Der Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner schreibt in seiner Biographie „Mein Leben mit den Elefanten“ (2000) – über „seine“ kinderlose Elefantenkuh Druk: „Oft will sie sogar uns behüten. Ihr höchstes Glück ist, wenn ein junger Elefant oder ein Elefantenpfleger unter ihrem Bauch sitzt.“ Und „trompeten“ tun Elefanten „aus Angst, Übermut oder Wut.“ Als ein Geräusch, auf das alle Elefanten erwartungsvoll reagieren, aber auch alle anderen Zootiere, erwähnt er das Klingeln mit seinem „Schlüsselbund“. Respekt verschaffen die Pfleger sich hingegen mit einem „simplen Besen“.
.
Ihre Pfleger suchen sich die Elefanten selber aus, wie der Hamburger Elefantenpfleger Karl Kock meinte. So hatten sie im Zoo Hannover z.B. eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Elefantenpfleger Ramin entwickelt. Als dieser schwer verletzt im Krankenhaus lag, mußte man ihn täglich in den Zoo bringen, „damit die Elefanten angekettet werden konnten.“ 1968 schickte der Zoodirektor Ruedi Tanner auf einen größeren Elefantentransport: Er sollte zwei kleine Elefanten aus Kalkutta im Flugzeug nach Zürich begleiten. Eines der Tiere regte sich unterwegs derart auf, dass auch kein Valium mehr half. Tanner steckte ihm daraufhin zwei Finger in den Mund, „damit es nuckeln konnte.“ Das beruhigte den kleinen Elefanten zwar, aber Tanner mußte deswegen stundenlang auf einem Blecheimer sitzend ausharren. Eine Zürcher Künstlerin machte aus dieser Szene später ein Wandteppich-Motiv. Der kleine Elefant, Chhukha wenig später genannt, wich seit dem Flug nicht mehr von Tanners Seite: „Die ersten Wochen war es besonders schlimm.“ Dafür konnte er bald auch Nachts in das Elefantenhaus gehen, ohne das die Tiere hochschreckten, was z.B. dem Zoodirektor, der Schlafforschung bei Tieren betrieb, nie gelang.
.

.
Patric Müller erzählte mir, wie sie versuchten, den Elefanten Abwechslung zu bieten, damit sie nicht in ihrem Gehege verblöden: „Beispielsweise wollten wir mit den Elefanten rausgehen, außerhalb der Elefantenanlage. Nichts Besonderes, einfach auf diese Kippe, wo viel Wald war, da sind wir mit dem Elefantenbullen, als er noch jung war, hin. Das wurde eine Zeitlang auch mehr oder weniger inoffiziell geduldet. Wenn der Direktor Dahte Geburtstag hatte, wurde er von einem Elefanten abgeholt. Wir wollten aber auch weiterhin gerne und auch mit anderen Elefanten rausgehen dürfen. Wir wollten einfach die Erfahrungsmöglichkeiten der Elefanten erweitern, ihr Verhaltensrepertoire vergrößern und ihre Langeweile reduzieren. Wenn der Tierpark zu ist, keine Besucher mehr drin sind, dann ist das ja auch eigentlich kein Problem, kein Sicherheitsrisiko. Wir haben viele Dinge gemacht, die nicht mit der Leitung unbedingt direkt abgesprochen waren, die aber für uns durchaus einschätzbar waren. Wir wollten damit vor allem erreichen, war, dass sie weniger schreckhaft reagierten – auf neue Sachen und Situationen.“
.
Der Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner berichtet ebenfalls von solchen quasi heimlichen Aktivitäten mit den Elefanten – z.B. „wenn unsere Vorgesetzten eine Sitzung hatten.“ In dieser „unbeaufsichtigten“ Zeit führte er u.a. „seinen“ jungen Elefanten, Thaia, durch den Zoo, an einem Vorderfuß mit dem Seil gesichert. Dabei fiel ihm auf, dass sie vor Flugzeuglärm groß Angst hatte. Weil sie auch noch Narben am Hals hatte, war er davon überzeugt, dass sie zwar in Thailand gefangen worden war, aber eigentlich aus Vietnam stammte: „Die Herde wurde mehrmals bombardiert. Deshalb hatte Thaia Angst vor Düsenflugzeugen. Durch Feuer und Entlaubung des Waldes wurde die Herde derart verängstigt, dass sie floh. Gegen Westen nach Thailand. Mit Futter und guten Worten nahm ich dem Tier die Angst vor den Flugzeugen.“
.
Die Romanistin und Elefantenliebhaberin Christiane Rath erwähnt in ihrem Buch „Die Elefanten zu Köln“ (2008) zwei Arten der Elefantenhaltung. Die im Ostberliner Tierpark und auch in Zürich praktizierte nennt sich „hands on-Haltung“ und die neue in Köln „protected contact“ (pc), dabei bleiben die Pfleger „immer durch Schutzgitter vom Tier getrennt“. Viele Zoomanager hoffen laut Ruedi Tanner, „dass mit dem ‚Geschützten Kontakt‚ die selbstbewußten Elefantenpfleger durch ‚Einheitstierpfleger‘ zu ersetzen seien“ – für die die Arbeit mit Elefanten nur ein „Job“ ist – „mit Ferien und Feierabend“. An anderer Stelle schreibt Tanner: „Zoobullen müssen fast immer wegen ‚Bösartigkeit‘ kurz nach Eintritt der Geschlechtsreife getötet werden.“ In Indien ist es genau umgekehrt – antiödipal: Wenn ein Mahut von einem Elefanten getötet wird, übernimmt sein Sohn diesen und sowohl ihm als auch dem Elefanten bringt man großen Respekt entgegen.
.
P.S.: In Afrika werden angeblich an jedem Tag etwa 100 Elefanten von Wilderern erschossen. Die Wildhüter der Nationalparks müssen ständig mit moderneren Waffen ausgerüstet werden, um den Wilderern gewachsen zu sein. In Sambia gibt es ein Elefantenwaisenheim mit einem Auswilderungsgehege für junge Elefanten, deren Eltern getötet wurden. Die Einrichtung brauchen laufend Spenden. Die letzten frei lebenden Elefanten zu schützen ist bald teurer als sie im Zoo zu unterhalten. Aber jeder Zoo ist auch eine Tierversuchsanstalt.
.
.

Das Faultier „Julius“ im Dortmunder Zoo, das vor einigen Monaten einem noch minderjährigen Zoobesucher auf den Kopf fiel. Beide kamen mit dem Schrecken davon. Die Besucherin auf dem Bild ist die aus Dortmund stammende Leiterin des Goethe-Instituts in Nowosibirsk, Stefanie Peter. Photographiert vom Schamanismusforscher Philipp Goll.
.

Stefanie Peter im Zoo von Nowosibirsk, ebenfalls von Philipp Goll photographiert. Die letzten Nachrichten aus dem Nowosibirsker Zoo:
27. Dez. 2016: Fast ausgestorbene Hundeartige lehrt man sich zu vermehren. Im Dezember bekam der Zoo Nowosibirsk ein Waldhundpaar. Die Tiere gewöhnen sich jetzt aneinander. Zurzeit ist der Zoo Nowosibirsk der einzige Zoo in Russland, der Waldhunde hält, erklärte die Zoosprecherin Jewgenija Piroshkowa.
27. Dez. 2016: Zoo Nowosibirsk wird ein Monument am Schwanensee aufstellen in Form des auf einer Bank sitzenden Rostislaw Schilo. Die Idee, ein Monument eines auf einer Bank sitzenden Rostislaw Schilo zu schaffen, wurde im Wettbewerb der Entwürfe, der im Sommer stattfand, von vielen Nowosibirskern unterstützt. Der Leiter des Nowosibirsker Zoos, Rostislaw Schilo, war am 26. April 2016 im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Das Denkmal kostet rund 30.000 Euro. An der Ausschreibung hatten sich über 200 Personen beteiligt. Der Entwurf mit der Bank erwies sich als einer der populärsten.
26. Dez. 2016: Zoo begann großangelegte Sanierung der Gehege und des Affenpavillons. Die Sanierung betrifft den Pavillon „Welt der Tropen“, den Winterpavillon für kleine Affen und Pinguine, den Pavillon für wärmeliebende Tiere, die Unterkünfte von Schneeleoparden, Löwen und Tiger, Tayra und Rentiere.
22. Dez. 2016: Nowosibirsker Delphinarium bekam Schaufelnasen-Hammerhai. Einen neuen Bewohner für das Hauptaquarium bekam das Nowosibirsker Zentrum für Ozeanografie und Meeresbiologie „Delfinija“ aus dem Moskauer Aquarium-Komplex „Aqua Logo“. Jetzt fand die neue „Bewohnerin“ ihren Platz im Hauptaquarium mit den Meeresfischen, wo bereits Zebrahai Jascha und seine „Freundin“ Glascha leben. Das Zentrum für Ozeanografie und Meeresbiologie „Delfinija“ ist ein für Sibirien unikales Objekt. Der Bau des Zentrums für Ozeanografie und Meeresbiologie „Delfinija“ begann im Nowosibirsker Zoo auf Initiative von Rostislaw Schilo. Erstmals wurde hinter dem Ural in einer beträchtlichen Entfernung von Meeren und Ozeanen ein großangelegtes Projekt eines hochtechnologischen ganzjährigen stationären ozeanografischen Wissenschafts- und Bildungskomplexes errichtet.
21. Dez. 2016: Online-Übertragung aus dem Nowosibirsker Zoo über eine Million Mal gesehen. Populärster Bewohner des Zoos wurde der junge Eisbär Rostik, der im Dezember 2015 geboren und nach dem ehemaligen Direktor benannt wurde. Die Übertragungen von sechs Webcams im Nowosibirsker Zoo wurden im Jahr 2016 über eine Million Mal angeklickt.
21. Dez. 2016: Zoo kaufte Kleinen Mara und Marco-Polo-Schaf. Der Nowosibirsker Zoo kaufte bei seinen Moskauer Kollegen sechs neue Tiere. Bis 30. Juni 2017 sollen in den Zoo kommen: ein Marco-Polo-Schaf, ein Kleiner Mara, ein Sibirischer Steinbock, zwei Meergänse – eine Weißwangengans und eine Aleuten-Zwergkanadagans, sowie ein Rautenpython. „Die Ware soll gesund sein, ohne äußere physische Mängel“, heißt es in den Vertragsbedingungen. Die Nowosibirsker schlossen den Vertrag über 3.780 Euro mit dem einzigen Lieferanten – dem Moskauer Staatlichen Zoopark.
5. Dez. 2016: Zoo Nowosibirsk bekam seltene Hühner Im Streichelzoo trafen seltene Hühner ein – Paduaner Haubenhühner, ein Hahn und eine Henne.
1. Dez. 2016: Schneeweiße und gehörnte Zicklein wurden im Zoo Nowosibirsk geboren. Ein seltenes Ereignis: es wurden gleich zwei junge Schneeziegen geboren. Gewöhnlich besteht der Nachwuchs bei diesen Tieren aus nicht mehr als einem Zicklein.
1. Dez. 2016: Guereza aus Nowosibirsk zog um nach China. Er lebt jetzt im chinesischen Nanchang. Der Affe ist herangewachsen und bereit zur Gründung einer Familie.
1. Dez. 2016: Ergänzung für den Tierbestand des Nowosibirsker Zoos: ein Waldhund. Der Zoo Nowosibirsk erhielt aus dem französischen Zoo Mulhouse einen zweijährigen Waldhund. Er wartet jetzt auf ein Weibchen aus dem Prager Zoo.
28. Nov. 2016: Eisbär Kai aus dem Nowosibirsker Zoo bekam kein Geschenk zum Geburtstag. Eisbär Kai aus dem Nowosibirsker Zoo hatte seinen 9. Geburtstag, doch die Verwaltung veranstaltete keinen „Personenkult“, erklärte die Leiterin der Abteilung für wissenschaftliche Information des Nowosibirsker Zoos.
25. Nov. 2016: Zwillingsgeburt bei den Kaiserschnurrbarttamarinen im Zoo Nowosibirsk. Die am 25. Oktober geborenen Jungtiere gehen in die Geschichte ein, denn früher hat sich diese Art in den Zoos der Russländischen Föderation nicht vermehrt.
14. Nov. 2016: Zoo Nowosibirsk bekam Gleithörnchen aus Tschechien. Jetzt befindet sich das einjährige weibliche Riesengleithörnchen in Quarantäne.
2. Nov. 2016: Angeschossener Kranich wurde zur Behandlung in den Zoo gebracht. Ein verletzter sibirischer Graukranich wurde in den Nowosibirsker Zoo gebracht. Jäger hatten den Vogel im Wald gefunden. Ihn zu fangen hatte einige Stunden gedauert. Im Zoo wird er gesund gepflegt, den Winter wird er hier verbringen.
1. Nov. 2016: Nowosibirsker Zoo bekam Fischkatze aus den USA. Im Mai 2016 hatte der Zoo Nowosibirsk vier junge Fischkatzen nach Texas geschickt. Die Länder tauschten Tiere aus im Rahmen eines speziellen Arterhaltungs-Programms.
31. Okt. 2016: Unsere Geschichte. 120. Geburtstag des Gründers des Nowosibirsker Zoos. Maxim Swerew lebte fast 100 Jahre, veröffentlichte 145 Bücher in Millionenauflage, begründete eine ganze Richtung in der Wissenschaft, schuf zwei berühmte Zoos und fügte sein ganzes langes Leben niemandem Schaden zu. Maxim Swerew wurde am 29. Oktober 1896 im Altai geboren und starb im Januar 1996 in Alma-Ata. Man kann nicht sagen, dass sein Lebensweg als Forscher und Schriftsteller auf Rosen gebettet war. Er begann ein Studium am Moskauer Polytechnischen Institut, doch der Erste Weltkrieg war im Gange, der junge Mann wurde einberufen an die Offiziersschule in Alexejewskij. Im Rang eines Fähnrichs verließ Swerjew die Schule. Der Schatten der Offiziersvergangenheit folgte ihm durch alle Stalinjahre, obwohl er an Kampfhandlungen nicht teilnahm und mit der Zeit auf die Seite der Roten Armee übertrat. Mitte des Jahres 1933 bildete sich auf der Basis einer agrobiologischen Station die Westsibirische Regionale Technische und Landwirtschaftliche Station für Kinder. Zu dieser gehörte ein winziger Tiergarten, dessen wissenschaftlicher Leiter Maksim Swerjew wurde – ein Schriftsteller und Wissenschaftler mit passendem Namen [swer = (wildes) Tier]. Am neuen Standort wurde der Zoo wesentlich erweitert. Im Jahr 1935 besaß er 50 Vogelarten, 35 Arten Säugetiere. Die Kinder beobachteten deren Verhalten und Physiologie. Im Jahr 1937 wurde der erste Band Schriften des Nowosibirsker Tiergartens veröffentlicht. Es wurde beschlossen, dem Tiergarten neue Flächen zur Verfügung zu stellen. Und erneut richtete die Geheimpolizei ihre verstärkte Aufmerksamkeit auf die Vergangenheit des ehemaligen Fähnrichs des Zaren. Swerew wurde schon im Januar 1933 verhaftet und zu 10 Jahren Freiheitsentzug verurteilt, doch sein Vorgesetzter, Altaizew, überzeugte die Behörde, dass Swerew der einzige Spezialist ist, der fähig ist, erfolgreich einen Tiergarten zu leiten. Maxim Swerew wurde erlaubt, zu Hause zu wohnen und im Tiergarten zu arbeiten, doch sein Gehalt musste er an den Staat abgeben. Im Jahr 1936 wurde Swerew ganz und gar von der Bestrafung befreit. Doch bald tauchte sein Name wieder auf einer Liste der künftigen Häftlinge auf (die Information sickerte zufällig durch). Maxim Swerew entging neuen Vergeltungsmaßnahmen, indem er aus Nowosibirsk nach Moskau flieht und von dort nach Alma-Ata. Sein weiteres Schicksal ist mit Kasachstan verbunden und der Organisation eines Zoos in Alma-Ata. In Kasachstan ist der Name Maxim Swerew viel besser bekannt als in Nowosibirsk. Seinen Namen trägt dort eine Straße, in der er jahrelang wohnte. [Laut amazon.de erschien im Kinderbuchverlag Berlin 1985 die dritte Auflage von Swerews „Der Wolf aus der Wüste“ und 1986 „Die Schneeleoparden vom Alatau“; „Die Schneeleoparden vom Alatau“ sind laut Katalog der Deutschen Nationalbibliothek 1989 in einer Übersetzung von Dieter Pommerenke in einer ersten Auflage neu erschienen, „Der Wolf aus der Wüste“ erschien 1979 in Hannover bei Schroedel Crüwell sowie in einer Übersetzung von Hans Baumann im Loewes Verlag Bayreuth 1975; 1986 erschien im Verlag „Kasachstan“ Alma-Ata ein Büchlein mit dem Titel „Unerwartete Begegnungen“, von Richard Hartmann aus dem Russischen übersetzt – d. Übers.]
Quelle: Zoopresseschau, Ausgabe 854 vom 15. Januar 2017.
.

Mesopotamischer Dammhirsch im Tierpark Hellbrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2017/Marc Mueller.
.
.
Elefantentransport
To see the elephant“ war früher eine gebräuchliche amerikanische Redewendung, wenn jemand etwas Außergewöhnliches oder Großartiges gesehen hatte. Auch die ersten , die ich hier als kleines Kind im Zirkus und im Zoo sah, haben mich schwer beeindruckt, noch mehr jedoch ein kleiner , den ich als Erwachsener traf. 1966/67 arbeitete ich im Bremer Tierpark des indischen Großtierhändlers George Munro – als Übersetzer und Aushilfstierpfleger. In dieser Zeit wurde einmal die Ankunft eines neuen Elefanten angekündigt. Zum Tierpark gehörte ein Elefantenhaus, in dem bereits vier noch nicht ausgewachsene indische Elefanten standen. Sie hatten auch noch ein Außengehege, nachts wurden sie von einem indischen Elefantenpfleger nebeneinander angekettet.
.
Der neue Elefant kam in einer Kiste auf einem Lastwagen an, um den sich eine Traube Menschen versammelt hatte – Journalisten, Besucher und Pfleger. Ich stand abseits und sah wegen der vielen Leute die Transportkiste nicht. Als man sie auf die Erde setzte und die Kiste öffnete, auch nicht den Elefanten. Da trompetete einer der Elefanten im Elefantenhaus. Der neuangekommene antwortete und lief schnaufend in seine Richtung, zwei Pfleger, die ihn mit dicken Tauen hielten, hinter sich herschleifend. Die Menschenmenge machte erschrocken Platz. Der Elefant war nicht viel größer als eine Dogge, aber sehr viel kompakter und kräftiger. Nachdem er sich im Elefantenhaus mit den vier anderen Elefanten bekannt gemacht hatte, gehörte er schon bald zu ihrer Gruppe, er wurde jedoch, weil er noch so klein war, Nachts nicht angekettet. Die Sparkasse spendete kurz darauf dem Tierpark eine riesige Palme. Sie wurde feierlich im Elefantenhaus aufgestellt. Aber schon in der darauffolgenden Nacht hatte der kleine Elefant sie mit seinem Rüssel zu sich gezerrt und völlig zerfetzt. Das gleiche passierte einige Wochen später mit einer freistehenden Voliere aus Kükendraht, in dem sich etwa 100 Webervögel befanden: Der kleine Elefant zerlegte sie ebenfalls in einer Nacht. Die Vögel flüchteten unter das hohe Dach des Elefantenhauses, es gelang uns nicht, sie wieder einzufangen. In den darauffolgenden Tagen fiel einer nach dem anderen vor Durst und Erschöpfung tot zu Boden. Ich war wütend auf den kleinen Elefanten, denn ich hatte die Voliere gebaut, deswegen stieg ich über die Abtrennung vom Publikumsbereich und haute ihm mit der flachen Hand auf den Hintern. Es hallte im ganzen Elefantenhaus. Der kleine Elefant lief erst zu den anderen großen, die angekettet waren, drehte sich dann aber um und rannte auf mich zu, der ich mich hinter eine Säule stellte, das nützte aber nichts, er verfolgte mich so lange, bis er mit seiner Stirn gegen meinen Hintern stieß. Daraus entwickelten wir in der darauffolgenden Zeit ein Spiel: Erst lief er weg, und ich versuchte ihm mit der Hand auf den Hintern zu hauen und dann lief er hinter mir her, um mich zu rammen.
.
Der Tierparkdirektor verkaufte dann einen der vier großen Elefanten nach Ostberlin – und ich sollte den Transport begleiten, zusammen mit einem der indischen Tierpfleger, Cholaf. Mein Chef machte oft Geschäfte mit dem Osten. Sie liefen über Verrechnungseinheiten – so kostete ein indischer Elefant z.B. zwei sibirische Tiger – in Leipzig gezüchtete. Der Elefant ließ sich willig auf einen LKW verladen und dann in einen auf dem Bremer Güterbahnhof stehenden geräumigen Waggon führen, wo man ihn ankettete. Ich einer Ecke wurde Heu und Stroh gestapelt. Wir gingen von einer etwa achtstündigen Fahrt aus. Erst kurz vor der Abfahrt erfuhr ich von einem Bahnbeamten, dass die Fahrt drei Tage dauern würde: zu spät, ich hatte nur ein paar Schokoriegel zum Essen mit, Cholaf gar nichts. Der Chef drückte mir ein paar hundert Mark in die Hand. Der Güterzug hielt alle paar Kilometer, weil er einen Personenzug vorbei lassen mußte oder umgekoppelt wurde. Einige Waggons hängte man ab, andere wurden angekoppelt. Bei jedem Halt versuchte ich mit einem Eimer erst einmal frisches Wasser für den Elefanten zu besorgen, wobei ich ständig befürchten mußte, unseren Waggon anschließend nicht mehr wieder zu finden – sie wurden ständig umrangiert. Noch schwieriger als das Wasserholen gestaltet sich das Essenbesorgen. Zum Glück gaben uns der Lokführer und sein Assisstent einige ihrer von zu Hause mitgebrachten Butterbrote.
.
Wir schliefen neben dem Elefanten auf Heu und wuschen uns die ganze Zeit nicht. An der DDR-Grenze wechselten die Zugführer. Bevor es weiter ging, besuchten der neue uns erst einmal im Waggon, wo er die stoische Ruhe des Elefanten bewunderten. Dann lud er mich auf seine Lok ein. Beim nächsten Halt stieg ich zu ihm. Mit Cholaf konnte ich mich so gut wie gar nicht unterhalten und zu lesen hatte ich auch nichts mitgenommen. Der Lokomotivführer tauschte seine Zigaretten gegen meine. Er erzählte mir lustige DDR- und Reichsbahn-Geschichten, ich ihm traurige Tiergeschichten aus dem Zoo. Die Fahrt zehrte an meinen Nerven, außerdem stellte ich mir unsere Nahrungsmittelversorgung in der DDR noch schwieriger vor als im Westen, nicht einmal Ostgeld besaß ich. Der Lokomotivführer tauschte mir fünfzig DM zum „Freundschaftskurs“ von 1:1 ein.
.
Beim nächsten Rangierpunkt wurden drei Waggons mit Pferden an unseren Waggon gehängt. Es waren die letzten Arbeitspferde der LPGen, Sie waren durch Traktoren ersetzt worden und nun ebenfalls für den Ostberliner Tierpark bestimmt – für die Raubtiere dort. Der Tierpark in Friedrichsfelde, so erfuhr ich, sei der flächenmäßig größte der Welt und das Raubtierhaus, die Alfred- Brehm-Halle, besonders üppig dimensioniert. Die etwa 60 Pferde, Maultiere und Esel wurden auf ihrer letzten Fahrt von einem alten Mann begleitet, der seine Tiere, die er zuvor überall in der DDR eingesammelt hatte, noch einmal ordentlich verwöhnte: sie bekamen Hafer und Heu so viel sie wollten und standen buchstäblich bis zum Bauch im Stroh. Unsere Waggons sollten am Bahnhof Lichtenberg ankommen, von dort wollte man uns mit Lastwagen abholen.
.
Kurz vor Berlin gerieten wir jedoch bei einem neuerlichen Rangiergeschehen an die falsche Lok und fuhren in Richtung Norden. Erst kurz hinter Oranienburg hielt der Zug und gelang es mir, den Lokomotivführer von der Fehlzusammenstellung seines Zuges zu überzeugen. Beim nächsten Halt wurden Pferde und Elefanten abgekoppelt und wir mußten erneut endlos warten, wieder und wieder wurden wir umrangiert. Dem alten Pferdebegleiter war es egal: „So leben meine Tiere noch eine Weile länger,” meinte er. Schließlich setzte sich der Güterzug aber doch in Richtung Bahnhof Lichtenberg in Bewegung. Ich stieg bei dem bärtigen alten Mann in den Pferde-Waggon. Weil er schon seit Jahren so unterwegs war, hatte er es weitaus gemütlicher als wir in unserem Elefanten-Waggon. Außerdem war es bei den Pferden wärmer und roch besser. Er erzählte vor allem Pferdegeschichten – und bedauerte seine Pferde sehr, die Raubkatzen lehnte er dagegen ab: „Die gehören nicht hierher!” Außerdem hätten sie nicht so ein langes verdienstvolles Arbeitsleben wie die Pferde hinter sich, lägen bloß faul herum und langweilten sich zu Tode. Um sich mit dem Pferdeeinsammler unterhalten zu können, mußte man hinter ihm herlaufen, weil er unentwegt damit beschäftigt war, irgendetwas für seine Tiere zu tun. Dabei redete er die ganze Zeit mit ihnen. Seine drei Waggons hatten elektrisches Licht, während es in unserem völlig dunkel war, so daß wir die Waggontür immer ein bißchen offen ließen, wodurch jedoch die Kälte hereinkam. Außerdem waren Cholaf und der Elefant so gut wie stumm. Manchmal machten sie den Eindruck, als hätte man gemeinerweise zwei völlig unschuldige Inder auf den Weg nach Sibirien geschickt. Ich war mir fast sicher, daß die beiden ihr Schicksal inzwischen bedauerten. Cholaf wurde immer dunkelhäutiger im Gesicht und der Elefant immer blasser, fragend wiegte er seinen Kopf hin und her. Wir verstanden uns, konnten aber nur wenig mehr füreinander tun, als weiter höflich und freundlich zueinander zu sein.
.
In Lichtenberg wurden wir nicht mehr erwartet, als wir endlich Nachts ankamen. Ich mußte umständlich im Bahnhof jemanden bitten, beim Tierpark anzurufen. Aber dann ging alles wie der Blitz. Cholaf und ich wurden ins Gästehaus des Tierparks gebracht, wo wir uns erst einmal waschen und umziehen sollten. Anschließend wartete bereits ein Essen auf uns in einem der Tierpark-Restaurants. Dann zeigte man uns kurz das Gelände. Der Elefant war in der Zwischenzeit bereits in das Elefantenhaus gebracht worden, wo die anderen Tiere ihn aus einiger Entfernung in seiner Einzelbox aufgeregt begrüßten. Nachdem wir uns von ihm verabschiedet hatten, sanken Cholaf und ich todmüde in die frischen Betten des Gästehauses.
.
Als ich am nächsten Morgen den Elefant sozusagen offiziell übergab – im Büro, bot uns die Tierparkleitung an, zwei Tage länger als geplant zu bleiben, damit wir uns erholen konnten. Für den Abend lud uns einer der Elefantenpfleger zu sich nach Hause ein. Er und seine Frau hatten eine kleine Party für uns organisiert – mit noch anderen Tierpflegern. Ich tanzte zu fortgeschrittener Stunden mit einer attraktiven Menschenaffen-Pflegerin auf dem Wohnzimmerteppich.
.
Nach dem Frühstück spazierten Cholaf und ich durch den Zoo und sahen dabei noch einmal nach unserem Elefanten: Er schien mit seinen neuen Mitgefangenen auszukommen und umgekehrt auch. Als wir ihn von der Zuschauerseite aus beobachteten, war gerade der Pfleger mit den Elefanten beschäftigt: auch mit ihm schien sich unser Elefant abzufinden. Wenngleich er noch ein bißchen nervös wirkte. Ansonsten schien er diesen elenden Transport gut überstanden zu haben. Am nächsten Tag mußten wir wieder zurück nach Bremen fahren, diesmal in einem Personenzug.
.
Heute wird bei Elefantentransporten ein Riesenaufwand betrieben – mit Veterinärarzt, Beruhigungsspritzen, Spezialwaggons etc.. Die Elefanten in den europäischen Zoos sind quasi ständig unterwegs. Besonders die männlichen, um die weiblichen in den vielen Zoos zu schwängern, die keinen der als gefährlich geltenden Bullen halten. Überhaupt bemüht man sich hier aus versicherungstechnischen Gründen um immer mehr Distanz zu den Tieren. Die bis heute im Ostberliner Tierpark praktizierte Elefantenhaltung nennt sich „hands on Haltung“, also mit direktem Kontakt, die andere – z.B. in Köln praktizierte heißt „protected contact“ (pc). Dabei bleiben die Pfleger stets durch Schutzgitter vom Tier getrennt. Viele Zoomanager hoffen laut dem berühmten Zürcher Elefantenpfleger Ruedi Tanner, „dass mit dem Geschützten Kontakt die selbstbewußten Elefantenpfleger durch ‚Einheitstierpfleger‘ ersetzt werden“ – für die die Arbeit mit Elefanten nur noch ein „Job“ ist – „mit Ferien und Feierabend“. Für den Schriftsteller John Berger ist der Zoo sowieso bereits Ausdruck der totalen Trennung zwischen Tieren und Menschen, schrieb er 2005 in seinem Aufsatz „Warum sehen wir Tiere an“.
.
In Indien ist der Umgang nicht nur mit Elefanten, mit denen gearbeitet wird, über die Jahrtausende sehr viel selbstverständlicher geworden. Und sowieso geht man dort quasi buddhistischer mit Tieren um. Deswegen fand George Munro, der neben dem Bremer Zoo noch eine Tierstation in Kalkutta besaß, auch nichts dabei, uns Unerfahrene (Cholaf war kein Elefantenpfleger und ich erst recht nicht) auf die Reise zu schicken – ohne Instruktionen und Proviant. Aber wir haben uns auch nichts dabei gedacht.
.
.

Asiatische Elefanten im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016.
.
.
Flamingos
„Flamingos gehören zu den beliebtesten Pfleglingen in Tiergärten,“ teilt der Verband der Zoodirektoren mit. Diese Wasservögel sind wegen ihres rosa- bis purpurroten Gefieders und ihres eigentümlichen Schnabels auch die am Häufigsten photographierten Zootiere. An ihren natürlichen Standorten, in Indien und Florida z.B., finden seit vielen Jahren schon „Pink Flamingo Festivals“ statt, das Lied von Manfred Manns „Earth-Band“ „Pretty Flamingo“ wurde weltweit ein Hit. Auf den heutigen Musikfestivals abseits ihrer Standorte erfreuen sich „Pink Flamingo Rave Outfits“ (mit vielen rosa Puscheln) großer Beliebtheit, und in den USA stellt man sich statt Gartenzwerge leuchtende Flamingos in den Garten, auch in den dortigen Schwulenbars sind sie beliebt. Die FAZ widmete ihrem „Erfinder“ Donald Featherstone 2015 einen Nachruf.
.
In Berlin gibt es etliche Lokale mit Namen „Pink ‚Flamingo“ (u.a. eine Bio-Pizzeria). Hier hat man aber noch keine wild lebenden Flamingos gesichtet, wohl aber in Frankreich, Spanien, auf Sizilien und seltsamerweise in einem Moor bei Münster. Vielleicht sind es Zooflamingos, denen mit quasi heimlich nachgewachsenen Flügeln die Flucht gelang, Flamingos sind nicht besonders kälteempfindlich, obwohl sie aus den warmen und sogar heißen Zonen stammen. „Tatsächlich bevölkern sie eines der rauhesten Habitate der Erde – seichte hypersaline Seen. Nur wenige Lebewesen vermögen die ungünstigen Bedingungen in der Nähe von Salzwüsten zu ertragen. Da Konkurrenten fehlen, können diejenigen, die hier gedeihen, , unglaublich große Populationen aufbauen,“ schreibt der amerikanische Wissenshistoriker Stephen Jay Gould (in: „Das Lächeln des Flamingos“).
.
Im Charlottenburger Zoologischen Garten lebt ein Flamingo, der 68 Jahre alt ist, eines der ältesten Zootiere in Deutschland, er wurde 1948 in Freiheit geboren, dann eingefangen und über Kairo nach Berlin gebracht, wie man erst vor einiger Zeit anhand seines Fußringes herausfand.
.
In dem 1955 eröffneten Tierpark Friedrichsfelde, wo es eine „Flamingo-Bar“ für Sommernachts-Events gibt, wurde 1967 eine Lagune am Kamelgehege für die Flamingos geschaffen, in der sie sich schon bald Schlammkegel bauten, auf denen sie dann auch brüteten. In diesem Jahr schlüpften dort bereits neun Junge, hieß es Anfang August.
.
„So lieblich uns diese Vögel dünken, so gehässig und zänkisch verhalten sie sich gegeneinander,“ schrieb die erste Nachkriegs-Direktorin des Charlottenburger Zoos Katharina Heinroth im Tagesspiegel 1956. Auf einem Youtube-Clip „Zickenkrieg unter den Flamingos“ – über die Brutkolonie im Friedrichsfelder Tierpark – kann man sehen und hören, dass das noch immer der Fall ist. Desungeachtet bleiben sie stets im Schwarm zusammen. Auch ihre Schönheit entfalten sie eigentlich erst im Schwarmflug, der ihnen jedoch in den Zoos verwehrt wird.
.
Die meisten Flamingos leben im flachen Brackwasser, wo sie sich – ebenso wie in den Lagunen von Salzseen – von Kleinkrebsen ernähren, die sie sozusagen auf dem Kopf stehend mit ihrem Schnabel aus dem flachen Wasser seihen. Dazu haben sie eine fleischige Zunge, die wie eine Pumpe das Wasser ansaugt und und durch den gezahnten Schnabel, der wie ein Filter wirkt, zurückdrückt, so dass die Krebschen und Larven hängen bleiben. Das Prinzip ähnelt dem der Wale, die den Krill, ebenfalls Kleinkrebse, mit ihren sogenannten Barten sammeln. Stephen Jay Gould weist ferner daraufhin, dass bei ihnen, anders als bei allen anderen Vögeln (und auch bei uns), der Oberkiefer beweglich ist und der Unterkiefer festgewachsen, was jedoch, da sie mit dem Kopf nach unten „fischen“, auf das selbe rauskommt.
.
Vor 2000 Jahren wären die Flamingos beinahe ausgestorben, weil die römischen Oberschichten eine Vorliebe für frisch zubereitete Flamingozungen entwickelten. Seit fast ebenso langer Zeit beschäftigt diese Zunge und der Schnabel aber auch die Naturforscher. Während der Französischen Revolution kam es darüber zu einem Streit zwischen dem Zoologen Etienne Geoffroy Saint-Hilaire und dem „Biologie“-Begründer Jean Baptiste Lamarck. Es ging den beiden Entwicklungsforschern dabei um die Frage: Folgt die Funktion der Form oder die Form der Funktion? Diese Frage kann man sich auch heute noch stellen, die Darwinisten haben sich für Letzteres entschieden, ebenso einige Bildhauer im 19. Jahrhundert, denen dann die Architekten einige Jahrzehnte lang folgten.
.
Die in Gefangenschaft gehaltenen Flamingos (im Friedrichsfelder Tierpark, wo der Fuchs einige riß – zwar im Freien, aber mit gestutzten Flügeln,) wurden alle nach einiger Zeit weiß – als Folge eines Ernährungsmangels. – Bis der Schweizer Pharmakonzern Hoffmann-La-Roche 1956 eine künstliche Karotin-Variante entwickelte, die dann auch gleich bei den Flamingos im Basler Zoo ausprobiert wurde. 1958 schlüpfte der erste Chile-Flamingo, seit 1963 gibt es dort eine Wissenschaftlerin, die ausschließlich Zooflamingos und spanische Rosaflamingos erforscht. Es gibt wohl sechs verschiedene Flamingo-Arten auf der Welt, alle sind einander ähnlich und vertragen sich, verpaaren sich gelegentlich sogar.
.
Das flammendste Rot haben die Kubaflamingos, von denen eine größere Kolonie im Friedrichsfelder Tierpark lebt. Die Zoopresseschau meldet – aus dem Tierpark von Almaty in Kasachstan: „‚In einem der Naturreservate Kubas gibt es eine Zuchtstation, wo Flamingos gezüchtet werden‘, erklärte die Zootechnikerin, ‚dort hat man sich bereit erklärt, speziell für unseren Zoo eine neue Gruppe aufzuziehen. Doch die ausländischen Kollegen stellten Bedingungen: Für die 20 ‚paradiesischen‘ Vögel sollten wie paradiesische Bedingungen schaffen. Früher gab es hier nur drei Rosaflamingos, die keinen Nachwuchs bekommen konnten, weil sie so wenige waren, außerdem ließen die Haltungsbedingungen Besseres zu wünschen übrig‘.“
.
Eine weitere Zoomeldung kommt aus dem Tierpark von Ishewsk im Ural: Dort werden gerade von Einwohnern Udmurtiens gerettete Rosaflamingos gezeigt.“ Wahrscheinlich hatten die Vögel sich verflogen und drohten nun beim Übernachten in flachen Gewässern im Eis einzufrieren (das droht ihnen mitunter auch in den Freigehegen, mindestens der nordischen Zoos). Flamingos können ausdauernd fliegen. Im März 2016 flog ein Zwergflamingo 2350 Kilometer weit von Madagaskar über den Indischen Ozean nach Südafrika.
.
Es gibt noch eine Besonderheit, die die Flamingos mit den Tauben teilen: Sie füttern ihre Jungen nicht mit zerkauten Kleinstlebewesen (bzw. Pflanzenteilen), sondern mit „Kropfmilch“, das sie im Magen-Darmtrakt herstellen, hinzu kommt ein wenig Blut, so dass ihre „Milch“ rot gefärbt ist.
.
Bei den Flamingos brüten Männchen und Weibchen. Für ein Single-sucht-Single-Event im Hamburger Tierpark Hagenbeck heißt es in der Ankündigung: „Flamingos gelten als ‚feinfühlige Liebesvögel‘, ihr leuchtend rosa Gefieder erhöht den Symbolwert. Klar, dass die Plakate zu den ‚Romantik-Nächten‘ bei Hagenbeck immer ein Flamingopärchen ziert. Es gibt drei Nächte (13., 20. und 27.8.) mit klassischer Musik vor den Tiergehegen, kulinarischen Köstlichkeiten, zum Abschluss ein stimmungsvolles bengalisches Feuerwerk.“ Und die Flamingos können drei Nächte lang nicht schlafen, schreien die ganze Nacht rum und nerven die anderen Tiere.
.
.

Elch im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2017 Marc Mueller.
.
.
Flöhe
„Die Flöhe sind seit langer Zeit Gegenstand der verschiedenartigsten Untersuchungen gewesen: man hat sie vom philologischen und vom satirischen Standpunkte aus beleuchtet, man hat sie wegen ihrer lustigen Sprünge besungen und noch häufiger wegen ihres Blutdurstes verwünscht, man hat sie ‚abgerichtet‚ und so aus ihnen Gewinn zu ziehen gewußt, nur gerade der Zoologe hat ihnen bisher nicht in der gebührenden Weise seine Beachtung geschenkt,“ schrieb der Parasitologe E. O.Taschenberg 1880. Der derzeitige Wissensstand über die hiesigen Flöhe basiert in erster Linie auf den ökologisch-faunistischen Arbeiten von Peus (zuletzt 1972), heißt es auf der Internetseite der Frankfurter Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, „ergänzende Arbeiten erschienen danach hauptsächlich für einzelne Bundesländer. Die jüngste faunistische Übersicht für das gesamte Deutschland datiert mit Kutzscher & Striese auf das Jahr 2003.“
.
Der jüngste Flohüberfall geschah im Sommer 2016 in einem Celler Pflegeheim, wo die Bewohner rote Punkte auf der Haut bekamen, die juckten. Die Feuerwehr löste Großalarm aus: Sie riegelte den Ort hermetisch ab – bis die medizinische Hochschule Hannover Entwarnung gab: Flohbisse sind zwar unangenehm aber keine Lebensbedrohung. Das Internetforum „heilpraxis“ erklärte dazu: „Der Speichel des Flohs verhindert, dass das Blut gerinnt. Durch diese Sekrete entzünden sich die Stichstellen und jucken. Wird der Floh gestört, hüpft er ein Stück weiter, so dass die Einstiche sich aneinander reihen“ – meistens sind es wie bei den Wanzenstichen drei. Warum immer drei, weiß kein Mensch! Das Berliner Naturkundemuseum gibt bekannt, seine Flohsammlung umfasse 237 Arten. Im Berliner Tieranatomischen Theater und im Wittstocker Museum des Dreißigjährigen Krieges sah ich Pestflöhe unter dem Mikroskop. Lebend sind diese flügellosen Insekten, die man paradoxerweise zu den „Fluginsekten“ zählt, äußerst selten geworden. Selbst die Flohzirkusse sind fast ausgestorben – bis auf einen, der alljährlich auf dem Oktoberfest gastiert, wo sich die Kinder unter den Besuchern oft darüber entrüsten, dass diese winzigen Tierchen so große Kutschen ziehen müssen.
.
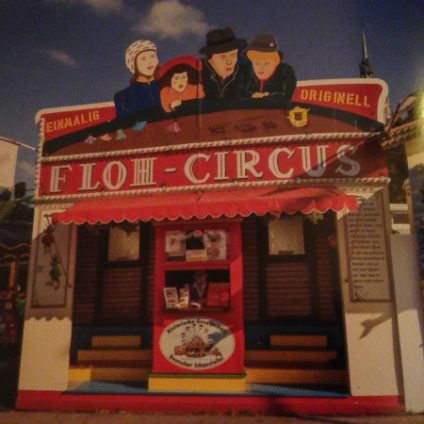
.
Gelegentlich bringen Reisende von „Flohmärkten“ im Ausland einige „Siphonaptera“ mit, sie werden hier aber nicht alt. Die Senckenbergischen Naturforscher erwähnen die „sogenannten Sandflöhe“, die in tropischen Ländern die Füße von Warmblütern befallen und dabei die „Tungiasis“ übertragen. Die Berliner Sandflohforscherin Marlene Thielecke setzte sich dieser Gefahr in Madagaskar und Kenia aus, war aber im Gegensatz zu den Einheimischen dank einer Tetanusspritze geschützt: „Als ich den Floh zufällig entdeckte, hatte er sich schon mit seinem ganzen Körper kopfüber in meine Haut gebohrt. Zuerst war er nur ein winziger roter Punkt in der Mitte meiner Fußsohle. Dann ist er Tag für Tag ein bisschen gewachsen, bis er sich als erbsengroße, druckempfindliche Erhebung abzeichnete: der Sandfloh oder in schlau: Tunga penetrans. Er setzt sich wochenlang fest, am liebsten an Ferse und Spann oder unter den Zehennägeln, um dort seine Eier reifen zu lassen. Eigentlich sollte ich ‚sie‚ sagen, denn das machen nur die Flohweibchen.“ Für die Humanmedizinerin ist die Infektion durch den Sandfloh eine „Armutskrankheit: Damit lässt sich kein Geld machen, also investiert auch die Pharmaindustrie nicht in Forschung und Medikamente. Ich wusste: Hier kann man noch vieles herausfinden und bewirken.“
.
Die US-Ökologen J. F. Masello und P. Quillfeldt fanden in Patagonien unter den Parasiten von Felsensittichen, eine extravagante Flohart, die an den Küken in deren Nasenhöhlen und unter der Zunge parasitiert. Mich haben schon mehrmals Hunde- und Katzen-Flöhe gestochen, aber sie ließen schnell wieder von mir ab. Mein „Lebenssaft“ (Schiller) wirkt bei ihnen empfängnisverhütend, wie die Biologin Lisa Signorile nahelegt, wenn sie schreibt: „Unser Blut stillt ihren Hunger, schmälert aber die Fruchtbarkeit und die Zahl der abgelegten Eier.“ (in: „Mißgeschicke der Evolution“ 2012). Sie fand auf einigen Katzen alle drei Arten: Katzen-, Hunde- und Menschenflöhe. „Unsere“ sind mit den Schweineflöhen identisch. Im Wikipedia-Eintrag heißt es, dass „Flöhe zwar Vorlieben für bestimmte Wirtstiere haben, aber nicht ausschließlich auf diese angewiesen sind. Vielmehr scheinen sie eine größere Bindung zu ihren Nestern zu haben als zu ihren Wirten.“ Und die „Nester“ finden sie außerhalb ihrer Wirte (in Polstermöbeln z.B.), was deren Domestikation und Seßhaft-Werdung geschuldet ist: Ihre Wirte laufen ihnen nicht weg. Als diese noch nomadische Viehzüchter waren, mußten die Flöhe in ihrer Kleidung bzw. im Fell ihrer Tiere mitwandern.
.
Für alle gilt, dass sie das Blut von jungen Warmblütern besonders bekömmlich finden, denn sie dringen mit ihrem zu einem Stechrüssel umgewandelten Mund leichter durch deren noch dünne Haut. In einer Hamburger Schule für Körperbehinderte bewiesen sie 2005, dass sie auch zählen können: Über 100 Flohweibchen überfielen wie ausgehungert 110 Schüler dort, die dann von der verzweifelten Schulleitung nach Hause geschickt wurden. Ein Sprecher der Bildungsbehörde versicherte: „Ein Befall in diesem Ausmaß ist sehr ungewöhnlich – zumal im November“. Außerdem wurden zwar jede Menge Flohstiche identifiziert, aber kein einziger Floh gefunden. Man forderte daraufhin die Eltern auf, bei sich zu Hause nach den Tieren zu fahnden. Meist ruft man heute bei Flohalarm den US-Weltkonzern „Rentokil“ – danach traut sich lange Zeit kein Floh mehr in das Gebäude. 1998 demonstrierten die ostdeutschen Kammerjäger in Berlin gegen diese ausländische Konkurrenz, die ihren „Lehrberuf“ entwertete, indem sie straflos ungelernte Ungeziefervernichter einstellte.
.
Einer ihrer „Außendienstmitarbeiter“ erzählte mir, als ich das Gespräch auf Flöhe brachte: „Man kann sie kaum zerdrücken, sie haben einen sehr harten Chitinpanzer, man muß sie mit dem Fingernagel zerknacken. Und erst mal fangen. Sie können in Bruchteilen einer Sekunde losspringen – 30 Zentimeter weit, und das ununterbrochen: tagelang. Ihre Sprünge werden durch die umfunktionierten Flugmuskeln ausgelöst… Aber gegen unsere chemischen Mittel nützt ihnen das alles nichts.“ Auch im Internet erfährt man eher was über das Wie und Womit ihrer Vernichtung, als über das, was sie sonst so treiben. Aber so ist das immer in Deutschland: Wenn man über Parasiten spricht, geht es stets um deren „Bekämpfung“, in Frankreich vermutet man hingegen erst einmal, dass „parasitäre Verhältnisse das System selbst sind,“ wie der Philosoph Michel Serres es ausdrückte. Er scheint ein ähnlich sympathisierendes Verhältnis zu Flöhen zu haben wie ich. Zum einen nannte meine erste Freundin mich „Floh“ und zum anderen besaß ich ein Aquarium und mußte für die Fische laufend Wasserflöhe fangen. Sie hüpften auch unter Wasser und erfreuten mich mit ihrer Munterkeit. Ein Gymnasiast in Ratingen, Lukas Schier, hat unlängst entdeckt, dass sie mit Kaffee noch munterer werden: „Sie hören gar nicht mehr auf, sich zu paaren,“ berichtete er der „Westdeutschen Zeitung“. Die Haustier- und Menschen-Flöhe auch so nicht: „Unter einer halben Stunde ist die Verpaarung nicht fruchtbar,“ meint Lisa Signorile, nicht zuletzt, weil die männlichen Flöhe „die komplexesten Genitalien des gesamten Tierreichs“ haben, und sowieso müssen beide vorher eine anständige „Blutmahlzeit zu sich genommen haben“ – sonst läuft gar nichts.
.
.

Przewalskipferde und Trampeltiere im Tierpark Hellabrunn. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
.
Gobibär
Man weiß nicht, ob die Absicht der mongolischen Regierung, 2013 zum „Jahr des Gobibären“ zu erklären die internationale Gobibärforschung befördert hat oder ob es umgekehrt war. Fest steht, dass wir heute mehr über den seltenen Gobibär wissen als noch vor einigen Jahren: U.a. dass es nur noch 20 bis 60 Exemplare dieses Tieres gibt, das von den Mongolen Mazaalai genannt wird. Sie leben in drei Gebirgszügen der westlichsten Ausläufer der Wüste Gobi – in der nahezu menschenleeren Umgebung der Oasen Baruun Tooroi und Shar Khulsny Bulag. Wegen der Wasserarmut und der unwirtlichen Landschaft finden selbst die genügsamen Ziegen in diesem Gebiet kaum genügend Nahrung zum Überleben. Eine russische Theorie besagt, dass die Tierart als Relikt aus der Borealzeit zu werten ist. Damals herrschten in der Gobi völlig andere Lebensbedingungen. Es gab große Wälder ähnlich der heutigen großen Taigawälder in Sibirien oder der Nordmongolei und das Klima war wärmer und feuchter.
.
Bei dem Gobibär handelt es sich um eine kleine Form des Braunbären, die heute den zentralasiatischen Isabellbären zugerechnet wird. Diese Bezeichnung bezieht sich auf ihr „isabellfarbenes“ Fell, was auf Isabella von Kastilien zurückgeht. Sie gelobte 1601, dass sie ihr weißes Hemd nicht eher wechseln wolle bis ihr Mann, Albrecht VII. von Habsburg, die Stadt Ostende, die er belagerte, erobert habe. Da die Belagerung drei Jahre, drei Monate und drei Tage dauerte, sah ihr Hemd entsprechend aus.
.
Auf „gobibaer.de“ heißt es, dass die „rotbraunen bis sandfarbenen“ Tiere erstmalig um 1900 von zwei russischen Botanikern entdeckt wurde, in ihrem „Feldtagebuch“ notierten sie: „Heute haben wir in den nördlichen Vorgebirgen des Cagan-Bogdo in einem trockenen und breiten Sajr… endlich einen Gobibären zu sehen bekommen. Er lief ohne Hast den Grund des Tales entlang, dunkelbraun, mit Fetzen von längerem und hellerem Haar, das nach dem Haarwechsel an dem dunkelbraunen Pelz hing. Der Bär beschnupperte etwas, war anscheinend auf der Suche nach Nahrung.“
.
1943 bestätigte ein mongolisch-sowjetisches Forschungsteam ihre Beobachtungen, 1953 gelang es lokalen Wissenschaftlern, ein Jagdverbot für den Gobibären durchzusetzen, 1975 wurde sein Verbreitungsgebiet in einer Größe von 52.000 Quadratkilometern zum Naturschutzgebiet erklärt: „Great Gobi Strictly Protected Area (GGSPA) heute genannt. Dass die kleine Population dennoch weiter abnahm, führen Gobibärforscher auf die Klimaerwärmung zurück, was die dort ohnehin sehr geringen Wasservorkommen weiter verringert. Vertreter der „National Commission for Conservation of Endangered Species“ der Mongolei erwägen eine regelmäßige Zufütterung sowie ihre Züchtung in Gefangenschaft. Der amerikanische Bärenforscher Harry Reynolds, der bereits 2005 zusammen mit kanadischen Biologen ein „Mongolian-American Gobi Bear Project research program“ initiierte, meint jedoch: „Das Wichtigste ist, sie in Ruhe zu lassen. Ihre Lebensweise ist derart prekär, dass die kleinste Störung ihr völliges Aussterben bewirken kann. Sie haben jedoch bewiesen, dass sie sich an extreme Lebensbedingungen anpassen können.“
.
Der ehemalige mongolische Umweltminister Damdin Tsogtbaatar sieht in den Anstrengungen zum Schutz des Gobibären, die ihren Ausdruck u.a. im „Jahr des Gobibären“ finden, ein Beispiel für einen anderen Umgang mit Tierarten, die wir an den Rand des Aussterbens gebracht haben. Das beinhaltet, dass es die Menschen (Jäger) waren, die die Gobibär-Population derart reduzierten. Der Umweltminister erinnerte in diesem Zusammenhang an die wilden Przewalski-Pferde, die in den Sechzigerjahren in der Mongolei ausgerottet wurden. Nur 12 überlebten – in europäischen Zoos, von wo aus ihre Nachkommen in den Neunzigerjahren wieder in der mongolischen Steppe ausgewildert wurden.
.
Beim Gobibär halten sich die direkten Beobachtungen bis heute in Grenzen. Es existieren nur wenige Fotos und seit 2004 ein bißchen Filmmaterial – als es gelang, Aufnahmen mit einer automatischen Kamera zu machen. Die sichersten Nachweise lieferte ein amerikanischer Genetiker in den achtziger Jahren, der durch das Auslegen von Drähten an vorher eingerichteten Futterstellen Haare gewinnen konnte. Leider war es aber auch damals nicht möglich, die Tiere direkt zu beobachten. Genetische Untersuchungen erbrachten jedoch einen Beweis dafür, dass es sich um eine eigene Tierart handelt. Zweifelsfrei konnten 13 verschiedene Individuen identifiziert werden.
.
Über die Lebensweise dieser Tiere ist noch immer so gut wie nichts bekannt. „Man weiß nicht zweifelsfrei, ob die Bären tag- oder nachtaktiv sind, wo sie überwintern, ob sie in Gruppen leben oder Einzelgänger sind. Selbst über die Ernährungsweise herrscht Uneinigkeit. Während russische Zoologen von einem sich überwiegend von Fleisch ernährendem Tier ausgehen, sehen mongolische Forscher den Gobibären als Pflanzenfresser, welcher als Hauptnahrung Bajuun-Wurzeln (dt. Kleiner Rhabarber, lat. Rheum nanum) im Frühjahr, ansonsten Beeren und andere Pflanzen zu sich nimmt.“ Dieser wilde Rhabarber war einst auch ein begehrtes Nahrungsmittel am Hof von Tamerlan in Samarkand.
.
Die Internetseite „gobibaer.de“ wird vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern geführt, dieser finanzierte auch ein „Schutz- und Informationszentrum für den Gobibären in der Mongolei“, das 2012 eröffnet wurde – zusammen mit der Nationalen Universität der Mongolei in Ulaanbaatar und der Schutzgebietsverwaltung des Großgobi-Naturschutzgebietes, Bayuntooroi.
.
„Von diesem Zentrum aus sollen konkrete Schutzmaßnahmen zum Erhalt des höchst bedrohten Gobibären gestartet werden.“ Im Vorfeld hatten die deutschen Gobibärschützer 2008 und 2009 bereits zwei „Expeditionen“ in das Verbreitungsgebiet des Gobibärs unternommen:
.
„Die Expeditionen haben klar gezeigt, dass eine dringende Notwendigkeit besteht, für den Gobibären etwas zu unternehmen. Wir konnten frische Spuren finden, was bedeutet, dass der Bär noch in der Transaltaigobi vorkommt. Wir konnten ferner eine hohe Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung und wichtiger Entscheidungsträger in der Mongolei erfahren. Das sind die Voraussetzungen vor Ort, um eine Station aufbauen zu können, die zum Überleben des Gobibären essentielle Voraussetzung sind.“
.
Bei der Konkretisierung des Projekts waren sich die deutschen und mongolischen Gobibärschützer nicht immer einig: „Wir haben in allen Gesprächen deutlich gemacht, dass es sich bei unserem Projekt um den Schutz des Gobibären in seinem Lebensraum handelt. Etwa 30 km von Bayantooroi entfernt hat eine mongolische Initiative einen anderen Weg zum Erhalt des Gobibären eingeschlagen. Es wurde eine Zuchtanlage gebaut, die aus engen Betonkäfigen bestehen und wo es gelingen soll den gefährdeten Gobibären zu züchten. Dazu sollen wilde Bären gefangen werden und hierher verbracht werden. Da nur wenig über die Biologie der Art überhaupt bekannt ist, die Populationen sehr klein sind und deshalb die Auswirkung von Wildfängen kaum vorhersehbar sind, wird dieses Vorhaben von uns strikt abgelehnt.“
.
P.S.: Um weitere Gelder für das Gobibär-Zentrum zu acquirieren, produzierte der bayrische Landesbund für Vogelschutz e.V. einen Film über den Verlauf seiner zwei Expeditionen: „Mazaalai – Auf den Spuren des Gobibären“, man kann ihn als DVD beim Landesbund für Vogelschutz in Bayern bestellen.
P.P.S.: Auf „reisenmitsinnen.de“ ist 2017 von einer 17-tägigen ECO-Volunteer Reise zum Schutzprojekt „Gobibär “ die Rede: „Hören Sie das zufriedene Brummen? Die Gobi-Bären freuen sich darüber, dass Sie Ihnen Futter bereitstellen. Beitreiben Sie zudem Forschung bei weiten Wanderungen.“ Die zu dieser Aufforderung gezeigten Photos von Gobibären zeigen, dass man von diesem scheuen Tier immer bessere Photos machen kann, seine Fluchtdistanz sich folglich erheblich verringert hat in den 17 Jahren seit Beginn des „Projekts zum Schutz der Gobibären“.
.
.
Braunbär „Olga“ im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Ellinor Fischer.
.
Ausgestopfter Bär im Museum von Nowosibirsk. Photo: Stefanie Peter 2015.
.
.
Fliegen
Insektenforscher werden gerne als „Fliegenbeinzähler“ abgetan. 1948 belegte z.B. der Präsident der Lenin-Akademie für landwirtschaftliche Forschung, Trofim Lyssenko, die mit Fruchtfliegen experimentierenden Genetiker der UDSSR mit diesem Schimpfwort – und sorgte dafür, dass sie alle entlassen wurden. Aber man wußte da schon längst: Fliegen haben sechs Beine. Warum sie sich jedoch selbst in großer Gefahr noch die Zeit nehmen, um sich alle paar Schritte mit ihrem hinteren Beinpaar erst ihre zwei Flügel und dann die Beine zu putzen, das wird tatsächlich seit langem von unzähligen Brachycera-Experten erforscht. Auch ihre vorderen zwei Beine putzen sich die Fliegen ständig, was ihnen, verbunden mit den ruckartigen Laufbewegungen, etwas derartig Nervöses gibt, dass die Forschung darunter leidet.
.
Bei dem vorderen Beinpaar gehen einige Entomologen-Schulen, ähnlich wie viele Erforscher von Bienen, davon aus, dass – wenigstens die gemeine Stubenfliege (musca domestica), die zur Familie der „Echten Fliegen“ zählt – dort ihre wesentlichen Sinnesorgane besitzt. Erst wenn diese etwas Interessantes signalisieren, Zuckerwasser z.B., wird der Kopf runter genommen – mit den „leckend-saugenden Mundwerkzeugen“, wie es im Wikipedia-Eintrag heißt, dessen Autor sich im übrigen der obigen Entmologen-Schule angeschlossen hat, wenn er schreibt: „An den Fußendgliedern besitzen sie Chemorezeptoren, mit deren Hilfe sie Zucker schmecken können.“ Und weiter: „Ihre Eier legen sie in faulenden Stoffen und Exkrementen ab, von denen sich die Larven ernähren. Fliegen leben 6 bis 42 Tage, die Weibchen meist etwas länger. Ihre Fluggeschwindigkeit beträgt ca. 2,9 Meter pro Sekunde (rund 10 km/h).“
.
Andere Entomologen, die man zur Schule des Verhaltensbiologen Konrad Lorenz zählen kann, deuten das nervöse Flügel- und Beinputzen als „Übersprungsverhalten“. Dem liegt die Lorenzsche Annahme zweier entgegengesetzter „Instinkte“ zugrunde: Nahrungssuche (Gier, Angriff) und Flucht, wobei die beiden Triebregungen sich blockieren und die „Energie“ auf ein drittes Verhalten (eben das Putzen) überspringt.
.
Eine weitere Gruppe Entomologen erforscht die Füße, mit denen die Fliege auch auf glatten Flächen Halt findet, für diese Wissenschaftler gilt, dass das Putzen der Beine die Haftfähigkeit der Füße erhöht. Andere Forscher sind von den Augen, besonders der Märzfliege, begeistert. Der holländische Biologe Midas Dekkers schreibt: „Sie sehen aus wie ein runder großer schwarzer Po. Göttlich glänzend und aufreißend stramm, ein Lustobjekt für jeden Entomologen…Bei den Männchen berühren sich die Augen in der Mitte des Kopfes. Bei den Weibchen ist ein Spalt dazwischen. Und wie immer zeigt sich auch hier die Güte Gottes im Detail: Nur bei den Männchen ist die Spalte behaart.“
.
Ja, in so einer gewöhnlichen und für gewöhnlich lästigen Fliege steckt unendlich viel Forschung. Die Fliegenfänger, auf denen sie kleben bleibt und sich langsam zu Tode strampelt, sind deswegen zu Recht mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes verboten worden. Zuvor hatte der Schriftsteller Robert Musil bereits das grausame Sterben auf dem „Fliegenpapier“, wie sein Text hieß, akribisch geschildert. Der Naturforscher Carl von Linné erwähnte in seinem „Vollständigen Natursystem“ Band 1: „Aus Martinique wird ein Fliegenfänger gebracht, der oben braun und unten blaßfärbig ist. Buffon“ Seiner knappen Bemerkung läßt sich dreierlei entnehmen: 1. Der alte Schwede hat sie wohl dem französischen Naturforscher Buffon zu verdanken; 2. Die Erfindung dieses Fliegenfängers stammt aus der Karibik, wo es bedeutend wärmer als hierzulande ist und es deswegen ganzjährig viel mehr Fliegen gibt. Das Verbot klebriger Fliegenfänger bedeutet natürlich nicht, dass man sich der Tiere nicht mehr erwehren oder sie nicht verfolgen darf. Letzteres kann man sogar als die Hauptbeschäftigung der Fliegenforscher bezeichnen.
.
Zu den hartnäckigsten Entomologen der jüngeren Generation zählt der schwedische Schwebfliegenforscher Fredrik Sjöberg, der ein Buch über seine Jagd auf diese Tiere veröffentlichte: „Die Fliegenfalle“ (2008). Er beschränkte sich dabei auf die Arten, die auf einer Insel vor Stockholm vorkommen. Dazu mußte er sie fangen und dann „zu Tode mikroskopieren“, wie der Naturforscher Ernst Haeckel das genannt hat. Über das Schwebfliegen-Buch von Sjöberg heißt es: „Jeder kennt diesen Moment, in dem man sich fragt: Warum mache ich das eigentlich alles‘ Bei Fredrik Sjöberg war er erreicht, als er sich mit einem Lamm im Arm auf den Straßen Stockholms wiederfand. Das Tier sollte bei einer Theateraufführung mitwirken, der Autor war dafür verantwortlich, dem Regisseur jeden Wunsch zu erfüllen. In diesem Moment brach sich eine lange im Verborgenen gereifte Erkenntnis Bahn: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Im darauffolgenden Jahr ließ er sich auf einer Insel nieder und begann eine lang unterdrückte Passion endlich auszuleben: Fliegen zu fangen und ihr Leben zu studieren.“
.
In seinem neuesten Buch, das 2016 auf Deutsch erschien, fragte er sich jedoch schon im Titel: „Wozu macht man das alles?“ Zwar hatte er auf seiner Insel mehr Schwebfliegen-Arten als erwartet entdeckt, und bei einigen handelte es sich sogar um noch unbenannte und verwandtschaftlich noch nicht eingeordnete, d.h. um neue Fliegen quasi (laut WWF gibt es wahrscheinlich noch zigtausend nicht-entdeckte Arten), aber als Lebenswerk war Sjöberg das anscheinend doch zu wenig. Deswegen ist in seinem neuen Buch nun mehr von den zwei großen Natur-Benamern und -Sortierern – Carl von Linné und Charles Darwin die Rede.
.
Bei den Schwebfliegen geht man von 6000 Arten aus. Ihr Charakteristikum ist, dass sie in der Luft auch bei starkem Wind auf der Stelle fliegen können – dann plötzlich zur Seite oder nach vorne schießen und wieder stehen bleiben. Auch dieses Verhalten hat etwas sehr Nervöses. Sie haben laut Wikipedia eine extrem hohe „Flügelschlagfrequenz – bis zu 300 Hertz“. Die Entomologen erforschen die Schwebfliegen jedoch wie gesagt meistens „ruhiggestellt“, d.h. tot auf ihrem Arbeitstisch.
.
Viele Schwebfliegenarten haben ein hummel-, wespen- oder bienenähnliches Aussehen – „angenommen“ sagen die Insektenforscher und sprechen dabei von „Mimikry“. Als Darwinisten gehen sie stets von der Nützlichkeit aus – und die besteht in diesem Mimikry-Fall darin, dass ein harmloses Tier sich einem wehrhaften aus einer ganz anderen Art in Form, Farbe, Geräusch etc. angleicht. Das ist so einleuchtend, dass Woody Allen darüber seinen besten Film gemacht hat: „Zelig“. Dem gegenüber hat die französische Insektenforscherschule um Roger Caillois versucht, die Mimesis von ihrer darwinistischen Verklammerung mit der “Nützlichkeit” zu lösen – und sie als ästhetische Praxis zu begreifen: So versteht Caillois z.B. die falschen Augen auf den Flügeln von Schmetterlingen und Käfern als “magische Praktiken”, die abschrecken und Furcht erregen sollen – genauso wie die “Masken” der so genannten Primitiven. Und die Mimikry ist für ihn überhaupt ein tierisches Pendant zur menschlichen Mode, die man ebenfalls als eine “Maske” bezeichnen könnte – die jedoch eher anziehend als abschreckend wirken soll. Wobei das Übernehmen einer Mode “auf eine undurchsichtige Ansteckung gründet” und sowohl das Verschwinden-Wollen (in der Masse) als auch den Wunsch, darin aufzufallen, beinhaltet. So oder so stellt die Mimikry jedenfalls einen Überschuß der Natur dar.
.
Die Fliegen bilden mitunter schon für sich genommen einen „Überschuß der Natur“. Wobei der deutsche Naturschutzbund jedoch zu bedenken gibt, „dass wir in der Stadt inzwischen eher zu wenig Fliegen haben, worunter vor allem die Vögel, besonders während der Aufzuchtzeit, leiden.“ Das Verbot des „Fliegenklebers“ kam also beinahe zu spät. Überdies sind Öko-Varianten davon auch weiterhin erlaubt, u.a. die „giftfreie, spiralförmige Leimfalle aus natürlichen Rohstoffen“. Die ökologische Schädlingsbekämpfung hat überhaupt in Deutschland eine gewisse Tradition: Schon der Biologe Ernst May widmete sich 1942 als Leiter des „Entomologischen Instituts der Waffen-SS“ am KZ Dachau, das zur „SS-Forschungs- und Lehrgemeinschaft ‚Ahnenerbe’“ gehörte, den Fragen der Fliegenbekämpfung, an der „der Reichsführer-SS ein ganz besonderes Interesse hat,“ wie er dem SS-Obersturmführer Dr. Rudolf Schütrumpf schrieb, der dem Entomologischen Institut zugeteilt worden war. May wollte laut der Biologiehistorikerin Ute Deichmann (in: „Biologen Unter Hitler“) untersuchen, ob sich die Fliegen durch Infektion mit dem Pilz Empusa „naturgemäß-biologisch“ bekämpfen ließen. „Himmler, der alternativen Methoden zur Schädlingsbekämpfung gegenüber sehr aufgeschlossen war, ließ anfragen, ob nicht auch Schlupfwespen gegen Fliegen gezüchtet werden könnten, und er bat May, der Frage nachzugehen, ob nicht die Vernichtung ‚der Fliegen oder der Fliegenbrut‘ durch irgendeine Kurzwellenbestrahlung möglich sei.“
.
.

Inkaseeschwalben im Zoo Rostock. Photo: Zoo Rostock Kloock.
.
.
Haselmäuse
„Eine kleine Haselmaus huscht leide durch die Nacht, huscht leise durch die Nacht/Niemals ist ein Mensch davon je aufgewacht,“ heißt es im „Haselmauslied“. Und das stimmt auch: Das von Nüssen und Früchten sich ernährende Nagetier aus der Familie der Bilche ist wirklich leise – im Gegensatz zu seinem Vetter, den Siebenschläfer, der, wenn er Nachts ins Haus eindringt, „so viel Lärm macht, dass dieser auch einem erwachsenen Menschen, etwa einem Einbrecher, zugeordnet werden könnte und nicht einem so kleinen Tier,“ wie es auf Wikipedia heißt.
.
Beide sind nachtaktiv und halten Winterschlaf, aber die kleinere Haselmaus wird immer seltener, weil der Siebenschläfer sie angeblich vertreibt, sie wurde deswegen jetzt zum gefährdeten „Tier des Jahres 2017“ erklärt. Bereits 2011 hatte sich bei Zittau ein Kongreß von Haselmausforschern aus 24 Ländern dem beliebten Kleintier gewidmet, dass Alfred Brehm als das „niedlichste, anmutigste und behendeste Geschöpf unter allen europäischen Nagetieren“ bezeichnete, welches sich durch „Reinlichkeit, Nettigkeit und Sanftheit des Wesens“ auszeichnet. Es sei zwar schwer, sie zu fangen, aber „hält man sie einmal in der Hand, ist sie auch schon so gut wie gezähmt.“ Wie wir und z.B. die Blaumeise, deren Nester sie bisweilen nutzt, ist die Haselmaus ein „Nesthocker“, d.h. ihre Nachkommen sind anfänglich nackt und hilflos und werden gesäugt. Wenn sie größer sind, spielen sie draußen im Gebüsch. Schon im Oktober ziehen die Haselmäuse sich für gut ein halbes Jahr in ihre mit Vorräten gefüllten „Winterlöcher“ zurück, wo sie sich zusammenrollen, ihre Körpertemperatur reduzieren und seltener atmen. Beim Zittauer Haselmaus-Kongreß kam im Wesentlichen heraus, dass über die „Schlafmäuse“ noch viel geforscht werden muß, um sie, so die SZ, zu enträtseln.
.
.

Gorilla „Tano“ im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn Weihnachten 2016 Marc Mueller.
.
.
Primatenforschung (1)
Die Affenforschung ist in der Biologie und Anthropologie besonders beliebt. Vor allem die Menschenaffen stehen – darwinistisch gesehen – den Menschen besonders nahe, mit dem Unterschied, dass man straflos alles mit ihnen machen kann, vom Aufbohren ihrer Schädel bis zum mehr oder weniger respektvollen Beobachten ihres Zusammenlebens in Freiheit. So mehrt sich das Wissen über sie. Anders als Hunde wollen die Affen jedoch nichts von uns wissen. Der Paläoanthropologe Louis Leakey, der zusammen mit seiner Frau in der kenianischen „Olduwaischlucht“ nach Knochen des „Frühmenschen“ bzw. „Urprimaten“ grub, aus dem sich einst Menschenaffen und Menschen „entwickelten“, hielt es für sinnvoll, dass man daneben auch die Lebensweise der heutigen Menschenaffen erforscht.
.
Da er die westliche Verhaltensforschung für patriarchalisch verblendet hielt und sowieso Frauen mehr Fähigkeiten zum Verstehen des Sozialen zugestand als Männern, schickte er in den Sechzigerjahren drei junge begeisterte „Affenfrauen“ in den Dschungel – nach zehn Jahren wollte er die ersten Berichte von ihnen haben: die Sekretärin Jane Goodall ging nach Tansania zu den im „Gombe Stream National Park“ lebenden Schimpansen; die Ergotherapeutin Dian Fossey schickte er nach Ruanda zu den Gorillas, die in den Bergen der Virunga-Vulkankette lebten; und die hippieske, von Orang-Utans begeisterte Studentin Birute Galdikas auf die Insel Borneo in das Reservat von Tanjung Puting.
.
Ausgehend vom „National Geographic Magazine“, dessen Herausgeber diese drei „Langzeitprojekte“ finanziell förderten, verfilmte man, z.T. mehrmals, auch die Lebensgeschichten der drei Frauen. Der letzte Dokumentarfilm – über Birute Galdikas Arbeit, „Born to be Wild 3D“ – wurde kürzlich auch einer Gruppe freilebender Orang-Utans vorgeführt. Jane Goodall lebt sporadisch noch heute auf ihrer Station am Gombe-Fluß, daneben hat sie eine internationale Tierschutzorganisation gegründet. Weil die tansanischen Regierungsbeamten kein „junges englisches Mädchen ohne europäische Begleitung“ in den Busch lassen wollten, wurde sie von ihrer Mutter begleitet, die im „Camp“ ein kleines Hospital für die Leute aus den umliegenden Dörfern einrichtete, was Jane Goodall half, von ihnen akzeptiert zu werden. Das Anfüttern der Schimpansen mit Bananen trug dann dazu bei, dass nach einiger Zeit bis zu 45 Tiere ihr Camp aufsuchten, einige regelmäßig. Dazu kam bald auch eine Pavianhorde, die sich zum Bedauern der Schimpansen und Jane Goodalls angewöhnte, „ständig in der Nähe herumzugammeln“. (Während man auf ihrer Station die Paviane weg haben wollte, erforschten ironischerweise die nachfolgenden jungen Affenforscherinnen Paviane, indem sie deren Horden immer näher zu kommen versuchten.) Es dauerte auf Goodalls Station sechs Jahre, bis die 20 Mitarbeiter des Forschungprojekts einen optimalen „Futterplatz“ aus Beton und Stahl für die Schimpansen gebaut hatten. Später kam noch ein zweiter für Touristen hinzu. Dian Fossey setzte sich dagegen schon früh derart rabiat für den Schutz „ihrer“ Gorillas – vor allem vor einheimischen Jägern, die sie Wilderer nannte – ein, dass man sie 1985 in ihrem „Camp Karisoke“ ermordet auffand. Andere Verhaltensforscher und Gorillaschützer führten ihre Arbeit fort. Erst kürzlich kam von dort die Nachricht, dass „drei männliche Gorillas mehrere Fallen zerstört“ hätten – und zwar „äußerst fachmännisch. Die Fallen waren für sie als Erwachsene zwar nicht gefährlich, jedoch war wenige Tage zuvor ein kleiner Gorilla in solch einem ‚Schnappseil‘ zu Tode gekommen, nachdem er sich beim Versuch, daraus zu entkommen, die Schulter gebrochen hatte.“
.
Die dritte Affenforscherin, Birute Galdikas, lebt heute noch im Wald auf ihrer „Auswilderungs-Station“ für in Gefangenschaft gehaltene oder dort geborene Orang-Utans (über 100 in den ersten 23 Jahren ihrer Forschung). Sie hatte immer wieder gegen „Holzfäller“ zu kämpfen, die ihr „Paradies“ mit Kettensägen bedrohten. Inzwischen ist sie mit einem der einheimischen Parkverwalter verheiratet und hat drei Kinder. „Für mich war die Beobachtung und Rettung von Orang-Utans kein Projekt, sondern eine Aufgabe, eine Berufung, ich wollte sie verstehen, nicht um eine akademische Karriere damit zu machen“, schreibt sie. Sie fühlte sich für das Leben und Arbeiten im Regenwald auch deswegen berufen, weil sie in einem Wald (in Litauen) gezeugt wurde und in einem anderen Wald (in Kanada) aufwuchs. „Meine wissenschaftliche Ausbildung und schlichte Verehrung des Waldes im Verein mit der genauen Kenntnis und den Fertigkeiten der Dajak (den mit dem Wald vertrauten Ureinwohnern]), brachte meine Untersuchung der Orang-Utans ein gutes Stück voran.“
.
Die drei Frauen ersetzten zwar für verwaiste Jungtiere die Mutter, die wild lebenden Affen beobachteten sie jedoch nur aus einiger Entfernung, wobei sie nach und nach mit einigen vertraut wurden; deren Biographien sind dann auch ganze Kapitel in ihren Büchern gewidmet. „Affen sind viel zu intelligent, um uns für einen der ihren zu halten. Jane, Dian und wir alle, die wir mit wildlebenden Primaten arbeiten, versuchen uns lediglich als harmlose, bewegliche Teile in die Umwelt der Tiere zu integrieren. Schließlich wollen wir ja ihr natürliches Verhalten beobachten“, meinte ein früherer Mitarbeiter von Dian Fossey. Bei den Orang-Utans war diese „höfliche Distanz“ quasi naturgegeben, da sie „Baumbewohner“ sind, wohingegen Galdikas sich als „erdgebunden“ bezeichnet. Einige von ihr aufgezogene Orang-Utans sind in „close contact“ mit ihrer Station geblieben. Einer versuchte einmal eine ihrer Köchinnen zu vergewaltigen, die anderen einheimischen Mitarbeiter von Beirute Galdikas behandelte er als Dienstboten.
.
Bei ihren ersten Annäherungsversuchen machte Dian Fossey noch Fehler: z. B. trommelte sie auf ihrem Oberschenkel, um das Brusttrommeln der Gorillas zu erwidern, dies hat jedoch eine aggressiv-abweisende Bedeutung. Ebenfalls merkte sie erst nach einer Weile, dass es besser war, sich den Tieren auf allen Vieren zu nähern und nicht aufrecht. Zudem zwang sie sich, selbst bei einem Angriff nicht wegzulaufen, nachdem sich das bei einigen ihrer Studenten als fataler Fehler erwiesen hatte. Nach zehn Monaten hatte sie das Gefühl, eine „unsichtbare Schwelle zwischen sich und den Tieren überschritten“ zu haben: „Peanuts“, ein junges Männchen aus der Gruppe 8 „futterte etwa fünf Meter neben mir, als er plötzlich innehielt, sich umdrehte und mich ansah. Gebannt erwiderte ich seinen Blick. Peanuts beendete diesen unvergesslichen Augenblick mit einem tiefen Seufzer und futterte ruhig weiter.“ Dian Fossey telegrafierte ihrem Förderer Leakey sofort: „Wurde endlich von einem Gorilla akzeptiert.“ Ein Jahr später, 1967, kam sie mit einem männlichen Jungtier ihrer „Gruppe 4“ in näheren Kontakt, das sie „Digit“ nannte und mit dem sie bald sehr vertraut wurde, auch noch, als er zu einem dominanten „Silberrücken“ heranwuchs. Ein Photo von ihm zierte 1972 das Werbeplakat des Touristenverbandes von Ruanda. Als Digit einmal Dian Fosseys Notizbuch nahm und es sorgfältig und vorsichtig studierte, ließ sich nur noch schwer sagen, wer Beobachter war und wer Beobachteter. Anschließend drehte er ihr den Rücken zu, legte sich hin und schlief ein, was ein außerordentlicher Vertrauensbeweis war. Die Szene wurde zum Hauptteil einer Sondersendung der „National Geographic“.
.
Die zunehmende Aufmerksamkeit der Medien führte u.a. dazu, dass 1997, als der Bürgerkrieg in der Republik Kongo eskalierte und die Gegend um den Zoo von Brazzaville in das Zentrum der Kämpfe rückte, die französische Armee einen Hubschrauber losschickte, um eine Gruppe von Gorillas aus der Kampfzone auszufliegen, dazu gehörte auch ein im Zoo gefangen gehaltener Schimpanse namens Grégoire mit zwei jungen Gefährten, um die sich Jane Goodall gekümmert hatte, u.a. mit Spenden von Brigitte Bardot.
.
.

Okapi „Zawadi“ im „Okapiwald“ des Leipziger Zoos. Photo: Zoo Leipzig 2011.
.
.
Primatenforschung (2)
Wenn Menschenaffen nicht reden können, sie aber viel zu sagen haben, dann kann man ihnen vielleicht beibringen, ihre Finger zu benutzen, ungefähr so wie ein Taubstummer, schlug der amerikanische Tierpsychologe Robert Yerkes 1925 vor. Zu den ersten, denen man die „American Sign Language“ (ASL) beibrachte, zählte die Schimpansin Lucy, die im Haus des Psychotherapeuten-Ehepaars Temerlin aufwuchs. Sie hatte einen Sprachlehrer, Roger Fouts, und der hatte eine Assistentin, Sue Savage-Rumbaugh. Kaum hatte Lucy die ersten von schließlich 90 Zeichen gelernt, versuchte sie schon Fouts mit Hilfe der Gebärdensprache zu belügen: Sie hatte auf den Teppich im Wohnzimmer gekackt, als er sie zur Rede stellte, behauptete Lucy, nicht sie, sondern Sue Savage-Rumbaugh wäre es gewesen.
.
Die NZZ berichtete über sie: „Wer zu dieser Zeit das Haus der Temerlins betrat, wurde Zeuge eines ungewöhnlichen Familienlebens. Hatte Lucy Durst, ging sie in die Küche, öffnete den Schrank, nahm einen Teebeutel heraus, kochte Wasser und füllte die Tasse. Dann setzte sie sich aufs Sofa und blätterte in Zeitschriften, am liebsten hatte sie die „National Geographic“ (die umgekehrt die Menschenaffen und ihre Affenforscher berühmt machte sowie auch ihre Beziehungen finanziell förderte). Bald entdeckte Lucy nach dem Tee auch noch härteren Stoff wie Bourbon und Gin.“Wenig später kam eine neue Vorliebe hinzu. „Eines Nachmittags saßen Jane und ich im Wohnzimmer und beobachteten, wie Lucy die Stube verließ“, berichtete Temerlin. „Sie ging in die Küche, öffnete einen Schrank, nahm ein Glas heraus, holte eine Flasche Gin hervor und schenkte sich drei Finger hoch ein. Damit kam sie zurück in die Stube, setzte sich auf die Couch und nippte. Doch mit einem Mal schien ihr ein Gedanke zu kommen. Sie erhob sich wieder, ging zum Besenschrank, holte den Staubsauger hervor, steckte ihn in die Steckdose, schaltete ihn ein und begann, sich mit dem Saugrohr zu befriedigen.“ Dabei blätterte sie im „Playboy“. Ihre beiden Betreuer fanden das nicht nur lustig. Lucy war eigentlich gar kein Affe mehr: „Sie war gestrandet, befand sich irgendwo zwischen den Arten.“ Das zeigte sich, als man schließlich versuchte, sie in Gambia in einem „Chimpanzee Rehabilitation Trust Camp“ auszuwildern, aber sie ängstigte sich zu sehr vor den anderen dort bereits ausgewilderten Schimpansen und das Nahrungsangebot in der neuen Freiheit ekelte sie an. Ihre Babysitterin, die angehende Biologin Janis Carter, die sie auf der Insel im Gambia-River an die Freiheit gewöhnen sollte und dafür einige Monate veranschlagt hatte, brauchte acht Jahre, bis sie es geschafft hatte. Am Ende hatte Lucy sich dort mit der Horde von „Problemaffen“, wie sie selbst einer war, abgefunden. Sie ging noch einmal zu Carter und umarmte sie, woraufhin diese in Tränen ausbrach. Lucy klopfte ihr sanft auf den Rücken, als wollte sie sagen, jetzt ist alles okay. Die übrigen Affen machten kehrt und verschwanden wieder im Wald. Lucy stand auf und folgte ihnen. Ein Jahr später fand man Lucys Leiche. Wahrscheinlich wurde sie von Wilderern getötet, denen sie sich arglos genähert hatte. Die Gründerin des „Chimpanzee Rehabilitation Trust Camps“ meinte rückblickend: „Das ganze Projekt war eine einzige Katastrophe.“ Schimpansen, die in einer normalen US-akademischen Mittelschichts-Familie aufwuchsen, könnten nicht an die Freiheit gewöhnt werden. Sie empfänden sich als Menschen, könnten vielleicht rechnen, ein bißchen Gebärdensprache und mit Messer und Gabel umgehen, aber einem Leben in der Wildnis – und wohlmöglich noch unter Affen – seien sie nicht gewachsen.
.
Ähnlich äußerten sich später auch die Schimpansenforschungs-Autorität Jane Goodall gegenüber Roger Fouts, als der sie fragte, ob er seine nächste Schimpansin, Washoe, der er die Gebärdensprache beigebracht hatte, auswildern solle, weil er keine anständige Unterbringung für sie in den USA fand. Jane Goodall schrieb ihm: sein Vorschlag sei dasselbe, „als würde man ein zehnjähriges amerikanisches Mädchen nackt und hungrig in der Wildnis aussetzen und ihm verkünden, es werde jetzt zu seinen natürlichen Wurzeln zurückkehren“.
.
Fouts arbeitete weiter mit Washoe. Mit fünf Jahren „benutzte sie 132 Zeichen verläßlich und war in der Lage, hunderte weitere zu verstehen“, zudem setzte sie ihre Wörter „zu neuen Kombinationen zusammen“. Z.B. wollte sie einen Zug aus seiner Zigarette, die Fouts gerade rauchte: „Gib mir Rauch, Rauch Washoe, Schnell gib Rauch,“ sagte sie. „Frag höflich“, erwiderte er. „Bitte gib mir diesen heißen Rauch“, antwortete sie. „Es war ein wunderschöner Satz“, dennoch schlug er ihr die Bitte aus. Sie war noch zu jung dafür. Als die das Zeichen für „Blume“ gelernt hatte, benutzte sie es auch für Pfeifentabak und andere interessante Gerüche. Fouts liebte Washoe, er plante ein großes Freigehege für sie und vier weitere Schimpansen, die Washoe inzwischen adoptiert hatte. Ihre internationale Fangemeinschaft „Friends of Washoe“ organisierte eine Spendensammlung, auch die Gemeinde Ellensburg bei Seattle, die stolz darauf war, dass in ihrem Ort jetzt „der klügste Affe der Welt“ lebte, zeigte sich großzügig. 1993 war es so weit: Als Washoe morgens aufwachte, sah sie durch eine Glastür auf eine Graslandschaft mit Klettergerüsten – und mit leuchtenden Augen verlangte sie: „Hinaus, Hinaus!“ Moja und Tatu weigerten sich wochenlang, zurück ins Haus zu gehen. Ihr Lebensraum hieß nun: „Institut für die Kommunikation von Schimpansen und Menschen“ und war ein „Modell, an dem junge Menschen eine nichtinvasive, einfühlsame Form von wissenschaftlicher Forschung kennenlernen können“.
.
Lange hörte man nichts von Washoe, aber dann meldete der „Spiegel“ 2007, dass die 1965 in Westafrika geborene Washoe „in Ellensburg eines natürlichen Todes“ gestorben sei. Auf der Webseite der „Friends of Washoe“ fand ich den Hinweis, dass sie „nach langer Krankheit starb“ (Zigarettenraucherin?). In einem Nachruf schreibt das Gehörlosenforum „my-deaf-com“: „Der einzige lebende Affe zur Zeit, der noch die Gebärdensprache beherrscht, ist die Gorilladame Koko‘. Sie lernte an der Stanford University angeblich mit über 1.000 Zeichen der ASL zu kommunizieren und später annähernd 2.000 englische Wörter zu verstehen.“
.
.

Orang Utan „Matra“ mit Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn München. Das zweite Kind gehört ihrer Mitgefangenen, es wird jedoch von Matra versorgt. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
.
Primatenforschung (3)
Die amerikanische Pavianforscherin Barbara Smuts schrieb über „ihre“ Tiere (in „Sex and Friendship in Baboons“ 1985), die sie jahrelang in der Savanne beobachtete: „Zu Beginn meiner Forschungsarbeit waren die Paviane und ich in keiner Weise einer Meinung.“ Sie mußte zuvörderst die Paviankommunikation wenigstens annähernd beherrschen: „Erst durch ein gegenseitiges Kennenlernen konnten sowohl Paviane als auch Mensch ihrer Arbeit nachgehen.“ Dabei interessierte Barbara Smuts jedoch nicht mehr die Frage ihres Doktorvaters: „Sind Paviane soziale Wesen?“, sondern sie fragte sich selbst: „Ist dieses menschliche Wesen sozial?“ Als sie das schließlich im Hinblick auf „ihre“ 123köpfige Affenhorde einigermaßen positiv beantworten konnte – und ihre Forschung dementsprechend voranschritt, kam sie zu dem Schluß, dass die nicht-sprachliche Kommunikation, bei der sich die Körper über Blicke und Grüßen „eng austauschen“, der sprachlichen Verständigung in puncto Ehrlichkeit und Wahrheit überlegen ist.
.
Demnach scheint in der Kommunikation/beim Kontakt eine auf die Beteiligten unmittelbar bezogene Reziprozität der Gesten und Laute gegenüber dem Austausch von Äquivalenten, auf die unsere Warensprache abhebt, stabilere Kollektive/Gemeinschaften zu schaffen. Kann man sagen: der Affe favorisiert soziale Erfindungen, der moderne Mensch technische? Schon der Kieler Meeresbiologe Adolf Remane begann sein 1960 veröffentlichtes Buch über den Stand der Soziobiologie mit dem Eingeständnis, dass „das soziale Zusammenleben den Menschen große Schwierigkeiten bereitet“. Dies war bereits dem „ersten Naturwissenschaftler“ Aristoteles aufgefallen. Als Beweis hatte er u. a. die vielen „Reisegruppen“ erwähnt, in der man sich wegen jeder Kleinigkeit streitet.
.
Dem gegenüber kam die amerikanische Primatenforscherin Shirley Strum bei ihrer 42 Jahre langen Beobachtung von Pavianen in Kenia zu dem Ergebnis, dass in ihren Horden schier permanent versucht werde, das soziale Zusammenleben erträglich zu gestalten. Und weil die Paviane dazu weitaus weniger Hilfsmittel haben als wir (Statussymbole, Sprache, Kleidung, Werkzeug etc.), deswegen sind sie quasi Sozial-Profis im Vergleich zu uns Menschen und machen das „wirklich nett“ – nicht zuletzt deswegen, „weil im Unterschied zu den Menschen keiner von ihnen über die Fähigkeit verfügt, die wichtigsten Lebensgrundlagen zu kontrollieren. Jeder Pavian hatte sein eigenes Futter, sein eigenes Wasser, seinen eigenen Platz im Schatten und sorgte selbst für die Abdeckung seiner grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aggression konnte zwar als Druckmittel eingesetzt werden, stellte jedoch einen gefesselten Tiger dar. Grooming, Einander-Nahesein, gesellschaftlicher guter Wille und Kooperation waren die einzigen Vermögenswerte, die man gegenüber einem anderen Pavian als Tausch- und Druckmittel einsetzen konnte. All das waren Aspekte der Nettigkeit‘. Was ich entdeckt hatte, war ein revolutionäres neues Bild der Pavian-Gesellschaft.“
.
Der Anarchist und Ethnopsychoanalytiker Paul Parin hat ebenfalls etwas in einer Pavian-Gesellschaft entdeckt: Er besuchte einmal den Zürcher Pavianforscher Hans Kummer im Hochland von Äthiopien. Gemeinsam schauten sie Abends dem Treiben auf dem Affenfelsen zu. In seiner Geschichte „Kurzer Besuch bei nahen Verwandten“ schrieb Parin: „Es war uns vergönnt, dabei zu sein, wie sich eine Vermutung der Forscher erstmals bestätigte. Zwei ältliche Junggesellen – ihre Namen müßte ich verschweigen, wenn ich sie nicht vergessen hätte – lebten seit langem zusammen und schliefen eng aneinander in einer Felsspalte. An jenem Abend jedoch, in der Stunde der Geselligkeit, näherte sich ein schlanker Jüngling dem einen der gesetzten Herrn, kraulte ihm verstohlen das Fell und bot ihm, wenn der Freund des Alten nicht hinsah, sein hellrotes Hinterteil. Der Strichjunge, wie wir ihn nannten, hatte Erfolg. Dem Freund des Verführten waren die Zärtlichkeiten der beiden nicht entgangen. Jetzt war es zu spät. Aus den Augenwinkeln schielte er hinüber, wie sich sein Freund mit dem jungen Gespielen einließ. Verlegen blickte er zu Boden. Traurig – das sah man seinen müden Bewegungen an – turnte er schließlich den Felsen hinauf und fand einen Platz für seine einsame Nacht. Als es dunkelte, hatte auch das ungleiche Paar genug vom sinnlichen Spiel. Die beiden setzten elastisch hinauf zum gewohnten Schlafplatz der Freunde.“
.
Mir hat an dieser Geschichte besonders der Satz gefallen: „Zwei ältliche Junggesellen – ihre Namen müßte ich verschweigen, wenn ich sie nicht vergessen hätte“: So weit sind wir schon, dass wir die Affen nicht nur benamen, sondern ihnen ihr „Coming-Out“ als Schwule auch selbst überlassen, wenn sie nicht gerade Personen von öffentlichem Interesse sind, was bei diesen drei Pavianen anscheinend nicht der Fall war. Der Wissenssoziologe Bruno Latour ist der Meinung: „Ökologie wird nur dann gelingen, wenn sie nicht in einem Wiedereintritt in die Natur – diesem Sammelsurium eng definierter Begriffe – besteht, sondern wenn sie aus ihr herausgelangt.“ Wie das zu verstehen ist, dazu hat sich der Delphinsprachforscher John C.Lilly geäußert, als er seiner Assistentin, der zukünftigen Orcaforscherin Alexandra Morton riet, die Tiere bloß nicht zu „zoologisieren“. Sie hat sich dann auch daran gehalten, wie überhaupt die Verhaltensforscherinnen weitaus weniger dazu neigen als die männiglichen Verhaltensforscher.
.
.

Silbergibbon mit Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Maria Nicole Fencik.
.
.
Der Kluge Hans
Der Berliner Volksschullehrer Wilhelm von Osten hatte irgendwann den Eindruck, dass sein Pferd Hans noch viel mehr konnte als seine Kutsche zu ziehen und er begann, dessen „Intelligenz“ zu fördern. Als Hans 1895 starb, schaffte er sich einen zweiten Hans an. Nach einem mehrjährigen Unterricht stellte er das Pferd der Öffentlichkeit vor. Zunächst interessierten sich nur einige Kavalleristen für das Tier, das „zählen, rechnen, lesen, Personen und Gegenstände erkennen und auf seine Art [mit dem Huf klopfend] bezeichnen“ konnte. Als aber auch Wilhelm II. Interesse an Hans zeigte, wurde an der Universität schnell eine Untersuchungskommission gebildet, damit der Kaiser nicht auf einen Schaustellertrick hereinfalle. Dies war der Anfang eines neuen Faches: „Tierpsychologie“. Beim „Klugen Hans“ kam die Kommission unter der Leitung des Philosophieprofessors Carl Stumpf zu dem Ergebnis: „Das Pferd versagt, wenn die Lösung der gestellten Aufgabe keinem der Anwesenden bekannt ist… Es kann also nicht zählen, lesen und rechnen…Es bedarf mithin optischer Hilfen,“ die „nicht absichtlich gegeben zu werden“ brauchen. Der Assistent von Stumpf, Oskar Pfungst, der die Untersuchung experimentell fortführte, kam dann zu dem
Ergebnis, dass von Osten „verschiedene Bewegungsarten“ erkennen ließ, „die den einzelnen Leistungen des Pferdes zugrunde liegen.“ Osten war demnach doch ein Schwindler, obwohl strittig blieb, „ob dessen minimale Kopfbewegungen zwischen 0,5 mm und 1 mm vom Pferd überhaupt wahrgenommen werden können.
.
Ein anderer Tierforscher, Theodor Zell, fand es zwar interessant, „daß der Hengst manchmal trotz der abweichenden Ansicht des Lehrers bei seinem Klopfen beharrte und die Stellung des Buchstabens richtig angab,“ aber er bezweifelte, dass ein Tier sich
überhaupt eine „Vorstellung von einem abstrakten Begriff, wie es eine Zahl ist“, machen könne. Sodann unternahm der Elberfelder Juwelier Karl Krall einige Intelligenztests mit Hans, wobei er versuchte, das Übermitteln von Zeichen, bewußten und unbewußten, zu verhindern. Als von Osten starb, nahm Krall das Pferd mit nach Elberfeld, wo er Hans weiter „unterrichtete“ – zusammen mit drei anderen Pferde, von denen eins, Berto, blind war (und deswegen keine optischen Zeichen wahrnehmen konnte). All das sprach sich herum. Schon bald mehrten sich in Europa die Nachrichten von klopfsprechenden Pferden, Hunden und Schweinen – geschult nach der „Krallschen Methode“. Noch heute kommt alljährlich im Sommerloch mindestens ein sprechendes Tier in die Nachrichten. Zuletzt, 2012, war es ein Elefant in Korea. Als klopfsprechender „Wunderhund“ galt lange Zeit der Border-Collie „Rico“, der 1999 „Wettkönig“ in einer „Wetten dass…“-Sendung wurde und mehr als 200 Plüschtiere auf Kommando herbeiholen konnte. Seine Lernfähigkeit wurde daraufhin im Leipziger Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung getestet.
.
Krall hatte 1912 ein dickes Buch: „Denkende Tiere. Beiträge zur Tierseelenkunde auf Grund eigener Versuche“ veröffentlicht und 1913 eine Zeitschrift: „Die Tierseele“ gegründet, dazu eine „Gesellschaft für Tierpsychologie“. Gleichzeitig wurde jedoch auf einem internationalen Zoologenkongreß eine Protesterklärung gegen die „durch keine exakte Methodik gestützten Lehren Kralls“ verabschiedet. Den Wissenschaftlern waren sie zu okkult, grenzten an Telepathie. Tatsächlich zog Krall dann nach München, wo er ein „Institut für Tierseelenkunde und Parapsychologische Forschungen“ gründete und mit dem sogenannten
„Okkult-Professor“ Albert von Schrenck-Notzing zusammenarbeitete. Es ging Krall dabei um das Auffangen von Gedankenwellen zwischen ihm und einem Hund. Im „Klub“ des „Hypnosearztes“ Schrenck-Notzing verkehrte auch Thomas
Mann, wo er u.a. den Magenspezialisten Dr. Loeb am Kamin über Hundekrankheiten befragte. Er hatte selber Hunde und schrieb während des Ersten Weltkriegs ein Hundebuch: „Herr und Hund. Ein Idyll“, das dem Hundeexperten Konrad Lorenz als „die schönste Schilderung der Hundeseele“ galt. Für die „Elberfelder Pferdeschulung“ hatten sich zuvor bereits andere Künstler interessiert: u.a. Kafka, Rilke und Maeterlinck, sie vertraten dabei eine „mediumistische“ Auffassung. Thomas Manns Hund, Bauschan, holte seinen Herrn stets von der Straßenbahnhaltestelle ab, wobei er seltsamerweise zu wissen schien, wann dieser aus der „Welt“ (München) zurückkehren würde. Den Herrn freute das jedesmal so, dass ihm darüber seine „Weltlaune verrauchte“. Seine jüngste Tochter, die Seerechtsdiplomatin Elisabeth Mann-Borgese, die bis zu ihrem Tod 2002 in einem abgelegenen Haus in Kanada lebte, lehrte ihren Hunden dort das Schreiben auf einer Schreibmaschine und das
Klavierspielen: „Sie freuen sich darauf,“ erklärte sie in ihrem Buch: „Das Abc der Tiere“ (1967).
.
In der Wissenschaft hatte der „Kluge-Hans-Fehler“ bis heute negative Folgen: „Man hat daraus lediglich eine Konsequenz gezogen, nämlich die, in wissenschaftlich anerkannten Experimenten den Einfluß des Menschen mit allen Mitteln auszuschalten,“ kritisierte der Zürcher Tierpsychologe und Zoodirektor Heini Hediger. Die „positive Folgerung“, die man aus dem „Kluge Hans Fehler“ hätte ziehen sollen, „wäre die genaue Analyse jener störend wirkenden persönlichen Zeichen und die
Abklärung ihrer Wirkung gewesen. Die experimentelle, d.h. die ans Laboratorium und dessen übliche Versuchstiere gebundene Tierpsychologie seziert und analysiert immerfort nur die eine Hälfte der tierlichen Psyche, während sie die andere ebenso wichtige Hälfte, die Gefühlssphäre, nicht nur unterdrückt, sondern sie sehr oft vollkommen übergeht.“ Dabei gäbe es bei Säugetieren eine hoch entwickelte Fähigkeit, „menschliche Ausdrucksweisen aufs feinste zu interpretieren. Das Tier, besonders das Haustier, ist oft der bessere Beobachter und der präzisere Ausdrucksinterpret als der Mensch.“
.
Nach dem Zweiten Weltkrieg interessierten sich einige aus der Lenkwaffenforschung in den Frieden entlassene „Kybernetiker“ bei ihrer Beschäftigung mit einer „mathematischen Theorie der Kommunikation“ für das „Kluge-Hans-Phänomen“, wie es fortan genannt wurde. „Das Wort Kommunikation wird von uns im weitesten Sinne verwendet, um alle Möglichkeiten zu erfassen, mit denen jemand das Bewußtsein eines anderen beeinflußt,“ erklärte 1949 der US-Mathematiker Warren Weaver in seiner „mathematischen Theorie“, in der er das Problem behandelte, wie man erkennen könne, dass keine „Kommunikation“ stattfinde. In diesem Zusammenhang brachte er die „Pferde von Elberfeld“ ins Spiel – indem er erwähnte, Karl Krall habe auf den Vorhalt, seine Tiere würden „lediglich auf die Kopfbewegungen ihres Dompteurs reagieren“, die Pferde selbst gefragt, ob sie solche kleinen Bewegungen überhaupt erkennen könnten, worauf sie nachdrücklich mit „Nein“ geantwortet hätten.
.
Der Grazer Medienwissenschaftler Daniel Gethmann nahm diese Anekdote 2012 zum Ausgangspunkt eines kommunikationstheoretischen Aufsatzes. Für ihn hatte sich bereits in dem Pfungst-Gutachten von 1907 die „kommunikative Perspektive“ umgekehrt: „Es war nicht länger Hans, der in einer ‚Hufsprache‘ spricht, sondern von Osten, dessen Körpersprache die entscheidenden Signale gab…Die Theorie der Übertragung kommunikativer Zeichen war damit um das ‚Kluge-Hans-Phänomen‘ reicher“ – aber um die Frage, was wechselwirkt da?, ärmer.
.
.

Zwergflusspferd im Zoo Rostock. Photo: Zoo Rostock Kloock. Dieses Zoo-Werbephoto, das so anders ist als meine dilletantischen im blog-eintrag davor, indem es das Tier phototechnisch frei stellt, zeigte mir, dass dieses Genre die Zootiere so zeigt, wie der Besucher sie sehen soll und vielleicht auch möchte, aber nie sieht, weil die Gehege- bzw. Käfigsituation der Tiere immer mitgesehen wird, nicht jedoch auf diesem und den anderen Zoo-Photos, wobei mir das vom Zwergflusspferd besonders auffiel, weil es eine Art Museums-Panorama mit einem lebenden Tier ist: hinter ihm befindet sich eine bemalte Wand, die einen Teil der Landschaft abbildet, in denen das Zwergflusspferd sonst frei leben würde. Dieses Tier ist also in Gefangenschaft gezwungen, in einer westafrikanisch anmutenden Bühnendekoration zu leben – so als würde es die Hauptrolle in einer Tier-Komödie spielen, die gleichzeitig eine -Tragödie ist, denn es gibt genaugenommen keine Handlung in dem Stück. Die Zoodirektoren neigen zu ersterem, die Tierschützer zu letzterem. Wir, der Zoobesucher, sehen das erst alles auf diesem Photo. Franz Kafka hat einmal den Unterschied zwischen einer Inszenierung und dem wahren Leben in zwei Sätzen über den Zirkus formuliert…
.

.
Auf der Galerie: „Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden erbarmungslosen Chef monatelang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter dem nichtaussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind – vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, rief das – Halt! durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters.
Da es aber nicht so ist; eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt, zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen; der Direktor, hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet; vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt; sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben; schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt; neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft; die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt; ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann; mit englischen Ausrufen zu warnen versucht; die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt; vor dem großen Salto mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen; schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küßt und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet; während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will – da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und, im Schlußmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.“
.

Eisbären-Geschichten: Von der berühmten, inzwischen verstorbenen DDR-Eisbären-Dompteuse Ursula Böttcher gibt es eine gute Biographie (siehe Umschlagsphoto), von einem Journalisten mit ihr zusammen verfaßt. Nach ihrem Tod 2010 berichteten die Tierschützer von „Peta“, dass der Zirkus-Liquidator der Treuhandanstalt zwei ihrer Bären, Boris und Kenneth, für 1 DM das Stück an einen mexikanischen Zirkus verkaufte, in dem sie derart mies gehalten und behandelt wurden, dass „Peta USA“ für ihre Beschlagnahmung durch die US-Behörden sorgte. Die beiden Bären kamen dann in einen Zoo im Staat Washington.
Der neue Direktor der beiden Berliner „Hauptstadtzoos“, Veterinär Knieriem, meinte kürzlich – über „Knut“, er „versuche, die Dinge auf der Sachebene zu behandeln“, aber es ist doch höchst unsachlich, dass er über den im Naturkundemuseum ausgestopften Zoo-Eisbären just zu dem Zeitpunkt, als die Geburt eines Eisbärjungen im Tierpark stattfand, verlauten ließ: „„Knut wird Artenschutz-Botschafter“ – was sowieso ein großer Blödsinn ist. Ich füge hier ein Photo vom ausgestopften neuen Botschafter hinzu.
Die Mutter von Knut, Tosca, wurde aus dem DDR-Staatszirkus, d.h. aus der Eisbärengruppe von Ursula Böttcher, rausprivatisiert. Man hat sie erst an den Nürnberger Zoo verkauft, wahrscheinlich nur zum Schein, und von da aus an den Westberliner Zoo, wo sie dann Knut gebar. An dieser Privatisierung war die Schwiegertochter des Westberliner Zoodirektors Heinz-Georg Klös beteiligt: Es ging um die „weltberühmte Nummer“ mit fünf Eisbären von Ursula Böttcher. Sie hatte sich beim Staatszirkus der DDR von der Putzfrau zur Raubtierdresseurin hochgearbeitet, arbeitete mit Löwen – bis der Generaldirektor sie vor die Wahl stellte: „Entweder übernehmen Sie die alten Bären – oder Sie kriegen eine Hundenummer!“ Die Löwen hatte sie von ihrem Kollegen, den Löwendompteur Georg Weiß, der immer in Schlips und Anzug und mit Brille auftrat, übernommen. Er schrieb über seine Raubtier-Nummern u.a. in seinen Autobiographien „Start in die Manege. /Abschied von der Manege. Die Lebensgeschichte eines Dompteurs und seiner gemischten Raubtiergruppe“ (1978) und „Mit meinen Tieren auf du und du“ (1973) Nach der Wende wollte der „Circus Busch-Roland“ mit der Bärennummer von Ursula Böttcher auf Tournee gehen, auch Zirkus Krone hätte sie fünf Jahre unter Vertrag genommen, aber der Treuhand-Liquidator des Staatszirkusses verkaufte die Eisbären an verschiedene Tiergärten, zwei übernahm der Westberliner Zoo, und Ursula Böttcher wurde „aus betriebsbedingten Gründen“ gekündigt – mit der Begründung: „Eisbären gehören nicht in den Zirkus, das ist nicht artgerecht für sie, die kommen in einen Zoo.“ Über die Kündigung des Liquidators meinte Ursula Böttcher: „Nach 47 Jahre Zirkus und einer Weltkarriere eineinhalb Zeilen“. Das hat sie derart verbittert, dass sie kurz darauf starb. Laut Berliner Zeitung kombinierte der Pressesprecher des „Circus Busch-Roland, der vergeblich gegen den Bärenverkauf geklagt hatte: „Des Liquidators engste Liquidierungsberaterin heißt Ursula Klös, Schwiegertochter des früheren Berliner Zoodirektors und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden von Zoo und Tierpark, Heinz-Georg Klös. Ihr Mann wiederum arbeitet in leitender Stellung im Zoo…“ Hinzugefügt sei, was der „Zoo Berlin“ kürzlich vermeldete, dass der Eisbärenkurator „Heiner Klös“ heißt – Sohn von Heinz-Georg Klös.
.

Der vom Chefpräparator des Berliner Naturkundemuseums,Detlev Matzke, ausgestopfte „Knut“. Photo: Naturkundemuseum Berlin 2014. Im Naturkundemuseum sind viele Gäste von der scheinbaren Lebendigkeit der Ausstellungspräparate irritiert. In der Präparationsausstellung stehen sich zwei Raubkatzen gegenüber.“Mami, sind die Katzen echt?“ – So beginnt die Geschichte der Kulturwissenschaftlerin Clara Probst: „Es sind Ozelotpräparate aus den Jahren 1819 und 1934, an denen die Geschichte und Herstellung von Säugetierpräparaten thematisiert werden. Das ältere Raubkatzenfell wurde nach der damals gängigen Präparationsmethode einfach ausgestopft, was zu einem unnatürlich deformierten Körper führte. Die glasig trüben Augen unterstreichen diese Künstlichkeit, sodass dem Präparat jegliche Ähnlichkeit zu lebendigen Artgenossen fehlt. Das Präparat von 1934 hingegen ist eine Dermoplastik. Es besitzt einen künstlichen Körper, der anatomisch korrekt geformt wurde, und wirkt schon allein dadurch fast lebendig. Vor allem aber ist es das Gesicht und insbesondere die Augenpartie, die den individuellen, lebendigen Ausdruck des neueren Raubkatzenpräparats hervorrufen. Während die Augen des alten Präparats bereits aus der Ferne künstlich erscheinen, sind es bei dem neueren Exemplar gerade die Augen, die ihm erst Lebendigkeit verleihen.“
Detlev Matzke äußerte über seine Arbeit an dem Eisbären gegenüber der BZ 2014: „Das Schwierigste an der Präparation war die Wahl der Haltung, die Knut einnehmen sollte. Wir haben Hunderte Bilder studiert, um schließlich die natürlichste Pose zu finden.“ Ist damit nun die Knut-typischste oder die Eisbären-typischste Pose gemeint?
Über die Präparation – z.B. von Fischen – hatte Detlev Matzke uns gegenüber einmal geäußert: „Es geht dabei ja nicht darum, zu zeigen, daß ist jetzt der Karpfen Kuno aus dem und dem Teich, sondern darum, eine bestimmte Form zu zeigen, die typisch sein muß für den Karpfen. Wir wollen ja in der Museumspädagogik ganz andere Sachen mit rüberbringen: wir wollen darauf aufmerksam machen, welche Körperform hat er, wird er schnell schwimmen oder langsam, ist es ein Friedfisch oder hat er kräftige Zähne…Das kann man über ein naturgetreues Modell viel besser machen als mit einer Originalpräparation eines Fisches, wo ich immer aufpasssen muß, daß die Luftfeuchtigkeit nicht zu sehr abfällt im Winter und ich hinterher Risse habe und das Ding auseinanderfällt. Vor zwei Jahren war ich bei einer internationalen Leistungsschau von Präparatoren in Holland, wo ich mir mal angesehen habe, was die Kollegen, aus Amerika z.B., so machen. Da waren eine ganze Reihe von Präparaten mit Originalhaut, sehr vorzügliche. Aber es gibt natürlich auch noch bestimmte Probleme, was man auch sieht: im Kopfbereich z.B. einen gewissen Schwund. Da wird dann aufmodelliert. Das kann man auch erkennen. Und dabei ist es mir dann auch egal, ob im Inneren die Haut drinsteckt, wenn ich auf der Außenfläche was raufmodelliert habe. Das kann man natürlich machen, aber im Vergleich dazu fand ich unsere Sachen nach wie vor ganz gut.“
Ist es einfacher ein bestimmtes Tier für seinen Besitzer oder das Exemplar einer bestimmten Art für die Wissenschaft zu präparieren?
„Das hängt sehr von der Fähigkeit des Präparators ab. Im Museum kommt es im Regelfall darauf an, quasi eine bestimmte Tierart als ganz typisches Tier vorzustellen. Für den Museumsbesucher ist es relativ egal, ob es der Löwe A oder B gewesen ist – aus dem Zoologischen Garten. Etwas anderes war es mit dem Gorilla Bobby. Das war ein Tier, das jeder kannte, da gab es tausende von Photos von und deswegen mußte seine Präparation bis in die kleinste Mimik hinein stimmen. Das ist sicher ähnlich mit einem Hund, den ich, sagen wir mal, zehn Jahre auf dem Schoß gehabt habe. Wenn ich das Ding jetzt präparieren soll, dann muß das auch bis ins letzte Detail stimmen. Der Präparator kann das noch so schön machen, wenn die Glasaugen nur eine Spur zu hell oder zu dunkel sind, dann ist das Ding nicht mehr das Tier. Was aber eigentlich keine Rolle spielt, weil es z.B. die gleiche Rasse mit etwas helleren und etwas dunkleren Augen gibt. Oder wenn die Pupille etwas größer oder kleiner ist, was also im Rahmen des normalen Lichteinfalls durchaus möglich ist, aber Herrchen oder Frauchen erkennen ihr Vieh nicht mehr wieder. An sich ist es aber viel wichtiger, daß das Wesen des Tieres richtig rüberkommt. Und als Präparator kann man da ein bißchen tricksen bei der Sache. Es gibt also einerseits die rein naturalistische Nachbildung. Wo man sagt, ich modellier jetzt das Tier und natürlich muß es ein Löwe oder was auch immer sein. Ich muß mich mit dem Löwen auch sehr beschäftigt haben. Aber darüberhinaus kann man ihn jetzt etwas kräftiger machen, etwas geschmeidiger, das Katzenhafte herausholen, die Spannung herausarbeiten. Normalerweise, wenn ich Löwen sehe, in Afrika oder im Zoo, liegen die auf der Seite, wackeln mit dem Schwanz und blinzeln mit einem Auge müde in die Landschaft. Das ist die eine Seite.
.
Man kann sie aber natürlich auch etwas spannender zeigen. Weil man z.B. zeigen will, der Löwe ist der König der Tiere. Man kann dabei auch so einen Geschlechtsdemophismus herausarbeiten – den Löwen als den Pascha darstellen, während das Weibchen ein bißchen mehr Aktion macht, bei der Jagd oder so. Das kann man alles machen. Wir haben dafür hier ein sehr schönes Beispiel im Huftiersaal, das sehen wir nachher beim Rausgehen. Heute kann man das erzählen, früher wäre es vielleicht ein bißchen heikel gewesen, da hätten sie uns das Ding rausgerissen. Da ist eine Elenantilope, ein kräftiges stattliches Tier. Präpariert wurde es 1936 zur großen Reichsjagdausstellung in Berlin. Der Weltreisende und Jäger Bengt Berg hatte das Tier irgendwo geschossen. Es wurde dann für Hermann Göring und seine Jagdausstellung präpariert. Und zwar im Stil des Dritten Reiches, ähnlich wie die ganzen Breker-Plastiken: sehr viel kräftiger und massiger als in Wirklichkeit. Die Haut ist geduldig, da kann man sehr viel mit machen. Es gibt aber Bereiche, wo absolut nichts zu machen ist, an den Beinen z.B., da kann ich nichts ausdehnen. Wohl aber am Halsbereich. Den haben sie dann auch sehr viel kräftiger gemacht, ebenso den Rumpf. Der ist dadurch richtig unproportioniert geworden, wenn man den gewaltigen Hals z.B. mit den dünnnen Beinen vergleicht. Aber es paßte in den Stil der Zeit.“
.
Wenn ich das richtig sehe, dann beginnt für den toten Eisbären ebenso wie für viele andere gestorbene Zoo-Tiere im Naturkundemuseum ein zweites – kulturelles – Leben, das ebenfalls bestimmten Gesetzen gehorcht. Bleibt trotzdem die Frage: Ob als Individuum oder als Repräsentant seiner Art. Diese Frage stellte sich der Biologie und Verhaltensforschung auch schon während ihres wirklichen Lebens, tot auf dem Arbeitstisch des Präparators stellt sie sich einem Kulturschaffenden.
.
.
Tapire – Vater „Copasih“ und Sohn „Ketiga“ – im Leipziger Zoo. Photo: Zoo Leipzig 2017.
.
.
Der kluge Papagei
Der Professor für Religionsphilosophie Klaus Heinrich war Mitbegründer der Freien Universität und seine „Dahlemer Vorlesungen“ ein wahres Ereignis. Er hatte sich 1964 mit einer umstrittenen Streitschrift habilitiert: „Versuch über die Schwierigkeit, nein zu sagen“. Dieser 218seitige „Versuch“ erwies sich wenig später als fast der einzige Theorie-Beitrag zur „antiautoritären Bewegung“ in Westberlin (die meisten kamen von der „Frankfurter Schule“). Der Heinrich-Schüler Cord Riechelmann schreibt: „Die religionsphilosophische Studie, die ‚in einer Welt, die zu Protesten Anlaß bietet‘, die Formel vom Neinsagen untersuchte, wurde in ihrer geistigen Fernwirkung zu einem Stoff, der den Protest der Studenten in den späten Sechzigerjahren fütterte.“ Nicht einmal der später fast unvermeidlich werdende „Exkurs über Buddhismus als Ausweg“ (die buddhistische Logik der Verneinung) fehlt in diesem „Frühwerk“, das den „induktiven Verfahren“ den Vorzug gibt: „Erst die Mittel heiligen den Zweck!“
.
Ein erstarkender Protest ist ein anschwellendes „Nein“. In vielen asiatischen Despotien fällt es noch heute den Menschen selbst im Alltag schwer, „Nein!“ zu sagen. In Indonesien z.B. gibt es sieben Worte für „Ja!“, von denen zwei auch ein „Nein“ bedeuten können. Wenn mein vietnamesischer Bekannter etwas im Gespräch verneinte, nickte er und sagte: „same same but different“. Aus dem anfänglichen „Nein!“ des studentischen Protests wurde „kritisches Denken“. Die in Berlin lebende Schriftstellerin Yoko Tawada hat diese Haltung zur Welt (die Adorno als überlebensnotwendigen „bösen Blick“ bezeichnete) wunderbar herausgearbeitet (in „Talisman“ 2011). Als Japanerin war ihr dieser Drang zur Kritik so fremd, dass sie ihn sich schnell wieder abgewöhnt hat. Ähnliches gilt inzwischen auch für den französischen Wissenssoziologen Bruno Latour, für den die „Kritik“ zu viel bodenloses Nein enthält, weswegen man fürderhin besser auf sie verzichten sollte.
.
Muß man sich das „Nein!“ nun aber (mühsam) erwerben oder wird man damit (leichthin) schon geboren? Solche Fragen stellen sich Lebenswissenschaftler. 2007 starb Alex, der „Professor unter den Papageien“. Er hatte in seinen 31 Jahren bei seiner Besitzerin, der Psychologiedozentin Irene Pepperberg, die ihm unentwegt Worte und Zahlen beibrachte, gelernt, auf verschiedene Weise „Nein!“ zu sagen. In Pepperbergs Buch „Alex und Ich“, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, heißt es: „Während unserer Arbeit lernte Alex, Nein zu sagen. Und Nein hieß dann auch Nein.“ Bis es so weit war, hatte er es erst einmal auf die unter afrikanischen Graupapageien übliche Weise zu „sagen“ versucht: laut kreischen, beißen, oder, „wenn er keine Lust mehr hatte, auf die Fragen eines Trainers zu antworten, die betreffende Person ignorieren“, ihr den Rücken zukehren, sich ausgiebig putzen…Meist kam er damit durch, seine „Trainer“ verstanden ihn: „Subtil war unser Alex nicht gerade,“ meint Irene Pepperberg. Aber dann reichte ihm diese „Sprache“ nicht mehr im Umgang mit seinen Betreuern. Diese sagten häufig „Nein [bzw. No], wenn er etwas falsch identifizierte oder etwas anstellte.“ Irgendwann bemerkten sie, „dass Alex in Situationen, in denen für ihn ein ‚No‘ angemessen gewesen wäre, ein Laut wie ‚Nuu‘ hervorbrachte“. Irene Pepperberg, sagte daraufhin zu ihm: „Gut, dann können wir Dir auch gleich beibringen, das richtig schön zu sagen.“ Schon bald verwendete Alex „diese Bezeichnung, um uns zu signalisieren: ‚Nein, das mag ich nicht!'“ In einem Dialog mit seiner Sprachtrainerin Kandia Morton hörte sich das folgendermaßen an:
.
„K: Alex, was ist das? [ein quadratisches Holzstück hochhaltend]
A: Nein!
K: Ja. Was ist das?
A: Vier Ecken Holz [undeutlich aber richtig]
K: Vier. Sag es schöner!
A: Nein!
K: Ja!
A: Drei…Papier [völlig falsch]
K: Alex. Vier, sag vier.
A: Nein.
K: Komm schon.
A: Nein.“
.
Laut Irene Pepperberg genoß Alex seine wachsende Publicity immer mehr: Kameras, Mikrophone, staunendes Personal, freudige Trainer und Fans etc.: „Er stand nun mal gerne im Mittelpunkt. Dann trat ein gewisses Glitzern in seine Augen, er plusterte sich auf – im übertragenen Sinne – und nahm die Pose des Stars an.“ Irgendwann war er jedoch das ewige Sprachtraining und auch die wachsende Aufmerksamkeit leid: „In puncto Verweigerung wurde er umso kreativer, je älter er wurde,“ schreibt die Autorin, dann freute sie sich aber doch: „Alex versteht die Bedeutung des Begriffs ‚Nein'“. Sie folgerte daraus sofort positiv – ganz im Sinne ihrer Projektbeschreibung: „Sein Ausdruck eines negativen Konzepts war durchaus schon als fortgeschrittenes Stadium sprachlicher Entwicklung zu betrachten.“
.
Diese zu fördern (bis hin zu Mathematik) war allerdings teuer, zudem kamen dann noch zwei Papageien dazu, wechselnde Assistenten, das Labor, das Büro, ein Zimmer für jeden Vogel usw..Pepperberg gründete eine „Alex Foundation“, ließ sich scheiden und hielt Vorträge bei den Verbänden der amerikanischen Papageienfreunde, wobei sie stets darauf hinwies, dass es soziale Vögel seien und man sie deswegen nicht allein und in Käfigen halten dürfe. Sie bräuchten viel Beschäftigung und Ansprache. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelte sie nichtsdestotrotz einen „elektronischen Babysitter“ und „Unterhalter“ für Alex, bei dem er mittels eines Joysticks Bilder, Filme und Musikstücke auswählen konnte (wahrscheinlich weil sie ihn so oft allein lassen mußte, um Geld für ihre Alex-Forschung aufzutreiben). Alex interessierte sich nur für die Musik, bei der er mitpfiff und -tanzte. 1981 war es bereits zu einem ersten Reduzierung der finanziellen Förderung ihrer Forschung gekommen. Auch bei Pepperbergs Kollegen, die alle mit Schimpansen arbeiteten, denen sie die Taubstummensprache beibrachten, einige auch das „Kommunizieren“ mit einer Art von elektronischer Schreibmaschine. In New York veranstaltete die Academy of Science in dem Jahr einen Kongreß mit dem Titel „Das Kluge Hans Phänomen“. Hauptredner war ein Affenforscher, der bewies, dass sein Affe „Nim Chimpsky“ ihn jahrelang hinters Licht geführt hatte: Nim hatte keine Ahnung von Grammatik, obwohl er zehn Sprachlehrer gehabt hatte. Die Papageien- und Affenforscher, die ihrenTieren menschliche Sprache beizubringen versuchen, würden sich ihre Erfolge nur einbilden. Es handele sich dabei nicht um Intelligenz-, höchstens um Gedächtnis-Leistungen…Die akademische Verneinung lief darauf hinaus, dass dabei bloß „Forschungsgelder sinnlos verschwendet werden.“ Und prompt wurden solche Projekte zunehmend weniger gefördert. Der zweite Einbruch bei der Entwicklung des menschlichen Sprach- und Denk-Vermögens bei Graupapageien kam, als Irene Pepperberg mit Alex noch am MIT arbeitete, das wegen seiner Pionierrolle bei der Algorithmisierung unserer Lebenswelt im Geld nur so schwamm, aber nach dem Platzen der“Dotcom-Blase“ war damit erst einmal Schluß. Die Universität sagte Nein. „Nun hatte ich weder einen Job noch einen Ort, an dem ich meine Arbeit mit Alex und seinen Freunden fortführen konnte.“ Aber irgendwie ging es dann doch weiter – an einer anderen Universität, bis Alex im Herbst 2007 schlußendlich „Nein“ sagte, und seine Besitzerin darüber fast zusammenbrach. Als in der Weltpresse jedoch überall rührende und rühmende Nachrufe auf Alex erschienen (dessen Name ein Akronym für „Avian Learning Experiment“ – Vogellernexperiment – gewesen war), erholte sie sich langsam und dachte sich: Ich habe doch noch ‚Kyaroo‘ und ‚Griffin‘ – die auch schon ganz schön klug sind. Und Alex hat ja bereits „die Welt der Wissenschaft revolutioniert.“
.
.

Harris-Antilopenziesel im Zoo Rostock. Photo: Zoo Rostock Dobbertin.
.
.
Der musikalische Spatz
Die englische Musikerin und Hobbyornithologin Clare Kipps veröffentlichte 1953 ein Buch über die Aufzucht eines Spatzen, der – auf sie „geprägt“ – zwölf Jahre bei ihr lebte. Die Autorin, die allein in London wohnte, entwickelte ein besonderes Verhältnis zu „Clarence“ – ihrem Sperling, der in den Kriegsjahren, da Clare Kipps im Luftschutz eingesetzt war, in ganz England berühmt wurde, weil er die im Bunker sich Versammelnden unterhielt, so dass sie vorübergehend ihre Sorgen und Ängste vergaßen. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag darüber: „Neben einigen anderen Tricks war die Luftschutzkellernummer sehr beliebt: Clarence rannte auf den Ruf ‚Fliegeralarm!‘ hin in einen Bunker, den Mrs. Kipps mit ihren Händen bildete, und verharrte dort reglos, bis man ‚Entwarnung!‘ rief. Noch beliebter waren indes seine Hitlerreden: Der Spatz stellte sich auf eine Konservendose, hob den rechten, durch ein Jugendunglück leicht lädierten Flügel zum Hitlergruß und begann zunächst leise zu tschilpen. Er steigerte dann seine Lautstärke und Furiosität bis zu einem heftigen Gezeter, verlor dann scheinbar den Halt, ließ sich von der Dose fallen und mimte eine Ohnmacht. Clarence wurde auf diese überraschende Weise zu einer Symbolfigur der von Hitlers Luftangriffen geplagten Londoner und ihres Durchhaltewillens. Er wurde in Presseberichten gefeiert, und sein Bild zierte Postkarten, die zu Gunsten des Britischen Rotes Kreuzes verkauft wurden.“
.
Clare Kipps Buch über ihn, das sie ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte, wurde vom Biologen Julian Huxley mit einem Vorwort versehen. Für die deutsche Ausgabe – „Clarence der Wunderspatz“ betitelt – schrieb der Basler Biologe Adolf Portmann ein Nachwort: „Vom Wunderspatzen zum Spatzenwunder“. Darin versuchte er vorsichtig einige Verallgemeinerungen aus Clare Kipps Langzeitbeobachtung eines Individuum zu ziehen. Clarence konnte singen, wobei er von der Autorin am Klavier begleitet wurde; Portmann schrieb: „Es mag im Spatzen ein sehr vages allgemeines Erbschema eines Liedes vorhanden sein, das in der Spatzenwelt normal gar nicht ausreift, das aber in neuer Umwelt sich entwickelt. Solche Erscheinungen kennt die Erbforschung da und dort. Das würde uns zeigen, wie wenig ‚frei‘ die normale Entwicklung in einer Gruppe ist, wie viele Möglichkeiten eine gegebene Sozialwelt erstickt…Der Gesang des trefflichen Clarence mahnt an schwere Probleme alles sozialen Lebens.“ Ansonsten begrüßte es Portmann, dass der knapp 100seitige Bericht sich auf die Individualität eines Vogels konzentrierte: „Wir wissen durch nüchterne Beobachtung, dass bei manchen Vogelarten gerade im Gesang starke Individualitäten sich äußern.“ Außerdem konnte sich Portmann in den Fünfzigerjahren noch darüber freuen, dass sich auch in der biologischen Forschung langsam Begriffe wie „Stimmungen“ oder „Gemütsleben“ (Jakob von Uexküll) durchsetzen: „Das Tiergemüt kommt zu Ehren,“ schrieb er (leider etwas voreilig).
.
In dem Buch von Clare Kipps hört sich das so an: „…Er nahm mir nie etwas übel und betrachtete mich von klein auf als seine Erretterin aus jeder Schwierigkeit und Klemme.“ Clarence schlief im Bett der Autorin, an ihren Hals geschmiegt. Einmal wollte eine Freundin von Clare Kipps im Bett übernachten: „Er lief das Kissen auf und ab, schalt und drohte und griff schließlich meine Freundin so wütend an, dass sie als Eindringling gezwungen war, aufzustehen…“ (Um auf der Wohnzimmercouch zu schlafen). Der erste Teil oder die Einleitung des Gesangs von Clarence „war ein Ausdruck des Vergnügens, der guten Laune und alltäglichen Lebensfreude, während der zweite Teil, das eigentliche Lied, ein Verströmen reinen Entzückens war. Beide Teile waren gewöhnlich in F-Dur, aber der zweite Teil variierte an Tonhöhe um soviel wie eine kleine Terz, je nach der Tonstärke.“
.

Hungrige Spatzen in Westberlin. Photo: Christine Engel. In der Sowjetunion galt der Spatz als „proletarischer Vogel“ – jetzt aber nicht mehr, was zur Folge hat, dass überall sein Verschwinden beklagt wird. Er folgte sozusagen der Arbeiterklasse – ins Nichts. Bei dem sowjetischsten aller sowjetischen Schriftsteller, Andrej Platonow, der einen Band mit Erzählungen „Die Reise des Spatzen“ betitelte, heißt es in seinem Roman „Tschewengur“ aus den Jahren 1926-1929: „Die Spatzen spektakelten auf den Höfen wie vertrautes Hausgeflügel, und wie schön die Schwalben auch sind, sie fliegen im Herbst in üppige Länder, die Spatzen aber bleiben hier, um Kälte und menschliche Not zu teilen. Das ist ein wahrhaft proletarischer Vogel, der sein bitteres Korn pickt. Auf der Erde können durch lange bedrückende Unbilden alle zarten Geschöpfe umkommen, aber solche unverwüstlichen Wesen wie Bauer und Spatz bleiben und halten aus bis zum warmen Tag. Kopjonkin lächelte dem Spatzen zu, der es in seinem mühseligen winzigen Leben vermocht hatte, ein großes Versprechen zu finden. Es war klar, daß ihn am kühlen Morgen kein Getreidekorn erwärmte, sondern ein den Menschen unbekannter Traum. Kopjonkin lebte auch nicht vom Brot und nicht vom Wohlergehen, sondern von unbewußter Hoffnung. ‚So ist es besser,‘ sagte er, ohne den Blick von dem arbeitenden Spatzen zu lassen. ‚Sieh an, so klein, aber wie zäh…Wenn der Mensch so wär, dann wär die ganze Welt längst erblüht.“ Nicht nur Kopjonkin, auch Tschepurny lobt die Spatzen: „Er ging zum Ziegelhaus, wo die zehn Genossen lagen, aber ihn empfingen vier Spatzen und flogen aus dem Vorurteil der Vorsicht auf den Zaun. ‚Auf euch hab ich gehofft!‘ sagte Tschepurny zu den Spatzen. ‚Ihr seid uns blutsverwandt, bloß Angst braucht ihr nicht mehr zu haben – die Bourgeoisie gibt’s nicht mehr, lebt bitte!'“ Und Dwanow freute sich, als er sah, dass ein „abgemagerter, Not leidender Spatz“ endlich Futter gefunden hatte – und „mit dem Schnabel im sättigenden Pferdekot arbeitete.“
.
Wenn Clarence es satt hatte das Publikum im Luftschutzbunker mit Tricks zu unterhalten, „nahm er eine Patiencekarte in den Schnabel und dreht sie darin zehn- oder zwölfmal herum. Das war glaube ich sein Lieblingstrick, denn er hatte ihn selbst erfunden und vergnügte sich noch jahrelang damit…Leider begann er im Frühjahr 1941 des Lebens in der Öffentlichkeit mit all seinem Glanz überdrüssig zu werden…Ich glaube nicht, dass er Sinn für Humor hatte… Es war eine sehr wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens, dass wir viele Stunden friedlicher Betrachtung in Stille zusammen genießen konnten. Ich liebe weder Geräusche noch zuviel Musik.“ Es gab aber auch Probleme: Clarence war z.B. „sehr heftig dagegen, daß ich in einem neuen Kleid erschien, und selbst ein neuer Hut oder neue Handschuhe riefen scharfen Protest hervor.“ Clare Kipps meint, erst nach seiner „verspäteten Reife bildete sich sein Charakter, und weil sein Dasein verhältnismäßig frei von Ereignissen war, blieben sein Verhalten und seine Gewohnheiten ziemlich gleich…Sein Charakter war – abgesehen von seinem wilden Temperament und der Eifersucht – ohne Makel. Es lag nichts Zerstörerisches in seinem Wesen, und nie war er gierig…“ In dem Kapitel über sein letztes Lebensjahr heißt es: „Das stolze Gebaren, das wählerische Verhalten und der tyrannische Eigensinn waren verschwunden…“ Er erwies sich als sehr weise – „es fiel mir immer schwerer, ihn als einen gewöhnlichen Vogel zu betrachten.“ Abschließend schreibt Clare Kipps: „Wenn meine Vermutung richtig ist, dann ist die Psyche eines kleinen Vogels von größerem Interesse, als es die Ornithologen bisher angenommen haben…Dass seine Intelligenz überragend war, glaube ich nicht. Ich bin klügeren Vögeln begegnet. Was ihn so interessant und reizend machte, war die Fähigkeit, durch das Medium der ungewöhnlichen Umgebung seine Vogelnatur in einer Sprache auszudrücken, die ein menschlicher Verstand begreifen und an der er teilhaben konnte. Und darin war er vielleicht einzigartig.“
.
Das läßt sich auch von meinem Spatz sagen, den ich in den frühen Sechzigerjahren großzog, leider nicht 12 Jahre lang. Er war aus dem Nest gefallen. Zwar hatte ich damals keine Ahnung vom Füttern eines solchen Jungvogels, aber meine Eltern halfen mir – wir probierten einfach alles aus. Und er entwickelte sich gut. Im Sommer kam er mit aufs Land. Und dort mauserte er sich zu unserem interessantesten Haustier. Bei Spaziergängen im Wald flog er voraus, landete aber immer wieder auf der einen oder anderen Schulter und erzählte uns von da aus alles mögliche. Er unterhielt sich gerne mit uns. Im Haus stürzte er sich auf den Frühstückstisch, landete dabei auch mal im Honig oder in der Marmelade – und mußte jedesmal mühsam gewaschen werden. Auch flog er gerne auf den in der Sonne liegenden Dackel und zupfte ihm graue Haare aus dem Fell. Mittags schlief er bei meinem Vater zwischen Schulter und Wange. Einmal schlüpfte er nachts unter den Bauch des Meerschweinchens, das ihm daraufhin gedankenverloren einige Flugfedern anknabberte. Der Spatz, der Benjamin hieß, konnte danach eine ganze Weile nur noch schlecht fliegen, er blieb aber fröhlich und unternehmungslustig und begleitete uns einfach zu Fuß auf unseren Spaziergängen. Am Liebsten fuhr er im Auto mit, wobei er sich auf die Rückenlehne des Fahrers setzte und sich auf den Verkehr konzentrierte. Monatelang erzählten wir anderen Leuten nur noch Geschichten, in denen er die Hauptrolle spielte. Und er dachte sich auch fast täglich neue Aktivitäten aus, die uns begeisterten, auch wenn sie aus seiner Sicht vielleicht schief gegangen waren. Schon bald war er unser beliebtestes Familienmitglied. Wenn einer von uns nach Hause kam, war seine erste Frage: „Wo ist Benjamin?“ „Was macht er?“ Wir kamen zu der Überzeugung, dass er sich als Mensch begriff, andere Vögel, auch Spatzen, interessierten ihn nicht, und der Größenunterschied zwischen sich und uns schien ihm nichts aus zu machen. Als er starb, der Hund hatte im Halbschlaf um sich geschnappt, als er stürmisch auf ihn zuflog – und ihn aus Versehen dabei mit den Zähnen erwischt, trauerten wir wochenlang um den Spatz, auch der Hund. Er wurde im Familiengrab auf unserem Grundstück beerdigt.
.
Ich will mit diesen „Anekdoten“, wie die quantifizierendeVerhaltensforschung ( die eigentlich Physiologie betreibt), solche Spatzen-Geschichten nennt, darauf hinaus, dass die darin enthaltene „Annäherung“. nicht im Sinne einer immer größeren „Genauigkeit“, sondern als genau der Ort des Durchgangs zu dem, was geschieht, zu verstehen ist. Das ist doch witzig.
.
.

Gepard im Zoo Rostock. Photo: Zoo Rostock Kloock.
.
.
Gänse
Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz war der Meinung: „Um eine Graugans zu verstehen, muß man als Graugans unter Graugänsen leben, muß man sich ihrem Lebenstempo anpassen. Ein Mensch, der nicht so wie ich von Natur aus mit einer gottgewollten Faulheit ausgestattet ist, kann das gar nicht,“ denn seine zehn Graugänse, mit denen er fast täglich in die Donau-Auen ging, wo sie sich ans Ufer setzten, waren einfach nur „wunderbar faul“, wie er fand. Sein Nachfolger auf der Forschungsstation, Kurt Kotrschal, hat später den Gänsen zwei Jahre lang Sonden implantiert, die ihren Herzschlag registrierten. Dabei kam heraus, dass dieser schon dann extrem in die Höhe schnellte, wenn die Tiere „soziale Kontakte zwischen ihren Artgenossen nur beobachteten!“ Anders gesagt: Lorenz‘ Gänse saßen im Gegensatz zu ihm also gar nicht faul herum, es ging bei ihnen partymäßig hoch her – nur dass sie sich dabei „nichts“ anmerken ließen. Dieser kleine Fortschritt im Wissen über Gänse hatte ein Nachspiel: Einige Tierschützer erboste das Implantations-Experiment derart, dass sie das Institut besetzten. Sie wurden daraufhin angeklagt. Bei der juristischen Klärung vorab, ob der Gänseforscher oder die Gänseschützer ein Verbrechen begangen hatten, ergab jedoch die Abwägung der Tatbestände Tierquälerei versus Hausfriedensbruch, dass das Verfahren gegen sie eingestellt wurde.
.
Das meiste Wissen über Gänse verdanken wir desungeachtet immer noch Konrad Lorenz, der dazu später – im eigenen Institut – auf die Protokolle von Gänsebeobachterinnen zurückgriff. Diese hatten seltsamerweise alle Doppelnamen, waren also wohl feministisch inspirierte Ehefrauen mit einer Festanstellung in seinem Institut. Manchmal erlaubten sie sich in ihren Notizen launige Bemerkungen in Klammern über „ihre“ benamten Gänse – z.B.: „Es sind ja auch nur Menschen!“ oder – bezogen auf einen Ganter namens Uwe, nachdem der nicht auf die Annäherungsversuche der Gans Britta reagiert hatte: „Warum sollte er auch?!“ Konrad Lorenz begann seine Gänseforschung 1923 damit, dass er das Gänschen „Martina“ auf sich „prägte“, d.h. er hatte – aus Versehen! – das erste Wort an sie gerichtet, nachdem sie in seinem Brutapparat aus dem Ei geschlüpft war. Martina hatte ihn daraufhin mit einem Auge schief angekuckt und zurückgegrüßt, was wie ein „feines, eifriges Wispern“ klang – und damit war er für immer ihre Mutter geworden. Dies bedeutete, dass er sie bei sich im Bett schlafen lassen mußte. Trotzdem wachte Martina stündlich auf und stieß ein fragendes „Wiwiwiwiwi“ aus – das Lorenz mit einem gebrochenen „Gangganggang“ beantworten mußte, erst dann schlief Martina mit einem leisen „Wirrrr“ wieder ein. Neun weiteren kleinen Gänsen, die Lorenz wenig später ebenfalls auf sich prägte, war dagegen die Geschwisterschar genauso wichtig, während Martina im Zweifelsfalle stets seine Nähe suchte, was bedeutete, dass er sie überall mit hinnehmen mußte. Der Einfachheit halber nahm er oft die neun anderen gleich mit.
.
Die heute 120 Gänse der Grünauer Forschungsstation, die weitgehend wild leben, werden noch immer als „relativ zahm“ und „ortsfest“ bezeichnet, d.h. sie folgen nicht dem allgemeinen Zug der Graugänse nach Süden – obwohl sich im Herbst durchaus noch eine gewisse „Zugunruhe“ bei ihnen bemerkbar macht. Ihr Verhalten wird dort inzwischen mit Begriffen aus der amerikanischen Gesellschaft analysiert. So beschäftigt man sich z.B. „mit den individuellen Kosten und Nutzen des Soziallebens dieser Vögel,“ wobei sich mindestens der Institutsleiter von einem strengen Darwinismus leiten läßt: „Die einzige gültige Währung im Spiel der Evolution ist, mehr reproduktionsfähige Nachkommen zu hinterlassen, als andere Individuen,“ meint er. Angeblich sehen das auch die Gänse so, denn wie bereits Konrad Lorenz in seinem Buch zur „Ethologie der Graugans: Hier bin ich – wo bist du?“ (1988) schreibt, steigt ein Gänsepaar im Rang seiner Schar im Maße es ihm gelingt, lange zusammen zu bleiben und möglichst viele Jungen groß zu ziehen. Generell gilt zwar, dass Gänse monogam leben – bis das der Tod sie scheidet, aber praktisch geht es auch in einer Gänseschar eher drunter und drüber.
.
Dazu eine Protokollzusammenfassung von Lorenz über die 1974 geschlüpfte Sinda, die zusammen mit Alma, Alfra, Jule und Blasius von Sybille Kalas-Schäfer handaufgezogen wurden, sowie die 1973 geschlüpften Florian und Markus, die zusammen mit etlichen anderen Gösseln Brigitte Dittami-Kirchmayer führte. „Zunächst scheint es, als ob Jule mit Markus und Sinda mit Blasius ginge. Später wird Jule oft mit Blasius und Sinda mit Markus gesehen. Offensichtlich ist es die Unklarheit dieser Situation, die allmählich zu einem regelrechten Haß zwischen den beiden Gantern führt. Es kommt wiederholt zu einem Flugkampf zwischen Markus und Blasius.“ Mal unterliegt Markus, mal siegt er – woraufhin „Blasius zusammenbricht und flieht, Markus kommt mit Triumphgeschrei zu Sinda und ihrer Schwester, die noch fest zusammenhalten.“ Die Kämpfe gehen weiter, Blasius muß öfter fliehen, kommt aber stets nach kurzer Zeit wieder. „Markus hält sich in Sindas Nähe auf, aber nicht zu dicht.“ Der Haß der beiden Ganter eskaliert im Frühjahr 1975 in einen dramatischen Luftkampf, dabei wird Blasius verletzt. „In der Folge geht Sinda in dichtem Zusammenhalt mit Markus, zusammen mit Alma fliegen sie in geschlossener Schar. Der Haß zwischen Blasius und Markus bleibt, allmählich kommt es zu einer Überlgenheit des Blasius. Sinda wird einmal eng mit Blasius gesehen. Kurz darauf fliegen Alma, Sinda und Markus zu dritt weg, kommen nach einigen Tagen geschlossen zurück, Blasius etwas später zusammen mit Jule, mit der er nun fest verpaart ist.“ Wenn Sinda Markus sieht, läuft sie ihm sofort entgegen und schnattert mit ihm. Eine Weile zuvor wurde Sinda oft mit Florian und seiner Gattin Nat gesehen. Markus geht nun zwar fest mit Alma, vertreibt aber nach wie vor alle Ganter, die sich für Sinda interessieren. Wenig später „wird Blasius allein angetroffen, ihm fehlen die Schulterdeckfedern. Danach findet man Jule – von einem Fuchs gerissen. Alma und Markus fangen zwei Mal an zu nisten – und brüten schließlich erfolgreich auf einem Nachgelege.“ In seinem Gänse-Buch „Hier bin ich – wo bist Du?“ erzählt Lorenz noch weitaus verwickeltere Beziehungsgeschichten.
.
Ähnlich wissenschaftlich und politisch beseelt wie Konrad Lorenz war der schwedische Jäger und Tierphotograph Bengt Berg, der ebenfalls Gänse erforschte. Was bei Lorenz die Gänsebeobachterinnen mit den Doppelnamen, war bei ihm eine selbstbewußte „dänische Gänsemagd“ ohne Namen. Und was für Lorenz „Martina“ war, wurde bei ihm „die Gans Nummer 5“. In seinem Buch „Die Liebesgeschichte einer Wildgans“ (1930) erzählt Bengt Berg, dass er sechs Gänseeier von einer Pute ausbrüten ließ. Als die Gössel schlüpften, übernahm er sie, wobei er sie beringte – mit Zahlen von 1 bis 6. Die „Nummer 5“ war die „kleinste, zarteste und schüchternste“, deswegen kümmerte er sich besonders um sie. Sie konnte bald, wie ihre fünf Geschwister, fliegen, zog es dann jedoch vor, nicht in den Süden abzuziehen, sondern in Südschweden zu bleiben – auf dem Eis in der Bucht vor Bengt Bergs Haus, wo sie sich „eifersüchtig von einem großen kanadischen Gänserich bewachen ließ (der nicht fliegen konnte).“ Im Frühjahr flog sie jedoch mit einem „jungen Graugänserich herum“. Er durfte dem Kanandaganter nicht zu nahe kommen, d.h. er und die „Gans Nummer 5“ waren nur zusammen, wenn sie aus der Bucht heraus zu ihm flog. Ihr Nest baute sie dann aber „innerhalb der Bucht“ – auf einer Schäre. Während sie mit dem jungen Grauganter unterwegs war, bewachte der alte Kanadaganter ihr Gelege und kümmerte sich dann auch um die Brut, deren Vater er vielleicht war. Sobald die Jungen jedoch fliegen konnten, wurden sie von dem jungen Grauganter – in der Luft – beschützt, vor allem gegen Adler, die damals in Südschweden noch häufig waren und es gerade auf die noch nicht so flugtüchtigen jungen Gänse abgesehen hatten. Die ersten zwei Jahre flog die „Gans Nummer 5“ mit ihrem Grauganter und ihren Jungen im Herbst nach Spanien, in den darauffolgenden Wintern blieb sie aber mit ihrer ganzen Familie bei Bengt Berg. „Da sie die Klügste war, hing alles von ihrer Überlegung und von ihrem Willen ab. Sie hatte das Vertrauen zu mir, weil ich sie großgezogen hatte. Die beiden Ganter folgten ihr, wo sie von sich aus niemals hingegangen wären. Und die Kinder – sie folgten und gehorchten ihr, aber nur ihr“.
.
.

Wasserschwein-Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
.
Kaninchen
„Kaninchen sind äußerst interessante Tiere,“ fand der Zürcher Tierpsychologe und Zoodirektor Heini Hediger. In Indien erzählt man sich folgenden Witz: Ein Europäer ist gestorben und angeblich in den Himmel gekommen. Seine Witwe will sicher sein und versucht über ein Medium mit dem Toten in Kontakt zu kommen, schließlich gelingt es ihr: Sie fragt, wie es ihm gehe? „Prima,“ antwortet er. „Wir essen ausgiebig, vögeln dann und schlafen danach, anschließend essen wir wieder was und vögeln ein bißchen, dann schlafen wir erneut, usw. – ein angenehmes Leben.“ Ich habe mir den Himmel ganz anders vorgestellt, erstaunte sich die Witwe. „Wieso Himmel? fragt ihr Mann. „Ich bin jetzt ein Kaninchen und lebe in Australien.“ Dort müssen viele Europäer ihre Wiedergeburt erlebt haben, denn bereits kurz nachdem man die ersten englischen Kaninchen 1788 in Australien ausgesetzt hatte, wurden sie – ebenso wie die weißen Siedler – zu einer wahren Landplage, indem sie von allen eingeführten Haustieren „die weiträumigsten Zerstörungen anrichteten,“ wie „australien-panorama“ weiß. Man hielt sie dort zunächst nur in kleinen Ställen zum Schlachten, aber dann setzte der Jäger Thomas Austin auf seiner Farm in Victoria 24 Wildkaninchen und Hauskaninchen aus. „Die Einführung von ein paar Kaninchen wird kaum Schaden anrichten, kann mir aber auf meinem Jagdrevier ein Gefühl von Heimat geben“, soll er seinerzeit erklärt haben. Die Farmer Westaustraliens versuchten die Kaninchen schließlich ab 1901 mit einem 3256 Kilometer langen „Rabbit-Proof Fence“ von ihrem Land fern zu halten. Zur Kontrolle wurden „Kanincheninspektoren“ eingesetzt, die auf Kamelen am Zaun entlangritten. Als das nicht half (im Gegenteil: auch die Kamele verwilderten und wurden „Schädlinge“), versuchte man es mit der künstlichen Einführung von Kaninchen-Pockenviren (Myxomatose). Der Nachteil war, dass diese „Kaninchenpest“ jedesmal auf halber Strecke bei den damit infizierten Populationen stehen blieb, weil der Rest immun dagegen geworden war. 200 australische Wissenschaftler arbeiten seitdem ununterbrochen an neuen, für die Kaninchen noch tödlicheren Ansteckungskrankheiten. 2015 berichtete „spektrum.de“: „Anscheinend ist das K5-Calicivirus die neue Superbiowaffe gegen die Kaninchenplage. Dabei handelt es sich um einen aus Südkorea importierten, deutlich infektiöseren Stamm des bereits seit 1995 in Australien verbreiteten Kaninchen-Calicivirus (RHDV).“
.
Abgesehen von dieser Ausrottungswissenschaft wird über Kaninchen so gut wie gar nicht geforscht, klagte der Heini Hediger. Auch die ganzen Institute für „Jagdwissenschaft“ (heute für „Wildbiologie“) lassen die Kaninchen meist links liegen. Hediger zufolge tragen die Jäger aber auch sowieso nur wenig zum Wissen über Tiere bei: „Ein Schuß, selbst ein Meisterschuß, ist eben niemals Beginn, sondern stets das Ende einer allzu kurzen und meist nicht sehr vielsagenden Beobachtung“.
.
Die Schüsse sagen eher etwas über die Jäger aus. Der als Sanierer auf vielen Gütern des preußischen Adels tätig gewesene Alfred Henrichs berichtete in seiner Biographie „Als Landwirt in Schlesien“, dass man u.a. auf der Herrschaft Buchenhöh (vormals und ab 1945 wieder Zyrowa genannt) riesige Mengen Fasane für die Jagd aufzog, an die jährlich 60.000 Hühnereier aus Galizien verfüttert wurden, zusammen mit einer Unmenge von Kaninchen, die zu diesem Zweck mit Haut und Haaren gekocht und durch den Fleischwolf gedreht wurden. Für ihr eingezäuntes Freigelände war ein „Karnickeldirektor“ verantwortlich, für das in Volieren gehaltene Federvieh ein „Fasanenmeister“. Wenn die Vögel ausgewachsen waren, wurden sie frei gelassen, aber weiter gefüttert – bis zum Tag der Jagd, an dem laut Henrichs „alles abgeschossen wurde, was vor die Flinte kam“. An einem solchen Jagdtag erschossen fünf Adlige, hinter denen jeweils zwei Büchsenspanner gingen, rund 2500 Tiere – meist Fasane und Kaninchen. Die Jagd bildete bei vielen Magnaten laut Henrichs „Das Zentrum ihres Denkens“, dem Grafen auf Buchenhöh machte es wenig, dass seine Fasanen- und Kaninchenaufzucht irrsinnige Summen verschlang, er hatte Mary, die Tochter eines amerikanischen Millionärs, geheiratet. Wichtig war ihm vor allem, gelegentlich den Kaiser als Jagdgast bei sich zu haben. „Ich erinnere mich eines Gutshauses, dessen zugehörigen Betrieb ich betreute, in dessen Salon in einer Virtrine ein weißer Damenhandschuh aufbewahrt und wie eine Reliquie verehrt wurde. Ihn hatte die Dame des Hauses getragen, als sie dem Kaiser vorgestellt wurde und er ihr einen angedeuteten Handkuß gewidmet hatte.“
.
In Berlin lebten bis 1989 zigtausend Kaninchen unbehelligt im Todesstreifen zwischen dem antiimperialistischen Doppelschutzwall. Sie gehörten der DDR, aber der Westberliner Verleger Wagenbach kümmerte sich um sie – publizistisch. Als die Mauer fiel, war Schluß mit lustig – auch für die Kaninchen: Sie verteilten sich im gesamten Stadtraum. Eine Gruppe lebte sogar auf der kleinen Verkehrsinsel des Moritzplatzes. Für einige Zeit sah man sie überall, aber nun berichtet der Naturschutzbund (NABU), „dass man heute oft vergeblich nach ihnen sucht, da ihre Zahl deutlich zurückgegangen ist.“
.
Hediger hat Wildkaninchen auf dem Land erforscht, Wagenbach die auf dem Grenzstreifen. Jetzt haben Ökologen der Frankfurter Universität einige wesentliche Unterschiede im Leben von Wildkaninchen in der Stadt und auf dem Land entdeckt. Es geht dabei im Wesentlichen um unterschiedliche Reviergrößen. Wer den rührend naturalistischen Kaninchenroman „Unten am Fluß“ (1972) von Richard Adams gelesen hat, weiß: Auf dem Land lebende Wildkaninchen siedeln in großen Gemeinschaftshöhlen. In der Stadt „schrumpfen dagegen ihre Bauten, es gibt sogar Singlewohnungen,“ berichtete die SZ. Der Bayreuther Biologe Dietrich von Holst erforschte 20 Jahre lang Wildkaninchen auf einem großen Versuchsgelände. Manchmal starb bis zu 80 Prozent seiner Population – durch Krankheiten und Raubtiere, aber sie erholte sich auch immer wieder dank der enormen Vermehrungsrate seiner Nagetiere. Ihre durchschnittliche Lebensspanne betrug zweieinhalb Jahre, dominante Tiere wurden bis zu 7 Jahre alt, während die rangniedersten schon wenige Tage nach Eintritt der Geschlechtsreife vor lauter Angst-„Stress“ dahinsiechten. Wenn Nahrungsknappheit droht, können die Weibchen ihre Föten zurückbilden.
.
Bei den Kindern sind Zwergkaninchen sehr beliebt, die sie gerne mehrmals am Tag mit Apfelshampoo waschen („Kaninchen mögen doch gerne Äpfel!“). Weil sie sich so schnell vermehren, sind sie auch beliebte Kindergeburtstagsgeschenke – zum Entsetzen der betroffenen Mütter, die sie erst einmal auf dem Balkon absetzen. Dort vermehren sie sich dann ohne Rücksicht auf das Inzesttabu munter weiter. Ich half einmal einer Prenzlauer Berg Mutter, sie immer wieder los zu werden. Schon nach kurzer Zeit winkten alle Kinderbauernhöfe ab: „Wir haben bereits zu viele!“ Schließlich trug ich sie zum Zoo in Charlottenburg, wo ich mich am Wirtschaftshof jedesmal in eine lange Schlange von Müttern mit Kaninchen und Meerschweinchen einreihen mußte. Die Kuscheltiere werden dort in einer großen Halle in zwei Gehegen gehalten. Einmal bemerkte eine Mutter, als sie ihr Kaninchen zu den anderen setzte, dass es von drei Rammlern heftig bedrängt wurde. Sie war entsetzt. Die Tierpflegerin konnte sie jedoch beruhigen: „Keine Angst, das gibt sich bald.“ Zufriedengestellt verließ die Mutter die Halle. Zu mir gewandt meinte die Pflegerin daraufhin: „Aber bis dahin haben wir es längst verfüttert“. Das Leben eines Kaninchens ist weder lang noch witzig. Ich hatte allerdings eins, ein großes braunes mit Namen Christoph, das einmal in der Woche voller Übermut unseren Dackel und die Katze durch die Wohnung jagte. Immer im Kreis. Allen dreien schien diese Umdrehung des Verhaltens von Beutetier und Raubtier großen Spaß zu machen.
.
.

Zebrafohlen im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Maria Fencik.
.
.
Kakerlaken
Komisch: Je größer und dreister die Kakerlaken, desto eher nimmt man an, dass sie aus dem Osten stammen, hier nennt man sie polnische Kakerlaken, dort russische. In umgekehrter Richtung, aus dem Westen, vermutete man die Herkunft der die „Lustkrankheit“ Syphilis übertragenden Bakterien: Hier sprach man von der französischen Krankheit , dort von der spanischen. Die gemeine „deutsche Küchenschabe“ heißt auch in Amerika „deutsche Küchenschabe“. Dort gibt es daneben noch einige andere Kakerlakenarten – u.a. die „Waldschaben“. Während die Küchenschaben ähnlich den Mehlwürmern Allesfresser sind, haben die Waldschaben sich auf Zellulose spezialisiert. Ihre Darmflora ist ähnlich zusammengesetzt wie die der Termiten. Im Gegensatz zu den Mehlkäfern machen die Kakerlaken keine Metamorphose durch: Sie überspringen das Larven- und Puppenstadium quasi und schlüpfen fertig aus dem Ei. Anfangs sind sie noch klein und haben noch keine Flügel, sie müssen sich mehrmals häuten. Aber Kakerlaken ebenso wie Mehlkäfer fliegen sowieso nicht gerne.
.
Im Haus werden die „Küchenschaben“ meist totgetreten oder sonstwie umgebracht, wenn man sie erwischt. Wegen der feuchtwarmen Luft halten sie sich auch gerne in Bienenstöcken auf. Die amerikanische Imkerin Sue Hubbell schreibt in ihrem Buch „Leben auf dem Land“ (2016), dass sie anfangs die „amerikanischen Schaben“, die sie regelmäßig beim Öffnen ihrer Bienenstöcke fand, mit dem „Stockmeißel“ entzweischnitt. Und jedesmal rannte das hintere Ende weg, das offensichtlich auch ohne den Kopf bestens funktionierte.“ Laut einer US-Kakerlakenstudie sollen sie sogar mit abgeschnittenem Kopf noch „lernfähig“ sein. Sue Hubbel überließ dagegen bald ihren Bienen die Aufgabe, die Schaben und deren Eier aus dem Stock zu werfen.
.
Der Philosoph Martin Heidegger hatte bereits zum Beweis seiner These, dass Tiere „weltarm“ seien, auf ein ähnliches Experiment von Insektenforschern zurückgegriffen: „Es ist beobachtet worden“, führte er in seiner Vorlesung 1929/30 über „Die Grundbegriffe der Metaphysik“ aus, „daß eine Biene, wenn man ihr den Hinterleib während des Saugens vorsichtig wegschneidet, ruhig weitertrinkt, während ihr der Honig hinten wieder herausfließt. Das zeigt schlagend, daß die Biene in keiner Weise das Zuvielvorhandensein von Honig feststellt. Sie stellt weder dieses fest noch auch nur – was noch näher läge – das Fehlen ihres Hinterleibs…Sie ist einfach von dem Futter hingenommen. Diese Hingenommenheit ist nur möglich, wo triebhaftes Hin-Zu vorliegt.“ Das Tier nimmt damit in der Heideggerschen Entwicklungskonzeption eine mittlere Position ein – zwischen dem „weltbildenden“ Menschen und dem „weltlosen“ Stein. Bei einem anderen Experiment von Insektenforschern schnitt man den Bienen kurzerhand die beiden Fühler ab, um aus dem daraus resultierenden Orientierungsverlust zu schließen, welche Wahrnehmungsaufgaben ihre Fühler haben (eine Menge!). Bei weiteren Experimenten bohrte man sogar den winzigen Kopf von Bienen auf, um zu kucken, was da drin ist. Seitdem die US-Regierung und die EU die Gehirnforschung mit mehreren Milliarden Dollar bzw. Euro fördern und damit nach dem Gen-Hype einen ganz neuen Geschichtsabschnitt, die „Neuro-Ära“, eingeleitet haben, werden noch ganz anderen Tieren die Schädel geöffnet.
.
Zurück zu den „Waldschaben“: Bei der Imkerin Sue Hubbell gelangen sie mit dem Brennholz ins Haus, aber das ficht sie nicht an: „Ihr Verdauungsapparat und meiner sind so verschieden, dass wir nicht dieselbe ökologische Nische bewohnen.Wir sind keine Konkurrenten, also kann ich Nachsicht mit ihnen üben, d.h.ich muß sie nicht vertreiben,wie die Bienen es tun, oder sie zerquetschen,wie eine Hausfrau es tun würde.“ Stattdessen begriff die Autorin sich als Teil eines neuen, „noch im Versuchsstadium befindlichen Lebensform-Experiments“ der harmlosen Waldschaben in ihrer Hütte, an deren „Körperbau die Evolution seit dem Oberkarbon fast spurlos vorübergegangen ist. 250 Millionen Jahre sind wirklich eine lange Zeit.“ Mindestens so lange gibt es die Kakerlaken bereits. Der Anthropologe Hugh Raffles interessierte sich ebenfalls für Kakerlaken. In seiner „Insektopädie“ (2013) legt er jedoch nahe, dass es ihm nicht recht ist, wenn ein solches Tier sich umgekehrt auch für ihn interessiert: Als eine besonders dicke Kakerlake ihm einmal von oben, von der Schiene des Duschvorhangs aus, zusah, wie er sich wusch, war ihm das zu viel – und er erschlug sie.
.
Anders der in Berlin lebende russische Maler Nikolai Makarov: Er und seine Freunde waren gerade an den dicksten Küchenschaben interessiert, mit denen sie regelmäßig „Kakerlaken-Rennen“ in ihrem „Tarakan-Klub“ veranstalteten („Tarakan“ heißen die Kakerlaken auf Russisch). Die Tiere wurden zwar von Makarov gefangen gehalten – in kleinen Terrarien, dafür wurden sie regelmäßig mit den besten Lebensmitteln gefüttert, was ihnen wahrscheinlich in den letzten 250 Millionen Jahren noch nie passiert war. Auch nicht, dass man sie mit Namen ansprach. „‚Ivan der Schreckliche‘ gegen die ‚Ehrgeizige Olga‘,“ titelte die FAZ, „beim Kakerlaken-Wettrennen avanciert die gemeinhin als abstoßend empfundene Küchenschabe zum umsorgten und bejubelten Wettkämpfer.“ Der Zeitung erzählte der Maler (der nebenbeibemerkt gerne die Stille malt): „Die Idee habe ich vom Dichter Michail Bulgakow, in seinem Buch ‚Die Flucht‘ beschreibt er, wie sich russische Emigranten im Exil mit Kakerlakenrennen die Zeit vertrieben.“ Die FAZ fügte hinzu: „Inzwischen verweist Makarov auf einen illustren Kakerlaken-Fan-Kreis: Banken, die Berlinale, Modemessen, ein Theaterfestival buchten die schräge Schau. Auch ins Fernsehen zu Stefan Raab hat es Makarov schon mit seinen ‚Haustieren‘ geschafft.“
.
Es gibt auch noch zwei Kakerlaken-Romane, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben: Zum Einen „verfressen, sauschnell, unkaputtbar“ von Hans-Hermann Sprado. Er erzählt darin, wie er in einem Hotelzimmer in Kontakt mit einigen großen Küchenschaben kam, die er „selbst mit roher Gewalt nicht außer Gefecht setzen konnte.“ Woraufhin er „immer mehr Respekt für diese Tiere entwickelte,“ die ihm schließlich zu „dem Erfolgsmodell der Evolution“ wurden. Der andere Roman – von Daniel E. Weiss: „La Cucaracha oder die Stunde der Kakerlaken“ handelt von einer hochgebildeten Kolonie „deutscher Schaben“, die in der New Yorker Wohnung eines jüdischen Juristen leben, wo sie sich in seiner Bibliothek eine erstaunliche Bildung angefressen haben. Ihr eher kontemplatives Dasein wird jedoch gestört, als der Jurist von seiner kakerlakenfreundlichen Freundin verlassen wird und eine neue Freundin bei ihm einzieht, „die sich als Putzteufel und neurotische Hygienefanatikerin entpuppt.“
.
Ihre cucharachafeindlichen Aktivitäten nützen jedoch nichts: „Sind Schaben im Haus, vermag Hygiene wenig. Denn die Allergieerregende Substanz, die von den Schaben hinterlassen wird, wenn sie nur über eine Wurst oder einen Teller laufen, verträgt sogar einstündiges Kochen bei 100 Grad,“ wie die US-Allergieforscher Halla Brown und Harry Bernton herausfanden. Der Schriftsteller Daniel E. Weiss schreibt, dass die Schaben die Bücher als „Larven“ fraßen, sich demnach also auch wie die neue Freundin seines Protagonisten irgendwann „entpuppten“. Das ist wie oben erwähnt falsch, richtig ist jedoch, dass sie „auch Papier, Tinte und Stiefelwichse verzehren,“ wie der Kakerlakenforscher und Nobelpreisträger Karl von Frisch herausfand. Man kann sie allerdings erziehen: In der Frankfurter Wohnung des Künstlers Johannes Beck und des Trendforschers Matthias Horx gab es einen großen WG-Tisch, in dessen Mitte ein Porotonstein lag. Als ich sie bei einem Frühstück nach dem Grund fragte, erfuhr ich, dass ihre Kakerlaken darin wohnen. Sie kämen jedoch erst nach dem Essen raus, um sich die Reste zu holen, danach würden sie sich diskret wieder in ihren Stein zurückziehen.
.
.

Schneeleopard „Fiete“ im Rostocker Zoo. Photo: Zoo Rostock. Der Panthera uncia zählt laut der Süddeutschen Zeitung zu den scheuesten Raubkatzen der Welt – und die müssen es ja wissen, die Münchner „Edelfedern“ (Brigitte) kennen sich sogar in den geheimsten Ecken Berlins aus. Dort – im Tierpark – leben übrigens gleich drei Schneeleoparden und sie sehen alle intelligenter aus als der hier auf dem Photo. Im Wuppertaler Zoo konnte ein Schneeleopard aus seinem Gehege entkommen, wurde aber kurze Zeit später betäubt und in seinen Käfig zurückgebracht. Die Schneeleoparden im Karlsruher Zoo wurden ins Himalaya-Gebirge verfrachtet. Im Basler Zoo sind die Schneeleoparden angeblich „in Hochform“. Die Schneeleopaqrden im Central Park Zoo von New York lassen angeblich „so manches Herz höher schlagen“. Die Zürcher Schneeleoparden ziehen nach Polen und in die USA. Die SZ schreibt, dass die Schneeleoparden am Himalaya bald aussterben könnten – wenn ihre Beutetiere, Bergschafe und wilde Ziegen wegen der Klima- und Landschaftsveränderung verschwinden und sie verstärkt auf Nutztiere ausweichen müssen. Ähnliches gilt für die Mongolei und Kasachstan. Außerdem nimmt die Wilderei zu, Schneeleopardenfelle sind begehrt. „Das Leben der Schneeleoparden ist nur mühsam zu erforschen,“ schreibt die SZ, die immer wieder über dieses scheue Tier berichtet: „Wandern im Himalaya. Auf dem Pfad des Schneeleoparden“, „Der Pfad des Schneeleoparden“„Australische Skifahrer treffen auf Schneeleoparden“, „Ein Tag für Schneeleoparden“, „Schneeleoparden-Nachwuchs im Dresdner Zwinger“, „Im Neunkirchner Zoo findet ein ‚Tag des Schneeleoparden‘ statt“, „Der Schneeleopard greift an“, „Schneeleoparden haben blaue Augen“. Im Görlitzer Tierpark können „SZ-Card-Besitzer“ kostenlos die beiden Schneeleoparden dort beobachten. „Beim Schneeleoparden verwischen die Grenzen zwischen Fabeltier, Phantom und Realität,“ so einen Quatsch schreibt allerdings nicht die SZ, sondern „Die Welt“.
.
.
Waschbären
Mindestens seitdem der Strom der „Wirtschaftsflüchtlinge“ (heute „Refugees“ genannt), nach Lampedusa einsetzte, hat sich der Streit, ob Deutschland ein „Einwanderungsland“ ist oder sein sollte, auf Tiere und Pflanzen ausgedehnt, wenn nicht gar verlagert. Kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Massenmedium mit neuen „Erkenntnissen“ über „invasive Arten“ aufwartet und Ratschläge gibt für einen durchaus vernünftigen Umgang mit ihnen. Der TV-Sender Arte schickte mir neulich schon unaufgefordert seinen Film „Invasion der Pflanzen. Gefahr für Umwelt und Mensch“ zu. Das „Neue Deutschland“ veröffentlichte eine ausschließlich der Vernunft verpflichtete Zusammenfassung der Debatte über tierische und pflanzliche Ausländer: „Die Mehrheit der Wissenschaftler ist dabei einer Meinung: Invasive Arten sind in der Summe als kritisch für das Ökosystem anzusehen.“ Dazu scheint für den ND-Autor auch die Menschenwelt zu zählen – ja, vor allem sie, denn als Beispiele erwähnt er einige ausländische Pflanzen, die sich hier, einmal eingeschleppt, unglaublich vermehren – und „Allergien, Hautausschläge“ etc. hervorrufen. Es gibt inzwischen ganze Sondereinheiten – auf Basis von 1-Euro-Jobs, die mit Schutzanzügen anrücken, um sie auszurotten. Die gleichen, für Menschen unangenehmen Pflanzen sind jedoch bei den Bienen äußerst beliebt, weswegen sie z.B. von den Imkern geschätzt werden: Sie protestieren gegen ihre „sinnlose Vernichtung“.
.
Bei den Tieren werden u.a. die aus Amerika importierten und ab 1929 in Westdeutschland ausgewilderten bzw. 1945 aus einer zerbombten Zuchtfarm in Ostdeutschland entkommenen Waschbären erwähnt: „Sie dezimieren die hier heimische Vogel- und Amphibienwelt.“ Ihnen treten die Jäger entgegen, indem sie regelmäßig eine sogenannte „Bestandsregulierung“ vornehmen. Der Waschbär darf hierzulande ganzjährig gejagt werden. Allerdings muß man jedes tote Tier amtlich registrieren lassen. 2013 wurden allein in Berlin und Brandenburg 20.300 Waschbären „erlegt“. Das Brandenburger Agrarministerium bilanzierte dies als eine Art wirtschaftspolitischen Erfolg: „In nur vier Jahren verdoppelte sich die Strecke…“ Gemeint ist mit diesem Jägerdeutsch-Euphemismus die Zahl der erlegten Tiere, die nach dem Halali vermüllt werden, denn wer will heute noch mit so einer albernen Waschbärmütze mit Schwanz hintendran oder gar mit einem ganzen Waschbär-Pelzmantel herumlaufen? Ersteres trugen nach dem Krieg die verhinderten Trapper, letzteres die ungehinderten Zuhälter.
.
Auch in den anderen Bundesländern mußten 2013 zigtausende von Waschbären dran glauben. Dennoch warnte eine Schweizer Zeitung: „Waschbär ist auf dem Vormarsch Richtung Südostschweiz“. Die FAZ titelte: „Die Rasselbande zerstört alles“, der „Spiegel: „Randale unterm Dach“, und die „Welt“: „Terror-Waschbären richten immense Schäden an“. Die „Zeit“ pries gar die unsere Wälder von diesem Schädling befreienden Jäger als verantwortungsvolle Ökologen – mit der Überschrift: „Von wegen Spaß am Tiere-Töten.“ Im „Merkur“ priesen sich daraufhin die Jäger selbst: „Wir sind Naturschützer“. Darüberhinaus finden sich im Internet mittlerweile hunderte von Seiten über (technische) „Schutz- und Abwehrmaßnahmen“, so dass selbst Nichtbewaffnete gegen die Waschbären aktiv werden können. Daneben findet man aber auch anrührende Feuilletons – z.B. von Rentnern, bei denen eine Waschbärfamilie auf dem Dachboden oder im Kamin lebt.
.
Der „Anti-Jagdblog“ gibt unter der Überschrift „Jäger erlegen so viele Waschbären wie nie zuvor“ zu bedenken, dass noch einmal so viele alljährlich überfahren werden. Die Tierschützerin Marianne schreibt: „Ja, dieses Brandenburg ist landschaftlich schön, nur leider ist es das Land, mit der größten Dichte an Mördertürmen, Fallen, Kirrstellen, Ansitzen und Mörderpack. Am Rande von Berlin und Potsdam sind die Wälder gespickt mit Blutbader [Jägern] und trotzigen Bauwerken [Hochständen], die den Wildtieren den Garaus machen. Der Minister ist selbst Blutbader und Befürworter der Massentierhaltung. Leider sind die Brandenburger nicht sehr aufgeklärt, aber zum Glück werden die Jagdgegner immer mehr.“ Neben den Jägern und den Wirtschaftsförderern sind es vor allem die Singvogel-Freunde und Besitzer von Obstbaumgärten, die etwas gegen Waschbären haben.
.
Auf der anderen Seite verhält es sich bei den Waschbär-Forschern so wie bei allen Erforschern von Tierarten: Sie sind von ihren im Grunde harmlosen und ebenso rührenden wie klugen Untersuchungsobjekten derart eingenommen, dass sie sich mit der Zeit gradezu zu ihren Sprechern, Waschbärensprechern, aufschwingen. Dies gilt z.B. für den Biologen Ulf Hohmann und den Tierphotographen Ingo Batussek. Für ihren Forschungsbericht „Der Waschbär“ (2011) beobachteten sie im Sollinger Forst bei Höxter jahrelang den nachtaktiven, gerne auf großen Eichen lebenden Kleinbären mit ihren Nachtsichtgeräten, sie fingen sich welche in Fallen und statteten sie mit Sendern aus oder ließen sie von Diplomstudentinnen großziehen, damit sie das Verhalten dieser halbzahm gewordenen Tiere später auch noch in Freiheit bequem, quasi von Nahem, studieren konnten. Diese Mischung aus Zoo- und Feldforschung wandte bereits Konrad Lorenz erfolgreich bei Graugänsen an, von denen eine, Martina, es sogar zur Berühmtheit brachte.
.
Den Göttinger Waschbärforschern wurde diese etwas aufwändige Methode von der NDR-Redaktion „Expeditionen ins Tierreich“ finanziert. Die Jungtiere dafür erwarben sie bei einem sauerländischen Waschbärzüchter. Ihre „handaufgezogenen“ Waschbären galten den Forschern schon bald als „Botschafter in eigener Sache“. Im Internet werden heute jede Menge Waschbären angeboten: „albino, blonde, elfenbeinfarbene und naturfarbene“. Auf einer Internetseite fand ich den Hinweis: „Zuerst sollten Sie genau wissen, was Sie sich holen, wenn Sie einen Waschbär kaufen. Wussten Sie, dass ein Waschbär Ihr Anwesen zerstören kann, wenn Sie ihn nicht richtig pflegen? Zum Beispiel ist es bekannt, dass Waschbären Kabeldrähte ausgraben. Außerdem sind sie kaum zu zähmen…“ Das ist nicht unbedingt eine Werbung für den Waschbär als Haustier.
.
Selbst die Waschbärliebhaber Hohmann und Bartussek geben unumwunden zu: „Der Waschbär ist kein Haustier und wird es nie werden. Daran ändern auch die Beteuerungen so mancher Tierhändler nichts.“ Das hält sie jedoch nicht davon ab, im letzten Kapitel ihres Buches „Tipps und Tricks zu Aufzucht und Haltung von Waschbären“ zu geben – und sich sogar zu fragen: „Doch als Haustier?“ Dazu heißt es: „Wenn man sich entschlossen hat, Waschbären im Haus zu halten, muss bedacht werden, dass wir für unseren Pflegling fortan seine ‚Waschbärgruppe‘ sind.“ Und das bedeutet u.a., dass wir als „Sparringpartner“ für seine wilden Beiß- und Kratz-Spiele herhalten müssen, dafür sind wir Menschen aber zu dünnhäutig: „Nur ein robuster, im Haus lebender Hund kann diese Aufgabe übernehmen.“ Mit dem Kauf eines Waschbären sollte man sich also am Besten auch noch gleich einen großen Hund anschaffen. Die beiden Waschbärenforscher haben das selbst ausprobiert – und können deswegen lustige Geschichten darüber erzählen. Einen kastrierten Waschbär namens Willi ließen sie fast ein Jahr lang Nachts raus, das sei in einem bewohnten Gebiet jedoch nicht zu empfehlen, meinen sie, denn „die Tierliebe und Toleranz sämtlicher Nachbarn wurde dabei auf eine harte Probe gestellt.“ Am Stadtrand von Berlin sehen dagegen viele Bewohner rot, wenn sie einen Waschbären in ihrem Garten erblicken: Sofort rufen sie einen Jäger an, der ihnen das Tier mit einer Falle wegfängt – und tötet.
.
In meiner Familie hatten wir immer viele Tiere, dabei wurde kein großer Unterschied zwischen Mensch und Tier gemacht. Heute würde ich auch die Pflanzen da mit einbeziehen, der Vegetarismus ist also keine Option für mich. Beim Waschbären würde ich auch erst einmal – wie die beiden Waschbärenforscher – eine „Inklusion“ ins Auge fassen, wobei mir bewußt wäre, dass Waschbär nicht gleich Waschbär ist. Das Prinzip „Kennst du einen, kennst du alle“ gilt gerade bei Waschbären nicht: Jeder ist auf eine andere Art gewaschen. Und im übrigen waschen sie ihre Nahrung gar nicht vorm Verspeisen, sondern suchen gerne unter Wasser nach Eßbarem (kleine Krebse z.B..). Dazu haben sie hypersensible Vorderpfoten: „Der Tastsinn ist die unumstrittene Geheimwaffe des Waschbären,“ schreiben Hohmann/Bartussek, „kein anderes Tier reserviert sich für die Interpretation der taktilen Reizimpulse aus den Handflächen so viel Hirnmasse wie der Waschbär.“ Er hat dafür genau „so viele graue Zellen, wie wir für die Reizverarbeitung unseres wichtigsten Sinnesorgans, des Auges, bereithalten.“ Mit der Folge: Wenn Waschbären im Wasser herumtasten „blicken sie ins Leere und wirken dabei merkwürdig abwesend.“ Neben ihrem Tastsinn ist aber auch ihr Geruchssinn „ausgezeichnet“: zwei Sinne, die wir eher vernachlässigen – seit einigen zigtausend Jahren schon. Ein Waschbär wäre in dieser Hinsicht also eine sinnvolle Ergänzung zu uns. Das wollte ich hier nur mal zu bedenken geben – an die Adresse der Gebildeten unter den Waschbärverächtern.
.
.
Mhorrgazelle im Tierpark Hellabrunn. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
.
Sirenen
Die Hamburger Firma „J.F.G. Umlauf“ verkaufte Naturalien und Kuriositäten aus Übersee. „Für mehr als 100 Jahre bestimmte das Unternehmen den deutschen Markt für Zoologica, Ethnografica, Anthropologica und plastische Bilder vom Menschen,“ schreibt Britta Lange vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in ihrem Buch „Echt. Unecht. Lebensecht“ über die Firma Umlauff.
.
Für die Wissenschaftler brauchte es gesicherte Informationen über die Herkunft der Objekte, wenn sie die Objekte für ihre Museen und Institute erwerben wollten. Deswegen waren „Erzählungen ein Hauptgegenstand des Umlauffschen Geschäfts.“ In den Völkerschauen, mit denen Zoos und . Weltausstellungen beschickt wurden, ging es um eine Darstellung der „evolutionistischen Wissenschaftsauffassung“, die analog zur Naturgeschichte eine evolutive Kulturgeschichte postulierte: wenn dort die Entwicklung vom Urfisch zum Menschenaffen fortschritt – dann hier von den Hottentotten zu den Engländern.
.
Einer der Umlauff-Söhne kam über das glänzende Geschäft mit „afrikanischen Mumien“ darauf, es auch mit Meerjungfrauen zu versuchen: „Der Körper wurde gebunden, auf den Rumpf ein schlechter Frauenschädel gesteckt und dieser ausmodelliert. Die Hände wurden aus Affenhänden gemacht, hieran ganz lange Nägel und die andere Hälfte – das Hinterteil – war mit einer grossen Fischhaut überzogen. Auf dem Kopf eine blonde Perücke.“ An diesem Objekt waren vor allem russische Schausteller interessiert. Umlauff schreibt: „Ich verkaufte in einem Jahr 15 Stück, und alle, die sie kauften, sind reiche Leute geworden, natürlich in Russland.“
.
Noch im 18. Jahrhundert hatte der dänische Bischof Erik Potoppidan die Existenz von „Meermaiden“ bestätigt und der dänische Anatom Caspar Bartholin diese Wassernixen zusammen mit den Menschen und Affen als „homo marinus“ klassifiziert. Als Goethe Neapel besuchte, wollte er den homerischen Nixen nachspüren: „Und nun locken mich die Sirenen, und wenn der Wind gut ist, gehe ich mit diesem Brief zugleich ab – südwärts,“ schrieb er „leichtlebig“, kam dann jedoch nie wieder auf seine Sirenensuche zu sprechen.
.
Zu sehen gab es eine sogenannte „Sirenide“ in der 1870 vom Biologen Anton Dohrn gegründeten Meeresforschungsstation in Neapel – in einem seiner dortigen Aquarien. Der auf der Sireneninsel Capri lebende faschistische Theoretiker Curzio Malaparte berichtet in seinem Buch „Haut“ (1950), dass dieser „Fisch“, wie fast alle anderen in Dohrns Aquarien auch, 1944 vom Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte getötet wurde – um anschließend von ihnen gegessen zu werden. Malaparte will selbst bei diesem Sieger-„Gastmahl des Meeres“ mit dabei gewesen sein. Weil aber das „zur Gattung der Sirenoiden“ gehörende Meerestier („dessen Flanken in einem Fischschwanz endeten – genau wie von Ovid beschrieben“) einem kleinen toten Mädchen zum Verwechseln ähnlich sah, habe eine der anwesenden weiblichen US-Offiziere darauf bestanden, den „Fisch“ stattdessen ordnungsgemäß im Garten der Forschungsstätte zu bestatten.
.
Die Koreaner und Japaner nennen ihre sportlichen Muscheltaucherinnen anerkennend Meerjungfrauen bzw. Sirenen. Für die pragmatischen Amerikaner sind Sirenen jedoch das, was wir „Seekühe“ nennen – gemütlich-dicke Meeressäugetiere in tropischen Gewässern. Früher gab es auch welche in sibirischen Gewässern. Diese „Stellerschen Seekühe“ wurden jedoch 27 Jahre nach ihrer Entdeckung ihres Trans und Fleisches wegen ausgerottet. Die mit Elefanten verwandten Seekühe ernähren sich von Seegras und stillen ihr Junges mit Milch aus Brüsten, die sich wie bei den Menschen vorne auf der Brust befinden, zudem können sie es mit ihren zwei Flossen Armen gleich umfassen. Sie sind quasi natur-zahm und beschäftigen in den USA zu ihrem Schutz hunderte von „Siren-Guards“, -Juristen und -Behördenmitarbeiter.
.
Sie sehen allerdings weder wie die auf antiken Vasen dargestellten Sirenen aus, noch singen sie wie die von Homer geschilderten. Das gilt auch für die bis zu ein Meter langen Arten der Gattung „Siren“, die man auf Deutsch „große Armmolche“ nennt, weil sie nur Vorderbeine haben, dazu Lungen und Kiemen. Sie gehören zur Familie der „Sirenidae“, leben an der Küste Floridas, ernähren sich von Pflanzen und halten Sommerschlaf.
.
Der Ostberliner Tierpark hält einige Seekühe im Dickhäuterhaus. Sie ernähren sich von oben schwimmendem Kopfsalat – also genau andersherum als in Freiheit. Der Tierpfleger kommt dafür regelmäßig im Taucheranzug in ihr Wasserbecken und streichelt sie: „Die brauchen das zu ihrem Wohlbefinden.“
.
Im Medizinhistorischen Museum der Charité sind in Alkohol konservierte „Sirenen“ ausgestellt. Es handelt sich dabei um zwei tote Säuglinge – „menschliche Fehlbildungen“: Bei der einen – „Sirenoiden“ – fehlten „die Beinanlagen, der Harntrackt und die Geschlechtsorgane“ – der Körper ging stattdessen ab der Hüfte in eine Art Schwanz über. Der anderen – „Sirenomelie“ – fehlten „Beine, Geschlechtsorgane, Niere, Blase und Enddarm“, man ließ sie wohl gleich nach der Geburt sterben. Für ihre „sirenoiden Fehlbildungen“ machen die jetzigen Kuratoren „übermässigen Alkoholgenuß der Mütter“ verantwortlich.
.
Nicht erst seit der romantischen Geschichte „Undine“ von Friedrich de la Motte Fouqué über eine Nixe, die sich unglücklich in einen Lands-Mann verliebte, weiß man, dass der Mensch den Sirenen ins Wasser folgen sollte – und nicht umgekehrt, weil das immer schlecht ausgeht. Ingeborg Bachmanns Erzählung „Undine geht“ von 1961 endet da noch harmlos. Auch hier kehrt die Meerjungfrau enttäuscht zurück: „unter Wasser“, wendet sich aber noch einmal, ein letztes Mal, an den Mann, an die Männer – „Ungeheuer“ und „Verräter“ allesamt! Gedacht ist dabei vielleicht an die unendlich vielen jungen Frauen, die von einem treulosen Schuft geschwängert wurden und keinen anderen Ausweg wußten, als sich im Mühlteich zu ertränken – von wo aus sie die Männer in ihren Schuldgedanken und Alpträumen als Seejungfrauen heimsuchten.
.
Die feministische Anthropologin Elaine Morgan wies 1982 (in: „The Aquatic Ape“) nach, dass die Frauen einst, nach Verlassen der Bäume, erstmalig Schutz vor ihren Feinden im Wasser gesucht hätten. Dort lernten sie den aufrechten Gang, die Schmackhaftigkeit der Meerestiere, bekamen eine glatte, unbehaarte Haut, veränderten sogar ihre weibliche Anatomie und wurden intelligent und verspielt (so wie im übrigen alle Säugetiere und Vögel, die zurück ins Wasser gingen). Während die Menschenmänner dagegen quasi auf dem Trockenen hocken blieben. Elaine Morgans Studie endet jedoch versöhnlich: „Wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und ihnen zu sagen (zu singen): ‚Kommt nur herein! Das Wasser ist herrlich!’“
.
Für Odysseus war das ein „verderblicher Gesang“ (er wollte unbedingt nach Haus zu seiner Familie und machte, das er weiter kam). Erst der Homerforscher Friedrich Kittler wollte genau hinhören – und organisierte dazu 2003 eine Schiffexpedition in die Gewässer um die Sireneninsel Capri als eine Form „empirischer Philosophie“. Kittler brachte von seiner Fahrt, an der sich mehrere Sängerinnen und der Leiter des Tierstimmenarchivs der Humboldt-Universität beteiligten, eine Menge „Audio-Material“ mit. Es ist auf seiner CD „Musen, Nymphen, Sirenen“ zu hören, vor allem seine Stimme. „Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, das ist ihr Schweigen,“ schwante bereits Franz Kafka.
.
.

Mähnenwolf „Arken“ im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
Guppys
Guppys, benannt nach dem englischen Naturforscher R.J.L. Guppy, sind kleine lebendgebärende Süßwasserfische aus der Karibik, die sich in Aquarien leicht züchten lassen. Sowohl professionelle Züchter als auch Amateure widmen sich seit vielen Jahrzehnten dem Guppy, und heute existiert eine überwältigende Fülle an Farben, Mustern und Formen. Daneben dienen sie den Biologen als beliebte „Modellorganismen“. Das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie berichtete 2014: „Bunte Guppy-Männchen haben die besten Chancen bei der Fortpflanzung“. Auch bei der Selektion durch die Aquarianer, möchte man hinzufügen.
.
Einige englische Fisch-Genderforscher beschäftigten sich mit der „sexuellen Belästigung“ von Guppyweibchen: „Wenn sich Weibchen untereinander bekämpfen und ‚rumzicken‘, sind Männchen daran nicht unschuldig. Die Gegenwart von Männchen, die die Weibchen sexuell bedrängen, verändert das Sozialverhalten der Weibchen untereinander“, berichteten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Biology Letters“. Die Weibchen verbrachten weniger Zeit miteinander und verhielten sich aggressiver gegenüber dem eigenen Geschlecht. Bei einer mit den Guppys verwandten Art – Poecilia mexicana – entscheidet sich das Weibchen angesichts zweier kämpfender Männchen anschließend eher für das „Verlierermännchen“, wie die Fisch-Genderforscher David Bierbach und Martin Plath von der Goethe-Universität Frankfurt herausfanden. Besonders attraktiv fänden die Weibchen homosexuelles Verhalten von Männchen. Wahrscheinlich, weil sie von diesen ebenfalls weniger aggressiv bedrängt werden.
.
Zwei Auricher Gymnasiasten, Jan Trebesch und Meint-Hilmar Broers, erforschten wild lebende Guppys auf Trinidad, indem sie einzelne Tiere markierten. Dabei fanden sie heraus: Je mehr ihr Platz eingeschränkt wurde, umso aggressiver reagierten die Guppys; sie entwickelten regelrechte „Beißhierarchien“. Fisch Nummer 8, der bevorzugtes Opfer von „Macho-Guppys“ wurde, tat ihnen sogar „irgendwie leid“, was Broers und Trebesch darauf zurückführten, „dass man auch ein bißchen verrückt wird, wenn man sich so lange mit ihnen beschäftigt“. In einem Aquarianer-Forum im Internet fand vor einiger Zeit eine Debatte darüber statt, wie man einen unheilbar kranken Guppy am Humansten tötet.
.
Der in England lehrende Biologe John Endler bestückte zehn Aquarien mit möglichst farbenprächtigen Guppys der Art „Poecilia wingei“, die ebenfalls auf Trinidad lebt. Die einen bekamen als Bodenschicht bunten Kies, die anderen bunten Sand. Dann teilte er diese beiden Gruppen noch einmal: zwei blieben unter sich, die beiden anderen bekamen jeweils einen Fressfeind zugeteilt: entweder einen Buntbarsch, der vor allem erwachsenen Guppys nachstellt, oder einen Zahnkärpfling, der kleiner ist und sich eher an die Jungguppys hält. Die FAZ berichtete: „Auf diese Weise hatte Endler gleich vier Selektionsmechanismen an Guppys eingeführt: erstens die Vorliebe der Guppyweibchen für besonders auffällige Männchen, zweitens deren höheres Risiko, gefressen zu werden, drittens die Chance, durch bessere Anpassung an die Umwelt zu überleben, viertens die Frage, wie sich eine Population entwickelt, wenn Nachwuchs und Sexualpartner unterschiedliche Überlebensraten haben.
.
Es dauerte keine 15 Generationen, und die vom Buntbarsch bedrohten Männchen hatten sich in ihrer Farbgebung weitgehend dem Untergrund angenähert – sie zeigten auf Kiesboden wenige große und auf Sandboden viele kleine Flecken. Die vom Zahnkärpfling verfolgte Population konnte sich größere Auffälligkeiten bei den geschlechtsreifen Männchen leisten, weil ihr Feind ja nur am Nachwuchs interessiert war, der noch nicht ausgefärbt zur Welt kam. Es dauerte allerdings länger, bis sich die Reproduktionsraten eingependelt hatten: nach dreißig bis sechzig Generationen kamen in den Barschbecken wesentlich mehr Guppys zur Welt, die gleichzeitig deutlich kleiner waren und früher geschlechtsreif wurden. Im Kärpflingsbecken hatte der gegenteilige Trend eingesetzt: weniger, dafür kräftigerer Nachwuchs, der sich seinerseits später fortpflanzte.“
.
In den Sechzigerjahren starteten amerikanische Fischforscher ein Experiment mit Guppys, das die Frage der Überfischung im Modell klären sollte. Dazu richteten sie zwei Aquarien mit ähnlichen Guppypopulationen ein. Aus einem fischten sie regelmäßig einige Fische ab. Die Fruchtbarkeit der Guppys konnte das lange Zeit ausgleichen, aber ab 50% „reichte die Vermehrungsfähigkeit nicht mehr aus“, schreibt H.W.Stürzer, der sich als Chefreporter der „Nordsee-Zeitung“ jahrzehntelang mit der Fischwirtschaft beschäftigte, in seinem Buch „Tatort Meer“ (2005). Es ging den Amerikanern bei ihrem Guppy-Experiment darum, den „sozialistischen Weg zum Reichtum der Fischgewässer zu widerlegen“. Die Sowjetunion hatte 19 Millionen Ostseeheringe im schwach salzhaltigen Aralsee ausgesetzt und dieser relativ kleine Schwarm hatte sich schnell vermehrt, was die sowjetischen Fischforscher auf die größere Freßkonkurrenz in den dichten Schwärmen der Meere zurückführten. Sie folgerten daraus laut Stürzer: „Intensiver Fischfang halte die Schwärme kleiner und begünstige das Wachstum der Überlebenden. Überfischung war zu einem Prinzip des immerwährenden Reichtums geworden.“ Die amerikanischen Guppys hatten nun zwar bewiesen, dass das ein Irrweg war, aber die Bundesforschungsanstalt für Fischerei in Hamburg favorisierte die sowjetische Theorie weiterhin, indem sie 1963 verkündete, dass der Schollenbestand an der deutschen Nordseeküste eine jährliche Abfischrate von 70% klaglos überstehen würde. Die Bremerhavener „Nordsee-Zeitung“ schrieb daraufhin: „Eine optimale Ausnutzung des Meeres macht also eine recht intensive Befischung sogar notwendig.“ Dabei hatte schon die bisherige Ausnutzung dazu geführt, dass die Fänge immer mehr zurückgegangen waren, von 20 westdeutschen Reedereien arbeiteten 18 bereits mit Verlust. Der Verband der Hochseefischerei forderte in dieser Situation: Zinsverbilligung für Neu- und Umbauten und die Suche nach neuen Fanggebieten. Nur so sei die Katastrophe zu verhindern. Alte Fanggebiete seien ausgefischt oder hinter vorgeschobenen Seegrenzen von Küstenstaaten nationalisiert (allein 140 Meerengen sollten Staatsgebiete werden).
.
Die Sowjetunion machte es vor: „Sie entwickelte eine Flotillenfischerei nach Walfangmuster und ließ in Kiel eine Serie von 24 mittelgroßen Heckfängern bauen, zudem in Leningrad einen Super-Fänger. Für dessen Besatzung waren 582 Kojen vorgesehen, davon 270 für Industriearbeiter. Sie sollten auf einer Reise 10.000 Tonnen Frostfisch oder 10 Millionen Fischkonserven produzieren. Stürzer titelte: „Fischbestände schrumpfen – Flotte wächst“. Zur besseren Bewirtschaftung der Bestände fand 1971 eine Konferenz in Moskau statt. Die sowjetischen Fischereiexperten drehten dort ihre im Aralsee gewonnene Fang-Theorie um: „Durch Verminderung des Fischereiaufwands um die Hälfte könnten die Erträge von jährlich neun Millionen Tonnen im Nordostatlantik nicht nur erhalten, sondern noch gesteigert werden…Für Mindestmaschen sei es bereits zu spät, deshalb sollten Gesamtfangmengen und daraus Fangquoten für die einzelnen Länder festgelegt werden.“
.
Vier Jahre später luden amerikanische Fischereiexperten von der „National Oceanic and Atmospheric Administration“ erfahrene Heringsspezialisten und ihre sowjetischen Kollegen, die Heringe in den Aralsee verpflanzt hatten, zu einer Expedition an die „Georges Bank“ vor dem Golf von Maine ein, um dort in 32 Metern Tiefe das Ablaichen von Heringen zu verfolgen. Dazu charterten sie vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht das Unterwasserlabor „Helgoland“. U.a. fanden sie heraus, dass es viele auch innerartliche „Larvenräuber“ gibt und dass die kommerziell genutzten Bestände an Kabeljau, Schellfisch und Plattfisch zurückgehen, während die Zahl der Knorpelfische – Rochen und Hundshaie – zugenommen hatte; sie fraßen die letzten Heringsschwärme. „Nur noch ein totaler Fangstopp wie in der Nordsee“ hätte laut Stürzer „die Heringe vielleicht retten können“. Die Amerikaner zogen aus dem Forschungsergebnis jedoch den genau gegenteiligen Schluß: sie motivierten ihre Fischerei mit zinsgünstigen Darlehen zum weiteren Ausbau ihrer Fangflotte.
.
In Moskau, wo die Aquarianer regelmäßig „Guppy-Wettbewerbe“ veranstalten, widmen sich einige Fischforscher inzwischen ebenfalls den Guppys – ausgewilderten: sie untersuchen drei Populationen, die in der Moskwa leben – „dort wo eintretende Wärme von Heizkraftwerken für die nötigen Temperaturen sorgt. Jede der Populationen entwickelt endemische Eigenheiten“, wie „moskau.ru“ 2014 berichtete.
.
In Berlin erzählte mir ein Techniker des Berliner Kraftwerks Rummelsburg, dass er zu Hause ein Aquarium mit Guppys besaß. Als er in Urlaub fahren wollte, wußte er nicht wohin damit und entsorgte sie deswegen im Kühlsystem des Kraftwerks. Jahre später mußte das System überholt – und dazu das Kühlwasser abgelassen werden. Dabei kamen mehrere Zentner Guppys mit heraus.
.
Die Innsbrucker Fischforscherin Ellen Thaler schreibt in ihrem Buch „Fische beobachten“ (1995): „Ich werfe einige bedauernswerte Guppys in mein Salzwasser-Aquarium, die alle in Windeseile meine alte Clownfisch-Frau schnappt und ihrer Anemone verfüttert.“
.
Inspiriert von den LSD-Versuchen der Harvard-Psychologen und der englischen Armeeführung wollte der Germanist Dirk Reich ebenfalls damit experimentieren, traute sich dann aber nicht und testete die Droge erst einmal bei Fischen. Er besaß ein Aquarium mit großen und kleinen Fischen. Die kleinen, Guppys, obwohl in der Überzahl, hatten unter den großen, Schwertfischen, gelegentlich zu leiden, vor allem fraßen sie ihnen regelmäßig den Nachwuchs auf. Nachdem er seinen LSD-Trip ins Wasser geworfen hatte, verkrochen sich die großen hinter Steinen und Pflanzen, während die kleinen sich zunächst oben an der Wasseroberfläche sammelten. Dann schwammen sie zu den großen – und attackierten sie – so lange, bis sie tot waren.
.
Diese Geschichte kam mir wie ausgedacht vor. Aber dann las ich im „Spektrum der Wissenschaft“, dass zwei Zoologen der schwedischen Universität Umea die Wirkung von Medikamenten-Rückständen in Gewässern untersucht hatten, konkret: den Effekt des angstlösenden Wirkstoffs Oxazepam auf einheimische Flußbarsche. Sie beobachteten deren Verhalten vor und nach Zugabe von Oxazepam zum Wasser und stellten fest, dass die Fische durch das Präparat aktiver wurden, schneller fraßen und bereitwilliger neue Beckenbereiche erforschten. „Normalerweise sind Barsche scheu und jagen in Schwärmen. Das ist eine bewährte Überlebensstrategie. Doch diejenigen, die in Oxazepam schwimmen, sind wesentlich mutiger“, meinte einer der Forscher.
.

Bodenguckerfische im Berliner Aquarium. Photo: Aquarium Berlin Januar 2015 Frederic Schweizer.
.
Orchideen
Manche Blume, so schrieb Theodor Lessing, könnte man „als ein festgebanntes Insekt“ bezeichnen – und andersherum „viele Insekten, zumal die Bienen und Schmetterlinge, als frei bewegliche Blumen“. Die meisten Orchideen, von denen weltweit etwa 25.000 Arten bekannt sind, sehen wirklich wie „festgebannte Insekten“ aus – und wer weiß, vielleicht wird man sie irgendwann auch als solche neu bestimmen. Ganz sicher weiß man jetzt schon, dass diese „Königin der Blumen“ die komplizierteste Existenzform unter den „bedecktsamigen Blütenpflanzen“ entwickelt hat, obwohl oder weil sie angeblich in evolutionärer Hinsicht die jüngste „Familie“ bildet. Fangen wir unten an – im Boden oder (epiphytisch siedelnd) auf Bäumen: Dort braucht sie einen Pilz, damit der Keim überhaupt aufgeht. Man kann die Nährstoffe, die ihm der Symbiosepilz zuführt, künstlich herstellen, das machen die Orchideenzüchter auch, weswegen es bereits über 100.000 Neuzüchtungen (Hybride) gibt, sie werden bei der „Royal Horticultural Society“ registriert und dort gelegentlich auch in ihrem botanischen Namen als besonders ausgezeichnet – „geadelt“. Es gibt aber auch heute noch tropische Orchideen, wild lebend, für die reiche Liebhaber mehr zahlen, „als heute ein Luxusauto kostet“ wie es im Ratgeber „Orchideen“ des Züchters Jörn Pinske heißt. Dabei geht es „nur“ um ihre seltsame Schönheit und manchmal auch um ihren Duft. Einige Arten enthalten daneben noch „psychoaktive Inhaltsstoffe“, aber ansonsten ist sie keine „Nutzpflanze“.
.
Die Mehrzahl der Orchideen-Liebhaber sind Männer. Der Pflanzenname leitet sich vom griechischen Wort „orchis“ her, was „Hoden“ heißt. Damit waren anfänglich die Knollen verschiedener Erdorchideen gemeint. Wegen dieser Speicherknollen, die bei Wildschweinen begehrt sind, gehört das „Männliche Knabenkraut“ zu einer besonders gefährdeten Art. Orchideen sind zweigeschlechtlich. In der Blüte hat sie (männliche) Staubblätter und eine (weibliche) Narbe, die zu einem „Säulchen“ (Gynosterium) verwachsen sind. Die Pflanze bestäubt sich nicht selbst damit, sondern braucht ein Insekt, dass ihren Pollen zu einer anderen bringt und ihr gleichzeitig fremden Pollen an die Narbe trägt.
.
„Daß Hummeln, Bienen, Tagfalter, also Insekten, irgendetwas mit den Blumen haben, wußte man schon seit der Antike. Auch daß sie sich irgendwie von ihnen ernähren. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wußte man auch, daß Blumen ein Geschlecht haben. Linné baute sein ganzes System der Pflanzen darauf auf,“ schreibt der Kulturwissenschaftler Peter Berz. Aber im Sommer 1787 entdeckt der Direktor der Spandauer Realschule Christian Konrad Sprengel auf einer Blumenwiese zwischen dem Wunder ihres Aussehens und den um sie herumschwirrenden Insekten eine völlig neue Beziehung.“
.
Sprengel findet, daß jedes kleinste Detail jeder Blumemes nur auf Das Eine abgesehen hat: Insekten anzulocken, sie hinzuführen, hinzuweisen auf die in ihr verborgenen Schätze – Saft oder Nektar – also den „in der Luft herumschwärmenden Insekten als Saftbehältnisse schon von weitem ins Auge zu fallen“. Und „indem die (so angelockten) Insekten in den Blumen ihrer Nahrung nachgehen“ tun sie etwas ganz anderes: „Zugleich,“ schreibt Sprengel, „ohne es wollen und zu wissen“ befruchten sie die Blumen. Es wird dabei getäuscht und getrickst: viele der spektakulärsten Orchideen haben gar keinen Nektar. Sprengel: „Ich muß gestehen, daß diese Entdeckung mir keineswegs angenehm war.“ Denn: stimmt dann noch die Grundthese?
.
Die Blüten der Sexualtäusch-Orchidee „Ophrys insectifera“ (Fliegen-Ragwurz) haben nicht nur die Form und Farben einer potentiellen Partnerin für Grabwespen-Männchen angenommen, sondern auch noch den weiblichen Sexuallockstoff. Bei seinen Kopulationsversuchen bekommt das Männchen zwei Pollenpakete auf die Stirn geklebt. „Dolchwespen fallen gerne auf Blüten der mediterranen Orchidee Ophrys speculum (Spiegel-Ragwurz) herein. Teilweise geht die Täuschung soweit, dass Bienenmännchen der Gattung Andrena die entsprechenden Ophrys-Blüten sogar einem Weibchen vorziehen. Verhaltensforscher nennen das eine überoptimale Atrappe,“ schreibt die Biologin des Berliner Botanischen Gartens Birgit Nordt.
.
Peter Berz fragte sich darob: „Duft als Belohnung. Wie geht das? Nur als Droge, Rausch. Fast zu schön, um wahr zu sein. Die unmittelbare Reaktion der männlichen Bienen auf die Flüssigkeit kann man nur als Rausch bezeichnen. Sie verlieren in erheblichem Maße die Kontrolle über ihre Bewegungen und werden unbeholfen und träge und unaufmerksam. Offenbar genießen sie ihre Empfindungen, denn sie kommen über lange Zeit immer wieder zurück.“
.
Einige südamerikanische Orchideen, die mit „Prachtbienen“ kooperieren, bieten den Prachtbienenmännchen sogar einen Duft an, der nicht ihnen direkt gilt. Sie nehmen ihn laut dem Biologen Karl Weiß „in ansehnlichen Flakons an den Hinterbeinen“ auf und fliegen damit zu ihren „Balzplätzen“, wo sie „Präsentationsflüge“ unternehmen. „Dabei soll ihr farbenprächtiger Panzer zusammen mit dem betörenden Pflanzenduft die Weibchen anlocken.“
.
Besonders raffiniert ist die Duftproduktion beim Germerblättrigen Stenderwurz, die im Jenaer Max-Planck-Institut für chemische Ökologie erforscht wurde: Um Schwebfliegen zur Bestäubung anzulocken, verströmt diese Orchidee einen Botenstoff, mit dem sich Blattläuse alarmieren, er lockt aber auch Schwebfliegenweibchen an, die ihre Eier bei Blattläusen ablegen, weil sich ihre Larven dann von ihnen ernähren. In der Orchideenblüte täuschen darüberhinaus „warzenartige Gebilde“ die Anwesenheit von Blattläusen vor. Es gibt dort aber gar keine, so dass die Larven der Schwebfliegen keine Nahrung finden und sterben. Der Biologe Johannes Stökl erwähnt zwei weitere Orchideenarten, die „stechende Insekten“ durch Vortäuschen von Schmetterlingsraupen in ihren Blüten zu deren Befruchtung verlocken.
.
Botaniker der Universität Wien erforschten auf Madagaskar Orchideenarten, die einen Geruch von faulem Fleisch verbreiten – um damit Aasfliegen anzulocken. Ihre Samen sind winzig klein und breiten sich wie eine Staubwolke aus, in jedem steckt ein Embryo. Es gibt daneben Orchideenarten, die bis zu zwölf Embryos in ein Samenkorn packen.
.
Über eine weitere auf Madagaskar vorkommende Art, die einen 30 Zentimeter langen Dorn in ihrer Blüte ausgebildet hat, an dessen Ende sich Nektar befindet, hat Darwin gemeint, man werde dort bestimmt auch einen Schmetterling finden, der einen genauso langen Saugrüssel hat. 1903 entdeckte man ihn tatsächlich.
.
Die Biogeochemiker der Universität Bayreuth haben bei einer Reihe südafrikanischer Orchideen herausgefunden: Wenn unterschiedliche Arten in enger Nachbarschaft leben und von den selben Insekten (Wespen z.B.) bestäubt werden, „platzieren sie ihre Pollen an unterschiedliche Stellen – z.B. auf verschiedenen Abschnitten ihrer Vorderbeine.“
.
Die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari gehen von einer wechselseitigen Beeinflussung aus, die eine Angleichung von Pflanze und Tier hervorgebracht hat. Ein solcher Vorgang – „Werden“ von ihnen genannt – gehört „immer einer anderen Ordnung als der der Abstammung an. Werden kommt durch Bündnisse zustande. Es besteht gewiß nicht darin, etwas nachzuahmen oder sich mit etwas zu identifizieren; es ist auch kein Regredieren-Progredieren mehr; es bedeutet nicht mehr, zu korrespondieren oder korrespondierende Beziehungen herzustellen; und es bedeutet auch nicht mehr, zu produzieren, eine Abstammung zu produzieren oder durch Abstammung zu produzieren…Das Werden ist eine Vermehrung, die durch Ansteckung geschieht.“ Affizieren und Affiziert-werden. „Werdet wie die Orchidee und die Wespe!“ raten sie.
.
Nach Meinung einiger Orchideenforscher ist bei diesem Angleichungsprozeß die Pflanze die treibende Kraft. Sie wollen festgestellt haben, dass eine Orchidee, die außerhalb des Vorkommens „ihrer“ Insekten „Fuß gefaßt“ hat, sich in Form und Farbe an eine neue Art angleicht.
.
Im übrigen kennen die Orchideen auch eine vegetative Fortpflanzung (durch Ableger z.B.), weswegen G. W. F. Hegel in seiner Vorlesung „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse“ (1830) die geschlechtliche Fortpflanzung für einen reinen „Luxus“ hielt. Sie wird dafür mit umso mehr Liebe betrieben. Wenn die mikroskopischen Samen einer asiatischen Orchideenart durch den Wind an eine Baumrinde geweht wurden, entrollen sie „spiralige Ankerfäden“, um sich festzuklammern und in Kontakt mit einem Symbiosepilz zu kommen. Ist keiner da, muß der Keim sterben, wie die Mitarbeiter des Berliner Botanischen Museums in ihrem Band über „die skurrile Welt der Orchideensamen“ schreiben.
.
Als ich unlängst im Orchideengewächshaus des Kassler „Bergparks Wilhelmhöhe“ war, konnte ich es nicht fassen: Es werden dort fast nur Orchideen gehalten, die der menschlichen Vagina in Form und oft auch in Farbe glichen. Ich erfuhr dort: Die Schamlippe heißt bei den Orchideen ebenfalls „Lippe“ (Labellum), es ist ein zur Lippe geformtes Blütenblatt, das den Insekten eine Landefläche bietet, und die Klitoris ist bei den Orchideen das vorstehende „Säulchen“. Hinzu kommt bei manchen Orchideenarten ein Sexualtäuschduft, der auch auf Menschen, mindestens Männer, wirkt, die Orchidee „Vanille“ kommt dem bereits nahe. Einige Orchideenblüten ähneln der Vagina auch deswegen, weil sie „Haare“ drumherum haben. Kurzum: „Die Sexualorgane der Orchideen sind einzigartig,“ wie die überwiegend männlichen Autoren der „Kosmos-Enzyklopädie Orchideen“ schwärmen. „Wir könnten eine Geistesgeschichte der letzten Jahrhunderte schreiben, indem wir eine Orchideenblüte schildern,“ meinte schon der Basler Biologe Adolf Portmann in seinem Radiovortrag „Insekten und Blumen“ (1942). Gleiches ließe sich auch wohl über die menschliche Vagina (vulgo: Vulva) sagen. Soll man noch erwähnen, dass ein katholisches Forschungsteam der Botanikerin Marta Kolanowska von der Universität Danzig im Kolumbianischen Urwald eine winzige Orchideenart entdeckte, die statt einer Klitoris ein weinrotes Teufelsgesicht in ihrer Blüte ausgebildet hat? Sie wurde „Telipogon diabolicus“ genannt. Und dann gibt es auch noch die „Orchis italica“, deren Lippe zu einem weißen Männchen mit großem Penis geformt ist. Wer damit wohl angelockt werden soll?
.
.

Seebär im Rostocker Zoo. Photo: Zoo Rostock Gohlke.
.
.
Quallen
Als der Schauspieler Till Schweiger auf seiner Facebook-Fanpage ein Video veröffentlichte, das einen Mann zeigte, der mit einer Wasserflasche zwei Feuerquallen ((Pelagia noctiluca), deren Nesselkapseln die menschliche Haut durchdringen können, zerquetschte, reagierten sein Fans ungehalten: „Wie gestört kann man eigentlich sein?“ oder „Soll ich Tierquälerei jetzt lustig finden???“ schrieben sie.
.
„Die Welt“ meinte: „Quallen haben keine Freunde.“ Fragte aber vorsichtshalber den Hamburger Quallenforscher Gerhard Jarms, ob Quallen Schmerzen empfinden können. Wahrscheinlich nicht, antwortete er. Zudem sind sie ohnehin todgeweiht, denn, so Sandra Kube vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, „wenn sie im Uferbereich dümpeln, haben sie kaum mehr eine Chance, aufs Meer hinauszukommen“.
.
Die Zeitung zitierte darüberhinaus noch einen berühmten Quallenversteher: „Einer der wenigen, die diese Tiere mochten, war der Jenaer Zoologe Ernst Haeckel, der Darwins Werke in Deutschland bekannt machte. ‚Alle übrigen Tierformen werden an Schönheit und Zierlichkeit von den herrlichen Siphonophoren übertroffen‘, schrieb er. Haeckel schilderte diese auch Staatsquallen genannten Hohltiere als ‚zierliche Blumenstöcke‘ mit ‚Blüten, durchsichtig wie Glas‘. Die Aquarelle, die er von ihnen malte, gehören zu den schönsten naturkundlichen Darstellungen des 19.Jahrhunderts. Eine Fahnenqualle benannte Haeckel nach seiner früh verstorbenen Frau Anna Sethe, die er sehr liebte: ‚Desmonema annasethe‘.“
.
Bei den „Staatsquallen“, gibt es eine Art, die für Menschen besonders schmerzhaft und manchmal sogar tödlich ist: die „Portugiesische Galeere“ (Physalia physalis). Haeckel schätzte die „Siphonophoren“ vor allem deswegen, weil sie aus tausenden von Individuen bestehen, die eine Arbeitsteilung praktizieren, indem sie unterschiedliche Funktionen ausfüllen: Beutefang, Verdauung, Verteidigung, Vermehrung usw.. Damit ähneln sie einem „stark centralisirten“ und „hochcivilisirten Culturstaate,“ fand er. Mangels einer „Zentrale“ sollte man aber vielleicht eher von einem „stark dezentralisierten Superorganismus“ sprechen.
.
Der Biologe Mark E. Martindale von der Universität Hawaii entdeckte in ihnen die gleichen Gene, die bei Säugetieren die Aufteilung und den Aufbau des Körpers steuern. „Die Welt“ gab jedoch zu bedenken: „Viel haben sie bei den Quallen nicht aufzubauen. Hohltiere besitzen kein Herz, kein Gehirn und kein zentrales Nervensystem. Die einzigen Organe, die bei der in Nord- und Ostsee häufigen Ohrenqualle [Aurelia aurita – aus der Klasse der Schirmquallen] als rosa Ringe im ansonsten durchsichtigen Fladenkörper auffallen, sind die Geschlechtsteile.“
.
Die Quallen – auch Medusen genannt – erzeugen durch geschlechtliche Fortpflanzung mit ihren Keimzellen Larven. Diese setzen sich irgendwo fest und entwickeln sich zu Polypen. Die Polypen erzeugen daraufhin auf ungeschlechtlichem Weg – durch „Sprossung bzw. „Abschnürung““ – wieder freischwimmende Quallen. Es brauchte lange, diesen „Lebenszyklus“ zu durchschauen.
.
Der im Gegensatz zu Charles Darwin von der Französischen Revolution beflügelte Naturforscher Jean-Baptiste de Lamarck, der den Begriff „Biologie“ prägte, befaßte sich mit „wirbellosen Tieren“; in den Korallenriff-Gemeinschaften hatten es ihm vor allem die Quallen – franz. „Méduses“ – angetan. In ihnen sah er „die Spiele, die Eleganz und das Lächeln der neuen Freiheit“ verkörpert.
.
Inzwischen werden die Quallen weltweit eher als Bedrohung wahrgenommen, weil sie sich in immer mehr Gewässern frei schwimmen, d.h. sich wegen Überfischung und gleichzeitiger Verschmutzung der Meere und Seen immer ungehemmter ausbreiten; hinzu kommt die Erwärmung des Wassers, was die rhythmische Pulsation ihres Magens und ihre Schwimmbewegungen mit dem Schirm (beides geschieht über Ringmuskeln) beschleunigt – und damit auch ihre Nahrungsaufnahme und -verdauung. Polypen wie Medusen leben von Plankton (gr. das Umherirrende). Letztere können mit ihren Tentakeln auch kleine Fische und Krebse fangen.
.
Anfang der Achtzigerjahre gelangte – vermutlich über das Ballastwasser von Frachtschiffen – eine Rippenquallenart (die Meerwaldnuss: Mnemiopsis leidyi) in das Schwarze Meer, wo sie sich derart vermehrte, dass schließlich 240 Exemplare pro Kubikmeter Wasser gezählt wurden. Erst durch Aussetzen ihres Freßfeindes Beroe ovata (eine andere Rippenquallenart) konnte ihre Population, die inzwischen auch ins Kaspische Meer und in die Ostsee eingedrungen war, reduziert werden. In der für die Meerwaldnuss eigentlich zu kalten Ostsee leben bereits zwei Quallenarten, die von der biologischen Anstalt Helgoland als ihre Freßfeinde identifiziert wurden. Desungeachtet sprach die „Bild“-Zeitung von einer „Quallenpest in der Ostsee“.
.
„Die Zeit“ schrieb über das Schwarze Meer: „Es garantierte mit seinen reichen Fischgründen und sauberen Stränden Arbeitsplätze für rund zwei Millionen Fischer, Nahrung und bescheidenen Wohlstand. Jetzt aber droht aus dem Binnenmeer ein totes Gewässer zu werden. Überfischung, Umweltverschmutzung und die invasionsartige Ausbreitung von Quallen und quallenähnlichen Tieren haben das besonders empfindliche Ökosystem des Schwarzmeergebietes zum Kippen gebracht.“ – Trotz der Rippenquallen fressenden tentakellosen „Beroe ovata“.
.
Zwei Schülerinnen der Lübecker Emanuel-Geibel-Gemeinschaftsschule, Laura und Antonia, haben weiteres Wissen über die Rippenqualle gesammelt: „Sie wird auch Discoqualle genannt, weil sie in der Nacht wie eine Discokugel leuchtet. In der Regel ist sie farblos, durchsichtig, es gibt aber auch bunt gefärbte sowie die Rote Tunga – eine verwandte Seele der Rippenqualle.“
.
Die meisten finden Quallen weniger beseelt und schön. Im Mittelmeer „vermiest“ die Wurzelmundqualle (Rhizostoma pulmo) „Jahr für Jahr den Urlaub an Italiens Küsten,“ schreibt der österreichische „Standard“ über diese Quallenart, die den Strand violett färbt, wenn sie in Massen angeschwemmt wird. „Der Stachel an den mit Gift gefüllten Nesselzellen lässt bei der geringsten Berührung die Nesselkapsel im Inneren der Zelle platzen, worauf ein Nesselfaden nach außen gestülpt wird, der das lähmende Gift abgibt.“ Für den Menschen ist das nur schmerzhaft, das Beutetier hingegen wird vergiftet und verschwindet im Inneren der Qualle.
.
In Thailand warnen jedoch die Hotels ihre Badetouristen vor der tödlichen Würfelqualle (Cubozoa). Vom vietnamesischen „Long Beach Phu Quoc“ berichtete Alfi auf „tripadvisor.de“: „Zuerst gab es Piekser, dann Quallen im Stabstadium und nun ist das ganze Meer mit kleinen Medusen ‚verseucht‘. Große dicke Quallen und jede Menge Polypen gibt es im Sand und im Meer. Dafür gibt es keine badenen Touristen im Wasser.“ Dort zählen Karettschildkröten, Thunfische und Delphine zu den Freßfeinden der Quallen, sie wurden jedoch anscheinend von ihren eigenen Freßfeinden – den Fischern – allzu sehr dezimiert. Manche Quallen bestehen zu 98% aus Wasser, die auf sie fast ausschließlich angewiesenen Karettschildkröten benötigen deswegen sehr viele, um satt zu werden.
.
Im Mittelmeer gibt es eine kleine Makrelenart, die am Liebsten Quallen frißt. Laut dem Umweltforscher Jakob von Uexküll haben es diese Fische – wenigstens im Golf von Neapel, wo er in der Zoologischen Station Anton Dohrn forschte – auf Quallen der Arten Cassiopeia borbonica und Rhizostoma Pulmo abgesehen, die mitunter viel größer als sie sind.
.
Auf den Balearen läßt das Umweltministerium gerade ein neues „Quallen-Alarmsystem“ entwickeln. In den mitteleuropäischen Seen wurden derweil kleine Süßwasserquallen (der Art Craspedacusta Sowebii) heimisch, die ursprünglich aus Ostasien stammen, sie haben mit 99,3% den höchsten Wassergehalt und vermehren sich meist nichtsexuell – während ihres Polypenstadiums.
.
In Kiel will eine Firma aus Quallen, die in der Bucht von Haifa vorkommen, Arzneimittel und Kosmetika herstellen. Das aus ihnen extrahierte Bio-Kollagen ist ideal für die Wundbehandlung, schreibt der Spiegel, nur ein Problem sei dabei noch ungelöst: „Wie bringt man die Meeresbewohner schmerzfrei um?“ Bisher erledigten die Kieler Forscher das mit einem Quirl, das Tierschutzgesetz verlangt jedoch eine „artgerechte“ Tötung.
.
In China und Japan ißt man gerne „Quallensalat“ (mit Samtfußrübling z.B.). „In Asien ist der Handel mit Quallen für den Verzehr bereits ein Multi-Millionen-Dollar Geschäft,“ berichtete der SWR, hierzulande habe allerdings die Lebensmittelbehörde Quallenspeisen noch nicht freigegeben. Desungeachtet versuche die Lebensmittelindustrie bereits aus der zunehmenden Not – schrumpfende Fischschwärme und wachsende Quallenbestände – das Beste zu machen, indem sie u.a. das Problem zu lösen versucht, wie man die Tiere entgiften – und dabei ihren Nährwert erhalten kann.
Im Institut für Meereswissenschaften in Barcelona gibt es laut SWR „Quallen für jeden Geschmack: Mit grünen oder phosphoreszierenden Tentakeln, mit bläulichen oder kräftig gelben Schirmen. Der Biologe Josep-Maria Gili züchtet unzählige Quallen in Aquarien im Keller des Instituts“ – um sie als Nahrungsmittel nutzbar zu machen: „Die Qualle hat kein Cholesterin. Sie ist fettfrei. Wie Fisch liefert sie viele Proteine und Spurenelemente und ist reich an Natrium, Kalzium, Calium und Magnesium.“
.
Die leicht giftige Spiegeleiqualle (Cotylorhiza tuberculata) etwa kann man laut Professor Gili erst mal dadurch unschädlich machen, dann man sie in einen Eimer mit kaltem Süßwasser und Eiswürfeln packt. Danach muß man noch ihre Tentakel abschneiden. Dies ist jedoch umständlich und für ihre kommerzielle Nutzung zu kostspielig. Es muß also ein rentables Verfahren zur Isolierung des Gifts her. Die Qualle wäre dann nicht nur für den menschlichen Verzehr geeignet (wenn man ihr auch noch mit Gewürzen und Soßen Geschmack verliehe), sie ließe sich auch zu Fischfutter in Aquakulturen verarbeiten, was die Fische im Meer, die bisher verfüttert werden, schonen würde.
.
Der „stern“ fuhr mit dem „letzten Krabbenfischer auf Sylt“ raus. Doch als Paul Walter Fischer das Netz reinholte, hatte er „statt der ersehnten Krabben nur Quallen“ gefangen. Der mexikanische Fischer José Salvador Alvarenga trieb 14 Monate mit seinem kleinen Boot auf dem Pazifik, er ernährte sich von Schildkröten und Quallen. „Wie schmecken Quallen?“ fragte ihn der „stern“. „Sie hinterlassen ein Brennen im Hals,“ antwortete er.
.
Im „Guardian“ fragte sich kürzlich ein Autor: „Ist es o.k. für Vegetarier, Quallen [Jellyfish] zu essen?“ Im Forum „vegane-inspiration.com“ wurde darauf geantwortet: „Quallen haben kein Gehirn, daher können sie auch nicht leiden. Das dürfte doch eigentlich kein Problem sein, oder? Quallen sind eher wie bewegliche Pflanzen.“ In der taz wurde daraufhin kurz über diese beiden Fragen diskutiert. „Sind sonst alle weltbewegenden Probleme gelöst? fragte eine Redakteurin erst mal. Während eine andere, die Frage, „Was wollen wir essen? durchaus für weltbewegend“ hielt. Eine dritte behauptete: „Quallen schmecken wie Austern! Es wird gemunkelt, dass über 50 % der in Europa als Austern geschlürften Delikatessen ohnehin mit Quallen gefüllt sind.“ Einer der Hausmeister wies darauf hin, dass man Quallen auch immer öfter in Aquarien halte – um sich an ihnen lebend zu erfreuen.
.
Im Aquarium des Berliner Zoos wird bereits seit den Achtzigerjahren die größte Quallenzucht des Kontinents aufgebaut. Der für diese „Feenwesen“ verantwortliche Tierpfleger, Daniel Strozynski, erzählte dem Tagesspiegel: „‚Erst dachte ich, das wird auf Dauer ja langweilig‚. Schließlich lässt sich zu den glibberigen Schönheiten nicht wirklich eine persönliche Beziehung aufbauen. Man erkennt sie schon am nächsten Tag schlecht wieder. Quallen wachsen und verändern sich so rasch, dass selbst er sie nicht unterscheiden kann. Immerhin, er ließ sich auf die Aufgabe ein und sagt heute: ‚Das ist mein Traumjob.‚ Weil Medusen hochsensible, kompliziert zu haltende Geschöpfe sind. Ständig fordern sie ihn neu heraus…“
.
Strozynski hat lange über sie geforscht. Inzwischen ist er sich sicher, dass der Zeitpunkt, wann sie als festsitzende Polypen durch Sprossung Quallen frei setzen, vom Futter abhängt und davon, wie man es schafft, „den Frühling mit Temperatur und Licht zu imitieren“.
.
In seinen Becken werden 22 Quallenarten gehalten. „Wer solche Tiere sehen will, muss also nicht ans Meer fahren, nach Spanien oder Italien“, meinte der Kurator des Aquariums im Zoo, Rainer Kaiser, gegenüber der Berliner Zeitung. Zum Züchten brauche es aber spezielle Apparaturen. „Eine der gefährlichen Würfelquallen hatten wir auch mal hier, aber da ist die Vermehrung nicht gelungen.“ Mit Ohren- und Mangrovenquallen u.a. hatte Kaiser mehr Erfolg, seine Quallen sind heute ein „Exportschlager“: Er beliefert damit viele europäische Aquarien. Das im Wiener Tiergarten Schönbrunn meldete am Jahresende die „weltweit erste Nachzucht der Riesenqualle Rhizostoma luteum,“ deren Existenz lange Zeit bezweifelt wurde. Der WWF zählte die Quallen zu den „tierischen Gewinnern 2015“.
.
.

Gepunktete Wurzelmundqualle im Aquarium des Rostocker Zoos. Photo: Zoo Rostock Dobbertin.
.
.
Pilze
„Nach den Bakterien sind Pilze die am weitesten verbreitete Lebensform der Erde,“ schreiben die Wissenschaftler des Frankfurter „Instituts für integrative Pilzforschung“. Pilze finden sich in der Tiefsee und im Hochgebirge, in Gesteinen und im Wasser, auf und in anderen Lebewesen, in Wüsten, Regenwäldern und an den Polen. Sie sind artenreicher als Pflanzen, Fische und Säugetiere zusammen, und Schätzungen zufolge sind mindestens 90 % ihrer Arten noch unentdeckt.
.
Eßbare Pilze gibt es nur wenige, aber sie interessieren die Menschen am meisten. Je besser die Pilz-Saison ist, desto mehr Pilzvergiftungen gibt es auch. Der Berliner Botanischen Garten hat eine „Pilzberatung“. Ihr Leiter, Hansjörg Beyer, meint, „2016 war eher kein gutes Pilzjahr. Allerdings war das Frühjahr für einige Pilzarten sehr günstig. Im April gab es zahlreiche Käppchen-, Speise- und Spitzmorcheln. Auch Mairitterlinge und Schwefelporlinge waren gut vertreten. Der Frühsommer brachte dann schöne Sommersteinpilze und einige andere Dickröhrlinge.“ Ansonsten war es jedoch zu trocken, auch wenn sich nach den Regenfällen Ende Oktober nun „doch so einige Pilze in der Region zeigen.“ Die am meisten hier gesammelten Speisepilze waren wohl Maronenröhrlinge und Große Riesenschirmpilze, gefolgt von den Steinpilz- und Pfifferlingsarten, auch Speisemorcheln seien beliebt. An giftigen Pilzen, mit denen die Leute häufig in die Pilzberatung kommen, erwähnt Hansjörg Beyer u.a. den Grünblättrigen Schwefelkopf, den Karbol-Champignon, den Pantherpilz, den Grünen Knollenblätterpilz, den Kahlen Krempling, den Kartoffelbovisten und den Grünling.
.
Die Pilze (Magic Mushrooms) mit halluzinogener Wirkung, vor allem aus der Gattung der „Kahlköpfe“, sind in der Pilzberatungsstelle noch nicht aufgetaucht, ihr Leiter hatte aber schon mit Fällen zu tun, wo jemand mutwillig Fliegenpilze verzehrte, die Vergiftungserscheinungen hervorrufen.
.
Die Hamburger Künstlerin Gabi Schaffner ließ sich bei ihrer Beschäftigung mit Pilzen von den „Betrachtungen eines Pilzforschers“ des russischen Dichters Wladimir Solouchin inspirieren, sie schreibt, dass es eine „Analogie zwischen den Gesetzen und Eigenschaften der Pilzwelt und der Struktur eines ‚untergründigen Denkens’“ gibt. „Und ähnelt ein schöner, giftiger Gedanke nicht einem Fliegenpilz in allem, sogar noch in der Wirkung zwischen Rausch und Brechreiz? Ein ungenießbarer Pilz ist wie ein falscher Gedanke am richtigen Ort.“
.
Über die genießbaren Pilze urteilt der aus Russland stammende Schriftsteller Wladimir Kaminer: „Die Deutschen suchen mit einem Ratgeber nach Pilzen, die Russen sammeln nach Gefühl. Während der Deutsche zweifelt und oft mit einem leerem Korb nach Hause geht, nimmt der Russe erst einmal alles mit. Man muss allerdings hinzufügen, dass sich die Russen auch öfter an ihren Pilzen vergiften. Die meisten Brandenburger halten nur Pfifferlinge und Steinpilze für wirklich essbar. Dutzende von Pilzsorten, die meine Landsleute gerne essen, nehmen sie gar nicht wahr, z.B. die merkwürdig aussehenden Rothaarpilze, die gar nicht als Pilze erkennbaren Smorchki – die Rotzpilze, sowie die Wolnuschkas, was auf Deutsch so viel wie ‚Aufregungspilze‘ heißt.“
.
Statt zur Pilzberatung zu gehen helfen sich die hier lebenden Russen selbst. In einem demnächst erscheinenden Buch über seine Frau schreibt Kaminer: „In der Pilzsaison kommt Olga jeden Tag mit einem vollen Korb aus dem Wald zurück, breitet die von ihr erlegten Pilze auf dem Küchentisch aus, fotografiert sie, postet die Fotos auf Facebook und tauscht sich über ihre Erfolge mit den anderen Freundinnen aus, die gleichzeitig mit ihr im Wald auf Pilzsuche waren. Im Herbst quillt das russische Internet über vor lauter Pilzfotos.“
.
Im deutschen Internet äußern sich vor allem passionierte Pilzsammler. Das Bayrische Landesamt für Umwelt meldet: „Das Wissen um die in Bayern lebenden Pilze ist heute zum überwiegenden Teil in der Hand von ehrenamtlich tätigen Mykologen. Nachwuchs gibt es kaum mehr.“ Und das sei bedauerlich, denn „man darf nicht vergessen, dass es sich beim Erkennen von Pilzen um eine Wissenschaft handelt, bei der man jahrelange Erfahrung und Geländekenntnis braucht, um sichere Bestimmungen durchführen zu können.“
.
Im Vorwort der Dissertation von Lothar Krieglsteiner über Pilze in der Rhön schreibt sein Doktorvater: „Pilze spielen als Destruenten und Symbionten in den verschiedenen Ökosystemen eine bedeutende, meist allerdings verborgene und wenig erforschte Rolle. Eine hohe Zahl erstmals in der Rhön festgestellter Pilzarten lässt erkennen, dass es selbst bei Anlegung eines relativ groben Bezugssystems für Beobachtungen (hier Naturräume) viel zu tun gibt. “
.
Über seinen Doktoranden heißt es: „Er gehört zu den besten Pilzkennern unseres Landes und nur so war es möglich, in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit, in die leider kein gutes Pilzjahr fiel, mit Ausdauer und großer Artenkenntnis zu einem sehr beachtlichen Beobachtungsstand zu gelangen.“
.
Der Leipziger Pilzforscher Jochen Gartz schrieb ein Buch „Halluzinogene im Sozialismus“, in dem es um Nachdrucke aus Büchern der Volksarmee geht, in denen die Magic Mushrooms als potentielle Militärkampfstoffe behandelt wurden. „Durch die Tabuisierung der Halluzinogene mit Forschungsstop in den westlichen Ländern sind diese komprimierten und interdisziplinären Darstellungen auch heute noch eine reiche Fundgrube chemisch/medizinischen Wissens,“ meint der Autor.
.
Inzwischen dürfen die Wissenschaftler im Westen jedoch wieder die „psychedelische Wirkung“ von Rauschpilzen erforschen, u..a. ein Team um den Mykologen Roland Griffith an der John Hopkins Universität. Die Wirkung der halluzinogenen Pilze halte zwar nur wenige Stunden an, doch noch ein Jahr nach dem Pilz-Trip konnten die US-Forscher einen persönlichkeitsverändernden Effekt der Pilze feststellen. Die Persönlichkeit werde durch sie vor allem in Hinsicht auf „Offenheit“ dauerhaft verändert, berichtete Griffith in der Fachzeitschrift „Journal of Psychopharmacology“. Dies sei besonders verblüffend, da die „Offenheit“ mit zunehmendem Lebensalter normalerweise abnehme.
.
Ein Forscherteam um David Nutt vom Imperial College London fand eine andere Wirkung von psylocibinhaltigen Pilzen (Magic Mushrooms). „Da wir von bewusstseinserweiternden Drogen sprechen, gingen wir davon aus, dass die Substanz die Gehirnaktivität ankurbelt. Doch genau das Gegenteil war der Fall“, schrieb Nutt in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Nicht nur, dass die Droge die Aktivität einer Gehirnregion herabsetzt, auch dass es sich dabei ausgerechnet um den präfrontalen Cortex handelt, verblüffte die Forscher, die den Pilz deswegen laut „Focus“ als Antidepressivum nutzen wollen, denn Depressive weisen genau in diesem Hirnbereich eine Hyperaktivität auf.
.
Der depressive Komponist John Cage war ein großer Pilzfreund, er lebte lange Zeit alleine im Wald – und komponierte, spielte jedoch auch mit dem Gedanken, Pilzforscher zu werden. In einem Interview meinte er: „Wenn ich gewußt hätte, wie es im Musikgeschäft läuft, wäre ich auch Pilzforscher geworden. Inzwischen weiß ich allerdings, dass es auch unter Pilzen wie im Musikgeschäft zugeht.“
.
Etwas freundlicher äußerte sich ein pilzinteressierter Kulturwissenschaftler auf einer Schleimpilz-Konferenz in Potsdam: „Pilze waren immer schon sehr nachdenkliche Leute.“ Ähnliches gilt auch für die Autoren der Pilzkundlichen Fachzeitschrift „Der Tintling“. Einige Tintlinge sind nicht nur Speisepilze, man kann aus ihnen auch „dokumentenechteTinte“ machen.
.
Die Mikrobiologin an der Jenaer Universität Kerstin Voigt forscht über Jochpilze, dabei geht es ihr um deren Schwanken zwischen Symbiose und Parasitismus. „Rein evolutionsgenetisch sind Pilze dem Reich der Tiere, nicht dem der Pflanzen zuzuordnen“, meint sie. Es sind quasi „stationäre Tiere“. Dabei stellen die von ihr untersuchten Jochpilze entwicklungsbiologisch gesehen innerhalb der Pilze ein Bindeglied zu sich geschlechtlich fortpflanzenden Lebewesen dar. Ihre Vertreter leben parasitisch auf anderen Pilzen, auf Pflanzen und in Menschen mit schwachem Immunsystem. „Die Mechanismen, mit denen die Pilze ihren jeweiligen Wirt dazu ‚überreden‚, sie auf ihm leben zu lassen und nicht gleich zu vernichten, sind die selben, die sie auch zur geschlechtlichen Fortpflanzung untereinander befähigen“, meint die Mikrobiologin.
.
Die Pilze hatten ihren jeweiligen Wirt „zum Fressen gern“ und wollten ihn daher möglichst lange am Leben erhalten. Indem die Urpilze auf Pilzen lebten, also auch ihre nächsten Verwandten ausnutzten, „erfanden sie den Sex“. Denn sie begannen untereinander genetisches Material auszutauschen – sozusagen als Gastgeschenk, um den Wirt milde zu stimmen. Damit legten sie zum Einen den Grundstein für ihre eigene weite Verbreitung. Im Lauf der Jahrhunderte überlebten sie in teils parasitisch, teils symbiotischen Lebensgemeinschaften. In Gemeinschaft mit Algen, nämlich als Flechten, konnten sie sogar die Gipfel des Himalaja stürmen. Zum Anderen wiesen sie den Weg aus der wenig flexiblen ungeschlechtlichen Reproduktionsmisere hin zur Artenvielfalt höher entwickelter Lebewesen durch geschlechtliche Fortpflanzung.“
.
.

Clownfisch im Aquarium des Tierparks Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn Maria Fencik.
.
.
Parasiten
Mitte des 19. Jahrhunderts nannte ein Zoologe des Britischen Museums einen „glashell durchsichtigen Falter“ aus dem Amazonasgebiet „Hetaera“, weil er dabei an die „durchsichtig gewandeten Kurtisanen des alten Griechenland“ dachte. Als Artname fügte er „Esmeralda“ hinzu – in Anspielung an die „liebliche Zigeunerin in Victor Hugos ‚Notre Dame des Paris’“. 1936 wurde „Hetaera esmeralda“ in das Bilderbuch „Falterschönheit“ über exotische Schmetterlinge aufgenommen, dem Hermann Hesse ein Vorwort beigab. Das Büchlein las Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil. Bei der Abfassung seines „Doktor Faustus“ geriet ihm dieser Schmetterling („in durchsichtiger Nacktheit den dämmernden Laubschatten liebend“) zum Leitmotiv seines Romans, dessen tragischer Held der hochbegabte „Tonsetzer“ Adrian Leverkühn ist. Er fühlte sich an die „Falterfreuden“ seines Schmetterlinge sammelnden Vaters erinnert und besonders an dessen „Hetaera esmeralda“, „als er im Freudenhaus die wartenden Mädchen erblickte,“ schreibt der Basler Biologe Adolf Portmann in der „Weltwoche“. „Esmeralda – das ist der Anfang des unheilbaren Leidens, das ihn früh verzehrt, und das zum Pakt mit dem Teufel führt, der sich ausdrücklich als Freund des Mädchens einführt.“ Zuletzt bezeichnet das „Hetaera-Motiv“ den „Augenblick des Zusammenbruchs, den Sieg des lähmenden schleichenden Leidens.“
.
Adrian Leverkühn hatte sich im Bordell mit dem Bakterium „Treponema pallidum“ (Syphilis) infiziert. Portmann nennt den Roman eine „Spirochäten-Philosophie“ – und „die Infektion [mit diesem schraubenförmigen Bakterium] geht den Biologen natürlich im höchsten Grade an.“ Sie stellt uns vor die Frage nach dem Zusammenhang zwischen der „schöpferischen Höchstleistung“ und dem „Wirken von Mikroorganismen, die das Zentralnervensystem befallen“. Die Mikrobiologen begreifen den Parasiten nicht nur als „wuchernden Zerstörer“, sie richten ihre Aufmerksamkeit auch auf eine „subtile Auswahl“, die das Bakterium „leistet“ sowie auf die „Hilfe“, die der Erkrankte für seine Verbreitung „zu leisten gezwungen wird“.
.
Tripper und Tuberkulose werden ebenfalls durch Bakterien verursacht, die sich durch Kontakt übertragen. Den drei Bakterienarten gelingt es, bei ihrem Wirt einen gesteigerten Wunsch nach körperlicher Nähe und sexuellem Kontakt hervorzurufen. Mikrobiologen gehen davon aus, dass die drei “Erreger” diesen Wunsch verstärken – um sich auszubreiten, d.h. weitere Wirte zu finden, denn die bereits besetzten machen es nicht mehr lange. In harmloser Form „steuern“ uns wahrscheinlich auch unsere Darmbakterien, „Escherichia coli“ z.B.. Das „Kolibakterium“ sorgt sich um meine Nahrung, die es aufbereitet – und drängt mich u.U. auf eine Weise, dass ich es scheinbar selbst bin, der plötzlich einen Heißhunger auf Schokolade oder Gurken etwa bekommt.Umgekehrt weiß ich von meiner inneren Bakterienkultur so viel, dass sie es z.B. nicht mag, wenn ich ihr auf nüchternem Magen mit Rotwein komme, obwohl genug Nährstoffe darin enthalten sind. Mit einem nachträglichen Kontrollblick in die Kloschüssel kann man die jeweilige momentane Befindlichkeit seiner Kolibakterien „entschlüsseln“. Sofern man noch einen der von den Nazis favorisierten „Flachspüler“ benutzt – und keinen Tiefspüler, wie die anderen Völker.
.
Mit Antibiotika kann ich E.coli beikommen, andersherum kann er mich unter Umständen und im Verbund mit anderen Darm-Mikroorganismen buchstäblich auffressen. Aus einem Symbionten ist dann ein Parasit geworden.
.
Parasiten sind wahre Könner im Steuern ihrer Wirte. Die „Ärztezeitung“ erwähnt die Larven des Saugwurmes Leucochloridium, die sich als „Fühlermade“ in den Fühlern der nachtaktiven Schnecke festsetzen und diese dazu bringt, am helllichten Tag so lange auf einer Blattoberseite herumzukriechen, bis sie endlich von einem Vogel entdeckt und von ihm gefressen wird. Auf diese Weise gelangen die Larven über einen Zwischenwirt in ihren eigentlichen Wirt. Der „Spiegel“ fügt hinzu: „Eindrucksvoll ist auch, wie sich die von den Parasiten befallenen Fühler verändern: Sie schwellen so sehr an, dass die gespannte Haut durchsichtig wird. Darunter werden farbige, pulsierende Streifen voller Parasitenlarven sichtbar, die für Vögel genauso aussehen wie ihre Lieblingsspeise: Raupen.“
.
US-Biologen haben bei einer drei Millimeter großen Gallwespe, die auf noch nicht geklärte Weise eine kleine Höhle für sich in den Stamm von Eichen entstehen läßt, eine sie parasitierende noch winzigere Erzwespe gefunden: Ihre Larven arbeiten sich im Körper der Gallwespe bis zu ihrem Kopf durch und beeinflussen sie dort derart, dass die Gallwespe nur noch kleine Ausgangslöcher statt ihr entsprechende bohrt, beim Versuch, ins Freie zu kommen bleibt sie stecken und stirbt, woraufhin aus ihrem Kopf die junge Erzwespe schlüpft und entkommt.
.
Auch die hiesigen Grabwespen, von denen es weltweit etwa 10.000 Arten gibt, haben es mit Raupen: Die Weibchen lähmen sie mit einem Stich, schleppen sie in ihre Bruthöhle und legen ihre Eier daneben. Wenn die Larven schlüpfen, ernähren sie sich von der noch lebenden Raupe. Charles Darwin fand diese Lebensweise so verstörend, dass sie seine Zweifel an der Existenz Gottes verstärkte: „Ich kann nicht so einfach wie Andere die Beweise für eine gezielte Erschaffung und allseitiges Wohlwollen erkennen, auch wenn ich es mir wünschen sollte. Es erscheint mir zu viel Elend in der Welt. Ich kann mich nicht davon überzeugen, dass ein wohlwollender und allmächtiger Gott die Grabwespen mit der Absicht erschaffen haben sollte, dass sie sich vom Inneren von Raupen ernähren.“
.
Ähnlich entsetzt wäre Darwin über die Schlupfwespen der Gattung Polysphincta gewesen. Sie sind Meister in der Kunst der Spinnendressur, schreibt der „Spiegel“. „Die Weibchen legen ihre Eier auf bestimmte Spinnen. Die Larven bohren Löcher in den Leib ihres Wirts und fressen sich an dem Saft satt, den sie daraus saugen. Nach einer Woche beginnen sie, Stoffe zu injizieren, die das Webverhalten der Spinne verändern. Einige Radnetzspinnen beginnen unter der Regie der Wespenlarven komplexe 3-D-Gebilde zu spinnen; andere, die sonst trichterförmige Netze bauen, versehen diese nun mit Türen. Alle diese Umbauten dienen dem Zweck: Verpuppungsplätze für die Wespenlarven zu schaffen.“ Wenn sie damit fertig sind, töten die Larven ihre willige Helferin und saugen sie aus.
.
Der im Amazonasgebiet lebende Candiru-Fisch parasitiert am Menschen, wenn auch nur an Männern: Der kleine rötliche Fisch beißt sich am Penis fest und wandert die Harnröhre nach oben. „Galileo.tv“ berichtet: „Wenn ihr von diesem Parasit befallen seid, dann hilft nur noch eine Operation. Der Penisfisch, auch Harnröhrenwels genannt, wird von Urin angelockt. Also dort nicht ins Wasser pinkeln“ Mag sein, dass Urin ihn anlockt, er ist jedoch an unserem Blut interessiert, und läßt eigentlich von seinem Wirt ab, wenn er satt ist. Dass er die Harnröhre hochwandert, wird nur von einem einzigen amerikanischen Amazonasforscher berichtet.
.
Intelligente Parasiten nehmen es mit allen Tieren und Pflanzen auf, selbst unter den Halblebewesen, den Viren, gibt es wahre Könner. Die Tollwut-Viren z.B. veranlassen einen Warmblüter, andere so heftig zu beißen, dass der virushaltige Speichel in die blutende Wunde eindringen kann, dann wandern die Viren die Nervenstränge zum Rückenmark hoch und ins Gehirn sowie in die Speicheldrüsen, wo sie sich vermehren. Nach einigen Wochen bekommt das Opfer selbst eine Beißwut, dazu einen starken Wandertrieb und eine Wasserscheu, ferner Krämpfe im Schlund. Wenig später tritt bereits der Tod ein. Diese seltsame Symptom-Kombination ist vom Tollwut-Virus „gewollt“ – lebenswichtig: Es geht ihm darum, dass immer wieder neue Warmblüter heftig gebissen werden, eine Muskelfleischwunde nützt ihm nichts. Auch der Wandertrieb des Opfers dient der Virusausbreitung. Die Krämpfe im Schlund verhindern, dass der infizierte Speichel verschluckt wird und die Wasserscheu, damit „der Keimträger von jeder Möglichkeit des Wegschwemmens der Keime bewahrt wird,“ wie der Zoologe Adolf Portmann darlegte, der das Verhalten des Tollwut-Virus (aus der Familie der Rhabdoviridae) verfolgte.
.
.

Roter Panda im Tierpark Hellabrunn. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
.
Orang-Utan
Affen gelten allgemein und zu Recht als witzig, mindestens gewitzt. Aber schon allein bei den sogenannten „Menschenaffen“ gibt es große Unterschiede in der Gewitztheit. In New York hat eine Gruppe von Zoologen und Zooexperten dies am Beispiel des Ausbruchsverhaltens von gefangenen Menschenaffen untersucht, sie kamen zu dem Ergebnis: „Wenn man einem Schimpansen einen Schraubenzieher gäbe, würde dieser versuchen, das Werkzeug für alles zu benutzen, außer für den ihm eigentlich zugedachten Zweck. Gäbe man ihn einem Gorilla, so werde dieser zunächst entsetzt zurückschrecken – ‚O mein Gott, das Ding wird mich verletzen‘ – dann versuchen, ihn zu essen, und ihn schließlich vergessen. Gäbe man den Schraubenzieher aber einem Orang-Utan, werde der ihn zunächst einmal verstecken und ihn dann, wenn man sich entfernt habe, dazu benutzen, seinen Käfig auseinander zu bauen.“
.
Der Schriftsteller Eugene Linden merkte dazu in seinem Buch „Tierisch klug“ (2001) an: „Auf diese Weise sind die Tierpfleger und die Orang-Utans in dem Menschenaffenäquivalent eines endlosen Rüstungswettlaufs gefangen, in dessen Verlauf die Zooplaner sich immer wieder Gehege ausdenken, die natürlich wirken und dennoch die Tiere sicher gefangen halten sollen, während die Orang-Utans jede Schwachstelle, die den Planern und Erbauern entgangen sein könnte, auszunützen versuchen.“ Und das, obwohl sie im Gegensatz zu den Schimpansen in der Freiheit kein Werkzeug benutzen, wenn man vom gezielten Umstürzen morscher Bäume absieht (Termiten graben sie z.B. mit der Hand aus).
.
In der Gefangenschaft entwickeln sie sich dagegen still und leise zu wahren „Ausbrecherkönigen“. Eugene Linden erwähnt einige: Dem im Zoo von Omaha, Nebraska, lebenden männlichen Orang-Utan „Fu Manchu“ gelang mit seiner Familie gleich mehrmals die Flucht aus ihrem Freigehege und ihrem Käfig. Sie wollten jedoch nur auf die Bäume draußen klettern bzw. sich auf dem Dach des Affenhauses sonnen – und ließen sich jedesmal wieder in ihre Unterkunft zurücklocken. Die Wärter waren lange Zeit ratlos. Schließlich kamen sie dahinter, dass „Fu Manchu“ im unbeobachteten Moment in den Graben des Freigeheges schlich, dort eine Tür, die zum Heizungskeller führte, leicht aus den Angeln hob und öffnete. Am Ende eines Ganges tat er dasselbe mit einer zweiten Tür, die ins Freie führte. Dann fingerte er ein Stück Draht aus einer seiner Backen und machte sich am Schnappriegel des Schlosses zu schaffen – so lange, bis er es geöffnet hatte.
.
Der Orang-Utan Ken Allen wurde im Zoo von San Diego geboren. Seine Eltern stammten aus Borneo. Ihm gelang dreimal hintereinander der Ausbruch aus dem Zoo. Seine Fähigkeit, die Zoowärter zu überlisten, aber auch seine Fügsamkeit nach dem Auffinden machten ihn in den Medien populär. Die erfolgreichen Gehegeausbrüche brachten ihm den Spitznamen The Hairy Houdini in Anlehnung an den Entfesselungskünstler Harry Houdini ein. Es bildeten sich zahlreiche Fanclubs, die Merchandising mit Ken Allens Konterfei vertrieben und den Slogan Free Ken Allen propagierten.
.
Anfang 2013 brach die Orang-Utan-Dame „Sirih“ im Frankfurter Zoo zum zweiten Mal aus dem neuen Affenhaus aus – ihr Gehege wurde danach ständig überwacht. 2015 schob man sie sicherheitshalber in den Zoo von Indianapolis ab, der über eine bessere Wegsperrtechnologie verfügt. Im Duisburger Zoo flüchtete 2015 ein Orang-Utan aus dem Affenhaus. Da man befürchtete, dass er Menschen gefährden könnte, wurde er erschossen.
.
Wenn sie einmal nach draußen gelangt sind, fürchten sich die Orang-Utans jedoch vor der ungewohnten Umgebung. „Auf einer gewissen Ebene wissen die meisten gefangenen Tiere, dass der Zoo der Ort ist, in dem sie leben.“ Von zwei Mitarbeitern an einem Projekt zur Erforschung der geistigen Fähigkeiten von Menschenaffen im Nationalzoo in Washington erfuhr Eugene Linden von einer Orang-Utan-Gruppe, die mehrere grüne Tonnen, die von ihren Wärtern beim Saubermachen ihres Freigeheges vergessen worden waren, übereinander stapelte und darüber rauskletterte. Eines der Weibchen fand man bei den Verkaufsständen wieder, wo sie ein Brathähnchen aß und Orangensaft trank, beides aus einer Kühlbox, die sie einem Zoobesucher abgenommen hatte. Ein anderer Besucher, der Zeuge ihres Ausbruchs gewesen war, sagte, dass er deswegen nicht die Wärter alarmiert hätte, weil er dachte, diese Affen dürften das, denn sie wären schon den ganzen Vormittag aus ihrem Freigehege raus- und wieder reingegangen.
.
Mit Orang-Utans könnten die Menschen an sich leichter als mit den anderen Menschenaffen zusammenleben , wie bereits der Tierpsychologie Wolfgang Köhler herausfand. Von 1914 bis 1920 hatte er die Anthropoidenstation der Preußischen Akademie der Wissenschaften auf Teneriffa geleitet, wo er Untersuchungen über den Werkzeuggebrauch und das Problemlösungsverhalten von Menschenaffen durchführte. 1917 veröffentlichte er über deren „kognitive Leistungen“ ein Buch mit dem Titel: „Intelligenzprüfungen an Anthropoiden“. Seine Affenforschung unternahm er z.T. unfreiwillig, weil er wegen des Kriegsausbruchs nicht von Teneriffa weg konnte: „Jeden Tag Affen, man wird schon selber schimpansoid“, klagte er. Seinen sieben in Westafrika „frisch gefangenen“ Schimpansen attestierte er nach einer Reihe „klassischer Intelligenzprüfungen“ eine relative „Gestaltschwäche“. Bei seinem nächsten Forschungsobjekt, dem Orang-Utan-Weibchen „Catalina“, kam Köhler jedoch zu dem Schluß: „Dies Wesen steht uns der ganzen Art nach viel näher als Schimpansen, es ist weniger ‚Tier‘ als sie.“ Und dieser Eindruck resultiere nicht so sehr „aus ihren ‚intelligenten Leistungen‘ als durch das, was man Charakter, Sinnesart o.dergl. nennt.“ Catalina hatte sich während der Experimente in Köhler verliebt. Wohingegen die sieben gefangenen Schimpansen ihn zu Recht für ihr ganzes Unglück verantwortlich machten.
.
Der Affenforscher Carel van Schaik meint herausgefunden zu haben, warum Orang Utans erst in Gefangenschaft „kreativ“ werden. Er hatte im Regenwald von Sumatra eine Strickleiter in einen Baum gehängt, um seine Messinstrumente zu installieren. „Dabei fiel ihm auf, dass die dort lebenden Orang-Utans das merkwürdige Ding kaum beachteten und eher einen Bogen darum machten. Ganz anders dagegen Orangs, die bis dahin in der Obhut von Menschen gelebt hatten und nun frisch ausgewildert wurden: Diese stürzten sich mit großer Neugier auf alles Neue,“ schrieb „Die Zeit“. Inzwischen ist Carel van Schaik davon überzeugt, dass den wild lebenden Affen die Muße für „Neugier und Innovationsfreude“ fehlt: „Sie können es sich nicht leisten, lange nachzudenken oder zu spielen“, meint er. Ganz anders die gefangen gehaltenen Orang-Utans: Es sei „fast unheimlich – im Zoo sind die Tiere wie eine andere Art.“ Hier seien sie neugierig und Unbekanntem gegenüber aufgeschlossen; in der Wildnis dagegen „interessieren sie sich überhaupt nicht für Neues, ja sie haben sogar etwas Angst davor“.
.
Da die Suche nach Futter in der Gefangenschaft wegfällt, suchen die Tiere sich andere Beschäftigungen – sie fangen z.B. an, sich für die Zoobesucher vor ihrem Käfig zu interessieren. Der Zürcher Zoodirektor und Tierpsychologe Heini Hediger schreibt: „Es darf aufgrund sorgfältiger Erhebungen gesagt werden, dass sich die (höheren) Tiere im Zoo ohne Publikum langweilen, dass sie durch die Besucher unterhalten und angeregt werden.“ Wegen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche bei den Huftieren mußte der Zürcher Zoo mehrmals geschlossen werden, Hediger erinnert sich, wie augenblicklich die Stimmung sank: „Eine allgemeine Apathie, um nicht zu sagen Depression breitete sich alsbald im Zoo aus. Die Tiere lagen oder standen gelangweilt und langweilig herum und waren dankbar für jeden Reiz…“ Und dies galt besonders für die Affen.
.
Unter besonderen Umständen kann der Kontakt zu den Menschen so eng werden, dass der Orang-Utan zwischen die Arten gerät. Der Primatenforscher Keith Laidler zog einen jungen Orang-Utan namens Cody bei sich auf, mit der Folge, dass er Angst vor seiner eigenen Mutter bekam. Eine Pflegerin der Orang-Utans im Pariser „Jardin des Pantes“ berichtete: Weil einige Besucher sich küssten, machten es irgendwann die Orang-Utans nach. Bei rothaarigen Besucherinnen machen sie Kußgesten zu ihnen hin. Die älteste „Nénette, wurde 1969 auf Borneo eingefangen. „So lange in Gefangenschaft zu sein, ist natürlich schrecklich, wir fühlen uns hier alle schuldig,” meinte sie.
.
Der Gründer und Direktor des „Wildlife Parks“ auf der Insel Jersey, Gerald Durrell, schreibt in einem seiner Bücher, dass sein rothaariger Mitarbeiter Simon eines Tages Ärger mit dem ausgewachsenen Orang-Utan namens Gambar bekam, weil dieser sehr eifersüchtig auf seine Frau Gina war und Simon für einen Nebenbuhler hielt. Wenn der den Gitterstäben nahe kam, schlug der Orang-Utan derart wütend gegen einen alten Autoreifen in seinem Käfig, dass es laut dröhnte. Anschließend packte er Gina und vergewaltigte sie. Simon meinte, dass Gina ihn dabei mit einem anklagenden Blick ansah. Er war sich sicher, dass sie ihm die Schuld dafür gab.
.
Die in Borneo lebende Orang-Utan-Forscherin Birute Galdikas berichtet, dass der von ihr aus der Gefangenschaft befreite Orang-Utan „Gundul“ eine der einheimischen Köchinnen sexuell belästigte, während er die einheimischen Männer im Camp als „Dienstboten“ ansah.
.
Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete im Dezember 2016, dass der Orang-Utan Benjamin, der aus Dänemark in den Kaliningrader Zoo kam, sich nicht nur an die neuen Lebensbedingungen gewöhnen muß, sondern auch an die neue Sprache. Noch versteht er seine Tierpfleger nicht, die sich in Russisch an ihn wenden. Doch erste Ergebnisse des praktischen sprachlichen Verstehens machen Hoffnung, sagte die Zoodirektorin S. Sokolowa.
.
.

Sibirischer Tiger im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Marc Mueller.
.
.
Ursprachen
Charles Darwin zeigte, dass nicht Gott die Lebewesen geschaffen hat, sondern die Evolution und speziell die Menschen aus Affen hervorgingen, die irgendwann von Afrika aus im aufrechten Gang, der ja laut Ernst Bloch zuletzt gelernt wird, losmarschierten. Bekanntlich hatte Gott uns, als er noch nicht von Nietzsche für tot erklärt worden war, die Sprache verliehen – als Alleinstellungsmerkmal quasi. Deswegen hatte Darwin nach seiner Evolutionstheorie die Not, zu erklären, wie die menschliche Sprache denn nun wirklich entstand.
Hundert Jahre zuvor hatten die Universitäten in Paris und London bereits so viele Preise für den klügsten Essay über den „Ursprung der Sprache“ ausgeschrieben, dass sie beschlossen, dazu keine Texte mehr anzunehmen. Die Suche nach der „Ursprache“ hatte die gelehrten Gesellschaften mit einer Lawine von „Denkschriften“ überhäuft. Im Grunde suchte man die „Ursprache“ schon seit 2500 Jahren. Überliefert ist das Sprachexperiment des ägyptischen Pharaos Psammetich I.: Er übergab einem Hirten zwei Neugeborene, die als „Ansprechpartner“ nur einige Ziegen hatten. Nach zwei Jahren konnten sie gerade einmal meckern.
Ähnliches führte dann 1240 der empiriefreudige Stauferkaiser Friedrich II. durch: Seine Versuchskinder wuchsen auf, ohne dass Erwachsene sie ansprachen. Alle Kinder starben – nahezu stumm. Friedrich II resümierte: „Sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen“.
Die auf Borneo lebende Orang-Utan-Forscherin Birute Galdikas berichtete 1995, dass ihr Sohn, der mit Affen aufwuchs, zuerst die „Gibbonsprache“ lernte, dann die „Orang Utan-Sprache“ und schließlich die der einheimischen Dayaks . Ähnliches berichtete auch der US-Psychologe Winthrop Kellog über seinen Sohn, den er zusammen mit einem Schimpansen großzog.
Darwin hatte 1871 zur Sprachentwicklung geschrieben: „Genau an dem Punkte, wo der Mensch sich von der Thierwelt lostrennt, bei dem ersten Aufblitzen der Vernunft, als die Offenbarung des Lichts in uns, finden wir die Geburtsstätte der Sprache.“ Neodarwinistisch ausgedrückt – mit dem US-Linguisten Noam Chomsky, der von 1981 bis 2001 an seiner Theorie feilte: 1. Der Mensch besitzt eine Universalgrammatik. 2. Die sie ermöglichende grammatische Struktur ist allein in den menschlichen Genen verankert bzw. im menschlichen Gehirn kodiert. Und 3. Das ist mit der Darwinschen „Trennung“ gemeint – sie erfolgte also aufgrund einer „Mutation“.
Abgesehen davon, dass es noch Stammesgesellschaften gibt, die sich ganz ohne „unsere“ Universalgrammatik prima untereinander verständigen, bleibt trotzdem die Frage, woraus sie sich einst entwickelt hat. In seiner Schrift über die „Abstammung des Menschen“ hatte Darwin sich zwar „mit der gebotenen Vorsicht“, wie die FAZ schreibt, geäußert, dafür aber unmißverständlich: Die Sprache entwickelte sich aus dem Vogelgesang, so dass die Anfänge der menschlichen Sprache dann auch zunächst Gesänge waren, vielleicht sogar nachgeahmte.
Unter den Menschenaffen gelang dies nur den in Südostasien lebenden Gibbons: Sie können wie die Vögel singen – hoch und tief zwitschern. Laut dem umstrittenen Ethnopharmakologen Terence McKenna und dem Autor des Buches „Darwin’s Pharmacy“ Richard Doyle verdanken wir die Sprache einigen Affen, die sich Pilze mit psychedelischer Wirkung einverleibten – d.h. eine im Wortsinn „bewußtseinserweiternde Droge“.
Umstritten war auch die vom österreichischen Biologen Karl von Frisch entdeckte und mit einem Nobelpreis bedachte „Tanzsprache“ der Bienen, mit denen eine Anzahl „Suchbienen“ den Übrigen den Weg zur nächstgrößeren Blütentracht weisen. U.a. Noam Chomsky hielt dagegen: der Bienentanz – das sei keine Sprache; ein Vergleich dieser Tänze mit unserer Sprache wäre zwar naheliegend, dennoch: „Die Bienen können über Honig kommunizieren: wo er ist, wie weit entfernt, in welcher Richtung. Das ist es dann aber auch.“ Karl von Frisch hatte demgegenüber experimentell festgestellt, dass es sogar verschiedene Sprachen bei den Bienentänzen gibt: So stößt z.B. der Schwänzeltanz einer italienischen Biene bei den hiesigen zunächst auf Mißverständnisse – die Entfernung betreffend.
In seinem 2016 erschienenen Essay „The Kingdom of Speech“ weist der US-Schriftsteller Tom Wolfe gleich beiden – Darwin und Chomsky – eine Upperclass-Unmoral nach, die sich gegen den Aufstieg zweier Empiriker aus der unteren Klasse (Wallace und Everett) richtete, die es besser, d.h. genauer, wußten. Aber zum Einen zieht Tom Wolfe sich dabei am Ende auf eine ästhetische Sprachtheorie zurück: „Zu sagen, dass die Tiere sich in Menschen entwickelt haben, ist das Selbe, als würde man die Meinung vertreten, dass ein Stück Carrara-Marmor zu Michelangelos ‚David‘ evolutionierte.“ Zum Anderen hatte die „dunkle Geschichte“ um die Priorität bei der Evolutionstheorie (Wallace oder Darwin?) bereits der Evolutionsforscher am Berliner Naturkundemuseum Matthias Glaubrecht 2013 gründlicher erhellt – mit seinem Buch: „Am Ende des Archipels“.
Neben den Darwinschen Vögeln gibt es auch noch die Frösche, die unsere „Ahnen“ beim Spracherwerb – und damit bei der Menschwerdung – gewesen sein sollen. Der Sprachforscher und Aufsichtskommissar bei der französischen Eisenbahn Jean-Pierre Brisset hat dafür zwischen 1883 und 1913 Beweise gesammelt. Die Pariser Avantgarde hat ihn deswegen als „Fürst der Denker“ gefeiert. Unter diesem Ehrentitel erschien 2016 eine „Dokumentation“ über ihn. Seine Sprachanalysen resultierten aus langen Wanderungen „in den Sommernächten“ durch die „umliegenden Sümpfe“ seines Wohnortes, wo er „dem Gesang der Frösche lauschte. Aufmerksam notiert er ihre Laute.“ Alles ist darin zu hören, „wenn man nur hören will. Die Frösche, sie sprechen eine Sprache,“ wie es im Vorwort heißt. Brisset schrieb: „Die Zahl der Grammatiken ist unendlich.“ In der Ankündigung der Veranstaltung zu seinen Ehren hieß es: „Die Ursprünge des Menschen endlich enthüllt. Wir stammen vom Frosch ab. Beweise aus der menschlichen Sprache sowie dem Körperbau, den Sitten und Rufen des Frosches erbracht.“
Brisset führte dazu aus: „Der Klang der Stimme und die Modulation des Gesangs des Frosches haben bereits etwas Menschliches. Seine Augen, sein Blick ähneln den unseren; und kein Tier besitzt eine körperliche Anmut von der Ferse bis zum Hals, die es so sehr dem menschlichen Körper annähern würde; wenige Menschen, selbst die jungen, sind so elegant.“ Der Wissenssoziologe Michel Foucault veröffentlichte 1962 einen Aufsatz „Der Zyklus der Frösche“ über Brissets Forschungsmethode: „Um ein beliebiges, farbloses Wort seiner Sprache, wie man es im Wörterbuch findet, versammelt er durch grelle Alliterationen andere Wörter, die an alte, aus unvordenklichen Zeiten stammende Szenen des Begehrens, des Krieges, der Barbarei und der Zerstörung denken lassen – oder an die kleinen Schreie der Dämonen und das Gequake der Frösche, die an den Rändern der Sümpfe umherspringen.“
Foucault hatte wenig Ahnung von Fröschen, er war ein Diskursforscher: „Brisset gibt die Wörter jenem Lärm zurück, aus dem sie hervorgegangen sind, und setzt nochmals die Gesten, Angriffe, Gewalttaten in Szene. Er setzt den ‚Thesaurus linguae gallicae‘ dem Urlärm aus, verwandelt die Worte zurück in die quakenden Kehlen, vermischt sie aufs Neue…Es handelt sich nicht um eine in sprachlicher Iteration gründende Ideenflucht, sondern um eine unendlich beschleunigte phonetische Szenographie.“
Brisset setzte allein die französische Sprache derart in Szene, seine Werke sind nicht so sehr Ausdruck einer Geistesverwirrung, sondern eher die (bio)logische Konsequenz aus dem alten gallischen Brauch Froschschenkel zu essen, weswegen man in den USA die Franzosen abschätzig „Frogs“ nennt und in England „Frogeater“.
Ähnlich denkt auch der Gießener Etholinguist Dr. Salm-Schwader, für den das grunzende Deutsch, die helle Hautfarbe und die Specknackigkeit unserer Altvorderen auf die germanische Vorliebe für Schweinefleisch zurückgehen. Inzwischen transplantiert man hierzulande sogar schon Organe von Schweinen in Menschen (Herzklappen z.B.). Salm-Schwaders Leitgedanke geht auf den Biosophen Ernst Fuhrmann zurück: „Du bist was du ißt.“ Folgt man der Mikrobiologin Lynn Margulis, dann ist das so zu verstehen: Einige der ersten Einzeller verschluckten eine Bakterie, die sie jedoch nicht verdauten, sie kooperierten stattdessen mit ihr – im Inneren. Und so ging es fort bis heute, da mittlerweile in jeder unserer Körperzellen, auch in den Zellen der Pflanzen, ehemals freilebende Bakterien – Mitochondrien und Plastiden – als Individuen fortexistieren. Andere Bakterien, die Licht produzieren, begeben sich eher freiwillig z.B. in Glühwürmchen, aber auch in viele andere Leuchttiere. Ihre Wirtstiere vermögen das „Glühen“ durch Drosselung der Sauerstoffzufuhr zu dimmen. Die Glühwürmchen entwickelten damit eine regelrechte Sprache, sie ähnelt einem Morsecode. Einige Weibchen beherrschen sogar mehrere dieser „Sprachen“: Sie locken mit „falschen Lichtsignalen“ Männchen einer anderen Art an, um sie zu verspeisen. Auch bei uns Menschen erfreuen sich Fremdsprachen immer größerer Beliebtheit.
.
.

Flamingos im Ostberliner Tierpark. Sie kommen nicht in „Brutlaune“, wenn ihnen ihre Kolonie zu klein dünkt, was aber in den meisten Zoo nicht der Fall ist.
.
.
Kartoffelkäfer
Der Kartoffelkäfer heißt auf Lateinisch „Leptinotarsa decemlineata“: „Zehnstreifen-Leichtfuß“ – und kommt aus Amerika, genauer: aus Colorado, weswegen er auch „Colorado beetle“ genannt wird. Dort ernährte er sich still und leise von der „Büffelklette“ – ein Nachtschattengewächs. Aber mit den Siedlern aus Europa, die ein neues Nachtschattengewächs, die Kartoffel, anbauten, wechselte er seine Nahrungspflanze, die bald reichlich vorhanden war, ebenso dann auch der Käfer, der dann umgekehrt nach Europa eingeschleppt wurde: 1788 sichtete man ihn erstmals in den Häfen von Liverpool und Rotterdam (Etwa 200 Jahre später folgte ihm seine alte „Büffelklette“).
.
In Europa hatte der Kartoffelkäfer keine natürlichen Fressfeinde, seine Warnfarben, die gelb-braunen Streifen, schützten ihn. 1922 vernichtete der Kartoffelkäfer bei Bordeaux auf 250 Quadratkilometer alle Kartoffelbestände. Erst in den letzten Jahrzehnten begannen einheimische Vogelarten, u.a. Fasane, ihn als Beute anzunehmen. Derweil konnte er sich jedoch über die ganze Welt verbreiten. Seine Erforschung ist fast immer zugleich seine Bekämpfung als „Schädling“. Derzeit versucht man, der „Käferplage“ durch Chemikalien und eine gezielte Infizierung mit dem Bacillus thurengiensis Herr zu werden. Auf kleineren Feldern wird er auch heute noch einfach abgesammelt und vernichtet.
.
Weil der Käfer die Angewohnheit hat, gelegentlich massenhaft aufzutreten, hat man ihn für eine biologische Waffe feindlicher Nationen gehalten, an die man selbst ebenfalls schon gedacht und mehr noch: gearbeitet hat – spätestens seitdem bekannt wurde, was die Vernichtung der Kartoffelfelder 1845 und 1852 in Irland bewirkte – die „Große Hungersnot“, während der Millionen Menschen verhungerten und weitere Millionen auswanderten. Die Deutschen werden von den Türken gerne „Kartoffeln“ genannt, hier hat dann auch die Erforschung des Kartoffelkäfers die absurdesten Blüten getrieben. Das begann damit, dass man im Ersten Weltkrieg den „Erbfeind“ Frankreich verdächtigte, ihn als „B-Waffe“ einzusetzen, um die Deutschen den Hungertod auszuliefern. Tatsächlich kam es in der zweiten Hälfte des Krieges auch zu einer bedrohlichen Lebensmittelknappheit. Vor dem Zweiten Weltkrieg befahl Hitler, der im Ersten von der „C-Waffe“ Senfgas in Belgien vorübergehend erblindet war, dass nur defensive biologische Kriegsforschung und keine offensive betrieben werden dürfe. Verantwortlich dafür war eine Arbeitsgemeinschaft (AG) namens „Blitzableiter“ beim Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Nachdem sich 1943 das Gerücht verbreitet hatte, dass die Amerikaner beabsichtigten, Kartoffelkäfer über Deutschland abzuwerfen, konnte die AG mehr oder weniger heimlich die biologische Waffenforschung in beide Richtungen angehen. Weil einige Forscher gedacht hatten, dass es darum ginge, Kartoffelkäfer gegen England einzusetzen, beschied ihnen das OKW aber zugleich, „daß ein Einsatz von biologischen Kampfmitteln im Angriff gegen England nicht in Erwägung gezogen“ werde. Um trotzdem bio-kampffähig zu sein, plädierte Oberst Münch auf einer Sitzung der AG trickreich für das „Erproben von Ausbringungsverfahren“, Freilandversuche, „damit man wisse, wie der Gegner die B-Mittel anwenden könne,“ wie es in einer Aktennotiz hieß. Der Ministerialdirigent Schumann machte sich dafür stark, den Führer zu überzeugen, dass „Amerika gleichzeitig mit verschiedenen menschlichen und tierischen Seuchenerregern sowie mit Pflanzenschädlingen angegriffen werden müsse.“
.
Zur landwirtschaftlichen Sektion der „Wehrmachtsabteilung Wissenschaft“ gehörte ein Forschungsinstitut in Kruft (Rheinland-Pfalz), wo unter der Leitung von Martin Schwartz Kartoffelkäfer gezüchtet wurden. Daneben wurde am Kaiser-Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenforschung in Wien-Tuttenhof unter der Leitung des später obersten DDR-Biologen Hans Stubbe an Unkrautpflanzen geforscht, deren Samen über England abgeworfen werden sollten. Auf einmal „schien auch der Kartoffelkäfer für einen Einsatz gegen England geeignet,“ wie die Biologiehistorikerin Ute Deichmann in ihrem Buch „Biologen unter Hitler“ schreibt.
.
Am KZ Dachau gab es noch das „Entomologische Institut der Waffen-SS“, das zur „SS-Forschungs- und Lehrgemeinschaft ‚Ahnenerbe’“ gehörte, hier wurde unter der Leitung des Biologen Ernst May erforscht, ob die malariaübertragende Mücke Anopheles für den Kriegseinsatz tauglich war. Und am „Institut für Wehrwissenschaftliche Zweckforschung der SS“ bekam der Leiter der Entomologischen Abteilung, Reichsärzteführer Kurt Blome, den Auftrag: „Die den Menschen schädigenden Insekten in ihren Lebensgewohnheiten zur Klärung der Frage bestimmter Anwendungen und verstärkter Abwehr zu studieren.“ Was bei dieser Forschung herausgekommen ist, weiß man nicht. Um die „Anwendung“ zu testen, stand der „Flieger-Forstschutzverband“ unter Oberst von Borstell zur Verfügung, im Reichsgebiet wurde aber laut Ute Deichmann „wegen der leichten Verstreuung das Arbeiten mit Kartoffelkäfern und damit die Züchtung der für notwendig erachteten 20-40 Millionen Käfer als problematisch erachtet.“ Dennoch fand im Oktober 1943 „ein feldmäßiger Versuch bei Speyer statt, bei dem 1400 Kartoffelkäfer vom Flugzeug aus abgeworfen wurden. 57 davon wurden wiedergefunden.“ Der Rest sollte im darauffolgenden Sommer „bei der allgemeinen Suchaktion gesammelt“ werden. Damit war der „Kartoffelkäfer-Abwehrdienst“ (KAD) des Reichnährstands gemeint, der mit dem Slogan „Sei ein Kämpfer, sei kein Schläfer, acht’ auf den Kartoffelkäfer!“ jeden zur Bekämpfung des Schadinsekts aufrief. „Die Schulkinder bekamen manchmal schulfrei, um die Käfer einzusammeln. Aus Arbeitslosen oder Schulkindern wurden in den Dörfern Suchkolonnen gebildet, um Felder nach Kartoffelkäfern abzusuchen,“ heißt es auf Wikipedia. Ähnliche Aktionen gab es nach dem Krieg auch wieder in der BRD und der DDR. Im Westen nannte man außerdem die vielen Ost-Flüchtlinge „Kartoffelkäfer“, man kann sich denken warum.
.
Als um 1950 herum fast die Hälfte aller Kartoffelfelder in der DDR von Kartoffelkäfern befallen wurde, machte die staatliche Propaganda erneut die Amerikaner bzw. die CIA dafür verantwortlich. Gleichzeitig mobilisierte die Regierung alle Schüler und Studenten, um den „Amikäfer“ und seine Larven auf den Feldern abzusammeln. Unterdes forderte die amerikanische Regierung von der BRD, propagandistische Gegenmaßnahmen zu unternehmen. Diese beschloss daraufhin einen Postversand an sämtliche Gemeinderäte der DDR und den Ballonabwurf von Kartoffelkäferattrappen aus Pappe mit einem aufgedrucktem „F“ für „Freiheit“. Diese wenig aufklärerische Aktion bestärkte die DDR noch in ihrer Annahme, es mit einer großangelegten US- bzw. Nato-Sabotageaktion zu tun zu haben, die darauf abzielte, eine Hungersnot in den sozialistischen Ländern herbeizuführen. Bertolt Brecht dichtete: „Die Amiflieger fliegen/ silbrig im Himmelszelt/ Kartoffelkäfer liegen/ in deutschem Feld.“ Noch Jahrzehnte später war der DDR-Dramatiker Heiner Müller davon überzeugt, wenn er es auch inzwischen eher witzig fand, dass die CIA im Kalten Krieg Kartoffelkäfer einsetzte.
.
Auch Polen wurde 1950 von einer Kartoffelkäferplage heimgesucht: „Unerhörtes Verbrechen der amerikanischen Imperialisten“, titelte im Mai des selben Jahres die „Trybuna Ludu“. Bis dahin war man davon ausgegangen, dass die deutsche Wehrmacht 1939 den Kartoffelkäfer in Polen eingeschleppt hatte. Die Deutschen hatten dort zuvor, im 18 Jahrhundert, bereits die Kartoffel eingeführt, weswegen man diese Feldfrucht in Polen auch „Berliner“ nannte – die Kartoffelkäfer später „Helmuty“.
.
.

Ein weiterer Silbergibbon im Tierpark Hellabrunn München. Photo: Tierpark Hellabrunn 2016 Daniela Hierl.
.
.
Naturschutzkonflikte in Ostelbien
Im Januar 2000 gelang es einem osteuropäischen Wolf, illegal über die Oder nach Deutschland einzuwandern. Er wurde eingefangen und zunächst in den Eberswalder Zoo verbracht. Der Tagesspiegel titelte: „Die Angst vor dem Osten oder Sibirien ist unheimlich nah“. Der Wolf, von den Ostbrandenburgern „Iwan“ genannt, hatte nur drei Beine, vermutlich war er zuvor in Polen in eine Wolfsfalle geraten. Das hinderte ihn jedoch nicht, bei Ossendorf ein Rind zu töten und eine deutsche Schäferhündin namens Xena zu schwängern. Zehn Wochen später machte Bild mit einer großen Story über die Geburt der „Mischlinge“ auf, die nach Meinung von „Wolfs-Experten“ sofort getötet werden müssten, weil sie für immer „unberechenbar“ blieben. Das wurde jedoch von offizieller Seite entschieden abgelehnt. Daraufhin vollführte die Springerpresse ebenso entschieden eine 180-Grad-Wendung – und seitdem werden wir über den dreibeinigen Wolf, der nun offizell Naum heißt, ebenso regelmäßig wie einfühlsam unterrichtet. Er kam dann in das Wolfsgehege des Wildparks Schorfheide, berichtete die Berliner Zeitung. Sie lieferte aber erst mal zwei Seiten Hintergrundmaterial über den „Todfeind Wolf“ – von Jack Londons „Wolfsblut“ bis zu Hermann Hesses „Steppenwolf“. Dann vermeldete sie: Der eingefangene dreibeinige Wolf sei immer noch sehr scheu, habe mehrmals versucht auszubrechen und könne nicht mit seinen deutsch-geborenen Artgenossen zusammengelegt werden, weil einer der Männchen des Rudels sich weigere, „Unterordnung zu signalisieren“. Fast eine RAF-Story! Er bekam dann ein großes Extragehege, in dem er – zur Strafe? mit einer „russischen Wölfin“ zusammenleben mußte.
.
Inzwischen haben sich in der Lausitz etwa 20 Wölfe wild wieder angesiedelt. Sie werden ganzjährig geschützt. Es wurde darüberhinaus einen „Wolf-Wiederansiedlungs-Management-Plan“ in Brandenburg verabschiedet. Damit werden u.a. die von den Wölfen gerissenen Schafe, die man den Schäfern finanziell ersetzt, mit den Mehreinnahmen durch den Wolfs-Tourismus gegengerechnet. So weit so gut, inzwischen haben sich die Wölfe auch in anderen ostdeutschen Regionen vermehrt, ebenso die Versuche der Landwirte, ihre Tiere vor ihnen zu schützen: Elektrozäune, große scharfe Hunde, Bewegungsmelder, die Beleuchtung und Sirenen angehen lassen, neuerdings versucht man die Wölfe mit Esel – z.B. in der Schafherde – abzuwehren. Und sowieso wird regelmäßig gefordert, die Wölfe wieder wie einst abschießen zu dürfen. Noch einem Tier haben die Naturschützer in Ostdeutschland erneut Bewegungsspielraum verschafft: dem Biber. In den Städten freuten man sich darüber: Noch mehr authentische Natur in Ostelbien. Aber unter den Landwirten und Gartenbesitzern im Biberland formierte sich eine biberfeindliche Bürgerinitiative. Unter ihnen zu meinem Erstaunen die für indigene Völker sich engagierende Biologin Hannelore Gilsenbach im Ökodorf Brodowin. Ein Photo in der Kreiszeitung zeigt sie ärgerlich neben einem von Bibern zernagten Obstbaum. Ich war deswegen erstaunt, sie als Antibiber-Aktivistin zu sehen, weil sie mir einmal fast stolz einen Brombeerbusch im Garten zeigte, auf dem etliche Laubfrösche saßen, und dann im Gras eine Grille fing und mir erklärte, die seien auch schon wegen der Klimaerwärmung bis hier in den Norden vorgedrungen, die Grille käme aus Italien. Zum Anderen hatte ich gedacht, sie sei für die Selbstregulierung von Naturschutzgebieten, wobei im übrigen das Brodowiner das älteste deutsche Naturschutzgebiet ist und Hannelore Gilsenbachs Mann, der Ökologieprofessor Reimar Gilsenbach 1981 die „Brodowiner Gespräche“ begründete, in denen es auch und gerade um ökologische Probleme in der DDR und im Rest der Welt ging. In Brandenburg engagierten sich bisher Intellektuelle wie sie eher in Bürgerinitiativen, die gegen den Bau z.B. riesiger Schweinemastanlagen protestieren.
.
Da gibt es die BI „Uns stinkts schon lange“ in Reichenow (Amt Barnim-Oderbruch), wo einer der größten Agrarunternehmer eine solche Mastanlage plant. Da veranstaltet die BI in Hassleben (Uckermark) gegen den Bau einer industriellen Schweinemastanlage eine Protestdemonstration. Es gibt in dem Ort zwei BIs – sie werben in der Mitte des Dorfes mit großen Schildern. Auf dem einen steht „36.000 Schweine machen den Touristen Beine“, auf dem anderen: „Gemeinsam in die Zukunft/ Aktion pro Schwein“. Es geht um die Wiederbelebung einer großen Mastanstalt für 140.000 Schweine, die nach der Wende aus Umwelt- und Tierschutzgründen geschlossen wurde. U.a. hatte die Schweinegülle zwei Seen in tote Gewässer verwandelt. Jetzt ist es jedoch kein sozialistischer Fleischversorgungsplan mehr, sondern ein holländischer Unternehmer, Harry van Gennip, der dort ganz groß „investieren“ will. Er besitzt bereits seit 1994 eine für 65.000 Schweine ausgelegte Anlage im altmärkischen Sandbeiendorf. In Haßleben plante er 1994 eine für 85.000 Schweine. Die Nachdenklichen dort und in Umgebung gründeten daraufhin eine Bürgerinitiative gegen diesen „Wahnsinn“. Unterstützung bekamen sie von allen Ökos und Grünen und von überall. Sie setzten sukzessive eine Verkleinerung der geplanten Anlage durch. Auf der anderen Seite war man aber auch nicht untätig: Der holländische Investor holte sich u.a. Helmut Rehhahn als Berater, einst SPD-Landwirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und davor Leiter einer Bullenprüfstation in der DDR. „10 000 Mastschweine. Alles andere ist Spielerei,“ erklärte er dem Spiegel. „‚Haßleben wird noch moderner. Haßleben,‘ sagte er, ‚das kommt. Das kriegen wir hin‘.“
.
Ein anderer Schweinemäster verriet dem „Freitag“, warum es ihn undandere „Holländer“ nach Osten zieht: „In Holland wirst du als Schweinezüchter ständig wie ein Krimineller behandelt. Das ist in Ostdeutschland anders. Hier kannst du noch Unternehmer sein. Umweltkosten spielen keine Rolle.“ Dazu muß man wissen, dass der holländische Staat dies strategisch plant: Unter Beteiligung von Banken werden an Landwirtschaftsprojekten interessierte Holländer in Arbeitsgruppen geschult und dabei ausgesiebt – getrennt nach Ost und West, je nach dem, wo sie sich in der EU niederlassen wollen. Vor Ort helfen ihnen dann holländische Berater und spezielle Botschaftsangehörige. Van Gennip fand vor Ort – in Haßleben – Unterstützung im langzeitarbeitslosen Teil der Bevölkerung, der sich von seinem gigantischen Schweineprojekt ganz ganz viele „Arbeitsplätze“ versprach und deswegen eine Bürgerinitiative für ihn gründete. Anderswo geht es ähnlich zu – im Osten, der daneben noch mit Windkraftanlagen zugepflastert wird, die man im reichen Bayern und Baden-Württemberg nicht haben will; von dort kommen bloß die Investoren.
.
An BIs gegen Schweinemastanlagen seien genannt: die BI der Gastronomen gegen eine Schweinemast in Klausdorf (Brandenburg), die „BI Mahlwinkel“ (Altmark) gegen eine weitere Schweinemastanlage von Harrie van Gennipp, die „BI gegen Schweinemast in Oldisleben“ (Thüringen) und die „BI gegen Schweinemastanlage in Gerbisbach“ (Sachsen-Anhalt). Es gibt noch etwa zwei Dutzend weitere. An BIs gegen Windkraftanlagen seien genannt: die „Freier Wald e. V.“ in Zossen, die BI gegen ein Windfeld Wolfsmoor (Brüssow/Uckermark), die BI Rettet Brandenburg (vor der Zerstörung durch Windparks), die BI Windkraftgegner Ladenthin in Uecker-Randow, die BI Stahnsdorf Süd gegen die Errichtung von raumbedeutsamen Windkraftanlagen usw.. Sie alle veranstalten Protestdemonstrationen und Aktionstage. Die Agrarsoziologen haben unterdes herausgefunden, dass auch Frau sucht Bauer auf solchen Aktionstagen gut und gerne zum Zuge kommt. Aber was im Westen ein „Kampf“ des „kleinen Mannes“ gegen naturzerstörende Großprojekte ist, stellt sich östlich der Elbe als ein Ost-West-Konflikt dar, insofern sowohl die Investoren als auch die Naturschützer aus dem Westen kommen.
.
In dem Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh wird in der Prignitz ein Vogelschutzgebiet und seine West-Betreuer vom „Öko-Kapital“ aus dem Westen ausgebremst, die dort im Kampfläufer-Schutzgebiet zehn Windkraftanlagen aufstellen wollen. Sie können das auch gegen alle naturschützerischen Abwehrmaßnahmen durchsetzen, woran schließlich die Gemeinschaft des davon unmittelbar betroffenen, z.T. davon aber auch profitierenden Dorfes „Unterleuten“ zerbricht. Auch die dortige Kampfläufer-Population wird sich wegen der riesigen WKA-Rotoren wahrscheinlich woanders ansiedeln. Den Unterschied zwischen den Auseinandersetzungen der BIs in Ost und West sollen zwei Beispiele deutlich machen: In Schleswig-Holstein wurde heftig um Gänse gestritten – und das jahrzehntelang. Es war ein Kampf zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Natur- und Kulturland. Die Bauern und das von ihnen einst durch Eindeichung geschaffene Ackerland auf der einen Seite, auf der anderen sibirische Ringelgänse und ihre deutschen Sprecher: Biologen und Umweltschützer. Es ging dabei um die Einrichtung des „Nationalparks Wattenmeer“, wie er von linken Ökologen bis hin zur Kieler Landesregierung geplant war. „Die Grünen sind schlimmer als die Gutsherren einst“, so sagte es 2001 ein friesischer Bauer. Während das „Bundesamt für Naturschutz“ stolz bekannt gab, dass sich die Ringelgänse in den „Schutzgebieten“ bereits auf eine andere Nahrung umgestellt hätten: „Sie nutzen die landwirtschaftlichen Kulturen im Küstenbereich sowie die Salzwiesen und haben dadurch im Winterquartier und auf dem energiezehrenden Heimzug in die Brutreviere eine bessere Ernährungsgrundlage.“ Ein Beobachter der Auseinandersetzungen, der Ethnologe Werner Krauss, schrieb anschließend: „Der jahrzehntelange Kampf hat Wunden hinterlassen, aber er hat sich auch gelohnt“. Dazu zitierte er einen der beteiligten Biologen: „Als die Bauern die Ringelgänse noch bejagten und zu vertreiben versuchten, hatten sie eine wesentlich höhere Fluchtdistanz“.
.
Auch der Kampf einer Ost-BI hat sich gelohnt: „Ein Riesenerfolg“, titelte die Märkische Oder-Zeitung und meinte damit das vorläufige Ende eines „öffentlichen Kampfes“ zwischen den Vorwerk-Bewohnern von Alt-Rosenthal (am Oderbruch), der „rabiatesten Bürgerinitiative Deutschlands“ (laut Tagesspiegel) und dem Grafen von Hardenberg, einem Düsseldorfer Porschevertreter, der einen Teil seiner ihm zusammen mit dem Schloß Neuhardenberg rückübereigneten Ländereien im Kreis Seelow an die englische Betonfirma Readymix verpachten wollte, um den Kies im Boden abzubauen und damit „neue Arbeitsplätze zu schaffen“ (Alle Kraft für unsere neue Hauptstadt!). Dann machte der inzwischen mexikanisch gewordene Betonkonzern aber doch einen Rückzieher. Man werde das Projekt Aufsuchung von Kiesvorkommen im Raum Alt-Rosenthal nicht weiter bearbeiten: der Protest der Betroffenen war zu groß und zu laut. Das Vorwerk Alt-Rosenthal ist zwar nur eine kleine Häuseransammlung, diese hat es aber in sich. Dort lebten die Schriftsteller Ulrich Plenzdorf und Klaus Schlesinger, als noch alles offen war, schrieb letzterer: „Tagelang wie benommen. Wutanfälle, ja Haß. So lange hat es eine politische Macht nicht geschafft, uns zu vertreiben, und nun soll es dem Geld gelingen? – Seit 1973 sind wir hier. Neun Häuser zwischen den welligen Feldern zweier Dörfer gelegen. Fast die Hälfte stand damals leer.“ Dann zogen immer mehr Künstler ein. Die Stasi versuchte sie zu zerstreuen, aber das gelang nicht. So dass West-Adel und -Kapital dort im Oderbruch dann nicht nur diese wütenden Intellektuellen gegen sich hatten, einschließlich des sie damals bespitzelnden Stasi-Zuträgers (der heute ein Asylantenheim bewacht), sowie eines nach der Wende aus Westberlin zugezogenen Psychoanalytikers und eines Kleinverlegers – alle drei haben sich sogar aktivitätsmäßig an die Spitze des Protests gesetzt – „um sich quasi zu rehabilitieren“, wie Klaus Schlesinger meinte, der auch das neue Kräfteverhältnis schon dementsprechend einschätzte: „Das Kapital hat seine Widersacher gleich mitgebracht.“
.
Weniger Glück hatte jüngst eine Art BI-Petition von brandenburgischen Bauern und Schäfern im Umkreis des Spandauer Forsts, wo sich sich in den letzten Jahren die zuvor dort ausgestorbenen Kolkraben angesiedelt hatten. Inzwischen umfaßt ihre Kolonie gut 20 Brutpaare. Die Bauern drumherum beantragten eine Sondergenehmigung für ihren Abschuß, dieser wurde jedoch von der Oberen Naturschutzbehörde abgelehnt. Sie wollten mindestens eine staatliche Entschädigung für die von den Kolkraben getöteten Kälber, Ferkel und Lämmer – so wie das bei den Wölfen, Bibern und Ringelgänsen gehandhabt wird. Die Behörde konnte das Begehren in diesem Fall jedoch leicht abwehren: Der Ökoethologe am biologischen Institut der Universität Potsdam, Professor Wallschläger, hatte zuvor bei anderen (brandenburgischen) Fällen die bäuerliche Mär empirisch widerlegen können, dass Kolkraben diese Tiere töten und fressen: Weil sie nicht die Kraft im Schnabel haben, brauchen sie Wallschläger zufolge Wölfe, Füchse, Hunde oder Greifvögel, um einen Kadaver „aufzubrechen“, sie sind deren „Nachnutzer“ – und kommen im übrigen nicht aus dem Westen, sondern aus Mecklenburg.
.
.

Maulwurf. Photo: Norbert Kröcher (Knofo)







